James Tate: Der falsche Weg nach Hause
SCHRILLES GARN
Anonymer Gefangener der Nachdenklichkeit,
träge in meiner Sprudelspule,
dumpfe Hülle gering geachteter Chöre,
höre ich die Schritte des Postboten
auf tausend Meilen Entfernung: Er redet über
Lappalien und ist, wie er selber zugibt, des öfteren
arbeitslos. Ich kundschafte seinen Blutstrom aus,
als sich ein Krug mit Dunkel über mich ergießt.
Feindselig bin ich, trag ausgebeulte Hosen.
Oh winziges Thermometer, nackte Qualenkugel,
ich ersticke in deiner Umarmung.
Erhebung schlichtester Verzierung,
ich fürchte deine Bedeutungslosigkeit
und die Erinnerung an das, was kommt.
Schmerzen und Tränen diene ich, kose ich,
bei Tränen verliere ich zumeist das Interesse.
Meine Vermieterin kehrt – die Zahnstocher stimmig –
dieses besorgniserregende Blatt in ihren Rinnstein;
ihre Hüfte bröckelt in riesigen Stücken ab:
ein Mietlaster wird sie später abholen kommen.
Was sonst gibt’s Neues von der Welt? Zwinkern,
Zischeln, Knirschen, du, Grimasse, du, Rolle
aus schneidenden Kadenzen. Ich muß mich jetzt aufraffen
zu Mummenschanz und Teilchen, darbieten muß ich
meinen stümperhaften Monolog hinter papageiengrünem
Wandteppich, einen geistreichen Einfall hervorstammeln:
Wieder ist Karneval in der Welt, ich muß versuchen, mit ihrem
Niedergang, ob stolz oder elend, in Einklang zu sein.
Nachwort
I
„Der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens“, schrieb André Breton, Gründervater der Bewegung, in seinem ersten, 1924 verfaßten surrealistischen Manifest.
Ist James Tate ein Surrealist? Zumindest ist er in noch jeder Rezension seit Erscheinen seines ersten Gedichtbandes als ein solcher bezeichnet worden. Und auch als Leser wird man, liest man etwa Tates „Rezept zum Einschlafen“, schnell bereit sein, seine Lyrik als „surrealistisch“ zu bezeichnen – so vollkommen scheint sie den Vorstellungen des von den Surrealisten verehrten Isidor Ducasse alias Lautréamont zu entsprechen, dem die „unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“ als Schönheitsideal vorschwebte:
knüpfe die Mücken zusammen
unter deinem Schlafanzug
laß einen Fremden an deinem Fuß lutschen
greife in dich selbst
und ziehe eine Kerze heraus
halte die Riesengarnele noch fester umklammert
renne die Treppe im Innern
eines Veilchens hinab
iß dich durch beide Türen hindurch
zapfe der Hängematte das Blut ab
entkorke den Kopf einer Puppe
und ersticke die Rose die darin ist
gelangst du an den Gletschersee
umwickel dich mit Mull
und schlucke deine Hände
das Ganze rückwärts hilft manchmal
beim Aufwachen
Es ist wahr, daß sich gewisse Parallelen zwischen Tate und dem lyrischen Programm der französischen Avantgarde der zwanziger Jahre kaum leugnen lassen. Doch während Breton eine Poesie des Unbewußten, des Unterbewußten anstrebte, zu Papier gebracht ohne die störende Kontrolle der Vernunft, äußert sich Tate weitaus abgeklärter zum Prozeß des Dichtens:
Es ist eine Kunstform, doch hat sie auch allerlei technische Aspekte. Selbst wenn man nicht mit festen Formen arbeitet, bemüht man sich um ein Höchstmaß an Verdichtung, an aufgeladener Sprache. Jedes einzelne Wort muß unter jedem nur möglichen Gesichtspunkt betrachtet werden, seine Etymologie, und wie es auf das neben ihm stehende Wort reagiert. Darüber hinaus sind das Tempo und die Bewegung des Gedichts als Ganzes zu bedenken, wie es präsentiert wird, wo Betonungen zu setzen sind. Die Gesamtheit des Gedichts, aber auch jedes einzelne Wort, jede einzelne Zeile, ist wichtig. Form- und Rhythmusgefühl sowie die Fähigkeit, die richtigen Akzente zu setzen, sind unabdingbar, und nur die allerwenigsten Menschen sind ohne jede Erfahrung dazu in der Lage, ohne beständige und ausgiebige Lektüre, ohne Kenntnis der Tradition und dessen, was einem selbst vorausging.
Das scheint dann doch denkbar weit entfernt zu sein von einer „écriture automatique“, wie sie André Breton, Louis Aragon und andere propagierten, denkbar weit entfernt auch vom verwandten Konzept eines „spontaneous overflow of powerful feelings“, wie der englische Romantiker William Wordsworth es nannte.
Man sollte sich nicht zu vorschnellen Beurteilungen hinreißen lassen. Wer jemandem ein Etikett aufklebt, enthebt sich allzuleicht der Mühe einer genaueren Betrachtung; wer jemanden eilfertig in eine Schublade steckt, muß sich fragen lassen, ob er ihn nicht einfach nur aus der eigenen Wirklichkeit verbannt sehen wollte: Das Suffix „ismus“ als leicht auszuführender, Wissenschaftlichkeit vorschützender Abwehrzauber des aufgeklärten Menschen gegen das, was ihn berühren, ihn verrücken, ja, ihn wortwörtlich aus der Fassung bringen könnte. Bei Tate jedoch will dies nicht gelingen. Tates Gedichte schockieren, schmeicheln, flüstern, brüllen, sie umgarnen, erheitern, verstören und deprimieren uns, sie torkeln, kichern und deklamieren. Bei alledem, was uns an ihnen „surrealistisch“, leicht abstrus erscheint, haben sie doch ganz unmittelbar mit unserer Realität zu tun. Tates Gedichte gehen uns an. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen, die in ihrer Konsequenz allerdings auf ein und dasselbe hinauslaufen: Entweder ist unser Alltag surrealer, als wir es gemeinhin wahrhaben wollen – und schon ein flüchtiger Blick in die Zeitung reicht, um diese Vermutung zu nähren. Oder aber Tate ist weitaus weniger surrealistisch, als man ihm unterstellt. Und plötzlich ist eine Möglichkeit nicht mehr von der Hand zu weisen: Ist Tate am Ende gar der ehrlichere, der schonungslosere Realist?
II
Während der Surrealismus in Europa bis weit über die Grenzen Frankreichs hinaus für Furore sorgte, während eine aufgebrachte Menge nach Vorführungen von Luis Buñuels Andalusischem Hund die Kinosäle in Schutt und Asche legte, blieb man in den Vereinigten Staaten relativ unbeeindruckt. War in der bildenden Kunst die Wirkung der legendären Armory Show 1913 in New York noch einem Erdbeben gleichgekommen, so blieb der Einfluß des Surrealismus auf die amerikanische Literatur, insbesondere auf die Lyrik, zunächst gering. Man muß nicht so weit gehen wie der Kritiker und Lyriker Dana Gioia, der vermutet, die Zeichentrickfilmindustrie Hollywoods hätte sich der europäischen Avantgarde als erste angenommen und habe diese – Pesthauch der „low culture“ – für potentielle amerikanische Nacheiferer unberührbar gemacht:
Amerikas erste große surrealistische Künstler hießen Walt Disney, Max Fleischer und Tex Avery.
Fest steht jedoch, daß, während New York der ehemaligen Kulturmetropole Paris den Rang als Impulse gebende Hauptstadt moderner bildender Kunst immer weiter ablief, auch die amerikanische Lyrik an Selbstbewußtsein und Eigenständigkeit gewann, die den Blick nach Europa zunehmend überflüssig erscheinen ließen. Waren die Granden Ezra Pound und T.S. Eliot noch dorthin abgewandert, machten nun in den USA Lyriker von sich reden, deren Werke sich deutlich absetzten von Eliots an den Traditionen des alten Kontinents orientiertem Poesieverständnis. Neben Hart Crane und dessen von Walt Whitman beeinflußtem, visionärem Langgedicht The Bridge (1930) waren dies vor allem Wallace Stevens mit den sinnlich-eleganten Gedichten seines Bandes Harmonium (1923) und William Carlos Williams mit Spring and All (1923) und In the American Grain (1925). Insbesondere Williams, der sein Leben lang als Arzt im provinziellen Städtchen Rutherford im Bundesstaat New York tätig war, ebnete einer spezifisch amerikanischen Lyrik den Weg: Nicht nur bezog er seine Themen und Bilder unmittelbar aus dem ihm vertrauten Kleinstadtalltag, er machte sich in seinen Gedichten auch die Besonderheiten der amerikanischen Umgangssprache mit ihrem Vokabular, ihren Rhythmen und ihrer Idiomatik zu eigen.
Vielleicht war es diese im Lauf der Jahrzehnte entstehende Trennung von Europa, die kollegiale, doch unmißverständliche Betonung einer national eigenständigen Lyriktradition, die es dem Surrealismus ermöglichte, in den fünfziger und sechziger Jahren doch noch in den US-amerikanischen Dichterkreisen anzukommen – und zwar nicht als Glaubensrichtung, zu der man sich bekennen, deren Manifeste man bedingungslos unterzeichnen mußte, sondern als mögliche Spielart der Dichtung, als eine wähl- und durchaus mischbare Farbe auf der Palette, die sich auf die eigene Grundierung auftragen ließ. So bedienten sich die Dichter der Beat-Bewegung und vor allem Allen Ginsberg in seinem Howl (1956) in ihrem an Crane und Whitman geschulten Versuch, eine visionäre wie gesellschaftlich relevante Lyrik zu schaffen, der surrealistischen Traumlogik und des rauschhaften Schreibens unter Ausschaltung einer ihnen politisch verdächtig gewordenen, repressiven Vernunft. Und auch die Dichter der „New York School“ ließen sich von der französischen Avantgarde der zwanziger Jahre anregen – insbesondere John Ashbery, dessen konzentrierte, reflektierende Lyrik im alltäglichen wie im intellektuellen, im europäischen wie im amerikanischen, im literarischen wie im malerischen wurzelt und der in einem seiner ersten Titel – „Zweifacher Traum vom Frühling“ – nicht umsonst den von Breton und seinen Weggefährten verehrten Maler Giorgio de Chirico zitierte.
III
Obwohl der Surrealismus als stilistische Alternative an sich mithin nichts Befremdliches mehr hatte, sorgte das Erscheinen von Tates erster Gedichtsammlung The Lost Pilot im Jahre 1967 für eine kleine Sensation in der amerikanischen Lyrikszene – und das nicht nur, weil der Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gerade einmal dreiundzwanzig Jahre alt und noch als Student an der University of Iowa eingeschrieben war. Auch nicht, weil Tate mit diesen frühen Gedichten (wie John Ashbery vor ihm) den angesehenen Yale Younger Poets Wettbewerb gewann. Vielmehr schien der Surrealismus zum ersten Mal vollständig naturalisiert, nicht als intellektuelle Referenz an das Paris der zwanziger Jahre, sondern als durch und durch amerikanisch. Das lag zum einen daran, daß die strikte Trennung zwischen Hoch- und Alltagskultur längst nicht mehr vollzogen wurde und die avantgardistische Attitüde an Bedeutung verlor – und an die Stelle der radikalen Verneinung, der vielleicht notwendigen Arroganz, ist ja längst schon die Ironie getreten. Bestand für Breton die einfachste surrealistische Handlung noch darin, auf die Straße zu gehen und mit einem Revolver wahllos in die Menge zu schießen, wie er in seinen Manifesten behauptete, ist Tate mit großem Genuß zu Gast in den gepflegten Vorgärten und auf den weißgestrichenen Veranden, die er sogleich mit doppelten und dreifachen Böden versieht. Noch ausschlaggebender, wenn auch damit zusammenhängend, ist, daß Tate seine Gedichte mit dem ganzen, in der deutschen Übersetzung nur unzulänglich wiederzugebenden Reichtum der amerikanischen Umgangssprache schmückt. Diese Verwendung von Slang und Idiomatik trägt ganz wesentlich dazu bei, die surreale mit der alltäglichen Ebene zu verbinden und das zunächst seltsam Anmutende vollkommen vertraut erscheinen zu lassen. John Ashbery sieht in Tates Lyrik deshalb eine „im eigenen Heim gezüchtete Spielart des Surrealismus“; dieser sei für Tate „so ähnlich wie die Luft, die wir alle atmen“, das Unterbewußte enthülle sich in seiner Lyrik „beim ganz vertraulichen Aufeinandertreffen mit dem Leben, das wir alle Tag für Tag führen“.
Die Gedichte aus The Lost Pilot waren, gerade auch für viele junge Leser und eine nachfolgende Generation von Lyrikern, aufregend neuartig und zugleich, bis hin zur fest im Alltag verankerten Poesie W.C. Williams, der jüngeren amerikanischen Tradition verpflichtet. Suchte man nach Einflüssen auf Tates Dichtung, so würden Spuren zu Williams und den genannten New Yorker Poeten, aber zum Beispiel auch zu Theodore Roethke führen, den Tate in einem Gedichttitel („Conjuring Roethke“) erwähnt und dessen erster Gedichtband von 1948 bezeichnenderweise den Titel The Lost Son trägt. In Tates Lost Pilot, der darauf anzuspielen scheint, finden sich zudem, eher überraschend, Anklänge an die „confessional poetry“ eines Robert Lowell, wenn Tate sich in dem berühmten Titelgedicht seinem im Zweiten Weltkrieg verschollenen, für ihn früh verlorenen Vater annähert und intimste Gefühle und Verknüpfungen zu „beichten“ scheint. Der Tiefe des Gefühls, in dem man die Person des Dichters zu erkennen glaubt, ja zu fassen wünscht, wird aber zugleich eine überraschende Bildlichkeit und ein ironisch distanzierter Stil entgegengesetzt:
Ich würde
dein Gesicht betasten wie ein gleichgültiger
Gelehrter ein Originalmanuskript.
Das „Ich“ des Gedichts wird vor dem Rampenlicht einer melodramatischen Bühne bewahrt und ist weit von jeglicher Selbstentblößung, wie sie teils Mode war und noch immer ist, entfernt. Ähnliches begegnet uns in einem anderen frühen Gedicht von Tate, „Meiner Mutter am Vatertag“, das mit dem Bekenntnis lockt, doch den Leser, als bewege sich dieser auf einer von M.C. Escher konstruierten Treppe, nicht zum Erwarteten gelangen läßt:
Du konntest dich nie ausruhen
in der traditionellen Mutterrolle,
ich ließ dich nicht. Das Schicksal,
wie du es nennst, hatte anderes im Sinn,
denn niemand von uns besaß jemals
ein Gegenüber, wie es in
Familien üblicherweise der Fall ist.
Ich war dein Bruder
und du warst meine unglückliche
Nachbarin. Du tatest mir leid,
so wie einer Mutter das Versagen
des Sohnes leid tut. Ich schaffte
es nie, den ersten
Schritt zu tun. Ich hätte
dir Zucker geliehen, Mutter.
Je mehr Traum und Wirklichkeit, Wahn und Wahrscheinlichkeit sich überlagern und einen eigenen Sinnzusammenhang bilden, desto schwerer greifbar wird das fast immer präsente, stets prekäre „Ich“. Scheint es in einigen frühen Gedichten wie „Der verschollene Pilot“ und „Meiner Mutter am Vatertag“ noch relativ scharf umrissen und mit einer klaren Identität ausgestattet zu sein, wird es später zunehmend metamorph: Der Sprecher in „Ash Manor“ etwa gleicht, wie er selber behauptet, den vermeintlichen Zwergen an seiner Seite, während die echten Zwerge ihnen gegenüber hünengroß sind, gleichzeitig jedoch an die Statur eines Kindes erinnern. Anderswo, in einem schlicht „Gedicht“ betitelten Text, erscheint ein „als Mann verkleideter Mann“, ausgestattet mit einer Sonnenbrille und mit einem Bart, den man überdies – so mißtrauisch wird man bei der Lektüre von Tates Lyrik – für falsch halten möchte. Was „der Szene Wirklichkeit verlieh / war das chinesische Mädchen“ im Pool, heißt es weiter, doch wird auch diese Gewißheit gleich mehrfach zunichte gemacht, wenn demselben Mädchen drei Zeilen später attestiert wird, „der Traum im Innern / des Traums im Innern“ zu sein.
„Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg“, schrieb schon Novalis Ende des 18. Jahrhunderts, und auch das Ich in Tates Gedichten folgt diesem Weg auffallend häufig – ohne allerdings gefestigter aus den eigenen Untiefen wieder aufzutauchen: Entweder die Innenwelt entpuppt sich als eine weitere, ebenso skurrile oder gewöhnliche Außenwelt wie die bisherige („Selbstbeobachtung“), entweder die Wände der Kohlengrube, die sich als Kopf des lyrischen Ichs herausstellt, beginnen einzustürzen“ („Mein ganz persönliches Tasmanien“), oder die „Stelle , die ein Fuß markiert hat, tritt plötzlich zwischen zwei Augen hervor, wandelt sich zu einem Bürgersteig, auf dem ein Mann geradewegs in ein Zimmer, das wiederum Kopf ist, gelangt („Wie die Freunde sich trafen“). Ich ist auch bei Tate immer ein anderer, und sei es nur ein lästiger, gehässiger Untermieter, und der geheimnisvolle Weg nach innen endet mitunter nach zahlreichen Abzweigungen in einer zwiespältige Empfindungen auslösenden Sackgasse:
Ich konnte weder aufstehen
noch fallen, und niemand
konnte mich fangen
(„Die Falle“).
Die Verunsicherung greift schnell auf den Leser über, der sich schon bald ebenso haltlos und, seltsam, mit ebenso großer Lust an der eigenen Haltlosigkeit wiederfindet. Auf eindeutige Antworten, auf plakative Wahrheiten gar ist nicht zu hoffen, das macht bereits das frühe Gedicht „Das Buch der Lügen“ unmißverständlich, oder besser: äußerst mißverständlich klar – „Ich habe dir bislang Lügen / aufgetischt. Glaubst du, // ich glaube mir selbst? Glaubst du / dir selbst, wenn du mir glaubst?“ Tate geht dabei oft genug auf zweierlei Art vor: Entweder nimmt er sich eine abstrus anmutende Ausgangssituation vor – beispielsweise ein ans Sofa genähtes Ohr („Hochzeitslied für Tyler“) –, die er dann mit aller Konsequenz, in sich durchaus stimmig und allen Regeln der Logik gehorchend, zu Ende führt. Oder aber eine vollkommen alltägliche Szenerie wird allmählich unterwandert, bis sie gleichsam als Negativ des bislang Gewohnten dasteht. Auf subtile Weise bestätigt Tates Lyrik einmal mehr Percy Bysshe Shelleys Diktum aus dessen Defense of Poetry:
Poesie zieht den Schleier von der verhüllten Schönheit der Welt und läßt vertraute Dinge unvertraut erscheinen.
So etwa in dem Gedicht „Land der kleinen Hölzer, 1945“:
Wo die Frau die Bratpfanne scheuert
und der Mann gegen die Scheune gelehnt steht.
Wo der kleine Junge Wasser in einen Eimer pumpt
und das Mädchen einen scheckigen Hund jagt.
Und der Himmel am Horizont ist aufgewühlt.
Eine Stadt namens Pleasantville ist verschwunden.
Und nun beginnen die Pferde zu scharren, leise zu wiehern,
und die Hühner auf der Stange blicken nervös hin und her.
In diesem Augenblick stimmt irgend etwas nicht.
Der Junge torkelt durch die Küche, verschüttet Wasser.
Die Mutter holt Pasteten aus dem Ofen und weist ihn zurecht.
Das Mädchen sitzt drüben beim Zaun und starrt auf die Pferde.
Und der Mann wie eben: Augen geschlossen, die Stirn
auf dem Unterarm und gegen die Scheune gelehnt.
So wie hier die archetypische amerikanische Farmhausidylle aufgrund einer winzigen Verschiebung in ein Szenario voller Bedrohung umkippt, deren Ursache, selbst wenn sich anhand der Jahreszahl Mutmaßungen anstellen ließen, nicht wirklich faßlich ist, wird in Tates Gedichten das Fundament sämtlicher vermeintlicher Grundgewißheiten untergraben. Und nicht zuletzt ist es die Sprache selbst, die hinterfragt wird – ebenjene uns vertraute Alltagssprache, die einen ersten Zugang zu Tates Lyrik so einfach macht.
IV
aaaaaweh unser guter kaspar ist tot.
aaaaawer trägt nun die brennende fahne im zopf. wer dreht die kaffeemühle. wer lockt das idyllische reh.
aaaaaauf dem meer verwirrte er die schiffe mit dem wörtchen parapluie und die winde nannte er bienenvater.
aaaaaweh weh weh unser guter kaspar ist tot. heiliger bimbam kaspar ist tot.
An Zeilen wie diese von Hans Arp, mithin an die Zeit von Dada und dem Cabaret Voltaire in der Züricher Spiegelgasse, fühlten sich viele amerikanische Kritiker bei der Lektüre von Tates in den siebziger und frühen achtziger Jahren erschienenen Gedichtbänden erinnert. Nicht zu Unrecht, möchte man denken, liest man beispielsweise die Anfangsverse von seinem „Gedicht für einige meiner jüngsten Gedichte“, in dem man jede semantische Bodenhaftung vergeblich sucht:
Geliebte kleine Billardkugeln,
höfliche Bastarde; eßbare patriotische Pflaumen,
die Schönheit habt ihr von eurer Mutter, die
einem zylindrischen Cornedbeef ähnelte.
Man mag bei einer solchen Definition von Schönheit an Dada denken – oder aber, und man ginge damit in der surrealistischen Ahnengalerie einen Raum zurück, an den schon eingangs zitierten Satz Lautréamonts. Modernen Sprachwissenschaftlern dagegen wird unweigerlich Noam Chomskys berühmter, vielfältige semantische Widersprüchlichkeiten enthaltender Satz „Colorless green ideas sleep furiously“ in den Sinn kommen. Und tatsächlich führt die Frage nach Wirklichkeit, wie sie sich in Tates Gedichten stellt, immer auch über die Frage nach der Sprache, mit der wir das, was an Welt um uns und in uns ist, fassen möchten, in der sich die Welt vielleicht erst manifestiert. Was zunächst wie purer Nonsens aussieht, ist in Wahrheit die überaus ernsthafte Suche nach Bedeutung:
Tate versucht, den Worten eine neue Frische zu verleihen, ihren Glanz wiederherzustellen, den sie durch die Werbung, durch beruflichen Jargon und ganz einfach durch das tagtägliche Wiederholtwerden verloren haben.
(Adam Kirsch in der New York Times)
In diesem Zusammenhang ist es an der Zeit, ein weiteres Etikett zu entfernen: Tate ist kein Nihilist. Zwar strotzt seine Lyrik von Paradoxien, zwar sind Verlust und Verletzung ständig wiederkehrende Motive, ist die gesamte Tatesche Welt immer in einer tänzerischen Bewegung über dem Abgrund begriffen. Doch der Aussage, die Liebe sei „nicht viel wert“ („Koda“), stehen so zarte Liebesverse wie „Die letzten Apriltage“ gegenüber. Tates Position ist weniger die eines radikal Verneinenden als die eines Suchenden: „Seht euch diese Wolken an“, sagt jemand in dem Gedicht „Verandatheorie“ und vermutet:
Gottes Angesicht ist darin verborgen
irgendwo.
Daß in „Te deum laudamus“ die „Menschen eilten, Wasserrechnungen und Strafzettel zu bezahlen“ spricht für deren Gleichgültigkeit, schließt jedoch nicht aus, daß es sich auch nach etwas anderem zu streben lohnt. „Gnade“ ist möglich, wie das gleichnamige Gedicht versichert, wenn sie sich auch anders und bei weitem unorthodoxer darstellen mag als erwartet. Man kann diesen Ausführungen Tates dunklen Humor, seine offensichtliche Vorliebe für Groteskes und Makabres entgegenhalten und auf die zahlreichen lädierten und geistig oder körperlich verstümmelten Akteure seiner Lyrik hinweisen, um den Vorwurf des Nihilismus zu rechtfertigen, auf die Blinden, die Tauben, die Hautkranken, die Wahnsinnigen, die Eiferer, die Einsamen, die Ausbrecher mit Holzbein, selbst auf die kinderfressenden Bäume. Deshalb sei der englische Gelehrte Vivian Mercier zitiert, der sich, wenn auch in Verbindung mit satirischer irischer Literatur, mit dieser speziellen Art von Humor befaßte:
Während makabrer Humor letzten Endes untrennbar mit dem Schrecklichen verbunden ist und als Verteidigungsmechanismus gegen die Angst vor dem Tod dient, ist der groteske Humor ebenso untrennbar mit Ehrfurcht verbunden und dient als Verteidigungsmechanismus gegen die heilige Scheu, mit der wir den Mysterien der Fortpflanzung gegenüberstehen. Stark vereinfachend ließe sich sagen, daß diese beiden Arten des Humors uns helfen, den Tod zu akzeptieren und das Leben auf ein kleineres Maß zu bringen.
So gesehen läßt sich Tates Lyrik auch als zutiefst humanistisches Plädoyer für Respekt vor dem Menschlichen, vor dem Allzumenschlichen lesen, als ein Entwurf, in dem noch das Kleinste, Unscheinbarste, das auf der Strecke Gebliebene – die Wanze, die vergilbte Zeitung, die verlorene Nachricht – seinen Platz im großen Weltenlauf hat: „Alles ist / von Bedeutung. Ich nenne es Liebe“, wie es in einem frühen Gedicht heißt.
Indem Tate nicht müde wird, diese kleinen Dinge, diese unscheinbaren Momente zu sammeln, fährt er fort, der modernen Wirklichkeit einen nur leicht verzerrenden, in seiner Brillanz um so klareren Spiegel vorzuhalten, erweist er sich als unbestechlicher Chronist unserer Zeit und der gesamten westlichen Kultur – insbesondere natürlich der eigenen Heimat Nordamerika, in der Breton schon Anfang des letzten Jahrhunderts in seinem ersten Manifest den idealen Nährboden für das Surreale wähnte: „Kolumbus mußte mit Verrückten ausfahren, um Amerika zu entdecken“, schrieb Breton, „und seht nur, wie diese Verrücktheit Gestalt gewonnen hat – und Dauer.“
Jan Wagner, Nachwort
1967 erschien die erste Gedichtsammlung
des damals gerade 23-jährigen Studenten James Tate und sorgte für eine kleine Sensation in der amerikanischen Lyrikszene.
Das fulminante Debüt The Lost Pilot und die zahlreichen folgenden Bände sind inzwischen längst zu Klassikern der amerikanischen Lyrik geworden, prägend für die nachwachsende Lyrikergeneration, zu deren unumstrittenen Helden Tate zählt.
Ob der Autor den Verlust des Vaters reflektiert, ob ein Schweinsohr als bester Freund an ein Sofa genäht, der Spiegel zur gläsernen Geliebten wird – Tates Gedichte berühren den Leser unmittelbar mit ihrem ganz eigenen Ton von abgründiger, oft heiterer Gelassenheit. Und sie leisten, was Literatur im besten Fall zu leisten vermag, sie lehren, die Welt, die man meint, bis zum Überdruss zu kennen, neu zu sehen, und verleihen den im täglichen Umgang abgegriffenen Worten einen neuen Glanz. Mit unaufgeregter Selbstverständlichkeit entwirft Tate surrealistische Szenarien und unterwirft diese dabei der gewohnten Logik der Alltagserfahrungen. Oder er nimmt eine Alltagssituation und verwandelt sie mit wenigen sprachlichen Griffen zur unerhörten Begebenheit.
Dass sich der Lyriker und Amerikanist Jan Wagner der Werkauswahl und deren Übertragung ins Deutsche angenommen hat, ist ein besonderer Glücksfall. Für seine Übersetzung erhielt Jan Wagner den Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzungen.
Berlin Verlag, Klappentext, 2004
Noch eine Minute bis zur Wunderzeit
Bei seinem Debüt 1967 war James Tate 23 Jahre alt, so alt wie sein Vater, als dieser 1944 von seinem Einsatz über Deutschland nicht zurückkehrte. The Lost Pilot, titelgebendes Gedicht seines ersten Bandes, machte den Verfasser schlagartig in den Vereinigten Staaten berühmt. Seit damals hält Tates reiche lyrische Produktion an, und einige Zeit war es sogar Mode, ihn in Creative-Writing-Seminaren nachzuahmen. Die Kritik freilich hatte lange Zeit Schwierigkeiten mit Tates Kunst, und erst seit 1992, als er für die Selected Poems (1991) den Pulitzerpreis erhielt, ist er eine offiziell etablierte Größe.
Schon das Gedicht „Der verschollene Pilot“ zeigt Tates Kunst und deren Problematik im Keim. Der autobiographische Hintergrund führt nicht zu einem bekenntnishaften Epitaph, sondern zur Reflexion über eine unmögliche Begegnung mit dem Toten, der in einer fortwährenden Umlaufbahn um die Erde imaginiert wird:
Den Kopf im Nacken, blicke ich gen Himmel,
ich kann mich nicht vom Boden lösen,
und du fliegst über mich hinweg,
schnell, perfekt und nicht gewillt
mir zu sagen, daß es mit dir alles zum besten
steht, oder daß ein Irrtum
dich in jene Welt verschlug
und mich in diese,
oder ein Mißgeschick
diese beiden Welten in uns.
Unsentimentale Gedankenspiele wie dieses und Paradoxien wurden Tate als amerikanische Variante des Surrealismus angerechnet. Doch das Beunruhigende, das man mit diesem Etikett bannen wollte, geht tiefer. Tate, der 1943 in Kansas City geboren wurde und in Amherst, Massachusetts, Literatur unterrichtet, erforscht in seinen Gedichten den ziellosen Riß, der gleichermaßen durch die Welt, die Sprache und den menschlichen Verstand geht, eine Kluft der Welten, die „durch Irrtum oder Mißgeschick in uns gekommen sind“. Aus diesem Grundmotiv gewinnt Tate seine Poetik. Im Ganzen seines Werks geschieht dies mit einer gewissen Monotonie, im Detail mit stets neuen, verblüffenden Varianten. Es sind mindestens zwei, meist mehr konträre Stimmen, Haltungen, Gefühls- oder Deutungsmuster, die Tate kompositorisch zusammenspannt. Das ergibt komische Kontraste, tragikomische Spiralen und absurde Verschachtelungen von Motiven und Tönen. Da ist etwa eine bürgerliche Hochzeitsfeier, bei der die Braut einschläft, was von Teilnehmern wie Bräutigam kommentiert wird. Jeder Erklärungsversuch verschlimmert die Situation, bis eine namenlose Stimme resümiert:
Und wen
interessieren schon solche Festtage, sie sind
nicht das, wofür wir leben.
Ein „Rezept zum Einschlafen“ soll, rückwärts gesprochen, beim Aufwachen helfen, und als ähnlich verfehlt erweist sich das zum Schutz des Privatlebens der städtischen Henkersfamilie eingeführte Inkognito ihres Namens und ihrer Gesichter, da sich so die Familienmitglieder nicht einmal selbst erkennen können. Tate hat seine Inspiration als das Hören von Stimmen beschrieben, doch unverkennbar ist auch das konstruktive Element in seiner Dichtung. Das Sitzen im Lehnstuhl wird zur „Falle“, als ein kleinerer Stuhl darin entdeckt wird, in dem der Sprecher viel lieber sitzt; doch auch in diesem Stuhl steckt ein kleinerer:
bis
ich in einem Stuhl
saß, der so klein war,
daß sich kaum sagen ließ,
ich säße überhaupt
in einem Stuhl.
Das Bauprinzip ist bekannt, doch selten ist das platonische Entdecken wahrerer Wirklichkeiten so beiläufig ad absurdum geführt worden.
Tates Welt ähnelt der trivialen Unendlichkeit eines Friseurladens, in dem die Spiegel gegenüberliegender Wände voreinander ins Jenseits fliehen und ein Kamm zum metaphysischen Ding werden kann, das aus allen Blickwinkeln eine andere Deutung zuläßt. Der Insasse dieser Welt, das „Ich“, war und ist „das stotternde Monstrum, das sein Geschick / hinnahm“. Allerdings steht diese finstere Anthropologie in einem Gedicht mit dem Titel „Die größten Hits des Tragischen“, das alles offenläßt:
Das Leben geht weiter, wo sind die Wunder?
Es ist zwölf Uhr, ich wünschte,
es wäre elf Uhr neunundfünfzig.
Und genau darin liegt Tates Kunst. Die Erfahrung der Inkommensurabilität der Dinge mit unserem Bewußtsein und das Ungenügen unserer Sprache verleiht auch der letzten Minute unendlichen Wert.
Tates Übersetzung durch Jan Wagner ist schlicht, manchmal etwas unrhythmisch, doch insgesamt treffend; wenige Ausrutscher – „das apathische Lächeln“ ist ein „sprachloses“ („aphasia smile“); „counterparts“ in einer Familie sind nicht „Gegenüber“, sondern Personen, denen man gleichkommt – fallen nicht ins Gewicht. Leicht getrübt wird die Freude an diesem Band durch das Nachwort. Wagner argumentiert darin weitschweifig gegen das Klischee „Tate der Surrealist“, um es durch die kaum besseren Phrasen „nur leicht verzerrender Spiegel“ und „unbestechlicher Chronist“ zu ersetzen. Informationen zu Provenienz und Auswahl der Gedichte sucht man vergebens, obwohl reichlich Platz gewesen wäre zu erläutern, daß die Teile I bis III des Bandes einen Ausschnitt aus den chronologisch geordneten Selected Poems bieten, Teil IV Gedichte aus den neueren Bänden bis 2001 umfaßt. Daß kein einziges Gedicht aus Tates Lieblingsband Distance From Loved Ones (1990) enthalten ist, verwundert. So bleibt der Wunsch, möglichst bald einen weiteren, hoffentlich zweisprachigen Band mit Tates Gedichten lesen zu können.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.10.2004
„Ich halte eher die Räuberleiter“
– Ein Gespräch mit dem jungen Berliner Lyriker und frisch gebackenen Anna-Seghers-Preisträger Jan Wagner über das Verwenden von befremdlichen Metaphern, die Gefahr des Pathos, den von ihm ins Deutsche übersetzten amerikanischen Dichter James Tate und das neue Bedürfnis nach Lyrik. –
Imke Schridde: Wann haben Sie erstmals ernsthaft angefangen, Gedichte zu schreiben?
Jan Wagner: So mit 16, im Rausch der Pubertät. Was man alles loswerden musste, hat man in Versform gepackt. So richtig ernsthaft aber wurde es erst zwei Jahre später; wobei Gedichteschreiben ja kein Berufsziel ist. Mit 18 habe ich mich wirklich mit Lyrik auseinander gesetzt, mit Technik und mit Stil. Ich habe dann Gedichte nicht mehr als ein Transportmittel für die eigene Befindlichkeit verstanden, sondern begonnen, sie als Kunstform wahrzunehmen.
Schridde: Also kann man Ihr „Ich“ immer als ein lyrisches lesen?
Wagner: Ich versuche schon sehr, meine Biografie herauszuhalten. Natürlich beruht das, was man aufschnappt und verwendet, immer auch auf dem eigenen Leben.
Schridde: Ihre Gedichte sind äußerst bilderreich – da gibt es „Schmetterlinge, die in die Wiesen fallen“, oder den Sirenenlärm im Gedicht „Neukölln I“, der zur „kleinen Nachtmusik der Ambulanzen“ wird. Beim ersten Lesen rufen Ihre Metaphern häufig Verwunderung oder gar Befremden hervor.
Wagner: Ich schätze an Metaphern, dass sie mit einem Kniff, mit wenigen Wendungen, eine Sache völlig neu erscheinen lassen. Am gelungensten sind Bilder, die man beim Lesen erstaunlich findet, die im nächsten Moment aber als die einzig natürliche Verbindung überhaupt einleuchten.
Schridde: Gerade in Ihren Landschaftsbeschreibungen aber sind die Bilder oft auch nicht frei von Pathos.
Wagner: Im Ernst? Finden Sie? (lacht) Komisch, Pathos versuche ich immer zu vermeiden.
Schridde: Warum?
Wagner: Ich bin skeptisch, was Pathos angeht. Eine irgendwo auch gefährliche Sache, von der man sich auf keinen Fall forttreiben lassen darf. Es ist sinnvoll, das ironisch zu zügeln.
Schridde: Oder zu brechen mithilfe von Wendungen, die sehr nah dran sind am ganz Banalen?
Wagner: Ich empfinde eine Nähe von Lyrik zum Leben als sehr wichtig, weil gerade die ganz einfachen Dinge im Alltag einen besonderen poetischen Reiz haben. Andererseits – was einem während des Schreibens natürlich nicht bewusst ist – ist es ja schon so, dass Gedichte immer als elitäre Kunstform wahrgenommen werden. Wohingegen sie für mich unbedingt etwas mit dem alltäglichen Leben zu tun haben und immer auch dafür gedacht waren, das Alltägliche zu reflektieren. Deswegen bringe ich diese vermeintlich banale Seite bewusst mit ein, klar.
Schridde: Auch die Gedichte des amerikanischen Lyrikers und Pulitzerpreisträgers James Tate, die kürzlich – von Ihnen übersetzt – mit dem Titel Der falsche Weg nach Hause erstmals in deutscher Sprache erschienen sind, leben von der Nähe zum Banalen und von einer Kumpelhaftigkeit. Und auch Tates Sprachbilder brechen mit gewöhnlichen Vergleichen. Inwiefern hatte Tate Einfluss auf Sie?
Wagner: Tate war kein direktes Vorbild für mich, aber natürlich mag ich das an ihm. Ich habe aber erst, nachdem bei mir diese Sprachbilder aufgetaucht waren, damit angefangen, Tate zu übersetzen.
Schridde: Die zuweilen surrealistischen Bilderwelten Tates gehen über Ihren Metaphernreichtum noch hinaus, sie bedienen sich oft einer Traumlogik. Tate war es, der in den Siebzigerjahren den Surrealismus in die US-Dichtung eingebracht hat. Es scheint aber, als wollten Sie in Ihrem Nachwort Tate davor bewahren, hier in Deutschland gleich in einer Surrealismusschublade zu landen?
Wagner: Wenn man jemanden als Surrealisten bezeichnet, dann steckt er gleich in dieser Breton-Schublade drin. Eine mindestens ebenso dicke Linie führt bei Tate aber zurück zu William Carlos Williams und dieser ganz typischen amerikanischen Lyrik, die im amerikanischen Alltag verwurzelt ist, in der amerikanischen Umgangssprache. Ein Leser, der Lyrik für etwas Kopflastiges hält, wird überrascht sein, wenn er Gedichte von Tate liest.
Schridde: Nun stehen Tates Originale leider nicht neben Ihren Übersetzungen.
Wagner: Eine Entscheidung des Verlags. Ich bin grundsätzlich immer dafür, das Original daneben zu stellen, selbst bei Sprachen, die kaum einer spricht. Weil man zumindest das Reimschema erkennen kann, das Versmaß.
Schridde: Man kann also nicht vergleichen, was Sie aus den umgangssprachlichen englischen Ausdrücken gemacht haben. Sehen Sie sich ein wenig auch als eine Art Koautor?
Wagner: Es ist so etwas wie eine Mischung aus Kreuzworträtsel-Lösen und Selberschreiben, wobei man natürlich immer von einer Vorlage ausgeht. Als Mitautor sehe ich mich nicht. Eher als derjenige, der die Räuberleiter hält.
Schridde: Auch wenn Tate kein direktes Vorbild war – ist es englischsprachige Lyrik im Allgemeinen für Sie? Sie haben ja einige Zeit in Dublin gelebt.
Wagner: Ja. Auch was das Formale angeht. Klassische Formen wie die Sestine waren ja in der englischsprachigen Lyrik, im Vergleich zur deutschsprachigen, nie aus der Mode. W.H. Auden, John Ashbury und andere nehmen diese alten Formen und füllen sie mit neuem Leben. Auch in der irischen Dichtung ist es völlig selbstverständlich, dass man die traditionellen Formen benutzt, sie dann aber auch ironisch unterwandert, etwa mit Halbreimen. Das versuche ich auch.
Schridde: Ein Beispiel?
Wagner: Wenn ich im Gedicht „Der Veteranengarten“ das Reimwort „matt“ verwende, indem ich das „Matterhorn“ auflöse, indem ich es trenne – also: „die veteranen steigen auf das matt-“, neue Zeile: „erhorn ihrer erinnerung“ und so weiter. Da habe ich natürlich schon sehr gelacht, als ich das gefunden hatte. Die Starre der alten Formen ist wahrscheinlich gerade dann schön, wenn man sie aufbrechen kann und so aus dem Korsett wieder herausfindet.
Schridde: Man muss sich das dann so vorstellen: Der Dichter Jan Wagner sitzt an seinem Schreibtisch und freut sich, wenn er den traditionellen Formen ein Schnippchen schlagen kann?
Wagner: Ja, schon – und natürlich ist es unglaublich reizvoll, die alten Formen mit neuem Inhalt zu füllen.
Schridde: Verfolgen Sie darüber hinaus ein Anliegen mit Ihrer Lyrik?
Wagner: Also kein direkt politisches Anliegen. Ich probiere sicher nicht, eine Meinung kundzutun. Aber eine der tollen Sachen, die ein Gedicht erreichen kann, ist ja, dass es die Sichtweise auf die Welt ein bisschen verrücken kann und zu neuen Betrachtungsweisen einlädt. Wenn ein Gedicht das erreicht, ist das schon viel. Das ist natürlich auch ein politisches Anliegen.
Schridde: Und merken Sie zuweilen, dass das klappt?
Wagner: Bei Lesungen merkt man, dass es Leute gerade auch meines Alters gibt, die Lyrik hören wollen, auf jeden Fall. Das Publikum ist da. Aber anscheinend wird es nicht optimal erreicht. Ich glaube, das Bedürfnis, Gedichte zu hören und zu lesen, ist ein grundsätzliches. Es war höchstens eine Zeit lang verschüttet.
taz, 20.11.2004
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Alexander von Bormann: Träume in der Scheune, ein Groschen im Schnee
Der Tagesspiegel, 25.2.2005
Jürgen Brócan: Surreale Szenarien. Erstmals auf Deutsch. Gedichte von James Tate
Neue Zürcher Zeitung, 2.12.2004
Thomas Poiss: Noch eine Minute bis zur Wunderzeit. Sanfter Brautschlaf
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.10.2004
Jessica Schwarz: Tate Gallery oder Das Schweinsohr am Sofa
Literarisches Zentrum Göttingen, 25.6.2005
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.
Fakten und Vermutungen zum Autor + PennSound + Homepage
James Tate im Gespräch On the Fly writers on writing 2010 in Iowa.


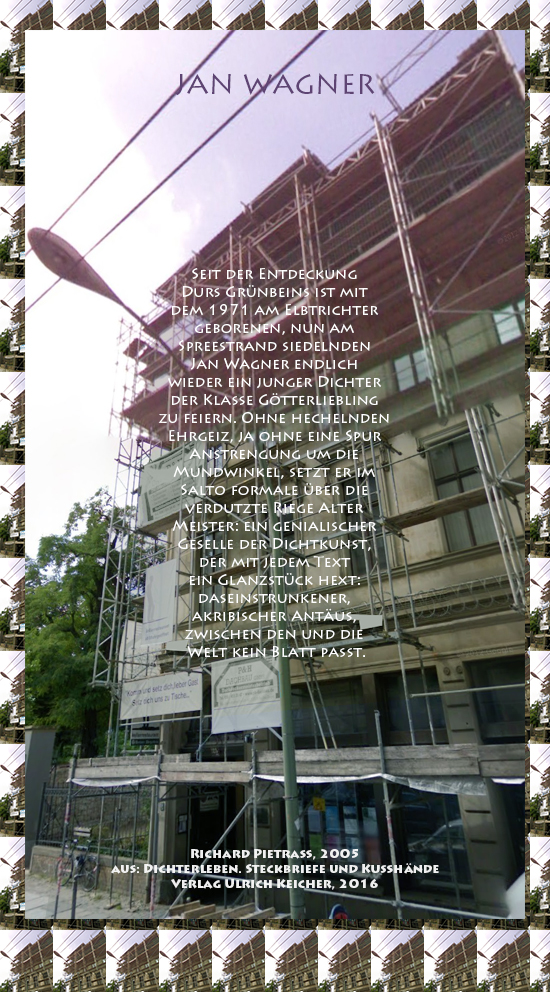












Schreibe einen Kommentar