Margarete Hannsmann: Wo der Strand am Himmel endet
STERNBILD
Falls die Waage
über der Bucht
von Kalamata stillsteht
wo wir
feigenschwer sitzen
während übers Gebirge
der Mond steigt
kann es geschehn
die Honigmelone
löscht den kleinen linken
Stern aus
nimmt seine Stelle ein
bildet die Waagschale
bis sie gen Westen davonrollt
Nachwort
Die in diesem zweisprachigen Band versammelten Gedichte Margarete Hannsmanns, eine Auswahl aus drei Jahrzehnten, führen uns nach Griechenland. Doch in welches?
Daß es nicht nur ein von der Sonne Homers vergoldetes Orplid sein kann, wird deutlich, wenn die Autorin ihr eigenes Schreiben als elementare Anstrengung erfährt. Als „Raubtier“ erscheint ihr Tag, vor ihm ist Dichten eine gefährliche Auseinandersetzung. Nicht mehr Musengeschenk, muß das Gedicht Stück um Stück den Zähnen der Bestialität entrissen werden, Jagdbeute im Überlebenskampf. Geduld allein genügt nicht länger, Schürfarbeit im „Abraum des Tages“, entsagungsvollfleißige Goldwäschersuche: Kampf ist nötig.
Was aber so dem Rachen der Bestie „Tag“ entrissen wird, kann nicht glattes Gebilde sein, muß Spuren tragen, blutende Ränder, Risse und Brüche, wenigstens verborgene Verletzungsmale, Rhythmusstörungen, untergründige Vibrationen, Zeichen des Acherontischen.
Wie aber zeigt sich dem, der sein eigenes Schreiben in solchem Bild zu begreifen sucht, der griechische Ort? „In der Tiefe der Steinkreis / bleibt leer“, heißt es im Gedicht „Theater in Dodona“. „Das von den Römern errichtete Tor / klafft meinem Abgang entgegen“. Flackernde Schatten füllen die Leere, es hallt etwas nach, doch dieser Nachhall verstärkt nur die gespenstische Abwesenheit („alle Auftritte vertan“).
Was hier in Vergeblichkeit ausklingt, wirkte zu anderer Zeit wie ein Sog. „Wieder zieht es mich dorthin / wo sie mit den alten Waagschalen / Leben zuwiegen“ lesen wir in einem früheren Gedicht. Das Nachhallende („Gleichzeitigkeit / fünftausend Jahre alt“) konnte ehedem zuversichtlich Ernte bedeuten („Leben… / das sie eben / … / vor meinen Augen / ernteten“). Die „alten Waagschalen“ schienen die Jahrhundertabgründe zu überbrücken, man durfte es mit eigenen Augen erfahren, „Drachmentage“, gültige Währung über die Zeiten hin.
Zwischen dem am Ende leerbleibenden Steinkreis in der Tiefe und den das Leben zuwiegenden Waagschalen liegt eine lange Wegstrecke der Begegnung mit Griechenland, mit griechischen Orten, auf der die Wundmale des Dionysos immer stärker hervortreten.
Am Beginn des Weges können „die Dörfer im Hang des Pelion“ zu „Schulen der Freiheit“ werden, läßt sich in Griechenland noch finden, „was man aus unseren Wäldern vertrieb“. Hoffnung treibt in Regionen, „wo noch immer Holz für die Argo wächst“, es scheint im glückhaften Augenblick alles wiederholbar, neues mythisches Abenteuer, dauerhafte Erringung des goldenen Vlieses möglich.
Bald folgt Ernüchterung. „Wo wir die Höhle suchten / hatte sich Militär einbetoniert“. Der glückhafte Augenblick, Moment plötzlicher Verzauberung, noch ist er erfahrbar („neben uns Retsinaflaschen / wartend bis die Nacht heranwächst / … / erst beim zwölften Schlag / sehen wir die Argo weit / draußen im Meltemi segeln“). Manchmal entspringt er der einsamen Begegnung mit dem Meer in der Frühe, bevor die andern zur Stelle sind („Ans Meer gehen / eh sich die Sonne erhebt“ – „sobald die Sonne / höhersteigt / fallen / die Anderen ein“).
Die „Anderen“, es können die Nackten sein „im Schutz der Bäume“, vor denen „die Alte / in schwarze Wolle gehüllt“ sich siebenmal bekreuzigen muß. Touristenströme. Haben sie das Verschwinden des Chiron bewirkt, die „alten Waagschalen“ zum Kippen gebracht? Am Anfang dieser Begegnungen mit Griechenland stehen Gedichte, in denen das „Alte“ noch „schattenlos / … sein Geheimnis preis(gibt)“. Nichts verschließt sich, muß entrissen werden, die Rollen sind einleuchtend verteilt („lauft / werft springt weit hoch / ich sing“ heißt es in „Olympia“). Noch scheint, wo Armut und Kargheit der Landschaft vorherrschen, für immer dafür gesorgt, „daß die Esel nicht aussterben“. Die Natur behauptet ein Übergewicht, das Produkt der Zivilisation wird verschluckt, vergeht „in den grünen Schluchten / im Farn / liegt ein verrostetes Auto“). Wie zeitlos tritt, „abseits der Allerweltsstraßen“, den Rastenden die gastfreundliche Spenderin von „Brot und Wein“ entgegen („nicht jung nicht alt / im einen Arm / den Laib Brot / im anderen die Flasche Wein“).
Das durch Archäologenfleiß freigelegte Alte verbleibt, gleichsam neben der zeitgenössischen Welt, im Einverständnis mit der Natur („Auf den Stufen des bald wieder / zugewachsenen Theaters / in der Mittagssonne / das Stück heißt Natur…“). Kann sich solche Natur vielleicht durch Kargheit dauerhaft vor dem „Raubtierzugriff“ bewahren („auch ihr Haus beginnt wieder einzufallen / fort / sagt ein Mann / hier nix Arbeit nix Geld / und läßt sein Maultier trinken“)? Doch für den Menschen sind es nur augenblickshafte „Stufen im Feigenfrieden“. Auf der Höhe der Erfahrung wird ihre Verlorenheit schmerzlich bewußt („Oben beschwört / der Eremit / blind von der Sonne / vom Wind taub / sein Sterben“) Nur durch Flucht, die sich ihre Hilflosigkeit eingesteht, gelingt Bewahrung. („Eh du zu Stein wirst oben / flieh hinab / zu den Stufen / zur Skene im Feigenfrieden“). Dennoch gewinnt auf diesen Stufen das Leben Gewicht, können noch immer die Waagschalen einen glückhaften Augenblick lang in der Fülle gleichstehen („Falls die Waage / über der Bucht / von Kalamata stillsteht / wo wirf feigenschwer sitzen“). Das Raubtierblut erscheint verwandelt, tropft aus „strotzenden Beeren“ („laß es über mich rinnen / hör nicht zu essen auf / bis der Verfolger weicht: / ich bin wie früher / besudelt vom Maulbeerbaum“).
Wie anders kehrt diese Metapher wieder, die Vergiftung anzeigend, die sich epidemisch auszubreiten droht („Maßlos ergießt es sich über die Hügel / Häuserkrebs / grellweiß / … / metastasendurchwuchertes Attika / wo ich die sanfte Brise im Fächeln der Bäume / atmete Frühlinge lang…“).
Wo das Maß verloren ist, versteint das Leben, wird der Mittag schwarz wie geronnenes Blut („Aber der schwarze Mittag: schon gehörst du ihm / einwärts gemeißelt / … / Relief zwischen Urne und Stier“). Nur noch der Wunsch nach Vergessen vermag sich zu erheben, nach Versinken, nach Einswerden mit dem Stein („Halt mein Gesicht im Schiefer fest / wo dein Herz grau ist gelber Berg // mache mich taub für das blaue Dröhnen / schließ deine Wimpern über mir zu“).
Anders flammt das Blut auf im „Purpuraugenblick“ des „Karfreitagsmohn(s)“, dort verhüllt sich sein Raubtier-Übermaß ins Christliche der „Griechischen Karwoche“ („Karfreitagsmohn / Mohn über alle Erde gerufen / damit nie mehr ein anderes Rot / triumphiere / Purpuraugenblick / dich will ich anrufen / in meiner letzten Nacht“).
Wieder wirkt das Bild der Waage herein („Mitte zwischen / Nochnicht Nichtmehr“), Waage-Augenblick des Mohns, Frucht der erntenden Augen („Dasitzen / die Augen sammeln / Stunde um Stunde / nur dieses Rot“). Bald aber werden „Übungen / die Augenlider zu überreden“ nötig (Ägina II), enthüllt das überständige Alte seine Zweideutigkeit („Diese Säule / ließen sie übrig / eine Wunde im Blau // Ursprung / Zerstörungsmal / Ebenbild / Mensch“). Dauer aber, wie sie sich an „El Grecos Geburtsort“ ablesen läßt („Sie schlachten Tiere / wie damals / … / Die Krüge sind noch aus Ton“), vielleicht stünde sie zur Ernte noch immer bereit („Windstiller Schoß / für die eine Hochzeit: / Orient-Okzident“), verwiese nicht, „auf dem Gipfel der Knabenepiphanie“, ein „Zerstörungsmal“ auf eine andere, tiefere „Wunde im Blau“ („Doch auf den Gipfel / der Knabenepiphanie führt jetzt die Straße / zum Radarschirm der NATO“).
Rudolf Stirn, Nachwort
Miteinander reden1
Margarete Hannsmann: Franz Fühmann, Sie wurden 1922 in Rochlitz im Riesengebirge geboren. Ihr Elternhaus war eine Apotheke. Aus dem Wiener Jesuiteninternat, in das Ihre Eltern Sie steckten, brannten Sie vier Jahre später durch und wurden ein so strammer Hitlerjunge wie ich ein strammes Hitlermädchen. Der Krieg, zu dem Sie sich freiwillig meldeten, hat Sie nach Rußland und später nach Griechenland geführt. Als er zu Ende ging, kamen Sie als Kriegsgefangener in den Kaukasus.
Darf ich hier schon aufhören und fragen: Haben diese Landschaften, aus denen die großen Mythen der Menschheit stammen, auf Sie eingewirkt?
Franz Fühmann: Ja, ganz ungeheuer: die Landschaften und die Menschen, die ja voneinander nicht zu trennen sind. Ich habe in dieser Landschaft Szenen erlebt, die aus einem Drama von Sophokles hätten stammen können. Ich erzähle Ihnen eine. Ich war Nachrichtensoldat, und im Peloponnes, der bis auf ein, zwei Straßen von den Partisanen beherrscht war, standen Relaisstationen, die wir bewachen sollten, und so setzten wir an einem Sommermorgen über den noch schlafenden Golf von Korinth. Der leere Himmel nachtverloren, über der Küste der rote Fels, und vor dem Karst ein Fischerdorf, Stein die Straße, Stein die Katen, dort landeten wir und formierten uns, zu einer Art Kastell zu marschieren, wo wir Quartier beziehen sollten, und da wir uns in Bewegung setzten, traten die Bewohner auf die Straße, Frauen, Kinder, Greise, kaum Männer, sie traten stumm aus dem Stein heraus und sahen uns an und sprachen kein Wort, und in dem Augenblick, da wir vorbeimarschierten, kehrte einer nach dem andern uns wortlos den Rücken, und wir marschierten durch ein Spalier von Haß und Verachtung, wie sie würgender nicht hätten bezeugt werden können als durch diesen wortlosen Chor.
Diesen Haß hatte ich überall erfahren, wo wir unseren Fuß hinsetzten, in Polen, in der Ukraine, in Böhmen; in ihm war Europa geeint, doch ins Mark getroffen hat er mich dort, in dieser Landschaft, vor diesem Meer. Ein alter Mythos war jäh lebendig, und gewiß ist da etwas in mir angelegt worden, das im Unbewußten weiter gewirkt hat. Später wurden Novellen daraus, vor allem der „König Ödipus“.
Ich bin dankbar, daß Sie mit dieser Frage beginnen, und ich gebe sie Ihnen zurück. Ich kenne Ihre Griechenlandgedichte, ich kenne Ihr großes Athengedicht: wie hat – in einer ganz anderen Situation, aber wir haben ja unsern Ausgangspunkt gemeinsam –, wie hat auf Sie diese Landschaft gewirkt?
Hannsmann: Das ist unheimlich. Dieser gemeinsame Ausgangspunkt, unter so verschiedenen Aspekten. Dasselbe Land, dieselbe Landschaft, zwanzig Jahre später. Als ich zum ersten Mal nach Griechenland fuhr, 1960, wurde überall gesagt: Da sind noch die tiefen Wunden aus dem zweiten Weltkrieg, Vorsicht mit der Bevölkerung, Vorsicht in einsamen Gegenden, Vorsicht, wenn ihr euer Zelt aufstellt in der Nähe von Dörfern, in denen Deutsche gehaust haben – der Haß ist noch wach. Das Gegenteil war der Fall. Die Griechen, die sich von Ihnen abkehrten, haben sich uns zugewandt. Und so wurden die Orte auf dem Peloponnes, in Attika und Nordgriechenland eigentlich zu Geburtshelfern meiner Gedichte.
Fühmann: Sie haben erst in Griechenland angefangen, Gedichte zu schreiben?
Hannsmann: Ja. Eigentlich ja. Darf ich an einem Beispiel auch aus dem Peloponnnes zeigen, wie ganz ähnliche Bilder, die Sie aus dem Krieg beschworen haben, zum Anlaß meiner frühesten Gedichte wurden?
Unser Zelt stand in der Landschaft Messenien, im Süden des Peloponnes, es ist ein reiche, fruchtbare Gegend, immer wieder verheert und heimgesucht von kriegerischen Völkern. Die Menschen leben vom Wein- und Gemüseanbau, vom Fischfang und Handel in der Bucht von Kalamata, das Land ist gegen Westen und Süden offen, aber im Nordosten versperrt ihnen das ungeheure Gebirge des Taygetos den Rücken. Deshalb geht die Sonne dort später auf und später unter. Abends, nach hartem Tagwerk, feiern die Menschen mit der sinkenden Sonne; wir saßen bei ihnen bis tief in die Nacht hinein. Morgens schliefen wir dafür länger.
Aber als ich dann Messenien verließ und den Wagen durch die Schluchten lenkte, in denen die Spartaner vor dreitausend Jahren ihre Kinder aussetzten – Sie wissen das: die zarten, schwachen, untüchtigen; das, was man in unseren barbarischen Zeiten als „lebensunwertes Leben“ bezeichnet hat, vielleicht solche, die später die Dichter, die Maler, die Musiker geworden wären –, da war es, als seien dreitausend Jahre aufgehoben. Die Menschen machten uns Schwierigkeiten, waren mißtrauisch, feindselig, es wurde früh dunkel und kalt im Schatten des Gebirges, und wir gedachten der Vergangenheit, da die Spartaner, früh von der Sonne geweckt, über die Pässe gingen, anderen Menschen die Feigen und Fische wegzunehmen. Bei der Fahrt durch den Taygetos fiel mir ein, daß Sparta tatsächlich kaum eine künstlerische Leistung hervorgebracht hat, und da schossen, in diesen mörderischen Schluchten, all diese Gedanken und Gefühle mit der Landschaft, der Geschichte, dem Mythos in mir zusammen, und es entstand ein Doppelgedicht: „Sparta I“ und „Sparta II“, mit diesem Schluß:
Nur der Eurotas baute sein Bett
nicht
wie das Gesetz es befahl.
Sie waren Soldaten
man braucht nicht viel Zeit
die Reste anzusehn.
Damit bin ich, und nicht nur beim Bettenbau, wieder bei der Wehrmacht in dem Krieg, in dem Sie den Peloponnes erlebten. Das Idol Sparta war ja auch für uns das Idol in der Hitlerjugend.
Fühmann: Als Idol war es bei mir nie wirksam; an den Nationalsozialismus banden mich als Auslandsdeutschen sehr viel elementarere Dinge, und der Soldatenalltag war spartanisch genug. Ich hatte keine Sehnsucht, Schwarze Suppe zu essen, und von der Ideologie her kein Bedürfnis, auf Spartas gerühmtem Boden zu stehen, wohl aber war es mein Traum gewesen, einmal durch die Stätten zu gehen, durch die ich, seitdem ich lesen konnte, mit Gustav Schwabs griechischen Sagen gezogen: Theben, Korinth, Athen, den Olymp. – Nun war ich da, aber in Uniform, und nicht Herr meiner Zeit und meines Handelns, und da habe ich, wiewohl verwilderter Nazisoldat, manchmal Karabiner und Stahlhelm verflucht. – Im Süden des Peloponnes bin ich nie gewesen, nur an der Nordküste, vorher in Athen und Korinth, und dann sind wir über den Olymp geflohen, gehetzt und gejagt von Partisanen und englischen Fliegern, da denkt man kaum an Demeter und Zeus.
Später allerdings fand ich Zeit zur Besinnung, daß die Mythen voll von Vertreibungen der den Göttern und Menschen Verhaßten, von Reinigungen des Landes sind.
Hannsmann: Es ist ja immer das Land, das den Göttern gehört. Sie melden sich früh an.
Ich kann das Thema Griechenland nicht verlassen, ohne noch einmal von den Bergen zu sprechen, auf denen der Mythos zu Hause ist: Natürlich waren es auch bei mir zuerst Schwabs griechische Götter- und Heldensagen, in denen ich ihm begegnet bin, doch schon als Kind machte ich mich auch über Homer her, vielleicht nur, weil er mit so aufregenden Bildern ausgestattet war. Sicher ist da mehr mit mir geschehen, als daß nur etwas hängenblieb: man weiß ja heute, wie ein Kind sehr früh geprägt werden kann. Also stieg ich später bei meinen fünf Griechenlandreisen auf die Berge der Götter, den Olymp, den Parnaß, den Helikon, wo die Musen hausen, auf die Kyllene, wo Hermes geboren ist, auf den Chelmos, über dessen Felswände der Styx stürzt, und manchmal entstand ein Gedicht. Ich weiß bis heute nicht, wovon es abhing. Mit Apollon zum Beispiel verbindet mich nichts, die Besteigung des Parnaß war ein ungeheures Erlebnis, aber mein Gedicht schrieb ich über die Nymphenhöhle Korykion Andron, dem Dionysos heilig, wo die Thyiaden hausen und sich zu bestimmten Zeiten die Mänaden, die rasenden Weiber, versammeln, ihre Feste zu feiern und auf den Parnaß auszuschwärmen. Der Gott Hermes war mir günstig gesinnt, aber mit einem Gedicht traute ich mich nicht an ihn. Auf dem Weg zum Zeusberg Ithome begegnete ich einem gewaltigen Popen, er trug einen schwarzen Regenschirm gegen die Sonne aufgespannt, in gebührendem Abstand folgten ihm seine hagere Frau und die Tochter, er rief immer nur ochi, ochi!, auf dem Gipfel das Kirchlein verfiel, und die Christenglocke war geborsten, bald würde der Berg wieder allein dem Wind und dem Wetter und Zeus gehören. Der andere Zeusberg im Norden Griechenlands erhebt sich über der Orakelstätte Dodona, er sah besteigbar aus und kostete mich fast das Leben. Den letzten Hirtenpfad längst verloren, krochen wir in brüllender Hitze dem Gipfel entgegen zwischen stürzenden Steinen, dort sollen in der Türkenzeit, von kundigen alten Frauen geführt, die griechischen Mädchen nach dem Genuß von Rauschkraut sich tanzend in die Tiefe gestürzt haben, um den Eroberern nicht in die Hände zu fallen.
Das sind also nun ein paar Beispiele von Orten, an denen meine Gedichte entstanden: fast ausnahmslos in der vom Mythos bedachten Natur.
Fühmann: Was mich nun aber doch überrascht hat: Daß Sie erst so spät, erst dort in den Bergen begonnen haben, Gedichte zu schreiben – nach dem, was ich von Ihnen kenne, denkt man, Sie hätten von Kindheit an nichts Anderes als eine dichtende Existenz gelebt. In dieser Landschaft, der Sie entstammen, in Heidesheim, im grünen Schwaben, da drängt sich das doch eigentlich auf, da kann man doch eigentlich nichts Andres treiben als dichten!
Hannsmann: Mit dem Wort „aufdrängen“ haben Sie aber jetzt etwas angestellt. Es bringt mich nämlich aufs „Verdrängen“, und da bricht ein ganzer Komplex auf. Wenn ich behaupte, ich habe in Griechenland angefangen, Gedichte zu schreiben, dann verdränge ich etwas. Damals war ich ja schon fast vierzig Jahre alt; natürlich habe ich als junger Mensch Gedichte geschrieben, dazwischen liegt eine Spanne von zwanzig Jahren, in der nichts passierte außer Leben. Es fing an mit Rainer Maria Rilke und Weinheber, was eben im Dritten Reich erlaubt war und zugänglich und in der Schule vorkam. Ich bemühte mich um Reime und Kostbarkeit; und im übrigen gab’s ja die Klassiker. Im Krieg geriet ich an die Menschheitsdämmerung und an Soergels Im Banne des Expressionismus. Diesen Gedichten war ich ganz allein konfrontiert, konnte mit niemand darüber sprechen; es war eine ungeheure Sache. Nicht das Verbotene war das Primäre, sondern daß ich mich in diesen Gedichten zu Hause fühlte, daß etwas sehr Starkes und Glückliches auf mich überging. Ich fing an zu schreiben wie die expressionistischen Dichter. Der Konflikt konnte nicht ausbleiben, ich war Hitlerjugendführerin, und in meinen Schulungsheften standen, unter dem Stichwort „Dekadenz“, alle meine Vorbilder: Trakl, Heym, Stadler, Werfel, Wolfskehl, Else Lasker-Schüler und viele andere. Dekadenz, das war etwas Weiches, Schlappes, Bequemes, Entartetes, fast schon so schlimm, wie Jude zu sein, und unter dem Schock, daß ich so etwas liebe, ja selbst hervorbringe, hörte ich auf, meine Gedichte, die Gedichte, in denen ich mich verwirklichen konnte, weiterzuschreiben. Das war die erste Verdrängung. Danach wurde ich, noch im Krieg, Antifaschistin und hätte mich durchaus wieder zu meinen Dichtern bekennen können, doch unterm Bombenregen verging einem das Schreiben, und hinterher blockierte das Wort von Adorno, daß nach Auschwitz kein Gedicht möglich sei, erneut für zwei Jahrzehnte mein Schreiben.
Fühmann: Nun ist es an mir, „unheimlich“ zu sagen, und nun habe auch ich ein „später“: Der Gewissensschock, den Sie da schildern, geschah mir erst nach dem Krieg, mit Trakl, der war kurz vor der Kapitulation der Wehrmacht, im Mai 1945, wie ein Feuerstrom in mein Bewußtsein getreten, und gerade er wurde als Inbegriff des Bösen – und auch unter dem Schlagwort „Dekadenz“ – von Autoritäten jener Ideologie verdammt, der ich trotz ihres damaligen Geprägtseins durch Stalin den Beginn meiner Lebenswende verdanke: dem Marxismus, dem Wissenschaftlichen Sozialismus. Da kam ich in eben den gleichen Konflikt: Ich hatte etwas zu verwerfen, als Inbegriff von Ungemäßem – sagen wir ruhig: von Feindlichem zu verwerfen, das mir Inbegriff von Dichtung geworden und als Dichtung auch jenes Rettende, das die Ideologie auf ihre Weise einst nicht minder gewesen war. – Diesen Kampf hatte ich in mir auszutragen; er hat, mit wechselvollem Verlauf, mehr als zwanzig Jahre gedauert, und gewonnen hat ihn schließlich die Dichtung, doch ich will jetzt nicht darauf eingehn, könnte es auch gar nicht: ich habe eben erst eine Arbeit mehrerer Jahre zu diesem Thema zu Ende gebracht. – Über Adorno müssen wir unbedingt noch sprechen; ich verstehe das Motiv seines Satzes und halte ihn doch für verhängnisvoll. – Doch zunächst noch die Strecke durch den Krieg. Da ist Weinheber auch mein Dichter gewesen, vor dem bin ich auf den Knien gelegen, ich habe dann auch à la Weinheber gedichtet, „Reime und Kostbarkeit“, das trifft es genau. Aber mit Rilke ging es mir dann ganz anders als Ihnen. Ich stieß erst als Soldat auf ihn, und das Erlebnis, das Sie mit Heym und Stadler hatten, das geschah mir durch Rilke, mit dem Doppelband seiner Neuen Gedichte. Nicht so sehr mit dem berühmten Cornet, das waren „Reime und Kostbarkeit“, Stoff zu schwärmen und zu träumen, doch mit den Gedichten wurde es ernst. – Nur daß es damals bei mir kein Gewissenskonflikt wurde; eher im Gegenteil. – Diese Gedichte haben mich überwältigt, überfallen und überwältigt; ich hatte in meinem biederen Riesengebirgssinn nicht für möglich gehalten, daß Gedichte so sein können, so sein dürfen: sie haben mich aufgewühlt bis ins tiefste, beinahe um den Verstand gebracht. – Drogen; ich kenne die meisten von ihnen noch auswendig. – Diese grelle Erotik, und zwar in dem, was man damals „pervers“ geheißen und was man geächtet, ja mit dem Tod bedroht hat: männliche Homoerotik und Lesbiertum; David und Jonathan; Sappho und ihre Gefährtin; Poetik der Ejakulation, Orgastisches und Orgienhaftes, Prinz Absolom mit den zehn Frauen im „hochoffenen Zelte, das jauchzendes Volk umstellte“ – das alles waren ja Provokationen ungeheuerlichsten Ausmaßes, und dann dazu noch, was Sie schon sagten: daß dies Altes Testament war, Judentum wie Heiliges Buch (ich komme ja aus einer frommen katholischen Kindheit), also doppelt und dreifache Blasphemie; und dazu in dieser Welt der Ordnung und Sauberkeit, die wir vertraten, dieses ungeheuerliche Rebellentum von Schmutz und Zersetzung und Lepra und Fäulnis, diese tropfenden Würmer aus Geschwüren, dieser Grind und Schorf, dieser Gestank der Verwesung, und daß all dies faszinierend war, mich erregte, verwirrte, mir den Atem abpreßte, und immer wieder in dieser Landschaft, die auch eine einzige Provokation war: die Thebais, die Wüste, der Sumpf, der Karst, unvölkischer konnte es ja nicht mehr zu gehn, und unheldischer nicht in den Gestalten, die diese Landschaft bevölkerten: Styliten und Huren, und Baalsdiener, und Propheten, und Wahnsinnige, und Sibyllen, und Kranke – Ich habe den Begriff der Dekadenz nicht gekannt –
Hannsmann: War der nicht im HJ-Vokabular?
Fühmann: Das weiß ich nicht; ich sagte ja schon, daß in meinem Nazitum wenig Ideologie war und Ideologisches mich kaum scherte. Außerdem war ich „unten“, nur Mannschaftsdienstgrad, nicht in einem Führungsrang wie Sie, also nicht mit der Verpflichtung, etwas zu lehren, was ich selbst nicht vertreten hätte. Jedenfalls weiß ich, daß diese Gedichte keinen Gewissenskonflikt auslösten, sondern daß ich mich ihnen hingab und geschehen ließ, daß sie mich verzückten. Es war da etwas, das ich erst viel später begriff: das Andere, die Ahnung von Alternative. Ich empfand diese Gedichte als Rebellion, doch ich wurde dadurch kein Antifaschist. Im Bewußtsein blieb ich der Nazisoldat; darunter fing etwas an, sich umzugestalten. Bewußt geworden ist allerdings damals eine Art Gier nach dem Unbekannten, nach Unzugänglichem, ja nach Verbotenem. Die empfand ich dann auch, so seltsam es klingen mag, auf dem Trott in die Kriegsgefangenschaft. Ich war gierig auf das Innen von etwas, das ich nur von außen kannte, und offen für alles, was kommen wollte.
Hannsmann: Sie kamen ja in das Land, wo Medea herkommt, in den Kaukasus, das Land der Kolcherin und des Prometheus, und Sie hatten, soviel ich weiß, mit Gedichten lang vorher angefangen. Geschah es Ihnen dort wie in Griechenland?
Fühmann: Ja und nein, und mehr nein als ja. – Ich erlebte zwar auch mythenhafte Szenen, Urszenen von Schuld, Begegnung, Verzeihen und Rache, doch es war kein Bezug zum Mythos da, nicht von innen noch von außen her. – In Griechenland war mir immer gegenwärtig, daß ich in der Landschaft der Mythen stand, und ich konnte sie auch lokalisieren; vom Kaukasus wußte ich kaum etwas, und was ich wußte, trat zurück. Als ich das vernichtete Noworossijsk sah, die zertrümmerte Stadt, den zertrümmerten Hafen vor dem schweigenden Bergrund, da dachte ich nicht: Das ist die Landschaft des Goldenen Vließes und des „Gefesselten Prometheus“; ich dachte: Das haben wir Deutschen gemacht, und diese Trümmer werden nun für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht dein Leben lang dein Land sein. – Ich hatte noch nie zuvor solche Verwüstung gesehen. – Gewiß, es hätte nahegelegen: die Landschaft des Ares; aber eben das war es nicht. – Wir kamen übers Schwarze Meer geschwommen, von Rumänien her, ein Gefangenenschiff, ich hab’s im Judenauto beschrieben, eine Fahrt unter strahlend blauem Himmel, zu Walzerklängen, mit einem Fäßchen Wein auf Deck nach vier Hungerwochen, berauscht und mit ausgelöschtem Bewußtsein, und dann der Karst des Kaukasus vor einem ungeheuren Himmel, der tiefblau war, in Violett überging, das Meer war regenbogenfarbig, aber kein Regenbogen der Hoffnung: ein stinkendes Meer aus grauem Schlamm, von unzähligen Öllachen überzogen, ein zerspellter Regenbogen, und geborstene Spanten, zerschlitzte Schiffe, zerstückter Stahl, und vor uns, auf dem Hang, der Schutt der einst schneeweißen Stadt, verschmort und versengt, eine zertrümmerte Muschel, und wir stapften durch die Trümmer, und da kam das Gerücht, daß jeder Transport solch eine Stadt zum Wiederaufbau bekomme – das Wort „Wiederaufbau“ wurde damals geboren –, und wenn diese Arbeit geleistet wäre, würden wir entlassen, eher nicht.
Doch wir blieben nicht in Noworossijsk, wir zogen hindurch, den Karst hinan, und in der Nacht, hoch über der Stadt, an kleinen Feuern, kam mir das Gedicht von Georg Heym in den Sinn: „Aufgestanden ist er, welcher lange schlief…“, also sein berühmtes Kriegsgedicht, mit der Personifizierung des Kriegsgotts als Riese mit einer Keule, mit der er auf die Städte einschlägt, und mit diesem Zugriff: „Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand…“ Ein Ares also, und nun könnte man Einschlägiges zitieren, aber eben dagegen wehrt sich bei mir etwas, und es hat sich wohl auch schon damals gewehrt. Und wenn wir so lang – und mit gutem Recht – über den Mythos gesprochen haben, ist es not wendig, auch von seinem Mißbrauch zu sprechen, er kann ja auch zur Ausrede dienen, zur Bemäntelung, zur Flucht, zur Verleugnung der Schuld. Es ist leicht zu sagen: „Landschaft des Ares“, aber es ist ja nicht Ares gewesen, der Noworossijsk zertrümmert hat, das waren ja wir, deutsche Soldaten, meinesgleichen, die Vernichter hatten einen konkreten Namen, und ich war ein Teil davon.
Hannsmann: Das wurde verdrängt –
Fühmann: Ja, eben, eben, und es ist so wichtig, daß die Erinnerung bleibt. Es gab ja Dokumente, und man kann sie noch einsehn. Da ist eine Wochenschau gewesen, die hat einen „Schienenwolf“ gezeigt, voll Stolz, was deutscher Geist so entwickelt: ein Gerät, das beim Rückzug auf die Schienen gesetzt wird, als letztes rausfährt und die Schwellen zerreißt. – Dann wurden die Brücken gesprengt, und die Wehre und Dämme, vorher schon die Häuser und Brunnen, die Bäume waren schon umgehauen, die Telegraphenmasten auch, die Schächte ersäuft, die Acker vermint –: ein schwarzes, verbranntes, verheertes Land, das ist ja auch voll Stolz verkündet worden, daß es sich in zweihundert Jahren nicht mehr erholen wird, und dahinein sind wir dann als Gefangene gekommen und haben angefangen zu heulen, daß es so wenig zu essen gibt. – Ich will nicht vergessen.
Hannsmann: Ich auch nicht.
Als der Krieg zu Ende war und mit ihm die Nazizeit, dachte ich, es gäbe nichts Wichtigeres, als Rechenschaft abzulegen – über das, was ich war und wovon ich wußte, weil ich es ja repräsentiert hatte: über die von Hitler verführte Jugend, zu nichts Anderem erzogen, als seinen Eroberungsplänen zu dienen, und zum anderen über meine Wandlung durch einen Mann, Vater meiner Kinder, der als Sozialist nach kurzem KZ-Aufenthalt und jahrelanger Überwachung mich die Welt anders sehen lehrte, daß ich, noch im Krieg, zur Antifaschistin wurde. Meine erste literarische Arbeit, ein Theaterstück über diese Entwicklung, wollte Erwin Piscator aufführen, als er noch einmal, für kurze Zeit, in Heidelberg ein Theater hatte; aber alles zerschlug sich. Niemand interessierte sich mehr dafür; Währungsreform, Wiederaufbau als Restauration in der Adenauerära verhinderten eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Niemand wollte an KZs und Vernichtungseinrichtungen für „lebensunwertes Leben“ erinnert werden. Die alten Antifaschisten blieben unter sich, sie wirkten kaum über ihren Kreis hinaus. Meine Versuche, dieses erneute Ghetto aufzubrechen, scheiterten; mein Mann geriet ins Abseits, danach ins Unglück; ich mußte die Familie ernähren, und wo noch Zeit abfiel und das Verlangen standhielt, literarisch etwas zu bewältigen, stieß ich gegen Mauern: Nicht diese Themen, bitte!
Bald war es so, daß ich ohnmächtig-stumm auf das starrte, was sich statt des Erwarteten im Nachkriegsdeutschland anbahnte. Gelegentlich fiel von einem der Großen noch ein klagendes oder anklagendes Wort, etwa von Mitscherlich über die „Unfähigkeit zu trauern“ oder das vorhin schon erwähnte, für mich so verheerende Verdikt, nach Auschwitz sei kein Gedicht mehr möglich, ein angeblich aus dem Zusammenhang gerissener Satz des Wortführers der heraufkommenden Studentenbewegung. Damit war das Urteil auch von der Gegenseite gesprochen, von der ich noch ein letztes Hoffen herleitete, über Vergangenes zu schreiben. War es da ein Wunder, daß ich die Möglichkeit Griechenland als Erlösung betrachtete?
Fühmann: Und wie wurde diese Möglichkeit vermittelt?
Hannsmann: Der Zufall führte da zwei Ereignisse zusammen: Im Land meiner Liebe und Sehnsucht wurde eine brutale Militärdiktatur errichtet, die der der Nazis kaum nachzustehen drohte, und der Holzschneider HAP Grieshaber trat in mein Leben. Das war gegen Ende der sechziger Jahre. Ich wurde sein Chauffeur, und er ließ nicht nach, mir zu helfen, die Vergangenheit in die Gegenwart überzuführen. Alles Verkrustete in mir brach wieder auf. Zuerst zeigte er mir die Orte der faschistischen Untaten in unserer engsten Heimat, etwa Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, wo, weithin sichtbar, die Verbrennungsöfen rauchten und niemand es je gewußt haben will, daß dort die geistig und körperlich Behinderten zu Tausenden gemordet wurden. Oder, nicht weit von Grafeneck entfernt, das ehemals jüdische Dorf Buttenhausen, aus dem die Familie Erzberger stammte, das einst eine Realschule besaß und nach der Ausrottung aller jüdischen Bewohner in dumpfen dörflichen Schlaf versank. Über diese Orte entstand mein erstes gemeinsames Buch mit Grieshaber: Grob fein und göttlich – die Rauhe Alb. Danach durfte ich Grieshaber viele Male in die DDR fahren, wo er Holzschnitte druckte und Bücher machte. Auf diesen Reisen zeigte er mir den Unterschied der beiden deutschen Staaten, die sich aus ein und demselben Land, aus ein und derselben Geschichte entwickelt hatten. Er brachte mir die DDR-Literatur, von der ich nichts wußte; ich hatte nicht die geringste Ahnung, daß dort eine Lyrik entstand, deren Voraussetzung ebendas war, was mir fehlte: aufgearbeitete Vergangenheit. Davon erfuhr ich erst 1970; ich wurde dann auch mit Schriftstellern der DDR bekannt und holte mir bei ihnen, was ich zur späteren Befreiung brauchte. Während und nach diesen Reisen entstand eine Anzahl Gedichte über Städte, Stätten und Landschaften der DDR aus dem Blickwinkel eines westdeutschen Besuchers.
Fühmann: 1970, das war eine Zeit unerträglicher Verengung, was die literarische Gestaltung der Gegenwart meines Landes anging, Kulmination einer Restriktionsphase, die Ende 1965 begann. Es ist höchst merkwürdig, wie unsere Wege so laufen. Auch wir haben damals viel nach außen geschaut. Vergangenheit, ja –: davon war vieles bewältigt, ihr nationalsozialistischer Aspekt teilweise wirklich radikal, bis in die Wurzeln hinein, das heißt: mit allen Wurzeln heraus, so etwa im ökonomischen, und das bleibt des Rühmens allezeit wert. Doch nicht alle Vergangenheit war so bewältigt, und uns brannte die Gegenwart unter den Nägeln: die unbewältigte Vergangenheit des Sozialismus als immer mehr quälende Gegenwart. Daß die Literatur von jedem Bewältigungsprozeß dieser Art strikt ausgesperrt schien, machte mich und manche meiner Kollegen fast resignieren. In dieser Zeit – und nicht nur damals – erschien mir eine Gestalt wie die Heinrich Bölls als Vorbild und – mutatis mutandis – Muster der Möglichkeit literarischer Kritik an der eigenen Gesellschaft.
Hannsmann: Ich habe indes auch Ihre Probleme und Schwierigkeiten kennengelernt. Vielleicht sollte ich sagen: ich habe damit begonnen, sie zu sehn und zu verstehen. – Über Ihre Entwicklung in der DDR haben wir noch gar nicht gesprochen; ich hätte da ein Bündel von Fragen. Doch vielleicht ist das beste, chronologisch zu bleiben. Was geschah also nach Noworossijsk?
Und ich vergewissere mich gleichzeitig noch einmal: Sie haben schon damals Gedichte geschrieben?
Fühmann: Ja, seitdem ich schreiben gelernt hatte; es war für mich eine Existenznotwendigkeit. Übrigens tat ich das, ohne an irgendeine Veröffentlichung zu denken, und massenweis, und ohne jedes Verbessern; es floß so raus. Ich tat das in meiner Pennälerzeit, ich tat das im Krieg und trieb das dann auch im Lager weiter, hockte abends nach der Arbeit auf meiner Pritsche oder lehnte am Ofen und kritzelte Verse auf eine der Holzschindeln, die als Karteikartenersatz fungierten, mit einem Tintenstiftstummel, der für drei Brotportionen eingetauscht war, und am nächsten Tag mußte ich’s mit einer Scherbe wieder auskratzen, weil ich nur diese eine Schindel besaß.
Hannsmann: Es gab kein Papier?
Fühmann: Eine Achtelseite Iswestiia wurde für zwei Brotportionen gehandelt – verbranntes Land. Es gab, merkwürdigerweise, fast ausreichend Tabak, der war Bestandteil der Rotarmistenverpflegung, die wir als Kriegsgefangene bekamen, aber es gab kein Papier, und es gab auch kein Messer, Pfeifen zu schnitzen. – Also die Schindel, und ich hockte nach meinem Tagwerk da und kritzelte nieder, was so rausrann: Dumpfheit, Ratlosigkeit, Klagen, Verzweiflung, weinerliche Selbstbemitleidung, all dieser Katzenjammer eben, wenn der Rausch des Herrenmenschentums verdunstet und das Welterobern schiefgegangen ist. – So lief das ein Jahr hin; dann kam ich durch eine Verkettung von Zufällen auf eine antifaschistische Schule und begann dann vier Jahre hindurch, ohne eine Zeile zu schreiben, nur zu lernen und aufzunehmen. Das war, natürlich von Stalinismen überlagert, meine erste Begegnung mit dem Marxismus, maßgeblich in der Gestalt von Lukács, und es war auch meine erste Begegnung mit Heine, es war meine erste Begegnung mit Lessing, und ich hörte das erste Mal Namen wie Hegel und Feuerbach. Freilich muß ich sofort hinzufügen: Es war auch die Forderung nach der Verwerfung Trakls und der Verurteilung der Romantik als reaktionär. In dieser Zeit, wie gesagt, schrieb ich keine Zeile. Dann wurde ich nach Deutschland entlassen, auf meinen Wunsch in die DDR, ein mir doppelt unbekanntes Land, in dem ich fast zehn Jahre lebte, ohne es eigentlich kennenlernen zu können, ich lebte darin als frisch Konvertierter, als Neophyt, mit all den Eigenschaften dieser Gattung; ich will – vergröbernd – sagen: als „Umgedrehter“, so beginnt es, und auch mein Schreiben war „umgedreht“, von einer schwarzen Weltuntergangsstimmung in den naiv strahlenden Optimismus der gänzlich kritiklosen Überzeugung, in einer homogen harmonischen Gesellschaft zu leben, und wenn die Realität dieses Wahnbild störte, dann waren das eben „Reste des Alten“ oder „Einwirkungen des Klassenfeinds“. – Gewiß gab es dies alles auch. – Ich kann jetzt nicht eine Entwicklung referieren, über die ich ein Buch zu schreiben begonnen habe; nur dies noch: daß ich 1958 aufgehört habe, Gedichte zu machen, eine Pause, die bis heute anhält, wahrscheinlich das endgültige Versiegen, wenn ich mich auch noch immer gegen diese Einsicht wehre.
Hannsmann: Aber man hat Sie eine poetische Hoffnung genannt…
Fühmann: Die ist mit einer anderen Hoffnung wahrscheinlich dahin; das Leben ist nun einmal so. Meine besten Gedichte habe ich nach dem XX. Parteitag der KPdSU geschrieben, nach Chruschtschows berühmter Abrechnung mit Stalin, da fing ich an, einen eigenen Ton zu finden, und was nicht nur mich beflügelt hatte, war die Hoffnung, daß nun ein Altes abgetan werde: moralisch, geistig, institutionell, politisch; grob gesagt: die Hoffnung auf ein rasches Voranschreiten dessen, was man dann später „Demokratisierung der sozialistischen Gesellschaft“ nennen sollte – dann kamen die ersten deutlichen Rückschläge in diesem Prozeß, der mit einer so großen Hoffnung begonnen, und dann starb halt so manches ab. Zuerst sterben immer die Gedichte. Das geschah nicht bloß mir, das geschah auch andern, und wenn wir je eine Geschichte der Literatur der DDR haben würden, statt jener peinlichen Karikatur von Beflissenheit, die sich einen solchen Titel anmaßt, dann müßte man darin auf diese Zäsur eingehen. Vor ihr lagen die beiden letzten Gedichtbände Bechers, die ihn wieder als bedeutenden Dichter auswiesen; vor ihr lagen neue Gedichte Hermlins. Damals konzentrierte ich mich auf die Prosa und begann, auf ganz weite Sicht hin, den Essay anzusteuern, weil ich fühlte, daß da das Medium sei, in dem vor allem ich zu mir selbst finden könnte.
Hannsmann: Hier trennen sich die beiden Linien unserer Entwicklung; meine läuft jetzt entgegengesetzt. In Griechenland brach die Militärdiktatur aus. Ich hatte gerade die Grenze überschritten. Die Hoheitszeichen waren mit Säcken verhangen. Auf der Agora in Athen, dem Ort, wo die Demokratie entstand, sah ich einen Panzer stehen. Über Nacht veränderte sich meine Lyrik. Aus der kontemplativen Betrachtung, der Landschaftslyrik, der poésie pure wurde poesie engagé. Ich erlebte, was den Griechen widerfuhr, den einfachen Menschen, mit denen ich umging, Bauern, Hirten, Fischern, sie wurden um ihre letzte Hoffnung betrogen: bessere Lebensbedingungen, bessere Schulen für ihre Kinder. Über Nacht mußten sie ihre Gewehre abliefern, das Zeichen ihrer Freiheit, Mannbarkeit. Die Männer ihrer Wahl, ihre Volksvertreter, wurden in die Gefängnisse geworfen, gefoltert und auf Verbannungsinseln deportiert. Diese Ereignisse waren jetzt der Gegenstand meiner Gedichte. Manchmal direkt, ohne Verschlüsselung, ich schrieb Agitprop, ohne vorher gewußt zu haben, was das ist. Manchmal benützte ich auch noch den Mythos, daß er mir transportieren half, was ich sagen wollte: die Geschichte von Prometheus etwa, oder Antigone, oder Philoktet. Natürlich mußte jetzt auch mehr mit meinen Gedichten geschehen, als daß sie in einem Büchlein begraben lagen. Ich mußte selbst damit auf die Agora, das heißt, ich ging zu Veranstaltungen für die Befreiung Griechenlands, las dort vor, Aufrufe, Gedichte, ich zog jahrelang durch die Bundesrepublik und veranstaltete selbst Kundgebungen mit Gastarbeitern, Studenten, Amnesty International und Griechenlandkomitees. Ich schrieb in Zeitungen und sprach im Rundfunk und trug Material zusammen von deutschsprachigen Schriftstellern aus ganz Europa, etwa für die Griechenlandnummer einer Zeitschrift. Unversehens veränderte das mein Leben. Fast gleichzeitig brauste ja die Studentenrevolution einen Sommer lang und dann mit vielerlei Nachwehen durch die Städte Westeuropas, auch sie schlug sich in meinem veränderten Denken und Schreiben nieder; dazu kam, wenn auch verspätet, Vietnam, und dann, noch bevor Griechenland frei wurde, Chile. Mein Engagement war so deutlich, daß ich jahrelang nicht mehr nach Griechenland einreisen konnte. Mein Chile-Engagement entstand in der DDR, dort erlebte ich eine Bewegung der Teilnahme, die durch die ganze Bevölkerung ging, machte eine Reihe Solidaritätsveranstaltungen mit, die im Zeichen Pablo Nerudas standen, zu dessen Gesängen Grieshaber Holzschnitte gemacht hatte, während Erich Arendt und Stephan Hermlin ihre Übertragungen der Gedichte Nerudas vorlasen – Abend um Abend fielen diese Verse in mich hinein. So wurde Pablo Neruda einer meiner Lehrmeister, fast ohne daß ich es bemerkte. Unter seinem Einfluß begann ich mein langes Gedicht über Buchenwald zu schreiben, einen Gesang auf Paris, meinen Canto Athen. Ich begriff, daß Agitprop, fast nur geschmäht in meiner Umgebung, woanders hinführen kann. Mein Engagement für die Unterdrückten, die Minderheiten, die Dritte Welt brachte mich zur Jugend, manche Altersgenossen unter den Schriftstellern wandten sich von mir ab, dafür erlebte ich Augenblicke inmitten der Jungen, wie sie Majakowski auf dem Roten Platz in Moskau hatte, als er vor den Zehntausenden seine Gedichte las.
Fühmann: Sehn Sie – und ich habe schmerzlich vermißt, daß bei uns die politische Dichtung versiegte. Nachdichtungen, gut, aber Originäres entstand nicht, das brachten unsere Generation und die Älteren nicht mehr hervor, zumindest nichts Nennenswertes. Die Gründe liegen auf der Hand: Wir versagten vor der literarisch-politischen Bewältigung der eigenen Gegenwart und deren Wurzeln in jüngster Vergangenheit, wie hätten wir da ferne Prozesse, die wir – trotz aller Anteilnahme – letztlich nur aus der Zeitung kannten (also auch immer mit dem Bewußtsein, sie nur unvollständig zu kennen), literarisch bewältigen können?
Ich habe sehr darunter gelitten, kein Vietnam-Gedicht zustande zu bringen, ich habe das monate- und jahrelang erzwingen wollen, doch es wurden nur gereimte Leitartikel daraus, und nicht einmal gute.
Das politische Gedicht, das diesen Namen verdient, konnte erst wieder in der nächsten Generation, die unser Kreuz des Gebrochenseins nicht mit sich schleppte, mit Volker Braun und Wolf Biermann beginnen – und diese Namen deuten die neuen Komplikationen schon an.
Hannsmann: Manchmal hatte ich den Eindruck, Sie – ich spreche jetzt von Ihnen persönlich – lehnten Agitprop überhaupt ab.
Fühmann: Nicht überhaupt, nur den schlechten, wie bei jedem Genre, bloß der schlechte ist leider der häufige.
Hannsmann: Das kleine Thema statt des großen, wie man wohl bei Ihnen sagt.
Fühmann: Ach Gott, das ist auch so eine Pauschalierung, die zu nichts führt. Was ist groß, was ist klein? – Der entlaubte Dschungel Vietnams, das ist ja wohl ein großes Thema, und es gab darüber eine Fülle miserabler Gedichte, und daß in einem Beutelchen Salz menschliches Glück bewahrt sein kann, ist ein kleines Thema, und Majakowski hat es groß gemacht.
Ich bin jetzt durch Sie provoziert, heftig zu widersprechen; zum Beispiel was Sie da vom Mythos als Transportmittel für Agitation gesagt haben, also da schaudert mir: In der Praxis unsres offiziellen Literaturverständnisses wird – wenngleich in der Theorie stets das Gegenteil gesagt wird – Dichtung nur als Transportmittel für Anderes angesehen: für Geschichte, Staatsbürgerkunde, Politik, Ideologie. – Einzelne Ausnahmen, Deutschlehrer auf verlorenem Posten etwa, bestätigen die Regel. – Aber Sie brauchen gar nicht zur Replik anzusetzen, wir verlieren uns sonst. Ich möchte erst mehr von Ihnen wissen. Sie sagten, Sie haben mit poésie pure begonnen – nach dem, was ich von Ihnen kenne, hätte ich das allerdings nie vermutet. Was Sie machen, ist doch immer das Gelegenheitsgedicht – und das ist vom Ansatz her eigentlich das Konträre zu poésie pure.
Hannsmann: Theoretisch kann ich’s wenig begründen. Es war ein weiter Weg, bis ich meine eigene Sprache, meinen Stil, mich selbst gefunden hatte. Ich komme ja aus keiner Schule, bin das, was man literarischen Wildwuchs nennt. Also keine Uni von innen erlebt, keine Germanistik, keine Poetologie, ich habe einfach gemacht, was kam, was ich mußte, die ersten Lehrer waren die Klassiker im Schullesebuch, die späteren, nun ja, das waren Männer, moderne Lyriker, denen ich als zeitweilige Weggefährtin meinen Gesellenbrief verdanke. Allerdings haben die vielerlei Brüche, die meine Generation mitmachen mußte, ihre Spuren hinterlassen. Die Verunsicherung: kaum daß ich mich orientiert hatte, galt wieder etwas Neues, man experimentierte wild vor sich hin, die Ismen lösten in einem irrsinnigen Tempo einander ab, ich lebte ja in einer offenen Welt, Einflüsse aus Frankreich, dann Pop, die Beatniks aus den USA, all das überschlug sich, ich selbst aber war viel zu durchlässig, stand immer noch im Banne des unübersehbaren Nachholebedarfs dessen, was meiner Generation durch die Nazizeit entgangen war. Ich fing völlig Unnötiges in meinen Netzen und schüttete Kinder mit Bädern aus, bis ich einigermaßen begriff, wo mein eigener Weg langgeht.
Fühmann: Das haben wir nun wieder gemeinsam, aber wieder auf diese vertrackte Weise, die unser deutsch-deutsches Verhältnis bestimmt. Es ist ganz seltsam, wir sind zueinander so etwas wie zwei Pole eines auseinandergeschnittenen Widerspruchs, dem sein Wesen fehlt, nämlich die Einheit, in der sich ein Widerspruch ja erst bewegt. Natürlich formieren sich auf diesen beiden, von der historischen Entwicklung her notwendig gegebenen Basen dann jeweils neue Widersprüche, aber gestockt, gehemmt, unentwickelt, und das bringt dann für beide Seiten Leerlauf und viel Sterilität.
Sie sagten: ein Zuviel an Eindrücken, Reizüberflutung, zu rasende Folge der Ismen; bei uns war und ist wieder ein Mangel daran, und der hat seine Folgen bis ins Heute und Morgen. Ich will nun hier nicht quantifizieren, dies gegenseitige Aufrechnen von mehr oder weniger Plus und weniger oder mehr Minus hüben und drüben ist ja so ziemlich das albernste Spiel, das man treiben kann; das Wesentliche scheint mir zu sein, daß wir beide, drüben wie hüben, und jeder auf seine spezifische Weise, das Problem der Selbstfindung auferlegt haben, staatlich wie individuell, und es nicht bewältigen können. Jedenfalls ist das mein Hauptproblem.
Hannsmann: Aber es ist doch jedenfalls bei Ihnen zu einer viel geschlosseneren, einheitlicheren Gruppe von Lyrikern gekommen und ich sehe es auch als einen Vorteil an, daß sie nicht so all diesen Einflüssen und Anfechtungen offengestanden hat und sich dafür etwas gewählt hat, das bei uns mit einem Tabu belegt war, das völlig out war, nämlich den Mythos; ich komme nun wieder auf ihn zurück. Bei euch wurde der als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches genommen –
Fühmann: Das stimmt nur sehr bedingt, der Begriff war viel zu sehr durch die Nazis belastet.
Hannsmann: Aber die Märchen –
Fühmann: Das ist etwas Anderes.
Hannsmann: Es sind zu viele Fragen auf einmal –
Fühmann: Eigentlich immer nur andre Aspekte.
Aber Sie haben gewiß mit der Feststellung recht, daß der Ausgangspunkt der Literatur in der DDR, und vielleicht besonders ausgeprägt in der Lyrik, sehr viel einheitlicher gewesen ist. Das liegt einfach an den politischen Umständen.
Schaun Sie, die Schriftsteller, die in die damalige Sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR, gegangen und dann dort geblieben sind, das waren von Haus aus ja alles Leute, die einig waren in einem bestimmten politisch-sozialen und auch poetologischen Programm. Die waren sich einig darin, daß die Dichtung etwas bewirken solle, und zwar im Sinn ihrer politischen Ambitionen, die waren sich einig im engagé, die waren sich einig in striktester Ablehnung von l’art pour l’art, die waren sich einig in dem, was man „operativen Charakter“ von Dichtung nennt. Gewiß gab’s da auch immer Nuancen; Stephan Hermlin etwa hatte da immer sehr viel freiere und – sagen wir für die fünfziger Jahre ruhig: Franz Fühmann sehr viel engere Auffassungen, doch im Grund waren wir, diese Schriftsteller, alle einig im Prinzip der Unterordnung der Dichtung unter die Politik, im Sinn des vielzitierten Wortes: In erster Linie bin ich Kommunist, und erst in zweiter Linie bin ich Schriftsteller (Maler, Komponist usw.). Nun ist Schriftsteller sein, sind Dichtung und Kunst – wenn sie es sind – nicht etwas, das „in zweiter Linie“ ist; Poesie ist entweder souverän oder surrogathaft, aber bis zu dieser Erkenntnis war der Weg weit, steinig, mühsam, ein „arger Weg der Erkenntnis“, und von der Erkenntnis in die Praxis war und ist dies alles dann noch potenziert. Hier bildeten sich die Differenzierungen aus, die jene einheitliche Gruppe nun deutlich in Gruppierungen teilten, die vielleicht schon im Anfang angelegt waren. Allein es kommt alles auf die Werke an, die entstehen, und diesen Prozeß als Prozeß darzustellen wäre Aufgabe einer Geschichte der Literatur der DDR.
Jetzt nur soviel, daß in diesen Differenzierungsprozeß ein neues Moment durch jene kam, die unsern Bruch, unsre crux, nicht kennen, die in der DDR aufgewachsen, in sie hineingeboren sind, im Sinn von etwas Schicksalhaftem. Wir hatten die Möglichkeit der Wahl; ich glaube, daß Jeder all der Jahrgänge bis zu den heute Vierzigjährigen die Möglichkeit hatte und noch hat, frei zu entscheiden, wo er leben und wirken will. Die „Hineingeborenen“ haben diese Wahl nicht; und bei dieser Generation ist nun alles da, was eben von menschlicher Anlage her in der Dichtung – ich möchte fast sagen: „naturgemäß“ – da ist, nicht eine Selektion wie bis in die sechziger Jahre bei uns. Und daß diese junge Generation ihre spezifischen Probleme und viel zuwenig Gelegenheit hat, sie artikulieren zu können, das ist eine der Fragen, mit der unsre Gesellschaft nicht und nicht und nicht fertig wird; für mich eine der quälendsten Fragen. – Übrigens auch wieder eine der Selbstfindung. – Und nun kommt als doppeltes Nachholebedürfnis diese Vielfalt der Ismen hoch, und da sie für die meisten nicht als Möglichkeit kommt, die Wahl ihrer Lektüre frei zu treffen, fließt auf die ärgerlichste Weise ein Schwall von Zweit- und Drittrangigem ein, das der Zufall halt irgendwie vermittelt, das aber als erstrangig angestaunt und nachgemacht wird – man kennt halt nichts Andres.
Aber das ist ein zu weites Feld.
Hannsmann: Wenn wir nun wieder zum Mythos zurückkommen, möchte ich mich nicht mehr allzusehr ins Historische verlieren. Sie schreiben keine Gedichte mehr, aber Ihre Herkunft können Sie nicht verleugnen. Sie erzählen nun also in Prosadichtungen den Mythos neu, den „Prometheus“, die „Ilias“, die „Odyssee“, oder die Geschichte von der Schindung des armen Marsyas. Haben Sie das getan, um etwas zu bewahren, daß es nicht dem Gedächtnis entschwindet?
Fühmann: Anfänglich schon. Das klassische Altertum ist ja eine der Wurzeln unsrer Kultur, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, und es ist mein Traum gewesen, die großen griechischen Mythen in einem Punkt zu versammeln und von einem Punkt aus zu erzählen, das wäre aus der Figur des Prometheus gewesen und hätte von Uranos und Gaia über Alkestis und das Goldene Vließ bis zu den Bacchantinnen und Odysseus gereicht. Das Ganze war auf fünf Bände hin konzipiert; einen hab ich zustande gebracht, und ich werde mich damit abfinden müssen, daß er vereinzelt bleiben wird. Ich müßte zumindest zehn Lebensjahre drangeben, und ich bin nun einmal kein Epiker, ich kann meine Herkunft in der Tat nicht verleugnen, produziere schneckenhaft langsam, nämlich zeilenweise als Tagwerk, und mir brennt so viel Andres unter den Nägeln, darunter auch das, was dann zu den Erzählungen um den „Marsyas“ geführt hat. Das kann man nicht für Kinder machen, da muß man sich souverän bewegen, und der „Prometheus“ war ja für Kinder gedacht.
Im „Marsyas“ war keine didaktische Absicht, da war ganz direkte Betroffenheit, die Erfahrung von Künstlerproblematik, auch wieder dies Selbstfindungsproblem. Man mißversteht das bei uns zu häufig, vor allem die jungen Leute glauben, das sei eine politische Schlüsselgeschichte und ich hätte mich bloß nicht getraut, das „direkt“ zu schreiben. – Nun, wenn ich etwas direkt sagen will, dann sag ich’s. – Natürlich fließt auch Politisches ein, aber eben nur auch. – Marsyas ist die Problematik des Sich-Entblößens; wenn man schreibt, in der Öffentlichkeit als Schreibender steht, wird einem die Haut abgezogen, das wissen Sie so gut wie ich. Nun gibt’s exhibitionistische Naturen, denen das Lust bereiten mag; ich gehöre nicht zu ihnen, für mich ist es qualvoll, von mir zu reden, doch ich muß es tun. Natürlich, ich wiederhole es, natürlich spielt auch Quälen des hinein, das von der Gesellschaft herkommt.
Diese Geschichte ist übrigens Heinrich Böll gewidmet, und das gewiß nicht zufällig.
Hannsmann: Und den Marsyas darf ja jede Generation für sich neu beanspruchen und entdecken. Ich wollte jetzt die Frage nach den Jungen stellen, die haben Sie schon vorweggenommen, so frage ich nach einer anderen Gruppe, die, glaube ich, auch mit dem Marsyas zu tun hat, denen die Haut ihrer Heimat abgezogen ist. Ist mein Eindruck richtig, daß einige der Dichter, die Ihr Land verlassen haben, weil sie meinten, daß sie unter den Bedingungen dort nicht mehr schreiben konnten die sich nach der „westlichen Freiheit“ sehnten – ist also mein Eindruck richtig, daß die unter den Bedingungen, die bei uns herrschen, keineswegs so viel glücklicher und besser dran sind, sondern daß sie auf so etwas wie eine imaginäre Mauer starren, weil sie weder hier noch dort mehr zu Hause sind?
Fühmann: Frau Hannsmann, ich kann Ihnen das für meine Kollegen nicht beantworten, ich habe kein Recht, für sie zu sprechen, das müßten Sie sie schon selber fragen. Was ich aber sagen kann und auch sagen will: daß ich jeden einzelnen Weggang – und nicht alle meine Kollegen sind ja freiwillig gegangen – als einen Verlust für uns bedaure, und daß er mich schmerzt, als einen Verlust für mein Land, nicht für irgendeine Gruppierung. Und zum zweiten: Ein Künstler ist verantwortlich für das Talent, das ihm die Natur mitgegeben hat. So reich daran ist die Menschheit nicht, ist Europa nicht, ist keines seiner Völker. Wem ein Talent gegeben ist, dem ist es für sein Werk gegeben, zur Hervorbringung, nicht zur Unterdrückung, nicht, daß er es in eine zweite Linie stelle, in Reih und Glied, darin alle gleich sind. – Ein Werk ist immer ein Neues, nicht ein Gleiches. – Das Werk ist das, was bleiben kann; nur danach wird der Künstler beurteilt werden, und für sein Werk muß er wissen, was er tut oder läßt. Natürlich muß er für alles auch zahlen, und manchmal hart. Das gilt im Kleinen wie im Großen, von der Rücksichtnahme auf einen Familienangehörigen bis hin zu Konflikten mit seiner Gesellschaft, und diese Entscheidungen sind nicht delegierbar; daß sie es seien, das ist ja auch so ein Irrtum gewesen, zu dem genügend Erfahrung gesammelt ist. Wem ein Talent in die Wiege gelegt war, der trägt dafür die Verantwortung, und wer die Verantwortung trägt, entscheidet, auch darüber, wo er leben und wirken will. In jeder seiner Entscheidungen kann der Künstler sich irren; er kann furchtbare Fehlentscheidungen treffen, er kann sich möglicherweise selbst zerstören und mit seinem Werk an dem Felsen scheitern, den er für sein Rettendes hielt. Doch das gehört zu dem Risiko, das unser Beruf nun einmal hat, und ich will auch sagen: Gott sei Dank hat. Wir stehn für uns selbst in Eigenverantwortung, in jeder Zeile, die wir schreiben, und in jedem Schritt, den wir dafür tun.
Hannsmann: Und war es nicht eigentlich immer so, daß Lyrik ebensosehr – wenn nicht unendlich viel mehr – aus der Enttäuschung und aus der Verzweiflung wächst als aus der Hoffnung?
Fühmann: Ich glaube, große Dichtung kann aus jedem Gefühl wachsen, wenn es nur das bezwingende für einen Künstler wird. Das kann die Verzweiflung sein, aber das kann ebenso gut die Hoffnung sein; die Wertigkeit liegt in dem, was er daraus macht, was dieses Gefühl ihm abverlangt. Es ist ganz dumm, dekretieren zu wollen, ein Gefühl oder eine Haltung sei an sich schlecht oder gut. Bei uns war das so in den fünfziger und sechziger Jahren – oder besser: da galt es exzessiv, heute nur noch prinzipiell –, da hatte die sozialistische Lyrik von Grund auf optimistisch und fröhlich zu sein, und dann kamen die Gedichte der Sarah Kirsch oder das Nachdenken über Christa T., und da war dann die Kritik schon mit der Feststellung geleistet, das sei ja pessimistisch und traurig, also zu verwerfen. – Immer weg damit. – Ich bin damals für die Sarah eingetreten, das wissen Sie ja. Ein Dichter hat ein Recht auf seine Verzweiflung, aber auch ein Recht auf seine Hoffnung, wenn er sie hat und wenn sie ihn trägt – ich muß ja gerade Ihnen nicht die Namen Pablo Neruda oder Paul Eluard nennen.
Aber ich möchte noch einmal auf eine Bemerkung zurückkommen, die Sie zu dem Marsyas gemacht haben: Die Haut der Heimat abgezogen. Ebendas ist mir einmal geschehen, und ich will mit leiser Stimme hinzufügen: Ich hätte Angst vor einem zweiten Mal. Meine Heimat war das Riesengebirge, das war die Landschaft meiner Kindheit, und das ist ja auch immer die Landschaft, in der man als Lyriker sich bewegt, von da stammen die Bilder, die Metaphern – diese Landschaft kann natürlich ebenso die der Stadt sein – und daß ich die verloren habe, und keine neue gefunden habe (auch meine Hoffnung, sie im Bergwerk zu finden, ist wohl gescheitert), hat natürlich auch mit dem Verlust des Gedichts zu tun. Dieses Riesengebirgstal war allerdings eine extrem provinzielle Landschaft, abgeschieden, eingeschlossen von vier Bergzügen, aber es war halt meine Landschaft, und meine Gedichte wurzeln da. Dann kam die Umsiedlung, die ich historisch bejahe, eine andere Lösung war wohl nicht möglich, dann sah ich diesen Mißbrauch der Heimatgefühle, dies Treiben der Landsmannschaften oder wie die heißen, dies kaltschnäuzige Kalkül ihrer Führer mit etwas, darin am Anfang gewiß Trauer und Schmerz schwang und das dann zur Operette und Farce wurde, zur gefährlichen Farce falschen Erinnerns, und da hab ich es mir gewissermaßen verboten: ich wollte diese Landschaft nicht mehr in meiner Lyrik weitertragen. Es war meine Entscheidung, wahrscheinlich eine falsche, denn es gibt ja das Beispiel Johannes Bobrowski, der es verstanden hat, seiner litauischen Heimat, diesem kleinen Stück Land, ein Werk abzugewinnen, vor dem ich mich bewundernd verneige.
Hannsmann: Und der märkische Wald, darin Sie jetzt leben, ist der nicht für Sie Heimat geworden?
Fühmann: Ersatz; nicht die Landschaft meines Herzens, nicht die Landschaft, aus der Dichtung wachsen könnte, obwohl ich dankbar bin, daß ich dort leben kann und die Leute mich hinnehmen, wie ich bin. Ein paar Wurzeln sind schon eingewachsen, aber Gedichte treiben sie nicht. Es ist die Landschaft Peter Huchels, nicht meine – und der sitzt nun in Schwaben, in Ihrer Landschaft.
Hannsmann: Der Landschaft Hölderlins, der nie in Griechenland war – sein Griechenland ist die Schwäbische Alb –, der Landschaft, die nun zugrunde geht und niemandem mehr Heimat ist.
Das Land ist zubetoniert, die Wiesen und Wälder sind zerstückelt, die Äcker in Fabriken verwandelt, die Dörfer zu Städten zusammengeschlossen – überall, wo das Land am billigsten war, zog man die Bauten hoch ohne Rücksicht auf das, was in Jahrhunderten gewachsen war. Es ereignete sich allmählich. Man merkte es immer zu spät. Im Laufe eines Jahrzehnts wurde die Landschaft, in der ich den zweiten Weltkrieg erlebte, schlimmer zugerichtet als durch die Bombenangriffe.
Da ist schon nichts mehr wiedergutzumachen. „Wachstumsrate“ heißt das magische Wort, dem niemand widerstehen kann; dahinter verbirgt sich nichts anderes als Habgier und Profitsucht. Projektmanagementteams haben ein Raster über unser Land gelegt, darin auch noch das letzte Stück Natur vermarktet wird; Planquadrat um Planquadrat ist alles genau festgeschrieben in den „Flächennutzungsplänen“. Jeder Widerstand, jedes Engagement wird mit dem Wort „Arbeitsplatzsicherung“ zu Fall gebracht. Für mich gibt es keine größere Lüge als dieses Wort, tagaus, tagein werden mehr Arbeitsplätze wegrationalisiert als neue geschaffen, und die Rationalisierung dient nur dazu, Überflüssiges für eine Überflußgesellschaft zu produzieren. Ich sehe Pflanzen aussterben, die jahrhunderttausendelang blühten, Tiere verschwinden für immer, die jahrhunderttausendelang über die Erde liefen. Für sie schreibe ich jetzt meine Gedichte. Ich weiß, sie können keinen Bagger aufhalten. Und doch fangen sich Kräfte an zu regen, Bürgerinitiativen tun sich zusammen, die Reste zu retten, Straßengroßbauten, Verkehrskreisel zu stoppen, die Begradigung der allerletzten noch mäandernden Flüsse zu verhindern, den Ausverkauf von Bergen und Seen, Stränden, Buchten. Ausgesperrt von den Reservaten der Herrschenden, wachen sie auf; noch sind es wenige. In zwanzig Jahren, haben sie ausgerechnet, wird jeder Quadratmeter Boden zwischen Schillers Geburtshaus und Hölderlins Grab mit Beton bedeckt sein, wenn wir so weitermachen wie in den letzten fünf Jahren. Das gilt nicht nur für die Schwäbische Alb, von überallher erreichen mich Briefe, Zuschriften auf meine Gedichte: Meinen Sie etwa die Eifel? Den Taunus hinter Frankfurt, wo es schon keine Margeritenwiese mehr gibt? Meinen Sie die Lüneburger Heide? Das Land um Hamburg? Um München? Wir wollen, daß der Wald wieder Wald heißt und nicht Naturpark. Wir wollen, daß unsere Kinder noch die Natur als Abenteuer erleben statt des sterilen Abenteuerspielplatzes, auch der Mensch braucht Biotope, ein Käfer stirbt aus, wenn ihm eine gewisse Anzahl von Quadratmetern als Lebensraum fehlt, der Hase braucht schon Kilometer. Dort, wo ich nach dem zweiten Weltkrieg einen Kohlkopf, eine Kartoffel, einen Apfel bettelte für meine Kinder und leer ausging, gibt es längst keinen Quadratmeter Erde mehr, um Nahrung anzubauen.
Fühmann: Ich habe das ja alles gesehen, Sie haben mich ja durchs Land gefahren, haben mir vom Filderkraut erzählt, diesem einzigartigen Gemüse, das in alle Welt ging und das nun unterm Beton ist – aber ich kann dazu jetzt gar nichts sagen, hab viel zuwenig darüber nachgedacht. Gefühle allein bringen ja nicht weit, und das Dümmste, was ich sagen könnte, wäre ein Ätsch! der Schadenfreude aus einer Landschaft her, die noch nicht zubetoniert ist, mit Straßen, wo noch Alleen stehen, aus einem Wald, der noch ziemlich heil ist, mit Heidekraut und Pilzen und Rehen und Dachsen und Storchennestern auf den Dächern – nein, die Landschaftsbedrohung greift ja auch bei uns zu, und Menschheitsprobleme gehn alle an. Wir sollten voneinander wissen, in einer saubren Informiertheit, und ich möchte unter dem „wir“ nicht bloß uns kleine Gilde der Poetenbrüderschaft verstehen, die das Schicksal nicht in den Taygetos geschmissen hat. Wir sind Einzelne, ja Vereinzelte, wir repräsentieren schon längst nichts mehr, doch wir sollten uns als Stellvertreter fühlen.
Ich bin froh, mit Ihnen gesprochen zu haben, Margarete Hannsmann.
Hannsmann: Ich auch, danke schön, Franz Fühmann.
PS:
Erst bei der Schlußredaktion dieses Gesprächs merkte ich, daß der Satz Adornos unerörtert geblieben war. Ich möchte diese Erörterung jetzt nicht fingieren, und es scheint mir am redlichsten, zwei berufene Stimmen zu ihm zu zitieren: Hans Magnus Enzensberger, der ihm erwiderte, und Adorno selbst, der darauf einging. Das, was da gesagt wurde, ist gültig; und wenn es mir einmal gelingen sollte, ein Meines hinzuzutun, wird das ein Aufsatz für sich.
F. F.
Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einen Satz ausgesprochen, der zu den härtesten Urteilen gehört, die über unsere Zeit gefällt werden können: Nach Auschwitz sei es nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben. Wenn wir weiterleben wollen, muß dieser Satz widerlegt werden. Wenige vermögen es. Zu ihnen gehört Nelly Sachs. Ihrer Sprache wohnt etwas Rettendes inne. Indem sie spricht, gibt sie uns selber zurück, Satz um Satz, was wir zu verlieren drohten: Sprache. Ihr Werk enthält kein einziges Wort des Hasses. Den Henkern und allem, was uns zu ihren Mitwissern und Helfershelfern macht, wird nicht verziehen und nicht gedroht. Ihnen gilt kein Fluch und keine Rache. Es gibt keine Sprache für sie. Die Gedichte sprechen von dem, was Menschengesicht hat: von den Opfern. Das macht ihre rätselhafte Reinheit aus. Das macht sie unangreifbar. Wer aber hätte das Recht und die Kraft zu einem solchen Schweigen, der nicht selbst ein Opfer wäre? Solange die Mörder noch unter uns sind, müssen wir andern sie ausrufen; solange leben wir „in finsteren Zeiten“, „wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“. So schrieb Bertolt Brecht, der selber ein Opfer war. Die Erlösung der Sprache aus ihrer Verzauberung steht bei denen, die In den Wohnungen des Todes waren. Sie wissen es und können uns sagen, daß jene Wohnungen immer noch da sind, in uns.
Hans Magnus Enzensberger: „Die Steine der Freiheit“; in: Einzelheiten, Frankfurt/Main 1962
„Den Satz, nach Auschwitz noch Lyrik zu schreiben, sei barbarisch, möchte ich nicht mildern; negativ ist darin der Impuls ausgesprochen, der die engagierte Dichtung beseelt. Die Frage einer Person aus“ (Sartres) „,Morts sans sépulture‘: ,Hat es einen Sinn zu leben, wenn es Menschen gibt, die schlagen, bis die Knochen im Leib zerbrechen?‘ ist auch die, ob Kunst überhaupt noch sein dürfe; ob nicht geistige Regression im Begriff engagierter Literatur anbefohlen wird von der Regression der Gesellschaft selber. Aber wahr bleibt auch Enzensbergers Entgegnung, die Dichtung müsse eben diesem Verdikt standhalten, so also sein, daß sie nicht durch ihre bloße Existenz nach Auschwitz dem Zynismus sich überantworte. Ihre eigene Situation ist paradox, nicht erst, wie man zu ihr sich verhält. Das Übermaß an realem Leiden duldet kein Vergessen; Pascals theologisches Wort „On ne doit plus dormir“ ist zu säkularisieren. Aber jenes Leiden, nach Hegels Wort das Bewußtsein von Nöten, erheischt auch die Fortdauer von Kunst, die es verbietet; kaum wo anders findet das Leiden noch seine eigene Stimme, den Trost, der es nicht sogleich verriete. Die bedeutendsten Künstler der Epoche sind dem gefolgt. Der kompromißlose Radikalismus ihrer Werke, gerade die als formalistisch verfemten Momente, verleiht ihnen die schreckhafte Kraft, welche hilflosen Gedichten auf die Opfer abgeht. […] Indem noch der Völkermord in engagierter Literatur zum Kulturbesitz wird, fällt es leichter, weiter mitzuspielen in der Kultur, die den Mord gebar. Untrüglich fast ist ein Kennzeichen solcher Literatur: daß sie, absichtlich oder nicht, durchblicken läßt, selbst in den sogenannten extremen Situationen, und gerade in ihnen, blühe das Menschliche; zuweilen wird daraus eine trübe Metaphysik, welche das zur Grenzsituation zurechtgestutzte Grauen womöglich insofern bejaht, als die Eigentlichkeit des Menschen dort erscheine. Im anheimelnden existentiellen Klima verschwimmt der Unterschied von Henkern und Opfern, weil beide doch gleichermaßen in die Möglichkeit des Nichts hinausgehalten seien, die freilich im allgemeinen den Henkern bekömmlicher ist.“
Theodor W. Adorno: „Engagement“; in: Noten zur Literatur III, Frankfurt/Main 1965
Aus Franz Fühmann: Essays, Gespräche, Aufsätze 1964–1981, Hinstorff Verlag, 1993
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Manfred F. Kubiak: Warum die Heidenheimer Schriftstellerin in ihrer Heimatstadt nicht immer geliebt wurde
Heidenheimer Zeitung, 9.2.2021
Fakten und Vermutungen zur Autorin + IMDb + Archiv

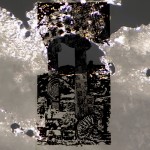












Schreibe einen Kommentar