28. Juni
Die kürzesten … die hellsten Nächte im Jahresverlauf, verhängt von den rieselnden, im Dunkel silbrig schimmernden Schnüren eines Landregens, der seit Tagen freundlich niederkommt und Fäulnis bringt. Unter meinen Apfelbäumen häufen sich die unausgewachsenen fleckigen Früchte, die Blätter sind in sich gekrümmt, angegilbt, von Schädlingen gelöchert. Durchs Geäst weht süßer Verwesungsgeruch. Alles, was Flügel hat, hält sich geduckt, versteckt. Der Wald, den ich weiterhin täglich begehe, trieft von lauem Regenwasser, zwischen den Stämmen lehnt träg die feuchte Luft. Ich raste vor der Hütte des Forstwarts, mit dem Rücken an die durchnässten Rundbalken gelehnt und mit Lust auf nichts. – Nochmals zu Dostojewskij: Gäbe es keinen Gott, wäre alles erlaubt. Mit Blick auf die Welt und die Geschichte könnte man wohl replizieren: Da alles erlaubt ist (es geschieht ja), gibt es keinen Gott. – Arthur Schopenhauer zu lesen, ist für mich ein Fest mit grandiosem Feuerwerk und unvermeidlichen misstönenden Krachern. Mit dem Buch zu beginnen: Allein schon die kleinen flexiblen Bände der Großherzogausgabe in der Hand zu halten, ist eine sinnliche Erfahrung besonderer Art – Format, Gewicht, Papier, Layout, Einband usf. erbringen, noch vor der Lektüre, ein gleichsam materielles Lesevergnügen. Das intellektuelle Vergnügen folgt sogleich. Schopenhauers Gelehrsamkeit und Sprachenkompetenz – er zitiert Griechisch, Lateinisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Sanskrit im Originaltext – kommen mit umwerfender Selbstverständlichkeit daher; sein Stil, seine Rhetorik ist von höchster Souveränität und Eleganz; die sprachliche Fassung komplexer Inhalte und hochdiffiziler Überlegungen ist bewundernswert, wird wohl erst wieder von Nietzsche, von Freud erreicht; sein Witz, sein Sarkasmus, seine Geistesgegenwart, seine Wahrnehmungsschärfe verbinden sich zu großer Literatur – auf jeder Seite gibt es bei Schopenhauer Einzelbeobachtungen und Einzelbemerkungen von unvergleichlicher Prägnanz, derweil das große Ganze seines Denkens und Wollens eher nebulös bleibt. Staunenswert ist sein vehementer Einsatz für den Tierschutz, vom domestizierten Hund bis zum Käfigvogel, erhellend seine (beliebig vielen) Notate zur Alltagswelt. Im Kontrast dazu kolportiert Schopenhauer – und da kommen die Misstöne auf – die widerwärtigsten Klischees, hält billigste Vorurteile hoch, bekräftigt hanebüchene Vorurteile – über »die« Deutschen, »das« Französische, »die« Weiber, »die« Puritaner, »die« Presse, »die« Literaturkritik, »die« Spießer usf. Die Verbindung von Genialität und Schwachsinn bleibt mir, hier wie bei Nietzsche oder Heidegger oder Derrida, unbegreiflich. – Seit jeher kommen mir noch jedes Mal, wenn ich ein heißes Bad nehme, unabweisbar zwei völlig unterschiedliche Gedanken – erstens der Gedanke an den Märtyrer Laurentius, wie er lebendig … wie er schön langsam im Öl gesotten wird; zweitens der Gedanke an die vielen … an Millionen von Zeitgenossen, die weder Bad noch Dusche kennen, die in Slums, in Flüchtlingslagern oder in verwüsteten Erdbebengebieten leben. Ich fürchte, ich verrate mich durch solche Gedanken als einer, der interesselos, schuldlos, unverdient, ungewollt, unverhofft bislang verschont geblieben ist. – Wie sehr ich auch bei Lesungen oder in Aufsätzen die Schwierigkeit meiner literarischen Sachen, vor allem der Gedichte zu relativieren, sogar ins Gegenteil zu wenden versuche – es gelingt nicht; es kann nicht nachhaltig gelingen, weil es immer bequemer sein wird, das konventionell in aller Sprache Mitgegebene, also das Gemeinte, Bedeutete, das hinter oder zwischen den Wörtern Vermittelte zu »verstehen«, als hinzusehen, hinzuhören auf das, was geschrieben steht. Was dasteht, kann doch immerhin jeder lesen, und was da zu lesen ist, braucht auch gar nicht im üblichen Verständnis bedeutungsmäßig begriffen zu werden, um dennoch Sinn zu machen. – Den Mob … die gängige Meinung, die aktuelle Stimmung lernt man besonders genau kennen am Leitfaden von Internetkommentaren und Leserbriefen. Jede Art von verbaler Aggressivität und Borniertheit kommt hier weitgehend unbehelligt in kaputter Sprache zum Zug – Beschimpfung, Verhöhnung, Verwünschung, Mobbing, Drohung, Vorurteil, Gemeinplatz, aber auch kritiklose Belobigung. Für Abweichler jeglicher Gattung und Herkunft empfiehlt ein anonymes Kollektiv von Normalverbrauchern im Internet alle möglichen Formen von Ausgrenzung – der Ruf nach Retorsion, Verwahrung, Abschiebung, Säuberung, Liquidierung, Brandmarkung usf. verbindet sich hier auf erschreckende Weise mit dem alten, immer wieder neu artikulierten und anders adressierten Ruf nach Ruhe und Ordnung. – Der Dichter Karol Kröpke, der 1970 mit eklatantem Erfolg sein erstes und einziges Buch vorlegte, ist heute kaum noch dem Namen nach bekannt und hat auch in der Literaturgeschichte keine Spur hinterlassen. Als ›Bürgerliche Gedichte‹ präsentierte Kröpke damals – scheinbar unverfänglich, in Wirklichkeit zumindest latent klassenkämpferisch – eine fünfzehnteilige Sequenz pornografischer Lyrik, die nach wie vor als Meisterwerk dieses schwierigen Genres gelten kann. Mit kaltem rhetorischem Furor wird hier, eins nach dem andern, jedes Register sexuellen Tuns vergegenwärtigt und zynisch abgehakt. Von Lust ist dabei keine Rede, von Gewalt umso mehr; oder vielleicht sollte man sagen, dass in diesen Texten Gewalt und Lust in eins fallen, dass der »bürgerliche« Geschlechtsakt konsequent als ein Akt von Gewaltanwendung vorgeführt wird, egal, ob es sich um Homophilie, Sodomie, Onanie, Pädophilie, Nekrophilie oder was auch immer handelt. Die Brutalität des »Liebemachens« findet bei Kröpke (dessen wahrer Name – Karl Krolow – für eine ganz andere Art von Lyrik steht) voluntaristischen Ausdruck, sie baut auf den Willen und die Kraft der Akteure, lässt keinerlei Form von Spielerei, von Laisser-faire, gar von Dekadenz aufkommen, beschränkt sich vielmehr auf eigens berechnete und konsequent durchgeführte Übergriffe potenter Täter auf zumeist wehrlose Opfer. Mag sein, dass Kröpke-Krolow als Sympathisant der 68er-Bewegung eben diese Asymmetrie der sexuellen Beziehung, die Partnerschaft durch Ausbeutung und Unterwerfung pervertiert, für spezifisch »bürgerlich« gehalten hat.


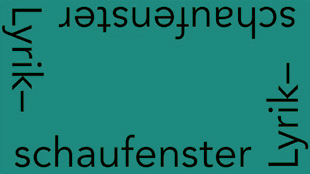
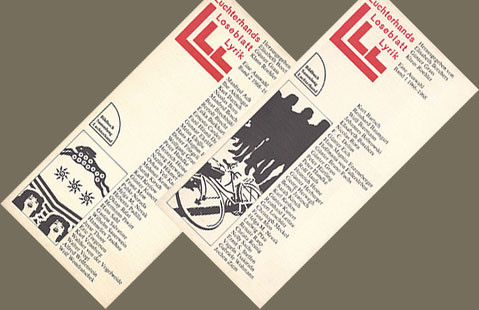



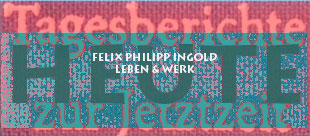
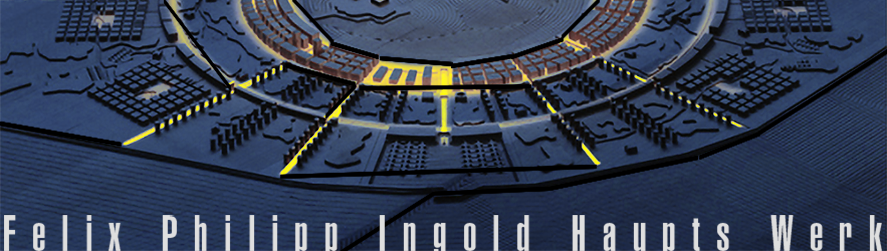
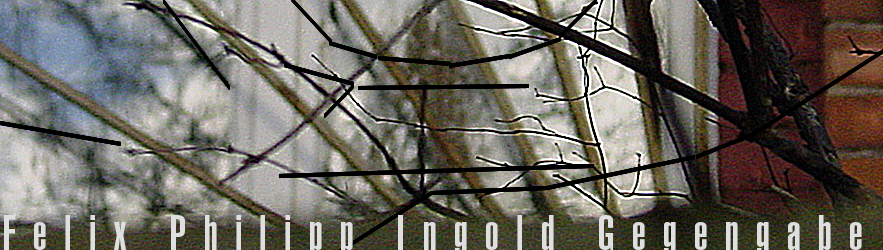
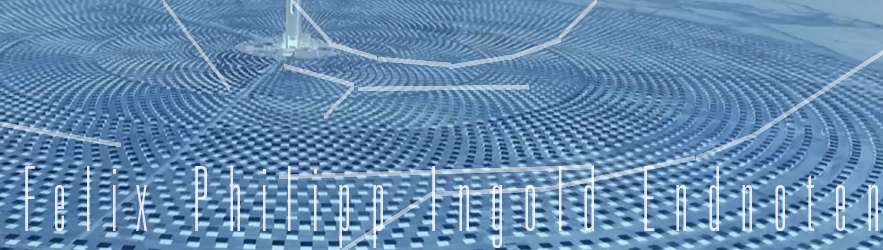

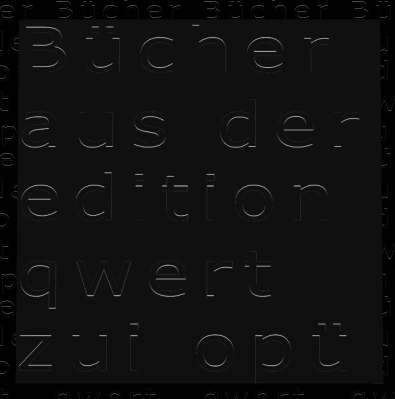
Schreibe einen Kommentar