26. Juni
Wach um halb sechs, der Tag ist schon da … ist schon so lichtvoll da, dass ich mir vorsorglich die Augen reibe, um mich zu vergewissern, ob es wirklich über Nacht geschneit hat. Doch die Weiße ist transparent, die Helle sieht bloß so aus, als wäre sie die Abstrahlung von frischem Schnee. Das »Als-ob« mag eine Möglichkeitsform sein, doch als solche macht sie einen Großteil der sogenannten Wirklichkeit aus. – Ich bin für zwei Tage in der Klinik, um mir eine hässlich vorstehende Geschwulst am Rücken entfernen zu lassen. Die »gutmütige« Geschwulst hat sich genau an der Stelle gebildet, wo vor Jahren am linken Lungenflügel ein »bösartiger« Tumor entfernt wurde. Damals genügte für die Operation ein Einstich, der Tumor wurde mit der Sonde ertastet, coupiert, dann zwischen zwei Rippen durch ein kleines Loch herausgezogen. Laparoskopie. Diesmal brauchte es – ich liege beim Notieren auf dem Bauch – einen zwölf Zentimeter langen Schnitt in Vollnarkose, um den lästigen Fremdkörper zu beseitigen. Verhältnisblödsinn? So verlässlich geht Quantität vor Qualität! – Zur Zeit studiere ich in Paris oder Prag, befinde mich aber, versteht sich, in Wien. Ich kenne mich schlecht aus, beherrsche die Sprache nicht, halte mich deshalb an das Grand Hôtel, obwohl ich es nur von innen kenne. Innen sieht es aus wie ein riesiger Theaterraum (Theatertraum?), die Halle ist im Stil der imperialen Gründerzeit möbliert, da gibt’s diverse, durch Stellwände voneinander getrennte Podien und Séparées, die Mauern sind mit schweren Teppichen verhängt, die auch als Lendenschürze für gewaltige Karyatiden und als Theatervorhänge dienen. Zuoberst schwebt und knarrt eine Galerie, hinter deren Geländer – das aussieht wie ein zerrütterter Gartenzaun – mehrere Monumentalgemälde an die Wand gelehnt sind, Gemälde, die in realistischer Manier, allerdings überlebensgroß und perspektivisch stark verzerrt irgendwelche Helden oder Heilige darstellen. Hans Ulrich Reck, Kurator des Hauses, verweist auf die zackige Signatur des völlig vergessenen Künstlers: Ed. Bouffet. Das großformatige, auf Leinen gemalte und auf einen viel zu schwachen Rahmen gespannte Bild sei, so erklärt der Kurator, eigentlich als Fresko bestellt worden, der Maler habe aber auf Öl bestanden, und überhaupt müsse diese Geschichte und müsse diese ganze Kunst erst noch erforscht werden. Meinen Weißtee habe ich bereits vor längerer Zeit bestellt, ich seh mich auf einem der Podien, elegant gekleidet, angetan mit Gilet und Krawatte, die Beine übereinander geschlagen, umgeben von leeren Sesseln und einem Sofa à la Récamier, bemerke, wie von hinten ein Schatten über meine rechte Schulter mir auf die Knie fällt, höre, wie eine hohe Männerstimme mit höflicher Insistenz danach fragt, ob all die Sitzgelegenheiten in der Runde »noch frei« seien. »Alles frei«, sage ich, worauf der Herr sich an meine Seite setzt. Er trägt mit fast provozierendem Aplomb, aber doch auch recht stimmig sämtliche Farben, die ich nicht mag – beige, lindengrün, violett. Schon hat er mir eine Zigarre angeboten, einen dünnen vierkantigen Stängel, der eher nach Süßholz duftet als nach Tabak. Der Mann will mich freilich, ich hab’s bereits begriffen, lediglich testen, will wissen, will sehen, ob und wie ich die Zigarre zu stutzen verstehe, mit andern Worten, ob ich als Schwiegersohn in Frage komme. Inzwischen sind die Sitzgelegenheiten in der Runde von lauter Damen besetzt, zwei Kellner im Frack nehmen ihre Bestellungen auf, ich lasse mir die kleine Guillotine reichen und knacke die stumpfe Spitze des Zigarrenstängels. Der Anschnitt ist geglückt, der Stängel zieht nicht, auch nicht, nachdem mir der Unbekannte zum zweiten Mal Feuer gereicht hat. Doch wir sollen nun die Gemächer besichtigen. Tochter Susi kommt mit, ebenso Dorothee, meine künftige Schwiegermutter, die das Hochzeitsgemach einrichten und ausschmücken wird. Von meinem Alter her, 33, bin ich in Ordnung, auch mein Outfit – ich trage den engen dunkelblauen Anzug, der mich so blass und womöglich interessant macht – scheint zu passen, allerdings will bei mir keinerlei Erwartungsfreude aufkommen, und bei Susis Vorspiel auf der Geige zeichnen sich unter ihren Ärmchen bald schon dunkle Schweißringe ab. So schwinden meine Chancen und Sympathien als ihr Prädestinierter rasch genug. Aber ich steh ja auch schon wieder in der Hotelhalle, wo noch immer der Bätschmann doziert und gerade eben der ICE aus Hamburg einfährt. Auf dem Bahnsteig drängen sich die rot uniformierten Boys und reißen sich um das Gepäck der aussteigenden Kandidaten. Zu den Kandidaten gehöre auch ich, und wie sie habe ich keine Aussicht auf irgendein Gelingen oder irgendeinen noch so bescheidenen Gewinn. Was mich an diesem Traum am meisten verblüfft, ist dass ich ihn ausgeträumt habe und … oder dass er sich zu einem überschaubaren Ganzen gefügt hat, obwohl ich zwischendurch viermal aufgewacht (einmal sogar aufgestanden) bin. Dennoch ist der Zusammenhang ohne merkliche Bruch- oder Leerstelle erhalten geblieben. – Aus Schanghai erreicht mich eine Email von Matthias Messmer, der mir beiläufig mitteilt … mir die Frage stellt, ob ich wisse, dass »unser gemeinsamer Freund Alain Berlincourt vor einiger Zeit gestorben« sei. Ich werde gleich zurückschreiben und um mehr Auskünfte bitten. Vor einiger Zeit? Wann genau? Und woran? Wir hatten beide als Funktionsoffiziere unter Berlincourt im eidgenössischen militärischen Geheimdienst gearbeitet, Messmer im Erkundungsbereich China, ich selbst musste damals in den jährlichen »Ergänzungskursen« den sowjetisch-afghanischen Gebirgskrieg aus russischen Quellen dokumentieren. Berlincourt, Sektionschef, leitete meine Übersetzungen und Zusammenfassungen an die Spezialisten im Generalstab weiter. Unvergesslich sind mir die Arbeitspausen, die man gemeinsam im Chefbüro (Bundeshaus Ost) verbrachte, wobei es nicht um den obligaten Kaffee aus dem Thermoskrug ging, sondern um die freiwillige Lektüre – die Rezitation – von Gedichten. Wir »Geheimdienstler« lasen einander Gedichte von Hölderlin, Horaz, Brentano vor. Auch Heinrich Heine. Besonders eindrücklich wurde für mich … unvergesslich bleibt für mich die erstmalige Lektüre des ›Kentauren‹ von Maurice de Guérin in Rainer Maria Rilkes Übersetzung. Berlincourt rezitierte den französischen Originaltext, ich die deutsche Fassung, in der Gruppe wurde darüber geredet. Unsre Lesestunde – zwanzig, bisweilen auch dreißig Minuten – war jeweils rasch vorbei. Übrigens hörte ich dort, »im Dienst«, erstmals von einem französischen Autor namens Jean de la Ville de Mirmont, der zu Berlincourts Favoriten gehörte und von dem ich in der Folge, dank seiner Anregung, das gesamte (sehr schmale) Erzählwerk las. Alain Berlincourt war damals in zweiter oder dritter Ehe mit einer Kasachin aus Almaty verheiratet, einer ebenso klugen wie schönen Frau, deutlich jünger als er, die ihn aber nach der Wende von 1989/1990 ohne irgendeine Erklärung und ohne irgendetwas mitzunehmen verließ. Bald danach erkrankte er schwer, eine klare Diagnose gab es nicht, er selbst nannte seine Krankheit einfach »Schmerz«. Einmal noch haben wir einander – viel später – zum Gespräch getroffen, als er, aus seinem Wohnort Ftan kommend, die Ausstellung meiner russischen Künstlerbücher und Erstausgaben in der Kantonsbibliothek St. Gallen besuchte. Wir redeten … er redete damals über die Philosophie der Zyniker und Skeptiker, die als einzige zu seinem »Schmerz« etwas zu sagen hätten. In der Folge schrieb ich ihm hin und wieder einen Brief, Antwort gab’s keine mehr; seinen letzten Aufenthaltsort, seine Telefonnummer konnte ich nicht mehr eruieren. Es blieb beim Schweigen. Und nun diese Nachricht. – Ich irre durch ein Riesengebäude ohne Tageslicht, durchquere lauter enge Räume, passiere unzählige meist gläserne Türen, verirre mich in Garderoben und Toiletten. Es herrscht ein unsägliches Durcheinander, nachdem hier sämtliche Nummern ausgewechselt worden sind – die Nummern der Büros und Gästezimmer, der Schließfächer, der Etagen, aber auch die Icons zur Kennzeichnung der Abstellräume, Laborräume, Operations- und Geburtssäle. Endlos viele mir unbekannte Leute irren wie ich in dem Gebäude herum; bloß ein einziger von ihnen – ein lässiger Dandy mit Gelfrisur – hat überhaupt so etwas wie ein Gesicht. Der Mann berichtet durch seine Katzenmaske von Reisen und Autos und Frauenhäusern, gibt Tips für den Aufenthalt im östlichen Ausland. Ich soll für drei Wochen nach Russland, ohne eine Ahnung zu haben, wozu und zu wem, reise ab, nehme mir vor, die Galina zu kontaktieren. Bin in Moskau in einem Studentenheim untergebracht, dort soll um elf eine Vorbesprechung stattfinden – ich werde mich für ein Seminar verpflichten müssen (»but in English«), doch es ist noch viel zu früh. Ich geh spazieren, überlege, ob ich eine Konversationslehrerin anheuern soll, mit der ich dann auch Museen, Konzerte, Sportveranstaltungen usf. besuchen würde. Merke aber bald, dass ich mich schon wieder verlaufen habe und dass ich also bis elf keinesfalls zurück sein kann. Frage nun auf der Straße einen jungen Mann, der ein Baby auf den Armen trägt, nach dem Weg zur Uliza Charbera, er weiß sofort Bescheid, tut sich nun aber selber schwer, die Richtung zu weisen. Gleich wird er einen Kollegen fragen, der dort drüben mit einer Gruppe von Bekannten zusammensteht. Ich übernehme derweil das Kind, ein waches intelligentes Ding mit rundem Kahlkopf und hellen guten Augen, bin erstaunt, dass der Kleine fließend spricht, frage ihn nach seinem Namen, er antwortet sofort: Glattfelder, Norech. Lange halte und trage ich den Kleinen nah am Leib auf den Armen, wir reden wie vernünftige Erwachsene miteinander. Ich erzähle ihm von meinen Forschungen im Wolgadelta und flüstere den gleichen Vortrag, mit dem ich auch sonst durch die Welt reise, in sein winziges Ohr. Dabei steigen wir über weitläufige Serpentinen zur Innenstadt hoch, sie krönt den gewaltigen Hügel mit Großbauten aus Backstein, doch mein Heim bleibt unauffindbar. Im Gelände stehn, groß wie Einfamilienhäuser, klotzige, aus Beton gegossene Buchstaben, die insgesamt den Namen oder die Aufforderung oder die Warnung D E M N A E C H S T ergeben. – Meine Verhaltens- und Sprechweise wird oft, zumal in Deutschland, als altmodisch empfunden … als merkwürdig (und unnötig) verlangsamt – lauter Suchbewegungen und Fragezeichen. Mag ja sein. Mag sein, dass auch meine Freundlichkeit bloß ein altmodischer Tick ist. Die kann allerdings, wenn sie strapaziert oder missbraucht wird, rasch in Ärger und groben Zorn umschlagen. Die Verstimmung hält jeweils nur kurz an, nachtragend bin ich nicht, es sei denn im Guten. Hassgefühle verfliegen schnell, bleibt einzig Verachtung; doch Verachtung lässt sich kaum ausleben, man kann sie nur immer wieder rhetorisch aktualisieren. Anders im Umgang mit mir selbst. Da bin ich … da halte ich ungute Gefühle jederzeit wach und leide (weide mich) sinnlos daran. – Es ist ein unangenehm heller Abend, mild ausgestrahlt mit gedämpftem Licht ohne erkennbare Quelle, auch ohne Schatten. Höher im Norden würde daraus eine Weiße Nacht. Ich empfinde die Stimmung eher als katastrophal, eher so, als hätte grade eine lautlose Chemie- oder Atomexplosion stattgefunden und alles wäre nun tödlicher Niederschlag. – Liebe Ursula Krechel, Dank vorab für den schönen Brief, er evoziert gemischte Gefühle, Gedanken. Stichwort: Vergeblichkeit. Ihr anschaulicher Bericht aus dem Literaturinstitut gibt Anlass zur Frage, wozu wir denn also noch unterrichten, lehren, fördern (außer: um zu lernen)? Ist nicht vielleicht das Selbstlernen die bessere Lehre? Und ist man zuletzt – nicht – sich selbst am nächsten als Lehrling und Lehrer? Großartig doch das scheinbar widersinnige Diktum Senecas: »Menschen lernen dadurch, dass sie andern ein Vorbild sind.« Die andern müssen ja nicht gleich die Hölle sein, aber anders sind sie allemal, erkennbar, erreichbar bestenfalls dort, wo der Zufall oder das Missverständnis oder die Hoffnung mithilft. Das ist auch meine Erfahrung als Autor. Jedes meiner Bücher ist zu früh, zu spät, zur Unzeit herausgekommen, und Sie haben sicherlich Recht mit Ihrer Vermutung, dass Leseangebote wie ›Letzte Liebe‹ von 1987 oder mein Kurzroman ›Ewiges Leben‹ von 1991 heute noch weniger goutiert würden als zur Zeit ihres Erscheinens. Anderseits macht Ihre »zufällige«, zeitlich und räumlich versetzte Lektüre deutlich, dass es fürs Lesen keine Unzeit gibt, dass im Akt des Lesens jederzeit Aktualität sich einstellen kann. Mich freut’s, dass diesmal Sie die Leserin waren, dass Sie sich haben ansprechen lassen, ohne von mir angesprochen worden zu sein – die beiden Bücher entstanden ja vor unsrer Zeit, ich meine, bevor wir uns kannten. Ich habe kein Publikum, ich werde kein Publikum haben, ich schreibe auch nicht für ein Publikum, ich schreibe, unbekannterweise, für diese Leserin, für jenen Leser, und nur dort, beim Einzelnen, wird mein Geschriebenes immer mal wieder ankommen. Ich bleibe bei diesem elitären Literaturverständnis. Wie sollte ich – zum Beispiel – Ihre Lesart meiner Sachen ernst nehmen können, wenn ich für ein Publikum oder gar für das Publikum schriebe? »Schon eure Zahl ist Frevel«, heißt es in ›Die tote Stadt‹. Oder beim frevelhaft vergessenen Bruno Bauer: »In der Masse ist der wahre Feind des Geistes zu suchen.« Zu suchen braucht man diesen Feind freilich nicht, er ist’s, der uns – heute weit mehr als damals – unentwegt nötigt, der uns mit Ablehnung oder auch mit Lob provoziert. Dass dieser massenhafte Feind irgendwann irgendwo bei irgendwem das schlichte Bedürfnis zu selbstbestimmter, mithin eigensinniger Lektüre noch einmal wecken könnte, hatte ich lange Zeit gehofft, glaube ich heute nicht mehr. Fort-da! Ich schreibe tatsächlich von mir weg, vor mir her, auf nichts anderes hin als auf den Text, der hier und jetzt unter dieser (meiner) Hand entsteht. Unerwartete argumentative Schützenhilfe finde ich bei Alias (B. Traven u. ä.), der 1919 im ›Ziegelbrenner‹ – Replik auf die Zuschrift einer Leserin – dezidiert festhält: »Ich bin kein Schriftsteller. Ich will nichts anderes sein als: Wort!« Und … aber das Wort kann bloß verlauten, egal, ob’s vernommen, verstanden, missverstanden, abgewiesen wird. Liebe Ursula, ich bleibe noch für eine längere Weile in Zürich, um hier – dem Widerwillen, mich zu lesen, zum Trotz – die Korrekturen zur Anthologie und zum Roman zu erledigen, skizziere nebenher das Konzept zu einem Buch über den russisch-jüdischen Anarchophilosophen Lew Schestow, versuche, mein Tagungsreferat zur Doppelgängerei in ein druckfertiges Skript umzuschreiben, lauter linkshändige Beschäftigungen, nicht eben hinreißend, aber unumgänglich. Mein angefangener Roman liegt, vorerst abgebrochen, in R. – neue Impulse wären zum Weiterschreiben nötig, doch zur Zeit ist meine Energie und ist auch mein übliches Tempo ausgebremst durch »die Verhältnisse, die nicht so sind«. Falls Sie mich bei einer virtuellen Begehung des Friedhofs zu Romainmôtier begleiten mögen – finden Sie hier einen Guide mit sechs Koordinaten und fünf Stills. Dazu die schönsten Grüße Ihres Id. – Anselm Kiefer im Fernsehen – auch ein Mann (Künstler, Denker) seines Formats wird durch das Medium notwendigerweise als Unterhalter missbraucht; und lässt sich missbrauchen. Auf die mediengerechten Fragen kann er nur mit »Naja« oder »Ja, klar« antworten und verschlankt sich dabei – er, der Tiefsinnige! – zum unbedarften Nachrichtensprecher. Soll er doch bei seinem Leisten bleiben und tun, was er kann. Allerdings kommt auch seine … kommt gerade seine Kunst mehr vom Tun als vom Können. – Seit einer Woche bin ich mit der Erstübersetzung von Lew Schestows nachgelassenen Aufzeichnungen (aus dem Archiv der Sorbonne in Paris) beschäftigt. Ungelenke Prosa von oftmals schockierender Unbedarftheit, aber stets dem Wesentlichen – dem Unaussprechlichen – auf der Spur. Parallel dazu Nietzsche lesen, erstmals die Briefe (in der alten Inselausgabe), stilistisch und rhetorisch meisterhaft, ein seltsames Gemenge von Zerknirschung, Wehleidigkeit, Größenwahn. Solche Emotionalität fehlt bei Schestow, doch unentwegt redet er (handelt er redend) von jenen großen Gefühlen, aber es ist die sekundäre, die resümierende und zitierende Rede des philosophischen Literaten, in der Friedrich Nietzsche … in der Nietzsches Wahnwitz nach- und mitklingt. Lew Schestow ist sicherlich einer der stärksten Rezipienten Nietzsches überhaupt, dieser hätte ihn als einen seiner wenigen adäquaten Leser bezeichnen und auch schätzen können. Schestows Schriften sind durch und durch – stellenweise wörtlich – von Nietzsche imprägniert, und doch lassen sie einen unverwechselbaren Personalstil … eine unverwechselbare Denkbewegung erkennen. Ich selbst finde mit Nietzsche keinerlei Übereinstimmung, sein rhetorisches Pathos ist mir ebenso zuwider wie seine Rechthaberei und sein larmoyanter Heroismus; dennoch finde ich bei ihm beliebig viele Beobachtungen und Formulierungen, die für mich, wenn nicht gar von mir sein könnten. »Es ist so schlimm, dass ich gar keine Menschen mehr habe, die es verstünden, mich zu erholen …« – »Wieviel Bitterkeit muss ein Mensch der Tiefe herunterschlucken, bis er die Kunst und den guten Willen hinzulernt, seine nächsten Freunde nun auch nicht mehr zu ›enttäuschen‹: d. h. bis man sich entschließt, seine Not und sein Glück immer erst in die Oberfläche, in die Maske zu übersetzen, um ihnen verständlich zu werden, um etwas von sich überhaupt noch mitteilen zu können.« – »Vereinsamung – Misstrauen – Strapazen – Selbstüberwindung –« – »Das, was mich noch leben heißt, eine ungewöhnliche und schwere Aufgabe, heißt mich auch den Menschen aus dem Wege zu gehen und mich an niemanden mehr anzubinden.« Usf. Aber im Unterschied zu Nietzsche leide ich unter diesen Umständen kaum; seine Klagen sind mir ebenso fremd wie sein Lachen. Fremd auch seine Selbstüberhöhung, seine Beflissenheit in eigener Sache (Verlag, Erfolg). Weil er keine Feigheiten und falschen Kompromisse auf dem Gewissen habe, meint Nietzsche, ziehe er negative Emotionen auf sich; er habe, klagt er, niemanden, der mit ihm das Nein und das Ja gemein hätte! Darin bestehe seine Einsamkeit. Nietzsche an Lama: »… ich treibe es nunmehr auf eigene Faust und will von denen nichts mehr, welche mir nichts zu geben haben. Später wird sich das Urteil über mich schon wieder berichtigen.« Schön wär’s; doch solche »Berichtigung« wird unsere und wird auch die fernere Zukunft nicht mehr leisten.


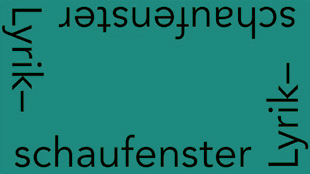
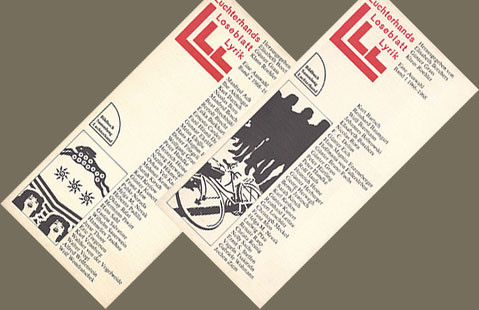



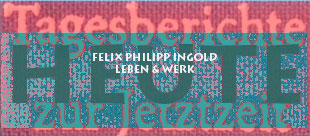
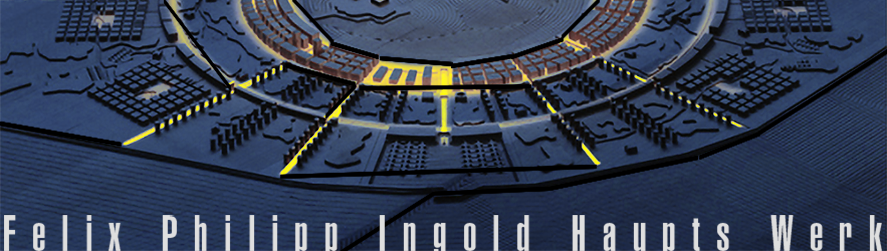
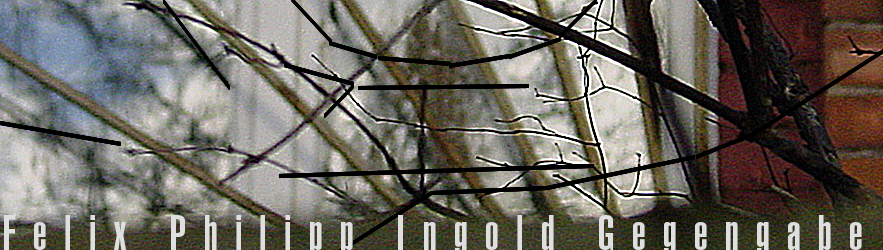
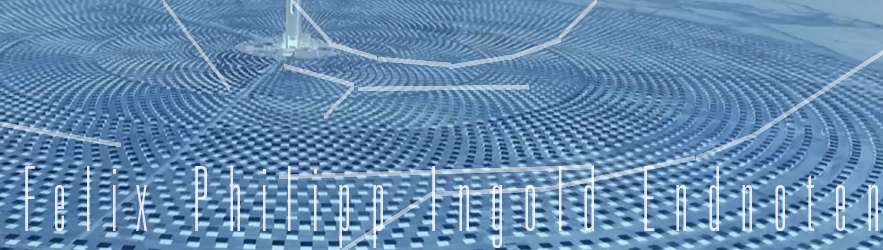

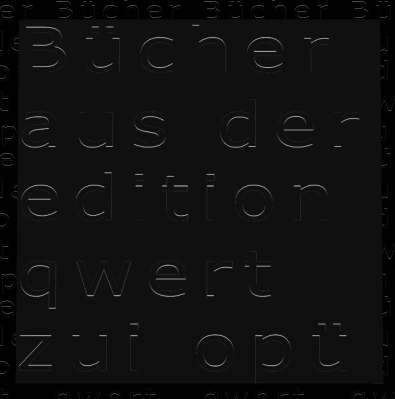
Schreibe einen Kommentar