ANGEHN, ANGRIFF
Wie gutwillig ist ein Mensch?
Er fällt hin, etwas wirft ihn nieder
mit eigener Kraft.
Es überrascht ihn. Er ahnte nichts.
Er erfuhr etwas, es entsetzte ihn,
er konnte es sich nicht verbergen.
Er wollte es sich nicht verbergen.
Es nicht beschönigen. Sich nicht hüten.
Vor dem Zusammenbruch?
Ja, hätte ich ihn verhüten können?
Das ist es ja! Er war nur die Folge.
Nicht die Ursache. Ich sammelte Kraft,
nicht entsetzt zu sein. Zu begreifen.
Ich kann nicht begreifen, was mich nichts angeht.
Ich sammelte Kraft, ich sammelte es.
Seinen Zusammenhang.
Was es bedeutete. Was es mich anging.
Bis es reichte und mich umwarf.
-Jahre später habe ich ein anderes Niederstürzen
nachträglich so begriffen:
Das Bewußtsein, die Besonnenheit, Besinnung,
das Denken, die Intelligenz, die Vernunft (?),
die Sicherheit, die Fähigkeit, unbeirrt zu kombinieren,
zu verarbeiten,
zu erkennen,
-tritt von selbst zurück!
Sie wird nicht überrumpelt!
Sie tritt von selbst zurück – um den Schock zu erfahren…
![]()
Eine poetische Biografie
Als ich im Sommer 1983 daranging, eine kleine eilige Tagebuch-Notiz literarisch zu klären, d.h. ihre Belange (Horizonte, Halterungen) mit meinen bisherigen Schreiberfahrungen zu prüfen, ergaben sich sofort (und dann weiterhin sechs Jahre hindurch) Aufschlüsse über Aufschlüsse (viele von ihnen prinzipiell oder direkt, im Charakter einer dringenden Mitteilung ‚an Alle’ Mitlebenden). Sofort und auch weiterhin – während sich (bis zuletzt) für den Text kein Ende absehen ließ – zeichneten sich in das Textland vorgreifende und es sichernde Aufgaben ein („dieser Text wird gewiss nicht enden bevor…“). Sie erfüllten sich unerwartet und auf unvorhergesehene Weise und nicht so, dass mit einer ihrer Lösungen etwas besiegelt und abgetan war, sondern so, dass es sich in weitere Zusammenhänge eingebunden und zu neuen Perspektiven aufgeboten fand. Ich nahm endlich wahr (ich nutzte endlich, konsequent auch kraft der im Mai notierten Konflikt-Not) den Vorteil, den das Textleben als fixiertes Gedächtnis gegenüber dem übrigen Leben hat. Als Gesetz gewann dieser Spielraum dem Schreiben das soziale Ideal einer verbindlichen Offenheit und offenen Verbindlichkeit für alle verursachten Wirkungen. Die umfänglichen und intensiv aufwendigen Arbeiten und anderen Lebens-Teile, die den Prozeß in den sechs Jahren unterbrachen, störten ihn nicht, sie förderten ihn. Der Text ist gelebtes Schreiben wie erschriebenes Leben (und nicht etwa ersetztes, sondern ein Leben von aufregender, abenteuerlicher, von erfreulichster, sogar heiterster Art). Er hat eine Heldin. Die Heldin ist eine Frage. Die Frage heißt: „Aber werde ich denn noch lieben?“ Die Heldin muß warten, während der Text ihren Handel betreibt (sich anficht, feindlichen Bedingungen aussetzt), seine eigenen Methoden (Eroberungen, Triumphe) in Konflikte treibt, bis sie scheitern. Sie, nicht er. Bis die Heldin eingeholt wird, die Frage gelöst, die Heldin zu sich kommt…
Elke Erb
So oder so
Aha, nun sind die achtziger Jahre wahrhaftig vorbei, und ich werde nach meinen damaligen literarischen „Eigenheiten“, jenen, die „innovativ wirken“, und nach einer Autorenpoetik gefragt. Wie ich mich doch immer von solchen Fragen nicht finden lassen will! Als habe man sich in der Tür geirrt und der Bäcker wohne nur nebenan. Tagelang suche ich nach einem Weg durch das von dieser Frage angerichtete Labyrinth. Dabei habe ich in meinen 450-seitigen Winkelzügen oder nicht vermuteten, aufschlußreichen Verhältnissen (beendet November ’89, Erscheinen im Druckhaus GALREV, Berlin) noch und noch mit weiterhelfenden (suchenden, irrenden, ungewohnten, gewohnten, schlüssel-&-schloßgleichen, unbehausten) Winkelzügen zu tun gehabt und auch die (genau im Juni ’80) verlassene 70er-Jahre-Tour der Kurzprosa mehrfach rekapituliert: erschrocken geschmäht, in ihrem Vorgehen erkannt und, erhellt vom Gang durch die texteigenen Situationen während dieser bis ins Spitzfindige lebenswahren Erörterung, nach und nach würdigen können, dankbar, gewiß nicht erschöpfend. Jener innovativen Form, die sie endgültig beendete, sie augenscheinlich „durchbrach“, hatten die bisherigen Texte regelrecht Vorschub geleistet, indem sie sich mit Spannungen aufluden, die in anscheinend divergierende Intensiv-Signale (Text-Positionen) hinein„schossen“, bis sie in der gewohnten Geschlossenheit nicht mehr zu halten waren; herbeigeführt hatten sie jene einer demokratischen Erneuerung vergleichbare „Explosion“ der thematischen Produktivkräfte in der (den 50er Jahren „an sich“ nicht mehr neuen, nur mir neuen und in meinem Gesellschafts- sowohl als auch Bewußtseinsbezirk wohl auch allgemeines Neuland sich gewinnenden) Produktion auf dem Blatt verteilter Wort-&-Sinn-Gruppen.
Innovation: Der Hintergrund, nämlich der Herstellungsprozeß, von dem bisher nur das Resultat zu gelten hatte und stand, trat als Vorgang in den Vordergrund. Seine Anliegen, Liegenschaften, Umstände, die bisher den notorisch (der Rede gleich, aber ohne die lebendige Gegenwart ihrer mitredenden und stillschweigenden Verständigungen) linear ablaufenden Texten, den dinggleichen, den Modelltexten, Beispiel-, Gegenbeispiel-Texten – a) zum Spiel das Beispiel, b) „Texte, auf die alles gesetzt war“, c) wie geht das zusammen? – die den bisherigen Resultat-Texten also ihr fortsetzendes Wort in die Zeile abzuordnen und auf eine möglichst günstige Gesamtvertretung dort zu zielen hatten – erwiesen sich als selbst mündig, sobald sie, wie es nun anging, selbst gesehen wurden: Das Rohmaterial war nicht roh, der Wust nicht wüst, das taube Gestein nicht taub. Nachgiebigkeit verlangten, Redlichkeit, Wahrnehmung, Gehör diese ehemals anscheinend sprachlosen, zurückgelassenen Teilhaber meines Bewußtseins von mir, und so, wie ich nachgab und aufnahm, so förderten sie den Text, das Thema, mich, so förderten sie zutage: ihresgleichen, rückständige, vernachlässigte, verdrängte, unerkannte, ihren eigenen, meinen Zusammenhang. Die unhierarchische, kollektiv-aktiv förderliche Text-Form dieser feldhaften Erörterungen nahm fast selbsttätig (als sei die Schreibwerkstatt ein experimentierendes Labor) einen „Sujet“-Typ nach dem anderen durch. Während die Texte vorher ohne einen wahrgenommenen Zusammenhang untereinander entstanden (alle Bindekraft neu in jedem von ihnen, Zusammenhalt in ihnen, Texte, auf die alles gesetzt war), spürte ich nun ein Weitergehen von Text zu Text.
Offenbar trat der Zusammenhang, den sie mir (mit ihren Eröffnungen, Übungen, Lehren) zusicherten, an die Stelle eines Mangels, den die Werkstatt der früheren schließlich erzeugt hatte. Denn gegen Ende des Lehrgangs begann ich wieder lineare Textchen zu schreiben, die – als wären sie aus der feldhaft-themadienlichen und kollektiven Erörterung vereinzelte Sinn-Orte – mit einem gewissen Mutwillen, einer (beim Schreiben jedesmal) gefühlten Entschlossenheit die Gemeindegrenzen eines eingemeindenden Sinns hinter sich ließen: einen Zusammenhang voraussetzten, unterbanden, herausforderten Opposition gegen den Anspruch auf ihn, unbewußt, Nicht-Anerkennung und Erkenntnis seines Vorgebots.
Meine Sammlung Vexierbild (geschrieben 77–81, erschienen 1983) enthält vor allem Kurzprosa und diese feldhaften Erörterungen. Die Sammlung danach (geschrieben 81–84) enthält feldhafte Erörterungen und vor allem Gedichte, unter ihnen diese Textchen, die sie zu einem Gebilde aus heterogenen und divergierenden Bewegungen machten. Ohne die seit ’80 gewonnene Bewegungsfreiheit und Sicherheit, insbesondere ohne die inzwischen geübte Fähigkeit zur Reaktion auf heterogene und divergierende Ansprüche, wäre ich 1984 nicht dazu gekommen, Text für Text darin mit Kommentaren zu beantworten, und zwar um dem Buch (Kastanienallee, erschienen 1987) eine Geschlossenheit nach gewohntem Maß zu geben.
Seit 1983 schrieb ich an den Winkelzügen. Ich hatte nur vorgehabt, eine kurze Tagebuch-Notiz vom Frühjahr „literarisch zu klären“. Es begann ein Schreibprozeß, dessen Ende ich nicht sah, dessen dank der neuen Erfahrungen veränderter Charakter mir aber sofort ein solches Zutrauen gab, daß ich seine unbekannte Zukunft schon am Anfang (wie dann auch im Fortgang) mit Aufgaben belud, die vordem nicht einmal denkbar waren. Der Text folgte einem Schreibgesetz, das den Satz „Der Zweck heiligt die Mittel“ richtiggestellt hatte, nämlich, zunächst nur mit seiner Umkehrung: „Die Mittel heiligen den Zweck.“ So wie die Mittel sind, so ist auch das Ergebnis. Das Schreibgesetz hieß: verbindliche Offenheit und offene Verbindlichkeit. Unbeschränkte, vorbehaltlose Wahrnehmung der vom Schreiben im Text und neben dem Text bewirkten Erscheinungen bei einer Offenheit (Entspannung, Entzerrung, Gelassenheit) der strikten textbildenden Verbindlichkeit. Ich zitiere von Seite 172f (x im Zitat ist das Unbewußte, Unterbewußte, y das Bewußtsein, das bewußt Artikulierte, Beobachtete):
Ein Zusammenhang verändert sich in einem Prozeß der Verwandlung von Wirkungen in Ursachen und von Ursachen in Wirkungen.
Von anderen Zusammenhängen, in denen x und y aufeinander wirken,
unterscheidet es das Schreiben
(und ihm darin gleiche Unternehmungen),
daß es diese Ursachen fixiert
und sie so der Erkennbarkeit erhält,
d.h. sie seinem Zusammenhang als Ursachen erhält
in einer künstlichen Gegenwart des Vergangenen
jenseits ihrer jeweils aktuellen Wirkung.
Befreiend war, daß dieser Text in die von ihm eröffneten Perspektiven selbst weiterging, und ich fragte mich, auf die früheren Texte zurückblickend, erschrocken:
/…/
wie konnte ich nur – wem denn?
überlassen, was ich jetzt selbst tue.
Die Textprobe läßt erkennen, wie die, wieder lineare, Schreibweise der Winkelzüge die Weise der auf das Blatt verteilten Wort-&-Sinn-Gruppen beerbt (sie wendet sie gelegentlich auch selbst an): Blindzeilen schaffen den Aussage-Einheiten Raum, in dem syntaktischen und/oder gedanklichen Verbund für sich zu stehen. Einrückungen und Kursiv-Setzungen ferner fördern gesonderte ebenso wie verbindende Wahrnehmung in beweglichen Zusammenhängen. Die unterbrochenen Zeilen formen die Intonation, die den vielgestaltig geklärten Ausdruck ihrer Möglichkeiten, Gründe, Motive, Spannungen, Rhythmen, Entscheidungen… (sowie deren Studium) mitwirkend in die Kontur setzt.
Dieses Schreiben war Handeln, nicht Darstellen, Bereitstellen, Feststellen. Die Text-Art hat keinen Namen unter den üblichen. Ich habe mich dafür entschieden, sie „prozessuale Erörterung“ zu nennen, im Vertrauen darauf, daß sich aus der Kombination von prozessual und Erörterung schließen läßt (nein?), es müsse dann wohl eine gelebte Erörterung sein. (Ich selbst verstehe unter Erörterung ein Gehen von Ort zu Ort, ein Orte Erkennen, Aufsuchen, Erwandern, Durchwandern. In einer solchen Direktheit der Wort-Auffassung übrigens sehe ich eine normative Erneuerung). Die Aktionen und Situationen in den Winkelzügen erforderten Erfolge im Angriff auf die Codes, die Denkvoraussetzungen und Fertigformen, auf das vom Heil der Zivilisation in sie getriebene Unheil.
Das, was neu war, bin ich infolgedessen gewohnt. Mir ist, als sei ich unterwegs gewesen, lange, durch dieses Jahrzehnt. Eine der „aufgebrachten“ Devisen hieß:
Grenzen leben ist offen leben.
Neuerdings aber spüre ich einen recht restaurativen Zug, der mir nicht recht geheuer ist. Allerdings neu für mich. Vielleicht gibt es sich.
Elke Erb, aus Ulrich Janetzki und Wolfgang Rath (Hrsg.): Tendenz Freisprache, Suhrkamp Verlag, 1992
Ein Rot jenseits allen Rots
− Elke Erbs Winkelzüge: Experimentelles aus der DDR. −
Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse“, dieses verzwickte neue Buch von Elke Erb ruft im rechten Moment – gerade weil es aus der „Edition Galrev“ kommt – wieder ins Bewusstsein, dass die unkonventionelle, herausfordernde Literatur in der DDR nicht nur am Prenzlauer Berg der achtziger Jahre geschrieben worden ist. In dieser, im Gehalt wie im Umfang fulminanten poetischen Reflexion, an der Elke Erb seit 1983 arbeitete, geht sie weit zurück, bis an die Anfänge, des eigenen Schreibens in den sechziger Jahren, als sie noch „das Wort ergreifen“ wollte und „das Grauen wortlos kam“. Erst im Übersetzen von Block, Pasternak, Zwetajewa fand sie ihren Weg in das Land der Sprache, des poetischen Sprechens, und es ist wirklich abenteuerlich, mitzugehen, wenn sie einem Gedicht von Alexander Block Wort für Wort nachspürt und in „herrlich“ statt auf einen Herren auf ein Rot jenseits allen Rots stößt.
„Bin ich, was ich tue / Bin ich, was geschieht?“ Alle Vorstellungen, Begriffe, die ihr Handeln, Denken prägten oder prägen sollten, bringt sie zur Anwendung, zum Scheitern. Der Fortgang, den Leben und Sprache bei ihr nehmen und der schließlich das einzigartige Buch „Kastanienallee, Text und Kommentare“ hervorbringt – 1988 mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet -, wird in einer „Handelsbilanz des Paars Entzweiung/Versöhnung“ charakterisiert: „Offenheit und Verbindlichkeit sind meine Mittel, / mich gegen den gesichtslosen Schutz des Tuns zu schützen.“ Den eigenen Mitteln begegnet sie nicht deshalb mit weniger kritischer Distanz. Auch Ironie spielt hinein, wenn sie sogar mit einer „Heldin“ aufwartet, die nichts weiter ist als eine Frage: „Aber werde ich denn noch lieben?“ In elliptischen Bögen durchzieht sie das Buch, um sich immer erneut zu stellen und in das schöne Paradox überzugehen: „Ich gebe die Liebe, die mir fehlt.“ Gegen Ende des Buchs gelangt Elke Erb mit ihr an einen Punkt, an dem das utopische beinah nicht mehr utopisch zu sein scheint. Womit die Fragen wieder beginnen.
Überhaupt werfen die „Winkelzüge“ viele Fragen auf. Zu den zentralen zählt auch die nach der Art und Weise, in der ein Text sich dazu bringen lasse, die eigenen Zusammenhänge zu erkennen, offenzulegen. Zunächst wohl durch Gegenfragen: „Zusammenhang aber – ist auch nur ein Wort? / und was tut das Wort?“ Natürlich sind diese Fragen nicht neu. Doch der Umgang, den Elke Erb mit ihnen in „feldhaften Erörterungen“ pflegt, geht über die allgemeine Handhabe weit hinaus, irritiert wohltuend. Denn offen sind die Fragen der Beziehungen von Sprache und Wirklichkeit, Schreiben und Biographie allemal noch. Und diese Fragen sind für sie – auch darin geht sie weiter als einige der jüngeren Prenzlauer-Berg-Autoren – keine Spielerei. Elke Erb ist weniger aus- als viel mehr von Grund auf eingestiegen in eine Lebens- und Sprachwirklichkeit, die ihr erst einmal den Mut zum eigenen Leben, einer eigenen Sprache nahm, um diesen dann im konsequenten Widerstreit zu ihr finden zu können. Das führt eben zu einem Buch wie „Winkelzüge“, das die Anlässe, so persönlich sie waren und tragend sind im guten Sinn hinter sich läßt und sich in ein Gebilde sprachlicher, geistiger Souveränität verwandelt. Zum Einlesen in Elke Erbs gesamtes literarisches Werk und damit als ideale Ergänzung, beziehungsweise Begleitlektüre zu den „Winkelzügen“, bietet sich der jüngst bei Reclam Leipzig erschienene Band an: „Nachts, halb zwei, zu Hause, Texte aus drei Jahrzehnten“. Nicht nur, daß er preiswert ist, er macht auch eine Reihe von Texten aus lange vergriffenen Büchern wieder zugänglich.
Christian Schaffernicht, Stuttgarter Zeitung, 24.1.1992
Die Lust am Text als beunruhigendes Abenteuer
− Die Lyrikerin Elke Erb und die Wende. −
„Ich hatte den Zirkel der mir überlieferten Poesie-Münzen, der poesietümlichen Wörter wie Stein, Wind, Hunde, mit denen ich zuerst zu bauen versuchte, bewusst verlassen.“ Was die Lyrikerin Elke Erb da von der Wende in ihrem Schreiben erzählt, klingt harmlos, meint aber ein ungeheuerliches Experiment. Nichts geringeres nämlich als den Versuch, das Zepter für einen Text nicht mehr den Ideen oder Themen oder Figuren zu belassen, sondern der Sprache selbst. Es geht darum „zu spüre, was der Text fordert“, „Textverhältnisse sollen erhellt“ werden, der Text also als Lehrpfad.Und so wirft denn die Autorin einen Stein in das grosse Wörtermeer, eine einfache Frage – es geht um die Fähigkeit zu lieben -, und schon ziehen die Wellen ihre Kreise, immer weiter, immer feiner, und es entsteht ein Oeuvre von 450 Seiten, gewachsen in sechsjähriger Arbeit (1983-89). Es ist diese eine Frage, die den Text vorantreibt, sie ist die Heldin des Sprachgeschehens, der Schreibenden bleibt nur, ihrem Weg zu folgen.
Elke Erb überlässt sich diesem Abenteuer mit der denkerischen Schärfe einer Philosophin, der Lust zur Abstraktion einer Mathematikerin und mit dem Sprachsensorium einer Übersetzerin (die sie ja auch ist, man kennt sie als eine der besten Übersetzerinnen russischer Lyrik) Die Wörter werden gewogen, ergründet, ausgetauscht, Sätze werden in serieller Abwandlung konjugiert und kommentiert. Oder wie eine Mathematikaufgabe in Formeln aufgelöst, und dann geht die Suche los nach den unbekannten Variablen.
So treibt es die Autorin vom banalen Alltagsgedanken hin zum Kindervers mit seinen Gesetzen, gescheiterte Textversuche sind nicht etwa nutzlos, sie haben genauso ihre Wahrheit wie eine zufällig aufgefundene Notiz, vor sechs Jahren aufgeschrieben. Es ist das Gedicht, das Kontakt mit ihr aufnimmt, nicht etwa umgekehrt, es ist ein einst von ihr notierter Satz, der sie plötzlich anspringt und seitenlang nicht mehr loslässt. Unscheinbare Bemerkungen können sich querlegen zum Denkfaden, Alltagserfahrungen werden zu Text, das Leben mit ihrem kleinen Sohn etwa, „die sechsundzwanzig Arbeitsschritte für eine Flasche Milch“ oder der Moment kindlicher Essverweigerung, „ein irrer Augenblick im Leben einer Mutter“.
Sie sucht die Peripherie.
Diese Autorin macht Ernst mit der „Verwandlung der Schreibwerkstatt in einen offenen Lebensraum“. Sprache und Leben sind für sie eins. „Winkelzüge“ nennt Elke Erb ihr Vorgehen oder „prozessuale Felderörterung“, ausgezirkelt von wechselnden Standorten. Räume sollen dabei geöffnet werden, damit sich Leben zeigen kann, ausserhalb der eingeschliffenen Korsettsprachen, der Zeitungssprache beispielsweise, die nur „das Hauptkettenglied und den Engpass“ kennt. Schon in den siebziger Jahren begann die Ostberliner Lyrikerin solch eigenwillige Wege. Sie gehört zwar zur Generation von Rainer und Sarah Kirsch, von Karl Mickel und Volker Braun, sie konnte auch veröffentlichen, im Osten und im Westen. Aber sie suchte und brauchte die Peripherie, war genauso in der jungen Literaturszene im Prenzlauer Berg zu Hause, bei jenen, die ihre eigenen Sprachexperimente vorantrieben, ihre Texte in kleinen Hefteditionen selber verlegten, sich um Zensur und öffentlichen Literaturbetrieb wenig kümmerten.
Bei der Gruppe also, von denen einige sich nun, nach der Wende, mit dem „Druckhaus Galrev“ ihren eigenen Verlag aufgebaut haben. Wer sich so radikal der Sprache ausliefert wie Elke Erb, erträgt weder Ideologien noch Marktstrategien. „Während ich fühlte, dass ich der Sprache zu gehorchen hatte, und ich ihr gehorchte -, war mir, als gehorche ich damit auch mir.“ Eine ungeheure Herausforderung- auch für die Leserin, den Leser.
Lisbeth Herger, Tagesanzeiger, 12.8.1991
Winkelzüge
− Elke Erb – grenzenlose Bereitschaft für Expeditionen in neue Wortländer. −
Wehe dem, der versucht, Elke Erb in der Literaturlandschaft der ehemaligen DDR dingfest, ortsfest zumachen. Andreas Koziol hat in seinem „Bestiarium Literaricum“ für Elke Erb den „Eidechsenvergleich“ herangezogen. Eidechsen bekommt man bekanntlich kaum zu fassen, obwohl man sie immer wieder unvermutet auftauchen sieht. Mit dem Jahrgang 1938 gehört Elke Erb zur Generation etwa von Rainer und Sarah Kirsch, Karl Mickel, Volker Braun – u.a., also derjenigen Autoren für die sich mittlerweile Adolf Endlers Begriff der „Sächsischen Dichterschule“ eingebürgert hat.
Als Vermittlerin, Herausgeberin und Autorin in selbstverlegten Hefteditionen spielt Elke Erb verschiedene Rollen in der Männerdomäne jener Lyriker, die gemeint sind, wenn man von der „inoffiziellen DDR-Literaturszene“ spricht. Die Tierbilder von Andreas Koziol sind eher Metamorphosen einer Lesart als Autoren-Porträts; die Eidechse hilft mir denn auch weiter bei meiner Suche nach Begriffen für die Schreib-Mentalität, den Boden, auf dem die Texte Elke Erbs wachsen – Texte, die sich dem germanistischen Lasso der hoch zu Ross reitenden Rezensenten entziehen und die sich nur dem in die Hand geben, der zum neugierig-geduldigen Mitspielen bereit ist und sich auch von „Winkelzügen“ (so der Titel des neuen Buchs) nicht beirren lässt.
Elke Erbs Schreiben ist mehr als Schreiben. Mit der „Verwandlung der Schreibwerkstatt in einen offenen Lebensraum“ ist die Grenze zwischen Leben und Schreiben aufgehoben. Will man den Stoff, das Thema dieses Schreibens benennen, läuft man auf Grund: „das Leben“ selbst „Eine Floskel? Nicht, wenn man das im fahrlässigen, allgemeinen Sprachgebrauch etwas verluderte Wort „Leben“ fragend wiederbelebt und etwa nach den Gesetzen unseres Denkens forscht, die die Wahrnehmung dieses Lebens steuern, eingrenzen und willkürlich kanalisieren und damit das Leben selbst beschneiden, in einer Reduktion, für die sich in den „Winkelzügen“ treffend das Bild der chemischen Elementetafel findet: „Die Bestimmungstafel bestimme auch noch nicht gefundene Elemente (Systemlücken) so dass sich in ihr etwas Neues nicht mehr zeigen konnte.“
Außerhalb solcher Denk-Systeme, die im öden Ping-Pong der Dualismen oder in unfruchtbaren Kausalitätsbezügen dem Leben seinen Spielraum rauben, sind die Texte von Elke Erb auf der Suche nach dem, „was Schreiben mehr ist als Leben“ – geschriebenes Leben eines Texts, der in einer hintergründigen Landschaft auf Gedankenwegen einen Sinn entgegenstrebt, den er noch nicht kennt.
Der Start in dieses Schreiben sei langwierig gewesen, versichert Elke Erb. Zehn Jahre habe es gedauert, bis der erste Text „durch“ gewesen sein und standgehalten habe. Die bahnbrechende Innovation war von Anfang an die Kurzprosa, eine Textform, die, ohne Vorbilder in der näheren oder weiteren Umgebung, entstand. „Ich hatte den Zirkel der mir überlieferten Poesie-Münzen, der poesietümlichen Wörter wie Stein, Wind, Hunde mit denen ich zuerst zu bauen versucht hatte, bewusst verlassen“, schreibt Elke Erb rückblickend in den „Winkelzügen“ zur Voraussetzung der beiden ersten Bände „Gutachten“ (1975) und „Der Faden der Geduld“ (1978).
Die Kurzprosa-Texte sind konzentrierte Momentbilder, unwiderlegbar erhellt von einem Wortlichtblitz, „und, als hätte ich Steine werfen wollen in das Komplott der Verhältnisse“, gerät die gewohnte Wahrnehmungswelt vom Einschlagort her sanft, in konzentrischen Wellen, in Bewegung. „Texte, auf die alles gesetzt war“, und jeder Text für sich ein Gegenent-Wurf: „Du entwirfst mit den Texten deine eigene Gesellschaft, indem du Wort für Wort einen Aufbau machst, der standhält gegenüber einem Außen, das Herrschaftsansprüche anmeldet. Ein DDR-spezifischer Kunstaspekt? In der DDR sei die Haltung „Konfrontativ hervorgereizt“ worden, weil eine fragwürdige Autorität mit ihrem Alleinherrschaftsanspruch immer präsent war. „Der Markt freilich ist ja vielleicht eine größere Autorität als sibirische Gefängnisse, nicht wahr?“
Der Innendruck dieser komprimierten Texte, auf die alles gesetzt war, stieg an. Die verschiedenen Aspekte, die im Brennspiegel der Kurzprosa eingefangen waren, strebten immer stärker ins Weite, bis sie die Form sprengten. Im Band „Vexierbild“ (1983) ist dieser Umbruch des Schreibens nachzulesen: Er enthält, neben Kurzprosa, auch die neue Textform der „prozessualen Feld-Erörterung“, die dem Streuungswinkel der Denkwahrnehmung Raum gewährt. Erörterung – das ist wörtlich ein Gehen von Ort zu Ort, Wort zu Wort: Die Sätze werden nicht mehr linear im Block angeordnet, sondern als Wortgruppen auf dem Blatt verteilt, womit die lineare Zeit ausgehebelt und Gleichzeitigkeit tatsächlich lesbar wird. Stärker noch als schon in der Kurzprosa führt der Text nun ein Eigenleben – der Autorin blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.
Im Band „Kastanienalle“ (1987) ist die Textentstehung bereits in den Vordergrund gerückt; die nachträglichen Kommentare zu den Gedicht-Texten spüren „dem Textleben, dem Lebenstext“ nach. In den „Winkelzügen“ ist diese Kommentarebene, die in „Kastanienallee“ den Texten als „Beistand“ mitgegeben war, in den Text gehoben und unlösbar mit ihm verwoben. Die 450 Seiten sind ein langsames Gewächs: Von 1983 bis 1989 arbeitete die Autorin daran, mit Unterbrechungen, die zuträglich waren: „Was wirklich wächst, braucht alles. Zwischenzeiten haben den Text nicht gestört, sondern ihm gedient, ihm Zuwachs geliefert.“
Während in den früheren Texten von „poetischer Klärung“, „Verdeutlichung“ (in Abgrenzung von den Begriffen „Deutung“, „Bedeutung“) die Rede war, wenn es um die Bedingungen des Schreibens ging, hat die Dynamik in den „Winkelzügen“ eine entscheidende Wendung genommen:
„Dieses Schreiben war Handeln, nicht Darstellen, Bereitstellen, Feststellen.“ Wie alles andere, ist auch dieser Satz wörtlich zu nehmen: Der Text selbst handelt, er tritt als personifiziertes Subjekt auf, dessen Bedürfnissen die Autorin folgen muß, will sie ihn nicht verfehlen. „Wie soll ich auch: mich in den kalten Sattel des Autors schwingen können, aufs hohe Pferd? Da ist niemand, nichts, was ich suche.“ Nicht von oben herab, die Zügel straff in der Hand und alles ringsum überblickend, wird ein solcher Text geschrieben – die Autorin bewegt sich auf der Ebene des Textes, mit den Wörtern und Sätzen per du. Alles kommt im wahrsten Sinn – zu Wort: Zwischengedanken, der Ärger über einen querliegenden Satz, der sich nicht vertreiben lässt: „Wenn nämlich du so ernsthaft auf etwas aus bist wie ein Tier auf Beute, wirst du deine Witterung auch auf das richten, was dich hindert, die Beute zu erlangen.“
Dieser behutsamen Jagd in Winkelzügen zu folgen, ist für den Leser nicht immer einfach. Vieles erschließt sich einem spontanen Bilderlesen intuitiv, nimmt unmittelbar Gestalt an in der Vorstellung des Lesers; anderes sperrt sich, und man schüttelt genauso ratlos den Kopf wie die Autorin selbst, die, nicht faul, in kommentierenden Sätzen versucht, ihren Gedanken auf die Schliche zu kommen. In einem geruhsamen und (ja!) liebevollen Lesen, das Raum bietet für Verwirrung, Achselzucken, Staunen und ein seltenes Leseglück, beginnt der Text zu sprechen – mit der Stimme des Lesers, der unversehens seinen eigenen Lebenstext liest, denn die Freiheit der Selbstwahrnehmung ist ansteckend. Beim Lesen hat mich dieser eine, mit Lust und Energie gesagte Satz aus dem Gespräch mit Elke Erb immer wieder gekitzelt: „Du lässt dir überhaupt nichts mehr verbieten!“ – beim Schreiben nicht, beim Lesen nicht. Wollte mir angesichts dessen etwa die Piff-Paff-Puff-Wendung von „poetischem Sprengstoff“ in den Text? – augenzwinkernd antwortet ein Zitat aus Elke Erbs Ablagemappe, von irgendwann: „Dein Pulver wird dir nass / dereinst im Grab, / Luise!“
Sieglinde Geisel, der Freitag, 26.4.1991
Die Gangart der Winkelzüge
− Elke Erb schaut den eigenen Sätzen beim Entstehen zu – ein Abenteuer für den Autor wie für den Leser. −
Der Band Winkelzüge oder nicht vermutete aufschlussreiche Verhältnisse von Elke Erb ist ein waghalsiges literarisches Unternehmen: eine Reise in „unbewusstes textuntergründiges Land“, dorthin, wo die Denk- und Wahrnehmungsprozesse stattfinden, die zu einem literarischen Text führen. Die „Kundschafterin“, „Aufklärerin“ dieser Expedition ist eine Frage, die von der Autorin listig zur Heldin des Textes erklärt wird – „sie brach auf, ich folgte ihr nur“. Die Frage – „Aber werde ich denn noch lieben?“ – ist nicht nur auf der Suche nach der Fähigkeit zur Liebe, sondern, dem Gang des Textes folgend, auch nach den Bedingungen der Wahrnehmung, der Veränderlichkeit, des Blickwinkels, denn „was wann und wie gesehen werden kann, ist (…) ein umfassendes Thema des ganzen Textes“.
Prüffeld für diese Untersuchung ist die biographische Realität der Autorin selbst; allerdings durchaus nicht als unmittelbarer, intimer Selbstausdruck, sondern abstrahiert, mit feinem Nerv für die Stilisierung ins Modellhafte. Nach einer ausführlichen Rekapitulation der Entwicklung ihres eigenen Schreibens konstatiert die Autorin: „Nach langen Jahren kam vom Schreiben her (langsam, verwundert erwachend, sich umblickend) eine klare Selbständigkeit in mein nichtgeschriebenes Leben.“ Dieses Schreiben des „Lebenstextes“ hat damit einen „Ich-Gewinn“ erbracht, der missverstanden würde, wollte man in ihm nur eine Spielart der Selbstverwirklichung erkennen. Die Befreiung der radikalen Subjektivität, die der Schreibprozeß, das „Textleben“ ermöglicht, führt aus gesellschaftlichen Zwängen hinaus und schlägt um in radikale Sozialkritik:
Die Fremdbestimmung,
von deren künstlich verengtem (entstelltem) Horizont aus / das Ich als geraubt (privat) erscheint, hätte mir nicht zu gehen erlaubt.
„Gehen“ ist eines jener elementaren Worte, die sich im Verlauf des Textes mit einem weiten Horizont von Bedeutungen umgeben. Die Gangart der Winkelzüge spiegelt sich in verwinkelten Sätzen, die allerdings typographisch übersichtlich dargestellt sind – eine Lesehilfe im Labyrinth der Sprache. Die realen psychosomatischen Gehstörungen, von denen die Autorin berichtet, werden aufgehoben, durch die Gehbewegung des Texts, der zeigt, „wie es gehen kann, landgreifend Wort an Wort“, und der die Freiheit hat, „ins Offene zu gehen“, im Unterschied zu Texten, „die als schlüssige Modelle ins Offene nur weisen“.
Das Entweder-Oder des dualistischen Denkens und die Einbahnstraße kausaler Gedankenketten von der Ursache zur Folge werden als die gängigen schematischen Reaktionsabläufe entlarvt, die als abendländische Denktradition die Wahrnehmung rastern. Kleinkariert. Soll das Denken, das von den Konventionen schachmatt gesetzt wurde, wieder flottgemacht und zu neuen Konstellationen seiner Figuren befreit werden, hilft nur ein Winkelzug, der den Spieß der Kausalzwänge umdreht: „Die gewohnte (stationierte) Begründung entmachtet, die Umkehr ermächtigt. Lichtblick.“ Für diese Erweiterung des Horizonts, wo Widersprüche nicht mehr als Denkfehler ausgegrenzt werden, hat Elke Erb ihren eigenen Begriff geprägt, „lebenswahr bedeutet, das eine ist richtig und das andere auch, obwohl das eine unrichtig ist, wo das andere richtig ist“.
Ein Denken, das sich in dieser Weise nach seinem Grund umsieht, blickt in den Spiegel seines Unbewussten und schaut den eignen Sätzen beim Entstehen zu, mit zunehmender Verwunderung darüber, dass dort bereits ein Zusammenhang, ein verborgener Sinn darauf wartet, ausgesprochen zu werden. „Wer ahnt denn, dass ein sinn, ein Streben selbständig, ohne die Leitung des Bewusstseins, sich zielgerecht fortsetzt, durchsetzt, als sei es eine Pflanze, die wächst.“ Die Metaphorik ist charakteristisch: Neben dem „Gehen“ ist es das „Wachsen, das die Entstehung des Textes in ein bewegliches Bild übersetzt.
Fast unmerklich verschiebt sich dabei die Autorschaft – der Text wird zu einem eigenständigen Subjekt und sucht sich selber seinen Weg. Bei Elke Erb ist zwar nicht von einer „Zerreißung der Fotografie des Autors“ (Heiner Müller) die Rede, im Gegenteil, in der Erkundung der eigenen Geschichte bleibt die Autorin anwesend. Sie hat jedoch die Position gewechselt, ist abgestiegen vom hohen Roß der allwissenden Autorität über den Text und mischt sich – halb als Zuschauerin, halb als Mitspielende – unters Volk.
Unter ihr eignes Volk, denn die „Textgrößen“ wachsen sich aus zu einem eigentlichen Textpersonal: „Die Namen der Umstände waren Begriffe. Die Umstände bleiben nicht stehen. Es zeigte sich, daß sie zu Themen wurden, Themen, die handelten, ein Schicksal hatten, eine Rolle spielten: Figuren, Romanfiguren gleich traten die Umstände auf.“ Die erste dieser Textfiguren, die auszog, die Liebe wiederzufinden, hat die Gangart der Winkelzüge entdeckt und weiß, wie man sich, in einem „lebenswahren“ Dreisatz, am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht: „Ich suche die Liebe, die mir fehlt. (…) Ich habe die Liebe, die mir fehlt.“ Es ist eine andere Liebe als diejenige, deren Verlust am Anfang des Texts die Frage ihren „Hungerwinkel“ aufsperren ließ. Diese Liebe geht über die private Glückserfahrung hinaus und schafft Raum für die unverstellte Wahrnehmung des – und jedes – anderen Menschen.
Die Gedanken-Gänge der Winkelzüge sind, vor alle in den alpinen Regionen der konsequenten Abstraktion, nicht auf Anhieb bis in all ihre versteckten Ecken hinein nachvollziehbar. Die Autorin ist, als Leserin ihres eigenen Textes, jedoch eine hilfreiche Begleitung beim Lesen; staunend, manchmal ratlos und bisweilen verärgert nimmt sie ihre eigenen Sätze oft als scheinbare Fremdlinge im Text wahr, bis sie selbst die Maskerade durchschaut und ihnen auf die Schliche kommt Ein solcher Text ist Spielraum und damit auf einen Leser angewiesen, der sich auf ihn einlässt und das vielversprechende Risiko eingeht, beim Lesen verwirrt, aus der Fassung gebracht, erheitert oder gar beglückt zu werden von den nicht vorhersehbaren Winkelzügen des vertrackten Texts, der darauf besteht, im Lesen jedes Mal neu und anders erschrieben zu werden.
Sieglinde Geisel, Tagesspiegel, 24.5.1992
Die Autorität der Autorin
450 Seiten lang über die Voraussetzungen und Vorgänge de Schreibens selbst zu schreiben, ohne sich dabei im Leerlauf zu drehen, ist kein Kunststück, sondern Kunst. Elke Erb ist Meisterin in dieser Kunst, „Das Leben als Schreiben (zu) begreifen, nämlich die Möglichkeiten erkennen, die das Leben hat, wenn es Schreiben heisst“. „Winkelzüge oder nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse“ heisst der über sechs Jahre hinweg entstandene Band, als dessen „Heldin“ die schlichte Frage auftritt: „Aber werde ich denn noch lieben?“, ein Textwesen zwischen Abstraktion und Figürlichkeit. Die Frage, die sich ursprünglich als private Tagebuchnotiz zur „literarischen Klärung“ angemeldet hat, wird – nicht vermutet und aufschlussreich – zum „novellistischen Auslöser“ eines Textes, der die Klärung seines eigenen Werdegangs zum Ziel hat. Bereits im letzten Gedichtband, „Kastanienallee“, erklärt Elke Erb: „Mir schwebt vor, den Denkprozess zu erfassen, dessen Ausdruck das Reden und Schweigen der Texte ist.“ Während Elke Erb in „Kastanienallee“ ihren Wörtern noch mit einer eigenen Kommentarebene auf die Schliche zu kommen versucht, lässt sich diese Ebene in den „Winkelzügen“ nun nicht mehr aus dem Text lösen.
Eine sensible und vorurteilslose Selbstwahrnehmung ist die Voraussetzung dafür, das eigene Denken hinter seine Sprachgestalt zurückzuverfolgen. Die Verfolgungsjagd im Hinterland des Textes, der „wandlosen Werkstatt“ des Unbewussten, ist zwar ein Schreiben in konsequenter Assoziation, jedoch nicht als ungehemmte écriture automatique, sondern in wachsamer und durchaus kontrollierter Pirsch:
Wenn nämlich du so ernsthaft auf etwas aus bist
wie ein Tier auf Beute,
wirst du deine Witterung auch auf das richten,
was ich hindert, die Beute zu erlangen.
Hakenschlagend geht die Jagd in Winkelzügen hinter der Beute her, hinter jenem „verborgenen Sinn“, der beim Schreiben nur inkognito dabei ist und doch den Textverlauf bestimmt: „Der Text sagte es, ohne mein wissen.“ Ein Autor, der das sagen kann, verzichtet auf seine Autorität über den Text. Im Schreibprozess sieht sich die Autorin – mitunter nicht ohne Irritation – als eine Art Medium, ein „Sammelbecken für Bereitschaften“, ohne hoheitliche Ansprüche auf die Urheberschaft des Textes:
Wie soll ich auch:
Mich in den kalten Sattel des Autors schwingen können,
aufs hohe Pferd? Da ist niemand,
nichts, was ich suche.
Selbst das Pferd ist weg. Ein Phantom. Der Sattel
seelenverlassen. Da sehe ich klar.
Wie bereits die Frage als handelnde Heldin gewinnt nun auch der Text als Ganzes eine unvermutete Autonomie: Er tritt auf als ein Subjekt mit Eigenleben. Die Autorin geht zu Fuss, den Wegen des Textes folgend, „so lange bis (…) die Texte vernehmlicher mit mir selbst zu reden begannen (…) und ich ‚schliesslich’ das Wort nur noch so ergriff, wie es mich ergriff“. Wie sieht dieser Vorgang aus? Die Genese des Satzes „Draussen regnet der heilige Frühling“ macht das Geschehen, in Zeitlupe übersetzt, sichtbar:
Bevor sich dieser weitere Sinn als ohrfertiger Satz
Ablöst und dem Auge mit seiner Beute entschwebt,
heisst er Auge und Ohr, ihnen fernher vorschwebend,
ihm sein erstes Wort bilden helfen: Draussen.
Das grammatikalische und semantische Subjekt dieses Vorgangs ist jener Sinn, dem die Autorin in der allmählichen Verfertigung der Sätze beim Schreiben behutsam auf der Spur ist.
In den „Winkelzügen“ befragt Elke Erb jedoch nicht nur den Mikrokosmos ihres Schreibens. In ausführlichen Rekapitulationen zeichnet sie auch die Entwicklung ihres Schreibens von den ersten Texten bis zur Schreibweise der „Winkelzüge“ nach. Gerade in der Genauigkeit, mit der Elke Erb ihre eigenen Texte Revue passieren lässt, ist die Kenntnis ihres Werks eine Voraussetzung für das Verständnis dieser Textpassagen. Es wäre daher angemessen gewesen, die betreffenden Texte aus den früheren Bänden grosszügiger zu zitieren, zumal (bis auf „Kastanienallee“) derzeit sämtliche Bücher von Elke Erb beim Aufbau-Verlag vergriffen sind. So erscheint die Auseinandersetzung mit der eigenen Schreibvergangenheit oft ungewollt privat, fast wie ein Selbstgespräch.
Dieser Eindruck verzerrt, was in diesem Schreiben seit Jahrzehnten erkundet wird, denn der „Ich-Gewinn“, den Elke Erb vom gelungenen Schreiben fordert, hat mit privater Selbstfindung kaum etwas zu tun; er ist vielmehr jenen gesellschaftlich vorgeprägten Denkstrukturen abgetrotzt, die dem fortgesetzten Richtungswechsel von Winkelzügen den Weg versperren. Perfektes Bild für die lebensfeindliche Schematik ist ein Relikt aus der Schulzeit, die Tafel der chemischen Elemente: „Die Bestimmungstafel bestimmte auch noch nicht gefundene Elemente (Systemlücken), so dass sich in ihr etwas Neues nicht mehr zeigen konnte.“ Der aristotelischen Denktradition mit ihren Dualismen und ihrem Beharren auf unumkehrbarer Kausalität erteilt Elke Erb eine listige Absage:
Man führt dir ein Punkt für Punkt
einleuchtend richtiges Denken vor,
und daneben ist (ohne zu leuchten) klar,
dass es nicht „greift“.
Also begreift es auch nicht.
Dann ist ja wohl – eben die Richtigkeit falsch!
Das Paradoxon ist die Gangart des Denkens in Winkelzügen, mit dem Elke Erb die „Idyllik des Richtig & Falsch“ unterläuft. Der Schalk sitzt ihr im Nacken, und sie lässt es sich nicht nehmen, dem Baron von Münchhausen, Till Eulenspiegel und dem Rattenfänger von Hameln unterwegs in stiller Eintracht zuzuzwinkern, haben doch auch die drei Gewährsmänner in Sachen verkehrter Welt gewusst, dass man, gemäss der griechischen Wortbedeutung von „paradox“, nur gegen den Schein, blinzelnd, ins Licht sehen kann.
Hölderlins poetischer Sehnsucht folgend, ist das Schreiben, das diesen Ich-Gewinn verspricht, ein traumwandlerischer Gang ins Offene, Wort für Wort in unbekanntes, wartendes Neuland des Textes, „zu den bereits wartenden Orten seiner Zukunft“. Unversehens – ein weiteres Paradox – schlägt die radikale Subjektivität und Selbstwahrnehmung der Autorin um in ebenso radikale Gesellschaftskritik, die an der Wurzel, nämlich den Mechanismen sozial verbindlicher Wahrnehmung, ansetzt. So wird aus dem Schreiben ein wirkendes Handeln, das dezidierten Widerstand ankündigt gegenüber
Einer Kultur, die leugnet,
dass sie ausspart und was sie ausspart,
die ihre Artikulation (Ausbildung)
als vorgegebene Vollkommenheit voraussetzt,
der zu dienen sei,
und die diese Vorgabe auch noch
umlügt in eine soziale Stimmigkeit
und Übereinkunft,
ja Abstimmung,
wenn sie von etwas, was sie bestreitet, sagt:
Da ist noch nicht gesagt.
Der Ich-Gewinn, der gegen diese Ausgrenzung des Sagbaren erstritten wird, den die Autorin sich zuspricht, führt nicht in eine egozentrische Tautologie. Die Heldin des Textes, die Frage nach der Liebesfähigkeit, die aus dem Blickwinkel der gescheiterten Liebesbeziehung aufgebrochen war, gelangt wunderbarerweise an einen Ort der universalen, ja fast erlösten Liebe, die nicht auf private Glückserfahrung aus ist, sondern zu einer gesteigerten Wahrnehmung des anderen Menschen befähigt: „Wie er von sich aus war. Ungetrübt, Endlich unverstellt.“ Jenseits des Normbilds der Gesellschaft, in das er sich fügen gelernt hat.
Elke Erbs Reflexionstext entzieht sich einem beutegierigen, vereinnahmenden Lesen. Es erfordert einige Hingabe des Lesers, den verwinkelten Gängen der Assoziationen geduldig zu folgen und die Schätz zu heben, die im Untergrund verborgen sind. Zu diesen Schätzen gehört auch das Alter ego der Heldin, die, „irrlichternd unter dem Vorwurf der Torheit“, nicht ohne weiteres preisgibt, dass sich in ihr eine der grossartigsten Figuren der Literaturgeschichte spiegelt. Im schillernden Titeltext des Bandes „Vexierbild“ kam er schon einmal vor: „Der Tor mit seiner Mutter im Wald.“ Und wer Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ kennt, wird die feine Leuchtspur, die in den „Winkelzügen“ an einigen Stellen aufblitzt erkenne und ihr staunend folgen. Auch Parzival gelangt durch Ich-Gewinn als Gralskönig in die Sphäre der absoluten, universalen Liebe, nachdem er sich von jenem blinden Gehorsam gegenüber sozial sanktionierten Forderungen gelöst hat, der ihn beim ersten Besuch auf der Gralsburg die entscheidende Frage versäumen liess. Wer sich im poetischen Dialog der literarischen Werke untereinander so subtil und mit sichere Kohärenz zu bewegen vermag, hätte es schon längst verdient, nicht mehr als Geheimtip durch die Gegenwartsliteratur zu geistern. So sei es denn gesagt: Elke Erb ist eine grosse Dichterin.
Sieglinde Geisel, NZZ, 30.3.1992
Von Elke Geerbt
− Nachdenken über Winkelzüge oder nicht vermutete, aufschlußreiche Verhältnisse. −
Über den Sehschlitz
Das war Elke Erb für uns: Die Wirklichkeit durch einen messerscharfen Spalt gesehen. Das Licht, das dann trifft, ist nicht verwirrend, sondern hat die Genauigkeit eines Laserstrahls. Dazu kam die scheidende Selbstbezichtigung des Eifers. Wie lustig und belehrend schied sich, „die Treppe hinab zählend“, die Haushaltende von der Begriffsforscherin. Immer anwesend war die Schülerinnenlust, den gedanklichen Widerspruch in der nächsten Umgebung zu finden, spitzfindig. „Ich weiß was, Herr Lehrer!“ Aus einem kindlichen Widerspruchsgeist hatte sie eine Sprache gemacht, die den Weltwiderspruch nicht vergaß.
Als ich selbst schwankte zwischen der literarischen Malerei und der malerischen Literatur und mich mit diesen Inkonsequenzen quälte, begann mich die literarische Miniatur zu interessieren. Und ich stand in den Buchhandlungen lesend, wenn ich so etwas fand. Das bißchen Luft unter die Sohle und der kleine helle Knall in meinem Kopf, den Elke Erbs Texte mir brachten, haben mich bewogen zu kaufen. Ich bin ein schlechter Buchkäufer. Ich lese Bücher bei anderen und trage sie denen weg. Meine eigenen Bücher wiederum dränge ich anderen auf und verliere sie so. Verloren habe ich den schmalen Band einer Anthologie mit Gedichten, darin ein Foto von Elke Erb, jung, streng, vor einem hohen Fenster, das mageren Haushalt signalisierte. Es war, als ob ich sie durch einen Sehschlitz genau beobachtete.
Als ich sie mir wieder ansah, saß sie, im Winter ’91, auf dem Sofa in der Kulturküche von Wilfriede Maaß und las, reif, weich, weise aus den Texten, die bei Galrev „im Satz“ waren. Da war sie seit sieben Jahren dabei, herauszutreten aus dem Spalt und abgeschotteten Sehschlitz der Selbstbewahrung, aus dem heraus sie jene dinghaften Texte gemacht hatte, die mir den kleinen hellen Erkenntnisknall gaben.
„Toleranzbreite“, „Zusammenhang von Herz und Papier“, „einen Horizont angehen“, „Schritt für Schritt“. Wie? Mit: Vorwärts, wir müssen zurück! Mit der Untersuchung der ihr eigenen Winkelzüge, mit dem Vertrauen, daß es sie schon führen werde, es sich zeigen werde. Spitzfindigkeiten und Textverhältnisse in einem dicken Buch, eingefügtes Vor und Zurück. Da folgen einander Selbstzitat und Überarbeitungen und Rechenschaft von den Überarbeitungen, damit sie sich selbst als Autor aus jener Camera obscura herausholt, wo das kleine Lichtloch so scharfe Bilder zeichnet von einem Stück der Welt, den Sehenden aber im Dunklen läßt. Das Grauen vor der Scheidung des sich rettenden Geistes von der Welt wegschreiben, das ist das Buch.
Wahrhaft ein Buch, viel zu viel Papier und Herz für einen Leseimbiß im Buchladen, mehr was für ein Leselager gleich Bibel oder Wörterbuch. Und tatsächlich saß sie am 15. Mai im Sessel mir gegenüber und sagte mehrmals unvermittelt: „Philosophie, Philosophie, Philosophie…“, sie muß es ja wissen. Daß sie jedenfalls vom Sehschlitz herkommt, das schreibt sie selbst auf Seite 312 im Zitat des Textes von 1977:
Den Blick werde ich schärfen, d.h. die Augen verengen,
um den Horizont zu erweitern.
Und wo das hin soll, abgewinkelt, Richtung gewechselt, stand in Kastanienallee (1984):
Ich sehe jetzt, daß ich in die Engen selbst
hineinzugehen
und den Horizont dort, nämlich ihren Horizont,
zu erweitern hatte,
mit keinem anderen Schutz als dem
des Schritt für Schritt landgreifenden
sprachlichen Weges.
Das meine ich gut zu verstehen.
An dieser Stelle, und wenn es sein muß noch an anderer, gestehe ich, daß ich doch oft hocke vor dem Text wie vor den Rätseln einer Sphinx, dann erhellt und verbindet sich wieder was, so daß Lust und Qual dieser Lektüre winkelzügig wechseln. Und manchmal kommt es vor, daß die Schattenrisse und Gestaltabdrücke von Angela Hampel, der Zeichnerin der Winkelzüge, mit ihrem dunklen Gewicht der Erhellung dienen.
Über das Lehrbuch
Umgehen mußte ich mit dem neuen Buch ganz anders als sonst mit Texten von Elke Erb. Ich konnte mich nicht zehn Minuten einer kleinen Erhellung freuen auf irgendeiner Seite der Vexierbilder oder auf einigen Seiten der Kastanienallee eine halbe Stunde mich vertiefen, sondern ich mußte Lehrgängen folgen, Kurse durchlaufen, Gang 1, 2, 3, 4. Ich mußte ein System und seine Begriffe, seine Fachsprache lernen. Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, mußte ich zurück, z.B. auf Seite 111. Und wenn ich Seite 60 anwenden sollte, dann mußte ich wieder zurück, oder sogar zurück in die anderen Bücher, und dort noch mal nachschlagen wie „Ein Stundenplan kommt selten allein“ (Kastanienallee). Und wenn ich wissen wollte, wie weit ich schon eingedrungen war in den Lehrstoff, dann blätterte ich nach hinten, d.h. vorwärts, um es an dem Inhaltsverzeichnis zu messen, und beschäftigte mich mehrmals seufzend mit dem Abschätzen der schon erlesenen Seitenzahl durch einen Blick auf den Buchschnitt, grauenhaft. „Wie weit bist du denn?“ „Erst auf Seite 145?“ Mir, der ehemaligen Lehrerin, gefällt es, daß sich Elke Erb als ein Mensch zu erkennen gibt, der auch durch Schule geprägt ist, daß ihr abhängiger Eifer und ihre Selbständigkeit entstanden sind aus der Auseinandersetzung mit Unterricht. Mir gefällt, daß ich mich ihrer Unterrichtung jetzt unterziehe, meine Begriffsstutzigkeit eingestehend. Zum Beispiel brauchte ich Nachhilfe bei so einfachen Übungen wie dem auf Seitenzahl, Zeilenlänge und Absätze hin von ihr selber streng gebauten „Satz“ für den Druck. Da rufe ich sie an und frage noch, wie das für 400 Seiten geht! Bin ich blöd? Warum nicht, wenn es für 100 gegangen ist? Nur, weil sie mich diesmal bittet, doch auf Seite 346 noch mal nachzulesen? Der Leser hat einen Fehler gemacht und muß zurück auf Seite 28, um noch mal nachzuzählen, warum immer von den 12 entscheidenden Worten die Rede ist. Ich schlage zurück, ich zähle:
Daß – man – Sätze – braucht – ist – eine – Wahrheit −
Könnten – wir – das – nicht – zugeben.
12 Worte, ich gebe es zu. Sätze brauchen wir, natürlich, warum soll ich dieser Voraussetzung widersprechen?
Davon ausgehend, wird Elke Erb mit allen Winkelzügen, mit dem „Erfahrenen“, mit der Entwicklung der Worte, der Sprache aus sich selbst heraus, oft auf dem deduktiven Wege des logischen Schlusses aufschlußreiche Verhältnisse beschreiben, die unvermutet, also neu sind. Deswegen sind die Poesie und das Bild immer da: „Draußen regnet der heilige Frühling.“ „Die winselnde, aus Weiden geflochtene zwanziggradige Luft steht wie auf eingeschlagenen Pfählen…“
Aber die Dichterin wird nicht arbeiten mit der Beschreibung der Handlungen von Personen, sondern sie wird eher die Begriffe handeln lassen wie Hegel, und ich muß aufmerksam folgen. Wie bei einem Lehrbuch kann ich nicht weitergehen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Später, wenn ich sicherer bin, kann ich hier und da nachschlagen und mich der aufgefrischten Weisheiten freuen. „In dem wirklichen Zusammenhang verstehen sich die Worte.“ Mit meinem Lehrbuch ist es mir aber so ergangen. Ich hatte es mit Anmerkungen und Zusätzen vollgeschrieben, mit „schön“ und mit Fragezeichen und Hinweisen auf andere Seiten versehen. Dabei hatte ich das Exemplar rücksichtslos behandelt, mit verschiedenfarbigen Stiften auch die Vorsatzpapiere und den Deckel bedeckt mit Gliederungsversuchen und Zusatzfragen. Da verlor ich es in der U-Bahn!
Zuerst war ich kopflos.
In einem anderen (weggetragenen, noch reinen) Exemplar las ich weiter. Das Lehrbuch war jetzt offener zu mir. Es begann sich mir zu erschließen. „Powtoritje poschaluista.“ Aber auch der schon erinnerbare Stand half von Seite 250 an. Überschrift: GRENZEN. Da bin ich gewesen, als ich es verlor, das Lehrbuch mit den Anmerkungen und Fragen.
Das Lehrbuch ist in vielen Teilen, besonders in „Erinnerter Stand“ (S. 228) und „Wir werden von uns abgezogen“ (S. 338), auch ein Buch darüber, selbst belehrt worden zu sein. Es geht in der poetischen Biographie auf die Schule zurück. „Ich habe nur infolge fremder Autorität gelernt zu arbeiten.“ („Schule“, S. 228) Ich, die Zuhörende, war aufmerksam, als sie, die Autorin, das vorlas.
Ich habe die (fremde) Autorität übernommen.
Das Wort ergriffen
(Ich übernahm mich jedesmal)
Ich teilte mich:
Ich X übernahm die Autorität.
Ich Y arbeitete wie infolge fremder Autorität.
(Unteilbar identisch wurde dieses Wie mit seinem So!)
Ich antwortete, ohne gefragt zu sein.
Ich verantwortete.
Ich, Leser-Hörer, hatte doch ein „ver-antworten“ gehört als falsch handeln, falsch entscheiden, falsch antworten. Was habe ich getan? Der innere moralische Überfall kam, die Worte wurden kräftig, wurden selbständig handelnde Wesen, sie packten mich. Ich hatte (ich auch, Herr Lehrer, ich auch) das Wort er-griffen, mich über-nommen und ver-antwortet.
Ich bin jedesmal davon ausgegangen
und darauf zugegangen, daß es geht
(…)
Ich blieb erfahrungslos,
weil ich nur die Zukunft hatte.
Ja, wir hatten nur die Zukunft, aber – es geht nicht um die „Zukunft“, sondern nur, weil hier die Arbeit ein Text ist, um die Zukunft des Textes, ich weiß. Ich lerne es gerade, der Text soll es erarbeiten und der Heldin der Frage helfen. Die Haltung zum Text, die Entschlossenheit, wird zu einer handelnden Fee oder zu einer versperrenden geometrischen Figur, einem Pentagramm z.B. „Die Figur, die Zorn, Geduld und Grauen verbindet“.
Kaum lassen sich die Gedanken sehen
auf den sprachlichen Wegen, verzaubert sie sie
ins Unwegsame. Bis der Richtige kommt? Geduld?
Ein Märchenbild. Die Haltung zum Text, die Figur, das Zeichen, unter dem alles steht, versperrt die Textwege, wenn sie nicht von den richtigen Gedanken gewiesen werden, wie ein Zauberwesen, wenn man nicht das Lösungswort weiß. (Das geht weit über Lehrbücher hinaus und liegt zwischen Nostradamus und Kant. Oder so, stelle ich mir vor in meiner halbgelehrten Voreingenommenheit: mir fehlen, das Lehrbuch besser zu begreifen, offensichtlich Voraussetzungen.)
Als ich Elke Erb besuchte und wir über die Menge Text nachdachten, der ich da dienen wollte, sagte sie:
Konzentriere dich doch auf die Schule, das muß dich doch interessieren.
Ich bin 44 Jahre lang in die Schule gegangen, grauenhaft, was man da verlernt. Und doch, oft habe ich mich gefreut, es war ja keine Not, die mich und meine Schüler zwang zu durchdenken, ob Kreon in Antigone ein uneinsichtiger Tyrann bleiben muß oder zur Einsicht in die eigene Hybris gelangen kann. Wir spielten nur, ohne Not. Für das Leben lernten wir, aber nicht in dem Leben. Und dieses Denkenlernen „ohne Not“ verspottet sie kräftig, weil es ihr, der guten Schülerin, offensichtlich eine Hemmung wurde und die Gefahr bestand, in einen „toten Winkel“ zu kommen. Schulstellen, das waren die Stellen, wo im Café Clara bei der Lesung am 14. Mai Stimmung aufkam und die Hörer signalisierten: „Ja, so ist es“, mit Lachen.
Als wir Gesetze zu lernen hatten,
hatten wir sie zu erkennen an uns zumeist
unvertrauten Erscheinungen (Englische Revolution)
oder an solchen, die uns nicht drängten,
ihr Gesetz aus ihnen zu abstrahieren (freier Fall)
(…)
Bei lebendigem Leibe Vorbereitung
auf den Schritt ins Leben.
Im Café Clara standen neben Elke Erbs lernkritischen Lehrbuchtexten die Selbsterfahrungen der Jayne-Ann Igel über Schule und Lehrer, die mir zu Freude den Ernst des Kindes, lernen zu wollen, beschrieben:
… die vom lehrer aber auch von uns selbst ausgehende imaginationskraft war so intensiv, daß wir fühlten, hier & jetzt der geburt einer wahrheit beizuwohnen… obwohl doch nüchtern betrachtet, indem der lehrer die frage stellte, die wahrheit (antwort) schon im raume war. (Jayne-Ann Igel, Fahrwasser, 1991)
Diesen Ernst des Kindes setze ich bei Elke Erb voraus, von linken Eltern aus dem Westen nach Sachsen gebracht, war Schule ernstgenommen, und was sie nicht gab, wurde echter Mangel:
Immer wieder, seit ich aus der Schule bin, muß ich lernen,
mich dem Nächsten, dem jeweils Aktuellen zuzuwenden.
Das wird schön am nicht funktionierenden Haushalt und Konsum gezeigt:
Die Schule hat einen Mangel erzeugt,
den das Lernen schließen muß,
oder:
Es ist ein Lehrgang, und es gibt Erfolge.
Ich folge also diesem Lehrgang und seinen Erfolgen beim Lesen. Aber, mir ist bei alledem wie der Autorin auch:
Als hätte ich dem Zufall zu gehorchen, nicht dem Gesetz.
Die Leute, die in diesem Lande, in dem das Buch geschrieben wurde, die Gesetze lernten, stießen alle an deren Ungültigwerden im Detail.
Die Hausfrau, die mit einer Idee des Haushaltens erfüllte, schlangengesichtige Philosophin, die sich seit ihrer Schulzeit bemühte, der Hegelschen Dialektik noch einen Inhalt zu lassen, sagt dazu:
… es ist das Gesetz im Gewande des Zufalls.
… Und da erwies es sich,
meine Idee und ich, wir waren nicht allein.
Wollte ich ihr folgen, schloß sich uns
die Anwärterschaft all ihrer Voraussetzungen an.
(Und: Drahtbürste. Lösungsmittel. Fragen Sie Freitag nach…)
Da muß es doch schon ein seltsamer Humor werden, das
Was mich veranlaßt, bin ich,
und was ich daraus mache, bin auch ich.
(…)
(„im Hegelschen Sinn“ oder „positiv“…)
Sie verstrickt sich? Irgendwann, verstrickt in die Verästelungen der nie beschnittenen Textbezüge, will die Autorin
zum Telefon laufen,
Philosophen anrufen, wen?
Laufen, wie man zum Doktor läuft. Heilen, „Heil“, ich wollte so ein Wort nicht annehmen, als wir redeten. Sie verwendet es aber jetzt.
Elke Erb mußte sieben Jahre lang ein dickes Buch schreiben, weil sie aus den früheren dinghaften, vereinzelten Texten heraustreten wollte. „Ohne das Ganze ist kein Durchkommen.“
Auf freiem Felde, nicht mehr im Winkel, vertraute sie sich der Evolution der Begriffe an. Jede Rückfrage, jede Richtungs- oder Blickwinkeländerung nahm sie ernst. Schritt für Schritt maß sie das Feld aus in vielen Gängen und wurde wieder froh, geheilt? Als ich Schritt für Schritt das Ganze durcharbeitete, machte mir das Lernen in Elke Erbs Lehrbuch Freude. Freude hatte ich daran, wie sie z.B., weil sie von der Arbeit alles verlangt, spitzfindig den pietistischen Hausschatzsatz „… und siehe, Pflicht ward Freude“ mit in den Text verstrickt!
Übrigens, sie strickt.
Natürlich ist das Lehrbuch überhaupt kein Lehrbuch, wenn schon Wissenschaft, dann eher das Protokoll einer Versuchsreihe. Oder doch ist es eines: „Das Aleph, das Leben, das Ich, das Schreiben“, und hat keinen Vorsatz, nur die Entschlossenheit, nichts zu verbieten, wohin das auch führen mag.
Die Frage „Aber werde ich denn noch lieben“, am Anfang des Buches personifiziert, sie ist eine Heldin, die in Not ist. Wichtig sei die Not, sagte mir Elke Erb bei meinem Besuch, die Not, aus der heraus die Frage geboren wurde. Diese Frage folgt einer mit mathematischen, geometrischen, algebraischen Begriffen durchsetzten umwegigen Logik. Aber die Heldin, die Frage, hat ein Schicksal, und das bleibt ungewiß. Schicksal gibt es in Lehrbüchern nicht, da gibt es die Notwendigkeit und das Gesetz, möglichst mathematisiert.
Die Mathematik
Es hatte mir eine Mathematiklehrerin und Kollegin jede Frage nach Anstößen für die Mathematik aus der Not verboten. Die Mathematik entwickele sich aus sich selbst heraus. So was glaube ich natürlich nicht. Sie habe keinen ANFANG UND KEIN ENDE und sei doch nach oben hin offen. Und es ist verhext, wenn a b bedingt, dann bedingt b auch a. Wegen der Entwicklung „aus sich selbst heraus“, wegen der schönen Abstraktion, wegen dem Seriellen und dem geometrisch Feldhaften im sprachlichen Prüffeld, wegen feinerem Humor? „Ich-Quadrat plus zwei IchDu plus Du-Quadrat.“ (S. 343) – was weiß denn ich, weswegen liebt Elke Erb die mathematische Metapher? Und der genau unter-über-hintereinander gesetzte SATZ ist ihr so wichtig wie dem Rechnenden die Stellung der Zahlen in einer Additionsreihe, wo die Zehner nicht zu Einern werden, die Kommastellen nicht verrückt sein dürfen. So exakt wie möglich sein? Z.B. in der Konzentration auf ein zu pflegendes Leben, das des Kindes, dafür wird „die Treppe hinunter gezählt“.
Grinsender Widerspruch, die Praxis ihres Lebens ist nicht berechnet. Sollte dies Mathematische das Hexeneinmaleins sein? Die Algebra verlangt mir zuviel ab, ich hatte immer Schwierigkeiten damit. ax und ay, und das a ist ein anderes in ax als in ay. Schwerfällig folge ich. Aber ich werde von Elke Erb nicht nur mit Algebra, sondern auch mit geometrischen Modellen beschäftigt. Schon am Anfang des Textes, der Frage, der Not, gibt es nicht nur einen Winkel, einen aufgesperrten Vogelschnabel. Die Aspekte, das Verhungern oder Ersticken bilden einen Kreis, „legen… ihre Enden zusammen…“ Geometrische Modelle liegen mir. Das Schreiben in diesem Buch ist sowieso Schreiben in konzentrischen Kreisen, engeren und weiteren. Es werden Winkel, Gerade, Horizontale und Vertikale gebraucht, Kreise, Ovale.
Wie hat mir der helle Knall das Hirn erleuchtet bei der allgemeingültigen Metapher vom Kampfoval. Sie schreibt, kritisch betrachtend ihre Fähigkeit, mit Freiheit und Herrschaft umzugehen:
So war ich auch nicht imstande,
die in dem Text Abrede bezeichneten Pole:
wir, die Getreuen, hier – Herr, stolz auf dem Sitz dort −
bis zu den Brennpunkten eines Kampf-Ovals durchzuzeichnen.
Das Kampf-Oval ist ein verzerrter Kreis,
Die Brennpunkte kämpfen darum, den Kreismittelpunkt
zu besetzen und den Kreis um sich zusammenzuziehen.
Da werden die „aufschlußreichen Verhältnisse“ ein Bild. Die widersprechenden Brennpunkte – Herrschaft und Getreue – bemühen sich, im Kampfoval zu einem Kreis, zu einem Mittelpunkt zu verschmelzen. Ich, die Leserin, fühle mich verstanden mit dem Bild. So ein Kampfoval kannte ich, mein Kampfoval, das mich als Lehrerin beinahe den Verstand gekostet hätte – Anspruch der Herrschenden und meine Idee von Herrschaft und Freiheit.
Ob nicht ein retardierender Trieb zur Geborgenheit
an einem Verharren in dem Kampf-Oval beteiligt ist?
Elke Erb verbietet sich nicht, zum Oval des Kükeneis hinüberzudenken. Das Küken muß aber raus, Geborgensein und Nichtgeborensein sind zu durchbrechen. Das geschah.
Die Begriffe handeln
Die Begriffe ergriffen in umfassender Handlung den Weltwiderspruch wie versprochen, so daß das Lachen mir ins Zwerchfell kam, leise. Und neugierig wurde ich, wohin das führen soll:
Objektiv und Subjektiv lagen in Scheidung,
Objektiv und Konkret sollten heiraten
Fast machen sie sich lächerlich, die Begriffe. In „Start“ untersucht die Autorin, zurückgreifend auf eine Ablage von 1965, den ihr „übermittelten Bewußtseinsspiegel“, der auch meiner war.
Der Ausdruck Engpaß nahm uns geistig (fort
von den platten Mühen der Ebenen, die vor uns lagen, und)
wieder mit sich in die unwirtliche
Engpaßwirtschaft der Gebirge, die hinter uns lagen.
(…)
(Offiziell verheiratet mit Inoffiziell…)
Begriffe kommen mit ihrem Gegenteil, Hand in Hand daher, und das sei sehr lustig, wie es bei Hegel heißt. Und was die Begriffe für kraftvolle Tätigkeiten ausführen!
… die ihren Ort zerschlagende Frage:
oder
Ja, kann das Bewußtsein wie ein Planetarium
einen anderen Himmel drehen in sein eigenes Dunkel?
(…)
Das Denken spurt nicht, es
… muß also heraus aus der Ruhe der Bahn,
auf der es spurte, ging, lief, hastete,
sich überstürzte,
… und sich nach seinem Grund umsehn.
Das Denken hat zu tun. Aber die Heldin, die Frage, fragt nach dem Gefühl, und die Autorin macht Denkbewegungen, um ein „Gefühl am Herzen…“ sprachlich zu fassen. Auf Seite 77 kommt deshalb das Wort Vernunft, erst ist es ein mißbrauchtes und ungegliedertes WORT, dann wird es zu einem kräftigen Spruch:
Rat zu üben: Dem Waffenlosen
aaaaaaaaaaaBleibt was? die Vernunft.
aaaaaaaaaaaWahr, es ist leichter sich aufzuhängen
aaaaaaaaaaaAls das Gebelfer der Waffenträger
aaaaaaaaaaaFünf Minuten bloß zu ertragen
aaaaaaaaaaaDie Vernunft
aaaaaaaaaaaIst eine furchtbare Last
aaaaaaaaaaaNur die Vernünftigen
aaaaaaaaaaaGehn mit ihr
aaaaaaaaaaaEin paar Schritte.
Die Vernunft ist es nicht, das Gesuchte, aber sie handelt, bewegt sich, wird zu einer kleinen Person auf Seite 80, eh sie entwischt. „… die Vernunft, / eine Person… / schnurstracks, ihres Wegs, ging sie, auf den Hang zu, so / als liefe sie mir eine Probe…
Ich wunderte mich und dachte,
meinem Blick hinterherstolpernd:
beschopft, beim Schopfe fassen,
Scheitel, gescheit
Bei diesen Worten verschwand sie
Wie ist mir das Bild vertraut, weil ich so oft eine Erkenntnis zu fassen vermeinte und sie schon an ihrer Schwanzspitze hielt, da entwischte sie doch. Die Begriffe machen Bewegungen, kommen, entwischen, sie sind Personen und handeln bei Elke Erb. Worte, Begriffe, Inhalte rücken auseinander, stellen sich anders zusammen oder kehren sich um, laufen einander nach, begegnen sich und beginnen sich zu verstehn. Am Ende ist die Schilderung des Schicksals der Begriffe nur die Methode, es schießt eben vom Hirn zum Herzen, und die Autorin ist die Heldin, das Subjekt?
Aber es ist doch die Autorin das Subjekt! – Es ist ja doch ein Gefühl – am Herzen. „Ahnungen“, altes Wort, wird gewählt und weggetan, reuevoll wird der erste Ausdruck wieder genommen: die Figur eines Gegenübers: „mit Licht gefüllt“. Siehste, kein Begriff, ein Gegenüber, ein Mensch, ein Freund.
erfüllt es sich, verrät es mich?
erfülle ich, verrate ich?
Die Begriffe sind es nicht mehr, das ist die Autorin selber. Sie fühlt. Sie sucht sich, sie handelt, sie schreibt, gegen das „Grauen“, die „Wahrheit“, völlig normal.
Über die Liebe
Die himmlische oder die irdische, die Liebe zum Leben, zur Arbeit, zum Menschen, zum Kinde, zum Manne, die Lust? Was für eine Liebe, himmelherrgottnochmal, die Erregung, die Güte, die Ahnung eines Glückes oder was, die Kündigung des Feindbildes? Auch das „Kind als das leuchtende Vorbild“! Von allem! Was gibst du dem Leser, fragte ich. „Alles“, sagte sie. Na.
Von der Angst, daß die schöpferische Erregung verloren ist, davon ist auch die Rede, und es wird der Heldin, der literarischen Heldin, jener Frage nach der Liebe gedankt, daß sie über das Absterben geholfen, lebensrettend eingegriffen hat.
Davon muß ich ausgehen, wenn ich endlich die Liebesverhältnisse, die der Text aufschließt, klären will. Die Frage „Aber werde ich denn noch lieben?“, diese Heldin, bringt den Text, die Textarbeit an vielen abgelegten, abgebrochenen Notizen und Überarbeitungen wieder voran, indem sie die Autorin von den ursprünglichen Richtungen (den schwarzen Seiten mit der weißen Schrift, ich weiß) erlöst. Erlösung, nachdem die schwarzen Seiten durchfahren sind von der fliegenden Holländerin, der Autorin. Die Autorin, die in ihrem Schreiben von den „geglückten Entzweiungen“ gelebt hat, ruft mit jener Frage unter Tränen nach Versöhnung?
„Erbarmen!“
Die sprachlichen Felder, die wegen der Frage nach der Liebe durchlaufen werden, stellen der Versöhnung die Entzweiung gegenüber. Die Entzweiung, die Scheidung (auch die Ehescheidung) von den falsch geschlossenen Molekülen, die Bewahrung vor der Anpassung hatte zu den früheren Texten geführt.
Ich nahm also das Maß richtig geschlossener Moleküle an,
Aber ich interessierte mich nicht für deren Treiben,
…
Wie aber in der Ehe kann ich das wissen,
wenn ich, wie mir das Beispiel Molekül ja zeigt,
zwischen richtig und fälschlich unterscheidend
mich für fälschlich interessiere.
Hier wird die Versöhnung mit dem bisher (1977, 1985) zu diesem Problem Geschriebenen gesucht. Immer deutlicher werden die literarische Heldin und die Autorin ein- und dieselbe. Es kann nicht mehr nur das Schicksal einer Frage: „Aber werde ich denn noch lieben?“ verfolgt werden. Hervorgeholt werden Texte, die richtig von der richtigen Liebe reden und Rede stehn. Solche Texte:
… ich lebe zur Zeit in einem Gefühl,
besonders, wenn ich seinetwegen weine,
daß die Liebe grün sei, nicht rot,
grün wie junge Blätter, viele Blätter,
kein Rot, und weglos wie die Pflanzen.
und Klartext:
Die Liebe ist vergessen!
… Ich dachte für alle…
Sie kommen zu kurz.
(…)
Ich konnte nicht unterscheiden,
die eine Not von der anderen nicht,
die fremde Not von der eigenen nicht,
denn die Leidenschaft Liebe
hatte den Mut zu allen.
Es war derselbe Mut,…
… der mich der Frage folgen
und sie zur Heldin dieses Textes machen ließ.
Mit den Texten über die Liebe schließt auch das Buch, das ich kaum erschlossen habe. Und nach dem ordnenden Resultat:
Drei gebe die Liebe, die mir fehlt,
dann habe ich die Liebe, die mir fehlt,
möchte ich gerührt, aber auch hilflos, um nicht sentimental zu werden, niederschreiben, was der Geliebte zu dieser Frage sagt: „Selber lieben macht fett.“ Ende des Textes:
… erlöst
von dem Tilgen, Töten und Leugnen.
Ach, Elke Erb!
Wenn also unser lebendiger Geist nichts Glückliches auf dem Hintergrund von Unglück ist, sondern so natürlich wie die Grazie im Gange der Katze, wie du es beschreibst (auf Seite 402), dann möchte ich deinem Rat gefolgt sein und mitgetanzt haben zu deinem Text.
Ricarda Bethke, Sinn und Form, Heft 2, 1992
Elke Erb las aus Winkelzügen
− Ein Buch mit vielen Denkanstößen. −
… Schließlich las Elke Erb aus ihren Winkelzügen, in der literarischen Form schwer definierbar, vom Genre her nicht eindeutig zu bestimmen, wie sie selbst sagte. In sechs Jahren der Auseinandersetzung mit ihrem Ich hat sie das Buch geschrieben, also stark autobiographisch, oft sogar direkt. Sie las vom Bezwingen des „Grauens“, von Krieg und Ökologie, von unseren Neubaustädten als Zeichen propagandistischer Erneuerung, vom „Trott“ der Scham der Verantwortung. Traumhafte Bilder entstanden in den „Folgen des Schocks“, Gedanken über die Liebe im erhobenen wie im alltäglichen Sinn folgten. Das Schreiben, so die Erb, wurde ihr in diesem Buch zur Befreiung vom Schuldgefühl. Sie begann andere als ihre bisherigen Schreibweisen zu finden; die lyrischen Momente, so schien es mir, blieben dominant, bei allem Sentenziösen, gar Theoretischem. Eine mit Vignetten versehene wohlfeile Ausgabe soll’s werden, das Buch von den „Winkelzügen“, offenbar ein „Lesebuch“ mit vielen Anstößen zum Nachdenken. Wohl für den literarisch wie gedanklichen Anspruchsvollen. Leuchtturm in der Flut des Trivialen auf dem Büchermarkt.
Werner Knibbe, Union, 4.3.1991
… Erb schreibt heute anders,
aber nicht als Folge der politischen „Wende“, sondern als Ergebnis ihrer eigenen Schreibentwicklung. Von 1983 bis 1989 schrieb sie den fortlaufenden Text WINKELZÜGE ODER NICHT VERMUTETE, AUFSCHLUSSREICHE VERHÄLTNISSE (1991), der einen innovativ-modernistischen Schreibprozeß darstellt. Die Zeilen bestehen aus lyrisch anmutenden Worten, dazwischen stehen die Spielräume für Gedanken, die ein Gewebe als Ganzes herstellen. Wie schon in ihrer Schreibentwicklung in Kastanienallee (1988) befragt sie einzelne Wörter, sogar manchmal auch Laute (siehe z.B. Schnappsack, angeregt durch die A-Laute). Auch hier schließen ihre Sprachüberlegungen das Politische mit ein:
„Ich fing an, mit Sätzen zu arbeiten, mit Sätzen, die spontan aus dem Unterbewußtsein kommen. So kann ich sie befragen und es kam heraus, daß ich die Weltproblematik oder die Problematik unserer Welt als eine Denkproblematik auffasse.“…
Patricia Anne Simpson: Die Sprache der Geduld: Produzierendes Denken bei Elke Erb. In: Ute Brandes (Hg.): ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN. SCHRIFTSTELLERINNEN DER DDR AUS AMERIKANISCHER SICHT. Verlag Peter Lang, 1992
„die Sprache ist ein Unterwegs-Gebilde“
− Axel Helbig im Gespräch mit Elke Erb, am 1. Mai 2004 in ihrer Berliner Wohnung. −
„Elke Erbs Engagement ist primär sprachlicher Natur. Das macht ihre Texte eigentümlich reell. Selbst Beiläufiges gewinnt durch die Sorgfalt der Fügung Gewicht und Bedeutung“, schreibt Harald Hartung 1977 über die bis heute vornehmlich als Dichterin wahrgenommene Autorin. „Lyrik als unablässige Arbeit und Anstrengung der Reflexion“, beschreibt Urs Allemann 1988 das Gesamtwerk. Gerhard Wolf schreibt 1990 über Kastanienallee: „In dem emotionalen Vorgang, in dem sie sich den Dingen, vorurteilsfrei im Formulieren, nähert…, ist sie bestrebt, im Sprachefinden und Sinnsuchen ihren Stil aus sich selbst heraus zu entwickeln – ein prozessuales Schreiben, bei dem weder ein Ziel noch der Weg dahin festgelegt oder vorgegeben sind.“ „Elke Erb ist das, was man einen poetischen Geist nennen möchte, sie wird getrieben, sie ist befallen von der poetischen Manie“, charakterisiert sie Friederike Mayröcker 1995 in einer Laudatio: „Das hermetische LICHT ist vorherrschend, die aufgeklärte Erleuchtung pflanzt sich fort.“
Ich traf Elke Erb am 1. Mai 2004 in ihrer Berliner Wohnung. Am Beginn unseres Gespräches stand ein Warnschild: „Ich weiß ja gar nicht, ob wir uns etwas zu sagen haben?!“ Dies hätte mich erschrecken können, wenn ich nicht ihre Bücher intensiv gelesen und auf diese Frage, als eine in ihr Werk eingeschriebene Frage, nicht schon gestoßen wäre. Wer Elke Erbs Winkelzüge oder Nicht vermutete aufschlußreiche Verhältnisse kennt, weiß mit welcher Akribie dieser und anderen Fragen in ihrem Werk nachgegangen wird: Das ist das Prozessuale, von dem Gerhard Wolf spricht. Montaignes „Ich kenne mich, also kenne ich die Menschen“ wird von Elke Erb längst nicht so glatt hingenommen, sondern hinterfragt und so zu einem: Ich kenne mich wohl, aber es gibt da noch Fragen, immer wieder neue Fragen. Diese Fragen resultieren aus erlangten Gewißheiten wie: „Was ich als Tier bin, ist mir fremd“, oder: „Meine erste Fremdsprache war die Muttersprache“, oder: „Ich weiß welche Schäden wir genommen haben… durch unseren Fortschrittsglauben.“ Auch unser Gespräch entwickelt sich zu einem Reiben an diesen Fragen und Gewißheiten. Ohne es recht zu merken, rücken wir enger zusammen, gießen Beruhigungstee nach und schließen Freundschaft. So erfahre ich manches über die Entstehung ihrer Texte. Am Beginn des Schreibprozesses stehen Tagebuch-Notizen, zumeist vor der Natur eingetragene Gedanken, die beim wiederholten Lesen hinterfragt werden. Aus einigen Notizen entstehen Gedichte, die im weiteren strengen Prüfungen standhalten müssen. Auch den endlich gedruckten Texten ist keine Ruhe gegönnt. Während der Arbeit stellen sich überraschende Erkenntnisse ein, etwa: „Der Traum führt deine Arbeit aus, die du wach nicht ausführen kannst, oder das Wissen um eine in allem verborgene Zielgerichtetheit. Sie „lasse einem abgesunkenen Wissen oder Meinen noch einmal die Entscheidung“, damit es sich selbst bestimmen möge, sagt Elke Erb. Nach dem Gespräch liefen wir gemeinsam zur S-Bahn und hatten uns, wie es schien, endlos viel zu sagen.
Axel Helbig: Frau Erb, Ihr zuletzt, 2003 bei Urs Engeler Editor, erschienenes Buch die crux besteht aus vier Teilen: dem Fragment „Eile mit Weile“, das ich als eine Art Poetologie lese, dem Text „Teilräume, Zeiträume, Würfel“, als der Versuch, das Bild der Mutter zu fassen, dem akribischen Protokoll „Das Spiegelbild einmal wieder“, als der Versuch, sich im Spiegel zu erkennen, und schließlich die unter dem Titel „Älter werden“ zusammengestellten Auszüge aus Tagebüchern der Jahre 1995 bis 2001. Die wenigsten Texte sind in Berlin entstanden, die meisten in Wuischke, einem Dorf bei Bautzen, einige Texte unterwegs. Im Tagebuch beschreiben Sie sich an einer Stelle als Nomadin, die – in Umkehrung des zivilisatorischen Vektors – im eigenen Heim „eine rohere Art Feld & Flur“ erkennt, einen „ruhelose(n), von Leere nebenher bejagte(n) Jagdgrund“. Wie organisiert sich das Leben und Schreiben von Elke Erb zwischen Berlin, Wuischke und den sonstigen Jagdgründen?
Erb: In Wuischke bin ich den ganzen Sommer über. Als wir damals, noch mit Adolf Endler, nach Berlin zogen, empfanden wir die dortige Hinterhofwohnung als derart laut, daß wir ein Asyl auf dem Land brauchten. Wir sind damals schon, auch mit dem kleinen Kind, den Sommer über in Wuischke gewesen. Das hat sich so erhalten.
Wahrscheinlich ist es so, daß ich, die ich vom Lande herkomme, auf dem Lande besser imstande bin, über alles nachzudenken. Man stieg da in Wuischke – eine Schaumgummimatte auf dem Kopf und die Tasche mit dem Tagebuch und den Büchern geschultert – über einen Kuhzaun und kam auf eine weite Wiese, die auf der einen Seite durch einen Bach begrenzt ist. Vis à vis ziehen sich Felder einen Berghang hinauf. Dinge, die ich sehe, die ich lese, kann ich dort – mit einem zurechtrückenden Blick – überdenken. Ich weiß nicht, ob solche Gedanken, die mich auf meine Kindheit auf dem Lande zurückverweisen, auch in Berlin kommen würden. Das „Tagebuch“ ist ein Notizbuch, vor allem ein ideelles Notizbuch, mit Daten.
Die von Ihnen zitierte Stelle mit dem „eigenen Heim“ bezieht sich im übrigen nicht ausschließlich auf Berlin, damit ist jede Arbeitsstätte gemeint. Nur, es ist so: der „Nomadin“ kommt es vernünftiger vor, Gedichte draußen in der Natur zu lesen. Mir gefiel es nie, den Sommer zu verlassen und in die Stadt zurückzugehen. In bin dann einmal, nach einer Rückkehr aus Wuischke, in den Berliner Humboldt-Hain gegangen und habe begonnen, dort – auf und ab gehend – zu lesen. Die Natur, ein Stück Wegrand, der beginnende Rasen, die Blätter eines Baumes, durch die das Licht tritt, die Natur übernimmt die Zeugenschaft für das, was man liest. Die Natur steht dem rezipierenden Ich bei. Man prüft mit ihrer Hilfe. Wenn Sie sich hier in der Wohnung umschauen, finden Sie keine einzige Stelle, die imstande wäre, so etwas für Sie zu tun. Eine Gewähr zu geben, eine Mitsprache zu leisten. Der Tisch nicht, der Schrank nicht, alles nicht. Aber die Natur kann das. Sie kommuniziert mit mir. Ich lese etwas, ich schaue Hilfe suchend um mich. Und dann kommt eine Antwort – von einer Astbildung, einem Stück Rinde, Landschaft Das sind Antworten, die die Stadt nicht geben kann. Die Stadt ist zu leer in ihren Bezügen. Ich will die Natur nicht verklären. Aber ein Teil Natur, egal was es ist, hat vielfältigere und komplexere Bestimmungen als ein Ding, das hergestellt wurde. Und die Stadt besteht aus Dingen, die hergestellt worden sind. Ich habe lange gebraucht, dies zu verstehen, weil ich als Kind von elf Jahren in die Stadt gebracht worden bin. Was ich übrigens damals auch wollte. Ich habe mich auf den Defizit-Betrieb Stadt eingelassen.
Helbig:In „Eile mit Weile“ verfestigt sich die anfängliche Hypothese „Prosa ist ein Zwitter zwischen Sonne und Dunst“ über den Text hin zur Erkenntnis. Einmal ist auf die Inhalte Ihrer Prosa verweisend angehängt: „traumhaft unwirklich ein Zeitstück wie Glas“. Gibt es in Ihrem Schreiben eine für Sie folgerichtige Entwicklung einer Poetik?
Erb: Es kann nicht anders als folgerichtig sein. Als ich die umfangreiche Recherche Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlußreiche Verhältnisse schrieb, habe ich entdeckt, daß ich mich untergründig folgerichtig entwickle. Von da nach dort. In meinen Anfängen dachte ich, ich kann gar nichts, es mißlingt immer alles. Ich bin aber damals dann, habe ich gesehen, ohne es zu wissen, regelrecht Lernschritte gegangen. Und so ist das bei jedem, wenn nicht gerade eine starke Störung oder Ablenkung in eine andere Richtung stattfindet. Was aber dann auch folgerichtig wäre. Es kann immer nur eine Ergänzung zu den vorherigen Schritten erfolgen.
Als ich an dem Text „Älter werden“ arbeitete, stellte ich einen Bruch fest. Meine Arbeitsweise ist so, daß ich im Sommer die Notate aus dem Tagebuch durchgehe und aus diesen eine Auswahl für die weitere Bearbeitung treffe. Bei der Arbeit an „Älter werden“ spürte ich plötzlich deutlich: Das ist jetzt ein Ende dieser Arbeitsweise.
Es war mir darum gegangen, dieses „Älter werden“ zu protokollieren: Das ist so und das anders. Jetzt hab ich den Schlüssel verloren, wieso geht da die Welt unter? Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl, geschmäht zu sein oder untauglich zu sein? Das habe ich mein Lebtag nicht gekannt. Dann stelle ich mir immer wieder die Frage, ob das seelisch oder chemisch bedingt ist. Die ich bis ans Ende des Textes nicht löse. Es kann nicht seelisch sein, wenn ich nirgendwo einen Grund sehe. Demnach müßte es körperlich bedingt sein – wie die Pubertät, eine Art Umwandlung. Aber dann wäre es, wenn es hervorträte, Meinung, autoritäre und totale Meinungsäußerung. Es geht nicht um soziale Stereotype. Etwa, man wird alt und tritt ab. So etwas interessiert mich weniger. Dieses andere – daß man sich schmählich oder untauglich fühlt – das ist nicht aktuell sozial bedingt. Das ist ein ganz persönliches Gefühl. Denn man hat auch seinen eigenen Anstand.
Helbig: In „Eile mit Weile“ steht: „Sprache nicht greifbar bei ihrer Einfalt“ oder „Sprachen sind jeweils wie Wege überallhin“. Wie „einfältig“, wie fluid ist Sprache?
Erb: Das sind keine programmatischen Äußerungen. Zu „Sprache nicht greifbar bei ihrer Einfalt“ gibt es noch ein ähnliches Zitat: „Alles weiß die Sprache, nur, daß sie immer nicht weiter weiß.“ Sie entdecken etwas, und dann haben sie irgendwo in der Nähe einen Spruch, wo das schon da ist.
„Wege überallhin“, das ist eine ganz andere Art des Nachdenkens über Sprache – daß sie nur medial ist, daß sie Funktion ist und daß sie eigentlich, in diesem Sinne, charakterlos ist. Weil sie überall hingeht, wie Wege. Diese Erkenntnis über Sprache, über das eigene Handwerkszeug, war abgelesen an Bildern von außen. Ich war am Comer See, einem See in den Alpen, von dem aus man nur an Bachläufen entlang oder über wenige, mit Gewalt errichtete Autostraßen in die Berge hinauf gelangen, aber nicht in die Berge wandern kann. Wichtig war in diesem Zusammenhang, daß ich aus dem Arbeitszimmer im zweiten Stock beim Schreiben, „unter dem Schreiben“, in eine Baumkrone hinuntersah, deren Blätter sich unaufhörlich bewegten, als wollten sie etwas mitteilen. So ist das Bild „Sprachen sind wie Wege überallhin“ entstanden. Wenn Sie etwas in die Wege leiten, müssen Sie es meistens sprachlich anfangen.
Helbig: In einem Interview bezeichneten Sie einmal die Sprache als die „erste vorartikulierte Schicht, … reliefartig vor vielem, was dahinter noch ist.“ Ist mit dieser „vorartikulierten Schicht“ das bezeichnet, was aus dem Unterbewußtsein hochkommt und erst einmal zu erforschen ist, eine Art amorpher Stoff, der vom Bewußtsein sukzessive aufgenommen und weitergeformt wird?
Erb: Die erste vorartikulierte Schicht? Damit kann nur die oberste gemeint sein, wenn sie im Unterbewußten gesehen sein soll. Gewiß wohl auch mit anderen „vorartikulierten“ Schichten verkoppelt. Aber amorph eben nicht. Und auch nicht „erst einmal zu erforschen“, wie Sie sagen. Ich meine, daß man sich vorher gerade nicht – wie im Werkkundeunterricht – über das Material zu unterrichten hat, ehe man spricht. Das geht nicht. Die Sprache ist ein Unterwegs-Gebilde. Aus Ihrer Sprache höre ich eine ganz andere Herkunft, ein ganz anderes Weggehen oder Zielgehen als bei mir oder noch ganz anderen heraus. Auch die jeweiligen Lektüren wirken sich aus. Immer wieder treffen sie auf andere Gesamtheiten von Sprache. Ich protestiere oft, wenn gesagt wird, jemand „kommt aus nichts als Sprache“. Denn, wenn wir geboren werden, dann haben wir noch keine Sprache. Und dieses Wesen, das geboren wird, wächst eigentlich gleichzeitig mit dem Gebrauch der Sprache, mit der wachsenden Sprachbeherrschung, mit dem Spiel mit der Sprache. Die eigene Sprache wächst nur parallel zur sonstigen sich ausbildenden Persönlichkeit eines Menschen, samt der professionellen.
Helbig: Es gibt bei Ihnen auch die Feststellung: „Meine erste Fremdsprache war die Muttersprache“.
Erb: Ich mußte sie erst übersetzen. Wie wir alle. Das ist mir freilich erst bewußt geworden, als ich erwachsen war. Es ist auch berufsbedingt, natürlich, daß man so weit Zurückliegendes wahrnimmt, Erinnerung mobilisiert. Da gibt es ja Theorien wie, daß die Syntax angeboren sei. Wenn sie angeboren wäre, dann wäre dieses angeborene Set selbstverständlich ebenso fremd wie die Sprache, die wir antreffen. Denn das, was Sie als Tier sind, ist Ihnen ebenso fremd wie das, was sie als Mensch noch nicht kennen. Alles andere auch. Es ist gleich. Nur, meine Hauptkritik in diesem Themenkreis ist, daß man nicht mit dem Menschen rechnet, der sich bewegt, der Interessen hat, der etwas will, der erst mal da ist. Es geht weit hinein ins Vorsprachliche, daß da ein schon ein geordnetes, mit Bildern und mathematischen Formen versehenes Denken ist. Mit rechts/links, oben/unten, rund/gerade, mit solchen Formen, die kollektiv jeder hat, die an der Gestik abgelesen werden können. Es findet sich in Grundbildern wieder, in der Metaphorik der Sprache. Oben/unten, rechts/links stehn gern auch zusammen, so daß oben/unten zu einem Begriff wird. Das, was in der ausgebildeten Sprache auseinandergehalten wird, hängt in dieser tiefer liegenden Verständigungssprache oft noch zusammen.
Helbig: Das oben zitierte „traumhaft wirklich“ beschreibt einen meines Erachtens markanten Zug Ihrer Prosa: Das Sich-Entwickeln aus Träumen. Warum vertrauen Sie in so starkem Maße auf die aus Träumen vermittelten Bilder?
Erb: Da ist nicht die von den Psychologen oder ohne sie gelesene Traumsprache gemeint. Sondern das im Denken erscheinende Bild. Wissen Sie, ich sehe jaalles. Wovon ich spreche, sehe ich. Und wenn ich jetzt Träume sehe. … Was ich sehe, ist gleich. Es muß jetzt nicht real sein. Ich habe oft Texte geschrieben, weil sich das, worüber ich nachdachte, in ein quasi reales Bild verwandelt hat. Das sogar so kräftig war, daß ich es wieder holen konnte, um die Wahrnehmung zu präzisieren. Ich habe nicht erfunden. Ich bin einfach nur einer Sicht gefolgt.
In „Älter werden“ – wo es um Konflikte und Lösungen geht, um Bredouillen, in denen ich bin, und wo ich wissen will, ob ich da raus komme – gibt es eine Stelle, die mir sagt: Der Traum – oh Wunder! – führt deine Arbeit aus, die du wach nicht ausführen kannst. Und deshalb stehst du morgens da. Und wo du nie Zeit hattest, stehst du auf einmal da und weißt nicht, was du tun sollst. Weil diese Obsession durch den Traum fortgeführt wird, aber du kannst es nicht sehen, weil du wach bist.
Aber übrigens ist in „Eile mit Weile“ keine Poetologie verborgen.
Helbig: Ich lese diesen Text als eine Art Poetologie, weil ich dort wie im Schnelldurchlauf vieles wiederfinde, was ich aus Ihren Büchern an markanten Formen kenne. Wie im Zeitraffer läuft das ab. Z.B. sehe ich in „Eile mit Weile“ die oft assoziative Entwicklung Ihrer Prosa angedeutet. Etwa wenn in bezug auf den „Libellenkopf“ eines modernen Touristenbusses Epitheta wie „glasfroh“ und „wohlhäbig“ entwickelt werden, oder wenn Etym-Sprünge wie „leugnete, äugnete“ vollzogen werden. Das sind Keime, die dem Text Struktur und Richtung geben.
Erb: „Glasfroh“, „wohlhäbig“, das kann ich bejahen. Daß bei Gegebenheiten, die man wahrnehmen kann, von einem zum andern gesprungen wird. Das sind dann Bilder, wo das eine an die Seite des anderen tritt.
Bei „leugnete, äugnete“ sehe ich das anders. Diese Art lautliche Ableitungen haben gerade in diesem Text eine spezielle Funktion. In „Eile mit Weile“ führen und leiten lauter Laute, die sich treffen, und dann wieder abwechseln, mal ist es das O, mal ist es das Ei – preise den Kaiser –, und das war fühlbar neu für mich dort. „Eile mit Weile“ ist ein Text über Mobilität. Und leitet so auch von einem Wort zum anderen. Sonst würde ich dem nicht folgen. Nichts gegen Spielfreude. Ich finde aber, das würde, wenn ich es immer täte, die Lautung überbeanspruchen. Ich kann sie nicht derartig in Dienst nehmen.
Helbig: In der Kastanienallee lese ich „Komfort / kommt vor / komm fort“.
Erb: Da kommt es aber vom Spiel zwischen Schrift und Laut. Das ist ja ein dreifacher Witz. Es gab keinen Komfort in unserem Haushalt. Dann geben sie uns plötzlich eine Wohnung mit so einer Badzelle. Und dann denke ich, „Komfort / kommt vor / komm fort“, kommt gar nicht erst in den Kopf usw. Das ist eine ganz aktive Geschichte. Dort gehe ich nicht von einem Bild zum anderen, sondern ich rede, und zwar mit dem Mundwerk, mit dem rheinischen Mutterwitz. Der geht dann durch mit mir. Ich benutze das. Ich finde auch Schimpfqualitäten per Witz – definieren, genauer sein, scharf sein. Dabei kann es untergeordnet eben auch leicht zu Etym-Sprüngen kommen, zu Sprüngen oder Kopplungen, bei solcherart Büttenrede. Der Sachse sagt Gusche dazu. Ich höre da sehr genau hin. Es wird niemals etwas als Laut vorkommen, was nicht irgendwo hinführt.
Helbig: In „Eile mit Weile“ finde ich auch das für Sie typische Antreiben mit Reimen, wie: „geboren, verloren, als sätest du Sporen“.
Erb: Ja, richtig.
Helbig: Ein anderer hervorstechender Zug ist die Entwicklung eines reduzierten rhythmischen Sprechens. Etwa wenn in bezug auf den im Text vorkommenden Jungen formuliert wird: „Ihn hatte man schon. … Verwiesen. … Wer hatte? Man. Man hatte von wo? Von der Schule. Wieso?“ Das erinnert mich an Beckett, etwa wenn er schreibt: „Auf, frisch und früh an jenem Tage, ich war noch jung, fühlte mich gräßlich, und raus.“ („Aus einem aufgegebenen Werk“).
Erb: (Lacht) Aber es gibt noch eine andere Assoziation. Wenn Sie sich an ärgerliche Dispute zu Hause erinnern. Das sind Wortwechsel. Das ist das Geknatter von einem Wortwechsel. Und das habe ich wirklich im Ohr. Da fragt man sich, wieso. Offenbar habe ich, was diese Dinge angeht, ein etwas überdimensionales Ohr, das diese Sachen wirklich ganz genau hört. Dabei bin ich unmusikalisch. Hier aber scheint es so, als hätte ich das absolute Gehör. So etwas schult man natürlich bei Nachdichtungen. Da kam es am Ende, wenn die Situation wirklich hoffnungslos war, auf die leiseste Nuance im Laut an. Das ist meine rheinische Veranlagung, die ich zu Hause kaum geschult haben konnte, denn da war oft Traurigkeit. Ich habe das Rheinland nicht um mich herum gehabt. Meine Mutter war allein mit uns drei Kindern. Kein Vater, kein Elterndisput, keine Verwandtschaft. Und mit den drei Nachbarjungen im Dorf, da ist auch nicht viel passiert. Trotzdem hat sich diese Mentalität durchgesetzt. Das ist ein Punkt, der mich beschäftigt, der mich neugierig macht. Wie kann das sein, daß sich so etwas – egal, wo man ist – durchsetzt? Vielleicht hat man ja auch, weil das natürliche Umgebensein von Verwandtschaft fehlte, diese Aufmerksamkeit entwickelt. Weil nichts um einen herum war, hat man sehr intensiv hören müssen. In dem Kindheitstext kommt das vor, daß ich immer dachte, wo wollen die hin, die Bauern. Wahrscheinlich ist das eine normale kindliche Frage: Das ist jetzt das Set, und was nun?
Helbig: Im Text „Das Spiegelbild einmal wieder“ zeigen Sie schonungslos offen Haut. Ich kann mir den Text gut als einen Film vorstellen, …
Erb: Oh, ja, das stimmt.
Helbig: mit Großaufnahmen von Haut, …
Erb: Keinen Spielfilm, sondern einen Studienfilm, mit Grafikstudien.
Helbig: als einen das Bild pflegenden Kurzfilm, wie er auf den Festivals in Leipzig oder Oberhausen gezeigt wird.
Erb: Der Text folgt einem Auftrag, den ich mir gegeben hatte, und einem Experiment.
Sie sagen „schonungslos“. Das sagen Sie aber nur gemessen an anderen, nicht an dem Text selbst, den Sie lesen. Obwohl er eine Art hat, die man als streng bezeichnen kann. Es geht um eine Strenge. … Ich will etwas nicht. Ich will nicht, daß ich mich im U-Bahn-Fenster sehe – so beginnt es ja –, und nicht wahrhaben kann, wie ich aussehe. Von den Schraffuren im Gesicht überrascht bin. Ich will mich innen so fühlen, wie ich außen aussehe. Das ist eine strenge Forderung. Auch eine ärgerliche Forderung. Dieses: Wenn ich schon so aussehe, dann will ich mich auch so fühlen, ich will mich nicht ständig irren!! Das ist ein intellektueller Anspruch. Aber ziemlich viele Frauen, die resolut genug sind, könnten so denken. Das ist nicht schonungslos, sondern aufrichtig. Es ist weniger schonungslos als resolut.
Helbig: Im Text – der von Mai 1998 bis September 2000 reicht – gibt es eine Entwicklung. Das Protokoll eines Ärgernisses wird zum Protokoll einer „fröhlichen Wissenschaft“. Man kann dazu raten, den Text in Apotheken anzubieten. Er wird manchem helfen können.
Erb: Das können Sie bis in meine Anfänge zurückverfolgen. Ich habe immer gedacht, zugeben ist das Mittel gegen das Unglück. In meinem dritten Buch, Vexierbild, können Sie sehr viel Unglück, sehr viel Dunkles finden. Ich dachte damals auch, daß solcher Text, anderen helfen kann. Wenn es einem schlecht geht, dann ist es gewiß gut zu erfahren: Da war schon einmal ein Mensch, wo du jetzt bist. Das ist gut, es kann helfen. Mir geht es genauso. Wenn ich etwas erkenne, nennen kann, dann kann ich dem wenigstens schon einmal nehmen. Daran ist etwas ganz Helles, Klares. Es gibt genug Dinge, die ich nicht durchschaue, wo ich nicht weiterkomme und mir in meinem Unglück auch nicht helfen kann. Dabei ist mir immer klar, daß meine Sachen nichts besonderes sind. Daß das völlig allgemein ist, wo ich durchgehe, … Krisen … , das war mir immer klar. … Ich weiß aber auch die Ursachen. Ich weiß, welche Schäden wir genommen haben – von unserer oberflächlichen Ausbildung, unserem Rationalismus, durch unseren Fortschrittsglauben. Das sind ganz wesentliche Schäden.
Helbig: Im Text gibt es eine Einrückung: „Achtung, hier startet der Versuch: absichtlich betrachten und schriftlich reagieren. Ich werde mich beim Abschreiben oft ärgern, weil der Text nicht flügge ist.“ Auf welches Problem wird hier aufmerksam gemacht?
Erb: Das heißt einfach: Ich habe vor, hier etwas zu unternehmen. Ich will diese Spiegelserie jetzt starten. „Ich werde mich oft ärgern“. Wenn Sie in eine experimentelle Reihe gehen und Sie haben vorher keine Sprache dafür, und wissen gar nicht, ob Sie durchkommen, kann das Ärger bringen. Was dann später ja auch immer wieder kommt: Ich fluche und fluche und fluche. Aber das ist noch eine andere Kategorie. Weil es für die meisten Dinge, die da vorkommen, überhaupt keine Worte gibt. Man ärgert sich, man ist nicht im Stoff, und dann spielt ja auch der Hochmut eine Rolle. Natürlich erwarte ich, im Stoff zu stehen. Was natürlich ein provokanter Hochmut ist, an dieser Stelle. Aber das macht es ja auch aus. Wenn ich eine Versuchsreihe starte, werde ich ja nicht kleinmütig rankriechen.
Helbig: Am Ende der akribischen Untersuchung kommt der Text zu interessanten wie schönen Konstellationen: „Das junge Blut ist gekränkt. Kein Blut ist alt.“ – „Die alte Haut. Sie bedauert nur, dem jungen Blut nicht helfen zu können. Ein Unrecht geschieht dem jungen Blut.“ – „Das Spiegelbild weiß von nichts.“ Mit dem Bild des „jungen Bluts“ korrespondiert das Bild „vom ewig ahnungslosen, kerbenlosen Innenbild“. Was ist das für ein Quell der Ahnungslosigkeit? An einer Stelle steht geschrieben: „Aber wäre ich nicht fortdauernd, fortdauernd / unwissend – blitzte nie etwas auf.“ Wie ist dieser Quell der Ahnungslosigkeit und Unwissenheit im positiven wie im negativen Sinne zu bewerten?
Erb: Wenn ich es vorher weiß, dann bin ich zwar nicht ahnungslos, aber dann kann ich mich auch nicht mehr wundern. Andererseits lasse ich ja über alles, was ich erfahre, immer wieder die Geburt siegen …, daß der Mensch da ist und lebt. Vorher war er nicht da, dann ist er da. Jetzt weiß er das, er wird wieder neu sein und sich erneut wundern. Das aber ergibt wiederum so eine durchgehende Ahnungslosigkeit. Sie ist eine andere als die ausgebildete Ahnungslosigkeit, in der Schule usw., dieses oberflächliche Wissen, das einen einzuordnen scheint, diese unhaltbaren moralischen Verträge, die einen immer wieder im Griff haben, wo man sich über Unrecht aufregt und erschüttert ist. Die Aufregung hindert, die Dinge zu verstehen, wie sie sich wirklich abspielen. Ahnungslosigkeit ist ein sehr vielfältiger Begriff. In einem Gespräch mit Brigitte Oleschinski habe ich dafür ein konsequentes Bild gefunden, welches dann auch als Titel verwendet worden ist: „Der Stein, der ich bin, durch den alles hindurchmuß.“ Das ist der extremste Ausdruck dafür. Als wäre ich ein Stein im Acker meines Kindheitsumfelds. Dieser Stein wird alles aufnehmen und alles verstehen. Das Bild ist, finde ich, gut brauchbar, nur sollte es nicht romantisiert werden. Aber die Härte. Du brauchst eine Art steinerne Härte, um von steinerner Härte durchschnitten zu werden. Sonst kommst du nicht heraus aus dem weichen Brei von Unwissen, der dich beherrscht. Diesem Ungefähren, in dem man lebt. Du mußt es umwandeln in etwas. Ich bin ja schneidend, auch. Da ist ein Gefühl von Ich dabei, wenn ich sage, ich will, daß es schwingt, ich will, daß es scharf ist.
Ich lerne Englisch. Vor kurzem habe ich in einem Lehrbuch gelesen, daß die Engländer ihre Sprechwerkzeuge „entspannter halten“ als die Deutschen. Wie ich das lese, werde ich sofort neidisch und wollüstig und möchte es besser gehabt haben. Nachdem ich das eine Weile ausgekostet habe, schwingt es aber ins Gegenteil: Aber ich liebe es, wenn es hart, präzis und konzis ist!! Das ist wirklich ein Ideal, das der Situation, in der ich bin, entspricht. Das ist wirklich das, was man braucht, um raus zu kommen. Ich würde aber in diesem Zusammenhang nicht von Schonungslosigkeit sprechen wollen.
Helbig: Der Text „Älter werden“, ein Arbeits- und Lebenstagebuch, trägt immer wieder auch selbstanalytische Züge – registriert „Versäumnis-Schrecknisse“ und „Elendsfigur-Gefühle“ wie altbekannte Wiedergänger. An einer Stelle wird die Angst begrüßt, wo es heißt: „es scheinen Höhlungen in mir aufgeschlissen, − / so daß ich – lobe sie! – Angst haben kann.“ Registriert wird auch, wir hatten das vorhin bereits, daß die Träume sehr rege in intensiver nächtlicher Arbeit Themen durchnehmen, im Gegensatz zum wachen Bewußtsein, das, weniger selbständig, zumeist unschlüssig bleibt. Ist das die Crux, diese Unschlüssigkeit des wachen Bewußtseins?
Erb: Da ist „unschlüssig“ zu wenig. Damit würde gesagt, daß ein Problem ständig gegenwärtig ist, so daß man ständig unschlüssig ist. Die Crux ist jedoch die Abwesenheit des Problems – das Nichts. … Das Nicht-Fühlen von etwas. … Das ist mehr.
Ich fasse das ganz persönlich. Bei dieser Stelle im Buch, wo von der Crux die Rede ist, geht es ja um das Nähen von Liegemattenbezügen für Wuischke. Wenn die Arbeit beendet ist, ist für mich auch alles, was mit ihr zu tun hat, erledigt. Ich denke aber, daß andere Menschen diesbezüglich sinnlicher empfinden, daß sie mehr durchfühlen, was sie tun. Es geht vielen Leuten so, daß die Arbeit sie auslöscht. Es heißt nicht umsonst grauer Alltag und Einerlei. Das ist schon eine Produktion Nichts.
Helbig: In dem in die crux enthaltenen Text „Teilräume, Zeiträume, Würfel“ sprechen Sie einen Mangel an Liebkosungen in ihrer Kindheit an: Der Vater im Krieg, später in englischer Kriegsgefangenschaft, die Mutter ein Mensch, „der sich vorenthielt“, ein, wie Sie sagen, „nicht entfaltetes Kind“. Ihr Fazit: „So aber war das gesamte auszehrende, mich zurückstoßende Nicht eingeräumt in mich und blieb zeitlebens“.
Erb: Da haben Sie, was ich eben sagte: Daß das mein Thema ist. Nicht ein Thema aller. Trotzdem weiß ich, daß ich nicht für mich alleine spreche.
Helbig: Resultierte aus diesem Nicht, aus dieser Mangelsituation für Sie ein „not-wendiger“, ein die Not wendender Schreibimpuls?
Erb: Not ist ein wunderbares Mittel, um überhaupt zu schreiben. Denn eine Not, die auch Nicht heißen kann, ist ein sehr helles Licht. Hat ein Ziel, will heraus und ist ein sehr schönes helles Licht. Ich denke, daß ich mir das erst bewußt machen mußte, … während des Schreibens. Daß ich mich unterbrechen mußte und mich fragen mußte: Wie und unter welchen Voraussetzungen bist du hier eigentlich zugang? Daß heißt, ich war vorher zugang. Das konnte ich aber nicht wissen, daß dieses Nicht dabei war.
Ich führe immer das Beispiel vom Huhn als Schlüsselerlebnis an. Ein Huhn, das im Nachbarhof ein Ei legt und danach anfängt zu gackern. Das macht einen ziemlichen Lärm. Und ich weiß noch, ich stehe oben auf unserem Hof und höre bis in die Knöchel verwundert diesem Lärm zu. In dem Lärm ist auch Leere. Leer-Sein. Ich höre dem zu. Ich habe mal gesagt, das waren meine Oden und Epoden, das war meine Lehrschule. Weil ich sonst keine hatte, übrigens. Natürlich.
Das Nicht war immer anwesend. Aber ich mußte es erst verstehen. Meines Erachtens bin ich zum Schreiben gekommen, weil wir aus der Eifel nach Halle umgezogen sind. Da war ich elf. Dort war sehr viel Sprache um einen herum. In der Schule begannen die naturwissenschaftlichen Fächer. Und dann war dieser Staat voll von Reden. Man war von Ideologie-Reden umgeben. Das alles in sachsen-anhaltinischer Intonation. Ich denke, ich habe übersetzt, ohne es zu wissen. Ich habe versucht, umzulegen. Es kam etwas anderes ans Ohr, als die Kehle gewohnt war. Folglich hat sie übersetzt, was das wohl sein würde. Natürlich ist es so, daß jede Rede, jede Propaganda, die auf einen zukommt, eine Antwort verlangt. Was die Propaganda natürlich gar nicht will…, daß du antwortest.
Helbig: Welche Bedeutung hatte die Krise ihres Vaters – ausgelöst durch die 1953 erhobene Bezichtigung, ein englischer Agent zu sein – für Ihr Schreiben?
Erb: Das war ja mehr. Es ging um das ganze Unglück der kommunistischen Bewegung. Weil er natürlich auch immer sprach davon, da ging es um Trotzki, um Lenins Witwe und Sinowjew usw. Er hat im Grunde gar nicht verstanden, was es war. Was der Stalinismus war. Er ging immer als Idealist hinein. Das kam zu körperlichen Leiden, Zusammenbrüchen, Angina Pectoris … Das war meine Jugend, elterlicherseits. Dann diese ganze DDR, dieses Karriere-Gesocks. Mir war immer dieses französische Il est arrivé. Mais dans quel état? Er hat Karriere gemacht. Aber in welchem Staat (état) und zugleich Aber in welchem Zustand (état)! durch den Kopf gegangen. Als Kind steht man vor diesem Unglück, diesem Mißlingen, und steht dann gerade dafür. Es ging sehr weit, es war nicht nur das persönliche Unglück des Vaters. Ich weiß, daß ich damit in Halle auf dem Marktplatz stand und dachte: Die haben den Krieg gemacht und wir müssen das jetzt verarbeiten! Es war eindeutig, daß die das nicht konnten. Schmächtig war ich und unterentwickelt, aber in geistiger Bereitschaft.
Helbig: Ist das eine Reflexion auf diese Dinge, wenn Sie in den Winkelzügen sagen, „ich bin im Argen, auf meiner Seite das Recht: des unabgesicherten Redens“?
Erb: Das „Arge“ dort ist eine Abstraktion, vermutlich einer Text-Situation. Was mich dort an der Sache wirklich interessiert, ist das „Recht des unabgesicherten Redens“. Weil sich das Arge überhaupt erst so herstellt, daß das „Recht des unabgesicherten Redens“ nicht eingestanden wird. Du mußtest genau die Antwort geben, die sie hören wollten. Das waren Bürokraten.
Wenn ich aber in den Winkelzügen sage, „ich bin im Argen“, dann ist das auch Exposition. Ich guck mir zu dabei.
Helbig: Ich sehe in den Winkelzügen sprachlich eine große Veränderung zum vorher Geschriebenen. Einen großen Atem. Vorher dominierte die knappe Form – in der Prosa wie im Gedicht −, Sie sprachen später einmal vom geschlossenen Gedicht, im Gegensatz zum offenen Gedicht, das etwas eröffnet. Auch die Kurzprosa war, wenn man so will, geschlossen.
Erb: Ja, die vor allen Dingen.
Helbig: Gab es so etwas wie ein Programm, sich auf das Langgedicht zuzubewegen?
Erb: Nein. Das paßt zu einem immer ahnungslosen Menschen nicht. Da gibt es keine strategischen Überlegungen. Die Winkelzüge sind eine Passage.
Ich weiß noch, wie es war. Es war am Bach, in Wuischke. An einem Nachmittag. Da schrieb ich ein paar Sätze ins Heft, die mich dann sechs Jahre beschäftigten. Das war neu. Interessant war auch: Gleich auf den ersten 50 Seiten haben die Winkelzüge Aufgaben bekommen. Es ließ sich überblicken: Dieser Text hier wird nicht eher enden, als bis das Grauen beendet ist. Es war das Grauen, das sich immer einstellte, auch zu der Zeit noch. wenn ich auf die unfertigen Notizen in der Ablagemappe und in den Tagebüchern sah. Das Grauen der Scham. Und Schande. Es war unwahrscheinlich, daß ich es überwinden konnte. Das heißt, daß man den eigenen Bewegungsraum nach vorne spüren kann. Was verrückt ist. Eigentlich denkt man doch, daß man das Zurückliegende in sich hat. Ich denke, daß man es ebensowenig intus hat, wie das, was kommt. Ich will sagen, daß das, was gewesen ist, nicht fühlbarer ist als das, was kommt. Das ist eine interessante Gleichung. Ich liebe Gleichungen. Nicht eher, als bis die Frage beantwortet ist – das war absolut verwegen, so ein Gedanke, denn ich wußte Null von der Lösung. Nichts! Das ist vollkommen real, das kennt eigentlich jeder, der irgend etwas Sich-Entwickelndes tut. Das ist wohl eine allgemeine Erfahrung.
Helbig: Es gibt eine Stelle in den Winkelzügen, wo von der Forderung eines „schizothym gespaltenen Denkens“ die Rede ist. Zielt diese Forderung auf eine Methode, dem Unterbewußten auf die Spur zu kommen, damit es von dem preisgibt, was es schon „weiß“, was es dem Bewußtsein voraus hat? Ich schließe eine weitere Frage gleich an: Inwieweit sind Sie bei Ihrer Arbeit an den Winkelzügen psychischen Automatismen gefolgt?
Erb: Schizothym ist ja nicht das Deutliche oben und das Undeutliche darunter, sondern beide sind gleich deutlich. Das heißt die Spaltung. Vielleicht bin ich wirklich schizothym, aber dann nicht nur in zwei Teilen, sondern überhaupt.
Was das Unbewußte angeht. In den Winkelzügen wird die Entdeckung gemacht, daß unterhalb dessen, was ich zu reflektieren meine, eine zielgerichtete Arbeit meines Bewußtseins abläuft. Das ist nicht einfach nur ein Verdrängen, sondern noch etwas ganz anderes. Zum Verdrängten gibt es auch eine Meinung in den Winkelzügen: Bitte schön, wenn es vor will, dann soll es gefälligst selbst kommen! Ja, das ist eine andere Haltung. Die ist noch mehr auf Klarheit und Gangweise orientiert. Weil Sie nach der Strategie fragen. Die Winkelzüge gehen von einem Schritt zum anderen. Sie lassen sich von hinten schicken und von vorne ziehen. Aber sie gehen nur einen Schritt. Merkwürdig war, daß ich an manchen Stellen merkte, daß ich keinen weiteren Schritt tun kann, ehe die anderen alle irgendwie einen Laut vorgegeben haben, von dem ich jetzt ausgehen muß, wie von einem Nullpunkt. Das Gefühl, ich komme jetzt deswegen nicht weiter, weil das, was vorher getönt hat, nicht in einen Punkt, der weiter absenden kann, gemündet ist. Ich muß jetzt warten, bis der Ton kommt, den ich nicht vom Vorherigen kenne, sondern nur an dem, der jetzt kommen darf, erkennen kann. Also alles, was vorher war, gibt die Bedingung für das nächste. Das ist rein praktisch vollzogen und nicht theoretisch vorbereitet oder geleitet worden.
Helbig: Es ist nichts Konstruiertes an den Winkelzügen?
Erb: Nein, auch ihre Unordnung nicht. Sie sehen ja, daß die Themen über sechs Jahre hin nacheinander abgehandelt werden. An einer Stelle kommen plötzlich die unterdrückten Sätze, die am Anfang eine wichtige Rolle spielen und den ganzen Text in Gang setzen, hervor und bekommen ihren Part. Immer wieder sind Sätze die Helden der Winkelzüge.
Helbig: Zu einer der Hauptheldinnen – dem Satz „Aber werde ich denn noch lieben?“ – hat sich bei mir eine Assoziation eingestellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: „Die Heldin wird wie Alice in ein Wunderland der Winkel, Symbole und Unbekannten geschickt.“
Erb: (Lacht) Das ist wohl wahr. Nachher kommt dann ein ganz eruptives Kapitel über die Liebe. Wo es nur so geht. Und dann kommt noch das reale Kapitel Liebe, das ich plötzlich konnte, fast am Ende. Also wo ich hätte auf die Straße gehen können und es mit jedem anfangen. Wo man so total brennt. Da hat sich eins aus dem anderen entwickelt. Aber diese vorn angesprochene Voraussicht ist etwas, was mich wirklich interessiert, weil wir für gewöhnlich in einem viel zu klein dimensionierten Raum leben.
Helbig: Bei dem anderen „unterdrückten Satz“, den sogenannten zwölf Worten – „Daß man Sätze braucht, ist eine Wahrheit. Könnten wir das nicht zugeben?“, die ja mit dem Nachsatz „Laufe, Stolz Eisenschuh, hohes Ohr!“ verbunden sind – hat sich bei mir die Erinnerung an die „magnetischen Felder“ von Bréton und Soupault eingestellt, weshalb ich das „automatische Schreiben“, oder auch das schizothyme Schreiben, als Methode hinterfrage. Besonders den Nachsatz empfinde ich als surreales Bild.
Erb: Das ist kein surreales Bild. Wenn sie davon ausgehen: „Daß wir Sätze brauchen, könnten wir das nicht zugeben?“ Das ist ja die Voraussetzung. Wir geben Sätze von uns, als bauten wir Residenzen. „Sätze sind keine Kaiserkrönungen“, ist meine Meinung, und wenn wir sie brauchen, dann ist das eine mediale Sache. Und wir hätten ihre Funktionalität zuzugeben. Nicht damit zu präsidieren. Was uns aber hindert, das zu tun, ist eine Kombination aus „hohem Ohr“ – das ist Gottes Ohr – und dem Eisenschuh des Märchens. „Laufe, Stolz Eisenschuh, hohes Ohr!“ – das hat natürlich in der Schnelligkeit etwas von der surrealen Bewegungsweise. Aber es ist eine genaue Antwort auf die vorher gegebene Frage. Die wollen nicht. Da ist etwas, das will nicht. Na dann: „Laufe, Stolz Eisenschuh“. Je stolzer du bist, desto eiserner ist dein Schuh. Und „hohes Ohr“ ist die Vorbedingung für alles. Irgendwie scheint ein Gott zu existieren, mit dem man reden darf, der hört aber nicht: Laufe! Und alles das ist in dir. Das ist ein sehr schönes Bild. Da ist auch noch ein anderes Bild: „Wie das Tun ist das Leben nicht Erfüllung einer Forderung.“ Das war für mich eine Erlösungsstelle. Das war die Entdeckung: Wir sind nicht da, um Aufgaben zu erfüllen. Auch nicht vorgegebene. Wir sind überhaupt da. Tun und Leben. Heute bin ich diesen Unterscheidungen besser gewachsen. Aber damals waren es die ersten scharfen. Und daran sehen Sie, daß man scharf sein muß. Es ist wie mit dem Messer, gerade so geteilt.
Als ich in den 80er Jahren aus den Winkelzügen las, war es nicht mehr so, daß da einfach Unverständnis war. Ich erinnere mich, in Dresden, nach der Lesung in einer Galerie, kam in der Straßenbahn eine Frau in so etwas wie einem Dirndelkleid – damals für mich der Inbegriff der Dummheit – auf mich zukam und sagte laut: „Jetzt weiß ich, was ich soll, ich soll mich da reinschalten.“ Das war wunderbar. So etwas habe ich dann übrigens öfter gehört. Da war ich offenbar wirklich in einer Art Entwicklungsphase mit anderen gleich. Sonst hätte sie das nicht wahrgenommen. Dazu kommt ja, daß es eine abgesendete Sache ist, und nicht eine strategisch irgendwohin wandernde. Natürlich muß man sich in der Absendung Strategien entwickeln. Aber die sind dann praktische. Die gehen dann von Schritt zu Schritt.
Helbig: Gab es bei den Winkelzügen auch Reflexe auf Gelesenes? Eines Ihrer Lieblingsworte, allerdings sparsam gebraucht, ist mithin. Das Wort löst bei mir z.B. einen Kleist-Reflex aus, etwa auf den Kleist des „Marionettentheaters“: „Mithin müßten wir wieder vom Baume der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?“
Erb: Das ist fein. Aber ich denke sehr körperlich. Ich denke sehr räumlich, konkret und körperlich. Wenn ich sage mithin, heißt das gleichzeitig auch hin, heißt das mit hin. Es kann auch mal sein, daß ich mich in dem Charakter eines Wortes irre. Aber das ist nicht sehr häufig. Bei dieser Art von die-Sprache-in-Gebrauch-nehmen kommt es auch leicht vor, daß man die Etymologie von einem Wort errät.
Helbig: Auch die Akribie der Winkelzüge erinnert mich an Kleist, an dessen akribischen Versuch, Kant zu verstehen, an die Akribie der Brautbriefe und den akribischen Drang, das deutsche Drama zu revolutionieren. Auch dieses auf der Grenze sein, dieses Nie-wissen-wohin. Dieses Vor-dem-Niemandsland-stehen. Bei mithin geht es immer um etwas. „Mithin müßten wir wieder vom Baume der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?“ Das finde ich ja in den Winkelzügen wieder. Alle ihre Helden wollen ja wieder vom Baume der Erkenntnis essen, um frei zu kommen, um das wiederzugewinnen, was sie verloren haben.
Erb: Ja, ja. Das ist eine doppelte Verneinung. Einmal essen: Sündenfall. Zweimal essen: Gut. Das ist eine wunderbare Sprache. Was für ein Übermut. Wenn man das jetzt so versteht: „Einmal ist keinmal“. Dann machst du es noch einmal, und keiner wird kommen, dich aus deinem Paradies zu vertreiben. Die Probleme sind gelöst. Das ist wirklich sehr schön. Vor allem ist es so unerwartet. Und süß ist dieses mithin.
Helbig: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das ist das „aleph“. Das ist bei Borges fingergroß. Wie groß ist Ihr aleph?
Erb: Oh, da habe ich einfach diese kleine Muschelform von irgendeiner Zelle, was man auch im @-Zeichen hat und was auch das alpha sein kann. Das habe ich gesehen, das habe ich vor Augen gehabt. Ich dachte: Donnerwetter, das gibt es ja wirklich. Ich habe es aus meinem eigenen herkünftlichen Denken. Das will ich betonen. Es gibt solche Sachen, die mehrfach auftreten. Sonst wären sie gar nicht real. Das ist nicht schlichthin ein Eigenbau von Borges. Das ist in der Beobachtung, etwas, was man spürt. Etwas, was man erst rezipiert, ehe man es produziert.
Helbig: Vom aleph erfahren wir in den Winkelzügen: „Mein aleph schickt mich zu allem, was ich tue.“ „Mein aleph, alt und jung, / wie eine Kröte, / ist das kleine, nicht alternde / Kind, das sich unsterblich / die Mutter erschafft.“ Ich finde, das „Kind, das sich … die Mutter erschafft“ korrespondiert mit dem Text „Teilräume, Zeiträume, Würfel“ in die crux.
Erb: Oh, da war es doch wohl die Realmutter in der Eifel.
Helbig: Es korrespondiert mit dem Mutter-Defizit, von dem der Text ja auch spricht.
Erb: Wissen Sie, was mir jetzt einfällt. Die Mutter in diesem Bild ist genau dieselbe Mutter wie die Mutter in der Eifel. Ich wußte es nicht. Nur, die Mutter in der Formel ist nicht das, was die Mutter hätte sein sollen. Sie ist das Nicht der Mutter. Diese Instanz da, diese merkwürdige.
Also, ich habe kein zweites Leben, ich kann mich nicht noch einmal mit allem …
Helbig: In einem Interview sagen Sie: „Das Subjekt ist einfach das Wesen, das die Spannung aufbringt, leben zu wollen und sich nicht ersticken zu lassen…“
Erb: Das Subjekt ist das produzierende Ich.
Helbig: „… Und das ist mehr … Da fangen schon diese von der Umwelt hineingetragenen Formen an zu wirken, ergeben Motivketten. … Sie versuchen sich zu erkennen, diese Formen. Es sind Dinge, die man nicht immer festmachen kann – das arbeitet auch von allein“. Das ist eine Erfahrung, die auch Herta Müller im Gespräch vorangestellt hat, wenn sie sinngemäß sagt: Ich muß mit aller Behutsamkeit an den Texten arbeiten, denn die Texte wissen, wo sie hin wollen.
Erb: Eher als auf den im Text hergestellten Zustand schaue ich auf das produzierende Ich, das den Text hervorbringt. Ich wäre nicht ich, wenn ich den Text selber heiligte. Ich bin nicht im geringsten fetischistisch. Es gibt für mich nicht etwas, das außen zu heiligen ist. Es gibt überhaupt nichts Heiliges in dem Sinn. Weil das ja schon eine Fetischisierung wäre. Aber die Anerkennung eben. Wenn ich jetzt z.B. einen Text mache – ich habe aus den Notizbüchern etwas genommen und es entwickelt –, dann sehe ich nach einer gewissen Zeit, da ist etwas nicht klar. Dann gehe ich wieder in das Notizbuch zurück und schaue dann ratlos auf diese Seiten und hoffe, den Ursprung des Gedankens wieder finden zu können. Sehr interessant sind Fehler. Du mußt sehr achten auf den Fehler, den du machst. Denn der will es vielleicht, der enthält es vielleicht, wo es hingehen soll. Du willst gehen, aber du machst es nicht richtig. Aber in dem, wo es richtig liegt, ist es nicht, wo du hinwillst. Da hast du die paar Stufen genommen, aber bist noch nicht im Haus. Ich lausche auf das, was an Antworten zusammengekommen ist, und überprüfe, ob es stimmt.
Helbig: An anderer Stelle sagen Sie: „Ich bin die Zeugin dessen, wovon ich rede, ich bin die Blackbox, ich kann mich zu allem gebrauchen, das ist eine Art ichloses Ich.“
Erb: Ja. Da haben wir das Nicht wieder drin. Es gibt da noch etwas anderes. Ich habe die Vorstellung, daß das Ich ein Integral ist. Das Integral ist für mich die bündige Form für das Ich. Das ist eine optische Vorstellung. (Streicht mit der Hand durch die Luft.) Eher als in mir selber verwirkliche ich es in einem Gedicht. Was ich dann abgebunden nenne. Es hat jetzt entbunden. Es ist jetzt abgebunden. So daß also darüber hinaus dieser Punkt von wiederum einem Nichts entsteht, der aber ins Freie führt.
Helbig: Ich möchte gern zu dem Gedicht „Traum“ aus Kastanienallee eine Frage anschließen…
Erb: Da war die Wortfolge übrigens wirklich, authentisch, aus einem Traum. Und auch automatisch war der Anfang von „Eile mit Weile“. Ich hätte das nie geschrieben, wenn ich nicht bis zu dem Halstuch-abbinden alles in einem Zug runtergeschrieben hätte. Das weitere hatte ich dann daraus zu entwickeln. Bis dahin kam der Text automatisch, ohne Idee vorher und ohne zu zögern. Das Automatische ist bei mir keine Methode. Ich lasse es lediglich zu. Alles, was auf mich zukommt, ob das ein Text ist oder eine Figur, lasse ich zu. Warum sollte ich nur irgendwelche vorgeprägten Dinge zulassen. Das wäre ja widersinnig. Da bin ich nicht gehorsam.
Helbig: Das ist ja meine Feststellung, daß in diesem Text nahezu alles drin ist, was Elke Erb an Formen präferiert. Vielleicht finden ja spätere Untersuchungen heraus, daß in „Eile mit Weile“ auch schon Vorgeformtes zu dem später noch Zu-Schreibenden enthalten ist.
Erb: Das haben Texte an sich. Das habe ich bei anderen Autoren auch gefunden. Sonst könnte ich nicht schon am Anfang erraten, was danach kommt. Gewöhnlich ist es so, daß ich eine Bemerkung mache, und zwei Seiten weiter führt der Autor etwas aus, das dieser Bemerkung entspricht. Ein Synonym oder etwas anderes. Ganz pünktlich. Ich bin darauf gekommen, daß ein Text seine Möglichkeiten schon in sich enthält und dies signalisieren kann. Wenn man ihn aber zur Rede stellen will, dann verdirbt man sich diesen Zugang.
Helbig: Im Kommentar zum Gedicht „Traum“ stellen Sie zunächst einmal fest: „nicht meine Sprache“, und später: „Ich habe mich verändert und seinen Ort (den Ort des Traumes) erreicht“. „Veränderung“ ist aber vorwärtsgewandt, das heißt, das Unbewußte war vorausgeeilt. Kann man also sagen, daß der Kairos, der entscheidende Zeitpunkt, der Ort ist, wo sich Unterbewußtsein und Bewußtsein in einer Sache treffen?
Erb: Wenn das Unbewußte vorauseilte, hieße es ja, daß es fertig wäre. Ich denke jedoch, daß das, was so entsteht, eine Verbindung ist von dem, was ist, mit einem anderen, das gerade wird. Daß es also eine aktive Geschichte ist und nicht ein Abholen von schon Bereitem. Ich denke grundsätzlich so. Man sieht viel zu wenig Bewegung in allem. Schauen Sie sich das im Gedicht vorkommende Wort „Land-Aas“ an. Das Wort kommt bei mir sonst nirgends vor. Land liegt da wie Aas. Verfaulend irgendwie.
Aber ich sage es noch einmal: Ich hole das Unbewußte nicht einfach ab. Ich sehe das verbunden. Es würde sich nicht melden, wenn sich nicht ein Moment des Noch-nicht mit ihm verbinden würde. Es wird geholt. Und damit ist es nicht mehr einfach nur das Unbewußte. Das wäre zu bequem, wie: Entdecke dich selbst! Oder diese ganze esoterische Wirtschaft. So ist es nicht. Und schon gar nicht die Spionage, die der Freud da anfängt. (Lachen) „Du willst Deinen Vater töten, deswegen weinst Du so bitterlich über seinen Tod“. Das Unbewußte als das Verdrängte; wenn es vorkommen will, dann soll es gefälligst selbst vorkommen! Zu seiner Zeit. Das heißt, ich lasse einem abgesunkenen Wissen oder Meinen noch einmal die Entscheidung, daß es sich selber bestimmt. Die Auffassung von einer in allem verborgenen Zielgerichtetheit ist bei mir sehr stark. Und das hat sich auch entwickelt. Mit den Winkelzügen wurde sie zum ersten Mal richtig aufgedeckt. Du glaubst, du tust nichts, in Wirklichkeit spielt sich ein Prozeß ab. Sagt z. B. jemand zu mir: „Ich hab überhaupt kein Geschichtsbild mehr!“, dann weiß ich, daß sich dessen Geschichtsbild gerade umbildet. Dazu kommt, daß im sogenannten Oberstübchen eine Ignoranz herrscht gegenüber diesen unterirdischen Prozessen. Keineswegs sind sie amorph, nicht Abgrund noch Bestie, sondern themendienliches striktes Arbeiten von einer Stufe zur anderen. Unglaublich. Und das geht sehr weit. Das Unbewußte klingt als Schlagwort ziemlich grob. Das ist viel mehr, das ist ein ganz aktives Gebilde.
Die Kastanienallee zu schreiben, war für mich sehr anstrengend. Je mehr ich an gewisse Sachen kam, desto bedrängender wurde es. So daß ich nachher dasaß und weinte. Das war auch so eine Art innerer Auftrag, daß ich mir sagte: Du mußt das jetzt insgesamt formen und dich erinnern, wie war das mit jedem Text? Und dann kommt man an die Texte, die das eigentlich verursacht haben.
Helbig: Das aleph hat Sie offenbar schon damals losgeschickt, Ordnung zu machen. Auch wenn es in der Kastanienallee noch nicht erwähnt wird.
Sie unterscheiden das offene und das geschlossene Gedicht. Wann entscheidet sich, in welche Richtung das geht?
Erb: Das geschlossene Gedicht ist ein Resultattext. Das offene Gedicht ist transportierend. Es nimmt während des Laufs die Bewegung oder die Zeit in sich hinein. Wohingegen das Resultatgedicht keine verlaufende Zeit kennt.
Helbig: Das geschlossene Gedicht kondensiert einen Gedanken, wie Pound und die Imagisten sagen würden, das offene Gedicht breitet einen Gedanken aus?
Erb: Das offene Gedicht sagt: Wir tun das hier, und daß wir es tun, ist es schon. Natürlich muß es auch die Qualitäten eines geschlossenen Textes haben. Als ich das unterschied, war es anfänglich nur die Befreiung von der geschlossenen Form. In den Winkelzügen nenne ich diese Texte Wortmeldungen, dinglich oder sogar Stein. Die Steine habe ich ihnen in ihr Getriebe geschmissen.
Helbig: Wie stehen Sie zum Aufgreifen von tradierten Formen? Lehnen Sie das ab oder halten Sie es wie die Spanier der Generation von 27, die sagten, Freiheit der Form ja, aber die Freiheit schließt den Reichtum der tradierten Formen nicht aus?
Erb: In der Kastanienallee habe ich das formuliert: „Ich hätte die tradierten Formen als Sinn für meine Zeit begreifen müssen.“ Das Sonett wird geboren, wenn der Atem dafür da ist. Es gibt manchmal Ansätze bis hin zu Sonetten. Allerdings habe ich sehr hohe Achtung vor diesen Formen. Vor kurzem las ich einen Prosatext von Petrarca in der Übersetzung und warf ihm langweilige Standards vor. Dann sah ich im originalsprachlichen Text nach und hörte auf einmal seinen eigenständigen Geigenton. Man kann nicht einfach nehmen, was eine andere Zeit gemacht hat. Die Existenz dieser Formen ist mit deren Herkunft verbunden. Man kann das nicht einfach rauben. So gesehen war schon die Aufrichtung des Klassik-Idols eine Beraubung der Antike, der Griechen und Römer.
Helbig: Kommt es beim Übersetzen auch auf diesen Geigenton an, ist dabei das Lautsprachliche der maßgebliche Ausgangspunkt?
Erb: Nicht maßgeblich. Allerdings ist es so, daß sich die Lösung für einen Vers manchmal erst in etwas kaum Faßlichen, etwas Lautlich-Rhythmischem, nur Hörbarem, ergibt. Das Lautliche kann die Ermöglichung eines Verses sein, der sich rein aus der Bedeutung der Worte nicht erschließt. Man lernt das ein Leben lang. Vor kurzem habe ich begriffen – das war jedoch bei der Übersetzung von Prosa –: Wenn ich dieses oder jenes Wort nehme, dann muß es so oder so stehen, damit es mit einer gewissen Geschwindigkeit ins Ohr kommt. Sonst stimmt es nicht. Die Tempi müssen stimmen. Da stehen Sie zwischen Redlichkeit und Trick. Der Trick ist die vollendete Redlichkeit. Ist das nicht ein hübsches Paradoxon?
Helbig: An einer Stelle drängen Sie in bezug auf das Übersetzen darauf, „daß man die Worte ins Ambivalente bringt, daß sie nicht geheißen werden, etwas festzunageln.“ Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man sich nur auf eine Interlinear-Übersetzung stützen kann. Man muß ja auch dem Original gerecht werden, in dem das Ambivalente ja auch da ist und ein Reiz des Textes ist.
Erb: Das ist noch eine andere Geschichte. Das ist die Mehrdeutigkeit. Wenn Sie das schaffen, das so zu halten…
Helbig: Wird man während des Übersetzens aufgeladen und kann von dieser intensiven Beschäftigung mit Sprache auch für die eigenen Texte profitieren?
Erb: Ich habe es nie so erlebt. Als direkte Übermittlung.
Helbig: Bei mir hat sich der Eindruck eingestellt, daß die Beschäftigung mit Friederike Mayröcker, im Zusammenhang mit der Herausgabe einer Auswahl ihrer Texte für Reclam Leipzig, für Sie eine Art Katalysatoreffekt hatte, der die eigene Produktion antrieb, daß die Beschäftigung mit Friederike Mayrocker sich als Kraftfeld erwiesen hat, das ein Aufladen ermöglichte, das zusätzliche Kräfte freisetzte.
Erb: Das war bewußt eingeleitet. Da war auch schon etwas vorgegangen. Eigentlich war es immer so, daß die Texte sich unaufgefordert autonom und eruptiv entwickelten. Eine Aktivität im Vordergrund war dabei von Vorteil. Gut war es, wenn im Vordergrund ein Text lief, dann konnte der Hintergrund, alleine und in Ruhe gelassen, seine Produktionen liefern. Dann war es aber so, daß an diesen Hintergrund Fragen gestellt waren.
Bei Friederike Mayröcker ging es auch darum, daß sie für mich ein Teil der neuen Gesellschaft war. Und ich hatte mir den Auftrag gegeben: Laß dich nicht führen – denn, ein Jahr lang war ich nur gerufen worden, um irgendwelche Statements abzugeben –, sondern achte selber auf deine Bewegungen, deine psychischen Regungen und hör sie ab und nimm sie auf! Du mußt auf dich hören! Das ist auch ein Können, das sich entwickelt. Übrigens ist es nicht so unmöglich, beides gleichzeitig zu tun, zu rezipieren und selbst zu produzieren Wenn Sie meine Reaktionen ansehen, dann sind die sehr verschieden. Mal reagiere ich auf ein einzelnes Wort, mal auf ein Motiv. Da kann man eine Klassifikation anlegen, bei welchen Gelegenheiten ich worauf reagiere. Ich habe ganz verschiedene Arten der Aufnahme. Dann gibt es ja noch diesen direkten Text, „Lesebegegnung“, wo ich auch an sie schreibe. Das ist alles in dem Band Unschuld, du Licht meiner Augen enthalten. Die einen Texte des Bandes gehen auf sie zurück, die anderen nicht. Zum Beispiel „Angekommen in St. Médard“ hat gar nichts mit ihr zu tun. Wie soll man das sagen? Da haben sie jetzt so ein Gesamtwerk vor sich, das ist doch sehr intensiv – Friederike Mayröcker. Da kann es doch nicht sein, daß ein lebendes Wesen sich nicht auflädt. Logischerweise. Nicht? Das kann ja gar nicht sein, daß es so wäre, als wäre ich da in einer Energie-Steppe gewesen. Aber eher als Kraftquell würde ich sagen Aspektübernahme, und dann die Bindung, die Kraft ist jetzt die Bindung, daß ich sie verstehen will. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich nur von einer anderen, die gut geladen ist, Kraft übernehme. Ich wollte sie ja rational verstehen. Das ist eine Anstrengung gewesen. Wenn sie in diesem Zusammenhang das Wort Auslöser einführen, dann wird es noch etwas adäquater. Da gibt es diesen Text „Über den Winter“: „Was Du schreibst, ist ein neues Land, sage ich“. Das ist sie, die ich meine. Wenn Sie das jetzt mal nehmen, das ist ein gutes Beispiel, ein sehr intensiver Text, und auch neu für mich. In mehrfacher Hinsicht. Da ist andererseits auch Thema, was das Neue überhaupt betrifft. Der Wechsel der Gesellschaftsordnung, dieses Ganze, dieses, wo man nie ahnen konnte, daß sich das mal ändert. Dieses Neue. Und dann die Angst vor dem Wechsel. Und dann sehen Sie, ich bin selbst geladen. – Die Herausgabe war nicht mein Vorschlag, das ging vom Reclam Verlag aus. Ich weiß nicht, wie ich mit eigenen Texten reagiert hätte, wäre der Auftrag zeitlich tief im Osten an mich ergangen…
Helbig: Eine letzte Frage, in die umgekehrte Richtung: Welche Chancen hat das Gedicht, sich künftig zu behaupten?
Erb: Ich denke, daß selbst ein unverständliches Gedicht eine sehr gute Begegnung ermöglicht, die den Lesenden auf sich selbst weist. Das ist bei Bildern ähnlich. Es geht ja um Konzentrate. Und man konzentriert sich die ganze Zeit. Sie bekommen also während des Vorgangs, obwohl der nicht die Lösung bringen muß, sich selbst wieder. Ich meine, daß sich das qualitativ und nicht quantitativ definiert, was dann stattfindet.
Wenn die Lyrik totgesagt wird, und das wiederholt sich ja, sprechen, denke ich, die so reden, von toten Lesern, von sich selbst. Und sind vielleicht sogar erleichtert. Für meinen Part habe ich nie begriffen, was das soll, ich schreibe noch ein Gedicht und noch ein nächstes, und zwar nicht dasselbe wie vorher, sondern ein neues, mit neuen Eigenschaften. Und wenn, wie die Anthologie Lyrik von JETZT zeigt, eine ganze Generation von jungen neuen Lyrikern auftaucht, sollten diese Leute zugeben, daß sie sich geirrt haben. Das tun sie nicht. Hören Sie nicht erst hin!
Helbig: Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ostragehege, Heft 34, 2004
Es war niemals so,
daß wir zwei kunstbesessene Damen dargestellt hätten
− Die Dichterinnen Elke Erb und Brigitte Struzyk. −
Annett Gröschner: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Elke Erb: Oh, das ist interessant, wie haben wir uns kennengelernt? Das wird uns gar nicht einfallen, was Brigitte?
Brigitte Struzyk: Wie habe ich dich eigentlich eingefangen? Ich hab dich einfach mal mit in die Wohnung genommen, und da unterhielten wir uns lange.
Erb: Du hast Endler Gedichte in den Briefkasten gesteckt.
Struzyk: Ich hab sie nicht in den Briefkasten gesteckt, sondern ich habe geklingelt.
Erb: Irgendwas war mit einem Briefkasten.
Struzyk: Endler hatte mir was zum Nachdichten gegeben.
Erb: Da muß er dich also schon gekannt haben.
Struzyk: Ja, aber nur von Veröffentlichungen her. Persönlich kannte ich ihn noch nicht.
Erb: Brigitte, ich weiß jetzt, ich habe dich auf diesen west-ostdeutschen Literaturgesprächen kennengelernt, wo der Grass immer kam.
Struzyk: Stimmt, bei Schädlich in der Wohnung war das.
Und dann hatte ich eine Freundin aus Weimar, die in der Archäologie arbeitete. Die war vollkommen begeistert von deinen Texten, und deswegen bin ich zu dir gegangen und wollte welche von dir haben.
Erb: Das muß dann aber schon nach dem ersten Buch 1975 gewesen sein.
Struzyk: Ich war ja erst 1976 in Berlin, aber da ging das gleich los. Ich hatte von Endler Texte bekommen und bin hingegangen zu euch, weil ich darüber reden wollte. Er saß über einem griechischen Autor, den er übersetzen wollte, und hatte gerade einen Wutanfall gehabt. Das sah lustig aus, will ich mal sagen.
Erb: Der hatte WutanfäIle, jungejunge.
Struzyk: Du bist ein Stück des Wegs mitgekommen, und so ging das ganze los. Dann fingen wir mit unserer „Gruppe 46“ an. In Bad Saarow hatte der Aufbau Verlag Autoren eingeladen. Ich saß neben Hans Löffler, mit dem habe ich mich gleich angefreundet, und dann waren da noch Bernd Wagner und Richard Pietraß. Dort heckten wir aus, wir müssen nicht unbedingt nach Bad Saarow fahren, um uns zu treffen. So gründeten wir unsere „Gruppe 46“, und irgendeiner sagte, da müssen wir die Elke Erb dazu holen. Wir luden dich ein, und du bist gekommen. Das war Ende 76.
Erb: Ich kann mich auch noch an Gedichte von dir im Briefkasten erinnern. Die hab ich genommen und hab die verändert, als wären es meine eigenen. Ich gab sie dir zurück, und nach einem Jahr kam eine positive Rückmeldung. Du hast darüber nachdenken können. Es war mir damals nicht so bewußt, daß es ja eigentlich verletzend ist, wenn man fremde Texte einfach verändert.
Struzyk: Das war nicht verletzend, das war sehr anregend. Die Gruppe hat sich alle vier Wochen getroffen, und ich habe bis zum nächsten Treffen wirklich geackert.
Erb: Und dann haben wir darauf gedrungen, daß du aufhörst beim Aufbau Verlag, weißt du das noch?
Struzyk: Ja, das war aber erst 1982. Ich hatte im Lektorat Deutsches Erbe 20. Jahrhundert gearbeitet. Was ich in der Arbeitszeit nicht geschafft hatte, nahm ich immer mit nach Haus und machte dort weiter, so daß ich kaum noch Zeit hatte für mein Eigenes. Da hast du immer gesagt, du mußt dich jetzt mal irgendwie entscheiden.
Erb: Ich habe immer gedarbt unter sämtlicher Umgebung. Für mich war das der größte Betrug, die Menschen so festzuhalten. Und dann haben wir die Brigitte da rausgeboxt.
Gröschner: Das war eine Entscheidung, die du selber ja auch mal getroffen hattest, als du beim Mitteldeutschen Verlag aufhörtest.
Erb: Zwei Jahre war ich da und dann in die Nervenklinik endlich. Im nächsten Jahr wieder, und dann hatte der Arzt gesagt, ich kann Sie so und so lange krank schreiben, aber danach muß ich Sie invalidisieren, und dann kommen Sie nirgendwo mehr durch. Und obwohl ich das sowieso für Unsinn hielt, daß ich jemals irgendwo durchkommen würde, hab ich mich nicht invalidisieren lassen. Da hätte ich doch ’ne Rente gehabt die ganze Zeit, hör mal, ist doch toll. Hauptsache, die stört nicht, schreiben wir sie doch invalide.
Struzyk: Da hättest du immer in den Westen fahren können.
Erb: Also, stellvertretend die andere Individualität verteidigen, das habe ich nicht nur in Brigittes Fall gemacht, sonst vor allem mit diesen Nachdichtungen. Da habe ich immer den Autor verteidigt gegen den Übersetzer. Das heißt, gegen die mißverstehende Umwelt.
Gröschner: Aber du bist doch auch selber Übersetzerin, hast du den Autor gegen dich verteidigt?
Erb: Es war, glaube ich, Blok, den ich als ersten übersetzt habe. Es ging immer darum, was der da eigentlich sagt in seiner Zeile. Und das soll leben können, als ob ich auf diese Weise die anderen Individualitäten gebäre, und das ganze Leben sei das, daß man das gebiert, was um einen rum ist, und also verteidigt. Auf der anderen Seite gab es natürlich eine totale Unterforderung durch die Gesellschaft, weil die einem die Intelligenzumgebung versagt hat. Intelligenz galt nichts. Ich weiß noch, wie ich mich freute, als sie die Computer einführten in der DDR, als auf einmal irgend so ein Funktionär sagte, es gibt so und so viel Impulse in der Sekunde – wann hat sowas je gezählt in der DDR, diesem Schlafmützenverein, diesem künstlichen Verdummungsbetrieb. Da darf sich nichts regen, da ist alles von vornherein klar in dem kleinbürgerlichen Bewußtseinshaushalt. Siehst du ja jetzt noch.
Man wußte nicht genau, ob der Staat dieses kleinbürgerliche Denken oder umgekehrt das kleinbürgerliche Denken die staatlichen Angebote sanktioniert hat.
Struzyk: Wobei alles, was seinen Kopf raussteckte aus dieser kleinbürgerlichen Zwergenhaftigkeit, noch eins auf die Rübe kriegte. In der DDR wurden bestimmte Muster der Nazizeit wiederholt, das ist ja das Unheimliche, was ich als eine pure Feststellung erst mal ablehne, weil es die ganzen Herkünfte simplifiziert. Aber wenn mitunter bemerkt wird durch einen Blick von außen auf die DDR-Geschichte: die gleichen Lautsprecher, die gleichen Uniformen, die Art von Massenauflauf, von Freizeitgestaltung, dann stimmt das schon. Und wenn sich was regte, was demokratisch war vom Ansatz her, dazu zähle ich den Jazz, die Mode, dann sind die total wild geworden und haben es verboten.
Erb: Wir haben uns mal darüber unterhalten, was die immer nicht duldeten, und da habe ich dich gefragt, ob du das für möglich hieltest, daß die Ringelsöckchen nicht geduldet haben.
Struzyk: Ja, waren auch mal verboten.
Erb: Und dann hast du gesagt, Stielgläser.
Struzyk: Die auch.
Erb: Es ist ja nicht zu begreifen, wie konnten die etwas gegen Ringelsöckchen haben?
Struzyk: Die waren der amerikanische Imperialismus.
Erb: In welches finstere Kleinbürgerhirn mußt du dich da hineinzwängen mit deinen Vorstellungen!
Struzyk: Es war der Antiamerikanismus.
Erb: Ringelsöckchen?
Struzyk: Klar, das kam von den Amis.
Erb: Wieso denn?
Struzyk: Ringelsöckchen, Kreppschuhe, Be-Bop-Frisur und Überfallhemden.
Erb: Ich lach mich krank. Solche Ringelsöckchen habe ich eigentlich immer als spießig angesehen.
Struzyk: Ja, das war aber das Gegenteil von spießig damals.
Erb: Dann sind also Ringelsöckchen flott.
Struzyk: Ja. ja.
Erb: Siehste, hätte mir das jemand gesagt.
Struzyk: Die waren als Zeichen flott, das war der reine Symbolismus, die standen für was anderes.
Erb: Na, ich kann sie durchaus als flott ansehen. Jeweils unermüdlich rennen diese Ringe um die Knöchel und nicht nur das, um die Hacke, um den Spann, bis zu den Zehen hin, wo es dann endlich eine gewisse Ruhe findet.
Struzyk: Ferse und Spitze uni.
Erb: Ferse und Spitze uni, ja. Das Wort uni kommt auch aus der Zeit.
Struzyk: Das kommt alles aus dieser Zeit.
Erb: Mein Vater kam aus englischer Kriegsgefangenschaft, er war eigentlich Kommunist, zurück in den Osten, und dann hat es nicht sehr lange gedauert, daß er als Westagent abgestempelt wurde. Da hast du schon das ganze Vorwandtheater – er hätte doch nach Sibirien müssen, wenn er Westagent gewesen wäre. Das ganze Kollegium der Oberschule in Halle stimmte ab, daß er ein Westagent ist. Bei zwei Gegenstimmen oder zwei Enthaltungen. Das mußt du dir vorstellen.
Struzyk: Die mußten da ein bestimmtes Kontingent entlarven, glaube ich.
Erb: Er hatte sich nicht so ganz dieser Direktorin untergeordnet. Es war jetzt eine morphologische Bewegung. Ich weiß nicht, ob das so gang und gäbe war, ringsum Westagenten aufzutun. Und ich lief mein Leben lang rum und hatte zu murmeln, daß ich kein Klassenfeind bin. Mußt du dir vorstellen.
Es gibt ein Gedicht von mir, „Nachkrieg“. Im Grunde artikuliert das so ein Lebensgefühl der Jahre, auch wenn es erst zwanzig Jahre später geschrieben ist. Das dauert in solchen festgehaltenen Verhältnissen, bis man sich seiner bewußt wird, aber dann guckt man plötzlich mit den Augen der eigenen Vergangenheit mit achtzehn, ohne es zu wissen. Ich lese es mal vor:
Nachkrieg
Da ist nichts zu suchen, nichts zu rufen.
Rufen nicht, die da sind, nicht mehr da, getötet.
Tod zuckt in meinen Schultern, die sich krampfhaft wegdrehn.
Verdreht, verzerrten Mundes, Fratzen grinsend,
Grins ich die Leute an, die mir begegnen.
Die mir begegnen, schütteln ihren Kopf. —
Das ist ganz deutlich, daß es um eine frühere Gestalt des eigenen Ichs geht. Mir war das aber nicht so bewußt, aber wenn man schreibt, holt man alle Ichs zusammen, nicht? Man spricht doch aus einem breiten Hintergrund, glaube ich. Ich habe immer wieder gesagt, daß wir von einem Wir aus geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du das auch sehen kannst. Also in mir war das nicht Ich, sondern Wir. Bei euch war es schon so, daß ihr nicht vom Ganzen aus seht, sondern von dem Ich als Ganzem. Wie du zum Beispiel auf Majakowski geguckt hast. Den du erstens in Büchern, zweitens als Bild an der Wand hattest, das war eine Sammlung für dich selber. Der Umschlagplatz war nicht das Allgemeine, sondern das Individuelle. So daß du im Grunde nicht imstande gewesen wärst, „Nachkrieg“ zu schreiben.
Ich hab ja mehrere solche Texte, die viel später Dinge wiederholen, wie das eine, „Hochfrisur“: Da sie das Reisighaar aufgeschichtet jetzt trägt, / Magret, die vor die Tür tritt…, das entstand viel später, als diese Hochfrisuren schon aus der Mode waren.
Es ist ja keineswegs eine Memoire, es ist eher eine Programmerklärung. Viel später merkte ich, so verschieden wie die Menschen sind, so verschieden sind auch ihre Ergänzungen, die sie in sich haben, von dem mangelhaften Ganzen. Wenn ich eine Menschenmenge entlang gehen würde und würde sie einsammeln, hätte ich die ganze Fülle, die ich vermisse im Leben. Diese Erkenntnis kam Ende der Siebziger, ich hatte die Scheidung und war auf mich alleine gestellt. Da wollte ich zusammensuchen, was überhaupt gelebt wird.
Struzyk: Da haben wir uns ganz viel unterhalten.
Erb: Aber es war niemals so, daß wir jetzt so, sagen wir mal, zwei kunstbesessene Damen dargestellt hätten.
Struzyk: Eigentlich unterhielten wir uns eher über andere Dinge.
Erb: Wir hatten gewisse Verbrüderungsgespräche, als uns klar wurde, daß wir beide das nicht leiden können, wie sie die Rosa Luxemburg verbrauchen als Gefängnispoetin. Daß wir das absolut abscheulich finden bis ins letzte, Brunnenvergiftung. Wenn du das immer wieder hörst und du murmelst deine andere Auffassung darüber in dich rein und dann hörst du, jemand anderer hat die gleiche Meinung, dann bist du mit dem immer verbunden.
Wenn ich damals in das Wohnzimmer kam, standen dort immer zwei Teetassen vom vorigen Gespräch, dann kam der nächste, und dann hab ich die zwei abgewaschen und die nächsten zwei Tassen hingestellt, und in diesen Gesprächen, ständig, sagte ich mir: Menschen wie aufgeschlagen, also wie man Bücher aufschlägt. Ich wußte, ich hatte Schwierigkeiten, das Wort „schlagen“ aus mir rauszubringen, aber „aufgetan“ kannst du nicht sagen, das hört sich kitschig an. Sicher habe ich als Rheinländerin eine Geselligkeit an mir, aber andererseits ist es auch eine Formelgeschichte. Es ergibt sich, daß ich auf viele gucken muß, um die Fülle wiederzubekommen, die durch diese Verödung durch Kleinbürger und Sozialisten passierte. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in Westdeutschland gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht wäre ich in irgendeinem Fach gelandet. Also ich hätte nicht so einen Überbau wie Literatur gemacht, sondern eine ordentliche Sache, denn das fehlt mir sehr. Der ganze Aufbau der Arbeit hatte so was Verächtliches an sich und verdarb ihre Würde. Einmal erinnerte ich mich an das Wort „Lehrgebäude der Biologie“, das hatte etwas Intaktes. Und dann ihre üblen Parteikämpfe, wo sie die anderen ein- und ausgeschlossen haben. Bissige und tödliche Kämpfe und nichts anderes, fast nicht mehr benennbar, sie haben Glaubenssätze benutzt. Der ganze Marxismus ließ sich nicht mehr erkennen, war so ein verschmortes Ding, so daß wir ihn weggeworfen haben.
Struzyk: Aber ihr seid doch ziemlich heftig eingestiegen, zumindest in den fünfziger Jahren.
Erb: Ja, da war ich aber noch nicht dabei.
Struzyk: Aber Leute wie Endler und Mickel sind heftig eingestiegen in diesen Marxismus, aber nicht in der Form wie die Kleinbürger ihn in irgendwelchen kurzen Leitfäden durchzogen und sich eigentlich nur die Sachen rausholten, die sie für ihre Parteikonferenzen brauchten. Von Leuten wie Mickel wurde er richtig heftig durchdekliniert. Das „Kapital“ wurde auseinandergenommen und auf Brauchbarkeit und Wortmaterial und Gesellschaftsmodelle abgeklopft.
Erb: Und da war das Bauwesen wieder da.
Struzyk: Ja, da wurde gebaut.
Erb: Da war das Gebäude, das Gesamte, da war Anerkennung einer Leistung überhaupt. Der Mickel lebt heute noch davon. Auch Rainer Kirsch, was übrigens inzwischen schon wieder schön wirkt. Es ist so, als ob das Schöne anfängt zu summen. Rainer Kirsch war nach der Wende ein bißchen merkwürdig, so ein bißchen Don Quichotte ähnlich, wie er entsetzt war, daß den westdeutschen Interviewer die Veränderung des Blankverses gar nicht interessiert.
Man muß auch bedenken, die meisten kamen aus Arbeiterhaushalten. Der Marxismus war eigentlich das erste, was an solchen Denkgebäuden auf sie kam.
Struzyk: An geistiger Nahrung. Es ist ja auch ein ernsthaftes Angebot.
Erb: Ich weiß noch genau , wie ich beim Zahnarzt sitze, irgendwo da unten in der Brunnenstraße, und neben dem Behandlungsraum ist sein Wohnzimmer. Er macht die Tür auf und geht was holen, und ich sehe diesen wuchtigen Bücherschrank, den Mitteltisch auf dem Mittelteppich, die Mittellampe, und hab eine Sehnsucht nach einer intakten, geistig aufgebauten, stabilen Welt, wo noch ordentlich Lehrbücher sind. Wir waren in der Sprache sehr genau, da konnte kein Pfusch passieren, es gab schon fast einen fundamentalistischen Anhauch. Aber das hatte einen Sinn. Es ging auch darum, das, was die machten, zurechtzurücken. Natürlich war da auch eine, nennen wir es jetzt mal so, Utopie, die Idee, da ist eine Gesellschaft und soll menschlich miteinander leben. Dafür gibt es Gesetze. Der Kapitalismus ist ein Gesetzwesen von wirksamen Gesetzen, von nicht kodifizierten. Und die waren Schuld daran, daß der Mensch unmenschlich sein kann. Und deswegen konntest du um so leichter denken, muß man ihm doch helfen, dem Menschen. „Auf die Erde voller kaltem Wind kamt ihr alle als nacktes Kind.“
Gröschner: Und wie war deine Rolle dort in dem Kreis?
Erb: Weiß ich nicht.
Gröschner: Hast du am Rand gestanden?
Erb: Ich weiß nicht, was Rand ist.
Struzyk: Du hast mal erzählt, daß dich etwas immer abgehalten hat, dich richtig einzumischen in diese Gelehrsamkeit, die sich immer die neuesten Erkenntnisse präsentierte, ob nun über Versmaß oder Existentialismus. Du hast dich für andere Sachen interessiert. Dein Zugriff auf die Sprache war ein anderer.
Erb: Da ging es nicht um Moderne, sondern um das Gesamtgebäude von Klopstock her. Das haben sie geholt. In diesen Leuten ist ja ein Baubewußtsein. In mir ist das nicht drin, weil ich ja erst einmal diesen Orientierungssinn nicht habe als Weib. Ich bin ich nicht der Jäger, ich brauche den Überblick nicht. Ich bin diejenige, die bei den Kindern bleibt und Rhabarberpflanzen in diesen Schlamm bohrt mit den Fingerchen, und dann wächst es, mehr tu ich nicht, das ist ja fortgesetzt so. Ich hatte einfach nicht diesen Blick, nicht daß ich mich für etwas anderes interessiert hätte, das ist nicht so. Ich habe aber begriffen, daß es so ein einschüchterndes Wesen hatte. Ich mußte mir das übersetzen, ich konnte das nicht bei dem lassen, wie es sich äußerte. Für mich hieß das, die wissen immer, wo die Pfifferlinge im Wald wachsen. Der eine kennt die Pfifferlingsstelle in dem Wald und der andere im nächsten. Ich habe mir das erst mal in lebensnähere Formeln übersetzt, denn es war befremdend, wirklich, da hast du recht, das war etwas, was uns getrennt hat.
Struzyk: Und mir fällt dabei eines deiner Gedichte ein, von diesem Uferschlamm, wo von dem Gezweig des Baumes so eine Kruste sich um die Zweige legt.
Erb: Lippen, die Lippen.
Struzyk: Das war für mich was ganz Unerhörtes, weil solche, sagen wir mal jetzt „Nebensächlichkeiten“, solche ganz grundlegenden und kaum wahrgenommenen Elemente in den Texten von den Kollegen eigentlich nicht vorkamen. Ich hatte immer eine große Achtung vor den Dingen, die nicht angesehen werden, die man achtlos hinnimmt. Daß du dich um die gekümmert hast, hat mich gerührt. Das war eine Qualität. Ich denke, dieser Unterschied von Wir und Ich hängt ja auch mit dem Gesellschaftsentwurf zusammen, den wir nicht mehr für möglich hielten.
Erb: Meine eigene Erklärung, warum sie sich auf den Marxismus so eingelassen hatten, war, die wären ja völlig stumpfsinnig gewesen, wenn sie auf das Spielangebot, für die Gesamtgesellschaft zu denken, nicht eingegangen wären. Es hieß doch, auf dich kommt es an, auf uns alle. Und dann diese doch ordentlichen Aufdeckungen von Gesetzen.
Struzyk: Da war ja auch eine grobe Aufforderung mit drin – grob mein ich jetzt als unbehauen, als plebejisch, in dem Sinne wie: Kümmere dich jetzt darum, daß du zu deinem Recht kommst. Das sind dann diese Texte, die mitunter sehr didaktisch sind. Aber immer so nach dem Motto: Leute, das ist euer Ding, macht es.
Erb: Und dann leuchtet wieder die Sache aus jedem Knopfloch. Weißt du, an wen ich gerade gedacht habe? An den Ralf Schröder, der im Gefängnis gesessen und trotzdem nie aufgehört hatte, Sozialist zu sein oder Kommunist, und den hatten sie verknackt wegen Ulbrichtstürzerei.
Struzyk: Ja, das war diese Harich-Geschichte, 1956. Es gab eine ganze Menge solcher Leute, die waren Instanzen, an die konntest du dich halten.
Erb: Die haben auch immer wieder Leute, die es gut oder die es ernst meinten, hervorgebracht mit den Koordinaten, die sie angegeben hatten.
Aber eigentlich hätte ich angenommen, daß so ein Kleinbürgertum, wenn es an der Macht ist, Staat machen will, und da muß der Staat richtig toll sein, er muß glänzen, muß große Gebäude und großen Pomp haben. In der DDR ging ja über alles so ein verachtender Zug, jeder normale Bürger hat den Staat verachtet.
Gröschner: Aber nur so lange, wie er in seinen eigenen vier Wänden war.
Erb: Ja, aber sicher. Da müßte eigentlich auch diese Kleinbürgerlichkeit ein bißchen zersetzt worden sein, habe ich immer gedacht. Und deswegen waren die Leute auch so ausgesprochen giftig immer. Im Bus, in der Kaufhalle, es gab Zeiten, wo du regelrecht Giftspritzer bekamst von ihnen.
Struzyk: Die waren voll mit Gift. Da brauchtest du nur zu pieken.
Erb: Weil, wenn du jetzt den eigenen Mikrokosmos hast, den aufgeräumten Haushalt, dann muß es dahinter glänzend weiter gehen, in ihren Augen, und das ging ja nicht, da brillierte immer der Westen.
Struzyk: Der glänzte.
Erb: Der glänzte, ja.
Struzyk: Das war der Widerglanz eigentlich.
Erb: Da lagst du im Schatten, und das ist Streß.
Struyzk: Aber was mir sofort einfällt angesichts dieser giftigen und auf der Stelle tretenden Existenz: Ich werde nie vergessen, wie glücklich du einmal Ende der siebziger Jahre warst. Da bist du in einer der Nebenstraßen bei deinem Arkonaplatz in einem Weinladen gewesen und hast dich mit der Weinhändlerin ausgiebig unterhalten über die Vorzüge von jener Sorte, von dieser, und die hat dir alles vorgeführt, und du warst begeistert, daß ein Mensch so reden kann und sich kümmert um das, was er da als Ware zu stehen hat.
Erb: Das meinte ich mit Gebäude, gegen das gehalten, wo alles kaputt in eins fällt und verschmort und nichts mehr gilt. „Sachkunde“, wie habe ich diese Geschichte immer geliebt, in dem Buch von Orbeliani Weisheit der Lüge, eine Fabelsammlung aus Georgien, 17. oder 18. Jahrhundert. Ein wunderbarer Arzt lag im Sterben, war krank, und lauter Ärzte kamen, aber niemand konnte ihm helfen. Er zeigte den Ärzten immer den Daumen, und sie antworteten darauf nicht. Aber der, der zuletzt kam, der zeigte den Daumen und den Zeigefinger. Und das Daumenzeigen heißt, ich habe hundert Menschen vom Tode errettet, und der letzte sagte damit, er hat zweihundert gerettet, und deswegen wurde der Kranke vor Freude gesund. Für mich war das immer diese wunderschöne Parabel über menschliche Leistung. Wenn man das Wort Leistung sagt, ist schon ein böses Fispern in der Stimme. Aber was ich damit meine, ist etwas, was sehr natürlich ist und was wirklich eine Freude ist, das Können. Wie ich jetzt in der Klinik war, sie haben mir da so ein kleines Ding entfernt am Oberarm, und ich war nicht betäubt, da haben sie so schön miteinander gesprochen, die zwei Ärzte, daß ich wieder ganz glücklich war.
Struzyk: Dabei fällt mir ein, vier Wochen bevor die Irmtraud Morgner starb, habe ich sie besucht in Buch im Krankenhaus. Da lag sie mit ihren großen Augen, es war ziemlich schlimm um sie bestellt, und da sagte sie überströmend vor Glück, ich kenne hier zwei Ärzte, die hätten ins Regierungskrankenhaus gehen können, aber die haben gesagt, wir bleiben bei unseren Leuten, und die behandeln mich.
Erb: Siehste, das meine ich.
Gröschner: Wo hat sich eure „Gruppe 46“ getroffen?
Struzyk: Immer in meiner Wohnung in der Schwedter Straße 266, oben, vierter Stock.
Gröschner: In dem Haus, wo vor dem Krieg die Langesche Höhere Töchterschule war?
Struzyk: Genau, auf dem Hinterhof. Dieses Haus war für mich Brutstätte von allen möglichen Botschaften über den Prenzlauer Berg. Das waren für mich Aussagen, die im Widerspruch standen zu den späteren Legenden über den Prenzlauer Berg.
Erb: Aber hör mal, in der Zeit gab es doch diesen als Prenzlauer Berg bekanntgewordenen Namen noch nicht.
Struzyk: Das ging erst los. Das Haus ist für mich immer noch die Quelle dessen, was ich eigentlich unter Prenzlauer Berg verstehen muß, nach wie vor. Das waren Existenzen, die sich da festgesetzt hatten wie in einem Dorf. In dem Haus waren die alle kreuz und quer und bis über den Hinterhof miteinander verwandt, und dann haben die ihre Sache zusammen gesponnen.
Erb: Meinst du jetzt Leute, die wie du von außen kommen?
Struzyk: Nein, das waren die, die da schon immer wohnten.
Erb: So wie bei uns gegenüber Fettgenheuer, Fettgenheuer im Vorderhaus und Fettgenheuer zwei Häuser weiter?
Struzyk: Genau.
Erb: Und jetzt laß mal ’ne Geburtstagsfeier sein. Da kannste die ganze Nacht nicht schlafen von Fettgenheuer. Und dann ißt du, weil du ja nervlich zerrüttet bist davon, Dormotil, so ein kleines grünes Pillchen, dann machst du das Fenster auf und rufst rüber, und dann rufen die zurück, komm doch her und feiere mit. So, das ist für dich Prenzlauer Berg. Also hör mal, das ist doch aber nicht Prenzlauer Berg! Die haben jedenfalls mit dem, was sich da geistig begab, nichts zu tun.
Struzyk: Gar nichts.
Erb: Obwohl, ich erinnere mich noch sehr gut, wie der Biermann ausgebürgert wurde und die Frau Fettgenheuer gegenüber, die Mutter vom ganzen, kam und wollte bei uns telefonieren und sagte, na, haben Sie denn das gehört, wat sagen Sie dazu, die trauen sich wat, der hat doch jar nischt jesagt.
Gröschner: In einer deiner Geschichten, Brigitte, gab es einen Mann, der Weihnachtsmänner gesammelt hat, war das authentisch?
Struzyk: Ja, absolut. Alles 1:1.
Erb: Um wen ging es da?
Struzyk: Um Albert, der in seinem Küchenschrank Schokoladenweihnachtsmänner gesammelt hatte, von 1922 an. Die hat der nicht gegessen, sondern sich in den Schrank gestellt. Nur die Nachkriegsjahrgänge fehlten.
Erb: Weil es die in der Zeit nicht gab, oder hat er wegen Hunger die Sammlung angegriffen?
Struzyk: Das hat er absolut klar erklärt, es gab einfach kein Stanniolpapier, das hatten sie in der Rüstung alles verbraucht, was weiß ich. Die Weihnachtsmannproduktion setzte erst wieder 1949 ein. Also mit den beiden deutschen Staaten sozusagen.
Erb: Exakt, was?
Struzyk: Und da hat er sich dann auch Weihnachtsmänner aus dem Westen kommen lassen.
Gröschner: Da hat er immer zwei gehabt.
Struzyk: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob er dann immer einen Ost- und einen Westweihnachtsmann hatte. Ich durfte die auch nie sehen, die hat nur Rosa angucken können, die bei ihm wohnte, die war mit ihm vertraut, die hat berichtet, daß die Weihnachtsmänner da stehen und wie sie sortiert sind.
Erb: Wir haben auch mal solche Sammler getroffen, da habe ich mich gefragt, was tun eigentlich die Leute, das weißt du ja gar nicht.
Struzyk: Es gab im Prenzlauer Berg auch die, die aus Streichhölzern riesige Häuser bauten. Oder aus hölzernen Wäscheklammern, es gab zwei Varianten. Wäscheklammern nahmen die, die ein bißchen schneller fertig werden wollten. Da haben die sich in den Läden packungsweise Klammern geholt, die waren sowieso Mangelware, und dann waren die immer weg, ratzbatz, weil sie gebastelt haben.
Erb: Das ist wirklich wie so eine überlebende Dorfbevölkerung, nicht. Ich meine jetzt nicht Kriege überleben, sondern in der Stadt überleben, weil die Stadt sie, da sie sie ja im Proletarischen läßt, geistig nicht mitnimmt.
Ich war mit Eddy am Zionskirchplatz in einer Kneipe, und dort war gerade eine Versammlung gewesen von Sammlern, die löste sich auf. Dann kam der eine an unseren Tisch, weil die ja bei jedem wittern, da wäre vielleicht was. Und der erzählte, daß er Uhren sammelt. Wir haben uns länger mit ihm unterhalten. Das Fazit war, er hat jetzt schon so viele Uhren, und weil sie alle noch gehen, schläft er bei sich auf dem Flur.
Struzyk: Sehr gut, das ist ein Sammler.
Erb: Das war eine bleibende Information. Was man auch immer hörte, waren die Geschichten von Modelleisenbahnern.
Struzyk: Ja, es gab enorme Sachen.
Erb: Ich hatte mal eine Platte gekauft und verschenkt, die ging auch auf das Sammlerwesen zurück. Das war eine Sammlung von Lokomotivenpfiffen.
Struzyk: Die habe ich übrigens auch.
Gröschner: Ich auch.
Erb: Die ist wunderbar. Da sagt immer einer: Jetzt Lokomotive sowieso, und dann geht’s tschu, tschu, tschu, und schließlich hörst du einen Hund bellen, und dann wieder tschuuu. Das war so wie, als würde ich von Hüfte zu Schulter irgendwie die Sammlerbewegung grüßen.
Struzyk: Ja, wunderbar. Aber hier in diesem Buch (…) auch einer der Texte, den ich immer den Westdeutschen empfohlen habe, der sozusagen DDR beschreibt, anders als diese langen Romane. Das sind in der Regel irgendwelche Denkromane, die etwas beschreiben, was sein könnte. Ich muß ehrlich sagen, ich hab nicht so viele gelesen, aber wenn sie wirklich wissen wollten, was DDR ist, sollten sie dieses Gedicht „Schlamm“ zu sich nehmen.
Erb: Das ist aber nicht im Prenzlauer Berg. Das spielt auf dem Lande. Überhaupt habe ich ja diese Union gehabt, das Land und Berlin. Es spielt sicher eine Rolle, daß es nicht Weißensee war oder Pankow. In Pankow zum Beispiel habe ich entdeckt, daß da so geheime Wohnlichkeiten waren, also richtig wohnliche Straßen, was ja in Prenzlauer Berg nicht ist, wo die ja eher das grobe Zeug, die Silos für die Arbeitskraft, hingesetzt haben. In Weißensee war es so, daß ich das Gefühl hatte, da gerinnt jedes Haus zu einer kleinen Insel, und zwar in derselben proletarischen, schütteren Weise. Zwei- oder dreimal war ich dort in der Kneipe, und jedesmal war eine besondere Art von diesem schütteren, komischen Wesen von Weißensee. Schöneweide ist wahrscheinlich noch brutaler als Prenzlauer Berg, denn hier hat es noch irgendwie eine gewisse tänzerische Pose mit den Pumpenschwengelbrunnen auf der Straße.
Struzyk: Du meinst die Pumpen.
Erb: Pumpen, und auch die Hinterhoftristesse, man merkt ja, daß es nicht erst ein Ergebnis unserer Zeit ist. Dieses Hintereinandergehen der Höfe. Ich war mal oben auf dem Dach, da war überall diese Dachpappe, diese geteerte mit dem kleinen, glitzrigen Zeug drin. Als ob irgendwas umgekehrt war, ich war jedenfalls sehr erschrocken darüber. Und einmal bin ich drüber geflogen mit dem Flugzeug und habe diese proletarischen Hinterhofgeschichten von oben gesehen, also Hinterhof, Hinterhof, und das war ganz grauenhaft, es war, als ob das aufsteht und mir hinterherwinkt. Dieses Prenzlauer Berg, wonach du gefragt hast.
Gröschner: Ist dir das, wenn du unten standest, nicht so gegangen?
Erb: Erst als ich auf dem Dach war. Unglaublich, hab ich gedacht, was der Mensch da tut. Und ich gehe in das Märkische Museum, und da waren die Fotos, wie die da gelebt haben in diesen Silos, mit Schlafburschen noch, wo immer die Betten am Rand standen und die Kissen drauf, und dann sitzt die Mutter an der Nähmaschine. Dazu kamen noch Bilder von Baluschek, wo die Arbeiter aus der Fabrik kommen und alle gucken irgendwo hin, isoliert voneinander. Das ist, jedenfalls was die Arbeiterklasse angeht, ein besonderer Aspekt, den gibt es sonst nicht, sonst sieht man die immer als einheitliche Masse, und dann sind die auch immer so kameradschaftlich untereinander. Das ist schon eine Spezifik von Berlin, daß jeder für sich ist, so was Rieseliges, Sandiges im gesamten Wesen, nicht die heitere rheinische oder bayrische Menge, ich konnte es jedenfalls nicht antreffen. Es hatte vielleicht auch mit der DDR zu tun.
Gröschner: Wann bist du hergezogen?
Erb: 1968, als ich geheiratet hatte. Da habe ich sehr lange nicht weit von der jetzigen Wohnung, in der Rheinsberger Straße, Hinterhaus, 5. Etage gewohnt.
Struzyk: Das war eigentlich Mitte, streng genommen.
Erb: Das ist auf der Grenze zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Mitte ist für mich unten bei Bergmann-Borsig. Wo die Luft noch schlechter ist.
Gröschner: Bist du da auch spazieren gegangen?
Erb: Das hab ich versucht, es war umsonst. Das hat mich immer wieder zurückgeödet, ich konnte nicht. Das war eben keine Gesellschaft, die Bilder hatte, an den Wänden stand Firma sowieso, und die gab es nicht mehr.
Gröschner: Also die Spuren, die an den Wänden waren, waren Vergangenheit.
Erb: Das waren Spuren der Vergangenheit, und es hatte keinen Zweck, da nostalgisch was zusammenzulesen.
Gröschner: Bei deinen Texten kommt es mir manchmal so vor, als wenn du da langspaziert wärst.
Struzyk: Na, sie ist ja notgedrungen da langgegangen.
Erb: Ich war nicht Flaneur! Wenn ich in die Kastanienallee ging, dann wollte ich jemanden besuchen.
Gröschner: Wie kam es, daß du einen Gedichtband Kastanienallee genannt hast?
Erb: Weil das der erste Text war, der in diesem Gedichtband auftauchte. Die waren doch immer chronologisch, und da war das der nach dem letzten Band, der erste Text im neuen.
Gröschner: Da war auf dem Umschlag die alte Straßenbahn vor dem Prater drauf, das hatte sofort so einen Wiedererkennungseffekt.
Struzyk: Die Kastanienallee hatte Elke damit mehr oder weniger besetzt. Es gibt Orte, wo du langgehst und sagst, Tag Elke Erb. So wie die Dichter in den Jahrhunderten wohnen, haben sie auch ihre Orte.
Erb: Es ist ja wahr, es würde kein Mensch außer mir darauf kommen zu sagen, in der Kastanienallee roch es nachmittags um halb vier nach toten, selbstvergessenen Mäusen. Es wäre auch niemand darauf gekommen, diesen Satz als Gedicht hinzustellen. Damit behauptet man ja einen lebenden Zusammenhang, der eine Spannung enthält. Und das war auch die Parteikritik, die sagte, was die Erb schreibt, das ist doch alles so banal, was soll das?
Struzyk: Das wirkt auf den ersten Blick unscheinbar.
Erb: Ich bin ja nicht wie Brigitte, die kommt aus einer Stadt und kann vielleicht die Regungen, die in der Stadt zu spüren sind, lesen, weil sie es gelernt hat. Ich ja nicht.
Struzyk: Ich kam mit ganz anderen Voraussetzungen.
Erb: Ich hatte nicht das Gefühl, daß ich im lebenden Ding bin, im Gegenteil, ich weiß noch ganz genau, wie furchtbar mir die Kneipen vorkamen, und erst auf den Fotos von Helga Paris hab ich gesehen, da ist Leben.
Struzyk: Ich will dir den Unterschied benennen. Ich kam aus einer Stadt, die absolut klassizistisches Maß hat, dieses Weimar, wo die Gebäudehöhen, die Verhältnisse von Fenster zu Türen einfach stimmten. Das war für mich erst mal alles verzerrt in Berlin. Und dann war die erste enorme Wahrnehmung, daß in den Cafés der Bierhahn tropfte. In dieser Kleinstadt war ein Café ein Café, da gab es eben Kaffee, aber kein Bier. Und daß das hier anders war, habe ich erst einmal für eine enorme Sensation gehalten, weil es mir wie Freiheit vorkam.
Erb: Das kam dir wie Freiheit vor?
Struzyk: Ja, daß sie Café dranschreiben und Bier ausschenken.
Erb: Für mich war gen au das Gegenteil – die trinken sich ins Grab.
Struzyk: Das war die Konsequenz davon.
Erb: Die sind hier reingesetzt, die trinken sich ins Grab, die schrubben ihr Leben runter, dann ist’s aus. Aber dann kam Helga Paris und hatte Fotos gemacht, wo die miteinander reagieren usw. Ich war nicht imstande, das selber zu sehen.
Struzyk: Es war auch eine andere Art, miteinander zu reden. Nun kann es sein, daß es an dem Haus lag, in dem ich war. Es gab auch viel Streit und Knatsch und alles Drum und Dran. Aber dir Leute waren wahnsinnig gesprächig, vielleicht lag es auch an mir, weil ich neugierig war. Die haben mir Geschichten erzählt, das war enorm. In Weimar war alles abgezirkelt. Da war ein Lebenslauf klar überschaubar, und wenn da irgendeine Unebenheit drin war, wurde die verschwiegen. Während die Unebenheiten in Berlin die Normalität waren. Die waren alle irgendwo mal rausgeflogen, oder eben wie dieser Albert als Trottel durch alles durchgekommen.
Erb: Es war in dem Sinne keine intakte Bürgerlichkeit.
Struzyk: Nein, gar nicht, es war für mich lebendig. Das hat sich geändert mit der Zeit, aber das war erst mal so.
Erb: Prenzlauer Berg machte einen abgestorbenen Eindruck, die Bewohner waren zu fünfzig Prozent Rentner. Das weiß ich von der Ärztin. Und die anderen waren Studenten, die bald nach dem Examen wieder wegzogen.
Struzyk: Die sogenannten normalen Familien zogen nach Marzahn, weil sie, wie sie meinten, da nun endlich leben konnten.
Erb: Diese eigentlich Normalen gab es nicht so viel, es gab sehr kaputtes Volk auch.
Struzyk: Dadurch hat sich ja auch ein bißchen dieses Biotop entwickelt.
Erb: Ich erinnere mich noch, in der Brunnenstraße war so abgesunkenes, proletarisches Kleinbürgertum. Der Bäcker hatte zu Weihnachten ein ganzes Schaufenster voll Lebkuchen mit Zuckergußschrift. Und auf alle „Fröhliche Weihnachten“ draufzuschreiben war ihm wohl irgendwie zu langweilig, und so hatte er alle Sätze, die er überhaupt im Leben gehört hatte, auf die Pfefferkuchen geschrieben. „Kannst mir auch mal wieder die Hosen bügeln“ oder so was. Heute ärgere ich mich, daß ich kein Foto gemacht habe. Die Achtung dafür kam bei mir erst später. Es gibt ein Gedicht von mir, „Versmaß abgehört, Klartext“ – wie Leute reden. Ich habe Maß genommen an den Leuten, die um mich rum waren. Obwohl ich selbst keinen richtigen Zugang hatte. Als ich nach Köln kam, war es ein bißchen anders.
Gröschner: Waren die in dem Haus, wo du wohntest, dir gegenüber tolerant?
Struzyk: Die waren so wie sie waren. Die haben mir in dem Moment, wo die Waschmaschine überlief, mit der russischen Botschaft gedroht.
Erb: Hatten sie dich denn als Rote eingeschätzt?
Struzyk: Nee, das hing damit zusammen, daß die Frau, die drunter wohnte, Georgierin war. Und die hat dann immer gesagt, jetzt geht sie zur russischen Botschaft, so einem Subjekt wie mir muß das Handwerk gelegt werden. Sie hat es dann aber doch nie gemacht. Die hieß bei uns die Frau Professor Bettnässer, weil sie in der Kinderklinik das Bettnässen wissenschaftlich untersucht hat. Und das war so eine wunderbare Duplizität, da lief immer das Wasser von uns an ihren Wänden runter, während sie über das Phänomen des Bettnässens nachdachte. Ich hatte so eine Scheißwaschmaschine, so’ne alte Ostwaschmaschine, die noch Rührlöffel hatte, und da schäumte das immer über.
Erb: Das war bei uns etwas glimpflicher, unter uns wohnten Studenten. Die klingelten nur und sagten, nun haben wir gerade geweißt, nun ist das wieder gelaufen, das ist doch nicht schön.
Struzyk: Das ist ja geradezu eine ästhetische Andacht. Bei uns war es irgendwie ganz lebendig. Im Hinterhaus lebte ein Puppenspieler, mit dem wir uns zusammengetan haben. Wir tapezierten in der alten Mädchenschule einen als Abstellraum genutzten Kellerraum. Dort feierte dann das ganze Haus. Es war lustig, wenn die Rentner ihre alten Lieder sangen. Rosa Saletto und ihr Anhang kamen vom Zirkus. Rosa stand am Brett, die wurde von Messern umworfen. Vielleicht deswegen hatte sie was total Kühnes. Die hat sich auf einen Tisch gestellt und angefangen, obszöne Lieder zu singen, großartig war das. Mit denen sind wir auch im Pfefferberg feiern gewesen. Da war einmal im Jahr großer Ringelpietz mit Anfassen.
Erb: Wann bist du nach Berlin gekommen?
Struzyk: 1976.
Erb: Das ist ein ganzer Schwung später. All diese Volksfeste waren noch gar nicht, als ich kam.
Gröschner: Ringelpietz mit Anfassen gab es jedes Jahr, auch im Prater.
Erb: Das haben wir ja nicht gewollt. Ich meine eher, daß man selbst etwas auf die Beine stellte.
Struzyk: Das ging erst in den Siebzigern los, stimmt.
Gröschner: Ihr meint diese Art von Gegenkultur.
Struzyk: Dieses: Wir müssen ja nicht immerzu nur den Kopp hängen lassen, wir können uns auch ein bißchen an uns selber freuen.
Erb: Also nicht vom Wirt veranstaltet.
Struzyk: Ohne Nationale Front.
Erb: War direkt gemeint, ebenso wie metaphorisch.
Struzyk: Wenn wir uns trafen, um Texte zu lesen und daran rumzubasteln, haben wir immer auch noch andere eingeladen. Einmal kam Papenfuß, der war noch ganz jung und hatte schon dreitausend Gedichte in diesen grauen Klemmappen und noch nie eins veröffentlicht. Er hatte noch als Beleuchter gearbeitet. Aber 1979, als Willi geboren wurde, hörten wir auf. Und dann ging es weiter bei Ekkehard Maaß in der Küche. Der hat so 1979, 80 angefangen mit diesen Lesungen. Dann kam die Ära, wo diese jungen Dichter auch bei dir vorstellig wurden, ihre Texte vorzeigten und sich mit dir austauschten. Da war ich ja eigentlich nicht mehr mit dabei. Ich hatte das kleine Kind und bin nicht mehr hingegangen, und dann sind wir 1982 ins Neubaugebiet Fennpfuhl gezogen. Da haben wir eigentlich nur noch korrespondiert miteinander und uns kaum gesehen.
Erb: Das war nicht so, daß die plötzlich vor meiner Tür standen. Ich bekam einen Brief von Luchterhand-Jahrbuch, die Texte von jungen Autoren suchten. Ich hab sie aufgefordert, mir Texte zu bringen. Es war nicht so, daß die gespannt gewesen wären auf mein Urteil. Das war eine mündige Generation. Die hatten ihre eigene Entscheidung, die sie auch aus der Gesamtgesellschaft herausbewegte. Die brauchten keine Mentorin. Die brauchten auch nicht Braun oder Mickel, das glaube ich nicht. Das war typisch, wie Mickel den Papenfuß im Schriftstellerverband vorstellte und in seinen einleitenden Worten erklärte, er müsse mal seine Prinzipien überprüfen. Das war schon eher kollegial. Das waren nicht die Anfänger, die von den Erfahrenen lernen wollen, das Bild stimmt hinten und vorne nicht. Obwohl es immer und immer wiederholt wird.
Gröschner: Aber du bist eine der wenigen gewesen aus der Generation, die akzeptiert worden sind.
Erb: Wieso? Die anderen sind auch akzeptiert worden.
Struzyk: Die haben sie eigentlich nicht abgelehnt.
Erb: Die waren bei Kirsch, die waren bei Endler, die waren bei Braun, die waren bei Mickel, die waren bei Wolf. Natürlich nicht bei allen. Ich war allerdings immer wieder da, wenn gelesen wurde, öfter als andere.
Als ich die Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung zusammenstellte, bekam ich auch zu hören, ob das denn gut sei. Nicht unbedingt von Literaten, aber im Grunde von meiner Generation, da war Mißtrauen. Die blieben einfach in ihrem Ding drin. Ich fühlte mich schließlich nicht glücklich, also mußte ich ein Problembewußtsein haben, und dann ist es doch logisch, daß du guckst, was tun denn andere. Und eigentlich war mir immer egal, ob etwas, sagen wir mal, historisch ist oder in China. Das ist jetzt ein anderes Bild, aber es hängt damit zusammen, du konntest nicht reisen, du konntest dich nicht bewegen, in dem Zusammenhang war es mir egal, ob eine kulturelle Erscheinung aus Frankreich kam oder aus dem 16. Jahrhundert. Ich dachte auch, wie das anfing mit den Jüngeren, daß die jetzt wahrscheinlich was sagen, und dann kann ich meine ganze Arbeit wegschmeißen. Nicht im Sinn von Konkurrenz, sondern meinerseits von Unterlassung, die ich nicht bestimmen konnte. Vielleicht in dem Sinne, daß ich keine politische Dichterin bin. Und wie ich dann hörte, was die machen, da war es so, als wäre mir der Boden unter den Füßen verlängert. Also durch die ist mehr Land. Das war eine Beruhigung.
Struzyk: Vergangene Woche hatte ich eine Einladung der Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen. Die machen immer irgendwelche Berlinexkursionen und wollen das Phänomen Prenzlauer Berg begreifen. Da war ich zu so einer Session, und in einem Betonburg-Hotel, und da saßen lauter aufmerksame Zausel. Und denen hatte ich Berührung ist nur eine Randerscheinung mitgebracht, weil ich dachte, wenn sie das wirklich wissen wollen, dann werde ich ihnen antragen, was hier gesammelt worden ist, was hier eigentlich für ein Leben war, von welcher Situation das ausgegangen ist. Ich habe ihnen Texte daraus vorgelesen und ihnen den Kontext erklärt, wie diese Sammlung entstanden ist. Und natürlich wollten sie auch wieder was von Sascha Anderson wissen. Da hab ich ihnen auch von ihm einen Text vorgelesen. Die waren ziemlich pfiffig und sagten, mit einer gewissen Aufmerksamkeit kriegen wir eigentlich schon in den Texten mit, was der Junge für ein Problem hat. Was natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt ist als damals. Es entspann sich dann eine ziemlich lebendige Diskussion, auch darüber, ob Äußerungen in dieser sehr unterschiedlichen poetischen Form gebraucht werden, und wenn ja, wer das hat eigentlich aufnehmen können damals. Im Moment ist es irgendwie verschüttet. Es ist eine Art Sturzflut darüber gegangen, die was weggewaschen und ein glattes Bild hinterlassen hat: Da war ein großer Verrat in diesem Prenzlauer Berg, das war mal ganz lebendig, und es war immer Untergrund, ein Grummeln. Aber wenn du jetzt die Texte alle einzeln nimmst, erzählt jeder eine andere Geschichte, das geht in verschiedene Richtungen. Ich habe denen gesagt, sie sollen sich das Buch ausleihen und gucken, wo sind die Leute jetzt, was machen die, wie hat sich das entwickelt.
Erb: Du sagtest doch, die wollen wissen, was Prenzlauer Berg ist.
Struzyk: Sie wollten wissen, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt.
Erb: Wenn du jetzt Gegenwartsleute einladen würdest, es können sogar dieselben wie damals sein, dann würdest du nicht mehr Prenzlauer Berg rauskriegen dabei, nehme ich an.
Struzyk: Das glaube ich auch.
Gröschner: Prenzlauer Berg ist ja was Gemachtes, das ist Feuilleton. Es wird einfachheitshalber eine Gruppe angenommen, und die Gruppe gab es in dem Sinne gar nicht so.
Erb: Prenzlauer Berg gab es schon, aber die Sache ist doch die, daß niemand von innen das so genannt hätte. Es war kein Programm, es war keine geschlossene Gruppe, aber daß es da war und sehr, sehr lebendig war, das ist unbestritten. Ich hab das miterlebt, irgendwann hatte ich mal Ausgang nach Westberlin und hab den Anderson besucht, da war der schon rüber, das muß nach 1986 gewesen sein. Und da war der Kerbach, ein Maler, der war ein paar Jahre früher weg. Es war ein Film gedreht worden über den Weggang von Anderson, und der Kerbach war völlig erschüttert, was sich in dieser kurzen Zeit, seit er weg war, geändert hatte. Also ein Aufblühen von allem möglichen, wie es auch diese Anthologie spiegelt, wo innerhalb der verschiedenen Kunstgattungen Mischformen entstanden, überhaupt diese ganze Regsamkeit, die durch die Musik übermittelt wurde. Das hat sehr stark auf ihn gewirkt.
Gröschner: Bist du zu den Auftritten der Bands gegangen?
Erb: Gelegentlich, wenn sie große Gesamtschau hatten. Anderson hat manchmal so was organisiert. Wenn so was war, war er immer dabei, vielleicht sogar führend, na, dieses Stasi-Aas. Und da hab ich natürlich verschiedene gehört, Fiedler aus Dresden und so. Es war ganz viel zu sehen und zu merken. Obwohl es mir zu laut war, man hat immer den Text nicht verstanden. Da hab ich gedacht, was sind denn das für Wickelkinder, man kann doch wenigstens den Text sauber bringen, daß man ihn versteht. Aber Papenfuß mit Rosa Extra, das war schon sehr gut.
Struzyk: Ornament und Verbrechen auch.
Gröschner: Und hast du bei solchen Veranstaltungen auch gelesen?
Erb: Nee. Jetzt weiß ich gar nicht, wieso ich dann da war.
Struzyk: Die haben dich bestimmt eingeladen, haben gesagt, komm mal vorbei.
Erb: Ich hab’s immer bedauert, daß ich nicht auch im Zusammenhang mit Musik gearbeitet habe.
Struzyk: Einmal haben wir es gemacht, weißt du noch? Mit der Bolschewistischen Kurkapelle zusammen. Das war ein Text von mir, der hieß „Jetze“ und handelte von diesen polyglotten Typen aus dem 18. Jahrhundert.
Erb: Das haben wir zusammen gelesen.
Struzyk: Ja, das haben wir doch richtig aufgeführt. Da waren wir einmal in der Moritzbastei, und dann waren wir in Freiburg damit, weißt du’s noch? In der Moritzbastei stand Peter Härtling in einer Ecke und grinste. Hinterher hat er gesagt, das wäre das reine Lustgrinsen gewesen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Da warst du auch richtig Feuer und Flamme.
Erb: Ich habe noch ein Foto, wo wir beide in voller Aktion stehen.
Gröschner: Irgendwann seid ihr auch mal im Kino Babylon aufgetreten.
Struzyk: Das war eine riesige Lyrikschaffe.
Erb: Das endete irgendwie mit Schappi.
Gröschner: Der nicht mehr aufhörte zu lesen.
Erb: Ich war sehr erheitert von der Bolschewistischen Kulturkapelle. Das ganze Ding so durch den Kakao zu ziehen, das war richtig klug. Es hat auch in Freiburg gewirkt.
Struzyk: Die waren ja richtig happy da. Das war im Dezember ’89. Da waren auch Schappi und Matthias BAADER mit.
Erb: Ja? Matthias BAADER, ich kann mich nicht erinnern.
Struzyk: Der war wunderbar. Da waren wir in einem Restaurant auf dem Berg, und die zwei haben noch Kabarett gemacht.
Erb: An den BAADER kann ich mich nicht erinnern. An Schappi ja, weil ich den noch irgendwie geärgert hab.
Struzyk: Der BAADER war begnadet. Wie der seine Texte so einfach aus dem Ärmel schüttelte. Und kein Jahr darauf war er von der Straßenbahn überfahren.
Gröschner: Am Tag der Währungsunion.
Struzyk: Genau. Am 1. Juli. Auf der Kastanienallee, Zionskirchplatz.
Erb: Ich bin nicht schuld.
Struzyk: Nein, du warst es nicht. In der Kastanienallee ist immer was los. Und mit diesen Umleitungen im Schönbohmschen Stil, wo sie den 1. Mai von Kreuzberg nach Prenzlauer Berg getragen haben, ist jetzt jedes Jahr in der Kastanienallee dieses große Dreschen und Wasserwerfen.
Erb: Da war ich nicht da.
Struzyk: Ich war mittenmang.
Erb: Ist ja toll.
Gröschner: Habt ihr auch so was gemacht, wie in den Prater zu gehen am Sonntag, zum Kaffeetrinken?
Erb: Nein, du? Quatsch, wir gehen doch nicht in ein Restaurant Kaffee trinken.
Struzyk: Im Pratergarten sind wir schon manchmal gewesen.
Erb: Mit den Kindern?
Struzyk: Ja, aber da war eigentlich nichts los, außer Biertrinken.
Erb: Das hatte so was Trübsinniges, Ferienlokalartiges, elend, elend.
Struzyk: Das war nicht so toll.
Erb: Und jetzt belebt es sich irgendwie. Wie das heute aussieht, sieht das netter aus, als es vorher je ausgesehen hat. Jedenfalls gibt es jetzt eine ganze Menge Antiquariatsgeschäfte. In der Oderberger sitzt eine drin und macht ihren Modeschmuck, und hinter ihr stehen von ihm die ganzen Bücher zum Verkaufen. Jetzt ist es eigentlich so, wie es hätte sein können.
Gröschner: Das, was du beschreibst, ist ja quasi nur das, was von innen nach außen gegangen ist.
Struzyk: Was sonst auf dem Dachboden ausgestellt wurde.
Gröschner: Nähen oder Bücher austauschen oder Kneipe machen, das war früher in der Wohnung, und jetzt ist es unten.
Erb: Aber das ist doch nicht dasselbe, wenn es in der Wohnung ist.
Gröschner: Aber das war doch nicht privat, du hast doch mit ein bißchen Anstrengung immer gewußt, wer gerade eine illegale Kneipe macht.
Erb: Das habe ich nicht gewußt. Ich war auch nicht mehr in dem Alter, wo man diese Gruppenorientierung noch mitmacht. Da hätte ich auch nicht reingehört. Obwohl ich mich dunkel erinnere an so eine Situation, wo war denn das? Das war aber eine Ausnahme. Ich weiß nur, in der Mitte war so eine Art Lagerfeuer, und ich sitze da wie jetzt hier, aber auf dem Boden, und mir gegenüber sitzt jemand, und wir haben richtig was zu reden.
Struzyk: War das vielleicht in der Dunckerstraße?
Erb: Ich weiß nicht mehr.
Struzyk: Duncker 18, auf den Höfen war immer mal Lagerfeuer.
Erb: Das war nicht im Hof, in der Wohnung.
Struzyk: Ach so, in der Wohnung war das Lagerfeuer, das ist natürlich wieder was anderes.
Erb: Sehr extrem etwas von außen nach innen genommen, das Lagerfeuer.
Struzyk: Ganz am Anfang, als ich nach Berlin kam, gab es noch Schweinebraden mit seiner Galerie oben unterm Dach.
Erb: Nee. Das war im Erdgeschoß.
Struzyk: War das nicht so ein Boden, ist mir ist so in Erinnerung. Dann hatte er aber irgendwie eine Ausstellung in so einem Dachstuhl, das ist das einzige, was ich gesehen habe.
Erb: Das war doch nicht Schweinebraden, das war ein gewisser Kaiser.
Struzyk: Ich meine aber Schweinebraden. Der die Mappe gemacht hat „Mutter Erde unterm Hammer“.
Erb: Da gibt’s eine Mappe „Muttererde unterm Hammer“?
Struzyk: 1976/77 ist die gemacht, mit diesem Text von dir.
Erb: Die hab ich nicht mehr.
Struzyk: Muß ich dir mal zeigen, mit Zeichnungen von Sabine Grzimek.
Erb: Deswegen bin ich zum Schweinebraden hingekommen, ja?
Struzyk: Ich glaub schon. Das ist eine schöne Sache, die er gemacht hat. Aber der ist dann auch bald weggegangen.
Erb: Aber das andere, was ich meine, das war eine Ausstellung auf einem Dachboden, und rechts und links waren im Treppenhaus Stahltüren.
Struzyk: Scheibs Atelier meinst du, Sredzki/Ecke Ryke.
Erb: Sredzkistraße, ganz oben, wo auch mal Bert Papenfuß gelesen hat. Da war auch dieser Kaiser, der ein bißchen verrückt ist.
Struzyk: Der die Tüten geklebt hat?
Erb: Der hat eine Müllausstellung gemacht, phantastisch war das.
Struzyk: Die hab ich auch gesehen, wo der diese Picasso-Euter zusammengeklebt hat.
Erb: Wie bitte?
Struzyk: Picasso-Euter hießen diese dreieckigen Milchbehälter, die es gab. Was jetzt ein Tetrapack ist, die waren doch so dreieckig damals.
Erb: Mir hatte das gefallen, mit dem Müll so was anzufangen, ich war hin davon.
Struzyk: In der Szene gab es fließende Übergänge, da war dieser Schweinebraden, und dann habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob durch dich, Martin Hoffmann und Zabka kennen gelernt.
Gröschner: Die hatten auch einen Club, eine Zeitlang.
Struzyk: Ja, da habe ich auch mal gelesen, der war heiß beobachtet, in der Nähe der Warschauer Straße.
Erb: Da hab ich auch gelesen. Das war ursprünglich eine Kneipe und ist dann ein Kulturclub geworden, und da hatten sie Schwierigkeiten mit den Anwohnern, die vermißten, daß man dort in Ruhe trinken kann.
Struzyk: Die fanden das ein bißchen daneben.
Erb: Sowas hatte ich noch nicht erlebt, ich hab gelesen, und die waren total hoch, nicht daß sie einverstanden waren, aber die waren hochgebracht. Und dann kamen sie hinterher an und fragten, können Sie uns mal was über Ihr Leben erzählen, wir würden das gerne verstehen, was Sie da machen.
Struzyk: Das war ein toller Klub in einer ganz öden Gegend, gottverlassen, aber da gab’s einiges, das waren eigentlich Jugendclubs, und die wurden dann umfunktioniert.
Gröschner: Für kurze Zeit, bis sie auf Anordnung geschlossen wurden.
Struzyk: Dieser Krausnickkeller war auch so einer.
Erb: Und das hörte nicht auf, und dann rief dich einer an: Ich hab mal ’ne Frage, wir haben so’ne Lesung, um Mitternacht, in der Pieckstraße.
Gröschner: Pieckstraße war später.
Erb: Während nebenan, parallel, ganz rege die Hausausstellungen gingen, wo auch eine nach der anderen war.
Struzyk: Ich fand auch diese Nachbarschaft von Malerei und Literatur gut, denn wir haben doch immer irgendwelche Auseinandersetzungen gehabt, die auch nicht abgerissen sind, aber irgendwie sind die Zeiträume größer jetzt, in denen man sich wiedersieht. Zum Beispiel mit Karla Woisnitza. Die hat ja mit dir und Kerstin Hensel dieses schöne Buch gemacht.
Erb: Und dann das Malachit.
Struzyik: Malachit auch. Und ich hatte mit der Sabine Hermann, mit der ich nach wie vor in Verbindung bin, ein schönes Zusammenwirken und du mit der Angela Hampel in Dresden. Da warst du ja sicher auch ein paarmal zu solchen Galerielesungen.
Erb: Ja. Es waren überhaupt immer die Galerien, die uns gerufen haben. Hier in der Pratergalerie hab ich auch gelesen.
Die hatten’s nachher nicht mehr in der Hand. Die haben mir mal erzählt, wo sie Berlin zur Hauptstadt ausbauten und alle diese, wie nennt man das, die Kapazitäten aus den Bezirken herholten, ließen sie die Maler diese Wellblechzäune bemalen. Da habe ich mal irgend so eine Erzählung gehört, wie die Obrigkeit die Maler engagiert, aber das in der Hand halten wollte, und wie sie es nicht geschafft hat. Die Zensur flog einfach weg, das war sehr kräftig, in den achtziger Jahren.
Gröschner: Das Eigenartige ist: Ein solcher Bauzaun existiert heute noch, nach mehr als zehn Jahren. Der von Micha Voges, Schönhauser/Ecke Fehrbelliner. Da ist bis heute nicht gebaut worden, obwohl es fast nirgends mehr unbebaute Ecken gibt.
Aber was ich noch fragen wollte, wart ihr oft bei Wohnungslesungen?
Struzyk: Na klar, da haben wir uns ja kennengelernt, wie gesagt. Unter anderem.
Erb: Das war durch Grass eigentlich, weil Grass schrieb am Butt und war sehr in dem Roman drin, und ich glaub, das ist so ein Gesetz, daß wenn du von einer Sache sehr beschäftigt bist, gleichzeitig einen ganz starken Griff nach der Außenwelt hast. Das hat er sich organisiert. Er wollte allerdings überhaupt keine Kritik hören, ihm reinpfuschen, das ging nicht. Aber er kam immer an…
Struzyk: Die Sache hatte sich aber erledigt, als alle ausreisten, als Bettina ging und Sarah auch. Die war übrigens bei der Lesung bei Schädlich, das war einen Tag vor ihrer Ausreise. Da hat sie erzählt, wie sie ihr ganzes Zeug einpacken muß und diese Listen anlegen und noch die Taschentücher mit Monogramm aufführen muß. Was übrigens gespenstisch war.
Erb: Und wo ich dann einen Nervenzusammenbruch hatte und weinte in der Küche, und da stand der Schauspieler da, wie heißt der noch mal, der große, na hier, der dicke, der nicht dicke, sondern der große.
Struzyk: Holz?
Erb: Nein. Ach, weißte doch.
Struzyk: Wenn ich wüßte, welchen du meinst,
Erb: Der als Bierreklame auftritt.
Struzyk: Manfred Krug.
Erb: Ja, genau. Ich lag an seiner Brust und weinte. Und er dachte, ich weine, weil er weggeht. Mußt du dir mal vorstellen.
Struzyk: Und du weißt nicht mal mehr, wie er heißt.
Erb: Ich war aus dem Sommer gekommen, und alle gingen weg. Ich fuhr zurück und saß da am Bach und dachte, das Gras existiert doch noch, das Gras gibt’s doch noch, so als ob das Gras jetzt alles, was weg ist, leiblich vertreten soll. Das ist schon schlimm gewesen. Allerdings war es in Berlin noch anders, weil in den Prenzlauer Berg die kamen, die Ausbürgerungsanträge gestellt hatten, sie wurden aus ihren Berufen geschmissen und sammelten sich hier an. Ich hatte viele von ihnen in der Wohnung.
Struzyk: Das war bei mir ganz komisch. Wenn die gingen, da war bei so was wie eine Wunde, die aber ganz schnell verödet wird mit einem künstlichen Gegendruck, indem du einen blutstillenden Stift draufhältst, daß das Blut nicht mehr läuft. Es war wie eine Vereisung. Es mußte eben irgendwie weitergehen. Ich erinnere mich an den Abend, bevor Katja Lange-Müller ging, die hatte ein Frettchen, das lief über den Tisch, und ihre letzte Sorge war, wer es versorgen könnte. Als sie den nächsten Morgen über die Grenze ging, habe ich geheult wie ein Schloßhund. Das war so, als hätte ich all die anderen Abschiede in dem einen miterledigt. Katja ging erst relativ spät, 1985 oder 86. Komischerweise hatte ich das Gefühl, es ist nicht für ewig.
Erb: Als Sarah ging, sagten sie, du gehst vom Regen in die Traufe.
Struzyk: Das kam von Biermann, der sagte, daß er vom Regen in die Jauche kam.
Erb: Ich hab immer gesagt, das ist ja wohl umgekehrt.
Gröschner: Und wie war das so mit den Kindern?
Erb: Die Kinder haben ihre eigene Entwicklung, würde ich sagen.
Gröschner: Hatte das für die eine Bedeutung, wo sie lebten, hat sie das nicht geprägt?
Erb: Mein Sohn ist in der Ruppiner Straße in die Schule gegangen, und das war eine proletarische Schule, infolge dessen hat er sich mit denen verbündet, gegen das kulturell bestimmte Elternhaus. Das ist schon ziemlich früh gewesen, im Kindergarten eigentlich schon. Ich erinnere mich noch, wie er sitzt, Jazz hört und auf einmal sagt, ja, Beethoven und Beethovens Sohn. Das war für mich eine wirklich souveräne Aussage. Ich hab gedacht, jetzt sind schon die kleinen Kinder soziologisiert und bewußt. Und was sie da durchgezogen haben in ihrer Schule, das war ein Gesellschaftsspiel, wer gilt wie, wer hat was zu sagen. Dann haben sie sich geweigert, Bruchrechnung zu machen, alle Jungen hatten eine Fünf. Ich hatte zufällig ein Buch vom Westen, wo das Phänomen beschrieben wurde, daß die Bruchrechnung nicht mehr angenommen wird von den Kindern, wo du doch sagst, das ist ein Spiel, das eine machst du rüber und das machst du so rum und das kommt unter und da wird so umgewechselt. Aber die Kinder haben die Obrigkeit abgelehnt. Und diese linken Wessis schlugen sich an die Brust und bereuten: Was haben wir versäumt an den Kindern?
An der Bruchrechnung konnte man viel ablesen. Ich hab die Kinder an den Küchentisch geholt und wollte es ihnen erklären. Ich sage zu meinem Sohn, das ist doch ganz einfach, das kannst du doch. Er wich zurück, die beiden anderen unterhielten sich. Es war für ihn viel interessanter, was sich die beiden zu erzählen hatten, das war so eine Anziehung, diese Kinder waren eine in sich geschlossene Sozietät. Auch an den Witzen, die er erzählte, konnte man sehen, wie ungeheuer politisiert sie waren, ohne daß man die Richtung hätte benennen könne. Es war einfach das gesamte Gefühl, und die Witze, die sie brachten, der 10. Parteitag war damals gerade, und man schrieb das auf den Plakaten mit römischer Ziffer, und da sagten sie immer xter Parteitag; die Litaneien von Witzen müssen ja aus den Elternhäusern gekommen sein. Die Bevölkerung war schon ziemlich weit. Bevor es los ging, 1989, war er in der Firma Baureparaturen Lehrling. Dieses Gebilde waren 400 Arbeiter und 600 Angestellte, das kannst du als Paradigma nehmen dafür, wie die Gesamtgesellschaft sich umgebildet hatte. Und da ging er, 1989 im Sommer, neben einem Kumpel, der schon ausgelernt hatte. Und gegenüber auf der Brunnenstraße geht ein Polizist, und auf einmal fängt sein Kollege an, diesen Polizisten aus heiterem Himmel zu beschimpfen, und weil die Straße so breit ist, muß er rüberschrein. Das war neu. Ich weiß noch, wie er da in seine Lehrlingsschule ging, und eines Tages kam er nach Hause und sagte, tut mir leid Mama, wir denken national. Ich hatte mir schon denken können, daß es nicht so weitergeht mit der Abwertung des Nationalgefühls bei den Deutschen. Ewig kannst du das nicht machen. Als wir in Bulgarien waren und die erzählten uns ihre Geschichten, da dachte ich, vielleicht könnte man, wenn man jetzt die Bulgaren nachdichtet, den Deutschen etwas geben, was sie nicht haben. Du konntest dort das Gefühl haben, du wohnst der Entstehung eines Nationalepos bei.
Das war einfach nicht zu machen mit den Deutschen. Das geht auch jetzt noch nicht.
Gröschner: Dein Kind hat in einigen deiner Texte eine Rolle gespielt, es gibt diese eine Lieblingsszene von mir mit dem Treppehoch- und Runterzählen in dem Buch Winkelzüge. Die Treppe war unendlich lang mit einem Kind auf den Arm. Das hat was mit Muttersein und Stadt zu tun.
Erb: Aber voll. Besonders diese Sache, daß ich ihn auf dem Arm habe und ihn mein Herbertchen, Kläuschen nenne, wirklich mit x Namen, ganz viele Jungsnamen aneinandergereiht.
Gröschner: Ich kannte den Text mit dem Die-Treppe-hoch-Zählen und hatte selber ein Kind und eine Wohnung in der vierten Etage. Das war ein Ritual, wenn ich unten stand, mit dem Kind auf dem Arm und dem Einkauf in der Hand, dann hab ich mich an den Text erinnert und bin die Treppen hochgezählt.
Erb: Ja? Da habe ich von Brigitte einen Text in Erinnerung mit irgendwelchem Kommunismus und irgendwelchen Kohleneimer, war’s so.
Struyzk: Ja, und am Ende ist nur die Zeitung im Eimer, genau. Da sind auch diese Treppen drin.
Erb: Du hast auch ziemlich weit oben gewohnt.
Struzyk: Vierter Stock, und mein Keller war auf dem Hinterhof, in diesem ehemaligen Mädchenpensionat. Einmal hatte ich mir mit dem Messer beinahe die Fingerkuppe abgeschnitten. Ich mußte zum Arzt, und der hatte mir die Kuppe wieder angenäht. Das war ziemlich schmerzhaft, deshalb kriegte ich Faustan, damit ich das überhaupt aushielt. Ich habe mir zwei Faustan eingepfiffen und bin ausgerutscht und mit meinen zwei Mülleimern vom vierten Stock in den dritten runtergefallen. Dieses Faustan hat mir das aber alles irgendwie erträglich gemacht. Ich habe wie in einem Zeitlupenfilm zugesehen, wie ich da runterfiel und wie sich der Müll über die Stufen ausbreitete. Es war merkwürdigerweise ganz heiter, ich hab auch keinen Schmerz empfunden, ich war zugeknallt. Und dann habe ich in aller Seelenruhe die Eimer wieder mit dem Müll gefüllt und sie weggeschafft.
Erb: Da hast du jetzt aber eine schöne Parabel, wie der Osten mit Rauschgiften umgegangen ist.
Struzyk: Übrigens, meine Kinder gingen in der Schönhauser Allee in die Kurt-Fischer-Schule, gegenüber vom Polizeipräsidium. Eikes Klasse hatte eine Patenbrigade, angeblich vom Ministerium des Innern, aber es muß die Stasi gewesen sein. Die Klasse wurde von denen immer unheimlich gut ausgestattet mit Sportgeräten und anderem. Die müssen ihnen aus ihrer wichtigen Arbeit erzählt haben. Jedenfalls war Eike total erregt darüber, mit was für wichtigen Persönlichkeiten sie ihre Patenschaftsbeziehungen pflegen. Die Schönhauser Allee war Protokollstrecke, und wenn Staatsbesuch war, fuhren dort immer diese Karossen lang. Der Straßenrand war gesäumt von Werktätigen, die zusahen, wie sie sich schnell unbemerkt nach Hause verdrücken konnten, denn man kriegte ja frei zum Spalierbilden, ganze Betriebe. Etwa eine Stunde zuvor kam ein Bus an und spuckte diese jungen Männer in den Kutten aus. Und da hat Eike mit ihrer Freundin Silke Stullen geschmiert, ist runtergegangen und hat die den Kerlen gegeben und gesagt, ihr müßt doch jetzt eure Arbeit machen, da sollt ihr auch was essen.
Gröschner: Und wie hast du reagiert?
Struzyk: Ich fand das okay, weil ich dachte, sie muß ihre Erfahrungen selber machen. Ihr zu sagen, das sind ganz böse Stasitypen, fand ich völlig unangebracht, das hätte wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirkt. Aber mir fällt noch was von Janni ein. Janni ging in den Kindergarten auf dem Hinterhof vom Pfefferberg. Die Kindergärtnerinnen haben ihnen immer Heldengeschichten über Bauarbeiter erzählt. Das war gerade die Zeit, wo die alle aus den Bezirken zusammengezogen wurden, um Berlin zur Hauptstadt zu machen. Und da hat sie immer, wenn irgend ein männliches Wesen uns besuchen kam, als erstes gefragt, sag mal, bist du ein Bauarbeiter? Einmal sind wir spazieren gegangen, an der Mauer, Eberswalder Straße, und da war dieser Aussichtsplattform auf der Westseite, wo die Touristen immer hochgegangen sind, um zu winken. Sie hat das abgeschritten und gesagt, hier haben unsere Bauarbeiter aber nicht gut gearbeitet. Wieso? Die haben auf dieser Seite den Turm vergessen. Hier müßte auch einer sein, dann könnten wir auch winken und denen die Hand reichen.
Der Friedrichshain war unser Park damals. Und als wir am Märchenbrunnen rein sind, kam gerade eine Kinderkrippe an mit zwei dieser Mannschaftswagen, wo die Kinder drin saßen und ausgefahren wurden. Und wer schon laufen konnte, ging an der Hand der Erzieherin. Und da war so ein kleiner Mulatte darunter, der mußte laufen. Da stellte sie sich mit ihren sechs Jahren hin, stemmte die Hände in die Hüften und sagte ganz laut: Det is ja ’ne Unjeheuerlichkeit, det ist ja hier wie in Amerika, die Weißen dürfen sitzen, die Schwarzen müssen loofen.
Erb: Da siehst du genau, wie die Erziehung so lief. Aber bei Konrad war das schon anders.
Struzyk: Mit Amerika?
Erb: Der kommt aus den Kindergarten und sagt, die Russen sind doch doof. Matrjoschka, Buratino und Piroggen.
Struzyk: Bei Janni war noch mal so ein Vorkommnis, da war sie erste oder zweite Klasse, da haben sie immer dieses Lied von Udo Lindenberg gesungen: „Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?“ Das war streng verboten, und weil es verboten war, hat es dann gleich die ganze Klasse gebrüllt.
Erb: Weißt du, was ich gemacht hab, als mir mein Sohn erzählen wollte, die Russen sind doof? Ich hole den Atlas, zeige ihm ein Sechstel der Erde und frage ihn, ob er meint, daß auf einer so riesigen Fläche bloß doofe Leute leben könnten.
Gröschner: Und hast du ihn überzeugt damit?
Erb: Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich war echt empört.
Struzyk: Da gab es auch ein besonders blödes Lied, was sie im Kindergarten immer gesungen haben, das Matrjoschkalied. Kennst du das noch?
Gröschner: Ich war nie im Kindergarten.
Struzyk: Das ging irgendwie „Eins und zwei mein Freund komm mit, immer im Matroschkaschritt“. Dazu mußten sie immer Matrjoschkatänze machen.
Erb: Das muß schlimm gewesen sein. Oder ich fahr mit ihm nach Halle zu den Großeltern, und er sitzt mir im Zug gegenüber, guckt raus und singt: „Doofe Heimat, doofe Heimat…“
Struzyk: (singt) „… das sind nicht nur die Städte und Dörfer.“
Erb: Ja, ja.
Struzyk: „… unsre Heimat, das sind auch die Bäume im Wald.“
Erb: Eigentlich konnte man das nicht lenken, was aus ihnen wurde. So schlau konnte ich nicht sein, daß ich ihn als Mutter hätte in irgendwas Geordnetes hineinlenken können, das war nicht drin.
Gröschner: Was meinst du mit geordnet?
Erb: Naja, daß er Abi gemacht hätte oder so was. Das ging nicht.
Gröschner: Du hast doch gesagt, daß er sich verweigert hat, dazu gehört dann auch Abitur.
Erb: Aber ich kann von Konrad auch noch was sagen, was erst mal positiv aussieht. Mama, hat er gesagt, da ist jetzt Geburtstag der Republik, das heißt, da haben alle Geburtstag und alle kriegen Geschenke. Er hat erwartet, daß er was von mir zum Republikgeburtstag bekommt.
Gröschner: Er hätte dir dann aber auch was basteln müssen.
Erb: Das hätte er, aber so stand das nicht mit uns, nee.
Struzyk: Janni und Konrad haben manchmal Schach zusammen gespielt. Sie waren in derselben Schachgruppe. Auf der Kastanienallee, weißt du noch?
Erb: Ich weiß noch, daß er beim Schach war, aber ich nicht mehr, wo. Irgendwas mit Bäckerei war da.
Struzyk: Das war die Schachgruppe vom Backwarenkombinat. Da haben die immer um Torten gespielt. Der Champion kriegte ’ne Torte.
Erb: Also, ich freute mich überhaupt, daß er da hinging, weil dort sein Hirn in Arbeit genommen wurde, was in der Schule wegen seiner Verweigerung nicht ging. Aber wie er zum erstenmal zu einem Ausscheid ging, das war gegen Weihnachten, sag ich noch zu ihm, paß auf Konrad, wenn sie dich jetzt vielleicht gar nicht ran lassen, dann ist das, weil du noch neu bist. Aber er kam als Sieger zurück, einen Dresdener Stollen unterm Arm. Das ging sehr lange. Aber das ist weg jetzt bei ihm. Gelesen hat der Konrad, mit Fühmann kam das in Gang, trotz seiner Bildungsfeindlichkeit. Schon bei dieser Prenzlauer-Berg-Generation habe ich die Zivilisationskritik sehr deutlich gemerkt. Da fing das an. Es ist tatsächlich so, daß sich Papenfuß mehr für Konrad interessiert als für mich.
Struzyk: Ich hatte auch mal anfallartig den Wunsch, aufs Land zu ziehen, als es dann schon drei Kinder waren. Ich habe immer von oben meine Füße im Traum gesehen, die durch Gras gehen und daneben die Kinderfüße. Das war wie ein Film.
Erb: Aber bei der Glucke laufen sie hinterher.
Struzyk: Die liefen nebenher, und ich hatte das dumpfe Gefühl, du machst was falsch, die Füße gehören eigentlich ins Gras und nicht auf die Straße, die Kinder müssen barfuß gehen können. Und da hat es mich so richtig geschüttelt den nächsten Morgen. Ich fing an, hektisch nach einem Haus auf dem Land zu suchen. Nur mir fehlten jegliche Mittel dazu.
Erb: Aber du warst doch selber auch nicht mit Füßen im Gras aufgewachsen.
Struzyk: Na, ein bißchen. Einen Fuß hatte ich immer im Gras.
Meine Frage ist, ob meine Kinder tatsächlich ein Defizit hatten durch die Stadt. Ich denke, das ist nicht so, das war ihre natürliche Umwelt.
Gröschner: Das Problem, was ja viele haben, die aufs Dorf gegangen sind, weil sie gedacht haben, für ihre Kinder ist das genau das Richtige, ist ja, wenn sie erwachsen sind, ziehen die Kinder wieder in die Stadt, weil sie es auf dem Dorf nicht aushalten.
Struzyk: Ich hatte dann ein Haus gefunden bei Angermünde, eine ehemalige Kneipe, die stand ganz allein in der Landschaft. Es gab einen Riesenvorbau, so eine richtige Wirtsdiele, und dann ein Haus dran. Es hatte schon eine Familie angefangen, die sich dort niederlassen wollte, hatte es aber verbaut, und deswegen wollten sie es auch wieder loswerden. Es war auch eine riesige Hypothek drauf, die kein Mensch hätte übernehmen wollen.
Erb: Noch zu DDR-Zeiten?
Struzyk: Ja, und gegenüber von dieser Kneipe war eine Art Erlenholz, das mitten im Sumpf stand, und lauter Lianen haben sich um die Stämme gewunden. Das war eigentlich ein wunderbarer Anblick, aber meine Kinder sagten gleich, na hier wird es aber viele Mücken geben. Und als wir die Besichtigung hinter uns hatten, haben sie gemeint, wir wollen hier um keinen Preis der Welt leben. Wo gehen wir denn hier ins Kino, wo ist hier die Schule? Und tausend andere Gründe.
Erb: Ist ja klar.
Struzyk: Ich habe es auch bald eingesehen, es war ein Irrwitz, einmal von den Kräften her und zum anderen hättest du erst mal Geld haben müssen. Unsereins hatte ja nie Geld, und das scheint ja auch so zu bleiben. Aber diese Kraft zu investieren, nur um seinen Traum durchzusetzen, das ist fast wie eine irre Utopie, wo am Ende alles verknöchert. Und die, die du beglücken willst, fliehen dich dann, sobald sie können. So war der größte Ausflug, den wir uns gegönnt haben, nach Pankow zu ziehen.
Aus: Barbara Felsmann & Annett Gröschner: Durchgangszimmer Prenzlauer Berg. Eine Berliner Künstlersozialgeschichte in Selbstauskünften, Lukas Verlag, 1999
„In der DDR war nicht die Frage Mann oder Frau
die entscheidende, sondern:
Was ist das für eine Herrschaft,
was ist los mit dem Gemeinwesen?“
Birgit Dahlke: Mich interessiert Deine Sicht auf die Situation schreibender Frauen in der inoffiziellen Zeitschriften-Szene.
Elke Erb: Es gab fast keine, aber dazu kann ich nichts sagen, ich war ja nicht mit ihnen zusammen. Dann frag den Bert Papenfuß oder andere, was sie eigentlich meinen, warum die Szenefrauen nicht geschrieben haben.
Dahlke: Die Meinung der Männer darüber ist nicht mein Thema. Auch der „Prenzlauer Berg“ allein ist es nicht. Es gab ja schreibende Frauen, vielleicht eher am Rande dieser Szene, aber in den Szenen von Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Erfurt…
Erb: Was heißt denn „am Rande“, Kerstin Hensel z.B. ist für sich ein Zentrum, da würde ich nicht sagen, daß das am Rande ist.
Barbara Köhler hat die Zunge erst später gelöst. Dann ist da eine, Heike Willingham, da dachte ich neulich, bei der Lesung an Gerhard Wolfs Geburtstag, daß es ja eigentlich verwunderlich ist, wie eine schon bei uns so weit im Westen gewesen sein konnte. Das ist eine Art Weiterentwicklung konventioneller Literatur. Eigentlich hat die Barbara Köhler sich auch dort befunden und ist im Grunde erst jetzt dabei, Schritte über die Grenze zu gehen, ganz grob gesagt. Während mit der Kerstin Hensel so was überhaupt nicht zu diskutieren ist, weder theoretisch noch direkt, obwohl sie fragt: Was war denn da im Prenzlauer Berg überhaupt, was hab’ ich da versäumt. Sie hält sich eher an das Bauwesen von Mickel… Dann gibt es viel Gaukelei… Merkwürdig, daß man bei den einen Texten spürt, daß etwas von den alten Codes „zerschrubbelt“ wird, und bei den anderen nicht, das ist doch merkwürdig.
Dahlke: Woran machst Du diese Unterscheidung fest?
Erb: Das ist schwer zu bezeichnen. Was mir als erstes einfiele, wäre eine ganz dummes Wort: Demokratisierung, ein Hilfswort. Heike hat solche Metaphernfische, Gestalten, die in der Luft fliegen, nicht? Ichbilder. Es geht nicht darum, wie man etwas an den Voraussetzungen verbessert, korrigiert. Das ist im Grunde parasitär – was sie einsetzt, benutzt sie. Ich kann das sehr schwer sagen, die Übergänge sind schwer zu fassen.
Dahlke: Du wirst von vielen der von mir befragten Autorinnen als einzige ältere Dichterin genannt, als wichtige Bezugsgröße, als eine Art Mentorin…
Erb: Mentorin – das geht zu weit: Das steht überall in den Artikeln, unseriös, daran stimmt doch nichts! Warst Du dabei? Woher willst Du das wissen?
Dahlke: Moment mal, ich habe die Jüngeren einfach nach Traditionen, wichtigen AutorInnen, gefragt, und sie haben fast alle Deinen Namen als einzigen genannt.
Erb: Es passiert nicht selten, daß einen jemand als eine Idealgröße ausmacht und damit seinen Altar gesichert hat. Und das mit mir, die selber niemals einen Altar irgendwo hatte.
Dahlke: Ich verstehe schon, wogegen Du Dich wehrst. Gegen dieses Klischee von der Szene-Mutter. Aber ich hatte ursprünglich überhaupt nicht vor, Deine Texte in meine Arbeit einzubeziehen, wollte mich auf meine eigene Generation beschränken. Dann haben jedoch alle Gespräche an irgendeiner Stelle zu Deinen Texten geführt…
Erb: Wenn das so ist, dann gebe ich da ein bißchen nach.
Dahlke: Es hat sicher damit zu tun, daß Deine Texte besonders für Schreibende eine spezifische Anregung darstellen…
Erb: Bist du sicher?
Dahlke: Die Autorinnen sprechen ja über die Texte, nicht über die Person.
Erb: Bis jetzt bin ich schreibenden Leuten noch nicht begegnet, die das gesagt hätten, bis auf die Ilma Rakusa, der ich einfach glauben muß, wenn sie sagt, daß sie angeregt worden sei. Wie mich eben dauernd Friederike Mayröcker anregt, weil sie sich ständig verändert, variiert, sie lockt. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, daß ich Leserinnen habe, als daß Leute sich von mir im Schreiben angeregt fühlen. Wenn mir jemand sagt: Ich lese Sie gern, so kann ich das sofort verstehen. Es ist eine andere Seite an die ich beim Schreiben noch nicht gedacht habe, von der aber klar ist, daß es sie gibt. Wie ich schreibe, ist auch eine Versicherung über die Anwesenheit einer anderen Daseinsschicht. Besonders übrigens in den früheren Texten bis 1980. Das ist interessant, nicht? Wo ich meine, nachhaltig gewirkt zu haben, in der Verständigung über Hintergründe, das ist in den Texten vor den Neuerungen, also in Gutachten und in Der Faden der Geduld.
Diese Wirkung reichte oft weithin, also wenn mir eine Frau nach siebzehn Jahren sagt, daß sie den Text mit dem Fell („Mein Vater kam aus dem Krieg…“) mit sich trägt… Das ist schon gut. Nun wird sich diese Wirkung nicht unbedingt multiplizieren lassen, aber solche Leserinnen und Leser habe ich in beiden Teilen Deutschlands.
Dahlke: Wenn Du jetzt so „Leser“ und „Leserinnen“ unterscheidest, muß ich doch gleich eine Frage loswerden: Mich läßt stutzen, daß Du in den Winkelzügen immer von „dem Autor“ sprichst. Ist das eine bewußte Abstoßung von feministischem Beharren auf einem weiblichen Plural? Meinst Du damit beide Geschlechter?
Erb: Nein. Da war ich überhaupt noch nicht in der Schule mit diesem „In“, hab’ ich mir gar nicht überlegt. Mir tuts auch leid, daß das nicht umgekehrt geht, also daß man das „In“ abhängen muß. Denn wenn das so ist, daß die männliche Form für alles genommen wird, dann haben die Männer sie als männliche Form ja nicht mehr zur Verfügung. Darüber gibt es keine Einigung. Jetzt sollst du wieder zurück, als ob Drittes gar nicht existiert.
Außerdem meine ich, daß in der DDR nicht die Frage Mann oder Frau die entscheidende war, sondern: Was ist das für eine Herrschaft, was ist los mit dem Gemeinwesen? Da stößt man eher gegen eine hierarchische Ordnung, die beide Geschlechter unterordnet.
Dahlke: Wobei ich in den Winkelzügen schon auf ein erkennbar weibliches Ich stoße…
Erb: Ja, klar. Auch früher. Natürlich. Das heißt doch aber nicht, daß… Übrigens habe ich etwas entdeckt, das habe ich auch aufgeschrieben, in einem Text mit der Anrede „Liebe Frauen…“
Dahlke: Das ist im Weibblick veröffentlicht, den kenne ich.
Erb: Ich habe entdeckt, daß für mich in bezug auf bestimmte Aktionsgrößen eigentlich immer nur die Frauen gezählt haben, jetzt nicht unter den Autoren, aber überhaupt, wenn es um was ging, habe ich mich an Frauen orientiert. In Georgien hatte ich einmal nur wenig Zeit, das Land zu erfahren. Später, in Berlin, fiel mir auf, daß ich da im Bus z.B. immer nur in die Augen von Frauen gesehen habe, um mich über das Land zu versichern…
Ich meine, Du willst ja auch lieben und geliebt werden. Wenn du dann feststellst, daß du dich so wenig um die Männer kümmerst… Dann findet im Grunde ja das gleiche statt, worüber die Frauen sich beschweren: Daß Männer immer nur aufeinander rechnen. Man könnte doch vielleicht auch mal überlegen, ob die Sache so schwierig ist, daß man sich naturgemäß immer an den Nächsten orientiert.
Dahlke: Meinst Du wirklich, daß das so ist?
Erb: Jedenfalls ist das ein Punkt, der nicht beachtet wird. Was die Menschen überhaupt an Lebenslast auszutragen haben, jeder. Ein Konflikt z.B. zwischen den Generationen kann gar nicht bestehen, wenn die Eltern so viel mit sich selber beschäftigt sind… Das habe ich in den Verlagen gesehen, bei den Lektoren und mittleren Kulturleuten in den 80er Jahren im Zusammenhang mit dem Einstieg der jungen Literatur. Das ist kein Generationskonflikt, habe ich mir gesagt, weil: Was sollen die denn tun, diese Lektoren, die müssen ihre Manuskripte verteidigen, gegen irgendwelche Bonzen, die dümmer sind als sie, die ihnen vorgesetzt sind, die haben den Kopf voll mit Kulturpolitik, den Phrasen, den Direktiven… das reicht zu. Was danach noch kam, das wurde einfach nicht mehr begriffen, das war schon in keinem Spannungsfeld mehr, da ging kein Arm mehr hin, so konnte auch kein Konflikt entstehen.
Dem entsprach außerdem auch der Mangel an Aggressivität in der literarischen oder künstlerischen Avantgarde. Da gab’s ja einen Wechsel, die Jungen waren erst, Anfang der 80er Jahre, auf dem Code der Gegnerschaft und haben ihn dann verlassen. Das weiß ich noch genau, erst haben sie von „Bullen“ geredet, nachher war das völlig weg, und das war bewußt geschehen.
Dahlke: Mit deinem Vorwort zur „Berührungs“-Anthologie hast Du Dich vermittelnd zwischen die Generationen begeben, Du hast den sozialen und politischen Hintergrund dieser ungewohnten Texte zu erklären versucht.
Erb: Na sicher, ich habe sie eingeteilt, das ist aber doch kein Konflikt. Das war übrigens auch umstritten.
Dahlke: Was?
Erb: Der fehlende Konflikt. Das war ein für uns untaugliches Wort.
Dahlke: Wen meinst du mit „uns“?
Erb: DDR.
Dahlke: In diesem genauen und eindringlichen Vorwort fällt mir auf, daß Du Dich kaum auf eine der Frauen beziehst.
Erb: Ach, ja? Das sind drei… Conny Schleime schattet Spiegelungen ab von ihrem künstlerischen Arbeiten, das ist nicht die Hauptsache, dann Gabriele Kachold und… Katja Lange. Nein, es sind vier. Sie sind nicht so entscheidend, es gibt andere, die die wirkenden Motive besser austragen.
Dahlke: Kacholds Text ist in seiner Art auffällig…
Erb: Ich mache keine Karteikartenerhebung: Wie kommt welche Thematik vor.
Dahlke: Ich meine das nicht thematisch.
Erb: Wenn du das stilistisch meinst, so ist sie ziemlich konservativ, da finden keine neuen Bewegungen statt, sie traut sich nicht, geht zurück…
Dahlke: Inwiefern zurück?
Erb: Sie stellt irgendwelche harschen Widersprüche her, dann geht sie zurück, sie zieht keine Konsequenz. Als wollte sie die Konflikte behalten.
Dahlke: Sie bewegt sich anders, nicht im Sinne einer klassischen Schriftstellerin… Aber was sie vom Gestus und vom Ton her einbringt, ist was ganz Eigenständiges in meinen Augen. Okay, sie diskutiert alles über Geschlechteridentität, aber es ist was Eigenständiges und etwas, was ich in dieser Anthologie für wichtig halte, gerade für die DDR.
Erb: Ja, dann hast Du aber eine Art Existenzkatalog, nicht einen, wo es um eine Sichtweise geht, das ist noch was anderes.
Dahlke: Warum hast Du sie dann in die Anthologie aufgenommen?
Erb: Weil sie schon dazugehört, ich muß mich jetzt auch ein bißchen besinnen, sie hatte schon auch Texte darin, die innovativ waren, die hatte sie aufgebrochen, die hatten eine bessere Chance… Es sind auch Texte, die sie nicht entlarven als eine, die ständig Orgasmus diskutiert, sondern sie ist in meiner Darstellung eine werktätige Schriftstellerin, kein Guru.
Dahlke: Die Texte, die von Gabi Kachold dort abgedruckt sind, sind falsch zusammengerückt, es sind eigentlich drei einzelne…
Erb: Sag bloß, Du hast die Ausgabe, in der so viel falsch gedruckt ist. Dort sind 27 mal Texte aneinandergeschrieben, die gar nicht zusammengehören. Das ist eine Meisterleistung… Und wir hatten doch gedacht, im Westen ist alles okay, dann kann man sich drauf verlassen. Sie haben auch besserwisserisch Texte rausgeschmissen, ohne uns zu fragen, stümperisch, sie haben Tippfehler für innovatorische Dichtung gehalten.
Dahlke: Das ist aber bei manchen Texten auch schwer auseinanderzuhalten…
Erb: Nein, durchaus nicht. Selbst bei Tohm di Roes, das muß man nur mitkriegen. Leider haben wir da keine Leseanweisung gemacht. Ich hatte selber auch Hemmungen, geerbt von dem einschüchternden Wesen der Avantgarde der 60er Jahre.
Dahlke: War dann der Prenzlauer Berg in Deinen Augen die Ost-Variante der westdeutschen avantgardistischen Dichtung?
Erb: Nein überhaupt nicht, das würde ich immer wieder bestreiten, die Haltungen von Franz Mon beispielsweise und die sprachverwandelten Texte der Prenzlauer-Berg-Prinzen haben gar keine Ähnlichkeit. Ich wüßte nicht, wo die überhaupt Berührungen hätten, das ist sehr schwer aufzusuchen. Aber dauernd erzählen, die holen irgendwas nach, das können nur Leute, die nie irgendeinen solchen Schritt mal mitvollzogen haben. Die nie begriffen haben, was das ist. Die zu allem, was sich ein bißchen bewegt, „Jandl“ sagen. Sie haben es nie begriffen, aber längst cool überlebt.
Dahlke: Noch mal zurück zu den jüngeren schreibenden Frauen, kannst Du Deine Vorbehalte etwas genauer beschreiben?
Erb: Ich bin da noch vorsichtig… Ich sehe oft so eine Vasenform oder so eine Fischform entstehen, weißt du. So ein Ich-Integral… Es geht aber nicht nur um Bewahrung, es geht um Leben, auch Zertrümmern, Zersetzen, Fruchtbarmachen, um Glockenläuten, nicht nur um Bewahren. Mir kommt es so vor, als wüßte z.B. Heike Willingham von all diesen Sachen nichts…
Dahlke: Wobei Heike Willingham ein Ich einfach setzt, das kannst du bei Stötzer-Kachold nicht sagen, da wird das Ich schon problematisiert, auch bei Barbara Köhler…
Erb: Das meine ich auch nicht, sondern, was man für ein Bild herstellt, wo das Interesse an diesem Bild ist, wie die Worte lauten. Da entsteht dann so eine Vasenform, aber ich rede jetzt nur von Heike. Bei Barbara war es anfangs so. Ich weiß, das hat etwas mit Dilettantismus zu tun, wobei es bei der Heike aus dem Dilettantismus… Jedenfalls fängt man leichter so an als anders.
Dahlke: Es fällt auf, daß gerade Frauen in ihren Texten nicht einfach „Ich“ sagen können…
Erb: Das würde ja dazu passen, was ich sage, dauernd diese Vasenformen, stromlinienartig…
Dahlke: Auch bei Dir, in den Winkelzügen fällt mir diese Nähe zwischen Text-Ich, Reflexions-Ich, schreibendem Ich auf.
Erb: Ich benutze rücksichtslos dieses „Ich“. Wenn ich „ich“ sage, kann überhaupt niemand mehr bestreiten, daß ich das gesehen habe, daß ich das jetzt meine usw. Dieses Ich ist unbestreitbar so wie dieser Stein unbestreitbar dort liegt… Ich weiß aber nicht ob das immer so ist.
Dahlke: Würdest Du zustimmen, daß es eine große Nähe zwischen Autorin und Text-Ich gibt?
Erb: Das ist natürlich auch eine soziale Schwäche, wenn man das Ich nicht ausbaut, als eine Figur mit mehreren Schichten und Gewebeteilen… das ist asozial: Du bist kein Stein als „Ich“.
Ich bin die Zeugin dessen, wovon ich rede, ich bin die Blackbox, ich kann mich zu allem gebrauchen, das ist eine Art ichloses Ich. Funktionalisiert, aber nicht weitergeführt, es geht nicht um das Ich.
Dahlke: Du benutzt es, aber es geht nicht um das Ich. Es wird vorausgesetzt? Könnte es damit zusammenhängen, daß Dich kaum jemand nach Deinem Geschlecht als Schreibende fragt? Oder fragt man Dich das? Kerstin Hensel z.B. wird oft gefragt, worauf sie genervt reagiert, weil es sie nicht interessiert…
Erb: Nein, aber ich fetze auch nicht so rum wie Kerstin. Sonst würde man mich schon zu Recht fragen, wie die Verbindung zu der großen Fetzerei, nämlich dem Feminismus, denn nun aussieht… Z.B. dieses Buch von ihr, wo sie in die Wohnung zieht.1 Das ist ja sehr nah an diesen feministischen Auffetzereien.
Dahlke: Was meinst Du damit?
Erb: Fetzen? Wenn du wegschiebst, was da im Bilde ist und solche Wahrheiten hinplatzt, wie: „Es schimmelte“, „es roch“, „dann machte ich erst das“… Das ist aber sehr interessant, das ist das letzte Buch von Kerstin, das müßte man mal untersuchen in seiner Haltung zum Feminismus. Vergleichen, wie feministische Texte etwas aufreißen und wie sie das macht. Gegen einen vorgefundenen Text etwas aufzureißen, das nenne ich „fetzen“.
Dahlke: Was ist daran feministisch?
Erb: Die Frauenliteratur macht das auch, z.B. Kachold. Gegen den geltenden Text erzählen sie was ganz anderes. Oft ist auch inhaltlich von „Fetzen“ die Rede. Fetzen hat ja auch zwei Bedeutungen: Etwas auseinanderfetzen und Lumpen, lumpig…
Das mache ich übrigens nie. Ich schreibe z.B. nie „die Wahrheit“. Ich gehe nie in Abenteuer dieser Art, wo Realität aufscheint, wie man so hübsch sagt.
Dahlke: Es gibt aber Passagen in den Winkelzügen, wo Du genau beschreibst, was Du tust: „Ich gehe runter in den Gemüseladen, kaufe ein…“, fast tagebuchartig.
Erb: Das ist was anderes. Immer, wenn jemand seinen eigenen Text vorträgt, fetzt er was ab. Wenn eine Kindheit beschrieben wird, da haben übrigens Frauen sehr oft diesen Kinder-Talk-Ton drauf, da können sie fünfzig sein, diesen Baby-Talk, ist ganz schwierig. Das ist eine Form, die dieses Fetzen etwas mildert auffängt. Warte mal, man kann über solche Sachen so schwer reden, weil es Eindrücke sind… Ärgert mich immer, wenn ich auf diesen Ton treffe.
Dahlke: Das hat ja auch etwas Befreiendes.
Erb: Es findet bei mir nicht statt, daß ich mich freispreche, daß ich etwas loswerde, daß ich mir was von der Seele rede.
Dahlke: Doch! Es gibt solche Stellen in den Winkelzügen.
Erb: Das ist doch aber nicht der generelle Text!
Dahlke: Da hast du recht. Aber es gibt sie, und das ist interessant. Da findet sich dann auch ein völlig anderer Gestus.
Erb: Das macht den Text aus bei den Winkelzügen, daß verschiedene Elemente zusammengebracht worden sind. Ohne daß es einen Drive von innerem Monolog oder so hätte, das hat’s ja nicht. Das hat ja wirklich den Charakter einer ordentlichen Erörterung, von einem Punkt zum anderen zu gehen.
Dahlke: Es hat aber auch etwas von Befreiung und Wut…
Erb: Ja, Wut. Aber Wut ist doch sehr gehalten in einem Thema, die Winkelzüge haben ja ein Thema, nicht? Es geht eigentlich darum: Was ist in meinem Unterbewußtsein schon an Kultur vorhanden, was ist überhaupt im Menschen an Leistungsbereitschaft, an Kultur, an Gutwilligkeit, an Können, an Lieblichkeit, an Anmut, auch an Intelligenz vorhanden. Und was wird durch die Oberfläche, mit der er als Mensch von der Gesellschaft in Anspruch genommen wird, verdunkelt. Dahinter ist dann noch Ärger und Unruhe. Ich kann einen Satz sagen, spontan, der eine Erkenntnis trägt. Monate später sage ich einen zweiten. Wieso konnte ich, als ich den ersten sagte, nicht gleich zu dem zweiten weitergehen? Anders ausgedrückt wäre es eine Beschwerde über mein Nicht-Gehen-Können. Das hätte eine regelrechte Klage werden können.
Dann gibt es ab und zu Entdeckungen, die den Text regelrecht von einer zur anderen tragen, dazwischen immer wieder die Frage: Was? Wie habe ich mich bewegt? Was ist das? Was tun wir? Es sind auch Serien von Verfluchungen, Schimpfreden, immer wieder. Warum bin ich so eifrig, sobald es um etwas Negatives geht? Warum gehe ich selber denn nicht endlich mal in das Andere?
Dahlke: Hast Du das ritualisiert?
Erb: Nein. Ich benutze rhetorische Formen, wenn Du das meinst. Ich habe es nicht ritualisiert, sondern ich benutze Ritualformen, dieses große Ausrufen z.B., eine Rhetorikform auch für Gedichte, die ich früher, vor den Winkelzügen, nicht hatte. Es ist natürlich eine Lust, denen, diesem pauschalisierten „sie“, diesem Feind, diesem unsichtbaren, was zu initiieren, dem einen Text draufzusetzen. Das ist leibhafte Rache. Da geb ich’s ihm, immer und immer wieder. Wenn ich mich erinnere an dieses Buch, dann komme ich auf diese Wutausbrüche. Ausrufe wie „Bewußtstein“, statt „Bewußtsein“. Oder der Drache der Allgemeinheit fordert von dir…
Dahlke: Ist das gesteuert oder ungesteuert?
Erb: Ungesteuert? Ungesteuerte Wut? Das ist so eine Sache. Wir reden doch nicht umsonst von Befreiung. Ich wüßte nicht, wo eine ungesteuerte Wut überhaupt hingehen könnte, es kann fast keine ungesteuerte Wut geben. Eine ungesteuerte Wut wäre eigentlich eine, die ihr Thema verfehlt. Es gibt diese Hemmungslosigkeit nicht, du bist umgeben von Hemmungen. Mit dem Rhetorischen gehe ich ja auf eine Herrschaftsebene, nicht?
Dahlke: Mit der Du dann auch spielst.
Erb: Ich spiele damit insofern, als sie nicht unbedingt diesen Hintergrund hat, die Rhetorik hat nicht unbedingt den Herrschaftshintergrund. Ich spiele mit ihrem anderen, mit diesen „Oh!“-Ausrufen, mit diesen dionysischen Suaden… Dann wieder dieser strafende Vater, dieses Definieren: „Das ist, das ist“, dieses „Sünder, Du“, Dieses Konfrontative hat ja dann auch aufgehört, das ist ganz unmerklich geschehen, ohne daß ich das bewußt gemacht hätte. In den Winkelzügen lösen sich die Gegenpositionen ja immer dann, das ist ganz offenkundig.
Dahlke: Ist es das Konfrontative, das Dich an den Texten der jüngeren Frauen stört?
Erb: Nein, es ist eher das Nichtbeachten des Konfrontativen, eher eine ungeklärte Ignoranz gegenüber den Fronten… Und das zum Teil bewußt, bei Kachold z.B., die sich betont absetzt. Dabei schreibt sie immer wieder kluge Sachen.
Dahlke: Im Zusammenhang mit der „Berührungs“-Anthologie hast Du den männlichen Autoren oft ihre eigene Poetologie erklärt, bewußt gemacht…
Erb: Nein, nein, ich habe sie gefragt und habe das übernommen, was sie gesagt haben…
Dahlke: Aber die Fragestellung foderte die Reflexion des eigenen Tuns erst ab.
Erb: Das war ja so: Es waren mir fremde Texte, etwas Verschlossenes. Dann habe ich irgendwo angefangen, zu „zusseln“, und dann kam das im Strom aus ihnen heraus. Ich war regelrecht verblüfft. Es lag viel Begründung bereit, hinter ihren Texten. Ich weiß, daß ich Leonhard Lorek mal Reihungen von lauter „und“ vorhielt und Babytalk, keine Konstruktion, als ob er keine Strukturen kennt. Roßtäuscherei. Auf meine Vorhaltung kam eine derartig exzellente Erklärung von ihm, daß ich ihm recht gab und nicht mehr wußte, was ich eigentlich von ihm gewollt hatte… Das ist übrigens typisch für mich: Was da auftaucht, das lasse ich jeweils gelten, da gibt es keine Hierarchie. Es ist auch eine Schwäche, daß ich dann meinen Einwand vergesse.
Dahlke: Könnte dein schwächeres Interesse an den schreibenden Frauen damit zu tun haben, daß sie solche Selbsterklärungen nicht bieten?
Erb: Schwächeres Interesse? Hm… Aber solche Poetologien, das ist wahr, das habe ich nie gehört von ihnen, sie sind nicht aggressiv, was das betrifft.
Daß eine Frau so anfängt wie der Anderson, das ist unmöglich. Und das ist wirklich auch ein Vorwurf. Wo sind sie denn geblieben, warum fangen sie nicht an? Die einzige ist wirklich Conny Schleime, mit so ein paar Direktivsätzen. Die anderen… Deshalb: Frag die Männer, die mit ihnen zusammenwaren, was die Frauen gemacht haben in dieser Zeit, die Frauen, die nicht geschrieben haben. Ich weiß es nicht.
Dahlke: Es gab im schaden mal einen Ansatz zur Diskussion um weibliches Schreiben. Heike Willingham sagte, Du hättest dafür auch einen Text geschrieben, der aber nie fertig wurde.
Erb: Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich habe mich gewundert, daß die Sarah und andere darauf so reagieren, dann fand ich das wieder sehr okay. Ich konnte nichts damit anfangen, aber andere offensichtlich. Das tröstet einen, daß ein Text sich anderswohin auszweigen kann und offenbar entwickelt ist, auch wenn ich das nicht sehe.
Dahlke: Bist Du eigentlich auf die Autoren in der Szene zugegangen oder sind sie zu Dir gekommen?
Erb: Das war ganz einfach, das hat mit der Anthologie angefangen. Innerhalb eines halben Jahres, das mußt Du Dir mal vorstellen, habe ich dreißig Leute hier gehabt… Das war auch jedesmal eine Flasche Wein und so weiter.
Dahlke: Wer hat das angeregt? Sascha oder wer?
Erb: Nein, das war der Verlag. Der Lektor war hier, erst bei Martin Hoffmann, der hat ihn dann zu mir geschickt. Ich dachte, ich selbst habe schon einen Verlag, da gibt’s aber diese jungen Leute, das war doch nach dieser Anthologie, die an der Akademie (der Künste) nicht durchkam.2 Dann habe ich davon zu reden angefangen, der Lektor sagte, sie machen nur Prosa, so habe ich gedacht, na gut, dann muß man das irgendwie formen, damit das eine Art Rahmen bekommt. Sascha hatte diese angehäuften Manuskripte, das hat sich dann entwickelt. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich glatt einen zweiten Band gemacht. Das ging von August bis Februar. Es war schon so, daß es für viele Junge was Neues war, mit jemandem wie mir zu reden, das habe ich gemerkt, die staunten über das Echo, das sie plötzlich bekamen, untereinander war das naturgemäß ja nicht so. Es hatte auch etwas mit der Kreuzung zu tun zwischen Akzeptanz und dieser Schul-Logik, die für sie nichts taugte, die sie verlassen haben. Das muß sicher faszinierend gewesen sein. Es war ihnen ja nicht immer so bewußt, daß sie die Logik verlassen wollten.
Dahlke: Wenn Du von der Sprachkritik in dieser Zeit sprichst, benutzt Du oft ein „Wir“. Haben sich Dein Denken und dasjenige der Jungen damals angenähert?
Erb: Sicher gab es große Unterschiede, aber in den entscheidenden Punkten nicht, das war das Verrückte. Ich komme z.B. auf Symbole, die Zahl Zwei, die Zahl Eins, und dann tritt da einer auf, heißt Karsten Behlert, ist 21 und hat die Sieben als Heldin eines Textes, als Textgröße. Das ist schon ein „Wir“. Nur ist es bei mir ganz woanders hergekommen. Es war so, als ob das Leben das hervorbrachte, was bei mir durch Denken geschehen war, das Denken mußte bei mir aber Widerstände durchbrechen, bei denen offenbar nicht.
Dahlke: Das war auch ein Generationsunterschied.
Erb: Ja. Ich weiß noch, daß mir übel wurde von gewissen alten Figuren, alten Denkweisen in neuen Texten. Das hat sich jetzt gegeben, aber wenn man ausgeht und fängt nur etwas winziges Neues an, ist man wahnsinnig empfindlich, das Alte ist dann wie Leichengift, wirklich.
Dahlke: Nur warst Du auch nach der „alten“ Seite hin immer gesprächsbreit, z.B. in diesem Interview mit Christa Wolf…3
Erb: Die Innovationsphase kam später…
Dahlke: Aber für DDR-Verhältnisse war auch das, was Du damals machtest, etwas völlig Neues, Ungewohntes.
Erb: Die Gesprächsbereitschaft war dieselbe wie gegenüber den jungen Leuten. Da ist jemand, der hat Gesetze, nach denen er sich bewegt. Damals ging es um ein Nachwort zu einem neuen Band von mir. Es hatte vorher eine Zusammenkunft von Autoren gegeben, bei Erich Arendt, ich hatte einen Text von Marina Zwetajewa gelesen, und Christa fragte mich, wann das erscheint, mit so einem Funkeln in den Augen, und wegen dieses revolutionären Moments in ihren Augen dachte ich, es sei etwas Verbindendes da, wo wir uns treffen könnten. So haben wir das Gespräch gemacht, als Nachwort zu dem Buch. Das Gespräch ist sehr lebhaft gelesen worden, vielleicht nicht lebhaft, sondern eher still, aber gründlich. Auf zweifache Weise, die einen sahen es so, als ob ich die Antworten gebe, die anderen, als ob die Christa obsiegt. Seltsam.
Dahlke: Aus heutigem Abstand erscheint es mir eher so, als ob Christa Wolf wenig Zugang findet. Sie zeigt Offenheit, aber das Gespräch gerät eigentlich zu einem großen Mißverständnis.
Erb: Jetzt mußt Du dir mal klar machen, daß x Leute das als „endlich mal ein Gespräch“ gelesen haben. Du sagst, die reden aneinander vorbei. Du mußt dir mal klarmachen, was das heißt. Da gibt es nun viele Einverständnisgespräche, die werden gar nicht als Gespräche aufgefaßt. Und dieses, wo sie aneinander vorbeireden, wirkt auf viele als „endlich mal ein Gespräch“, ist das nicht verrückt? Mal nachdenken über das Thema Gespräch…
Dahlke: Hast Du Dich der jüngeren Generation näher gefühlt als Deiner eigenen?
Erb: Ich habe mich überhaupt nie jemandem nahe gefühlt, mal so gesehen. Was heißt hier näher. Was die ältere Generation mir nicht gegeben hat, menschlich, persönlich usw., haben die mir ja auch nicht gegeben. Nur da war wenigstens eine Antwort auf dieses Mißverhältnis unter den Lebenden, da war wenigstens ein Schritt da raus, so ungefähr kann man das nennen. Ob das nun menschlich…, das weiß ich nicht, das ist sehr, sehr schwer. Ich habe schon den Eindruck, daß die Älteren „verpackter“ gewesen sind und es noch sind, aber das kann daran liegen, daß ich nicht richtig sehe. Ich habe so ein Kriterium gehabt, in den Winkelzügen: Unsere Pubertätsbilder, die der Frauen natürlich wieder. Da gibt es immer zwischen 14 und 17 etwa eine Unkenntlichkeitsphase, bei mir, bei anderen aus meiner Generation auch Nachher, die Jüngeren, wurden freier, die haben nicht mehr die Erwachsenen nachgeahmt. Auf Fotos kannst Du das sehen, unglaublich. Dieses ganze Verlegene, Eckige und gleichzeitig der Versuch, pompös zu sein, das ist meine Generation noch, danach hört es auf. Die sind freier dann.
Dahlke: Warum sagst Du „die der Frauen natürlich wieder“. Habe ich das richtig verstanden?
Erb: Weil ich auf Männer da wiederum gar nicht geachtet habe, gar keine Ahnung habe. Schlimm, nicht? Das war ja meine Entdeckung damals nach Georgien, daß ich mich offenbar an Frauen orientiere, daß ich genau das tue, was die Frauen den Männern vorwerfen. Wobei das vielleicht gar nicht so ist, die Männer denken vielleicht viel mehr im Frauenmedium als die Frauen in Männern, oder wie ist das mit Dir?
Dahlke: Ich denke schon, daß Männer auch für mich immer wieder zum Maßstab werden, obwohl ich es vermeiden will.
Erb: Wenn sie sich als Politiker bewegen, dann haben sie kein bißchen Frau in sich, sind total eingestellt auf das Mann-zu-Mann.
Dahlke: Wir Frauen aber auch.
Erb: Wie denn? Du spürst doch, was Du als lebendes Wesen bist, Deinen Hintergrund, Deine Zeugenschaft, Deine Antwort, Deine Rezeptionsbildfläche, alles das kannst Du von einem Mann doch gar nicht wissen! Also gehst Du naturgemäß von Deinem eigenen Geschlecht aus. Ich kann mir nicht vorstellen daß jemand so raffiniert sein sollte, das Andere zu beobachte; und irgendwas abzulesen. Im Leben war ich noch nicht so raffiniert, ich würde es gern sein.
Dahlke: Eben nicht. Du übernimmst den Maßstab, ohne Dir bewußt zu machen, daß das ein männlicher ist, daß wenig von Dir selbst darin steckt.
Erb: Gut, diesen Maßstab habe ich aber aufgefaßt nicht als männlich, sondern als hierarchisch. Die Formel Eins die herrscht, die du kulturell vorfindest, habe ich als eine des Verunglückens, der Hierarchie – mit allgemeingesellschaftlichen Codes besetzt –, nicht als „männlich“ verstanden.
Dahlke: Brauchten im „Prenzlauer Berg“ nicht viele schreibende Frauen die Bestätigung durch Männer, um ihre Texte für gut und publikationswürdig zu halten? Während umgekehrt das Urteil der Frauen kaum Bedeutung hatte?
Erb: Das ist wahr. Frauen schreiben wahrscheinlich nicht so selbstherrlich. Darin liegt vielleicht sogar etwas Parasitäres von seiten der Frauen, wenn sie beanspruchen, daß jemand ihren Text gutheißt. Gabi Kachold z.B. oder andererseits der Dieter Schulze, wollten, was ihren Texten fehlte, durch eine Außeninstanz gezeigt bekommen, das ist ein parasitäres Verhältnis, das allerdings der Geschlechterrolle entspricht. Das ist den Frauen anerzogen: Die Hilfsbedürftige, ohne Mann Unvollkommene. Es ist eine Seite davon, nicht alles.
Dahlke: Wobei natürlich die meisten männlichen Szene-Autoren Dein Urteil durch ihre Erklärungen für sich gewonnen haben, Gabi Stötzer-Kachold hat das auf diesem Wege nie versucht… Sie hat bis heute keine Bestätigung von Dir erhalten.
Erb: Soll sie doch mal selber was von ihren Texten halten. So geht das nicht.
Dahlke: Damit hätte das männliche Selbstbewußtsein, bis hin zur Großkotzigkeit, mal wieder gesiegt.
Erb: Der Fehler ist nicht, daß Gabi nicht großkotzig ist. Und das mit den Erklärungen, sie hätten mich mit den Erklärungen gewonnen, ist falsch.
Dahlke: Gabi ist nicht unabhängig. Aber der Kampf um Unabhängigkeit ist eben gerade die Aufgabe, die Frauen in einer männerbestimmten Gesellschaft unablässig zu leisten haben. Männliches Selbstbewußtsein und weibliche Unsicherheit sind zwei Seiten einer Medaille. Großkotzigkeit ist nun nicht gerade ein charmanter Begriff, aber augenscheinlich haben sich, unabhängig von ihrer wirklichen poetischen Originalität, nicht wenige auch einfach unbefragt als große Dichter vorausgesetzt…
Erb: Vielleicht muß man das auch.
Dahlke: Vielleicht können das Frauen ganz oft nicht. Und das ist nicht nur eine Sache des individuellen Charakters…
Erb: Die Bedingungen dafür sind verschieden. Ich habe das mal bei der Droste-Hülshoff gesehen, die hatte einen schwachen Vater, eine starke Mutter und daneben eine Riesensippe, der eine Großmutter vorstand. Bei mir war der Vater im Krieg, außerdem lebten wir noch auf dem Land, ohne irgendwelche Verwandten rundrum. Ich habe alle die infrastrukturellen Auseinandersetzungen, wie sie sich gegenseitig knechten und einnehmen, nicht erlebt, so daß ich völlig frei überall reinstolpern kann.
Dahlke: Du hast keinen Bruder, nicht? Schwestern?
Erb: Zwei Schwestern. Das paßt auch so zu mir, nicht verdorben zu sein durch Ignoranz. Mit verdorben meine ich, nicht untertänig zu sein. Natürlich bin ich sonst auch…, aber verdeckt. Ich habe das mal entdeckt, daß ich Angst vor Meinungsäußerung habe, auf einmal wurde das klar, hätte ich nie gedacht.
Dahlke: Wann war das?
Erb: Das fing an mit dem Hans Arp, da gab es eine Aufforderung zu Beiträgen für ein Jubiläumsbuch, in den 80er Jahren irgendwann. Von Anfang an, bei der neuen Beschäftigung mit Arp, hatte ich gedacht: Nö, das sehen sie falsch. Das jedoch ohne Angst. Aber bei einem entscheidenden Text des Zyklus habe ich gedacht, wenn die das jetzt lesen, kippe ich die alle um. Und gerade den habe ich rausgenommen. Ohne daß ich das merkte, obwohl ich alles umnumeriert habe; was kompliziert war und irritierend.
Dahlke: Wer waren „die“?
Erb: Die Träger der herrschenden Meinung über Arp. Vielleicht war es damals auch das erste Mal, daß ich so direkt widersprach, das ist dir ja nicht gegeben, daß, wenn du etwas entwickelst, du auch an eine Dimension kommst, die sich über mehreres hin erstreckt, auch Gesellschaftliches berührt. Das ist etwas unten drunter Liegendes, da reagiert ein tierisches Orientierungswesen. Wer weiß, was im Alter überhaupt noch direkt entgegengesetzt von Angst und Unterwerfung produziert wird.
Dahlke: Als ich Dein Vorwort zur Anthologie von 1985 las, hatte ich den Eindruck, Du wolltest erklären, was in diesem Lande vor sich geht, wolltest auch „Halt“ rufen.
Erb: Ja gut, ich habe ja einiges über das Gemeinwesen da rausgeholt. Wenn du erwachst und sagst: Das hängt doch hier so und so zusammen, dann redest du ja nicht mit der Gesellschaft, sondern mit dem Wesen in dir, das das bisher nicht wahrgenommen hat. Irgendwie ist der Mensch immer so ein abgekochtes Ei aus Jahrhunderten und weiß von nix, oder findet alles normal, ganz merkwürdig. Man hat es schwer, Strukturen in sich gelten zu lassen. Von den Konditionen des DDR-Denkens konnte ich vorher ja nicht reden. Wenn man das Objekt ist, kann man nicht gleichzeitig das Subjekt sein. Deshalb waren die Jungen so eine gute Ablösung, das ist eine spannende Ablösung, wenn die wirklich 20 Jahre jünger sind.
Dahlke: Du sprichst auch über die eigene Ablösung von Strukturen des „DDR-Denkens“.
Erb: Ich habe ja in den Winkelzügen ganz zuletzt noch welche in mir angetroffen. Das hat mehrere Stationen. Ich versuche, die zusammenzukriegen, wo ich auf das Wort „Bewußtsein“ stoße. Das ist eigentlich marginal, nicht zentral, aber die Marginalen in diesem Buch fordern die Hauptstraßen regelrecht. Das Thema Entzweiung und Versöhnung tritt z.B. nur marginal auf, das kann nur auftreten, wo es selber nicht das Thema ist. Dort setzt es sich durch. So taucht an bestimmten Punkten immer das Bewußtsein auf. Am Ende muß es sein, wo ich frage, wann endlich fange ich an, Bewußtsein als eine Sache des Schwungs zu fassen. Und ich entdecke mit Schrecken, daß ich immer noch Bewußtsein mit der staatlichen Formation der Gesellschaft vergleiche, der Staat als Bewußtsein. Darüber erschrecke ich zwar, komme aber dann dazu, daß ich mir sage, ist ja kein Wunder, woher soll’s denn kommen. Es ist doch im Leben auch viel davon abhängig, was dir überhaupt begegnet. Das war 1988/89.
Dahlke: Deshalb haben Deine Winkelzüge Bedeutung nicht nur für Schreibende, sondern auch für Leute, die einen ähnlichen Ablösungsprozeß von eigenen, verkrusteten Denkstrukturen durchlebt haben und durchleben. Das ist sowieso das Faszinierende an Deinen Texten, daß Du diese Ablösung so bewußt vornimmst. Ich dagegen habe erlebt, wie langwierig und schwierig der Versuch ist, sich alte Denkmuster überhaupt erst mal bewußt zu machen, geschweige denn sie zu durchbrechen. Lange opponierst du nur, ganz diffus.
Jedenfalls sieht es bei Dir so bewußt aus.
Erb: Na, das möchte ich doch behaupten, daß ich mit nicht weniger daherkomme als mit Elefanten und Trompeten, also mindestens! Mit Trara. „Gedöhns“, sagt man im Rheinland. Mit der Zeit habe ich was mit der Stimme gemacht, die Stimme geholt. Erst recht mit dem Rhetorischen.
Dahlke: Ich denke, Deine Übersetzungsarbeit hat einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung Deiner Poetik, an ihrem hohen Reflexionsgrad. Man bekommt durch die andere Sprache so einen Fremdblick auf die eigene Sprache. In den Winkelzügen ist davon auch mal die Rede.
Erb: Ich glaube nicht, daß das ausreicht, wenn man von fremden Sprachen auf die eigene sieht. Das wirklich Schöne wäre, sich diese Freiheit im eigenen Sprachbereich zu schaffen, indem man sich bewußt wird, wie die Form ist, daß man sie dann fliegen lehrt oder schweben. Daß man die Worte ins Ambivalente bringt, daß sie nicht geheißen werden, etwas festzunageln. An das Wort „Fremdblick“ kann ich mich nicht erinnern.
Dahlke: Sorry, das ist ein Wort von mir. Es kam mir im Zusammenhang mit Deinen Passagen zur Blok-Übersetzung und zur Unübersetzbarkeit des russischen „sja“-Suffix in den Sinn.
Erb: Das ist, wie Du vorhin sagtest, du bist drin, lange opponiert du nur. Aber das sind ja die Anfänge der Bewegung, daß man etwas feststellt: Im Deutschen ist es so, im Russischen ist es so… Das sind natürliche tolle Sachen, als ob du im Traum neue Landschaften siehst. Als würde ich neue Plateaus sehen, neu geordnete, andere.
Dahlke: Machst Du weiterhin Übersetzungen? Setzt Du Dich diesem Reiz bewußt aus oder machst Du das, um Geld zu verdienen?
Erb: Ich habe eigentlich noch nie was gemacht, um Geld zu verdienen. Das kann ich jetzt so sagen, das muß man mir glauben. Es war immer ein anderes Interesse das führende. Ich habe so ein großes Projekt, wovon ich vor zwei Jahren dachte, das würde ich gar nicht können, das müßte ich zurückgeben: Pasternak.
Das sind fünfzig Gedichte, und ich bin so im zweiten Drittel. Ich werde jetzt ganz vertraut damit, was vorher so unverständlich aussah, wird einfach Material, wie Stein für den Steinmetz, nicht so hart, aber… du kannst dich nur wundern. Dieser Wechsel der Ansprüche ist sehr wichtig. Dann mußt du natürlich auch wieder mit dir rechten, ob du auch treu bist oder ob du treulos irgendwas wechselst.
Dahlke: Treue ist ein Begriff, der mir im Zusammenhang mit Deinen Texten noch nie eingefallen ist. Aber er könnte wichtig sein.
Erb: Ja, wahrscheinlich. Aber so wie eine Selbstverständlichkeit, denn sonst gehört er zu den dualistischen Paarungen, die der Teufel erfunden hat.
Dahlke: Sag mal, die Frage „Werde ich denn noch lieben können?“ als Ausgangspunkt der Winkelzüge ist eine ganz weibliche Frage, oder? Mir ist unvorstellbar, daß ein Mann eine solch „private“ Frage zum Ausgangspunkt der poetischen Bewegung macht.
Erb: Das ist wahr, kann man sich weit und breit nicht vorstellen. Bei Frauen ist sie sehr existentiell, sehr nahe, unausgesprochen nahe, unter dem Ausgesprochenen, sie ist nur noch unter der Haut, da ist sie aber sehr verbreitet. „Geht das denn noch? Werde ich denn wieder, noch einmal…?“ Obwohl ja auch was hübsch Aufsässiges darin ist, so Heikles einzusetzen.
Dahlke: Für mich ergibt sich ein interessanter Widerspruch: Einerseits würde Dich kaum jemand auf den ersten Blick einem „weiblichen Schreiben“ zuordnen – Du selbst weist eine solche Zuordnung gereizt ab –, andererseits entdecke ich gerade in Deinen Texten mehrere Züge, die ich als Charakteristika weiblichen Schreibens beschreiben würde.
Erb: Das wird wohl so sein, wenn es doch so ist, daß ich mich, wenn es ernst wird, an Frauen orientiere. Vielleicht gehe ich mit Männern so um, als ob sie Frauen wären. Ich weiß nicht genau, es ist ja nicht so, daß ich sie ausschließe. Aber gerade in dem spezifisch Männlichen vielleicht doch… Das ist dumm! Und die, die haben die Möglichkeit, uns als weibliche Gewächse aufzufassen, und ich mache das nicht mit ihnen, bin ich dumm! Das ist die Erziehung.
Dahlke: Wie könntest Du sie denn als männliche Gewächse auffassen?
Erb: Na kannibalisch, so wie sie, fressen, naschen! Das ist aber das erste, was einem auf die Frage einfällt, warum geht man denn nicht weiter?
Dahlke: Manche Passagen der Winkelzüge weisen allerdings ganz traditionelle Frauenbilder auf, diese tagebuchartigen Stellen, wo es um Kissenbezüge geht, z.B.
Erb: Ich bin der Vater. Was wäre denn eine nichttraditionelle Rolle?
Wenn Du Dich erinnerst, wo es um den Haushalt geht, da meine ich, es ist mein Reich, ich bin jetzt frei. Das ist voll die tradierte Frauenrolle: Was die Mutter war, bin ich jetzt. Ist natürlich auch Herrschaftsübernahme: Ich bin der Herr in meinem Reich. Da gibt es keinen Vater.
Dahlke: Die Intensität der Selbstwahrnehmung in Deinen Texten wahrscheinlich ist auch weiblich?
Erb: Vielleicht nicht weiblich, sondern eine Form, die durch die Zwitterung zustande kommt. Ich mache das ja mit den gültigen, also eventuell doch männlich bestimmten Formen. Ich setze die Formen ja provokant, ausreizend, spielerisch ein.
Dahlke: Heißt das, Du gehst damit um, als wärest Du ein Mann?
Erb: Es ist so was wie die zweite Verarbeitungsstufe. Die erste wäre, Du bist wirklich ein Mann, du bist jemand, der gilt. (Was für mich soziologisch schon fast dasselbe ist.) Die zweite Stufe ist: Du bist ja kein Mann, so kannst du frei mit ihnen spielen, du kannst so offen sein, wie du willst. Dieses Fetzen, von dem ich vorhin gesprochen habe, tut so, als ob es wüßte, daß es so offen ist. So ungefähr, genau weiß ich das nicht, man muß Ruhe mit dem Thema haben und ansammeln… Da ist ganz viel Aufstandswesen drin, das weiß ich.
Dahlke: … Hm. Ich habe oft überlegt, wie Du Dich über ein Jahrzehnt als einzig akzeptierte schreibende Frau in der Szene bewegen konntest. Das hat sicher auch mit dem Generationsunterschied zu tun, aber…
Erb: Einzig akzeptierte Frau? Warte mal, wo waren denn die anderen? Sarah war nicht da… Das war auch so, daß die einen reinzogen, die sind zu Braun gegangen, zu Müller, auch mit den Zeitschriften…
Dahlke: Siehst Du heute Autorinnen, die mit der (männlichen) Sprache in der von Dir beschriebenen spielerischen Art umgehen?
Erb: Weißt du, es tut mir eigentlich immer ein bißchen in den Ohren weh, diese Sprache als männliche zu bezeichnen, ich habe das ja jetzt selber gemacht, aber… Ich sage eigentlich lieber „die überkommene“, „vorhandene“ oder „dominante“, um das Herrschaftsmonopol hineinzubringen. Es gibt sehr viele Frauen, die sich hart damit auseinandersetzen. z.B. die Ilma Rakusa, Elfriede Czurda, eigentlich alle Frauen, die schreiben. Die bewußtesten, unbewußt bewußtesten, setzen sich hart mit der Sprache auseinander. Da müßte man doch aber für die Männer das gleiche sagen, oder?
Dahlke: Meinst Du nicht, daß es da Unterschiede gibt?
Erb: Ich hatte immer den Eindruck, daß bei der Friederike Mayröcker große Unterschiede zu andern bestehen. Aber weißt Du, das ist so schwer, du kannst sie nicht gut überhaupt vergleichen. Sie macht wirklich etwas vollkommen Neues. Wie sie sich herausbegibt, etwas beginnt und dem auch folgt, das hat große Konsequenz, eins ist die Folge des anderen. Wenn sie liest, so nötigt sie mich zu nichts, das gefällt mir. Auch das Ganze, das sie herstellt, ist nicht zu fassen in einem Programm, das man benennen könnte. Es hat aus Daseinsweisen mehr Eigenschaften aufgenommen, ohne daß auch nur einmal die Klaviatur verlassen worden wäre. Das war doch Deine Frage eben? Es gibt auch Tabu-Verletzungen, was mir dann noch deutlicher sagt, daß die Klaviatur nicht verlassen wird. Das ist Opposition.
Dahlke: Vielleicht ist es unmöglich, diese „Klaviatur“, wie Du sagst, zu verlassen.
Erb: Es ist auch nicht nötig. Wohin sollte sie gehen? Andererseits wirft man ihr vor, daß sie so „Poesilien“ hat. Ich glaube, daß das nicht so ist, daß sie wirklich radikal die Kollektivsymbole einsetzt. Es gibt doch im Unterbewußtsein so eine Ansammlung von kollektiven Direktiven oder Kollektivbesitz an Symbolen, die sich z.B. darin ausdrücken, daß Menschen sich ziemlich ähnlich verhalten, wenn sie gestikulieren. Was sie da macht, ist ungeheuer. Ich habe ein bißchen gelernt, das zu lesen, immer in Ansätzen. Es hat bei ihr keinen Zweck, irgendwo anzufangen, etwas aufzuschlüsseln, weil das alles sofort da ist. Da ist sie wirklich eine Königin, beherrscht das alles. Ich weiß nicht, wie das kommt. Warum ist sie so stark. Vielleicht ist es so, daß sie gemeint hat, es muß so sein, und dann hat sie das gemacht, ungehemmt, als Frau ungehemmt. Denn es ist ja in den Frauen auch eine Totalität da, etwas Umfassendes. Das habe ich im Zusammenhang mit dem Wort „Lückenlosigkeit“ entdeckt. Das hängt ja zusammen mit dem Totalitären, die Totalbesetzung von allem. Du mußt, wenn du ein Kind aufziehst, es lückenlos aufziehen, du kannst keinen Teil herausfallen lassen. Das ist etwas, was die Männer nicht müssen, sie haben keine existentielle Erfahrung damit.
Dahlke: Meinst Du, daß Frauen mehr Totalitäres in sich tragen als Männer?
Erb: Ich weiß nicht, ob man dazu „totalitär“ sagen kann. Aber die ungewöhnliche Verbindung macht mir einfach Spaß… Ins Totale gehen, was auch die Enthemmung bedeutet. Wobei bei Friederike Mayröcker z.B. jede Art von Hemmung das ist, was beim Klavier die Tasten sind, alles, was man antrifft. Da, würde ich sagen, hat sie einen Zug, den man männlich nennen würde, wo sie greift, klaut, sich etwas nimmt. Es ist eigenartig, was mit mir passiert, während ich sie lese, wie ich reagiere: Das darf sie doch gar nicht, was geht sie das an? Wieso sagt sie etwas von Blumen, das geht sie doch nichts an, das sind doch nicht ihre. So entdecke ich bei mir eine Zurückhaltung vor Inbesitznahme, vielleicht ist da ein Unterschied zwischen dem Mitnehmen männlicher Form und einem Vorbehalt dieser Form gegenüber… Ich kann das nicht bezeichnen, sehr dumm, wenn man dazu immer männlich sagt.
25.10.1993. Das Interview führte Birgit Dahlke für ihre Promotionsarbeit Die romantischen Bilder blättern ab. Produktionsbedingungen, Schreibweisen und Traditionen von Autorinnen in inoffiziellen publizierten Zeitschriften der DDR 1979–1990, 1994
Zumutung
– Meine frühen Erb-Lektüren. –
Ich weiß nicht genau, welches Buch Elke Erbs das erste war, das ich las. Ich bilde mir ein, es sei Vexierbild gewesen, allein wegen des Wortes hätte ich den Band gekauft. Ich mochte Vexierbilder, sie waren, als ich Kind war, sehr beliebt. Ich meine nicht diese albernen, in denen beim genaueren Hinsehen aus zwei sich Küssenden zwei nackte Hintern werden, sondern jene im Kafka’schen Sinne, wie er es am 30. September 1911 in seinem Tagebuch als das „deutlich und unsichtbar“ Versteckte beschrieben hat, „deutlich für den, der gefunden hat, wonach zu schauen er aufgefordert war, unsichtbar für den, der gar nicht weiß, dass es was zu suchen gilt“.4 Vexierbilder sind Elke Erbs Texte für mich bis heute.5
In meiner Bibliothek stehen alle ihre zu DDR-Zeiten erschienenen Bücher, neben Vexierbild von 1983 auch der Debütband Gutachten (1975), Der Faden der Geduld (1978) und Kastanienallee (1987). Genau genommen zählen auch die von Brigitte Struzyk bei Reclam Leipzig herausgegebene Auswahl Nachts, halb zwei, zu Hause. Texte aus drei Jahrzehnten und die poetische Abhandlung Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlußreiche Verhältnisse dazu, die zwar beide erst 1991 erschienen, 1989 aber schon abgeschlossen waren.
Liest man diese Werke Elke Erbs chronologisch, schält sich eine Poetik heraus, die von den Kommentaren zu den Gedichten und den Notaten bis zu den Erörterungen der Winkelzüge reicht und Umkehrbögen und Wendeschleifen im Erb’schen Sinne mit einschließt. Im Frühwerk gesellen sich Aufsätze und Kurzprosa hinzu – wobei mir der Gattungsbegriff „Kurzprosa“ für Texte Erbs immer als ein zu technisches Wort erschienen ist. Für mich sind diese dichten Gebilde mehr der Gestalt einer Himbeere ähnlich oder einem Embryoblast. Es war das Nichtlineare der Texte, das mich von Anfang an beglückt und herausgefordert hat. Es gibt auch Texte von ihr, da ist die Herausforderung größer als das Glück, die warten auf Re-Lektüre.
Elke Erbs Gedichte zu lesen, ist nichts für Konsumenten. Sie zu lesen braucht Zeit und eigene Winkelzüge, die auch in toten Gängen von Labyrinthen enden können, „im Rücken Isoldes stechender Blick“.6 Das Vorwort von Gerhard Wolf in Vexierbild beginnt mit den Sätzen:
Texte von Elke haben immer etwas Unbedingtes, das uns herausfordert. Entweder können wir uns auf ihre Seh- und Sprechweise einstellen, um in einem durchaus nicht widerspruchslosen Vorgang an ihrem ,prozessualen Schreiben‘ teilzunehmen; oder wir lassen es auf diese Teilnahme gar nicht erst ankommen und lehnen ab, weil wir anders zu sehen, zu sprechen gewohnt sind. So sind diese Prosastücke, unbeabsichtigt, immer eine Provokation für den Leser.7
Mit heutigen Worten klingt das wie eine Triggerwarnung: Vorsicht Leser/Leserin, Lektüre auf eigene Gefahr!
In meinem Germanistikstudium an der Ostberliner Humboldt-Universität, das ich 1989 abschloss, gehörte Elke Erb nicht zum Kanon, sondern zu der anderen Welt, durch die ich nachts stromerte, der Subkultur des Prenzlauer Berg. Elke Erb hatte die Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung8 im Westen herausgegeben, die ich mir auslieh, um Gedichte daraus abzuschreiben, in mehreren Durchschlägen, die ich verschenkte an Leute, die ich für Gleichgesinnte hielt. Dabei war es nie das vordergründig Politische, das mich interessierte, sondern das Entgrenzte, das uns zu einem Teil des Kosmos machte.
An der Uni waren neben den deutschen Klassikern von Goethe bis Eichendorff und Heine Gedichte der etwa gleichaltrigen, später zur „Sächsischen Dichterschule“ zusammengefassten Autoren Volker Braun, Karl Mickel und Heinz Czechowski Kanon. Volker Braun veröffentlichte 1985 in der Zeitschrift Sinn und Form seinen Essay „Rimbaud, Ein Psalm der Aktualität“, der sich mit der literarischen Untergrundszene auseinandersetzte und leicht gegen sie gelesen werden konnte:
Technisch die Wiederholung des geistlosen Handbetriebs der Avantgarde, niedrige Verarbeitungsstufe.9
Er ging auch auf Elke Erbs Unterstützung ihrer jüngeren Kollegen ein, nannte sie herablassend „unsere Flip-out-Elke“.10 Auch an der Uni hatte man es nicht so mit Ausgeflippten, wenn sie noch nicht tot waren. In ihrer Antwort an Volker Braun,11 die nie in Gänze veröffentlicht wurde, formulierte Elke Erb in wenigen Sätzen ihre Poetik:
Als ich 1976 meinen Band Der Faden der Geduld abschloß, konnte und mußte ich mich fragen, wie es weitergehen würde, und ich kam auf drei Richtungen. Erstens: Eine Verschärfung der semantischen Konturen. Zweitens: Eine Entfaltung und Verselbständigung des Spielerischen. Das bedeutet eine Freisetzung und Entgegensetzung nicht integrierter und nicht einzuordnender Realität, des Klangs oder der lexikalischen Assoziation, des Schriftbildes (…) gegen ein verantwortungslos lineares aggressiv totalitäres Verständnis. (…) Drittens die Aufnahme alltäglicher, nicht literarisierter Realität als Zitat oder Thema, mit oder ohne Umgebung von anderem Text, als dunkle Größe, d.h. nicht zur Parabel und zum Dienst als Symbol. (25. Oktober 1985)12
Im Nachhinein war es nicht schlimm, dass Elke Erb an der Universität mit Nichtbeachtung gestraft wurde. Im Gegenteil, es machte frei, sie zu lesen. Das Studium war dazu da, Werkzeug zu erwerben und sich auf eigene Faust ins Dickicht der Verse zu begeben. So kam ich auf die Frauen, die mir als junger Lyrikerin, die freie Autorin werden wollte und nicht Germanistin, wichtiger waren, hatten sie es doch gewagt, das Schreiben zum Beruf zu machen. Sie waren, und daran hat sich bis heute nicht viel geändert, selbst in ihrem Scheitern wichtige Role Models. (Ich verwende den englischen Begriff, weil das Wort ,Vorbild‘ mir verbrannt ist für alle Zeiten.)
Als ich während des Studiums ungewollt schwanger wurde, habe ich mir eine Liste gemacht, welche Lyrikerinnen, die ich kannte, alleine Kinder großzogen. Es waren einige, unter ihnen Elke Erb. Das machte mir Mut. Ich bekam das Kind und schrieb später einen Text darüber, wie Verse aus dem Kapitel „Alles übrige – und ein Kind“ aus Winkelzüge13 mein Leben begleiteten wie Lieder, die man am Bett des Kindes singt.14
Aus einem der Bücher Elke Erbs fällt mir ein Zettel mit einer Notiz entgegen:
Die innere Ruhe, für die Inge Müller keine Zeit mehr hatte, ist hier da. Elke Erb schreitet, Inge Müller rennt
stolpert
fällt
steht auf.
Und mir fällt wieder ein, wie ich auf Elke Erb gekommen war. Ich hatte lange für meine Diplomarbeit über Inge Müller recherchiert, unter anderem suchte ich nach Widmungsgedichten. In Gutachten wurde ich fündig:
INGE MÜLLER
Zu Hell zu
Dunkel kommen Sie
Na schön
Sie sind der Arzt
Schön
Sie sind gekommen
Mein Teil sind tausend Wunden
Schön schön
Ich bin gespannt
Was Sie tun (1972).15
Nach und nach besorgte ich mir alles, was es von Elke Erb gab. Mein Favorit wurde der Band Kastanienallee und darin die „toten selbstvergessenen Mäuse“16 des ersten Gedichts.
1988 lud ich Elke Erb im Rahmen eines Studentenprojektes in die Sektion Germanistik ein, nachdem ich sie einige Male bei Untergrundlesungen gehört hatte. An der Uni machte sie dann das, was uns von den Dozenten als Sakrileg beschrieben worden war: Sie ging mit uns durch die Textwerkstatt, schlimmer noch, sie erklärte ihre Gedichte, mal Wort für Wort, mal mit neuen Versen. So, wie sie es 1991 auch in Winkelzüge17 tat, einem Buch, das ich bis heute nicht ,durch‘ habe, in dem ich aber immer wieder lese und dessen über allem schwebende Frage die Lebendigen antreibt:
Aber werde ich denn noch lieben?18
Elke Erbs fröhliche Begeisterung war ansteckend und ihre Gedichte plötzlich überhaupt nicht mehr ,schwierig‘ oder gar abweisend. Elke Erb hat mich gelehrt, bei den Worten zweimal hinzusehen. Ein Wort wie „Zumutung“ zum Beispiel. Die meisten lesen es als einen Vorwurf. Es steckt aber Mut zur Überforderung darin.
Das erste (und dann für Jahre auch letzte) Seminar, das ich 1991 an der Humboldt-Universität gab, hieß „Die verbannten Dichterinnen“. Es ging um jene Lyrikerinnen, die in der DDR verboten, ausgebürgert und an den Rand gedrängt worden waren. Und die in keinem Lesebuch der DDR gestanden hatten. Neben Elke Erb waren das Inge Müller (Selbstmord), Helga M. Novak (Ausbürgerung), Sarah Kirsch und Christa Reinig (Ausreise). Die Auswahl ist für mich heute, 25 Jahre später, immer noch gültig. Es war die neue Zeit, die mit der Übernahme der westdeutschen Massenuniversität begann. Die Stühle reichten nicht, und es wurden auch nicht weniger Studierende von Sitzung zu Sitzung. Aber ich habe nie wieder so ausufernde, heftige und dabei konstruktive Diskussionen in einem Seminar erlebt. Und noch dazu über Lyrik.
Leider sind die Aufzeichnungen verschollen, der Reader wurde noch während des Semesters entwendet. Ich muss mir 25 Jahre später durch Lektüre aller ihrer frühen Werke ins Gedächtnis rufen, welche Gedichte Elke Erbs ich damals eigentlich behandelt hatte, Stichworte sind ,Lamm‘, ,Gans‘ und ,Manna‘, was heißt, es waren die Gedichte „Ein Lamm weidete“, „Das Flachland bei Leipzig“ und „Widerspiegelung“. Von heute aus gesehen hatte die Auswahl etwas meiner Unsicherheit geschuldetes Pädagogisches. Es waren die am leichtesten zugänglichen Gedichte, zwei von ihnen waren schon in der Anthologie auswahl 6819 erschienen, die früheste Veröffentlichung Elke Erbs. Wir diskutierten lange über die Zeile „Ich hungerte, jetzt will ich wieder essen: / Dies Manna der Verletzungen, die munden“20 (wobei man die Bedeutung von „Manna“ nicht voraussetzen konnte), stritten über den starren Blick der Gans und das Lammfell unter den Füßen des lyrischen Ichs.
Elke Erb war keine „Andersdenkende“, sondern sie war und ist eine anders Denkende. Vielleicht ist sie deswegen eine der wenigen Autorinnen und Autoren, die mit dem Alter immer besser werden, immer noch etwas dazugeben, die Wege wechseln oder kurz mal umkehren, ohne sich um den Kanon und Sturzgefahren zu scheren oder auf ihrem Ruhm auszuruhen und Huldigungen entgegenzunehmen. Das ist auch einer der Gründe, warum Elke Erbs Gedichte nicht veralten, wie die vieler anderer, deren Texte heute nur noch historisch gelesen werden können.
Besonders eindrücklich war das 2011 bei dem von Studierenden veranstalteten Festival Prosanova in Hildesheim zu erleben. Elke Erb war mit dem 40 Jahre jüngeren Dichter Christian Filips und dem Musiker Bo Wiget angereist und hatte Teile ihrer Kücheneinrichtung mitgebracht. Zum Thema „Haushaltsfragen“ lasen sie am Küchentisch Gedichte, sangen und schälten Kartoffeln, während über ihnen die Quirle, Stampfer und Schöpflöffel schaukelten. Erb und Filips schwebten unter den Dingen.
Entlassen aus der Lehre, freigelassen
habe ich in dem Haushalt,
obwohl die Nötigung zur Hausarbeit
eine Störung der Arbeit ist,
ein Reich, in das ich trete
mit der Freiheit eines Herrn auf seinem Boden
und der Freiheit des Ahnungslosen
Der Haushalt beginnt seine Lehre.21
Die Alte stahl den Jungen die Schau, weil sie es verstand, nicht die Form zum Maß aller Dinge zu machen, sondern für den Inhalt eine angemessene, unabgenutzte Form zu finden. Wie seit den 1960er Jahren schon: Gegen das Mittelmaß, das nicht über sich hinauswill.22 Oder wie Elke Erb es in ihrer Antwort auf die Polemik Volker Brauns formulierte:
Statt da die Erbin glaubte, „sie müsse sich verweigern“ und eine „unbehelligte Individualität entgegensetzen“, schrieb sie 1980 den folgenden Denkansatz (den sie in den sechs Jahren darauf anwandte, in Konsequenz weiterentwickelte): „Ein Mittel ist, was es ist, ein Mittel. Zugleich aber, da der Mensch dieses Mittel erarbeitet hat, ist es ein in es hineingegangener, in ihm aufbewahrter Zweck. Lasse ich das Mittel nicht als etwas Menschliches gehen und zugleich als etwas Unselbständiges, dann läßt auch das Mittel mich nicht übrig und nicht sein, was ich bin, sondern es verschluckt mich.“23
Annett Gröschner, in Text+Kritik: Elke Erb – Heft 214, edition text + kritik, April 2017
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ + Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP + rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 + Hayer +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ + AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb + Archiv + Internet Archive + IZA + PIA + weiteres 1, 2 & 3 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Dirk Skiba Autorenporträts + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: Bundespräsident ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Die Zeit ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ faustkultur ✝︎ FAZ ✝︎ junge Welt ✝︎ literaturkritik ✝︎ LiteraturLand ✝︎ mdr ✝︎ MZ ✝︎ nd ✝︎ signaturen ✝︎ Sinn und Form ✝︎ SZ ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ tagtigall ✝︎ taz ✝︎ Volksbühne
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



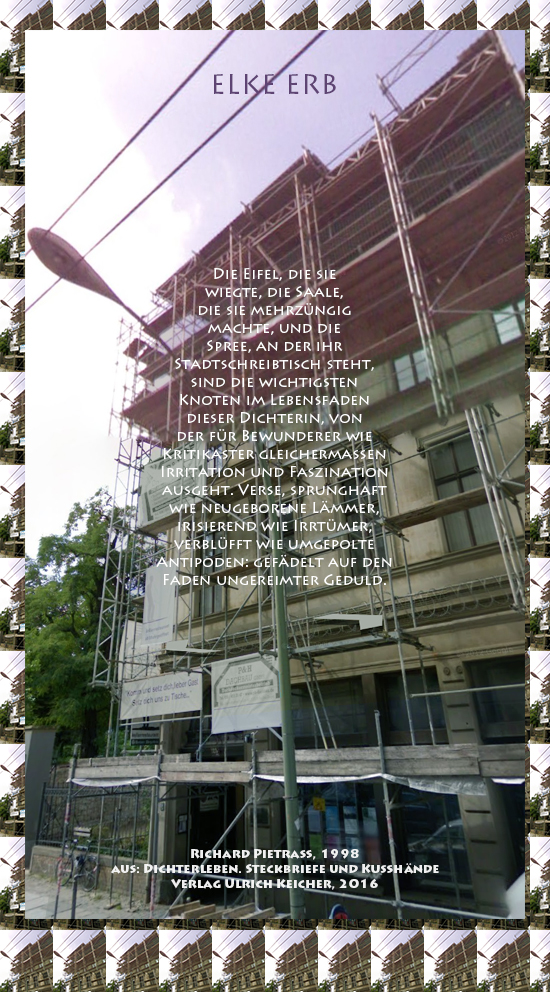












0 Kommentare