Giuseppe Ungaretti: Gedichte
FÜR IMMER
Ganz ohne Ungeduld werde ich träumen,
Ich werde mich an die Arbeit machen,
Die nie enden kann,
Und nach und nach, gegen Ende,
Kommen Arme den Armen entgegen,
Öffnen sich wieder hilfreiche Hände,
Licht geben die wiederauflebenden Augen
In ihren Höhlen,
Und du, plötzlich unversehrt,
Wirst auferstehen, nochmals
Wird deine Stimme mir Lenkerin sein,
Für immer seh ich dich wieder.
Nachwort
Giuseppe Ungaretti wurde am 10. Februar 1888 in Alexandrien, Ägypten, als Sohn von Emigranten aus Lucca, geboren. In dieser orientalischen Stadt, im Norden Afrikas, die ihm zum „üblichen Traum“ wurde, hat er seine Kindheit und Jugend verbracht. Erst um zu studieren, kam er nach Italien, ging später nach Paris, hörte Vorlesungen an der Sorbonne und entdeckte vor allem, was in der französischen Literatur und Malerei an Neuem geschah. Er lernte Apollinaire und Max Jacob, Derain und Picasso und Braque, Péguy und Bergson kennen und nahm teil an den erregenden Auseinandersetzungen über eine neue Kunst. Der erste Weltkrieg setzte den Lehrjahren ein Ende. Ungaretti kam als Soldat zum 19. italienischen Infanterieregiment und war zumeist an der österreichischen Front. Mitten im Krieg, in Udine, 1916, erschienen seine ersten Gedichte; es waren keine Kriegsgedichte, sondern die Gedichte eines Menschen, der sich plötzlich auf der „unvorhergesehenen Straße des Krieges“ fand und „Warum?“ fragte, sein „Warum?“ für alle wiederholte, die gleich ihm, wie im Herbst auf den Bäumen die Blätter, zu fallen bestimmt waren. „Soldati“ heißt ein Gedicht. Vier Zeilen, neun Worte. Das Wenigste wollte gesagt sein, weil wenig zu sagen blieb.
Nach dem Krieg ließ Ungaretti sich in Rom nieder und fand eine Beschäftigung im Außenministerium, wo er die französische Redaktion eines Bulletins übernahm. Il Porto Sepolto (Der begrabene Hafen), Allegria di Naufragi (Freude der Schiffbrüche) und Sentimento del Tempo (Gefühl der Zeit) waren mittlerweile erschienen und hatten ihn berühmt gemacht. Seine Dichtung erschien neu und einzigartig; sie wurde gefeiert und bekämpft auf eine nicht mehr vorstellbare Weise. Eigene Zeitschriften wurden gegründet in diesen Jahren, damit man Ungarettis Gedichte besser angreifen und besser verteidigen konnte. Er selber verdiente nicht genug, um seine Familie erhalten zu können. Ohne die Arbeit an seinen Gedichten zu unterbrechen, begann er darum für die Gazzetta del Popolo in Turin als Korrespondent zu reisen. Er schrieb Artikel aus dem italienischen Süden und den meisten europäischen Ländern und erlangte auch damit Ansehen.
1936 ging Ungaretti nach Brasilien und übernahm an der Universität Sao Paulo den Lehrstuhl für italienische Literatur. Die Wirkung seiner Lehrtätigkeit war nachhaltig; die dort geschlossenen Freundschaften dauerten. Nach dem Tod seines neunjährigen Sohnes Antonio kehrte er nach Italien zurück und schrieb die Kindertotenlieder „Giorno per Giorno“ („Tag für Tag“), die, zu einem Teil, in die deutsche Auswahl aufgenommen wurden. Italien ging in seine finsterste Zeit. Rom wurde von den Deutschen besetzt und erlebte eine Schreckensherrschaft. Die Leiden um sein Land, die Verluste von geliebten Menschen haben die Dichtung Ungarettis jener Jahre verändert. Die allegria ist dem Schmerz gewichen – Il Dolore ergab einen Band, in dem alle Unglücke im Leben eines Mannes verzeichnet sind.
Die römische Universität berief Ungaretti und schuf einen Lehrstuhl für ihn. Bis in sein siebzigstes Jahr hielt er seine Vorlesungen über Literatur. Aus der Ungaretti-Schule am „glorreichen Athenäum von Rom“ sind einige der jüngeren Schriftsteller und Dozenten hervorgegangen.
Mit Il Taccuino del Vecchio (Das Notizbuch des Alten) enden vorläufig die Kundgebungen einer Stimme, ohne die die neuere italienische Literatur – und nicht nur die italienische – nicht zu denken sein wird.
„Leben eines Mannes“ steht über alle Gedichtbände Ungarettis geschrieben. Die Erklärung dafür gibt er selber im Vorwort zu L’Allegria: „Dieses Buch ist ein Tagebuch. Der Autor hat keinen anderen Ehrgeiz, und glaubt auch, daß die großen Dichter keinen anderen hatten, als eine eigene schöne Biographie zu hinterlassen. Die Gedichte sind daher seine formalen Qualen, aber er wünscht ein für allemal begreiflich zu machen, daß die Form ihn bloß quält, weil er von ihr fordert, daß sie den Veränderungen seines Sinns, seines Gemüts entspreche, und wenn er irgendeinen Fortschritt als Künstler gemacht hat, so möchte er, daß dies nichts anderes bedeute, als daß er auch einige Vollkommenheit als Mensch erreicht hat. Er ist zum Mann gereift inmitten von außerordentlichen Ereignissen, denen er nie fern gestanden ist. Ohne je zu leugnen, daß die Dichtung auf Allgemeines sich richte, hat er immer gedacht, daß, wo etwas entstehen soll, das Allgemeine, durch ein aktives geschichtliches Gefühl hindurch, mit der einzelnen Stimme des Dichters übereinstimmen müsse.“
Aus dem ersten Band L’Allegria wurden für diese Auswahl an die 40 Gedichte übersetzt, also mehr als aus den späteren Büchern. Denn in den frühen Gedichten sind alle die neuen Töne und Gesten da, die wir zuerst kennenlernen sollten, alle die neuen Möglichkeiten, die Ungaretti in seiner Sprache entdeckte. „Allegria“ ist ein Wort, das man uns allerdings kaum zu erklären vermag. Hätten wir auch ein entsprechendes Wort, so fehlte uns doch – allegria. Das ist: Heiterkeit, Munterkeit, Freude… Eine Tempobezeichnung steckt auch darin; an das allegro in der Musik dürfen wir denken. Allegria gibt es bei Mozart, überhaupt manchmal in unserer Musik, aber sonst wohl kaum, weder in den Menschen, noch unter Menschen. Es ist ein Fremdwort für uns und wird nie für eine Wirklichkeit stehen. Bei Ungaretti ist das Wort in seiner ganzen lichten Bedeutungsfülle eingesetzt. Darum wurde es mit dem für uns erfüllteren Wort „Freude“ übersetzt. Freude, mit einem hellen Ton gedacht, Freude, die man in die Luft werfen kann und die einen gehen macht, leben macht – ein Geschenk von niemand.
Aber allegria ist nur eines der vielen Worte, die sich nicht übersetzen lassen wollen, die schwerer zu transportieren sind als der empfindlichste Wein.
Ungaretti schreibt über sich selbst: da der Wolf wohl das Fell verliert, aber nicht das Laster, habe er für jede neue Ausgabe, für jeden neuen Abdruck beinah, seine Gedichte verbessert. Von den meisten Gedichten gibt es daher mehrere Versionen. Sie weichen zwar kaum voneinander ab, zeigen aber die fortgesetzte Suche nach einem störungsfreien Hervortreten des Wesentlichen an einem Gedicht, nach Klangbefriedigung, nach dem genauesten, natürlichsten Ausdruck. Im Deutschen können diese Veränderungen nicht gezeigt werden, weil sie nur zu Veränderungen innerhalb der Übersetzung führen würden, die, begreiflicherweise, dann nicht den Verbesserungen am Original entsprechen müssen. Die Übersetzung folgt der letzten Ausgabe.
Viele der Gedichte sind datiert. Sie stehen darum, und weil Ungaretti auf der Chronologie – seiner Chronologie – besteht, in der Reihenfolge des Entstehens, von zwei Ausnahmen abgesehen: dem ersten und dem letzten Gedicht, da auch eine Auswahl leidlich einen Anfang und ein Ende setzen will. Nur eine Gesamtausgabe könnte zeigen, welchen Stellenwert auch diese und alle andren nicht berücksichtigten Gedichte haben.
Schwer zu erklären ist, wie Ungaretti innerhalb der italienischen Literatur steht und bewertet wird, denn die Kritik eines Landes hat mit sovielen Erscheinungen zu tun und den Bedingungen dieser Erscheinungen, daß die Sprache, die sie führt, um zu unterscheiden und zu werten, in einem anderen Land oft nicht mehr verstanden wird. Wir lernen nur einzelne große Dichter anderer Länder kennen, seltener Strömungen, Gruppen, und nehmen sie darum unbefragter hin oder messen großzügiger oder messen mit unseren Maßen, die im Herkunftsland wieder Befremden erregen können.
In Italien gilt Ungaretti den meisten als der größte Lyriker nach D’Annunzio, allen jedoch als derjenige, der mit der abgemühten, überladenen und dekorativen Sprache im italienischen Gedicht gebrochen hat. Man sprach von einer „wiedereroberten lyrischen Primitivität“, von der Frische, der Unmittelbarkeit, der Grazie, der Begnadung Ungarettis. Neuerdings heißt es hingegen, er sei ein hermetischer Dichter – aber wer seine Gedichte liest, wird das kaum verstehen. Als seine Ahnen werden Petrarca und Leopardi genannt. Das mag sonderbar erscheinen, denn für einen Dichter dieser letzten europäischen Moderne würde man bei uns die Ahnen wohl nicht so weit in der Vergangenheit suchen.
Petrarca, Leopardi… Doch beide haben ja, wie unser Dichter meint, ihre eigne schöne Biographie geschrieben. Sie haben das Leben eines Mannes gelebt zu anderer Zeit und waren, wie der Nachfahr, in der Konfession in ihrem Element. Sie haben das erste Erzittern über all das, was sie erfuhren und was ihnen widerfuhr, in die italienische Sprache gebracht. „Ed io pur vivo!“ heißt es bei Petrarca. Das war ein erster Schmerz, ein erstes Ausbrechen, erstes Aussprechen. Solche „erste“ Regungen finden wir auch bei Ungaretti. „Sono una creatura…“, „E t’amo, t’amo…“ Ein Wort ist darum auf ihn geprägt worden: Voce vivente. Lebendige Stimme.
Mit dieser lebendigen Stimme beginnt er, meist in normaler Lage, zu sprechen. „Bei uns zuhaus, in Ägypten…“ Oder: „Von welchem Regiment seid ihr, Brüder?…“ Und doch finden wir uns unvermittelt in einer viel höheren Lage oder in einem Drama wie in dem Gedicht „Brüder“ −, ohne daß wir angeben könnten, wie wir hineingeraten sind.
Ingeborg Bachmann, Nachwort
Giuseppe Ungaretti,
(1888 in Alexandria geboren, 1970 in Mailand gestorben) ist der Archipoeta, der Erzvater der modernen italienischen Dichtung. Man hat ihn einen Hermetiker genannt; aber dieses Schlagwort, zur Erklärung seines Werkes erfunden, hat es eher verdunkelt. Uns Heutigen erscheint es in strahlender Deutlichkeit, als ein Rätsel, das keiner Lösung bedarf. Ungaretti ist von nichts befangen; diese Freiheit ist es, was sein Dichten zu einem „offenbaren Geheimnis“ macht: lapidar, unzweideutig, schön wie ein Kieselstein.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1961
Lyrik
Immer mehr dringt die italienische Lyrik ins europäische Bewusstsein vor und erobert sich endlich den ihr gemässen Rang. Namen wie Montale, Quasimodo und Ungaretti haben heute auch ausserhalb ihrer eigenen Landesgrenzen einen guten Klang. Man entdeckte, dass sie durchaus nicht einfach Sänger des Südens sind, sondern dass ihre Dichtungen kosmopolitisch sind, dem Nerv unserer Zeit ebenso sehr nachspüren, wie den Menschen und ihren verborgenen Regungen und Träumen. Dass dabei Tradition und Herkunft noch spürbar bleiben, verleiht dem Geschaffenen erst recht ein eigenes Gepräge.
Von den drei genannten Dichtern ist Ungaretti der älteste. Er wurde 1888 in Alexandrien geboren, als Sohn von Emigranten aus Lucca. Seine ersten Gedichte erschienen 1916. Nach vielen Wegen und Irrwegen, die ihn auch nach Frankreich und Brasilien führten, berief ihn die römische Universität auf den für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Literatur, den er bis zu seinem 70. Altersjahr versah.
Man hat Ungaretti einen hermetischen Dichter genannt. Doch besagt diese Etikettierung wenig über das wahre Wesen seiner Dichtkunst. Sinnfällig ist sein jeder überladenen und dekorativen Sprache abholder Ausdruck. Man sprach von einer „wiedereroberten lyrischen Primitivität“. Ein oft äusserst knapper, beschnittener und skelettierter Lyrismus. Kunstwerke, die wie Fragmente anmuten. Ungaretti darf ein Meister des Kurzgedichtes, des lyrischen Stenogramms genannt werden. Darin und dahinter sind hingestreut die Spuren vom „Leben eines Mannes“, wie es über all seinen Gedichtbänden heisst.
Das vorliegende Bändchen der Suhrkamp-Bibliothek legt eine Auswahl aus seinem Gesamtwerk vor, italienisch und deutsch. Für die Lyrikfreunde mag es eine besondere Freude sein, dass die Uebersetzerin keine geringere als die als eigenständige Lyrikerin hochbegabte und bekannte Ingeborg Bachmann ist.
pso, Die Tat, 2.12.1961
Giuseppe Ungaretti
Das erste gewichtige Zeugnis der „modernen“ Poesie erschien 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, in der Etappenstadt Udine. Sein Titel: Der versunkene Hafen; sein Verfasser: der achtundzwanzigjährige Giuseppe Ungaretti. Ein Wiederabdruck von 1919 war um die nun titelgebende neue Folge Heiterkeit der Schiffbrüche vermehrt; in endgültiger Fassung wurde das Bändchen, als Heiterkeit ohne Zusatz, vom Dichter zum ersten Kapitel seines lyrischen Gesamtwerks Ein Menschenleben erklärt. Die Intention seines jugendlichen Erstlings umschrieb Ungaretti in einem sehr viel späteren Vorwort wie folgt: „Dieses lang zurückliegende Buch ist ein Tagebuch. Der Autor hat keinen anderen Ehrgeiz – und er glaubt, daß auch die großen Dichter keinen anderen hatten – als den, eine schöne Biographie seiner selbst zu hinterlassen. Seine Gedichte stellen also sein Ringen mit der Form dar, doch sollte es ein für allemal klar sein, daß die Form ihm nur deshalb zu schaffen macht, weil er von ihr fordert, daß sie den Wandlungen seines Gemüts entspreche und weil er – sollte er Fortschritte als Künstler gemacht haben – wünscht, daß diese Ausdruck auch seiner menschlichen Vervollkommnung seien. Er ist als Mensch inmitten außerordentlicher Ereignisse herangereift, denen er niemals fremd gegenübergestanden ist. Ohne je die Notwendigkeit einer Ausrichtung der Poesie aufs Universale zu leugnen, hat er immer dafürgehalten, daß das Universale, um vorstellbar zu werden, durch ein lebendiges Geschichtsbewußtsein mit der einzelnen Dichterstimme im Einklang stehen muß.“
Das sind Sätze, die seit langem zu den obligaten Belegen der Ungaretti-Kritik gehören; doch ist man sich anscheinend nie recht klar darüber geworden, wie seltsam, ja sensationell sie sich als Selbstaussage eines „hermetischen“ Dichters ausnehmen – denn mitten in der Arbeit am angeblich hermetischen Sentimento del tempo sind sie von Ungaretti niedergeschrieben worden. In einer Zeit, da Erlebnispoesie modisch verpönt ist, erklärt unser Dichter unerschrocken, seine Verse seien, als Ausdruck wechselnder Gemütsregungen, Spiegelungen eigensten Erlebens. Während die literarische Avantgarde der außeritalienischen Romania Dichtung als selbstgenügsame, ahistorische Blüte des Intellekts versteht, betont Ungaretti ihre Bedingtheit durch die „Zufälle“ der äußeren Geschichte. Und während sich die dort entstehende Lyrik alle unmittelbare Gegenständlichkeit – und nicht zuletzt die humanitäre – versagen möchte, macht Ungaretti nicht nur sein Ich zum zentralen Thema des Dichtens, sondern stellt einen programmatischen Zusammenhang zwischen seinem technisch-formalen und seinem menschlich-sittlichen Streben her.
Bezieht man diese Erklärung auf ihre geschichtlichen Orientierungspunkte, so lassen sich drei Momente herauslösen, die für die Genese des Ungarettischen Dichtens von entscheidender Bedeutung sind. Der ethische Ernst, den Ungaretti für sich in Anspruch nimmt, ist der gleiche, den in seiner Jugend die Zeitschrift La Voce dem geistigen Antlitz Italiens aufzuprägen versucht hatte. Das Ideal einer „schönen Selbstbiographie“ setzt eine illustre Überlieferung der italienischen Lyrik fort, an deren Anfang Petrarcas Canzoniere steht. Und mit den „außerordentlichen Ereignissen“, unter denen er zum Dichter herangereift sei, spielt Ungaretti – wir wissen es aus dem Einleitungskapitel – auf seine Erlebnisse an den Fronten des Ersten Weltkriegs an.
Auch zu diesem letzten Punkt hat sich der Dichter in einem diskursiven Bekenntnis besonders geäußert: „Man lebte in solcher Vertrautheit mit dem Tod, daß alles ein Schiffbruch ohne Ende war. Es gab kein Ding, das ihn nicht widergespiegelt hätte; unser eigenes Leben war von Anfang bis Ende jener beliebige Gegenstand, auf den zufällig unser Blick fiel. In Wahrheit war unser Leben selbst nur noch dinglich, das erste beste Ding. Jenes Sich-Versenken in den Augenblick eines Dings war ohne Maß. Die Ewigkeit war beschlossen im Augenblick…“
Nachdrücklicher noch als in vorausgehenden Zitat spricht sich hier der Zusammenhang zwischen Lebenserfahrung und künstlerischem Wollen aus. Wo der Mensch sich in so bestürzendem Grade als verlorenes Ding am Rande des Nichts erfährt, muß das hochgespannte historische, patriotische oder imperialistische Pathos von Carducci und D’Annunzio einem stilleren Stil des Menschseins und Dichtens Platz machen; und wer den „Augenblick“ immer aufs neue als Summe der Existenz erlebt, dem muß das großbogige, folgerichtig gebaute Gedicht der lyrischen Tradition widersinnig werden.
Man versteht nun, was die dichterische Revolution des Futurismus für Ungaretti bedeutete, wie begierig er auf Grund seines besonderen Lebensgefühls und Geschichtsbewußtseins ihre Errungenschaften aufgegriffen haben muß. Die Zertrümmerung der latinisierenden Periode, die Beseitigung des dekorativen Adjektivs, der logisierenden Interpunktion, die Verwendung des unvermittelten Vergleichs, der Verzicht auf den „geheimen Leierkasten“ der Reime, die Auflösung der strophischen Bindungen: all diese „modernen“, jegliche italienische Tradition umstürzenden poetologischen Grundsätze macht sich Ungaretti zu eigen; aber die laute, extrovertierte Emphase der Futuristen bildet er um in einen strengen und kompromißlosen Zug zur Wesentlichkeit.
Bei diesem Streben fand er einen Nothelfer in einem Dichter, den bereits die Futuristen – Uneingestandenermaßen – ausgebeutet hatten: in Mallarmé. Doch nicht nur dem unverwechselbaren „murmelnden Ton“ begegnete er dort; aus Mallarmés noch der Romantik verhafteten Frühwerk schöpfte er auch die meisten lyrischen Motive der Heiterkeit, soweit sie nichts mit dem Kriegserleben zu tun haben: Nacht und „noia“, die Melancholie und ihre Gegengifte Schlaf und Fleischeslust, die Frühlingsschwermut, die Qual der Widerständlichkeit des endlichen Raums. Noch hat Ungaretti von Mallarmé nicht das Ethos der strengen Form gelernt – er bedarf einstweilen nicht dieses Gegengewichts, da die Stücke seines ersten Bändchens zumeist in menschlich-normaler Sphäre liegen, weit diesseits des Mallarméschen Absoluten; wohl aber hat er ihm eine Reihe kleiner technischer Kunstgriffe abgeschaut, die sich unter dem von H. Friedrich geprägten Oberbegriff der „Unbestimmtheitsfunktion der Determinanten“ vereinigen lassen (Vorliebe für den unbestimmten Artikel, für unbestimmte hinweisende Fürwörter oder für bestimmte mit unbestimmter Sinngebung und so weiter). Von Mallarmé scheint schließlich sogar der Titel Heiterkeit der Schiffbrüche herzukommen. Klippe und Schiffbruch gehören, als Metaphern für das tragische dichterische Ringen mit dem Absoluten, zum festen Wortschatz des Mallarméschen Werkes. Im gleichen Sinne verwendet sie Ungaretti, jedoch mit jenem grundsätzlichen Unterschied in der Haltung, der sich im Titel andeutet und im Titel-Gedicht ausspricht. Nicht zum „bitteren Fürsten der Klippe“ lassen den jungen Ungaretti seine dichterischen Abenteuer werden, sondern zum wetterharten, heiter-resignierten „Seebären“, der in unbesiegbarem Optimismus nach jedem Schiffbruch die gefahrvolle Fahrt von neuem aufnimmt.
Was also Ungaretti in der Heiterkeit als erstes Ergebnis vorlegt, sind Gedichte, in denen die Klang- und Sinnschwere des einzelnen Wortes, ja der einzelnen Silbe wiederentdeckt wird, in denen sich die strophischen Einheiten nicht nach objektiven Regeln, sondern nach den Bedürfnissen des dichterischen Augenblicks formen und in denen selbst die typographische Anordnung, mit ihren säulenhaften Vertikalismen und ihren freien Zwischenräumen, sich als optisches Pendant des lyrischen Ausdruckswillens zum Klanglichen fügen will. An zwei Stellen des Bändchens verleiht Ungaretti seiner „poetica della parola“, der Entdeckung und Neusetzung des reinen, jungfräulichen Worts im geistigen, das „Lebensfieber“ klärenden Akt, dichterischen Ausdruck:
(…)
Dichtung erblüht aus dem Wort
ist die Welt die Menschheit glasklares Staunen
das eigene Leben aus fiebriger Gärung
Finde ich gräbt es sich in mein Leben
in meinem Schweigen wie ein Abgrund
ein Wort
In stärkerer symbolischer Verrätselung heißt es im Programmgedicht der ersten Sammlung, Der versunkene Hafen:
Dort kommt der Dichter an
und wendet sich dann zum Licht mit seinen Gesängen
und verstreut sie
Von dieser Dichtung
bleibt mir
jenes Nichts
aus unversiegbarem Geheimnis
Es liegt im Zuge dieses fortwährenden und immer strengeren Wegwaschens des Unwesentlichen – alles Erläuternden, Faktischen, Füllenden und Verbindenden −, daß die Quantität des Ausgesagten mehr und mehr zusammenschrumpft, bis der letzte und ideale Gipfel der Reinheit und des „Geheimnisses“ erreicht ist: die Kurzform des Fragments. Im lyrischen Telegrammstil liegt die kennzeichnende dichterische Leistung des frühen Ungaretti.
Hierfür einige Beispiele, zunächst aus dem Bereich eines romantisch empfundenen und manieristisch formulierten Naturerlebens:
HEUTE ABEND
Brüstung aus Brise
um heute abend
meine Schwermut aufzustützen
UNIVERSUM
Mit dem Meer
habe ich mir
eine Bahre aus Frische
gemacht
Eine epigrammatische Version der Kriegserfahrung, die man mit den Beispielen des ersten Kapitels vergleichen mag:
SOLDATEN
So
wie im Herbst
am Baum
Blatt um Blatt
Die folgenden Zeilen, die an die barocken Sinnsprüche erinnern, sind sicherlich als Hinweis darauf zu verstehen, wie der Dichter seine Verse „aufgefaßt“ sehen möchte:
TEPPICH
Jede Farbe breitet sich aus und gibt sich auf
in den anderen Farben
Um einsamer zu sein wenn du hinsiehst
Und schließlich, als äußerster Fall, jener berühmte und unzählige Male angeführte Zweizeiler, den Horst Rüdiger als ein „echtes Kuriosum des lyrischen Lakonismus“ bezeichnet und für den, nach vielen Versuchen anderer, Michael Marschall v. Bieberstein die meines Erachtens überzeugendste Übersetzung gefunden hat:
MORGENFRÜHE
Ich erleuchte mich
aus Unermeßlichem
Man sieht: diese lyrischen Splitter sind für den erfahrenen Leser keineswegs „dunkel“, sie bedienen sich einer geradezu „leichten“ Bildersprache, einer schlichten und hellen Syntax. Ihre scheinbare Irrationalität ist fast allein das Ergebnis einer radikalen Verkürzung des Stofflichen, derart, daß der Anlaß des Gedichts vieldeutig-unbestimmt wird und sich da und dort (wie im Beispiel „Soldaten“) nur über die Eselsbrücke des Titels entschlüsseln läßt. Auch Ungaretti bedient sich also, wie die meisten modernen Lyriker, der Suggestionstechnik, auch er richtet an den Leser die stillschweigende Aufforderung, sich selbsttätig in den poetischen Prozeß einzuschalten; diese Aufgabe stellt sich in der Heiterkeit hauptsächlich als eine solche des Auffüllens und Rekonstruierens.
Den, der von der italienischen Dichtungsgeschichte her auf diese Neuerungen blickt, wird das heftige Für und Wider, das sie auslösten, nicht überraschen. Die „Modernen“ suchten nach Beglaubigungen in anderen Zeiten und Völkern und dachten sie in der angeblichen (in Wahrheit überlieferungsbedingten) Bruchstückhaftigkeit der griechischen Lyrik und in den japanischen Haikus zu finden; die „Passatisten“ waren nicht gewillt, den geforderten Glaubensakt mitzuvollziehen und sprachen von Anmaßung und Mystifikation. Relativ spät faßte der Crocianer Francesco Flora in seinem Pamphlet „La poesia ermetica“ alle gängigen Einwände in der wohl schlagkräftigsten Form zusammen: Ungarettis „Gedichte“ seien überhaupt keine Gedichte, sondern Themen von Gedichten, Notizen zu Gedichten, oder gar „eine Folge kleiner Fehlgeburten in einem toten Raum“. Verdächtig sei schon die Unsicherheit und Willkür der Titelwahl. Der angeführte Zweizeiler, ursprünglich „Himmel und Erde“ überschrieben, wurde später zu „Morgenfrühe“. Gibt es – so fragt der Kritiker – einen zwingenden Grund, ihn keinesfalls „Mittag“ oder „Nacht“ zu nennen? Aus Ungarettis zweiter Sammlung Gefühl der Zeit zitiert Flora den Einzeiler „Einer Taube lausche ich aus anderen Sintfluten“ und kommentiert mit sarkastischer Pedanterie: »Hier ist vor allem die peinliche Zurückhaltung zu beobachten, mit der uns der Autor verschweigt, was die Taube eigentlich sagt und was für uns im Grunde alles zu bedeuten hätte. Auch wird man sich wundern über all diese ungeahnten Sintfluten außerhalb aller Geschichte und jedes vernünftigen Grundes. Und schließlich ist festzustellen, daß ein solcher Vers sehr stark an Zitate erinnert, wie man sie als verstechnische Belege in den Handbüchern der Metrik anführt. Immerhin steht dort das Gedicht dahinter, dem das Zitat entnommen war. Hier dagegen ist das Gedicht nicht vorhanden, und was mit den neuen, auf die biblische folgenden Sintfluten gemeint war und was die neue Taube bedeutet – das alles hätte in lyrischer Klarheit gesagt werden müssen. Ein Gedicht aus einem einzigen Vers? Warum nicht – vorausgesetzt, daß es vollendet ist, daß seine Strahlenbündel aus einem Mittelpunkt kommen und nicht willkürlich vorgestellt werden müssen! Evokation – warum nicht? Aber kein Caprice! Suggestion – warum nicht? Aber keine Mystifikation! Und sei es auch nur die, welcher der Dichter als erster zum Opfer gefallen ist.“
Es ist hier gewiß nicht der Ort, noch einmal das lang verhallte Streitgespräch um Sinn oder Unsinn des lyrischen Fragmentismus aufzuwärmen. Flora sperrt sich gegen die experimentelle Absicht der Ungarettischen Versuche, die von einer allzulangen rhetorischen Praxis abgenutzte italienische Dichtersprache von Grund auf zu erneuern; er konnte diesen Versuch wohl auch gar nicht billigen, da er von seinem Blickpunkt aus nicht notwendig war. Die grundsätzliche ästhetische Möglichkeit der lyrischen Kurzform vermochte er, bei allem kritischen Witz, wohl kaum ad absurdum zu führen. Den Kritiker hat im übrigen die weitere Entwicklung der modernen italienischen Lyrik ausgiebig widerlegt. Das Fragment ist seit Ungaretti nicht wieder aus der italienischen Lyrik verschwunden. Ungaretti selbst streut noch in seine späten Werke lyrische Splitter ein, Montale und Quasimodo kennen und benutzen die lyrische Minimalform, und Saba findet am Ende eines langen und ganz andersartigen Weges in ihr die höchste Verwirklichung seines Talents. Natürlich gibt es gute und schlechte, überzeugende und flaue „frammente“, so wie es eben gute und schlechte, geglückte und mißglückte Gedichte gibt; oder – um es mit einem scherzhaften Bilde Sabas zu sagen: „Auch Verse gleichen den Seifenblasen: die eine fliegt auf, die andere nicht.“
Das stärkste Argument für die Ernsthaftigkeit des ungarettischen Suchens lieferte indessen die Veröffentlichung seiner Verstreuten Gedichte (1945) mit den Varianten zu den ersten beiden Zyklen. Daß Ungaretti hier (und später von seinem „Gelobten Land“) die Vorstadien seiner Resultate bekanntmachte, entspricht einer grundsätzlichen Auffassung des modernen Dichters, der zufolge der Prozeß des Dichtens unauflöslich zum Werk gehört und selbst schon Poesie ist. Seitdem ist es also möglich, die vorletzten und letzten Phasen der dichterischen Arbeit Ungarettis zu betrachten; seine lyrischen Destillate erscheinen nun als Restbestände eines künstlerisch verantwortungsvollen Reduktionsprozesses und keinesfalls mehr als augenblicksgeborene, unkritische Setzungen. Eines der frappierendsten Beispiele für einen solchen Reinigungsvorgang bietet das Gedicht mit dem fragmentistischen Rätseltitel „Entspringt vielleicht“. In der Endfassung von 1943 lautet es auf deutsch:
Da ist der Nebel der uns auslöscht
Entspringt vielleicht ein Fluß hier oben
Ich lausch’ dem singen der Sirenen
Aus dem See darin die Stadt war
In der avantgardistischen Zeitschrift Lacerba war 1915 das gleiche Gedicht in der für jeden Kenner des definitiven Ungaretti kaum glaublichen Version erschienen:
Mamma mia! quanto hai pianto!
C’è la nebbia che ci cancella.
Nasce forse un fiume quassú.
Non distinguo piú.
Ascolto il canto delle sirene del lago
dov’era la città
So populär, emphatisch und „unrein“ wie nur immer möglich hatte der Einsatz dieser Fassung den biographischen Anlaß des Gedichtes verraten: die melodramatische Auseinandersetzung zweier Liebender vor den Toren einer Stadt, im Schutze des Nebels. Mit prosaischer Schulmeisterlichkeit hatte der Dichter im vierten Vers erklärt, der Nebel raube ihm das optische Unterscheidungsvermögen, und wie von ungefähr hatte sich der Klingelreim quassú – piú eingestellt. Nachdem aber diese beiden Verse im selbstkritischen Läuterungsprozeß vom Dichter verworfen und der ursprüngliche Titel „Sintflut“ (ärgerliche Assoziation mit dem Tränenstrom des weiblichen Subjekts!) durch das unbestimmte „Nasce forse“ ersetzt worden war, bei dem nicht ganz klar wird, ob es eine Frage oder eine Feststellung ist, hatte sich ein scheinbar gänzlich neues, unbestreitbar suggestives lyrisches Gebilde herausgeschält. Am Rande sei schließlich erwähnt, daß die veränderte Anordnung der beiden letzten Verse eines der zahlreichen Beispiele dafür ist, mit welch rastloser künstlerischer Disziplin Ungaretti das Problem des Freiverses auffaßte.
Soviel zu Ungarettis vielberedeten „frammenti“. Obwohl wir einige unter ihnen bewundern, glauben wir, daß der frühe Ungaretti sein Bestes in Gedichten mittlerer Länge gegeben hat, in denen er der lyrischen Bewegung, bei aller verkürzenden Stilisierung, ein freieres Ausschwingen verstattet. Hier zwei Beispiele, die uns nicht zuletzt inhaltlich interessieren sollen, da sich in ihnen ein öfter wiederkehrendes, offensichtlich originales Motiv der Ungarettischen Empfindungswelt gestaltet. Da ist zunächst das Gefühl des nomadenhaften Unbehaustseins, am wirkungsvollsten gefaßt im Gedicht „Landstreicher“:
In keiner
Gegend
der Erde
kann ich hausen
In jedem
neuen
Klima
dem ich begegne
schmachte ich
doch
schon einmal
war ich seiner
gewohnt gewesen
Und immer trenne ich mich
ein Fremder
Werde geboren
wiederkehrend aus
abgelebten Zeiten
Einen einzigen Augenblick
anfänglichen Lebens
genießen
Ich suche
ein unschuldiges
Land
Man beachte, wie stark die unmittelbar sinnliche Erfahrung dieses Bewußtsein heimatloser Unruhe bestimmt und wie das gesuchte „unschuldige Land“ viel mehr ethisch: als Land der arglosen Kommunikation, denn metaphysisch: als Reich des Absoluten gemeint ist. Das bejahende, euphorische Gegenstück zu solchen Momenten der Depression bilden jene gelösten Augenblicke, in denen sich der Dichter als eine „gelehrige Fiber des Alls“ fühlen darf, als kleine, aber erfüllte und sinnvolle Parzelle des Kosmos, Derartige Höhepunkte pantheistischer Stimmung sind meist auch solche des lyrischen Gelingens wie in „Verklärung“:
Ich stehe
gelehnt an einen Haufen
sonnenbraunen Heus
Quälende Unrast
steigt brodelnd
aus fetten Furchen
Entsprossen fühl’ ich mich
den Menschen dieser Erde
Ich fühle mich in den Augen
die achten auf die Wandlungen
des Himmels
in den Augen jenes Alten
dessen Antlitz zerfurcht ist
wie die Rinde
der Maulbeerbäume
die er beschneidet
Ich fühle mich in kindlichen Gesichtern
glühend
wie eine rosige Frucht
zwischen kahlen Bäumen
Wie eine Wolke
löse ich mich
in der Sonne
Weit tu’ ich mich auf
in einem Kuß
der mich verzehrt
und beruhigt
Abermals frappiert der Gehalt an Wirklichkeitsfülle, an ungenierter Sinnenfreude, der dieses „moderne“ Gedicht kennzeichnet. Man darf vermuten, daß hier D’Annunzio, der große Magier der Sinnlichkeit, mit „Alcyone“ nachwirkt. Nur sind bei Ungaretti, auf den ersten Blick erkennbar, sowohl D’Annunzios Pansexualismus wie seine selbstgefällige Artistik in menschliche, „unanimistische“ Wesentlichkeit verwandelt; so darf auch dieses Gedicht, obwohl das Pendel sehr weit nach der Seite der normalen Dinglichkeit ausschlägt, zum lyrischen Essentialismus gezählt werden.
Es sei uns gestattet, das – gewiß äußerliche – Kriterium der Ausdehnung noch eine kleine Weile beizubehalten und festzustellen, daß sich auch einige im herkömmlichen Sinne lange Gedichte in der Heiterkeit finden. Das berühmteste sind die oft zitierten – und gerühmten – „Flüsse“, in denen Ungaretti, innerhalb seiner diffusen Lebensbeichte, eine kompakte lyrische Selbstbiographie gibt, deren Stationen er in vier Flüssen zugleich bestimmt und versinnbildlicht: im toskanischen Serchio, von dessen Ufern seine Ahnen stammten; im Nil, an dem er geboren wurde und Kindheit und Knabenzeit erlebte; in der Seine, in deren Wasser der Pariser Student geblickt hatte, und schließlich im Isonzo, dem Schauplatz seiner Kriegserfahrungen. Wie der größte Teil der Heiterkeit überhaupt, so bieten auch die „Flüsse“ keinerlei Verständnisschwierigkeiten, sondern wollen gerade durch ihre gesammelte Schlichtheit auf den Leser wirken. Freilich kommt anderwärts diese Schlichtheit der ungebundenen, mitteilenden Rede oft bedenklich nahe, ja sie wird zur ausgesprochenen, lediglich vertikal aufgegliederten Prosa in dem „In Memoriam“ betitelten Stück, das im Stil eines poetischen „fait divers“ vom Selbstmord eines arabischen Freundes in Paris berichtet. Wir treffen hier auf das Residuum einer literarischen Erbschaft, die – neben den bisher erwähnten – ebenfalls noch in Ungaretti spürbar ist: die der „Dämmerungsdichter“, welche, wie wir inzwischen wissen, im polemischen Gegenzug gegen die Rhetorik der letzten Dichter-Trias den Stil des lyrischen Understatements gepflegt hatten.
Andererseits, und ganz im Gegensatz hierzu, bezeugen einige wenige Beispiele der Heiterkeit des Dichters Willen, die bare Realität im eigenwilligen, abrupten, verschiedene Wirklichkeitsbereiche zusammenzwingenden Bild schöpferisch zu transzendieren. Als Beleg wähle ich „Volk“, den metaphernträchtigen Gesang des heimkehrenden „Ägypters“, sein „Salve sacra tellus“ beim Gewahren des italienischen Landes:
Es floh das einsame Rudel der Palmen
und der Mond
unendlich über dürren Nächten
Verschlossenste Nacht
müht sich eine düstere
Schildkröte
Eine Farbe dauert nicht
Die trunkene Perle des Zweifels
rührt schon die Morgenröte auf und
zu ihren flüchtigen Füßen
die Glut
Schon wimmeln Schreie
eines neuen Windes
Bienenstöcke bilden sich in den Bergen
verirrter Fanfaren
Kehrt wieder alte Spiegel
ihr verborgenen Wassersäume
Und
während nun schneidend
die Schößlinge des hohen Schnees
den Anblick säumen
der meinen Alten vertraut
reihen sich
in der ruhigen Helle
die Segel
O Vaterland
alle deine Zeiten
sind wach geworden in meinem Blut
Sicher rückst du vor und singst
über einem hungrigen Meer
Diese wenigen Beispiele müssen genügen, um die lyrische Situation des jungen Ungaretti zu illustrieren. Zwei Impulse bestimmen offensichtlich sein Dichten, ein geschichtlicher und ein literarischer: das Kriegserleben und das Studium der symbolistischen Lyrik. Aus der Vitalerfahrung rührt sein besonderes Lebensgefühl her und der Drang, dieses dem gleichgestimmten Leser mitzuteilen; aus der geistigen Erfahrung dagegen die Erkenntnis, daß es der moderne Dichter mit einem Sprachmaterial zu tun habe, welches durch die Praxis entheiligt sei und daß die dichterische Sprache erneuert und sublimiert werden müsse; und schließlich, daß die Aufgabe des modernen Dichters nicht Mitteilung, sondern Ausdruck heiße, nicht Abbilden der Wirklichkeit, sondern deren Verdichtung und Erhöhung im Sinnbild. Auch wenn entsprechende Äußerungen unseres Dichters fehlen, so besteht kaum ein Zweifel, daß Ungaretti diesen Gegensatz als Spannungsverhältnis empfand. In der Tat zeigt nicht nur die Heiterkeit, sondern sein gesamtes, späteres Werk diese Polarisierung in Mitteileilung und Ausdruck, in Realität und Metapher. Die beiden Aspekte lösen einander ab, können aber auch an dichterischen Gipfelpunkten eine Synthese eingehen. In der Heiterkeit läßt sich besonders deutlich dieses Wechselspiel beobachten: wo die objektive geschichtliche Erfahrung im Vordergrund steht, wählt Ungaretti eine klare, kommunikative Sprache mit wenigen und stets transparenten Bildern; wo er von subjektiven Empfindungen spricht, strebt er nach einer esoterischen, oft preziösen Metaphorik. (Mit Recht hat Gustav René Hocke das oben angeführte Fragment „Heute abend“ in seine Anthologie europäischer Concetti aufgenommen. Andererseits steht ein Gedicht wie „Die Flüsse“ als Beispiel für eine geglückte Harmonisierung von Bild und Sinnbild, wobei freilich das Schwergewicht entschieden auf der Seite des Sinnlich-Wirklichen bleibt.
Läßt sich die Doppelung in Hell und Dunkel bei genauerem Hinsehen schon im Innern der einzelnen Ungarettischen Werke beobachten, so bestimmt sie im ganzen die Stationen dieses dichterischen „Menschenlebens“. Während in der Heiterkeit das Exoterische vorherrscht, steht das zweite Bändchen, Gefühl der Zeit, stärker im Zeichen des Esoterischen.
Die neue Sammlung vereinigt Gedichte, die zwischen 1919 und 1935 entstanden sind. Ungaretti nennt sie: „il mio secondo tempo d’esperienza umana“. Abermals haben wir in dem „urnano“ zugleich die Vokabel „künstlerisch“ mitzuhören, da – wir sahen es an früherer Stelle – Menschsein für Ungaretti Künstlersein bedeutet und umgekehrt. In künstlerischer Hinsicht beschreitet Gefühl der Zeit manch neuen Weg. Dem Zug seiner literarischen Weggenossen in Italien folgend, hat auch Ungaretti sich nun den lyrischen Traditionen seines Landes zugewandt: während es in der Heiterkeit sein Anliegen war, „die Natürlichkeit, die Tiefe und den Rhythmus im Sinne des einzelnen Wortes wiederzufinden“, ist er jetzt bestrebt, einen Einklang „zwischen der überlieferten Metrik und den heutigen Ausdrucksgeboten“ herzustellen. Noch kehrt er nicht zu den traditionellen Strophenformen (oder gar zum Reim) zurück, wohl aber zu den vertrauten Maßen der italienischen Versgeschichte: zum Sieben-, Neun- und vor allem zum Elfsilbler. Wie die italienischen Modernen der zwanziger Jahre ist Ungaretti bei Petrarca und Leopardi in neue Schule gegangen: das Resultat waren inhaltliche Reflexe, es waren bei ihm vor allem formale Errungenschaften.
Zugleich mit jener Rückbesinnung intensivierte sich jedoch auch das Vorwärtsgerichtete. Dessen Erscheinungsweisen sind einmal die stärkere Verselbständigung des Musikalischen, zum andern der häufigere Gebrauch der unvermittelten, auf das rationalisierende Zwischenglied verzichtenden Analogie. Hören wir zu beiden Aspekten dieser zweiten Manier den Dichter selbst! Daß sein Streben nach Klangwirkungen einem Programm absichtsvoll „dunklen“ Dichtens entspreche, leugnet er resolut: „Möglich, daß sich da und dort eine Dunkelheit einstellt. Darauf ausgegangen bin ich nicht: dies zu denken, wäre töricht. Aber die Dichtung, wie ich sie verstehe, ist voller Fußangeln, Fesseln und Zwänge. Da bin ich z.B. hinter einem Klang her und es entsteht mir etwas Überzeugendes, aber der Sinn ist ein wenig aufgeopfert worden, oder der Rhythmus…“ Aber auch Ungarettis zeitgeschichtliche Interpretation der Technik der freien Analogie sei vermerkt. Technologische Formeln der Futuristen wiederaufgreifend, erklärt er: „Wenn für das 19. Jahrhundert der Drang kennzeichnend war, mit Hilfe von Geleisen und Brücken Verbindungen herzustellen, so wird der heutige Dichter versuchen, entfernte Bilder in drahtlosen Kontakt zu bringen…“
Ein weiteres Novum des Gefühls der Zeit ist das Zurücktreten der subjektbezogenen Aussage, der Zug zu einer objektiven Thematik. Sein ganzes Dichten seit 1919, erklärte Ungaretti in einem Gespräch über sein Gelobtes Land, sei Betrachtung, Projektion der Gefühle in die Objekte, ein Versuch, die eigene Lebenserfahrung zu Ideen und Mythen zu erheben. In der Tat werden nun Nymphen, Sirenen, Leda, Diana, Apoll evoziert; eine mythisch-irreale Szenerie, im Sinne eines „reinen Ereignisses“, gestaltet das mit Recht berühmt gewordene (bei H. Friedrich abgedruckte) Gedicht „Die Insel“. Abermals begegnen Bilder und Motive aus Mallarmé – jetzt aber aus dem reifen Werk des großen Vorbilds der lyrischen Modernität. Hinzu kommen einige Reminiszenzen aus Valery, besonders aus dem Umkreis des „Aurore“-Gedichts. Doch gilt hier das gleiche wie für die Übernahmen in der Heiterkeit: Ungaretti entleiht dies oder jenes, aber er absorbiert es, beschneidet es, macht es zum Baustein des eigenen, um andersartige Notwendigkeiten kreisenden Werks.
Wir sagten an früherer Stelle, daß im Gefühl der Zeit die dunklere Seite vorherrscht. Doch gibt es auch so transparente und „leichte“ Gedichte wie das „Ruhe“ betitelte:
Die Traube ist reif, das Feld gepflügt.
Von den Wolken löst sich der Berg.
Auf die staubigen Sommerspiegel
ist der Schatten gefallen.
Zwischen den unsicheren Fingern
ist ihr Licht klar
und fern.
Mit den Schwalben flieht
die letzte Qual.
Von solchen Versen sagte seinerzeit der Kritiker Alfredo Gargiulo, ihre Diktion wirke wie eine Folge natürlicher Atemzüge. Auf einer etwas höheren Stufe der Verdichtung steht das folgende Stück, das, wie „Die Insel“, des Dichters Wunschtraum von der Überwindung der Zeit gestaltet, die Suche nach einer Windstille der Gefühle, einem mythisch unbewegten Glück
WO DAS LICHT
Wie wogende Lerche
Im heiteren Wind über jungen Wiesen
Leicht wissen dich die Arme, komm.
Vergessen werden wir, was ist,
Das Böse und den Himmel,
Und mein kriegerisch rasches Blut,
Schritte erinnerungsschwerer Schatten
In den Gluten neuer Morgenstunden.
Wo das Licht reglos im Laub,
Träume und Ängste zu anderen Ufern entflohn,
Wo der Abend ruht,
Komm, dorthin will ich dich tragen
Zu den goldenen Hügeln.
Befreit vom Alter, wird
Die dauernde Stunde
In ihrem verlorenen Glanz
Unser Laken sein.
Es fällt auf, daß viele Gedichte des Gefühls der Zeit die Windstille, die Ruhe, das erreichte Ende einer (besser wohl: jeder) Bewegung thematisieren. Ist es banausisch, darin eine geheime Entsprechung zum oder ein Symptom für das Ende der jugendlichen Auflehnung gegen die Tradition (im weiten Sinn), für die Rückkehr zur „Ordnung“ zu erblicken, die den Ungaretti der zwanziger Jahre geprägt haben? Zu dieser Gruppe rechne ich auch eines der schönsten Gedichte, die Ungaretti geschrieben hat, veranlaßt durch den Freitod eines sechzehnjährigen Mädchens aus seinem Bekanntenkreis:
GEDENKEN AN OFELIA D’ALBA
Zu früh
tranket ihr, vorzeitig gedankenvoll,
all dies eitle Licht, schöne Augen,
gesättigt hinter gesenkten Lidern −
schwerelos nun.
In euch Unsterblichen
suchen die Dinge,
denen ihr folgtet unter verfrühten Zweifeln,
glühend ob ihres Wandels,
Frieden.
Zur Ruhe kommen werden sie bald
auf dem Grunde eures Schweigens −
verbraucht:
ewige Embleme, Namen,
reine Beschwörungen…
Die Aufgabe für den Leser dieses teils mit neu platonischen, teils mit barocken Reminiszenzen unterlegten Textes (angemessen ist nur ein lautes Lesen) besteht darin, die weise gesetzten Pausen wiederzufinden und so die entscheidenden Elemente (aber welche wären es bei dieser Art des Dichtens nicht?) „ans Licht zu heben“. Man sieht hieraus, daß Ungaretti in seiner zweiten Phase keineswegs die Poetik des isolierten Wortes verabschiedet hat: er hat sie nur in einen neuen, größeren syntaktisch-metrischen Zusammenhang gestellt. Ähnliches gilt für das kurze Gedicht „Gefühl der Zeit“, das dann den Titel des ganzen Zyklus hergegeben hat. In ihm ist der Dichter so weit gegangen, daß er, zugunsten des beschwörenden Charakters der Einzelteile, sogar auf die Setzung eines finiten Verbums verzichten wollte. (Inhaltlich finden wir hier die erste Anspielung auf das Gefühl des Alterns.)
Und schauend das rechte Licht,
während ein leichter lila Schatten
auf das tiefere Joch fällt,
die Ferne offen dem Maß,
jeder Pulsschlag, wie das Herz es gewohnt,
doch jetzt hör’ ich ihn,
beeil dich, Zeit, auf meine Lippen
deine letzten Lippen zu drücken.
Eine Sonderstellung im Ganzen des Gefühls der Zeit nimmt die Folge „Hymnen“ ein. In ihnen spreche sich, gibt Ungaretti an, eine religiöse Krise aus, die von Millionen Menschen und ihm selbst in einem der dunkelsten Jahre der Nachkriegszeit (1929) durchlebt worden sei. Schon in der Heiterkeit war da und dort die Frage aufgeklungen: Was ist Gott? „Warum giere ich nach Gott?“ Die geschichtlichen Ereignisse der frühen zwanziger Jahre (Machtergreifung und erste Untaten des Faschismus) lassen nun die Gottsuche und das Rechten mit dem Kainsmenschen zum beherrschenden Thema werden – gelegentlich wiederum in hintergründiger Verknüpfung mit dem Problem der Inspiration, des dichterischen Schaffens. Nach seiner Rückkehr zum Katholizismus fühlt sich der Dichter als stellvertretender Dulder, „ausgestoßen inmitten der Menschen“, doch leidend für sie; nicht mehr zu ihrem Führer berufen wie die Seher-Dichter Carducci und D’Annunzio, auch nicht mehr selbstherrlicher Außenseiter wie die „poètes maudits“, sondern gewillt, für seine leidenden und irrenden Brüder zu beten. Für diese Phase stehe als Beispiel das (ziemlich deklamatorische) Gebet:
Wie friedlich mußte kreisen
Die Welt, ehe der Mensch war.
Der Mensch machte aus ihr Gespött von Dämonen,
Seine Zügellosigkeit nannte er Himmel,
Seinen Wahn erhob er zum Schöpfer,
Als ewig setzte er den Augenblick.
Das Leben ist ihm unmäßige Last,
Wie drunten jener Flügel der toten Biene
Der Ameise, die ihn schleppt.
Von dem, was dauert, zu dem, was schwindet,
O Herr, gefesteter Traum,
Laß wieder gelten einen Pakt.
O erhelle diese Kinder,
Laß den Menschen wieder fühlen,
Daß du, als Mensch, aufstiegst zu deiner Gottheit
Durch unermeßliches Leiden.
Sei du das Maß, sei du das Geheimnis!
Reinigende Liebe,
Laß wieder eine Treppe der Erlösung sein
Das Fleisch, das trügende.
Laß mich wieder dein Wort vernehmen,
Daß, in dir endlich vernichtigt,
Die Seelen sich vereinigen
Und droben bilden,
Ewige Menschheit,
Deinen seligen Schlaf.
In diesem Gedicht begegnen wir der spezifisch Ungarettischen Weise von Zeitkritik, von dichterischem In-der-Welt-Sein; daran wird sich auch nach 1943 nichts ändern. Zweifellos war unter dem Faschismus, von dem sich der Dichter inzwischen diskret distanziert hatte, eine solche moralisch-metaphysische „Opposition“ die einzige, welche die herrschende Diktatur als unverfänglich betrachten und dulden konnte. So erklärt es sich, daß Ungaretti nicht in die innere Emigration zu gehen brauchte wie viele seiner italienischen Dichterkollegen (Mitte der dreißiger Jahre ergriff er jedoch die willkommene Gelegenheit, sich – wenn auch ohne äußeren Druck – geographisch zu distanzieren); so erklärt sich letztlich die reale Möglichkeit seines doppelgleisigen, bald esoterischen, bald exoterischen Dichtens.
Die Thematik der „Hymnen“ nahm Ungarettis nächstes Werk Der Schmerz (1937-1946) vorweg. Drei Leiderfahrungen bilden den biographischen Hintergrund des neuen Zyklus: der Tod des Bruders, der Tod des neunjährigen Söhnchens Antonietto in São Paulo, wo der Dichter seit 1936 einem Lehrauftrag an der Universität nachkam, und schließlich der objektive Schmerz, das Mit-Leiden am Krieg, am Schicksal Roms, seines Landes und der Menschheit nach der Rückkehr, 1943.
Was sich indessen an diesem dritten Kreuzweg des Ungarettischen „Menschenlebens“. durchgreifend gewandelt hat, ist der dichterische Stil. Nur die Folge Tag für Tag setzt im großen und ganzen den gedrängten, aber überwiegend schlichten Fragmentismus fort, der einst die dichterische Handschrift Ungarettis gekennzeichnet hatte. Die übrigen Stücke dagegen zeigen einen bisher unbekannten Zug zum Extensiven. An die Stelle der Aufreihung syntaktischer Parzellen, die wir soeben noch am Beispiel des „Gebets“ beobachten konnten, treten nun große Satzkonstruktionen, die sich über viele Verse hinweg erstrecken und denen besessene Worthäufungen, Hyperbata und zyklopisch übersteigernde Vergleiche ihr Gepräge geben.
Am kürzesten und populärsten läßt sich die neue Manier Ungarettis als barock kennzeichnen. Barockes Antithesenspiel war auch in den früheren Werken da und dort begegnet. So war in der Heiterkeit das Gedicht „Nostalgia“ in die paradoxe Pointe ausgeklungen: „Und wie fortgetragen – Bleibt man zurück.“ Im Gefühl der Zeit war von „flammenden Schatten“, von „stimmlosen Schreien“ die Rede gewesen, und auch die „Verdinglichung pastoraler Thematik“ im Gedicht „Die Insel“ hat Leo Spitzer, Friedrichs Deutung korrigierend, mit preziösen und barocken Verfahrensweisen in Verbindung bringen und einleuchtend begründen können. Im Schmerz nun steigert sich einerseits die besagte Antithetik über perfekte Gongorismen („die feuerlosen Feuer der Vergangenheit“) bis zur Verbindung von Wortspielen zweiten Grades mit barocker Ich-Spaltung („Und mir selbst bin ich selber schon nichts mehr als das vernichtende Nichts des Gedankens“); andererseits wird immer wieder Erhöhung und Überhöhung der psychologischen oder sachlichen Aussage durch eine aufs Körperhaft-Große zielende Metaphorik angestrebt. (Die „zyklopische“ brasilianische Tropenlandschaft und die grausige Ungeheuerlichkeit der Zeitereignisse mochten dieses Verfahren dem Dichter als angemessen erscheinen lassen.) Obwohl nun all diese Kunstmittel mit erfahrener Hand gesetzt werden, kann sich der Leser wohl kaum des entschiedenen Eindrucks erwehren, daß das Dichterische in diesem Zyklus spärlich ist und die Deklamation bei weitem überwiegt. Rhetorisch überspannte Prosa: das ist das erstaunliche Ergebnis, bei dem der Dichter des leisen Tons, des lyrischen Essentialismus in den schwächeren Momenten seiner dritten Station angelangt ist.
Hiervon ein einziges Beispiel- das dichterisch bei weitem geglückteste -, in dem die verzehrende Gewalt der Tropenlandschaft in eine packende Antithetik zur grazilen Menschlichkeit des verstorbenen Knaben gebracht ist.
DU ZERBRACHST
I
Die vielen, grausigen, verstreuten, grauen Felsen
Bebend noch unter den geheimen Schleudern
Erstickter Urflammen
Oder unter den Schauern jungfräulicher Ströme
Dahinbrausend in unerbittlichen Liebkosungen −
Steil über dem Geflimmer des Sandes
In einem leeren Horizont, erinnerst du dich nicht?
Und der überhängenden Araucaria,
Aufgetan dem einzigen Schattenfleck im Tal,
Ins Riesenhafte gewachsen vor Sehnsucht
……………………
Erinnerst du dich nicht der stummen Fiebernden
Über drei Handbreit eines runden Kiesels
In vollkommener Schwebe
Magisch erscheinend?
Von Ast zu Ast, ein leichtes Vöglein,
Wundertrunken die gierigen Augen,
Erobertest du den zerrissenen Wipfel,
Verwegenes, musisches Kind,
Um auf dem klaren Grund
Eines tiefen und ruhigen Meeresschlundes
Märchenhafte Schildkröten
Unter den Algen erwachen zu sehn.
Der Natur äußerste Spannung
Und der Prunk der Meerestiefe −
Düstere Mahnungen.
2
Wie Flügel hobst du die Arme
Und gabst neue Geburt dem Wind
Dahinlaufend in der Schwere der reglosen Luft.
Niemand sah dich je
Zur Erde setzen
Den leichten Tänzerfuß.
3
Glückliche Anmut.
Du mußtest zerbrechen
In soviel harter Blindheit −
Du, bloßer Hauch und Kristall,
Allzu menschlicher Blitz für dieses
Ruchlose, waldene, erbitterte, summende
Gebrüll einer nackten Sonne.
Mit Recht hat die Ungaretti-Philologie auf eine sich schrittweise entwickelnde Leitmotivik und auf bestimmte Verzahnungen zwischen den verschiedenen Stufen des Werkes hingewiesen; im Verein mit den natürlichen Stationen dieses „Menschenlebens“ ergibt sich so im ganzen zwar keine strenge Architektonik, wie sie manche französischen und spanischen Symbolisten anstrebten, aber immerhin ein organischer Zusammenhang, der dazu beiträgt, Ungarettis Lebenswerk geistig zu legitimieren. Wir sahen bereits, wie sich in den letzten Gedichten der Heiterkeit das Gefühl der Zeit ankündigt und wie dessen Hymnen wiederum die Thematik des Schmerzes vorausnehmen. Der biographische Ansatz zum vierten „Akt“, dem Gelobten Land, liegt unverkennbar in den „Glückwünschen zum eigenen Geburtstag“ am Ende des Gefühls der Zeit:
Sanft neigt sich die Sonne.
Vom Tage trennt sich
Ein allzu heller Himmel.
Einsamkeit ergießt sich,
Wie aus großer Ferne
Bewegung von Stimmen.
Schmeichelnde Kränkung,
Seltsame Kunst dieser Stunde.
Ist’s nicht erstes Erscheinen
schon des freien Herbstes?
Mit unverschiedenem Geheimnis
Eilt in der Tat sich zu vergolden
Schöne Zeit, die fortnimmt
Das Geschenk der Narrheit.
Und doch und doch möchte’ ich schrein:
Rasche Jugend der Sinne
Die du mein Selbst mir verdunkelst
Und dem Ewigen Bilder verleihst:
Laß mich noch nicht, Leiden!
Den Übergang vom Sommer zum Herbst des Lebens hatte Ungaretti zunächst in wenigen „Quartine d’autunno“ (Herbstvierzeilern) poetisch zu gestalten versucht, aber die Zeit in Brasilien, das subjektive und objektive Leid hatten diese spärlichen Entwürfe zurückgedrängt und zur Entladung des Schmerzes geführt. Dann erst fand Ungaretti zur seelischen Disposition jener früheren Jahre zurück. Aber nun stellte sich wieder der für den Rhythmus seines Schaffens kennzeichnende Pendelausschlag ein: die allzu persönlichen, allzu mitteilsamen Ausbrüche des Schmerzes mußten Objektivierung und Verwandlung ins Mythische ablösen. Doch greift der Dichter diesmal nicht, wie im Gefühl der Zeit, zu Gestalten des klassischen Mythos, sondern zu solchen der klassischen Literatur: er nimmt Anleihen auf bei Vergil, dessen überraschende Neuentdeckung in der modernen italienischen Lyrik uns Herbert Frenzel in einem schönen Vortrag erkennen lehrte. Äneas, Dido und Palinurus sind die drei Masken, deren sich Ungaretti zur Transposition seiner Selbstaussage bedient. Äneas ist des Dichters sentimentalisches Idealbild: er ist Schönheit, Jugend, Naivität auf immerwährender Suche nach dem „gelobten Land“, in dessen – freilich vergänglicher – Schönheit er verzaubert die eigene wiederfindet und betrachtet. Dido hingegen ist Herbstgestalt, physische Erfahrung des unwiderruflichen Abschieds von den letzten Schauern der Jugend. In der Palinurus-Episode hat Ungaretti das geistige und seelische Problem des schaffenden Künstlers gestaltet, den Kampf zwischen der „Verführung des Schlafs“ und den „Impulsen zur Tat“, die Frage auch nach dem Sinn einer Arbeit, die unwiderruflich der Vergänglichkeit geweiht ist. Hervorzuheben ist wiederum, daß Ungaretti auch dieses Werk in ein geschichtliches Koordinatensystem gestellt wissen wollte (wobei nun allerdings die forcierte Esoterik ein Mißverhältnis zwischen Absicht und Verwirklichung argwöhnen läßt). Das Gelobte Land enthalte, so vermerkt er, viele Fakten seines eigenen Lebens „und des Lebens seiner Nation“. Und in den Klagen Didos spiegele sich nicht nur das Drama einer Person, sondern auch das einer Kultur, „denn auch die Kulturen entstehen, wachsen, neigen sich dem Untergang zu und vergehen“.
In der Form, wie es seit 1950 vorliegt, ist das Gelobte Land ein Torso: die geplanten Chöre des Äneas fehlen. Das einleitende Stück ist eine Canzone, deren Beginn sich an der Unterweltreise des Äneas inspiriert. Neunzehn „beschreibende Chöre“ sollen vom „Seelenzustand“ Didos künden. Das Palinurus-Gedicht endlich wird als „Rezitativ erzählenden Charakters“ vorgestellt. (Vier andere, kleinere und isolierte Stücke können hier übergangen werden.) Merkwürdig ist, daß die Titelbegriffe Strukturelementen der alten Oper entsprechen. Enthielt der unausgeführte Gesamtplan genauere Entsprechungen? Und wenn ja, in welchem Sinne ist dieser Parallelismus zu verstehen? Leider hat Ungaretti, soviel ich weiß, hierüber keinen Aufschluß gegeben, und auch keiner der zahlreichen Interpreten, die zu seinen Lebzeiten zu ihm gewallfahrtet sind, scheint diese naheliegende Frage an ihn gerichtet zu haben.
Während sich die Dido-Chöre in dem uns nun schon wohlvertrauten Bereich einer verschieden überhöhten Erlebnis- und Erscheinungspoesie halten, stellen die beiden großen Stücke, die „Canzone“ und das „Rezitativ des Palinurus“, den Gipfel der Esoterik bei Ungaretti dar. Die Canzone geht von einer auf die persönliche Problematik bezogenen Umdeutung der Unterweltsfahrt des Äneas aus, um Zug für Zug dem zuzustreben, was der Dichter selbst als „Realität zweiten Grades“ bezeichnet: der Verlagerung der Motive aus der Sphäre der Wirklichkeit der Sinne in die der intellektiven Wirklichkeit. Unnötig zu sagen, daß dieser zweite Realitätsgrad weder rational darzustellen noch rational zu erfassen ist. Die „Canzone“ ist tönende Suggestion, eine Aufeinanderfolge magischer Klangfiguren; und der Leser soll nun nicht mehr als ein Selbsttätiger in den dichterischen Prozeß einbezogen, sondern vielmehr in den Zustand einer unbestimmbaren poetischen Verzauberung versetzt werden, in dem sich die große Linie einer „Aussage“ soeben noch zweifelnd erahnen läßt.
Bemerkenswerterweise bezeichnen diese Höhepunkte der lyrischen Metaphysik bei Ungaretti zugleich auch die Momente der größten Formenstrenge in seinem Werk. Mit der „Canzone“ kehrt der Dichter zur klassischen Großform der italienischen Lyrik zurück; das „Rezitativ des Palinurus“ greift gar eine der schwierigsten aller lyrischen Formen wieder auf, die provenzalische Sextine: in sieben Strophen verweben sich in immer neuen Wandlungen die sechs gleichbleibenden Richt- und Reimwörter. Es ist nicht verwunderlich zu erfahren, daß Ungaretti dreizehn Jahre lang an diesen Gebilden geprobt und geformt hat. Sie zu übersetzen, ist ein verzweifeltes Beginnen – den Beweis liefert ein wohlgemeinter Versuch H. Frenzels. Doch hat Ungaretti sein unermüdliches Ringen um das poetische Bild – um Wirklichkeit und Schein und ihre dichterische Werthaftigkeit – bis zuletzt auch in die faßlichere Erlebnissphäre projiziert. Zwei seiner schönsten Gedichte sollen das belegen. Der neunte Dido-Chor objektiviert das Altersgefühl der wachsenden Distanz von der sinnlichen Wirklichkeit in einer Liebesklage der verlassenen Prinzessin:
Nicht ziehn mich mehr die Irrlandschaften
Des Meeres an, noch der Morgendämmerung
Zerreißende Fahlheit auf diesen oder jenen Blättern;
Nicht mehr kämpf’ ich auch mit dem Felsenblocke,
Uralte Nacht, die auf den Augen ich trage.
Die Bilder, wozu sie
Mir, der Vergessenen?
In einem Text des darauffolgenden Werkes (Notizbuch des Alten, 1960) hat sich die verhaltene Emphase dieses Rollengedichts zur Gelassenheit dessen abgeklärt, der sich selbst und die Rätsel dieser Welt schon mit jenseitigem Auge zu sehen beginnt; Vorgefühl der Erfüllung im Tod im Zeichen der Dialektik von Schein und Sein:
Jedes Jahr, wenn ich entdecke, wie Februar
Reizsam und, aus Scham, wirr und trübe ist,
Bricht, mit kleinen gelben Blüten,
Die Mimose herein. Sie fügt sich ins Fenster
Meiner Behausung von einst, der gleichen,
Wo ich nun die alten Jahre verbringe.
Während ich mich nahe dem großen Schweigen –
Soll sie ein Zeichen sein, daß nichts vergeht,
Wenn immerfort die Erscheinung zurückkehrt?
Oder werd’ ich endlich wissen, daß der Tod
Herrschaft nur hat über den Schein?
Das Notizbuch des Alten besteht in der Hauptsache aus 27 unzusammenhängenden lyrischen Meditationen, die der Verfasser überraschenderweise als „letzte Chöre des Gelobten Landes bezeichnet. Wohlgemerkt: es sind nicht die versprochenen Chöre des Äneas, und zur objektiven, mythischen Thematik des vorausgehenden Zyklus besteht kein erkennbarer Zusammenhang. Rechnet diese neue Folge als letzte Station des Menschenlebens? Ungaretti selbst erklärte damals in müder Bescheidenheit, für den Autor dürften die behandelten Motive eigentlich „gar nicht mehr als Bestandteile seines Werkes“ zählen.
Es sollten dennoch zwei weitere „Nachträge“ folgen. 1966 lernte der nunmehr Achtundsiebzigjährige Bruna Bianco, eine junge brasilianische Dichterin, kennen und tauschte mit ihr eine Folge von Liebesgedichten aus, die als Dialogo dem Gesamtwerk angeschlossen sind. (Eine limitierte Ausgabe war 1968 vorausgegangen, beide enthalten auch die – durchaus niveauvollen – Verse Brunas.) Und 1969 kam es noch zu einer Begegnung mit „Dunja“, einer jungen Kroatin („bebendes Langbein“), die den Dichter an die gleichnamige kroatische Kinderfrau („zärtlichste, vielerfahrene Fee“) erinnerte, der Ungarettis Mutter den kleinen Giuseppe in Alexandria hatte anvertrauen müssen. Dunja sind drei Texte gewidmet. Alle diese allerletzten Gedichte stehen unter dem ehrwürdigen Signum: Leidenschaft macht leiden. Brunda tritt zu Beginn in rotem Kleid auf, so wie Dante die kindliche Beatrice in der „Vita nova“ erschienen war. („Du erschienst im Tor / in einem roten Kleid, / mir zu sagen, daß du Feuer bist, das verzehrt und wieder entzündet…“) Noch einmal gelingt Ungaretti ein sehr impulsiver und quasi-jugendlicher Text, „Geschenk“:
Schlaf jetzt, unruhiges Herz,
schlaf jetzt, los, schlafe.
Schlafe, Winter ist bei dir
eingezogen, bedroht dich,
schreit: „Töten werde ich dich,
und keinen Schlaf wirst du mehr finden.“
Mein Mund, sagst du, schenkt
deinem Herzen Frieden,
los, schlaf, schlaf in Frieden,
hör, hör auf deine Liebste,
willst du den Tod besiegen, unruhiges Herz.
Am 2. Juni 1970 hat dieses unruhige Herz zu schlagen aufgehört.
Hans Hinterhäuser, aus Hans Hinterhäuser: Italienische Lyrik im 20. Jahrhundert, R. Piper Verlag, 1990.
Ungarettis Unermesslichkeit
– Überlegungen zu einem alten Übersetzungsproblem. –
Giuseppe Ungarettis Zweizeiler „Mattina“, vermutlich das kürzeste Gedicht der Weltliteratur, ist noch immer eine Herausforderung für den Übersetzer. Seine extreme Knappheit scheint eine nicht nur inhaltlich, sondern auch formal völlig stimmige Übertragung ins schwerfälligere Deutsch unmöglich zu machen. Exemplarisch werden hier Grundprobleme der Lyrikübersetzung sichtbar.
„M’illumino / D’immenso“ – karger geht es nicht. Zwei Wörter, zwei Partikel – welche Weiträumigkeit in nur sieben Silben! Ein erlebendes Ich, nur durch die Verbform angedeutet, und etwas unfaßbar Großes. Zwischen diesen beiden Polen geschieht etwas, ein Lichtereignis. Aber auch der Titel gehört dazu: mattina, Morgen. Es geht um das wiedererwachte Licht nach der nächtlichen Finsternis. Und im Hintergrund schwingt mit: Das Gedicht wurde 1917 geschrieben, mitten im Grauen des Ersten Weltkriegs. Das Wortverständnis bereitet keine größeren Schwierigkeiten. Aber damit ist der Sinn noch nicht erfaßt und auch nicht der Weg gefunden, die weitschwingende Schlichtheit des Gedichts und seine fluide Klanglichkeit nachzubilden. Erst die Vollkommenheit der Klanggestalt aber macht die „Aussage“ zum Gedicht.
„Immenso“ benennt das nicht Meßbare, alles Maß Übersteigende. Also das Unermeßliche. Man könnte auch an das Unendliche denken. Aber das wäre schon Interpretation und nicht mehr Übersetzung. Das Unermeßliche ist Erfahrung, das Unendliche bereits denkende Abstraktion. Woher wissen wir denn, daß das für uns Unermeßliche nicht doch irgendwo eine Begrenzung hat? „Illuminare“ meint beleuchten, im Licht erstrahlen lassen, mit Licht erfüllen. Da Licht in der Dichtung fast immer, und ganz gewiß bei Ungaretti, sowohl auf das physikalische Phänomen, als auch metaphorisch auf Geistiges verweist, böte sich „erleuchten“ an. Doch obwohl auch ein Palast erleuchtet sein kann, ist das Wort längst unauflöslich mit mystischer Erfahrung oder dem Satori des Zen-Meisters assoziiert, um in diesen schlichten Zweizeiler zu passen; es führt uns, ähnlich wie „unendlich“, vorschnell in spirituelle Dimensionen und überspringt die Unmittelbarkeit der sinnlichen Erfahrung. „Durchlichten“ dürfte angemessener sein.
Wie aber verbinden sich die Wörter miteinander und mit dem erlebenden Ich?
„Ich erleuchte mich / Durch Unermeßliches“, übersetzte Ingeborg Bachmann, und dem gleichen Grundmuster folgten alle seither vorgeschlagenen Varianten. Nicht nur der Länge wegen (es sind vier Silben mehr als im Italienischen) kann das nicht befriedigen. Meine Erfahrung als Lyrikübersetzer (Verlaine, Desbordes-Valmore, D’Annunzio) hat mich gelehrt, nicht an den Wörtern entlang zu übersetzen und nicht an den syntaktischen Fügungen zu haften, sondern in geduldigem Meditieren über Gedankensubstanz, Erlebnisfärbung und Klanglichkeit des Gedichts eine deutsche Entsprechung zu suchen, die dem Sinn wie der sinnlichen Erscheinungsform des Originalgedichts so nahe wie nur irgend möglich kommt; der Treue zur Poesie hat die philologische Treue sich dabei unterzuordnen. Da die grammatischen Strukturen der Sprachen differieren, muß mitunter auch ein anderes syntaktisches Mittel gewählt werden, um die Wirkung des Originals zu erzielen.
In Ungarettis Satz ist das Ich das Subjekt. Im Italienischen kann das Ich sich jedoch klein machen und fast verschwinden, indem es sich in die Konjugationsendung des Verbs zurückzieht. Das Deutsche muß das Personalpronomen setzen. Damit wird der Vers nicht nur umständlicher; das Ich erhält auch ein stärkeres Gewicht. Es wirkt pathetisch aufgeladen, geradezu egomanisch inflationiert.
Genau besehen ist das Ich in Ungarettis Gedicht aber nicht wirklich handelndes Subjekt. Seine gesamte Aktivität besteht darin, sich der Erfahrung des unermeßlichen Lichts auszusetzen. Jede Übersetzung, die mit dem Wort „ich“ beginnt, klingt dagegen ein wenig nach Größenwahn: als sei die Durchlichtung eine Leistung des Ichs aus eigener Kraft und Herrlichkeit und das Unermeßliche nur der Auslöser oder gar das Hilfsmittel; das Unermeßliche wäre damit degradiert.
Behandeln wir das Unermeßliche als das eigentliche Agens auch grammatikalisch als Subjekt, so kommt ein Vorzug des Deutschen gegenüber dem Italienischen ins Spiel: Es kennt „Unermeßliches“ ohne bestimmten oder unbestimmten Artikel. Im Italienischen müßte „ l’immenso“ gesagt werden. Der Artikel aber verdinglicht, macht das Unermeßliche zu einem Objekt neben anderen Objekten und nimmt ihm damit letztlich seine Unermeßlichkeit. Sehr darum konnte das Originalgedicht nie etwa lauten: „L’immenso / M’illumina“. Deutschen ist diese Umkehrung möglich. Oder vielmehr: Die Strukturgesetze des Italienischen haben eine Umkehrung des eigentlichen Aktivitätsmusters nötig gemacht.
Ich schlage darum die folgende Übersetzung vor:
MORGEN
Unermeßliches
Durchlichtet mich.
Sie kommt dem Original nicht nur in Kürze näher als die bekannten Übertragungen (immerhin zwei Silben weniger als der Bachmannsche Vorschlag, wenn auch immer noch zwei Silben mehr als im Italienischen), sondern durch ihre vielen Assonanzen auch in der Klanglichkeit. Und sie trifft den Sinn des Originals genauer: überwältigende Erfahrung einer lichterfüllten Unermeßlichkeit, von der das erlebende Ich sich gänzlich ergreifen läßt.
Hans Krieger, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 2015
Vom Image zum Psychogramm
– Ungarettis Weg als Dichter. –
Will man Wesen und Wandel der Lyrik Giuseppe Ungarettis formelhaft benennen, kann man sagen: Dieser 1888 in Alexandria geborene italienische Dichter war in seiner Frühphase extensiv, in seinem Spätwerk intensiv. Zwar gab es auch schon unter den frammenti Gedichte, die – wie etwa „Teppich“ –, gleichermassen metaphorisch leuchtend und in sich selber zurückgenommen waren:
Jede Farbe breitet sich aus und gibt sich auf
in den anderen Farben
Um einsamer zu sein wenn du hinsiehst
Im ganzen gesehen eignet den Poemen aus Der begrabene Hafen von 1916 (neu aufgelegt 1919 unter dem Titel Heiterkeit der Schiffbrüche) jedoch eine starke – und eigentlich keinesfalls die Bezeichnung Hermetismus rechtfertigende – Strahlungskraft, die das Resultat lebhafter Emotionalität ist. Die Kürze der Gebilde, ihre Luzidität stehen in einem kreativen Spannungsverhältnis zu den ihnen zugrunde liegenden positiven wie negativen Eindrücken. Ungaretti versuchte der Vergänglichkeit beizukommen, indem er einzelne Augenblicke durch sprachliche Präparation aus dem Geschichtszusammenhang befreite.
1933, in seinem zweiten Versband Gefühl der Zeit, gab Ungaretti dann viel von der Methode auf, das Phänomen der Zeit dadurch bewältigen zu wollen, das er – ähnlich wie Pound in Lustra – die affektbeladensten Momente in den transzendierenden Rang verbaler Schönheit erhob. Jetzt, da es sich darum handelte, im Gedicht die Zeit nicht länger als farbigen Punkt, sondern als dunkle Linie vom Einst ins Nie sichtbar zu machen, konnte auch der poetische Stil nicht länger von syntaktischer Einfachen und Direktheit sein. Ungaretti, um in den Besitz von Ausdrucksmitteln zu gelangen, die seinen seelischen Erfahrungen und seinen künstlerischen Intentionen adäquat waren, sah sich gezwungen, wieder an jene Tradition anzuknüpfen, die er mit seiner Image-Dichtung nur vorübergehend unterbrochen hatte, und zwar nicht, um Petrarca, Leopardi oder auch nur d’Annunzio, Carducci und Pascoli ins Unrecht zu setzen (dergleichen schwebte Marinetti und den Futuristen vor), sondern lediglich aus Gründen der Identität und der Präzision:
Was die Dichter und die Künstler von der Romantik bis in unsere Tage getan haben und auch weiterhin nicht ablassen zu tun, ist gewaltig: sie haben das Altern der Sprache, der sie angehören, empfunden, die Last von mehreren tausend Jahren…
So heisst es im selbstverfassten Vorwort zur französischen Ausgabe der Gedichte.
Ungaretti, der in Gefühl der Zeit die Möglichkeiten entdeckte, das Ich in den literar-historischen Rahmen zu stellen und das Subjektiv-Flüchtige vor dem Hintergrund von Mythen deutlicher zu machen, sah sich – nach einer Reihe von Uebersetzungs-Exerzitien und dem allzu rhetorischen Intermezzo Der Schmerz (1947) – mit Das verheissene Land (1950) und Das Merkbuch des Alten (1960) in der Lage, die Probleme seines Lebens und der menschlichen Existenz überhaupt auf eine Weise darzustellen, die seiner Reife entsprach. Da ist, in Das verheissene Land, die „Canzone“, ein Meisterwerk in traditioneller Manier, und da sind, wichtiger noch, die „19 Chöre, Didos Gemütszustände zu beschreiben“:
Im Sturm, da öffnet sich, im Finstern, ein Hafen,
der war, hiess es, sicher.
Ein Golf, ausgesternt,
und, so schient, unwandelbar sein Himmel.
Doch jetzt, wie anders!
Mit der Figur der von Aeneas erst leidenschaftlich geliebten und dann (wegen seines persönlichen Auftrags) verschmähten Karthago-Gründerin Dido hat Ungaretti eine schon, von Vergil – und übrigens auch von Ovid – verwendete Persona zu Verfügung, die ihm nicht nur Muster der vom Manne getauschten und enttäuschten Frau zu sein vermag, sondern zugleich auch Anima-Projektion im Sinne Jungscher Psychoanalyse, das will sagen: Versinnbildlichung derjenigen Eigenschaften und Anlagen im Manne, die feminin sind, die aber durch kulturellen Zwang umstrukturiert beziehungsweise unterdrückt werden. Bezeichnenderweise hat Ungaretti seinen ursprünglichen Plan, den Dido-Chören solche des Aeneas gegenüberzustellen, fallengelassen. Aeneas – das war jener Teil seines Wesens, der bereits früher (bei der poetischen Landnahme und Seegängerei der Heiterkeit-Gedichte) zur Geltung gekommen war. Nun interessierte den Lyriker, abgesehen von einer gewissen Sympathie für den ebenfalls dem römischen Epos entlehnten Palinurus, nur noch die schmerzgeprüfte Dido. Oder vielmehr: Ihn fesselte jene weibliche Seelenverfassung, die, mag sie auch durch Leiden verursacht sein, das Leiden keinesfalls flieht:
Eine Stumme, umdunkelt,
so schreitest du zu über saatloses Land:
dir zur Seite, stolz, erwartest du keinen.
Von diesem Geist, der im Unglück und im Erdulden den letzten – vom Manne kaum zu erreichenden – Sinn des Lebens sieht, wird auch Das Merkbuch des Alten beherrscht, besonders im Hauptteil, in der Folge „Ultimi cori per la terra promessa“. Das verheissene Land, jenes Gefilde, das Aeneas, der Erkunder geschichtlicher Möglichkeiten, ausserhalb seines Ursprungs und seines Selbsts suchen muss für Dido (und wohl auch für den alten Ungaretti) ist es die kaum weniger zugängliche Enklave des Erinnerns, in der sogar die Liebe bereits einen sich mythisch einfärbenden Charakter hat:
Nicht atembar der Abend, kein Lufthauch,
wenn ihr, meine Toten, und ihr, gezählte Lebende, die ich liebe,
mir nicht in den Sinn kommt,
glückbringend, während
ich begreife, aus Einsamkeit, abends.
Hans-Jürgen Heise, Die Tat, 22.3.1969
Zum 10. Todestag der Übersetzerin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Übersetzerin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Übersetzerin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Übersetzerin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Übersetzerin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Übersetzerin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Übersetzerin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Übersetzerin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Fakten und Vermutungen zur Übersetzerin + Instagram + Forum +
IMDb + ÖM + KLG + Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: Ungaretti: Die lichtvolle Hermetik
Die Tat, 10.2.1973
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLfG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachruf auf Giuseppe Ungaretti: Tat
Giuseppe Ungaretti liest Inno alla morte.


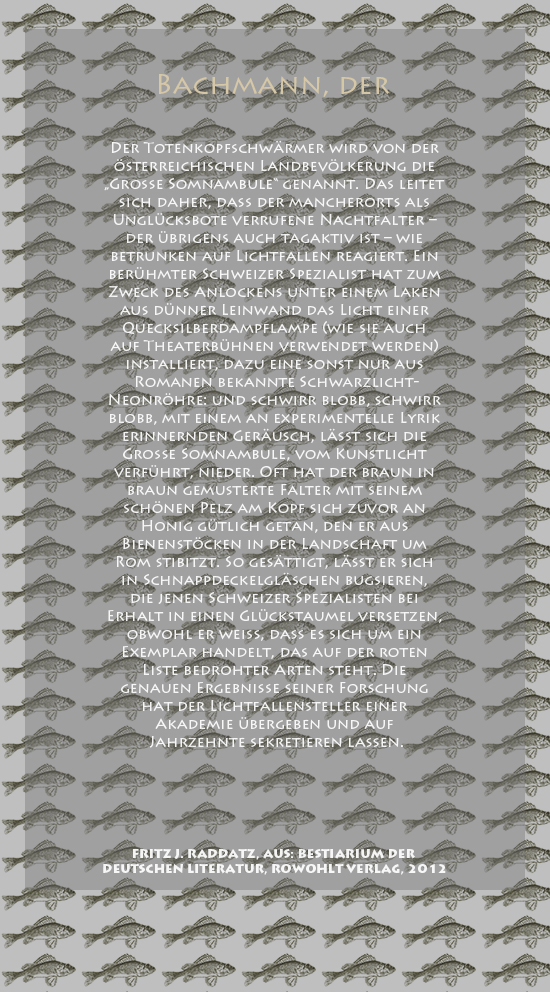












Mit dem wunderbaren Gedicht „M’illumino d’immenso“ wünsche ich innere Weihnachten.
https://rundbriefkasten.wordpress.com/2018/12/20/von-inneren-weihnachten/
Beste Grüße
Andreas
Lichtereignis ein wundererbares Wort.
DENKEN DANKEN
Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ein Dezember-Geschenk.
Wolfgang Püschel 2.12.2019