Marc-Oliver Schuster (Hrsg.): Aufbau wozu. Neues zu H.C. Artmann
„KEIN ZAUBER IST MIR FREMD GEBLIEBEN“:1H.C. ARTMANNS WORTGEBURTEN
I. Zaubereien
„Ich komm’ vom Zauberspruch her“, so erklärt Artmann in einem 1997 veröffentlichten Interview (1997). Auf die Frage seines Gesprächspartners Cornelius Hell, was ihn, der unter anderem gälische Verse verfaßt habe, eigentlich „zu den alten Texten hingeführt“ habe, betont Artmann seine bereits auf die Kinderzeit zurückdatierende Prägung durch Zaubersprüche, die er geerbt habe und selbst weitervererbe:
Ja, ich fang’ an, wo es beginnt – also im Deutschen bei den Zaubersprüchen. Ich komm’ vom Zauberspruch her. Ich komm’ aus dem Waldviertel, da gibt es die Zaubersprüche, ich kann alle Zaubersprüche meiner Großmutter, geb’ sie auch weiter an meine Tochter, die kennt sie auch schon alle. Das ist sehr wichtig […] (1997).
Der Zauberspruch stellt für ihn die Grundsubstanz und den Inbegriff lyrischer Rede dar, denn diese ist vor allem eines: evokativ.
Zaubersprüche muß man können, die ganze Lyrik geht darin auf. Gedankenlyrik gibt es nicht für mich. Es muß eine Lyrik sein, die etwas anderes ausdrückt, Stimmungen oder Beschwörungen. (1997)
Als gleichsam entmystifiziertes Pendant des Zauberspruchs erscheint Artmann das kalauernde Wortspiel, und auch dieses nennt er als wichtige Stimulation des eigenen Schaffens.2 Seine zahlreichen Texte über Zaubereien, Zauberkunststücke und entsprechende Requisiten bespiegeln – in der Regel auf phantastisch-surreale Weise – die dichterische Arbeit, werde der Dichter dabei nun als echter Magier oder als Variété-Trick-Artist modelliert.3
Artmann ist nicht der einzige Dichter des 20. Jahrhunderts, der anläßlich der Frage nach den Ursprüngen (und damit im ontogenetischen Sinn nach den Prinzipien) dichterischer Artikulation an sprachmagische Praktiken erinnert hat. Peter Rühmkorf widmet der Genese des dichterischen Wortes aus magischen Ideen und Praktiken weite Teile seiner Poetikvorlesungen von 1985. Für ihn ist „Literatur nicht bloß eine Formsache, sondern ein von magischen Vorstellungen noch und noch durchsetztes Zauberreich […], in dem gewunschen und Wunderwirkung erhofft wird wie ehedem, besonders nachdrücklich allerdings dort, wo man Irrationalismus und dunkles Geisterwesen endgültig vertrieben glaubt“ (1985a: 20). Sprachmuster wie Alliterationen und Reime besitzen, so Rühmkorfs Überzeugung, „eine Macht, die mit logischer Argumentation und dem ihr unterstellten Bedürfnis nach Wahrheit überhaupt nichts zu tun hat“ (23). Rühmkorf geht es nicht darum, die neuzeitliche und moderne Lyrik durch Vergleich mit magischen Ritualen zu auratisieren; eher ent-auratisiert er die magische Rede, indem er an ihr das Konstruktive sprachlicher Gestaltung hervorhebt. Auch der Effekt des Zauberspruchs beruhe auf der Herstellung von Verbindungen im Bereich des zunächst Unverbundenen:
Entwicklungsgeschichtlich betrachtet, ist der möglicherweise irritierende Widerspruch von numinoser Erleuchtung und praktischer Manipulation bereits in dem uralten Bindeprofessional veranlagt, der die fragmentarischen Götterwinke zu plausiblen Reimordnungen zu bringen vermochte. So zu verketten und zu ergänzen, möchte ich aber hinzufügen, daß auch das Selbstgemachte aussah, als wäre es geradenweges vom Himmel gefallen.
(1985a: 24)
Dichtung und Zauberspruch beruhen gestalterisch auf analogen Prinzipien, und ihre Form ist es, die aus Rühmkorfs Sicht für die Wirkung magisch-atavistischer wie spätzeitlich-lyrischer Rede entscheidend ist; die Macht poetischer Sprache verweise weit „zurück, in zaubrisch verhangene Zeiten, als das Losorakel und die Runenmagie in allen möglichen politischen oder familiären Entscheidungskonflikten zu Rat gerufen“ wurden“ (23). Als Urahn des modernen Dichters malt er sich einen Schamanen aus:
Der Priester oder Deuter wirft die mit Runenkritzungen versehenen Buchenstäbe auf ein weißes Tuch, greift […] einen Runenstab heraus, die sogenannte „Nota“, die den Ton angibt und den Vortrag regiert, dann erst beginnt seine eigentliche Arbeit: das Gefundene durch passende Erfindungen zu ergänzen: stabende Wörter, die den bruchstückhaften Götterbescheid in eine sinnvoll-ohrenfällige Ordnung überführen. Wir sehen mithin, wie sich am Anfang einer Kultur […] die Wahrsagekunst und das Dichterhandwerk in einer Person und ihrer Profession vereinigen und wie sich das Zufallsprodukt (das dem Menschen Zugefallene) mit dem poetischen Einfall zum bedeutungsvollen Amalgam verbindet. Wir sehen darüber hinaus, daß alle späteren Verbindungen von Inspirations- und Fabrikationstheorien nur immer wieder auf eine alte Doppelrolle zurückweisen, die in der Figur des Dichtermagiers noch ganz ungeteilt verkörpert war.
(1985a: 23)
Vor allem in ihrem angestrebten Effekt – dem der Evokation – konvergieren atavistische Sprachmagie und Dichtung:
Mit den Worten Wirkung tun, beziehungsweise mit der Sprache Welt heraufbeschwören, das ist es, was nun aber auch der Dichtkunst aller Richtungen und Zeiten als ein schönstes Traumziel vorgeschwebt hat: dem Realismus sowohl wie dem Soprarealismus und der Tendenzkunst […], jede auf ihre Art von einem Zauberglauben gelenkt, der mit Erfahrung zu tun hat, freilich infantiler.
(1985a: 62)
Auch Hermann Burger hat die Analogie zwischen Dichtung und Zauberkunst akzentuiert. Er erinnert in einem Aufsatz zum Thema „Zauberei und Sprache“ an den Germanisten Walter Muschg, der am Anfang seiner Tragischen Literaturgeschichte auf die Merseburger Zaubersprüche hingewiesen habe, diese „zufällig erhaltenen Zeugen einer untergegangenen Welt, einer grauen Vorzeit, in der Worte als Zauberzeichen galten“ (Burger 1983: 71). In den Spuren Muschgs unterstreicht auch Burger den evokativen Effekt von Zauberformeln als das, was sich auf die lyrische Rede späterer Zeiten übertragen habe.
„Wer die rechten Worte wußte und sie recht gebrauchte, besaß die Dinge und konnte nach Belieben über sie verfügen.“ [Muschg] Auf Wunsch des Zauberkundigen verwandelten sie sich augenblicklich, wie in der Phantasie des Kindes. (71)
In der Erzählung Diabelli (1989; zuerst 1979) läßt Burger einen Varieté-„Prestidigitateur“ von seinen Kunststücken erzählen, die allesamt gleichnishaft auf die Zauberkunst des Sprachartisten verweisen.
In Artmanns Œuvre bildet die Faszination durch das Zauberwesen eine Konstante, die sich inhaltlich wie formal geltend macht. Wiederholt stellen sich seine Texte explizit in die Nachfolge von Zauberformeln. So entsteht 1957 ein büchlein zaubersprüchlein, wo unter anderem eine Waldfrau und ein Teufel durch Verse angerufen werden, deren sprachliche Gestalt – „frau waldfrau waldfrau / tu mich nicht wecken“, „teufel teufel teufel / steig in dies öflein“ (1982: 293f) – volkstümlichen Formeln gleicht. Auch in den persischen quatrainen: ein kleiner divan wird der Teufel angerufen; das lyrische Ich will die Zauberei von ihm lernen:
ich ruf dich sommer heißer lucifer herbei
lehr mich mit schwarzen schmetterlingen zauberei
(Nr. xx; 1982: 312).
Ein anderes Gedicht aus dem büchlein zaubersprüchlein erinnert motivlich wie formal an die Merseburger Zaubersprüche:
an diesem fischbein
soll blut sein
an diesem blutstein
soll bein sein
fischbein und stein
blut und blein
sollen dir immerdar
zu handen sein
(1982: 299)
Sieht man genau hin, so hat sich über Zaubern das „bein“ in ein „blein“ verwandelt. Selbst wenn es sich um einen Schreib- oder Druckfehler handeln sollte – oder gerade dann? – wäre dies ein bemerkenswerter Vorgang. Der Dichter Artmann transponiert atavistische sprachliche Zauberpraktiken in die nur vermeintlich rationalisierte technisierte Alltagswelt; davon zeugt auch sein „zaubervers für wahlscheiben“:
zig zag portland
beádrer cólibri
porter in elf
[…]
(aus „iij. dritteil (wien)“; 1982: 101).
Entscheidend für Artmanns Faszination durch die Zauberformel ist deren performativer Grundzug: durch den Akt Anrufung wird Wirklichkeit verändert, im Extremfall sogar allererst geschaffen. Seine Vorliebe für performative Sprachhandlungen findet formal und inhaltlich in seinem Œuvre mannigfachen Niederschlag; neben „Zauberversen“ und ähnlichen Formeln enthält dieses „Anrufungen“,4 „Schlachtrufe“5 und „Befehle“, welche zunächst die Wörter und mittels dieser die Dinge in Bewegung setzen, etwa im Kaspar-Gedicht „anselm, antonia und der böse caspar oder ein kleines handbuch zum mißbrauch der lasterhaftigkeit“, in dem anselm ruft:
ich bin
der befehlshaber
zwischen nord
und süd,
meine worte springen
von einer harten,
strengen zunge
in dein zartes ohr!
(1982: 255)
Wer an die evokative Macht der Formeln glaubt, der tut gut daran, sich eine ansehnliche Formelsammlung zuzulegen. Zu diesem Zweck stattet der Sprachmagier Artmann unter anderem dem „Sprüchwörtterladen“ einen Besuch ab, um hier eine Szene spielen zu lassen, in der Redensarten und Sprichwörter als Handelsware kursieren und hinsichtlich ihres Wertes taxiert werden.
„Wann der ertzteuffel conterbaß spielet, müssent die engelein mit piccolo–
flöten fürlieb nehmen!“
„Das ist mir zu hypothetisch, mein guter!“
„Wann einer ein rohen kartoffel will schälen, wird er wol ein messer dar-
zue brauchen!“
„Versteht sich wie teutsch!“
„Und umb der armen leut recht ist es bestellet schlecht, es sei denn, sie
sitzent auff haus & hof, äcker & factoreien oder einer fümbfzackigten
kron!“
„Au wehe!“
„Wem aber ein erwachsener amandlenbaum ist, deme bedarfs langer bein,
will er sein bäumlein von obenherab begießen!“
„Soll das alles sein, ladenkramer?“
„O nein!
Der löwe ist der tiere könig, doch träume sonder träumer schäume!“
„Weiter, mann!“
„Ein florin in Holland gilt einen gulden zu Cöllen!“
„Nichts da, meister!“
„Wollan: Besitzest du kein baargeld nicht, so nütz dein ehrlich angesicht!“
„Dieses wär nicht übel“, sagt mein tapferer husar. „Es gefällt mir sogar
sonderlich. Also tut es mir in ein tütchen, und ihr mögt mein redlich ge-
sicht drum haben!“
Der husar überkommt seine waar in zeimngspapier gewickelt, sagt dem
winkelier adieu und tritt hinaus auf die helle, sonndurchflutete straße.
(1979, I: 207)
Mit seiner Behandlung sprachlicher Ausdrucksweisen als konkret verhandelbarer Objekte von spezifischem Tauschwert folgt Artmann unter anderem Anregungen Lewis Carrolls, der ja ohnehin zu seinen maßgeblichen Vor-Zauberern gehört;6 in Through the Looking-Glass läßt Carroll seine Figur des Humpty Dumpty als selbstbewußten „master“ der Wörter auftreten, der diese für sich arbeiten läßt und sie samstags ihrer jeweiligen Leistung gemäß entlohnt. 7
II. Wort-Wesen und ihre Umtriebe
Sprach-Magie bedeutet, daß durch sprachliche Akte Wirkliches strukturiert, verwandelt, ja kreiert wird. Wörter und Redensarten fungieren in Artmanns poetischem Kosmos als emsige Helfershelfer des Sprach-Zauberers bei der Generierung und Transformation von „Welt“; eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Namen. So lassen die Namen geographischer Räume ganze Welten erstehen – Welten der Imagination, deren Ähnlichkeit mit tatsächlichen Gegebenheiten allenfalls rein zufällig wäre und in denen sich die Jahrhunderte durchdringen:
Asien, ja, das ist ein wort! Die steppen, die tundren, die vereisten, ungeheuren ströme, das russische weltreich, die pyramiden und pagoden von Irkutsk, der große Mogul, der mikado von Samarkand! Das sagt mir eine menge, interessantes und romantisches..
Aber wie, wenn ich Afrika entdeckte? Schwarze neger und negressen, der tückische Zambesi mit seinen krokodilen, blaue gorillas, die zu schweren tropenhüte. […] /
Dann schon lieber nach Amerika mit seinen unbeschreiblichen möglichkeiten […]
(„Heiligentage“; 1979, III: 103)
Immer wieder wird sich der poetische Akt – mit einer Geste der Selbstvergewisserung – selbst zum Thema, so etwa in der „zueignung“ aus der Gedichtsammlung allerleirausch:
lerne was,
so hast du was.
kauf dir drum
ein tintenfaß,
füll die feder
dann darin,
nimm papier,
schärf deinen sinn.
schreibe nicht
ein licht gedicht,
weiß schreibt nur
der böse wicht.
krauchen solls
durch blut und bein
bis ins herzens
kämmerlein
(1982: 448).
Immer wieder entstehen Dinge aus Wörtern wie Kaninchen oder Tauben aus dem Zauberhut – vor den Augen des Lesers, der durch Selbstverweise des Textes auf die Beobachtungssituation als solche aufmerksam gemacht wird, etwa in der „Darstellung und Betrachtung eines imaginären Zustandes“ aus „Unter der Bedeckung eines Hutes“:
Eine nachricht gebiert die andere: so entstehen gerüchte über fremde länder und deren bewohner – lügen wie fasane ohne leber…
Zuerst waren die känguruhs da, ja, und dann die pferde, und später dann die zebras der weißen clowns
(1979, III: 158f).8
Eine oftmals implizit oder explizit bespiegelte Darstellungsstrategie des Sprachzauberers Artmann erinnert an magische oder pseudomagische Praktiken, bei denen der Zauberer sich zunächst sein eigenes Instrumentarium herbeizaubert, um dieses dann in den Dienst weiterer Kunststücke zu nehmen. Zunächst verwandelt der Dichter seine eigenen Ausdrucksmittel – die Wörter, Ausdrücke, Buchstaben und Zeichen – in lebendige Wesen, damit sie zu seinen Helfershelfern werden können. Und dann läßt er mit ihrer Hilfe neue Wesen erstehen: solche, die es darum gibt, weil sie plötzlich einen Namen haben, bei dem sie gerufen werden können – und die es dort „gibt“, wo sie gerufen werden: im Gedicht.
Die Transformation von Wörtern, Buchstaben und Zeichen in lebendige Wesen ist ein poetischer-„magischer“ Akt, den Sprache an sich selbst vollzieht: Indem Sprach-Elemente als „Dinge“ evoziert werden, erhalten sie Ding-Charakter und gegebenenfalls ein Eigen-Leben zugeschrieben. In Artmanns (in diesem Sinn performativen) Gedichten werden Worte vielfach zu konkreten, gegenständlichen Wesenheiten,9 aber auch Buchstaben;10 oft verschwimmt die Grenze zwischen Sprachlichem und natürlicher Welt,11 und wo durch Namen Dinge geschaffen werden, die ihren Einfluß in der Welt der Objekte zur Geltung bringen, dort kann solche Grenzüberschreitung zwischen Sprachlichem und Dinglichem auf die Sprache selbst zurückwirken.12
In einem Selbstkommentar für die Vortragsreihe (und für den späteren, von Walter Höllerer 1967 herausgegebenen Sammelband) Ein Gedicht und sein Autor hat Artmann seine eigene Einstellung zu Wörtern auf prägnante Weise charakterisiert. Suggestiv wird hier die Vorstellung vermittelt, daß Wörter eine Art Eigenleben führen, mit dem sie am Eigenleben der bezeichneten Dinge partizipieren. Darum können die bezeichneten Dinge in den Wörtern (wieder-)aufleben. Wer die Wörter zu einem Gedicht arrangiert, verbindet mit ihnen zwar private, eigene, subjektive Vorstellungen, aber über das hinaus, was er mit den Wörtern verbindet, haben diese ein eigenes und vom individuellen Benutzer relativ unabhängiges Bedeutungs- und Wirkungspotential:
ich rede nicht von meinen Gefühlen; ich setze vielmehr Worte in Szene und sie treiben ihre eigene Choreographie (1975: 376).
Artmann beschreibt sich als einen Spielleiter, der den Wörtern Gelegenheit gibt, das, was an Bedeutung (unter anderem an erinnerter Realität) in ihnen liegt, zum Ausdruck zu bringen. Und insofern mehrere Wörter durch ihre Zusammenfügung miteinander „reagieren“, ist er ihr Kuppler.
Was Sie von mir gehört haben und hören werden, ist u.a. getragen von dem Wortmaterial: Gewitter, Kuh, Schatten, Schäfer, Loden, Gewitter, Kuh, Messing, Leine, Hülse, Blitz, Messing, Jüngling.
Hinter diesen Worten stehen Vorstellungen, die „ich“ habe, die ich mehr oder weniger privat besitze, aber diese Vorstellungen geben kein Gedicht. Ich habe Vorstellungen und setze sie ein. Dieser Einsatz entfremdet mir in gewisser Weise meine privaten Vorstellungen: denn Worte haben eine bestimmte magnetische Masse, die gegenseitig nach Regeln anziehend wirkt; sie sind gleichsam „sexuell“, sie zeugen miteinander, sie treiben Unzucht miteinander, sie üben Magie, die über mich hinweggeht, sie besitzen Augen, Facettenaugen wie Käfer und schauen sich unaufhörlich und aus allen Winkeln an. Ich bin Kuppler und Zuhälter von Worten und biete das Bett […]
(1975: 375f)
Die Körperlichkeit von Sprachlichem, von Lettern wie auch von Zahlzeichen, wird zum rekurrenten poetischen Thema, z.B. im Gedicht „wenn man“:
wenn man
eine 8
umwirft
dann sieht
es so ∞
aus…
wie man
bemerkt
besteht
über die
feminine
qualität
der gefallenen
nach wie vor
kein zweifel –
die taille
bleibt
unverändert..!
schwieriger
allerdings
ist die mit
vollem recht
einzuwerfende
frage
ob sie nunmehr
am rücken läge
oder
am bauche..
(datiert „23. iv. 55“; 1982: 150).
Auch beschreibt Artmann Texte – Gedichte, aber auch naturkundliche Aufzeichnungen wie die Schriften Linnés – als Räume eines Geschehens, welches sich zwischen den Wörtern abspielt: Wörter eröffnen Räume und statten diese aus, etwa im Gedicht „das atelier“:
das atelier
der worte
steht offen..
wenn du
um das haus
herumgehst
kannst du
schon merken
wie tief wir
frühling haben..
die vögel
sperren
den mund auf
und holen
satz um satz..
schon duftet
nahend nah
der flieder
einer diktion..
schon ist herb
und frisch
schnittlauch
für punkte
und komma..
gegen abend
werfen dir
die worte
eine kaskade
ins herz..
dann
verschließen
wir das haus..
es hat
geradezu
fröhliche augen….
(datiert „21. 1. 55“; 1982: 198)
Und so erscheinen diese Wörter in Artmanns Welt als die eigentlichen Akteure; die schreibende Person des (nur sogenannten) Autors nimmt ihnen gegenüber die Rolle eines Mediums ein. Zwischen den Wörtern und dem, der sie schreibend benutzt, besteht insofern stets eine gewisse Fremdheit, die sich als (spielerischer) Machtkampf mit dem Eigensinn der Wörter, aber auch als genußvolle Hingabe an diese darstellen kann.
Neben Artmann haben auch verschiedene seiner dichtenden Zeitgenossen das Konzept der „lebendigen“ Wörter geschätzt, um den Effekt und das Selbstverständnis dichterischen Sprachgebrauchs zu umschreiben. So berichtet beispielsweise ein Gedicht von Konrad Bayer davon, wie die Protagonistenrolle an sprachliche Elemente übergeht:
verschiedene sätze treten auf.
verschiedene sätze treten nacheinander auf.
jeder satz betritt die situation, die alle vorhergehenden geschaffen haben.
diese neutralen sätze laden sich mit der situation auf.
diese sätze treten als trockene schwämme auf und saugen sich mit der situation voll
(zitiert in den Anmerkungen zu Artmann in Höllerer 1967: 345).
Und Ernst Jandl hat in einem Selbstkommentar zu seinem Poem „chanson“ vom Eigenleben der Wörter und ihrem Impuls zur Verletzung von Normen gesprochen; die verwendeten Wörter und ihre Silben, so charakterisiert er das sprachlich evozierte und zugleich vollzogene Geschehen, setzten sich hier „über Sprachgrenzen hinweg“ (1985: 18). Zu den entscheidenden Wegbereitern solcher Wortkunst, die aus Sprachlichem Lebendiges macht, das dann irritierenderweise seine eigenen Wege geht, gehört wiederum Lewis Carroll, der aus Redensarten die „Cheshire Cat“ und die „Mock Turtle“ kreiert, den „Mad Harter“, den „March Hare“ – und den „Nobody“.
Seine eigensinnigen, vitalen und umtriebigen Wörter helfen Artmann, wie gesagt, vor allem bei der Kreation neuer Wesen, die den Kosmos der poetischen Imagination bevölkern – und bei der Generierung entsprechender Räume. Die Gedichte mit dem Titel „landschaften“ sind „keine Landschaften im hergebrachten Sinne […], sondern innere Landschaften, imaginäre Paysagen, Landschaften, die die Worte sich selbst schaffen oder die durch Worte neu erstellt werden“ (1975: 376). Artmann liebt Wörter, Buchstaben13 und die mit ihrer Hilfe erzeugten Wort-Wesen;14 sein Œuvre bekundet eine unerschöpfliche Freude am Neologismus und eine ebenso unerschöpfliche Faszination durch imaginierte Wesen, die durch Neologismen oder substantivierte Ausdrücke in ein poetisches Leben gerufen werden. Explizit gesteht „Vater“ Artmann die Liebe zu seinen Wort-Kindern in Was ich gerne lese; seine Lieblingslektüre seien die eigenen Texte, und er wisse „nichts tröstlicheres, als in meinen selbstgeschriebenen büchern herumzuschmökern, ein liebenswerter vater also, der mit seinen prächtig geratenen kindern durch einen herbstlichen park lustwandelt und sie zufrieden mit den gelungensten skulpturen vergleicht, die da so zwischen schattichten hainen und verblühenden rondellen herumstehen“ (1979, III: 131).
Wollte man Artmanns Wort-Wesen panoramatisch zusammenstellen, so bedürfte es eines weitläufigen Zoos, der für Geschöpfe unterschiedlichster Provenienz Platz bieten müßte: für (um nur wenige Beispiele zu nennen) eine „liebe verehrte orchideengrüne primaballerina“, für einen „ultimobaldachin“, für „johann sebastian orth am örthersee“, für eine „elfenixbeinerne lokomotive“ (Gedicht von 1960; 1982: 376); für einen ,zwurg“, der dem Prinzip der Carrollschen Portmanteau-Wörter folgend aus Burg und Zwerg entstanden ist,15 vor allem für viele an die Grimmsche Märchenwelt erinnernde Wesen,16 für Sprachmonster aus den Welten der Kriminal-, SF- und Fantasy-Literatur, für Wesen, die wie die „würstin“ durch Analogiebildungen entstanden sind („die wurst weint / um die würstin“; 1982: 232), oder für Erscheinungen an der Grenze des soeben noch Vorstellbaren.17 Gern parodiert Artmann dort, wo er seine Wortgeschöpfe aufmarschieren läßt, wissenschaftliche Darstellungsverfahren; dazu gehört die lexikographische Form, die er wiederholt einsetzt. Ein Beispiel hierfür: Im Prosatext „Von dem Puma, welcher ein Freund des Grafen Osorio ist“ aus Von denen Husaren und anderen Seil-Tänzern (1979, I: 225ff) tritt nicht nur ein „puma“, ein „löwe“ und ein Zaubermeister namens „BlogBlog“ auf, sondern auch ein „salpetervogel“, der in einer eigens eingerichteten Fußnote Nr. 5 vorgestellt wird:
Der schröcklich Salpeopteryx, ein federmauß (von der bauart des archäopteryx, Anm. d. Verf.), so weiland in Affrica noch lebendt vorkame. Das gar selten männlein hätt 11 köpf &, mit verlaub, einen übelen gruch. Kamen in Europa nur auff denen ducaten Achatzji sen. vor und trugen die legenda „Hie non olent princ. elect. dixit“ (Thierkundt der ainen Hemisphär, tom. 9, cap. xvii, fol, 1042).
(1979, I: 226)
Ferner taucht ein „stilettfisch“ auf, zu dem angemerkt wird:
Amphiosus max., auch xiphias gladius min., einn sehr schnelle, außdaurender räuberhaubtmann unter denen fischen, & schröcken aller meerssäugethier. Ainzig species neben denen delphinidae, so tön herfürbringet. (Thierkundt der ainen Hemisphär, tom. 3, cap. v, fol. 834).
(1979, I: 226)
Manche der Artmannschen Wortgeburten erinnern an Morgenstern, der ja ebenfalls durch Modifikation vertrauter Ausdrücke neue Wesen kreiert und dabei eine Art phantastischer Zoologie betrieben hat; sein berühmter „Werwolf‘, entstanden durch das Wörtlichnehmen der Sprachpartikel „Wer“ und des grammatikalischen Terminus „Beugung“, findet ein Pendant im bösen „knochenfraß“:
der knochenfraß das ist ein tier
das hat keinen schönen pelz o nein
das hat keinen schönen pelz..
es kriecht auf seinen vieren lang
aus einer frühlingsnacht in dich o ja
es kriecht auf allen vieren..
so will ich zum herrn doktor gehen
der ist ein guter säger säger säger
der ist ein guter knochenfraßjäger
(1982: 218).
Wie dieser erscheinen manche der Artmannschen Wortwesen so erschreckend, daß dem Leser apotropäische Maßnahmen nahegelegt werden:
in iblis
ist ein ding
das lieber
dort bleiben
sollte
wo es
hingehört..
es kommt
manchmal
aus der erde
aus dem meer
aus der luft
aus dem berg
aus dem baum
aus dem mond
und manchmal
aus mir und
aus dir und
aus ihm und
aus ihr und
aus es..
wenn aber
ein iblis
nun irgendwo
herauskommt
geh gradeaus
und schau
nicht links
noch rechts
es ist
besser so..
(datiert „23. iv. 55“; 1982: 152).
III. Poesie der Listen
Artmanns Wort-Wesen treten besonders gern im Verbund und der Reihe nach auf. Solches geschieht etwa, wenn in „die hochzeit caspars mit gelsomina“ die schwarze Köchin des Menschenfressers als Nummerngirl in einer makabren Revue die Gerichte auf ihrer Speisekarte nebst Rezepten Revue passieren läßt; die „Verwurstung“ verschiedenster Dinge durch die kreative und einfallsreiche Köchin ist eines der vielen Artmannschen Gleichnisse für den poetischen Arbeitsprozeß:
unter anderen leckerbissen gibt es auch einen frischgefangenen installateur mit bratwurstfülle.. ein nicht zu fetter, mittelgroßer installateur wird ausgenommen, auf einer seite abgezogen und gespickt. […] ein ähnlich delikates, wenn auch nicht so leichtverdauliches gericht, ist ein gefüllter handelsvertreter auf fein bürgerliche art..
(1975: 116).
Die Listenform ist bei der Kreation von Artmanns poetischem Kosmos ein besonders wichtiges Gestaltungsprinzip.18 Kategorial Verschiedenstes läßt sich in Listen aufreihen und wird aufgereiht. Seine enthüllungen enthalten eine Liste mit kuriosen Episoden bzw. Lebensgeschichten; vorgestellt werden: ein „mumienpräparator“, der „exekutivbevollmächtigte eines suppenwürzekonzerns“, ein „pagatmännchen“, „der handleser Runtelzirg“, ein „hauptmann der legion“, ein „giftmischer“ (er gibt seinen Töchtern „eine vorstellung mit der laterna magica“), die bewohner eines „diskrete[n] tingeltangel[s]“ und der „große illusionist Noureddin Archenzohr“ (1975: 183ff); wiederum ergibt sich der autoreferentielle Charakter der Aufzählung aus der Analogie zwischen Dicht- und Zauber-Kunst.
Die Idee der Ausstattung einer „Welt“ durch Wesen, die gruppenweise sortiert und auf eine ihre Artenzugehörigkeit und Ordnung darstellende Weise ausgebreitet werden, kommt in dem Neologismus „Verbarium“ prägnant zum Ausdruck.19 Artmanns Zuneigung zu diesem Wort dürfte sowohl dadurch motiviert sein, daß es – über den Gleichklang mit „Herbarium“ – an den als Leitbild gewürdigten Linné erinnert, als auch deshalb, weil sich mit der Transformation von „Herbarien“ und „Verbarien“ eine modellhafte Verwandlung von „Natürlichem“ in Sprachliches vollzieht. Die „Verbarien“ sind als Wortlisten beschreibbar, für die die Durchmischung vertrauter und unvertrauter Ausdrücke, also gleichsam die Unterschiebung des Unvertrauten in der Verpackung des Vertrauten, charakteristisch ist. Das erste der „sieben lyrischen verbarien“ von 1954 zeigt dieses Prinzip deutlich:
ungummi
schneebitter
sanssouci
gekäfigte
note
abdusche
[…]
(1982: 85f)
Auch die übrigen „Verbarien“ wirken wie Reihungen aufgespießter und ausgestellter Einzelwörter; das fünfte enthält neben einheimischen auch exotische Exemplare:
watussi
flabello
watussi
flabro
watussi
flagello
watussi
flamma
besonderer
golf
gefaltetes
blondhaar
(1982: 89).
Der Übergang von Wort-Listen zu Ding-Listen gestaltet sich gezielt fließend; gern legt Artmann auch Wörtersequenzen an, die als Kataloge lesbar sind wie das Gedicht „fische. katwijk aan zee“ aus dem „i. dritteil (niederlande)“ der Sammlung erweiterte poesie von 1954:
skaglum
hackbraut
griffel
grootpot
potter
squint
kieloog
rjothe
lobb
burr
muuskarp
pillock
maugster
seekrey
benwahl
kilpo
duunkilp
rip
(1982: 95f).
Manche seiner Wortlisten erinnern an pflanzenkundliche oder pharmakologische Verzeichnisse, und auch sie bilden einen willkommenen Anlaß, das Imaginäre ins einigermaßen vertraut Anmutende einzuschmuggeln, so in der „mit conrad bayer“ zusammengestellten Liste namens bagh i bish qimat i zumûm:
digitalis purpurea (7, 8,)
atropa belladonna (6, 7, 8,)
cholchicum autumnale (in auctumne)
anemone pulsatilla (3,4,)
hyoscamus niger (6, 7, 8,)
datura stramonium (6, 7, 8, 9, 10,)
aconitum napellus (6, 7, 8,)
cicuta virosa (7, 8,)
ranunculus acer (5, 6, 7, 8, 9,)
daphne mezereum (2., 3, 4,)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(1957)
(1951) (1975: 35)
Im Gedicht „verbaristische szenen“ wird das Papier auf sinnfällige Weise zum Schau-Platz20 der in Reihenformation aufmarschierenden Wortgeburten:
tanaquil de lammerfors
nunckelprast paschah
der ernir wittelspliss
wenceslao weibelfrost
selim eichelsieb
almansur bubenzwirn
[…]
ursaw von glonnensaltz
candide le circenstruth
sfinks von argensteiss
bailltemourus ornaminct
lhodewyk ter tierenvind
malcon sungalc excelsior
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam u s i k :
(1986: 67f)
Im Selbstkommentar zu seinem Gedicht „landschaft 8“ hat Artmann nicht nur erläutert, was für ihn der Ausdruck „Landschaft“ bedeutet „und welchen Platz es im Haushalt meiner sinnlichen Erfahrungen einnimmt“ (1975: 373), sondern auch seine Faszination durch Listen kommentiert – unter Verweis auf Carl von Linné als auf einen inspirierenden Vorgänger. Dieser habe in seinem Reisetagebuch Iter Lapponicum gefundene Gegenstände zu Reihen gefügt, die auf Artmann wie Momentaufnahmen der registrierten Dinge selbst wirken und aus denen sie ihm entgegenleuchten.
Dieses Tagebuch ist fetzenhaft, bruchstückartig, unvollständig und unvollkommen. Aber als ich es las, war mir sofort klar, daß ich hier etwas für mich ungeheuer Wichtiges gefunden hatte. […] Was mich faszinierte, war nicht der behäbige und distanzierende Bericht eines Naturforschers, sondern es waren die strahlenden Momentaufnahmen winziger Dinge, seien sie organischer oder anorganischer, materieller oder sozialer Art: abgesprungene, isolierte Details und im Strahlenglanz ihrer leuchtenden Faktizität. Hier finden sich Minibeschreibungen von Pflanzen und gerade aufgebrochenen Blüten oder eines bestimmten Sonnenwinkels, in dem sie erglühen. Da gibt es Listen von Mineralien und Holzarten, von Kochrezepten und Interieurs von Rauchstuben, Badekammern und auch ungewollt „poetische Notizen“ über merkwürdige Augenkrankheiten oder, meinetwegen, Harnleiden, Vogelarten, Lurcharten, Mitternachtssonnenerscheinungen, und alles in der wertfreien Gleichzeitigkeit des Daseins.
(1975: 373)
Artmann zitiert Passagen aus Linnés Iter Lapponicum, die seine Faszination durch dieses Tagebuch erklären sollen; sie ähneln seinen eigenen Listen-Texten in ihrer Struktur wie in der Verwendung klangvoller Fremdwörter.
Die Lerche sang den ganzen Weg für uns, sie zitterte in der Luft
Ecce suum tirile, tirile, suum tirile tractat
Im Walde, an der jenseitigen Seite des Sumpfes, standen alle Arten
Lycopodia: sabinae, cupressi, abietis, bifurcati.
Nomina plantarum:
Botska. wird gegessen, alias Rasi. Engelwurz
Fatno. Angelica. Caulis. Engelwurz
(Stengel und Blätter)
Jerja. Sonchus purpur.
Gänsedistel
Jert. Ölsenich, wird als Ingwer gebraucht.
Hótme. Rausch- oder Trunkelbeere, Moorbeere
Cheruna. Schneehuhn, zart und klein
Lues. Großer Lachs
Stabben. Frauenfisch.
Ketke. Vielfraß
usw.
(1975: 373f)
Artmanns explizite Bemerkungen über Linnés Listen verdeutlichen, daß er hier ein Modell seines eigenen Umgangs mit Sprache und Welt gefunden hat. Über Linnés Notiz zu einem Sonnenaufgang schreibt er:
Es sind Beobachtungen, nicht feinsinnig, nicht ästhetisierend und exklusiv sondern handfest und sich berufend auf die groben Tatsachen, denen das Leben gerade in diesem Landstrich unterworfen ist. Linné hat sich Wortlisten zusammengestellt, behelfsmäßige Vokabelsammlungen und alles trägt in sich ein Moment des Surrealen und gleichzeitig eine augenblickshafte Erscheinung des Willens und der Selbstbehauptung, die das einzelne Bild und das isolierte Wort hineinstellt in eine umgreifende Erfahrung. Wir kennen den Begriff vom automatischen Schreiben. Er ist hier nicht anzuwenden. Aber das erzwungene Schreiben unter widerstrebenden Umständen, das rasche Festhalten von Eindrücken hat ein ähnliches Ergebnis. Es sind Vorfabrikate an Worten und Erscheinungsketten, Erfahrungsbrocken, abgegrenzt und in der Abgegrenztheit spontan und versehen mit dem Reiz des Spontanen, den das feinsinnige, langsame Beobachten und Aufschreiben kaum zu erreichen vermag.
(1975: 374)
Während der Arbeit an einer Übersetzung des Linnéschen Buchs habe er, so Artmann, mit der Abfassung eines imaginären Tagebuchs, Das Suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken, begonnen; nicht um die Darstellung der Tagesabläufe sei es dabei gegangen, sondern um eine Schärfung des Blicks „für die voluminösen Einzelheiten dieses täglichen Daseins“ (1975: 375).
In Das suchen nach dem gestrigen tag spielt die Listenform eine tragende Rolle; schon die Zueignung dieser „Eintragungen eines bizarren Liebhabers“ (1979, II: 7) ist listenförmig:
Ich widme dieses diarium höflichst
den schmetterlingen Saskatchewans,
den papageien der Tierra del fuego
und den colibris des Rauriser tals
(8).
Der Erzähler hat in die Auflistung der erlebten Tage Listen verschiedenster Art integriert; so gibt es etwa eine Liste von Fischen, eine Liste von Autoren, eine Liste sehr vergänglicher Dinge,21 eine Liste photographischer Motive,22 ein listenartiges Verzeichnis genealogischer Verhältnisse in einer phantastischen Zarendynastie (48f), eine Liste von „Sachen, an denen sich leute berauschen können“,23 oder eine Liste der faszinierenden Artikel aus „Buttericks Zauberladen“, mit der einmal mehr der Topos vom poetischen „Zauber“ variiert wird:
Ich wünschte, ich hätte Buttericks fundus und Bazon Brocks waffenhülfe: Der neuen kunst stünde nichts mehr im wege! (52).
26. oktober.
In Buttericks zauberladen gewesen, da ich eine falsche nase zur verklei-
dung brauche.
Hier gibt es wirklich magische dinge zu sehen. Schade, daß ich nicht so
viel geld habe, um das alles mitzunehmen […]
(1979, II: 51)
Die Aufzählung umfaßt einen „richtige[n] katzenschwanz mit ton“, eine „Knechtruprechtsmaske aus gummi“, eine „Zigarrenschachtel“ (aus der eine Spinne krabbelt), ein geräuscherzeugendes „Sitzkissen“, eine schwarzmachende „Teufelsseife“, eine Imitation von Erbrochenem („Erbsensuppe“), ein „W.C. als aschenbecher“, ein „W.C. buberl“ (Toilettenschild), einen „Schlangenhut“, eine Hundekotimitation, eine Ratte in einer Parfumschachtel und anderes; es gebe, so notiert Artmann, „hunderte“ von Artikeln: „Einer phantastischer als der andere“ (51f). Aufgelistet werden zudem diverse Namensvarianten mit der Komponente „Oscar“ (115) sowie „allerlei Herren“, z.B.: „Herr Hitler, herr Stalin, herr Himmler, herr Korbes, herr Cromwell, herr Buonaparte, herr Iskarioth“ (61); diese Reihung von Namen umfaßt eine halbe Druckseite, und der Erzähler betont: „Ich habe nichts hinzugefügt, bloß weggelassen“ (62). „Welt“ wird – einmal mehr – evoziert durch Aufzählung: „Jede große stadt ist eine tanzhand [vd. Paris, Berlin, Salzburg, Kiew, Washington, Antwerpen, Hamburg, Stockholm, Mexico City, Rom, Sidney, Nanking, Seattle, Glasgow und viele andre noch]“ (26).
Auch Textformen, die traditionellerweise nicht listenförmig aufgebaut sind, tendieren zur Listenform. Im Tagebuch aufgezeichnete Beobachtungen stimulieren den Erzähler wiederholt zu Reihungen imaginärer Objekte, die allein durch eine aus der Beobachtung abstrahierte Idee zusammengehalten und am Leitfaden dieser Idee der Reihe nach generiert werden. So wird am 13. November über ein feuchtes Zimmer notiert: „Streiften hier kätzchen an die wände, sie bekämen ein nasses Fell“, und dies löst eine Liste nasser Lebewesen aus:
Hunde im tau, rhinozerosse im tau besonnter wildbäche, tibetische yaks im sprühregen der feuchten aussprache eines komödianten, schimpansen in den körperlich fühlbaren morgennebeln Orplids, hirschhornkäfer in wolkenbrüchen […], und der böse wolf in der badewanne (1979, II: 73).
Schon die das Tagebuch einleitende Liste all der Personen, mit denen man sich auf der Grönegatan in Malmö treffen kann, verselbständigt sich und verwandelt sich vom Protokoll einer Szenerie zum Katalog märchenhafter Objekte:
Treffen: Man trifft sich mit freundinnen, kumpels, schuldnern, lehrpersonen, gegebenheiten, eigenartigen situationen [abenteuern], dem nachbarn von gegenüber, unleidlichen bekannten, verwelkten azaleen, lebensrettern, zirkussen, feldbetten, heimkehrenden arbeitern, soldaten, kleinen hündchen, kleinen geistern, besuchern, windsbräuten und hübschen aschenputteln
(1979, II: 11)
Aufgelistet werden Dinge, Ereignisse, Eigenschaften – natürlich auch Wörter und Redensarten:
Wie sagt man? Die welt ist klein, der herbst ist ein maler, jeder mensch, ganz gleich ob schwarz, braun, rot oder gelb, wird unter schmerzen geboren, jede schöne frau weiß, was sie will, nur einmal, freund, ist man wirklich verliebt, schönheit muß leiden, ein furz ist was menschliches, einmal könig sein, gold in der kehle haben, dann und wann nach einem guten buche greifen, nil humanum mihi &c. &c.
(1979, II: 18)
Im Angesicht der Listenform ist die Differenz zwischen Wortwelt und Dingwelt, zwischen „Verbarien“ und „Herbarien“, letztlich hinfällig. Artmanns Sammlung von Namen ist zugleich ein Herbarium:
Ich machte folgende aufstellung: Namen, die von blütenblättern an sich haben: anschovis, Agneta, Asimisma, Nina, Nagelfloxia, Lillian, Aino, Felipa, putzi, Linnea, sneewittib, […], Gunilla, tango […], und andre mehr (16).
Das Interesse an listenförrnigen Strukturen ist auch für die im Tagebuch verzeichneten Lektüren ausschlaggebend; so beschafft sich Artmann am 15. November aus der Stadtbibliothek den Experimentalroman Mobile von Michel Butor (1979, II: 74), oder er vertieft sich in Personenverzeichnisse der commedia dell’arte; zum „Progetto di una pantomima nel Prato dei Gesuiti a Vienna“ notiert er die „masken [in der folge ihrer auftritte]: / LISETTE, zofe / ARLECCHINO, bedienter des herrn Leander / LEANDER, ein reisender gentleman“ (79). Er liest Harsdörffer und legt prompt eine Personenliste an: „Wieder nach langem G.Ph. Harsdörffer gelesen. Personen: Lidias, ein edelmann, der Doctor Thesaurus […]“ – es folgen weitere Namen aus dem Personenverzeichnis, das, wie Artmann hinzufügt, noch viel länger ist (13). Schweden, sein Wohnsitz zur Zeit der Abfassung des poetischen Tagebuchs, bildet sich am „5. dezember“ (101)24 in einem gelisteten Aufmarsch phantastisch-anthropomorpher Tiere ab:
alles geht seinen gewohnten langweiligen gang, milchgefütterte wölfe und bären betrachten in hellen abortspiegeln den glanz ihrer künstlichen gebisse, lammfromme kirchenhirten verteilen desinfizierte psalmbücher an insulinbehandelte kraniche und eichhörnchen, luchse, dachse und adler verzehren im stehen ihre plastikverpackten lunchrationen, stiere und auerochsen stehen geduldvoll in selbstbedienungsspeisestellen schlange […].
(1979, II: 101)
Wie die magische Praxis, so ist auch die Anlage von Listen Sinnbild poetischer Darstellung: auch sie hat einen performativen Effekt – sie schafft Ordnung und damit „Welt“. Der strukturbildende Effekt parallelisierender Reihungen wird im poetischen Tagebuch Artmanns vor allem dort deutlich, wo Aufzählungen durch wiederholte Nennungen eines und desselben Objekts charakterisiert sind: an sich ein unsinniges Verfahren, denn was einmal auf einer Liste festgehalten ist, braucht ja nicht noch einmal genannt zu werden – es sei denn, die Liste fungiere als das, was sie bei Artmann primär ist: als Modell einer künstlichen Struktur, mittels derer Wörter und Dinge geordnet werden. In Eintrag zum 20. Dezember aus Das suchen nach dem gestrigen tag finden sich immer wieder „psalmbücher“ auf fast einer Druckseite:
Herr Landruquist ist stets bewaffnet mit psalmbüchern, kuchenstücken, füllfedern, hampelmännern, pelzfäustlingen, psalmbüchern, radiobestandteilen, rosenmessern, präservativgummis, eisschuhen, psalmbüchern, jägermützen, schlittenkufen, aspirintabletten, mähmaschinen, psalmbüchern, gartenscheren, polarsternen, spazierstöcken, falschen nasen à la de Gaulle, psalmbüchern, fleckigen hunden, levkojensamen, studentenpässen, fliegenpilzen, psalmbüchern […]
(1979, II: 114)
Der Ausdruck „Inventar“, der als Bezeichnung der angelegten Listen mehrfach auftaucht, ist bei Artmann mit der „Invention“ nicht nur durch die Klangähnlichkeit verbunden.
Ein weiterer wichtiger Grund für Artmanns Vorliebe für listenartige Reihungen dürfte darin liegen, daß gerade die Sprachspielform der Anrufung Affinitäten zur Liste hat. Litaneien stehen formal im Zeichen der variierenden Wiederholung – gelistet werden Eigenschaften und Taten der Angerufenen. Entweder werden Reihen von Heiligen um Schutz und Fürbitte angerufen, oder es werden von einer angerufenen Instanz verschiedene Leistungen erfleht. Gerade diese Spielform des rituellen Sprachgebrauchs verknüpft die Reihung und das Prinzip der Evokation also nachdrücklich. Eine damit strukturell verwandte Form ist die des Appells an aufgereihte Adressaten, z.B. im Kurzprosatext „Reformationstag“:
So freuet euch dann und frohlocket ihr Hund und Katzen, Mäus und Ratzen: freuet euch und frohlocket ihr Läus und Flöh […] (1979, II: 158; der Text umfaßt rund eine halbe Druckseite).
Artmanns „Greguerías“ am Beginn der Prosasammlung Das im Walde verlorene Totem enthalten litaneiartige Aufzählungen eigentümlicher Geschöpfe:
Die hungrige igelin um eure welke weihnacht
in hundert lohfeuer zu fachen
das verwunschene wiesel um in den bäumen zu lauern
wenn der trunkene weinmond zur erde stürzt
die törichte hindin um die abenteuer
eurer nachte eitel zu verprassen
das kleine unbeholfene haselhuhn um zu beten (1979, I: 11).25
Ein nach der volkstümlichen „Zauber“-Formel hokus pokus betiteltes Gedicht erinnert durch sein Prinzip der variierenden Wiederholung der Miserere-Formel an die Form der Litanei und unterstreicht damit implizit die Analogie zwischen magischem Ritual und christlichem Kult, wie sie sich im Gedicht „du übermeister necrophilus“ findet:
du übermeister necrophilus
du fleischfraß sarcophagus
du nimmersattes würmgehäus
aaaaao miserere nobis!
du kühler blasser matthäus
aaaaamiserere miserere..
[…]
du lorbeerblume bitterkeit
aaaaao miserere nobis!
du unerwartetes totenkleid
aaaaamiserere miserere..
du unbekannter numerus gar
in staub aus haut und haar
du sterbengel!
schwing die latern..
aaaaaet miserere nobis!
(datiert „juni mcmlv“; 1982: 212)
In dracula dracula gibt es eine „geheime litanei der bauern der umgegend von Mandrak“, in der Dracula in strikt parallel konstruierten Sätzen angerufen wird, die formal denen der Marienlitanei nachempfunden sind:
der du wie ein aas stinkest
aaaaaverschone uns
der du blut wie bier trinkest
aaaaaaverschone uns
(1979, II: 169; der Text umfaßt 18 Anrufungen)
Auf den evokativen Grundzug von Listen weist Artmann selbst explizit hin, indem er sie als Verzeichnisse erst noch zu realisierender Gegenstände deutet. Er betrachte, so hat er über eigene Texte gesagt, diese „als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten“, und als Verfasser solcher Verzeichnisse versuche er sich „in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft“ (1979, III: 139). Artmann setzt in diesem auf 1973 datierten Vorwort fort:
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird.
[…]
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
(1979, III: 139)
In manche der Artmannschen Listen des schwedischen Tagebuchs werden – durch Einklammerungen – weitere Listen eingefügt; so entstehen Listen-Listen, Meta-Listen. Am 8. Oktober notiert er – anschließend an das Eingeständnis, besitzlos zu sein und damit in aller Welt herumzuprahlen – folgende „Aufstellung allerlei besitztümer: Schlangenbesitz, tabaksortenbesitz, vollbesitz der geistigen kräfte, salzbesitz, besitze im salzburgischen, silberbesitz [messer, gabel, teelöffel, die aufgelassenen minen von Potosí, Peru], witzbesitz […], rosenbesitz, rassenbesitz [rassebeine, rassige wagen, der reiche (p)rasser], uhrenbesitz […]“ (1979, II: 25f). Aus dieser Besitz-Liste wird eine Ausdrucksweisen- und Redensarten-Liste entwickelt, die dann in ein poetisches Porträt übergeht:
Viel besitzen und wenig nützen, rittergutsbesitzer [traum], der einzige besitz, welcher in seinen zähnen besteht, samt einer guten witterung, seinen beirren, einem ausdauernden mut, seinem buschigen wolfsschweif, mit dem er die winde [nord, ost, süd, west) gerecht aufteilt, der allgemeine besitz der wilden katzen [plus falschheit und mädchenhaften augen], der besitz einer sonnenfinsternis [geschwärztes gesicht aus marienglas], alleinbesitz, vorbesitz, nachbesitz u.a.m.
(1979, II: 26)
Wie es scheint, ist die Listenform auch und gerade bei der Selbstbespiegelung des Dichters ein wichtiges Hilfsmittel.
IV. Poetisch-poetologische Selbstentwürfe aus Wörtern
Den Ausgangspunkt des Dichtens bildet bei Artmann wie bei anderen Dichtern des 20. Jahrhunderts auch das Bewußtsein von der Grund- und Bodenlosigkeit des eigenen Tuns. Gedichte sind nichts Notwendiges, Dichter sind nichts Notwendiges; niemand gibt ihnen einen Auftrag, kein vorgegebener Zweck rechtfertigt ihr Dasein – dies bedeutet zugleich Freiheit und Haltlosigkeit. Sinnbild solcher Bodenlosigkeit ist das Dasein des Akrobaten, des Artisten in der Manege, des Hochseilartisten vor allem, der sehr konkret im Bodenlosen agiert und seine Figuren produziert. In Artmanns Figurenarsenal begegnen dem Leser mancherlei Artisten, darunter auch Seiltänzer, die sinnbildlich auf die dichterische Sprachartistik als Hochseilakt ohne Bodenhaftung verweisen. In einem Gedicht aus der Sammlung hirschgehege & leuchtturm von 1962 heißt es: „jetzt kommt es darauf an ob ich auf meinem / seiltänzerseil den richtigen fußhalt finde“, und in eben diesem Text bezeichnet sich der Sprach-Artist auch als Sprach-Lehrer wie als Spezialist für exotische Fremdsprachen:
ich liebe mädchen ich lehre sie neue sprachen
ich bin ein sprachenlehrer für die mädchen
ich beherrsche das feine nahuatl das quiché
das aymarà das guarani das araucano o ja
ich bin ein spezialist für indianische idiome
ich gebe es zu es bedarf viel guter balance
mein seiltänzerseil trage ich in einer tasche
(1982: 404).
Man könnte metaphorisch die Listenform als das Seil charakterisieren, auf dem der ansonsten bodenlose Sprachartist Artmann herumturnt, um seine Sprachkunst-Figuren vorzuführen.
Im Bewußtsein der eigenen Grund- und Bodenlosigkeit muß der Dichter zunächst einmal Selbsterfinder sein. Insofern er mit Wörtern operiert, heißt dies, daß er sich selbst aus Wörtern zusammensetzen muß. Und auch dies geschieht, wie angedeutet, vorzugsweise in Form der Auflistung. Eine Liste von Namen aus Die Anfangsbuchstaben der Flagge beispielsweise repräsentiert die komplexe und facettenreiche poetische Identität des Erzählers Artmann: „H.C. Artmann, den man auch John Adderley Bancroft alias Lord Lister alias David Blennerhasset alias Mortimer Grizzleywold de Vere &c. &c. nennt“ (1979, II: 389); nicht abwegig erscheint die Idee, daß Artmann sich vor allem deshalb mehrere poetische Pseudonyme zulegt, um sie bei Gelegenheit als Liste rezitieren zu können. In einem Selbstporträt setzt er das eigene Bild aus disparaten Angaben zusammen, die in ihrer Inkompatibilität nur durch ihre äußere Form – die der parallelisierenden Aufzählung – zusammengehalten werden:
Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö, meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden, meine laune launisch, meine räusche richtig, […]“ (1975: 7).
Die fast anderthalb Druckseiten umfassende Sammlung von Angaben zur Dichterperson – wobei auch die restlichen Angaben im Zeichen von kategorialen Sprüngen stehen – listet nacheinander Fähigkeiten, soziale Relationen, Ortsbeziehungen, Erfahrungen, physische Merkmale und Taten, um schließlich in das abstrakte Modell eines Curriculum Vitae einzumünden:
a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden (8).
Im schwedischen Tagebuch inszeniert Artmann die Erfindung eines Dichters in Form einer Aufzählung; aus aneinander gereihten Angaben entsteht das Profil eines „märchenhaften“ Dichters, der in Einzelnem Artmanns eigene Züge trägt und auf die „Märchenhaftigkeit“ des Dichtertums verweist.26
Exposé eines märchenhaften mannes: Name: Wahrscheinlich M. Neuftêtes oder Herr Negenkopp. […] gesichtsfarbe blühend bis ledern, augen braun, grau oder blau; […] Haar, da neun köpfe, verschiedenfarbig, schamhaar einfärbig, keinesfalls rot, da nicht genug dämonisch, wohl vielleicht aber kupfern, da an geheime kessel und ungute brodeltöpfe erinnernd. Arme und beine normal, letztere nicht zu kurz, weil sonst weniger dämonisch. Aussprache deutlich, da zum verständnis der gesprochenen formeln wichtig. murmler berichten keine märchen. […] Glücksstern: der mond und die sonne, einer für die tage, einer für die nächte. Glücksstein: der diamant, da zum einschneiden von krawattenauslagen nützlich. Prädikat: teils Lord, teils Graf, teils Herr, teils Meister. Schmale, aber kräftige hände, sprachkenntnisse erlaubt, obligat jedoch die eigenschaft, kunstpfeifer zu sein. (1979, II: 24f)
Wiederum steht Artmann mit seiner Konstruktion einer Dichter-Figur aus Wörtern nicht allein. Hermann Burger hat einen „Mann aus Wörtern“ erfunden, der, wie es heißt, meist auftaucht, wenn der Schriftsteller in einem Wörterbuch liest: eine schwer beschreibbare Erscheinung, die aus unterschiedlichsten Wortarten zusammengesetzt ist, in deren Adern Tinte fließt und dessen Körperteile aus den Wörtern für diese Körperteile bestehen:
Der Mann, der nur aus Wörtern besteht, ist so schwer zu beschreiben wie Wörter, und alles, was schwer zu beschreiben ist, macht uns Angst. Wenn er lächelt, gleicht er mir, wenn er wütend ist ebenfalls, aber als Ganzes sieht er keinem menschlichen Wesen ähnlich, nicht einmal dem Wort Mensch, am ehesten dem Wort Wort. Sein Gewand ist zusammengeflickt aus Adjektiven, Substantiven und Verben. […] Seine Schritte tönen wie das Wort Schritt […]. Eigentlich eine Vogelscheuche. Das Wort Mann bildet das Gerüst, und daran hängen Tausende von kleinen Buchstabenflicken […]. Unter dem metallenen Oberkleid trägt er ein braunrot schimmerndes Unterkleid, das aus Wörtern wie Blut, Lunge, Niere, Herz und Leber gewoben ist, und unter dem Gefäde der Innereien ahne ich einen Brandfleck: das Wort Gewissen. Wenn man es verletzen könnte, müßte schwarze Tinte aus der Wunde rinnen.
(1983: 239f)
Ist der „Mann aus Wörtern“ bei Burger eher ein Schreckgespenst, eine abstoßende Vogelscheuche aus Wort- und Sprachfetzen, in der sich ein Autor bespiegelt, der sich vor der eigenen Abhängigkeit von den Wörtern eher fürchtet, so imaginiert Peter Rühmkorf in seinem Artisten-Gedicht „Hochseil“ ein „aus nichts als Worten“ bestehendes Wesen als künstlerisches Idealbild:
Wir turnen in höchsten Höhen herum,
selbstredend und selbstreimend,
von einem Individuum
aus nichts als Worten träumend
(1985b: 210).
V. Kaspereien
Vor dem Hintergrund der poetologisch-autoreflexiven Bedeutung von Artistenfiguren ist auch die Kasper-Figur bei Artmann zu sehen, in der sich die gleichnisträchtige Schausteller-Kunst, das Schaubudenmilieu und das Jahrmarktstreiben besonders oft und nachdrücklich verkörpert finden. Artmanns Kasper hat – wie sein Erfinder – verschiedene Gesichter. Er ist ein armer Kerl27 – und zugleich ein unbotmäßiger, ein frecher, ein „böser“ Kasper,28 widerspenstig wie ein Wortartist, der sich um konventionelle Maßstäbe der Moral und des guten Geschmacks nicht schert; er ist ein Abenteurer, ein Strolch, zugleich aber ein Sänger. Ihm zugeschrieben werden die ausnehmend schönen lieder des edlen caspar oder gemeinhin hans wurstel genannt (1982: 229–236).
Gerade in Wien hat die Gestalt des Kasper eine reiche Tradition; der Figurentypus leitet sich ab von der komischen Person des Wiener Volkstheaters und zählt zu seinen Ahnen den Hanswurst. Vorfahre des Artmannschen Kasper ist neben der Figur des Volks- und Puppentheaters vor allem der „kaspar“ Hans Arps, in dessen schillernder Gestalt zum einen Elemente des volkstümlichen Kasperle, zum anderen Motive aus der Geschichte des Findlings Kaspar Hauser miteinander verschmolzen sind.
weh unser guter kaspar ist tot wer trägt
nun die brennende fahne im zopf wer dreht
die kaffeemühle wer lockt das idyllische
reh auf dem meer verwirrte er die schiffe
mit dem wörtchen parapluie und die winde
nannte er bienenvater weh weh weh unser
guter kaspar ist tot heiliger bimbam kaspar
ist tot die heufische klappern in den
glocken wenn man seinen vornamen
ausspricht darum seufze ich weiter
kaspar kaspar kaspar
(Arp 1992: 170)
Wie Artmanns29 ist auch und gerade Arps Kaspar ein Zauberer, einer, der mit Worten den Gang der Dinge beeinflußt und in einer besonderen Beziehung zu Tieren und anderen außermenschlichen Geschöpfen steht. Sein Profil gewinnt der Arpsche Kaspar in einem Text, der durch seine vielfältigen Neologismen (in denen insbesondere die Grenze zwischen belebter und unbelebter Welt aufgehoben erscheint) charakterisiert ist. Arp nimmt in seinem Kaspar-Gedicht (das in verschiedenen Versionen vorliegt) Techniken vorweg, die bei Artmann wiederaufgegriffen und weiterentwickelt werden. Das erste Gedicht der ausnehmend schönen lieder des edlen caspar von Artmann bedient sich einer Wortverfremdungstechnik à la Arp:
sizilien
sizilien
im hinterhalt
blühn lilien
sie blühen auch
im vorbehalt
[…]
die zeit wird
immer später
sie spuckt und
spielt sie
juckt und wühlt
und schöpft die
strümpfchenmode
mit abc und cba..
wie wird doch da
die hode schwer
die linke und
die rechte
(1982: 231)
Neben der Produktion von Neologismen durch Analogiebildung ist die Listenform ein charakteristisches Merkmal der Artmannschen Caspar-Texte:
und sie trinken den guten cinzano
aus nagelneuen gläsern..
milch und
cinzano,
bosheit und
unschuld,
caspar und
maorifrau,
johann und
sebastian,
nixon und
kennedy,
moskau und
peking,
rolles und
roycelach..
(1982: 252).
Erich Fried (1992), Walter Höllerer (1961: 100ff) und Peter Härtling (1961: 164f) haben in Gedichten Kasper-Figuren erstehen lassen, die von Arps Kaspar ebenso abstammen wie der Kasper Artmanns. Was all diese Gedichte untereinander verbindet, ist die thematisch prägende Synthese zweier Leitideen: der Idee der Artistik und der des Animismus. Artmanns Kasper ist als Nachfolger des Arpschen also ein poetologisches Zitat, ein Hampelmann aus Wörtern – gleich jenen aus Wörtern montierten Hampelmännern, über die Artmann ein Manifest verfaßt haben will:
Ich habe heute ein manifest auf das machen von hampelmännern verfaßt
[…].
Das machen von hampelmännern ist eine sehr alte, sehr vergessene kunst.
[…]
Das verfertigen von wirklichen hampelmännern ist ein nur wenigen bekanntes geheimnis. Hampelmänner sind aus allem zu machen, kein material ist zu kostbar oder zu minderwertig, selbst aus nichts andrem als straußenfedern kann man einen bauen.
(Eintrag vom „18. dezember“; 1979, II: 112)
Monika Schmitz-Emans
Monika Schmitz-Emans: Literaturverzeichnis
Einleitung
I.
Der Titel dieser Sammlung, Aufbau wozu, ist ein Ausspruch Artmanns in einem Interview mit Kurt Hofmann (2001: 59; siehe Literaturverzeichnis weiter unten) und formuliert witzig-prägnant seine damalige Distanz zur Aufbau-Mentalität der Nachkriegszeit und, in Reaktion darauf, seine eigene kulturelle Aufbau-Alternative mittels Sprachkunst, Übersetzung, Wiederaufnahme und Weitervermittlung unterschiedlicher Kulturtraditionen. Dazu zählen auch seine Selbstdarstellungen als Poesie-in-Person, als „diese Art Poet“, so Wolfgang Bauer, „die man sich immer vorstellt und die es eigentlich gar nicht gibt – ausgenommen in seinem Fall. Ein ungeheuer tolles Klischee“ (zit. in Artmann 1996: 148). Außerdem steht der Titel im Zusammenhang mit dem auf der vorderen Umschlagseite verwendeten Film-Standbild, mit Artmanns Kriegserlebnis und vielleicht sogar mit dem legendären „St. Achatz am Walde, einem Waldgeviert im Waldviertel“ (Reichert 1975: 381), seiner fiktiven Geburtsstätte in Niederösterreich. Die Zusammenhänge sind grob umrissen wie folgt.
Das auf der Umschlagseite verwendete Standbild stammt aus dem Film Die Pfarrhauskomödie (BRD, 1972; Regie: Veit Relin), in dem Artmann in einem eineinhalbminütigen Kurzauftritt einen Mesner spielt. Den Priester, dem Artmann-als-Mesner beim Ankleiden zur Messe hilft, verkörpert der deutsche Schauspieler Herbert Stettner, den Artmann seit Ende des Zweiten Weltkriegs kannte. Nachdem Artmann im Mai 1945 im Raum Regensburg entwaffnet worden war, gelangte er kurzfristig in US-Kriegsgefangenschaft im Durchgangslager in Plattling bei Regensburg, wo er als Dolmetscher arbeitete und beim Ausfüllen eines Fragebogens als Beruf „Schriftsteller“ (writer) angegeben haben soll (Atze 2006: 125; Hofmann 2012: 59) Im Plattlinger Gefangenenlager lernte er den später als Schauspieler bekannt gewordenen Herbert Stettner kennen, dem er nach Ingolstadt folgte. Bei der Ankunft in Stettners Heimatstadt fanden sie dessen Vaterhaus durch einen US-Luftangriff zerstört; sein Vater, der gymnasiale Studienprofessor Ernst Stettner, war bei diesem Angriff ums Leben gekommen. Die Garage des Hauses war jedoch erhalten, und dort lagerte die Bibliothek von Ernst Stettner, der sich für moderne Literatur begeistert hatte. „Die Bücher waren alle in der Garage, da habe ich dann die ganze wunderbare Bibliothek zur Verfügung gehabt: expressionistische Lyrik. Das ist natürlich ganz wichtig, der Vater war Professor gewesen und hat auch Sachen gehabt, die verbrannt worden sind“ (zit. in Fialik 1998: 28). Marcel Atze zufolge kann man die Bedeutung von Ernst Stettners Bibliothek, „die von den Nationalsozialisten verfemte Texte bewahrte, für die Lesebiographie Artmanns und für den Verlauf seiner schriftstellerischen Entwicklung kaum überschätzen“ (2006: 126).
Artmann mietete sich ein Zimmer in Ingolstadt (er ist dort vom 12. Juni bis zum 1. Dezember 1945 gemeldet; Atze/Böhm 2006: 223) und fing an, „richtig zu schreiben. Gedichte, und Tag und Nacht gelesen. Vorexpressionisten, Expressionisten und Dadaisten. Gearbeitet hab’ ich nichts, Aufbau wozu. Gelebt hab’ ich nur durch Schwindel und Betrug“ (zit. in Hofmann 2001: 59). Nach der Abreise aus Ingolstadt im Dezember 1945 gelangte er über Bad Ischl zurück nach Wien. Ob er und Stettner danach einander trafen, ist mir derzeit ebenso wenig bekannt wie die Hintergründe seines Kurzauftrittes in Die Pfarrhauskomödie, der Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstücks von Heinrich Lautensack (1881–1919), wobei die betreffende Szene der literarischen Vorlage hinzugefügt wurde. Dieses „Carmen Sacerdotale“, so der Untertitel des Stückes, erregte im Wilhelminischen Deutschland nach seiner Drucklegung 1911 wegen des Angriffs auf den katholischen Zölibat bzw. wegen der verständnisvollen Bewertung der Priesterehe einiges Aufsehen und führte nach seiner Berliner Uraufführung 1920 zu einer Serie von erregten Premieren.30 Kurz zum Inhalt: ein niederbayrischer Dorfpfarrer steht zu seiner von ihm geschwängerten Haushälterin, während sein Hilfspfarrer ein Verhältnis mit der Aushilfsköchin (gespielt von Maria Schell) eingeht; die aufreizende Köchin wird auch noch schwanger, womöglich sogar vom Hauptpfarrer selbst nach einem kurzen Techtelmechtel.
Der für Artmanns St. Achatz relevante Aspekt liegt im Namen des Pfarrers: Achatius Achatz. Dieser ist als der weltlichen Liebe erlegener Hirte ein schwarzes Schaf der katholischen Kirche, erscheint aber, wie sein Stellvertreter, als allzumenschlicher und verantwortlicher Mann. Das Drama liefert mittels Figurencharakteristik und Handlungsverlauf eine deutliche, unpathetische Kirchen- und Milieukritik. Dahingestellt bleibt, ob sich dieses Werk in der übriggebliebenen, der zeitgenössischen progressiven Literatur aufgeschlossenen Bibliothek von Ernst Stettner in Ingolstadt befand, ob in diesem Fall Artmann dort auf dieses Stück gestoßen ist und, wenn ja, darin eine Quelle für seinen Achatz-Komplex gefunden hat. Die ergiebigen Beziehungen dieses Komplexes zum Katholizismus und zu Artmanns „schwarzen“ Figuren von Verführern, Unholden und anderen Monstern seien hier nur angedeutet.
II.
Im Jahr 1997 erhielt Hans Carl Artmann (1921–2000), etwas verspätet, den Georg Büchner Preis, weil er gemäß der Verleihungsurkunde „unbeirrbar die Menschenrechte der Poesie, ihre Würde und ihren Eigensinn, behauptet und gelebt hat“ (Jahrbuch 1998: 210). Trotz seiner Stellung als „wohletablierter Außenseiter der österreichischen Literatur der Gegenwart“ (Donnenberg 1981: 11) war noch 1992 der Ertrag der Artmann-Forschung „einigermaßen kümmerlich“ (Fuchs/Wischenbart 1992: 9), und dies trotz der vorhandenen Aufsätze, Rezensionen, Lexikoneinträge, Hommagen und Erinnerungsberichte. Zwei aus Dissertationen hervorgegangene Monographien31 und drei Aufsatzbände32 blieben neben Einzelarbeiten von Schriftstellerkollegen, Bekannten und Freunden wie Peter O. Chotjewitz, Jörg Drews und Klaus Reichert bis Anfang der 1990er die meistzitierten Kommentare.
Artmanns aufmerksam bedachter 75. Geburtstag, der Büchner Preis von 1997, sein Ableben drei Jahre später, und der Ankauf seiner Privatbibliothek durch die Stadt Wien 2004 erneuerten das Forschungs- und Öffentlichkeitsinteresse. Neben Neuausgaben (z.B. 2003), Übersetzungen (z.B. 2000) und einer Briefedition (Brandstetter 2005) erschienen mehrere Nachrufe und Interviewbände,33 Aufsätze34 und kleinere Aufsatzsammlungen,35 eine Monographie (Kaar 2004) sowie informative Aufarbeitungen der Kölner Artmann-Sammlung Knupfer (Kleinschmidt/Schmitz 2006) und von Artmanns Privatbibliothek (Atze/Böhm 2006). Dabei profitierte die Forschung von der anhaltenden Aktualität der Wiener Gruppe als Avantgarde-Phänomen,36 von Dokumentationen zur Kultur der Wiener Nachkriegszeit,37 und nicht zuletzt von der Anerkennung der langfristigen Einflüsse Artmanns und der Wiener Gruppe auf nachfolgende Schriftsteller. Dennoch fehlen weiterhin eine Biographie, Werkeinführung, Gesamtdarstellung oder eine zufriedenstellende Bibliographie der Sekundärliteratur (für eine Bibliographie der Schriften Artmanns, siehe Bauer 1997). Schon relativ früh wurde die akademische Beschäftigung mit Artmann international. Die erste Dissertation entstand im Ausland,38 und nur Wenigen dürfte bekannt sein, dass der kalifornisch-kanadische Germanist William Leckie Jr., Mediävist und Kenner phantastischer Literatur, schon seit Ende der 1980er bis Anfang der 1990er am Department of Germanic Languages and Literatures an der Universität von Toronto aufsehenerregende Seminare über „Artmann and Postmodernity“ abhielt. Wie viele vergleichbare Lehrveranstaltungen gab es bisher im deutschsprachigen Raum?
Neuere Studien folgen im Wesentlichen dem Hinweis Josef Donnenbergs, der 1981 die zukünftige Artmann-Forschung als besondere „Aufgabe für Komparatisten, Linguisten und Literatursoziologen“ erachtete (13), erweitern diese Aufgabenfelder aber methodisch und thematisch, etwa durch Semiotik (z.B. Backes 2001) oder Überlegungen zu Artmanns Postmoderne-Potential.39 Arbeitsfelder gibt es weiterhin genug, z.B.:
– die fortgesetzte Suche nach Quellen und Intertexten;
– die Analyse der Strategien in seinen Übersetzungen und deren Eingang ins Werk; fundierte Kontextanalysen des Zusammenhangs von Leben und Werk (z.B. Kriegserlebnis und -darstellung);
– die Verortung seiner Ästhetik und Sprachkunst innerhalb der künstlerischen Moderne inklusive philosophischer Richtungen (trotz seiner expliziten Absage an Philosophie, Theorie und Abstraktion); und nicht zuletzt
–psychologische und psychoanalytische Interpretationen (gerade wegen seiner expliziten Absage an biographische und psychologische Texterklärung).
Zwischen den Polen von autonomer Sprachartistik und historischer Kontextbezogenheit bleibt der Forschungshorizont breit genug für diverse Methoden, Positionen und Themen; letztere reichen von gesellschafts- und sprachkritischen Aspekten bis hin zu Rezeptionsspuren Artmanns im literarischen Werk anderer Schriftsteller, etwa in Peter O. Chotjewitz’ Romanstudien Tod durch Leere (1986: 80) oder in Michael Lentz’ Prosasammlung Oder (2003: 139).
III.
Die versammelten Beiträge decken einen Großteil der Bandbreite zwischen Sprachartistik und Kontextualität bei Artmann exemplarisch ab und bieten Neues in methodischer, textanalytischer, komparatistischer, biographischer und bibliographischer Hinsicht. Die Anordnung der Beiträge folgt der Tendenz von allgemeinen zu spezifischen Fragestellungen. Charakteristische Züge von Artmanns Poetik und Sprachkunst diskutieren Monika Schmitz-Emans, Peter Pabisch und Michael Backes, während John J. White die von Artmann und anderen Mitgliedern der Wiener Gruppe geteilte Begeisterung für die Barockliteratur untersucht. Dem Bereich der Dramatik widmen sich Elisabeth Parth, Alexandra Millner und Sonja Kaar. Jacques Lajarrige und Marc-Oliver Schuster decken zwei zeitlich benachbarte Prosawerke ab (Das suchen nach dem gestrigen tag und Frankenstein in Sussex). Alois Brandstetter wendet sich einem lyrischen Text zu und leitet zugleich zur wissenschaftlichen Artmann-Rezeption über, deren aktuelle Forschungslage und Nachlassbearbeitung Heide Kunzelmann und Martin A. Hainz erörtern.
In ihrem Beitrag „,kein zauber ist mir fremd geblieben‘: H.C. Artmanns Wortgeburten“ beginnt Monika Schmitz-Emans mit Artmanns Vorliebe für den Zauberspruch und andere formelhafte Literaturgattungen, deren magisch-wirklichkeitsverändernden Charakter er in seiner Vorstellung von lyrisch-literarischer Rede geltend macht. Sprach-Magie prägt Artmanns „Wort-Wesen“, wobei Namen bis hin zu Buchstaben gleichsam als eigenständige (Lese)Wesen generiert werden; dieses Konzept der „lebendigen“ Wörter betont die Körperlichkeit bzw. Materialität von Sprachlichem, besonders in Listen, Aufzählungen, Inventare und Verbarien. Strukturbildend im Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag vereinen solche Listen die performativ-evokativen Aspekte seiner individuellen Wortkunst mit denen volkstümlicher Literaturformen. Dem poetisch-poetologischen Selbstentwurf aus Wörtern wird im Zusammenhang mit der „Bodenlosigkeit“ moderner lyrisch-literarischer Rede in der Figur des Seiltänzers nachgegangen, mit der Artmann, wie auch in seinen Kasper-Versionen, die Idee poetischer (Selbst)Erfindung veranschaulicht.
Artmanns Sprachkunst ist auch das Thema des Beitrages von Peter Pabisch, „Die vielfältigen Sprachmasken und eigenwilligen Textsorten bei H.C. Artmann“, der einige der repräsentativen Masken von „Ich“-Figuren und von Artmann selbst zusammen mit seiner modernen Umgestaltung literarischer Traditionen behandelt. Hinter der augenscheinlichen Bezugslosigkeit seines Werkes zu Welt und Geschichte, so wird argumentiert, steht dennoch erkennbar dessen individuelle Lebensgeschichte, deren einschneidende Erfahrung des Zweiten Weltkriegs sein Sprach- und Literaturverständnis ebenso wie das von gleichgesinnten Dichterkollegen prägte. Pabisch sieht im Hintergrund von Artmanns Werk das Weltbild des Existenzialismus (mit dem Thema des Todes) und den Versuch, eine vom Alltag unabhängige Literatur- und Kultursphäre gelten zu lassen. Kommentare zu Artmanns Dialektdichtung und Barocklyrik verbindet der Beitrag mit Erklärungen zur abwechslungsreichen Entwicklung der Werkrezeption Artmanns, dessen relativer Popularitätsverlust ab Anfang der 1980er mit dem Aufkommen einer neuen Schriftstellergeneration zusammenfällt.
Michael Backes argumentiert in „H.C. Artmanns Darstellung der Dichterexistenz und die Wiener Gruppe“, Artmanns Darstellung der Dichterexistenz sei kein rein literarisches Projekt, sondern „poesie als weltanschauung“ (Konrad Bayer). Inspiriert vom Surrealismus bezieht diese Poesie real-imaginäre Erfahrungsdetails enigmatisch auf eine umgreifende Erfahrung und lässt sie in Gestalt einer „leuchtenden Faktizität“ in ihrer Eigenheit bestehen. Ihre augenblickshaften, hochreflexiven Fiktionalisierungen von Wirklichkeit bilden eine wichtige Voraussetzung für die experimentelle Semiotik der Wiener Gruppe, bleiben aber doch in Spannung zu ihr, wo Theoriebildungen die Augenblickshaftigkeit einengen und Radikalisierungen darauf abzielen, in der Zerstörung symbolischer Ordnungen „,wirklichkeit‘ auszustellen, und damit in konsequenz, abzustellen“ (Oswald Wiener). Auf eine gemeinsame Haltung jenseits unterschiedlicher Verfahren weist hingegen das Lob der „edlen oberflächlichkeit“ (Oswald Wiener) hin.
Die von Artmann mit anderen Mitgliedern der Wiener Gruppe geteilte Begeisterung für die Barockliteratur verfolgt John J. White in seinem Artikel über „Hans Carl Artmann und die europäische Literatur des 17. Jahrhunderts“, indem er sich auf vier Pastiche-Werke konzentriert: die Prosasammlung Von den Husaren, deren kontrapunktisch angehängten Epigramm-Zyklus „vergänglichkeit & aufferstehung der schäffery“, die poetologischen „epigrammata auff die dichter ihrer und unserer zeit“ („neun epigrammata in teutschen alexandrinern“) sowie den in mehreren Varianten vorliegenden Prosaband Der aeronautische Sindtbart. Diese „barockisierenden“ Werke erreichen ihren Effekt oft mit wenig Aufwand, übernehmen eine Reihe von barocken Motiven und stilistischen Merkmalen und erhöhen ihre intertextuelle Dichte noch durch die gelegentliche Einbeziehung der spanischen Tradition des pikaresken Romans. Ein durchgängiger Versuch einer rein imitatorischen Reproduktion des Barock als eines Epochenstils findet jedoch nicht statt, und so sind Artmanns Barock-Pastiches weniger als literarische Mimikry zu werten denn als Experimente eines kreativen Eklektizismus.
Elisabeth Parth untersucht in „H.C. Artmann – Dichter und Übersetzer: König Ubu, die Wiener Fassung des Ubu Roi von Alfred Jarry“ die Übersetzung dieses in Paris 1896 tumultuös uraufgeführten Stückes. Nach einem Blick auf die Rezeption Jarrys im deutschen Sprachraum und auf dessen Konzept von Pataphysik erfolgt im Zuge der methodischen Orientierung an Manfred Pfisters Konzept der Polyfunktionalität dramatischer Sprache die Anwendung von Roman Jakobsons Modell verbaler Kommunikation. Die Anwendung dieses mit sechs Faktoren und Funktionen arbeitenden Modells (expressiv, poetisch, appellativ, referentiell, metasprachlich, phatisch) ermöglicht Detailvergleiche der dramatischen Sprachfunktionen in Jarrys Original und Artmanns Übersetzung. Einige signifikante Unterschiede führen zu soziokulturellen, literatur- und theaterhistorischen Kontexten, welche einerseits die Besonderheiten des Originals und seines Schöpfers charakterisieren, andererseits bei Artmann die enge Beziehung von eigener Produktion und Übersetzung aufzeigen. Zuletzt werden im Anhang übersichtlich Artmanns Übersetzungen und Werkbearbeitungen von 1951 bis 2000 aufgelistet.
Alexandra Millner verfolgt in ihrem Beitrag „Kasperl als Dichter: Über die Lustige Figur in H.C. Artmanns Stücken“ Artmanns Bezug zur Tradition der Lustigen Figur sowie ihre Behandlung bei anderen Mitgliedern der Wiener Gruppe. In Stücken von Rühm und Bayer erscheint Kasperl als facettenreiche Repertoirefigur in unterschiedlichen Rollen und Kostümen, und dementsprechend umfasst die Komik der Kasperlfigur vielfältige Spielarten von Sprach-, Situations- und Bewegungskomik. Artmanns Versionen der Figur von Kasperl als Dichter zeichnen sich dadurch aus, dass Kasperl unter permanenter Not leidet und böse ist, womit er sich von der Tradition der Lustigen Figur absetzt. Artmanns Kasperlstücke sind symptomatisch für sein Werk, besonders für das lustvolle Spiel mit Versatzstücken aus Alltagsmythen, literarischen Figuren und tradierten Stoffen. Wichtiger als die schlüssige Abwicklung eines Handlungsbogens wird dabei die neue Sprachgebung zur Freisetzung von Poesie.
Sonja Kaar wendet sich in „H.C. Artmann, how lovecraft saved the world: Modell einer Analyse“ einem Dramolett zu, das sich schon vom Titel her auf den US-amerikanischen Schriftsteller Howard Phillips Lovecraft (1890–1937), einem Klassiker der phantastischen Literatur, bezieht. Dabei untersucht sie, wie dessen 1926 entstandenen Erzählungen „Pickman’s Model und Cthulhus Ruf“ von Artmann, der selbst sechs Geistergeschichten von Lovecraft übersetzte, verarbeitet werden. Einerseits steigert Artmanns „melodram“, so der Untertitel dieses schwer auf der Bühne realisierbaren Stückes, das von Lovecraft evozierte Grauen, andererseits durchbricht es den reinen Schrecken und das Wiedererkennen typischer Motive Lovecrafts durch Irritationen wie das Personenverzeichnis oder das Spiel im Spiel, das die Zuschauer am Ende zum Teil des Spiels werden lässt. Damit wird die Theater-Realität bewusst gemacht, aber nicht in Form eines Brechtschen Verfremdungseffekts oder eines sonstigen Mittels der Distanzierung, sondern als ironisch wirkende Überraschung und Selbst-Parodie.
Jacques Lajarrige analysiert in „Hans Carl Artmann als Diarist: Das schwedische Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag dieses 1964 unter dem Eindruck der Lektüre von Linnés Reisebericht Iter Lapponicum entstandene Werk. Es ist gekennzeichnet durch die Heterogenität der literaturgeschichtlichen Referenzen und Intertexte, die in Artmanns damalige Lektüren Einblick geben und zugleich durchdachte Gestaltungsprinzipien erkennen lassen. Wichtiger als die Bedeutung Linnés, auf den Artmann eigenwillig Bezug nimmt, ist jedoch die immanente Poetik seines Tagebuchs. Über die hergestellten Wahlverwandtschaften hinaus (etwa zur Barockdichtung, Detektiv- und Comicliteratur) wird eine Realitätswahrnehmung deutlich, die mit dem Surrealismus zahlreiche geistige Ähnlichkeiten aufweist. Gezeigt wird u.a., wie in der Nachkommenschaft von Bretons Manifeste du Surréalisme Artmanns schwedisches Tagbuch bevorzugt Koinzidenzen und Zufälligkeiten hervorhebt und dem Diktat der trockenen Vernunft eine andere Form von Logik entgegensetzt, die das Wunderbare einlädt und dem Leser nahelegt, dass Wirklichkeit nur als poetische Totalität erfassbar ist.
Marc-Oliver Schuster betrachtet in seinem Beitrag „,bei allem, was weiß ist‘: Intertextuelle Komplexität und implizite Ästhetik in H.C. Artmanns Frankenstein in Sussex“ zunächst die Figurenkonstellation zusammen mit den Änderungen, die Artmann an den Originalfiguren von Mary Wollstonecraft Shelley (Frankenstein-Monster) und Lewis Carroll (Alice) vornimmt. Die Perfektionierung von Alice und die Vermenschlichung des Monsters führen zu einer Lektüre, derzufolge es sich bei der Monster-Jagd auf Alice nicht um ein moralisches sondern ästhetisches Problem von Unrecht handelt, das auf eine werkkonstante Opposition von Figurentypen (MONSTER, ENGEL) hinweist. Neben Bezügen auf andere Werke Artmanns erhöhen zahlreiche intertextuelle Verweise den Grad an Komplexität und die Bedeutung des Kunst-Themas in diesem Prosatext, der zum einen moralisierendes und realistisches Erzählen parodiert, zum anderen angesichts von Artmann Erfahrungen im politisierten Berlin der späten 1960er als Verteidigung seiner damals suspekten „liberalen“ Autonomie-Ästhetik erscheint.
Einem lyrischen Text Artmanns gewidmet ist der Beitrag von Alois Brandstetter, „Konkrete Bildlichkeit: Zu einem Gedicht H.C. Artmanns“. Dabei handelt es sich in dessen Hauptteil um den (geringfügig veränderten und im Schlussteil leicht gekürzten) Wiederabdruck eines 1970 in der Berliner Zeitschrift Replik („Interdisziplinäre Hefte für Kritik und Kunst“) erschienenen Artikels. Darin untersuchte Brandstetter in seiner Interpretation des Gedichtes „landschaft 5“, inwieweit die Verschränkung der gleichwertigen Bedeutungsfelder „Krieg“ und „Kochen“ tatsächlich die moderne Richtung autonomer oder surrealer Bildlichkeit einschlägt, oder ob nicht vielmehr deren konkrete Bildlichkeit auf dem Hintergrund von Artmanns auktorialen Gesten von ironischer Distanz und stilistischer Zitierung zu lesen sind. Für die damals aufgeworfene Frage, ob das Gedicht eher von einer Köchin oder von Napoleon handle, erhielt Brandstetter nach der Artikel-Veröffentlichung die eigene Antwort Artmanns, die sich einer implizit dichtungstheoretischen Aussage annähert und in Brandstetters nachträglichem Vorwort zum Wiederabdruck vorgestellt wird, was zudem die Frage nach der Rolle wissenschaftlicher Interpretation angesichts späterer Zusatzinformation aufwirft.
Heide Kunzelmann zeigt in ihrem Artikel „Die ,Bibliothek H.C. Artmann‘ als posthumer Epitext“, wie man diesen Nachlass (er befindet sich seit 2004 in der Wienbibliothek im Wiener Rathaus) mitsamt seinen darin vorhandenen Arbeitsspuren für die Forschung nutzen kann. Die „Bibliothek H.C. Artmann“ ist sowohl als normale Quellensammlung (im Hinblick auf die Appropriation als Artmanns zentrales poetisches Verfahren) als auch als Gesamtkunstwerk (im Sinn eines Epitexts, wie Gerard Genette ihn begreift) anzusehen, und zwar vor dem Hintergrund einer noch nicht vollständig verorteten Artmannschen Poetik. Die vorgeschlagenen Lese- und Analysearten, beispielhaft vorgeführt an Artmanns Lektüre-Buchspuren von Max Jacobs Conseils à un jeune poète und Anatole Frances Le Jardin d’Épicure, zeigen einige Möglichkeiten, über seine assoziative und kontrastive Materialverwendung gewisse Arbeits- und Schreibmuster zu ermitteln, und sie münden in die Darstellung der Irritation als ein für diese Materialverwendung und für sein Werk charakteristisches Phänomen.
Im letzten Beitrag „H.C. Artmann: Werk – Nachlaß – Wirkung… und Versäumnis“ bezeichnet Martin A. Hainz den Forschungsstand zu Artmann zu Recht als wenig befriedigend, weil sein Werk und dessen literaturhistorische Bedeutung noch zu wenig aussagekräftig behandelt sind. Seine Selbststilisierungen begünstigten zwar die Abkehr positivistischer Material- und Texterschließung, doch ist eine solche Annäherung jetzt nötig, um Realien zu sichern, Lebensumstände zu dokumentieren, und Kontexte der Textproduktion und -rezeption darzustellen. Einer solchen Annäherung obliegt die Erforschung von entlegenen, anonym oder pseudonym publizierten Texten, die Rekonstruktion des Manuskriptbestandes sowie die inventarisierende Sammlung der verstreuten Teilnachlässe. Erst die Aufarbeitung dieser Grundlagen könnte die Dokumentation von Varianten und Vorstufen, das Projekt einer historisch-kritischen Edition und eine Werkmonographie ermöglichen. Daneben ergäben sich Beiträge zu Einzelinterpretationen, zu Traditionsverhältnissen sowie zu den von Artmann ausgehenden Wirkungen, woraus weitere Informationen zur Geschichte der österreichischen Literatur nach 1945 zu gewinnen wären. Als ersten Schritt zu einer solchen Aufarbeitung versteht sich die aktualisierte Auflistung der Sekundärliteratur im Schlussteil dieses Beitrags.
Den Beiträgern wurde die Wahl zwischen alter und neuer Rechtschreibung freigestellt; Zitate bleiben vollkommen unverändert. Aus Gründen der Kürze und wiederholten Zitierung derselben Primär- und Sekundärliteratur wurde die Zitierweise im Haupttext und im Literaturverzeichnis in allen Beiträgen einheitlich gestaltet. So verweist etwa eine verkürzte Stellenangabe im Text wie „Reichert 1975: 381“ auf die diesbezügliche Angabe im jeweiligen Literaturverzeichnis; in diesem Fall bezieht sich der dortige Eintrag (Reichert, Klaus. 1975. „Zettelkasten für ein Nachwort zu H.C.“ Artmann. 381–388) darüberhinaus auf das unter Artmann 1975 angegebene Werk (The Best of H.C. Artmann) mit den Seitenzahlen 381–388.
Prof. Wendelin Schmidt-Dengler (✝︎ 2008) verfolgte die Entwicklung dieses Bandes seit Anbeginn wohlwollend und wollte selbst einen eigenen Beitrag (zu Artmanns Prosa) verfassen, wozu es leider nicht mehr kam. Ihm ist der vorliegende Band in Dankbarkeit gewidmet.
Marc-Oliver Schuster, Vorwort
Marc-Oliver Schuster: Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
– Einleitung (Marc-Oliver Schuster)
– Monika Schmitz-Emans: „kein zauber ist mir fremd geblieben“: H.C. Artmanns Wortgeburten
– Peter Pabisch: Die vielfältigen Sprachmasken und eigenwilligen Textsorten bei H.C. Artmann
– Michael Backes: H.C. Artmanns Darstellung der Dichterexistenz und die Wiener Gruppe
– John J. White: Hans Carl Artmann und die europäische Literatur des 17. Jahrhunderts
– Elisabeth Parth: H.C. Artmann – Dichter und Übersetzer: König Ubu, die Wiener Fassung des Ubu Roi von Alfred Jarry
– Alexandra Millner: Kasperl als Dichter: Über die Lustige Figur in H.C. Artmanns Stücken
– Sonja Kaar: H.C. Artmann, how lovecraft saved the world: Modell einer Analyse
– Jacques Lajarrige: Hans Carl Artmann als Diarist: Das schwedische Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag
– Marc-Oliver Schuster: „bei allem, was weiß ist“: Intertextuelle Komplexität und implizite Ästhetik in H.C. Artmanns Frankenstein in Sussex
– Alois Brandstetter: Konkrete Bildlichkeit: Zu einem Gedicht H.C. Artmanns
– Heide Kunzelmann: Die „Bibliothek H.C. Artmann“ als posthumer Epitext
– Martin A. Hainz: H.C. Artmann: Werk – Nachlaß – Wirkung… und Versäumnis
– Angaben zu den BeiträgerInnen
– Index
– Verzeichnis der Abbildungen
Aufbau wozu:
begleitet von seiner Skepsis gegenüber der Aufbau-Mentalität der Nachkriegszeit schuf H.C. Artmann (1921–2000) ein stilistisch vielseitiges Werk im Rahmen einer Autonomie-Ästhetik. Seine eigenwilligen kulturellen Interessen und Vermittlungstätigkeiten beeinflussten nachhaltig die literarische Szene in Österreich. Der vorliegende Band versammelt neue Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Rezeption. Die Beiträge bieten unterschiedliche methodische Zugänge zum Spannungsfeld von Artmanns autonomer Sprachartistik und historischer Kontextbezogenheit, und sie dokumentieren zugleich aktuelle Tendenzen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem österreichischen Dichter.
Königshausen & Neumann, Klappentext, 2010
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zu H.C. Artmann + Reportage +
Gesellschaft + Facebook + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag von H.C. Artmann:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H. C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H. C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


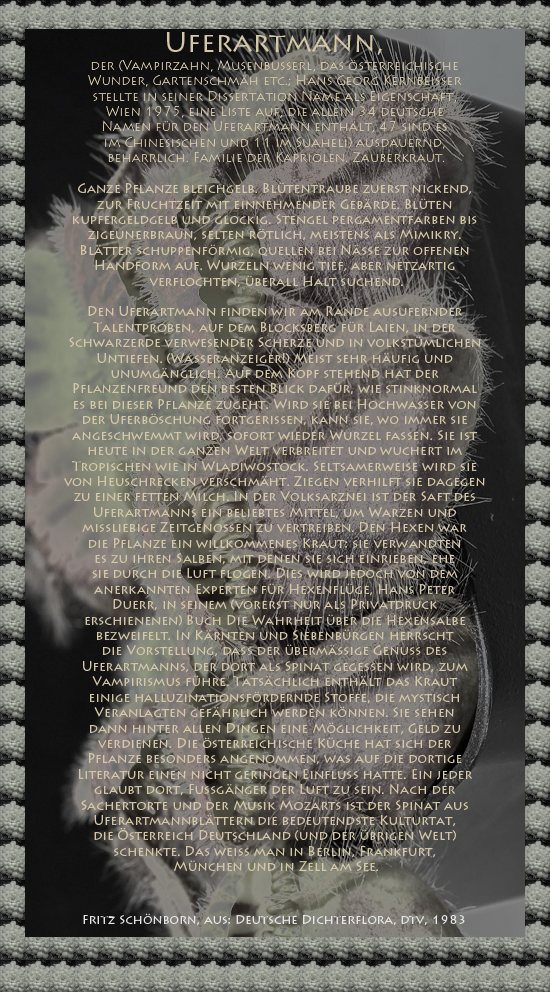












Schreibe einen Kommentar