Michael Braun und Hans Thill (Hrsg.): Lied aus reinem Nichts
ONE, TWO, ANARCHY
für firzliputzli, volk & vaterland
harren wir im sturm am strand
für fitzliputzli, volk & vaterland
stecken wir den kopf in den sand
für fitzliputzli, volk & vaterland
kontrollieren wir die waterkant
aaaaakassieren gebühren
aaaaalassen uns führen
hauptschar, untersturm, oberfeld
stahlaugenspanner am drücker
der kleptokrat kriegt das geld
& stuhlgeist ein stück zucker
aaaaaballa-balla, erika
aaaaaballa-dum, balla-die
aaaaadum-die, dum-die
aaaaaauf zack sind wir dabei
aaaaaone, two, anarchy –
aaaaahottentottenremmidemmi
wenden, wolmar & walk
in hand der freien schützen
ohne zu schwanken in wenden
allerlei zank in & um walk
verhandlungen die ganze nacht
lettische revolutionäre in wolmar
aaaaawehren exzesse ab
aaaaaverhindern plünderungen
riga, ösel & dago ausgeliefert
orscha, smolensk & wjasma genommen
schützengräben von dwinsk bis pinsk
der stab der front in minsk
aaaaaball-balla, babuschka
aaaaaballa-dum, balla-die
aaaaadum-die, dum-die
aaaaaauf zack sind wir dabei
aaaaaone, two, anarchy –
aaaaahottentotten remmidemmi
in der dämmerung der mitfreude
wird auf dem bunten blumenstrauß
des dankeschöns herumgetrampelt
& der schwarze lappen gezeigt
wenn sich ein lüftchen regt
oder auch nur ein abwind geht
aaaaain der nacht der niederlage
aaaaaschmeißen wir die siegerlage
abgebissen wird die hand
die uns mit brocken abspeist
ohne suff ist sinnlos pissen
anarchie muß man wissen
aaaaaballa-balla, anarchia
aaaaaballa-dum, balla-die
aaaaadum-die, dum-die
aaaaaauf zack sind wir dabei
aaaaaone, two, anarchy –
aaaaahottentotten remmidemmi
Bert Papenfuß
Lied aus Nichts und Gesang von Etwas
– Neun Fußnoten zum Gedicht des 21. Jahrhunderts. –
I
In einem seiner unvergänglichen Carmina hat der römische Dichter Horaz der Poesie eine große Zukunft vorausgesagt, eine Beständigkeit über alle wechselhaften Zeitläufte hinweg. „Non omnis moriar – ich werde nicht ganz sterben“, dekretiert Horaz. Denn – so fährt er fort – „das Monument der Dichtung, das ich errichtet habe, ist dauerhafter als Eisen“. Die Zuversicht und das Sendungsbewusstsein, wie sie sich ein Horaz 20 v. Chr. noch ungebrochen bewahren konnte, sind bei den Dichtern der Moderne ins Wanken geraten. Ein großer Meister der klassischen Moderne, der englische Dichter Wystan Hugh Auden, hat Horaz denn auch schroff widersprochen. „Die Dichtung bewirkt nichts“, so notierte Auden lakonisch, doch „sie überdauert, eine Art Zufall, einen Mund“. Wer nun im ersten Dezennium des 21. Jahrhunderts die Literaturzeitschriften und die sich neu konturierenden Lyrik-Portale im Internet studierte, die sich als Energieverstärker der Gegenwartspoesie verstehen, der entdeckte neben branchenüblichem Fatalismus auch ein neues Selbstbewusstsein der Dichter. In einigen Heften der Literaturzeitschrift BELLA triste wurden 2007/2008 wesentliche Fundamente gelegt für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Gedichts heute. Lange ist nicht mehr so sachkundig, offensiv und unverdruckst über Lyrik gestritten worden wie in diesen BELLA triste-Ausgaben – wobei einzelne Wertungen schrill und ungerecht ausfielen. Die friedliche Koexistenz und Kumpanei, wie sie bei Zusammenkünften junger Dichter an der Tagesordnung ist, wurde hier abgelöst durch eine neue Lust an der ernsthaften Auseinandersetzung.
II
Man hat in den vergangenen Jahren häufig von einer „Sturm-und-Drang-Phase einer neuen deutschen Dichtung von internationalem Rang“ gesprochen. Es gibt gute ästhetische Gründe für diesen Befund. Sie haben auch mit den Ausstrahlungskräften neuer außergewöhnlicher Lyrik-Verlage zu tun, mit dem Pionierehrgeiz des Berliner kookbooks Verlags, der Beharrlichkeit von Urs Engeler Editor oder der umfangreichen Editionen des Wiesbadener luxbooks Verlags. Trotz der sich abzeichnenden Gefährdung dieser lyrischen Infrastruktur versammelten sich und versammeln sich dort weiterhin die Autoren, die sehr viel aus den „kleinen Verschiebungen“ (Ernst Jandl) des lyrischen Sprechens gemacht haben. Zwei Beispiele nur: Daniel Falb schreibt, wie der Untertitel eines seiner Zyklen sagt, „verstreute Texte“. Unterschiedlichste Redeweisen, Sprachfiguren und vor allem Satzgruppen prallen hier aufeinander. Es geht nicht um metaphorische Kohärenz, sondern um die Konfrontation des Disparaten – der Autor selbst spricht von einer Neugruppierung bestimmter „Diskursformationen“. Das ist ebenso kühn und neu wie der Versuch von Steffen Popp, ein lyrisches „Exzellenz-Gefühl“ und die alten Bilder des Erhabenen für die Dichtung zu retten, aber sie gleichzeitig mit so viel ironischen Widerhaken und Brechungen zu versehen, dass nicht nur eine Bilderbuch-Version des Erhabenen zurückbleibt.
III
In einigen boshaften „Thesen zur Poesie“ hatte Michael Lentz 2004 der ganzen Gattung das komplette Fehlen von „Sprachüberraschungen“ und „verqueren Inhalten“ attestierte. Es herrsche, so notierte Lentz in seinen Thesen, eine fürchterliche „Bravheit“, die sich im „Anschauen alter Postkarten“ oder in der „Kumpanei mit der Antike“ erschöpfe.
Der über-dramatisierten Diagnose von Lentz kann man in einem Punkt folgen: Jawohl, es gibt auch unter jüngeren Dichtern „das Anschauen alter Postkarten“. Die Anverwandlung der Tradition und das Adaptieren alter Formmuster erfreuten sich wachsender Beliebtheit. Auffällig ist die Reaktivierung der alten Königsdiziplinen, die neue Begeisterung für das Sonett und den Sonettenkranz, für Terzine, Ekloge und Sestine. Man muss sich nur mit den Gedichten von Jan Wagner, Ulrike Draesner oder auch mit dem großen Mythomanen Uwe Tellkamp beschäftigen, um sich an wunderschönen alten Postkarten zu erfreuen. Die freilich neu koloriert sind. Jan Wagner, auf den unter anderem der Traditionalismus-Vorwurf von Lentz zielt, hat eine schöne Antwort parat:
Fortschritt ist das, was man aus dem Rückgriff macht.
IV
Was machen junge Lyriker aus dem Rückgriff? Lehrreich ist hier ein Blick auf die Versuche, ein altes Genre wie das Naturgedicht zu revitalisieren. So zelebriert etwa Ron Winkler genüsslich die ironische Entzauberung romantischer Naturpoesie, indem er den alten Naturstoff mit Fachsprachen vor allem aus der digitalen Welt konfrontiert. Die lyrische Aura von altehrwürdigen Wörtern wie „Regen“, „Vogel“ oder „Schnee“ zitiert er in fast jedem seiner Gedichte – aber nur, um sie dann mit wissenschaftlichen Vokabel-Registern zu konterkarieren. Winkler macht deutlich, dass er den Ur-Elementen der Poesie – Wasser, Wolken, Schnee, Jahreszeiten – keinen autarken Raum gewährt, sondern sie szientifisch-technizistisch in die Schranken weisen will. Natur bleibt auf ironischer Halbdistanz. Geht es bei der poetischen Rückwendung zu „Naturschriften“ also nur noch um ironische Distanznahme? Ohne die reflexive Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen sinnlicher Wahrnehmung ist Natur in der Lyrik jüngerer Autoren nicht mehr zu haben. Das zeigen die Wahrnehmungs-Exerzitien von Nico Bleutge, die um die Möglichkeiten und Grenzen sinnlicher Perzeption kreisen, das zeigen auch Marion Poschmanns komplexe Transformationen von Natur in Kunst. Aber auch die romantisch-emphatische Beschwörung von Naturstoff oder von Landschaft als letzten Refugien ist immer noch präsent in der Gegenwartsdichtung des 21. Jahrhunderts. Die erdverbundenen Gedichte des Wörtersammlers und „entschlossenen Landgängers“ Wulf Kirsten manifestieren die Kraft traditionaler Landschaftspoesie. Kirstens poetologische Maxime ist noch immer wegweisend: Sein Ziel, so schreibt Kirsten in seinem Essay „Entwurf einer Landschaft“, sei eine auf „sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit, eine Mehrschichtigkeit, mit der soziale und historische Bezüge ins Naturbild kommen“.
V
Selbst ein totgesagtes Genre wie das politische Gedicht hat im 21. Jahrhundert seine Haltbarkeit bewiesen. Es ist nicht mehr gesinnungsästhetisch abonniert auf private Konfessionen wie viele Elaborate der 1970er und 1980er Jahre. Es liebt nun eher die Artistik sprachlicher Zerreißproben – so etwa Hendrik Jackson mit seinem aufregenden Poem über den Top-Terroristen Osama Bin Laden. Hier betreibt Jackson ein ironisches Vexierspiel mit einer Gestalt des Terrors. Es ist besonders der rasche Wechsel zwischen Ironie, Emphase und Kalauer, zwischen Medien-Zitat und hymnischer Anrufung des Terroristen, die hier Irritationen auslöst:
bin laden geht in die berge, geht bewundernswert &
bärtig durchs gebirge im zweiten programm und in allen.
was ist, von hier aus, die rückseite der kapitalistischen münze:
adler oder eichmann, goethe oder lenz? falsch: (baudrillard)
… Ist da noch
speichelplatz unter der (vernerzten) zunge des propheten?
Bin Laden wird im Gedicht zur dämonischen Projektionsfigur der westlichen Medien, die sowohl ihre Hassfantasien als auch ihre Erlösungsbedürfnisse auf das „Rauhbein (der Apokalypse)“ verlagern. Man kann streiten über die poetische Legitimität dieses frivolen Spiels. Aber gerade an diesem brisanten Bin Laden-Poem lässt sich ersehen, welche Bildfindungs-Strategien in der Lyrik des 21. Jahrhunderts auftauchen werden: Medien-Zitate, kryptische Anspielungen, rasche Blickwechsel und schnelle Schnitte. Das moderne Gedicht wird – wie es eine Schlüsselfigur der jüngeren Lyriker-Generation, der 2005 verstorbene Thomas Kling, definiert hat – zum „optischen und akustischen Präzisionsinstrument“, das in der Flut der herandrängenden Redesysteme und Fachsprachen mit neuen kühnen Korrespondenzen eine eigene Ordnung der Erkenntnis schafft.
VI
„Mein Kopf ist ein Wespenschwamm“: So lautet eine Gedichtzeile bei dem 1978 geborenen Norbert Lange. Man darf das als Anspielung auf ein Zentralmotiv Thomas Kling lesen – die Wespe. Wobei eine semantische Verschiebung vom „Wespenschwarm“ zum „Wespenschwamm“ vollzogen wird. Dieser Vers kann aber auch als Bild für den Standort vieler jüngerer Lyriker im Gedicht gelten. Es sind sehr viele sich überlagernde poetische Reizungen und Zündfunken, die sich im Kopf eines jungen Dichters tummeln. Und sie sind nicht unbedingt zu einem festen motivischen oder semantischen Kern verdichtet, sondern sie koexistieren in den Gedichten selbst, die sich nicht zu einer kohärenten Form fügen wollen, sondern sich durch Fragmentierung ihre innere Unruhe und Widerständigkeit bewahren.
VII
Gute Dichtung beginnt mit dem Totalverlust aller Gewissheiten. Jedes neue Gedicht verändert und überschreitet die Theorien. Der Glaube an den lyrischen Fortschritt, der an bestimmte Traditionen und gesicherte Einsichten der Moderne verlässlich anknüpfen möchte, ist ein Kinderglaube – es gibt in der Dichtung immer nur vorläufige und sehr anfechtbare Wahrheiten. Das Grundvertrauen in die Sagbarkeit der Dinge und der inneren Empfindungen ist seit der klassischen Moderne stark beschädigt.
Der erste Dichter, der die existenzielle Bodenlosigkeit des lyrischen Sprechens registrierte, war ein okzitanischer Troubadour, Guilhem von Poitiers bzw. Wilhelm von Aquitanien, der um das Jahr 1100 elf bewegende Lieder schrieb, von denen eines ganz besonders die Fundamente des Sprechens aushöhlte. Es ist sein legendäres „Lied aus reinem Nichts“, das mit zwei Negationen beginnt:
Ich mach ein Lied aus reinem Nichts
Von mir nicht und von keinem sprichts.
Kaum beginnt dieser Dichter der poetischen Frühgeschichte zu sprechen, bröckeln oder schwanken die Fundamente. Denn der Urgrund der lyrischen Artikulation, falls es ihn gibt, ist brüchig, kein verlässlicher Ort, oder gar nicht erst vorhanden. Wo ist die viel beschworene Quelle der Inspiration, wo ist der ästhetische Entzündungsmoment, der den poetischen Prozess in Gang bringt? Guilhem/Wilhelm sagt, dass es diesen Urstoff oder auch einen Urtext gar nicht gibt, es sei denn, er ist aus „reinem Nichts“ gemacht:
Ich mach ein Lied aus reinem Nichts,
Von mir nicht und von keinem spricht’s
Nicht Liebeslied, nicht jugendlich
aaaaaNoch irgendwas.
Ich hab ’s im Schlaf gemacht, als ich
aaaaaIm Sattel saß
Weiß nicht, wann ich geboren bin,
Von trübem oder frohem Sinn?
Nicht fremd bin ich und nicht von hier,
aaaaaNoch unerwacht
Hat eine Fee zur Nachtzeit mir
aaaaaMein Los gemacht.
(Übersetzung: Ralph Dutli)
Der Dichter und Essayist Ralph Dutli hat in einem Essay über Guilhem/Wilhelm auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht, der aus der Bodenlosigkeit des poetischen Sprechens herausführt. Der Schlaf erscheint als der erste und beste Verbündete des Dichters. Guilhem/Wilhelm lässt sein poetisches Alter Ego im Schlaf dichten. Sein lyrisches Ich hält sich im Sattel auf, dichtet schlafend auf seinem Pferd und ist zugleich sein eigener Text-Zulieferer. Er gebiert die Phantasmagorien, aus denen dann die poetischen Konstellationen, Bewegungsformen und Dynamiken entstehen, über die bisher noch wenig gesagt ist. Denn wir sind ja zunächst nur mit Negationen konfrontiert.
Selbst tausend Jahre später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, scheinen die Dichter ihren Sprachstoff aus „reinem Nichts“ zu schöpfen.
Ein essayistisches Präludium dazu ist ein poetologischer Essay des Dichters Peter Waterhouse, der 1993 über das Verhältnis des Lyrikers zum Wort anmerkt:
Jedes Gedicht, das ich sagte oder schrieb oder schreiben wollte, kam aus einem: Ich kann nicht sprechen; ich habe keine Wörter.
Auch dies ist als Verlustanzeige zu verstehen, als Einsicht in einen Mangel an Sprache oder in einen Totalverlust, aus dem dann aber poetische Bewegungen entstehen. Noch einmal fünfzehn Jahre später werden erneut Lieder aus „reinem Nichts“ gesungen. Etwa von dem in Berlin lebenden Dichter Norbert Lange in seinem Gedicht „natürlich in Dakrylen“:
Werde ich machen ein Gedicht aus reinem Nix wie sagt man?
Nicht über mich auch von andren nicht. Von der einen Liebe, nein?
Vom Ältersein, oder etwas völlig Andrem?
Werde ich machen, auf Pferde wetten, weiss nicht, ein Gedicht?
Kann ich nicht einmal verstehen: wie zur Welt gekommen bin ich?
Weder machts froh, noch die Schnauze einem voll –
Bringt einen weder rein noch raus –
Kann ich nur machen dazwischen mit meiner Stimme –
So kam das gestern oben auf dem Sattel zu mir
Und ich habe nichts gemacht.
Hier ist das „reine Nix“ zurückgekehrt, zugleich kunstvoll übersetzt in eine komplexe Form – den Daktylus. Und auch hier, wie bei Guilhem/Wilhelm, werden die Urstoffe der Poesie eingeschmuggelt – über den Umweg der Negation. Alle zentralen Themen der Poesie werden aufgerufen, im Modus der Absage: die Liebe, das Älterwerden, die Frage nach dem Urgrund der eigenen Existenz – und natürlich die nach der Sagbarkeit und Sangbarkeit all dieser Elementarien.
Wir erfahren also bei der Lektüre von Poesie: Schon das „reine Nichts“ ist ein poetischer Resonanzraum. Wir befinden uns in der Dichtung auf ganz brüchigen unverlässlichen Fundamenten – und dennoch entsteht in der Konfrontation mit diesem „reinen Nichts“ ein poetisches Etwas. Komplementär zur Suchbewegung der Lieder aus „reinem Nichts“ vollzieht sich denn auch der „Gesang von Etwas“, den Christoph Meckel als fließenden, dem eigenen Atem folgenden Hymnus auf poetische Schöpferkraft angelegt hat. Der Protagonist dieses Gedichts gerät in einen unübersichtlichen Raum, in dem die Gegenstände und Materialien hochgradig chaotisch angeordnet sind. Nun ist es der poetische Prozess selbst, der die vorhandenen Stoffe in eine neue schwebende Ordnung bringt:
Es war da, ein Etwas, und.
Ein Etwas mit und ohne Grund.
Ohne Gegenwart, ohne
Sich befreit zu haben von Etwas aus Zeit,
Etwas aus Anfang, aus Ende.
Ohne. Ohne. Es war da.
Der Stoff der Poesie kann aus „reinem Nichts“ geschöpft sein – am Ende entsteht immer ein poetisches Etwas.
VIII
Eine geniale Lyrik-Anthologie war 1956 Walter Höllerers Transit. In ihrer Risikobereitschaft ist sie bis heute unerreicht. Der nimmermüde Zeitschriftenmacher und Anthologist Höllerer hatte damals im Textteil der Anthologie die Autorennamen einfach weggelassen und den Leser gleichsam mit poésie pure konfrontiert. Wenn er es passend fand, versah er auch einige Texte mit Randnotizen- und initiierte damit ein Gespräch mit den Gedichten. Die Herausgeber der vorliegenden Anthologie möchten von dieser Tugend der Enthierarchisierung lernen – wie in den gemeinsam organisierten Vorgänger-Projekten Punktzeit (1987) und Das verlorene Alphabet (1998). In den einzelnen Kapiteln werden keine literarischen „Schulen“ gegeneinander in Stellung gebracht oder die „Generationen“ in ästhetische Kämpfe verwickelt – etwa die „Jungen“ gegen die „Altvorderen“. Es geht um die Bestandsaufnahme eines lyrischen Jahrzehnts, nicht um die Promovierung einzelner Schreibweisen als der poetischen Weisheit letzter Schluss. Diese Bestandsaufnahme kommt ohne enzyklopädischen Ehrgeiz aus. Aber sie möchte exemplarisch die Vielfalt der lyrischen Sageweisen in ihren verblüffenden Facettierungen zeigen. Das Lied aus reinem Nichts ist polyphon. Unsere Anthologie will intertextuelle Spannungsfelder aufbauen, die verborgenen Motivbezüge zwischen einzelnen Gedichten und die Affinitäten zwischen bestimmten Autoren und ihren Schreibarten sichtbar machen.
IX
Im Blick auf die fortdauernden Metamorphosen der Dichtung und die unaufhörlichen Verwandlungen ihrer konkreten Textgestalt hat der Lyriker und Lyrik-Kritiker Harald Hartung einmal selbstkritisch angemerkt:
Ich weiß immer weniger, was das Gedicht ist.
Dieser Erfahrung können sich auch Anthologisten des 21. Jahrhunderts nicht entziehen. Je näher wir das Gedicht des neuen Jahrtausends anschauen, desto ferner schaut es zurück – und wir stehen am Ende der Lektüre mit mehr Fragen da als am Anfang. Wer aber unruhig nach Kriterien für das gute Gedicht forscht, der sollte sich einer poetologischen Maxime Paul Wührs anvertrauen:
Ich will, dass alles, was gesagt wird, ins Wackeln kommt, immer wieder neu.
Michael Braun, Nachwort
Farai un test
Ich mache einen Vers aus reinem Nichts: ein Vorhaben, das den Stoff eines Gedichts in den Vordergrund stellt. Postmodern? Nein, der Jahrtausendwechsel vom 11. zum 12. Jahrhundert. Wilhelm IX. von Aquitanien (1071–1127), der erste Trobador. Hans Test macht all seine Verse aus reinem Nichts.
*
Farai un vers de dreyt nien – ich möchte einen Vers aus reinem Nichts machen. Wer so beginnt, verspricht ein Kunststück, eine Sensation. Vielleicht hält er aber nur den Moment fest kurz vor Beginn des Schreibens. Denn natürlich entsteht jeder Text von innen heraus gesehen zuerst einmal aus einer Leere, die sich langsam füllt. Und rein von der stofflichen Seite gesehen, entsteht er ebenfalls aus reinem Nichts. Dann, so hat es Philippe Soupault beschrieben, ist da ein Satz, der im Raum kreist wie eine Fliege.
*
Qui est quod est et non est? Nihil. Quomodo potest esse et non esse? Nomine est et re non est. Was ist und ist nicht? Nichts. Wie kann es sein und nicht sein? Ein Name ist es und keine Sache. Das scholastische Spiel aus Frage und Antwort. Das Material des Gedichts als Problem und als Spiel (mit erotischem Hintergrund): Wenn ich eine Dame anschmachte, sehe ich in ihren Augen nicht immer nur mein eigenes Bild? Ist die besungene Dame nicht im Augenblick des Gedichts fern und im Augenblick des Beisammenseins das Gedicht vergessen?
*
Hans Test liest einige Interpretationen zu diesem Anfangspunkt der Europäischen Poesie. Vermutlich sind die Dechiffrier-Syndikate zu Zettels Traum fleißiger gewesen als die Romanisten bei diesem Gedicht. Er liest Raoul Schrott in seiner Anthologie Die Erfindung der Poesie. Jacques Roubaud in seiner Studie über die „Kunst der Trobadors“ – „La Fleur inverse“ (Das Gegenteil von Blume, die umgekehrte Blume). Dietmar Rieger in seiner „Untersuchung zu einem ,Schlüsselgedicht der Trobadorlyrik‘“. Ralph Dutli in seinem Essay „Ein Lied aus reinem Nichts.“
*
Mit dem Sieg des Französischen Königs über die Albigenser (Fall von Montsegur 1244) verstummen auch die Trobadors und ihre Lieder, die sich durch Spekulationsfreude und erotische Deutlichkeit auszeichneten. Danach kommen, jetzt auf Französisch, die Troubadours, der Minnesang. Die keusche Liebe, christliche Ritterlichkeit.
*
Natürlich ist die Poesie nicht „ewig“, natürlich hat jedes Gedicht seine Zeit. Seine Quellen können auf dem Zeitlineal an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Ob kurz hinter der Moderne oder im Mittelalter, ob im fernen Nirgendwo der Genesis, in einer Ur-Welt des Traums oder in einer „Hoffnung auf Wildnis“ (Lucas Hüsgen). Dennoch hält jeder dafür, daß das Gedicht zeitgenössisch ist. Oft jenseits der Moden und Trends, wie sie im Betrieb an jeder Ecke ausgerufen werden.
*
Tatsächlich wird von den Kulturhistorikern ein Beginn poetischen Sprechens in dunkle Vorzeiten verlegt, in den paläolithischen religiös-kulturellen Komplex. Unter Dichtern ist die Vorstellung verbreitet, das poetische Sprechen nähre sich aus einem Denken vor der Vernunft, aus der Zeit vor der systematischen Philosophie. (Paul Wühr und Paul Valéry, aber auch Flavio Ermini).
*
Dietmar Rieger weist nach, daß der „Vers aus reinem Nichts“ mathematisch organisiert ist. Die Zahlenwerte der Reimwörter ergeben ein Geflecht von Bedeutungen, einen Subtext voll biographischer Anspielungen, ein Gebäude aus Kolonnen und Verhältnissen. Wurde in den gut 800 Jahren, die dazwischen lagen, der Text immer falsch verstanden?
*
Hans Test liest die Abgesänge auf das alte Jahrzehnt in den Wochenendbeilagen der großen Zeitungen. Mit soviel Überdruß wurde noch kein Jahrzehnt verabschiedet. Test erinnert sich an Faszination und Schauder gegenüber der neuen Medienwelt in den achtziger Jahren, als Michael Braun und er eine Anthologie Paul Virilio folgend Punktzeit nannten. Dieser spricht jetzt vom „rasenden Stillstand“, ein ebenfalls reichlich zitiertes Paradox. Erst jetzt fällt Test die Männlichkeitsbehauptung im Namen Virilio auf. Viele angloamerikanische Begriffe und Wortspiele werden zur Qualifizierung des Jahrzehnts bemüht, für das es keine vernünftige Ordnungszahl zu geben scheint: Nullerjahre. „The Noughties“ (Simon Schama) sind von schlechtem Gewissen geprägt, „verketzerte Krisenjahre“ (Georg Diez). „Abstiegsjahrzehnt“. Das Jahrzehnt der „nach Tieren benannten Epidemien“ (taz). Das „realistische Jahrzehnt“ (Ijoma Mangold).
*
Es gibt in der scholastischen Rhetorik die Figur der Unähnlichen Ähnlichkeit. Der Mystiker Heinrich Seuse vergleicht die Sonne mit einem „Schwarzen Mohr“, um ihre Strahlkraft zu verdeutlichen: das Fernliegende kann unter Umständen plausibler sein als das Nahe. Mit diesem Kunstgriff schließt der mittelalterliche Visionär eine Klammer um die Gegensätze. Das Paradox ist ein Glücksfall der Logik. Eine aufschießende Erregung, wenn zwei starke Widersprüche in einen Sinn münden. Deshalb bleibt es im Gedächtnis haften, wird weitergesagt, als religiöse Wahrheit, als Weisheit, als Witz. Hans Test ist auch im Poetologischen für die Unterschiedlichkeit der Ansätze. Dafür spricht die bunte Reihe der Jungen Lyrik, die sich seit den späten Neunziger Jahren zu Wort meldet. Man sollte nicht die Hände überm Kopf zusammenschlagen, sondern aushalten, was die Moderne an Ungleichzeitigkeiten beschert.
*
Poesie ist ein Zustand der Sprache (Helmut Heißenbüttel). Poesie ist eine Lebensform (Paul Éluard, Stephen Popp). Poesie ist eine Sehnsuchtsform (Christian Schloyer).
*
Hans Test beobachtet Autoren beim Vortrag ihrer Gedichte. Er sieht die Abwesenheit in den Mienen, die Konzentration vor den ersten Worten, dann ein Aufleuchten. Inger Christensen, unscheinbar, mit der Handtasche auf dem Schoß, dann aufgeweckt von der eigenen hellen Stimme. Das Gedicht als sprachliches Glück.
*
Bestandsaufnahme in der Zeitschrift Bella Triste Heft 17. Das Durcheinander einer Debatte, die sehr um Definitionen bemüht ist. Eine Szene sucht nach einem Fundament, die Beiträge beeindrucken durch präzise Selbstbeobachtung. Ein Mix aus Sprachtheorie. Soziologie und historischen Überlegungen. „Jedesmal, wenn der Mensch aufs neue festen Fuß fasst, glaubt er zu wanken“ (Egon Friedell).
*
Von den Avantgarden hörten wir die schönsten Sätze der Befreiung: „Die Poesie wird mit dem Mund gemacht“ (Tristan Tzara). „Ich nähere mich der Poesie: aber damit ich sie verfehle“ (Georges Bataille). „Die Leidenschaft ist ein Express-Zug, der täglich um siebzehn Uhr vorbeikommt“ (Philippe Soupault).
Allerdings gibt es nicht nur die europäischen Avantgarden. Jeder Kontinent hat seine Moderne, wie auch die Archipele, die sich über die Meere verstreuen. Edouard Glissant von den Antillen (Martinique) mit seinem Modell der Poesie als Welt-Beziehung sieht im poetischen Sprechen den Ausdruck der sich immer wieder erneuernden Verhältnisse unter den Menschen nach dem Kolonialismus. Vor ihm brachte Aimé Césaire mit der Négritude die Emanzipation der Schwarzen in die Literatur. Bereits seit mehreren Generationen beschäftigen sich arabische Autoren französischer Sprache mit einer Revision der eigenen Kultur. Als Dichter stellt sich der Tunesier Abdelwahab Meddeb in die lange Reihe der mystischen Sufi-Provokateure, als Philologe betreibt er eine Art emanzipativer Hermeneutik zur Modernisierung des Islam aus seiner eigenen Geschichte. Und das sind nur Beispiele aus dem französischen Sprachraum.
*
Bella Triste: Das Experiment. Hans Test hatte seit langem den Begriff gemieden. Von Ulf Stolterfoht auf die Tagesordnung gebracht, erhält er neue Brisanz. Test sah ihn bisher als Kampfbegriff gegen die Realismusforderungen der Nachkriegszeit. Biedere Natürlichkeit, sozialistische Zukunftsgewißheit. Der Lebenshunger der Siebziger. Ein deutsch-österreichisches Phänomen. Die perfekten Reihen einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung. Passt der Begriff „experimentell“ zu einem „Schreiben mit ungewissem Ausgang“ (Ulf Stolterfoht)? Einige Stimmen wehren sich dagegen und sehen den Drang ins Ungewisse bei allen zeitgenössischen Lyrikern. Andererseits, wenn das wirklich eine Selbstverständlichkeit für das Schreiben von Gedichten wäre: weshalb dann die vielen abgezirkelten Gedichte? Die vielen fertigen Gedichte? Die vielen schnell fertigen Gedichte in den neuen Bänden und Zeitschriften?
*
Das Wort erschrickt und erstarrt zu Schrift. Test bevorzugt jedoch Formen, in denen die Sprache weiterarbeitet. Das Probieren beginnt auf dem Papier. Test schreibt Sätze auf, die er nicht sagen könnte. Schreibend begibt er sich auf das Feld der „produktiven Unzulänglichkeit“ (J.W. Goethe), verläßt den Bezirk des Schriftlichen. Abweichungen vom Muster gehen in Richtung Pathos oder in Richtung Unsinn. Der sublimierende Fehler, das profanierende Mißverständnis sind Zeichen für die Autonomie eines Textes, seine ästhetische Qualität.
*
Test sind die unfertigen Formen auch in der Geschichte am nächsten. Etwa die deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts (von den nachfolgenden Generationen bis ins 20. Jahrhundert hinein mit einem Naserümpfen zur Kenntnis genommen), in dem die elaborierte Form des Sonetts mit einem unfertigen Hochdeutsch realisiert wird, das in seiner Gestik zahlreiche mündliche Rückstände transportiert, schöne, mutige Patzer und manche dialektale Pointe. Die Klagen eines Gryphius, die „Wälder“ eines Fleming. Wie sich Opitz an seinem Ronsard abarbeitet, das hat wirkliche Größe, verglichen mit den glatten Versen eines Gottsched zur Zeit der großen Sprachbegradigung.
*
Test liest in Walter Höllerers Poetik Sammlung Theorie der modernen Lyrik. Erstaunlich, das weite Ausholen in eine leuchtende Zukunft bei den deutschen Expressionisten und Dadaisten. Hans Arp begnügt sich mit der Schilderung seiner Vorgehensweise.
*
Mund und Medien. Hand und Medien. Die Schrecken der Schrift. Die Gewißheit des Schreibenden. Das Ende der Bescheidenheit.
*
Test ist sich noch immer nicht sicher, ob er in seinem Notizbuch für seine Handschrift die richtige Buchstabengröße gewählt hat. Wäre seine Schrift nicht besser zu lesen, wenn er kleiner schreiben würde? Oder zumindest die Anfangsbuchstaben deutlich größer? Und dann den Durchschuß etwas enger, das heißt den Zeilenabstand verringern.
*
Ich mache einen Vers. Ich mache einen Text. Ich mache einen Test.
Hans Thill, Nachwort
Über dieses Buch
Wohin geht das Gedicht? Was kann es? Was ist ihm zuzutrauen, anzutragen, aufzubürden? Lied aus reinem Nichts ist eine Bestandsaufnahme der lyrischen Gegenwart, die nicht auf pluralistischen Sammelfleiß und enzyklopädische Vollständigkeit aus ist, sondern mit klaren Kriterien die ästhetisch wagemutigsten Schreibverfahren und substanziellsten und eindringlichsten Versuche lyrischen Sprechens vorstellt.
„Ohren auf und weiterdichten!“ war der Ausruf des Rezensenten in der Zeitschrift Am Erker, als er unsere Anthologie Das verlorene Alphabet (vergriffen) aus dem Jahr 1998 vorstellte. Damals grübelten die Autoren und Kritiker noch, ob denn nach dem Milleniumswechsel ein neuer lyrischer Aufbruch jenseits der einschlägigen Reprisen und Rekonstruktionen möglich sei. Die Stimmung war eher verhalten, die Furcht herrschte vor, man habe ein Nachwuchsproblem. „Ohren auf und weiterdichten!“ Die deutschen Lyriker ließen sich das nicht zweimal sagen. Mittlerweile ist die Lyrik die aufregendste und am intensivsten diskutierte Gattung innerhalb der Gegenwartsliteratur. Seit einiger Zeit ist auch die friedliche Koexistenz, wie sie im Clan der Dichter lange üblich war, abgelöst worden durch eine neue Lust an der ernsthaften ästhetischen Auseinandersetzung. In Zeitschriften wie Bella triste wird heftig über die Möglichkeiten des zeitgenössischen Gedichts und über die ästhetische Differenz zwischen traditionellen und modernen Schreibweisen gestritten. Nun ist es wieder Zeit für eine umfassende Bestandsaufnahme: Wohin geht das Gedicht? Was kann es? Was ist ihm zuzutrauen, anzutragen, aufzubürden? So steht es im Einladungsbrief, den die beiden Herausgeber verschickten. Sie erhielten Gedichte von weit mehr als 150 Lyrikerinnen und Lyrikern. Die strenge Auswahl beschränkte sich auf die wichtigsten Stimmen.
Wunderhorn Verlag, Ankündigung
Das Gedicht lebt heute vom Zweifel
– Michael Braun und Hans Thill sammeln bereits die deutschsprachige Lyrik des 21. Jahrhunderts. –
Die Dichtung braucht schon lange kein ästhetisches Leitbild oder gar ideologische Geborgenheit. Das 21. Jahrhundert eröffnet nicht mit einem programmatischen Jahrzehnt der Lyrik. So etwas gab es auch nur einmal: Das Jahrzehnt des Expressionismus von 1910 bis 1920. Aber was historisch gilt, muss im Einzelnen nicht zutreffen. Eine Anthologie des Kritikers Michael Braun und des Lyrikers Hans Thill verblüfft nicht nur durch einen exzentrischen Titel: Lied aus reinem Nichts. Deutschsprachige Lyrik des 21. Jahrhunderts. Sie ist auch eine weiterführende Verlockung. Diese Auswahl beispielhafter Gedichte widerspricht inhaltlich den „Thesen zur Poesie“ von Michael Lentz, die der zeitgenössischen Lyrik einen Mangel an „Sprachüberraschungen“ und „verqueren Inhalten“ anlasteten. Nun gut, man muss nicht gleich an Stefan Georges „Kraft der Ausdruckserneuerung“ denken.
Es stimmt, Momente der Spracherneuerung und ein abrufbares Potential für Provokation treten seltener in den Vordergrund. Auch gibt es keine literarischen Stimmführer mehr, eher stehen Namen für Repertoire. Die Sattelplätze der Dichterschulen liegen verwaist. Und Erwartungen an einen Kanon müssen grundsätzlich enttäuscht werden. „Die Dichtung bewirkt nichts“, zitiert Michael Braun den englischen Dichter Wystan Hugh Auden, aber „sie überdauert, eine Art Zufall, einen Mund.“ Das Kraftfeld dieser Sammlung ist der fortgesetzte Wandel des Blickes auf die hier versammelten hundertfünfzig Dichter. Die Herausgeber erkennen Unterschiede, wie Lyriker versuchen, die poetische Herrschaft zu erlangen über die unbeherrschbaren Dinge dieser Welt. Das zeigen nicht nur ihre getrennten Nachsätze, sondern auch Auswahl und Arrangement sowie die umsichtige Aufbereitung sich unterscheidender poetischer Façon. Geordnet wird nicht nach Generationen, gar Schulen, mehr nach Motiven, aber auch das spielerisch. Überschießende Modernität wird nicht gesucht, keine gonghaft schallenden Verse, kein Poetry Slam.
Sentenzen der Dichter überschreiben die Kapitel. So treffen sich neben Wolfgang Hilbigs „Matière de la poésie“ wie zum Beispiel, aber nicht zum Exempel, Christoph Meckels „Gesang von Etwas“, Oskar Pastiors „nasnblut o tangosonntag“ oder Johannes Kühns „Bleistiftstummel“ auch Marcel Beyers „Schreibhand“, Ann Cottens „Die Liebe ist Sieger“ oder Brigitte Oleschinskis „die letzten wanderer“. Es zeigt sich, Schlagwort und Attitüde, Tumult und Turbulenz, Jugendgebärde und Bürgerschreck, Exaltation und Exhibition haben sich verbraucht, von Tugendpathos und Schmerzgedächtnis ganz zu schweigen. Das Gedicht lebt heute eher vom Zweifel. Nichts muss so sein, wie es scheint. Hilbigs „Meer: das nicht mehr Tag noch Nacht ist sondern Zeit“ trifft auf „ein weltbewusstsein. ein schlechtes wetter“ von Michael Lentz.
Ob melancholisch oder voller nervöser Daseinslust, jedes Gedicht muss als Gedicht überzeugen, es lebt aus nichts anderem als durch sich selbst. Dem Amerikaner Charles Olson ist nicht zu widersprechen, wenn er darauf besteht, im Gedicht müsse etwas stattfinden. Ein Weltmann der Lyrik, Joachim Sartorius, hat das ironisch gebrochen:
Das Gedicht versteht mich nicht.
…
das Gedicht will nach vorn blicken, will zwei Flügel
haben und verbrennen. Es wartet, dass ich zündele.
Gezündelt wird immer noch im politischen Gedicht, wenn auch seltener wie bei Jürgen Theobaldy oder auch mehr als eine Generation später bei Hendrik Jackson und Björn Kuhligk. Beständig dagegen Volker Braun in seinem Phantomschmerz. Peter Rühmkorf hat es hinter sich:
Das Zeitgedicht, das Zeitgedicht,
hat nur ein kurzes Lebenslicht,
und wenn es auch die Wahrheit spricht,
man dankt’s ihm nicht!
Olé!
Auch Natur und Landschaft verweigern sich weiter der Vereinfachung, werden seltener bildgebend, ungeachtet aller „latenten Orte“, Bienen und Kormorane. Stephan Turowski:
Natur,
wie komme ich da wieder heraus.
Eine Antwort gibt Wulf Kirsten, der Virtuose unter den Landschaftern, in seinem Essay „Landschaft im Gedicht“, dem Versuch einer deutlichen „Abgrenzung gegen das pure Naturgedicht“, und spricht gleichsam grundsätzlich: „Wenn das Gedicht von einem starken Spannungsbogen getragen wird, muss ein Kraftvektor durchgehen, der auf den starken Schluss gerichtet ist.“ Richtig, Natur oder Asphalt, Umsturz oder Seelenpein, die Pointenverschleppung ist dem Gedicht nicht zuträglich. Selbst das Erotische zeigt sich hier pointenstark, das stimmt zuversichtlich für die Gattung. Durs Grünbein hört beim Liebesspiel den „Wal, kaum bin ich in ihr drin“. Nicht viel anders zeigt sich Barbara Maria Kloos neben Günter Kunert oder Sabine Schiffner neben Gerhard Falkner.
Dieser Band ist eine Exellenzvorstellung. Nicht überraschend stand er auf der SWR-Bestenliste vom Januar, gleichsam als Würdigung, ein Jahrzehnt zeitgenössischer Dichtung vehement begleitet und gewertet zu haben. Größere Säumnisse unter den Dichternamen werden nicht augenfällig, kleine Entdeckungen schon eher. Es gibt wenige, die sich zeitnaher Dichtung als Kritiker und Vermittler so nähern wie Michael Braun und Hans Thill. Hier ist früh gesammelt worden, auch wenn das Erkennen noch andauert.
Jürgen Verdofsky, culturmag.de, 9.2.2011
Lasst tausend bunte Verse blühen
– Anarchie und Ordnung: Zwei Anthologien versammeln die jüngste deutsche Lyrik. –
Wie steht es um die deutschsprachige Lyrik der Gegenwart? Dass sie die derzeit spannendste Gattung ist, pfeifen die Spatzen von den Dächern, doch weiß man auch, dass die Leserschar für Lyrik nicht gerade groß ist. Zwei neue Lyrik-Anthologien stellen sich dieser Herausforderung auf ganz unterschiedliche Weise. Wie jede Anthologie müssen auch sie zwei widerstrebende Tendenzen in Einklang bringen. Denn der Leser will einerseits Entdeckungen machen, andererseits aber auch einen Kanon präsentiert bekommen. Der muss zwar nicht allgemeingültig sein, wohl aber die Auswahl rechtfertigen und auch die Art der Zusammenstellung.
Je zwei ausgewiesene Lyrikspezialisten haben sich zu Herausgeber-Duos zusammengetan.
Der Literaturkritiker Michael Braun und der Autor und Übersetzer Hans Thill verantworten im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn einen Band mit dem programmatischen Titel Lied aus reinem Nichts. Er versammelt „Deutschsprachige Lyrik des 21. Jahrhunderts“, nimmt also eine willkürliche Zäsur zum Anlass, die „ästhetisch wagemutigsten Schreibverfahren und substantiellsten und eindringlichsten Versuche lyrischen Sprechens“ vorzuführen, wie es recht vage heißt.
Das einzelne Gedicht steht hier im Zentrum. Gruppiert werden die Gedichte nach poetischen Schwerpunktsetzungen, die den Titel eines Gedichts zur Überschrift des jeweiligen Kapitels erheben: „Fenster zur Weltnacht“, „Kleines Rasenstück“, „Fast eine Romanze“ beispielsweise. Die hierarchiefreie Kommunikation von Motiven und Sprechweisen ist das erklärte Ziel dieser Sammlung, deren muntere Anarchie den Leser dazu einlädt, wie ein schnüffelnder Hund durch die Verse zu streunen.
(…)
Welcher der beiden Anthologien man den Vorzug gibt, der streng konzipierten Sammlung des S. Fischer Verlags, die den Werkzusammenhang und die Autorenpersönlichkeit in den Fokus rückt, oder der auf die Überzeugungskraft des einzelnen Gedichts setzenden Blütenlese von Wunderhorn, ist eine Frage des Erkenntnisinteresses.
Viele Lyriker sind in beiden Bänden vertreten, darunter auch die wichtigsten Namen der jüngeren Generation, von Monika Rinck und Marion Poschmann bis Jan Wagner, Ron Winkler, Uljana Wolf und Steffen Popp. Eine unbekannte Autorin wie die mit einem schnoddrig klugen Alltagsgedicht vertretene Claudia Gabler kann man nur bei Michael Braun und Hans Thill entdecken.
(…)
Meike Feßmann, Der Tagesspiegel, 26.2.2011
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Walter Fabian Schmidt: Aus Facetten blickts, das Nichts
poetenladen.de, 15.10.2010
Fakten und Vermutungen zu Michael Braun + Kalliope +
Laudatio & Dankesrede
Nachrufe auf Michael Braun: Facebook 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 ✝︎ Zeit ✝︎
faustkultur ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ SZ ✝︎ FAZ ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Börsenblatt ✝︎ Rhein-Neckar-Zeitung ✝︎ Mannheimer Morgen ✝︎
signaturen-magazin ✝︎ VOLLTEXT ✝︎
Fakten und Vermutungen zu Hans Thill + Facebook
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Thill zum Internationalen Lyrikertreffen Münster 2021 mit seinem Statement „Pathos“.
Hans Thill liest sein Gedicht „Kühle Religionen“.




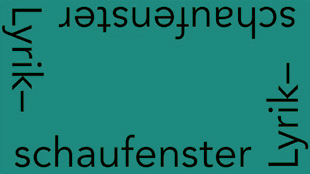
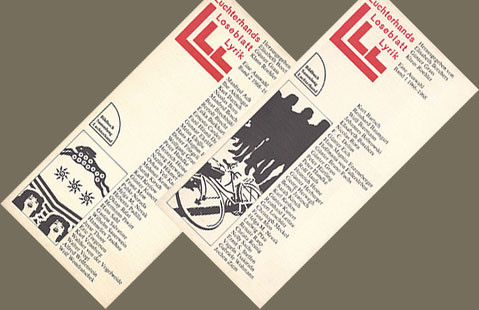



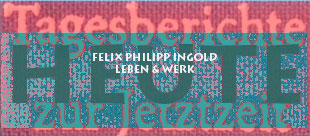
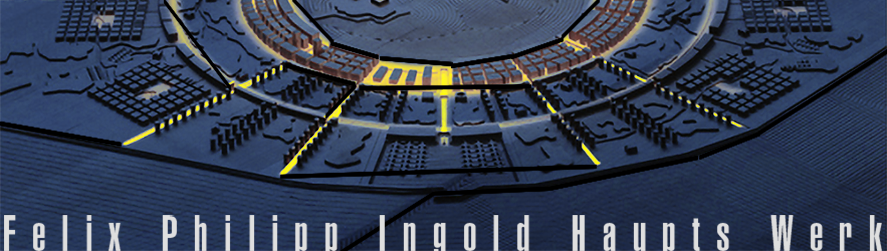
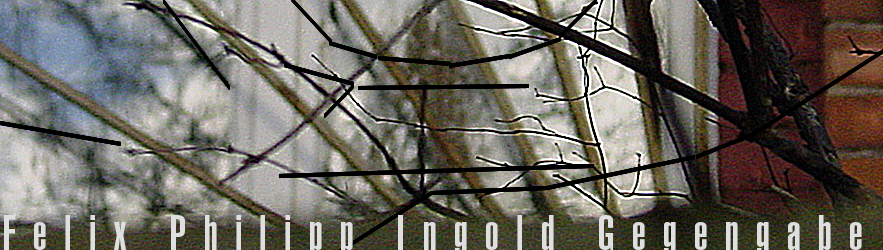
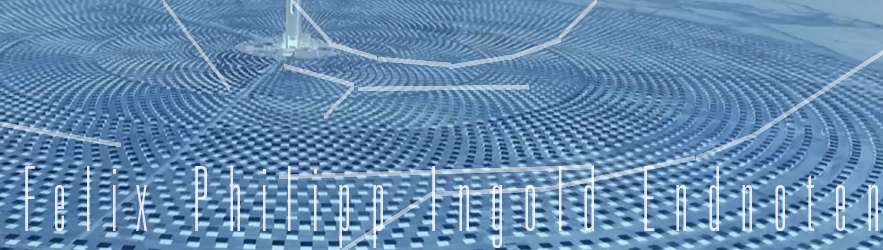

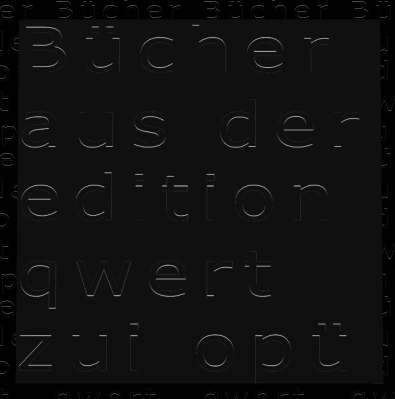
Schreibe einen Kommentar