Robert Gernhardt: Lichte Gedichte
DREIAKTER
Nach Motiven von F. Kafka
Das Leben ist ein Fenster,
in dem du kurz erscheinst.
Mit deinem Auftritt öffnet sich
das Fenster jenen Augenblick,
der deiner Rolle zugedacht,
dann wird es wieder zugemacht,
wie du auch fluchst und greinst:
Dein Leben ist ein Fenster,
in dem du kurz erscheinst.
Auf deinen Auftritt wartet hier
kein Inspizient, kein Regisseur,
kein Stichwort, kein Szenarium,
kein Text, auch ist das Publikum
viel kleiner, als du meinst:
Dein Leben ist dies Fenster,
in dem du kurz erscheinst.
Zu deinem Abtritt nur so viel:
Wenn mal das Rampenlicht erlischt,
dann ist der Vorgang hausgemacht,
der Pförtner hat es ausgemacht,
nach Plan, nicht nach Verdienst:
Dein Leben war dies Fenster,
in dem du kurz erschienst.
Als Robert Gernhardt
1987 den Gedichtband Körper in Cafés veröffentlichte, behandelte er auf 160 Seiten zehn Themen, die von „Körper“ über „Heimat“ bis zu „Schicksal“, „Sinn“ und „Leere“ reichten: Der bisherige Nonsens-Dichter war unübersehbar dabei, sich dem Megasens zuzuwenden. Das setzte sich 1994 fort, als der Gedichtband Weiche Ziele erschien, 208 Seiten stark und in sieben Kapitel unterteilt, die mit „Zu Paaren“ und „Auf Reisen“ begannen und mit „Im Gespräch“ und „Am Leben“ endeten.
Lichte Gedichte, 1997 erschienen, widmet sich in neun Abteilungen den ewigen Themen aller Dichtung ebenso wie sehr zeitgenössischen, ja privaten Sujets. Von der Liebe („lieblich“), der Person („persönlich“), der Natur („natürlich“) und der Kunst („künstlich“) ist anfangs die Rede, mit Tod („endlich“) und Erkrankung („herzlich“) schließt die Sammlung, wobei „Herz in Not“, das „Tagebuch eines Eingriffs in einhundert Eintragungen“, wider Erwarten für ein gutes Ende und dafür sorgt, daß das Versprechen „licht“ nicht zu einem schlichten „lich“ verkümmert.
Lichte Gedichte ist mit 256 Seiten der umfangreichste der drei Gedichtbände, die so etwas wie eine poetische Trilogie des zurückliegenden Jahrzehnts bilden. Der für Gernhardt typische Spagat zwischen ungenierter Komik und dezidierter Ernsthaftigkeit hat in seinen begeistert aufgenommenen Gedichten eine neue Qualität erreicht: Der dunkle Grund der Erdenschwere kommt ständig zur Sprache und verwandelt sich ebenso beständig vor unser aller Augen in Helligkeit und Schnelligkeit.
Fischer Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1999
Meisterschaft stets spürbar
Dass Robert Gernhardt der bedeutendste deutschsprachige Lyriker der Nachkriegszeit war, wird wohl keiner ernsthaft bezweifeln. So ist auch in dieser Gedichtsammlung die Meisterschaft hinter jedem Gedicht spürbar. Das bezieht sich nicht nur auf den Inhalt, den ungewöhnliche Themen wie Geburt des Teufels oder Toilettensitzung auszeichnen. Sondern auch auf die Sprache: Gernhardt beherrscht alle lyrischen Formen und sprachlichen Ausdruckselemente, die man sich nur denken kann.
Sein Humor ist stets von Wehmut geprägt, was den Humoristen gegenüber dem Comedian auszeichnet. Überall spürbar ist die ungeheure Kenntnis und poetische Bildung, Gernhardt ist mit allen Stilrichtungen vertraut.
Am Ende enthält dieser Band auch „Herz in Not“, eine Sammlung an Gedichten, die des Dichters einige Herzerkrankung lyrisch verarbeitet. Sprachlich-stilistisch sicher nicht sein Meisterwerk, aber menschlich ungeheuer intensiv.
Kleines Aber: manche Gedichte dieser Sammlung sind schon arg „licht“ geraten, so dass einiges an Gewicht verloren ging. Die eine oder andere kleine Kürzung, insbesondere bei den Gelegenheitsgedichten, die der Dichter während seiner offenbar zahllosen Bahnfahrten schrieb, hätte dem Band nicht geschadet.
Liberaler, amazon.de, 27.2.2014
Nonsensfreudig, satirisch und äußerst zitierfähig
Eine Zeit lang war Peter Handke das Thema
Jetzt ist auf einmal Durs Grünbein das Thema
…
Das Thema ist immer: Erfolg
Der Erfolg ist diesem Bändchen zu wünschen (aber auch ziemlich sicher). Wieder einmal eine spaßig-kreative Mischung aus intelligentem Nonsens, Humoristischem und satirisch verpackten klugen Einwürfen. Die „großen Themen der Dichtung“, Liebe, Natur, Krankenhaus und Sonstiges, kommen hier erfrischend undeutsch-unterhaltsam zur Sprache; das Buch ist ausgesprochen zitierfähig. Etwas nervig sind dabei die üblichen, leicht spätpubertär anmutenden eingestreuten Chauvinismen und Anzüglichkeiten.
Den Lesegenuss im Ganzen schmälern sie aber nicht. Wie kürzlich in der FAZ zu lesen war (ich hatte sie geliehen, nicht gekauft!), hat mit dem HipHop auch die Reimfreudigkeit wieder Einzug in die Dichtkunst weiter Teile der deutschen Bevölkerung gehalten. So gesehen ist Gernhardt dem Trend schon lange voraus. Wie schön, dass die Frankfurter Schule auch so leichtfüßig daherkommen kann. Die Freude an scheinbar sinnarmer Minimal-Poesie mit gewollt gewollten Reimen überträgt sich flugs auf den Leser: Wer Robert nicht Gernhardt / Der niemanden gern hat. Viel Spaß! (Dies ist eine Amazon.de an der Uni-Studentenrezension.)
Ein Kunde, amazon.de, 4.9.1999
Geistlose Kalauer, Phrasen und zynische Witzchen
Der baltendeutsche Schriftsteller Robert Gernhardt (1937–2006) schrieb in diesem vorliegend Buch etwas, das er mittels der Namenfolge Lichte Gedichte benannte. Aber nicht jedes Falles ergeben gereimte Wortfolgen oder Versformen auch Gedichte. Die Zugabe zu Geschriebenem, die wichtiger denn Reime oder Gestaltung ist, wird mittels des Namens ,Geist‘ benannt. Und den verknausert Gernhardt ego-hörig und ego-typisch.
Im vorliegenden Band ohne Gedichte sind neun Sinn-Gruppen mit folgenden Namen übertitelt: „I lieblich“, „II persönlich“, „III natürlich“, „IV künstlich“, „V lässlich“, „VI beweglich“, „VII alltäglich“, „VIII endlich“ bis „IX herzlich“. Aber schon in der ersten Gruppe „I lieblich“ steht zu lesen:
Ein guter Abend, um Pflaumen zu schneiden,
vorausgesetzt, es stimmt mit euch beiden.
Man kann beim Entkernen Gefühle erleben,
die schlichtweg erheben.
Das ist aber geistreich! Und vier Seiten fürder:
Über Liebe kann man nicht schreiben.
Man liebt oder lässt es bleiben.
O welche Weisheit!
In „IV künstlich“ lesen wir:
Horch! Es klopft an deine Tür:
„Mach auf und lass mich rein!“
„Wer da?“ „Die Einfallslosigkeit!“
„Das fällt mir gar nicht ein!“
Schon steht sie neben deinem Tisch:
„Was wird das? Ein Gedicht?“
„Ein Lob der Kreativität“.
„Das, Freundchen, wird es nicht.“
Das ist wenigstens aufrichtig, wenn es nicht doch als „autoironisch“ gedacht und somit doch wieder unaufrichtig und ego-betonend ist. Diese latente Egothesis ist durchgängig zwischen den Versen zu sehen. In „VIII endlich“ ist unter der Überschrift „Ein Glück“ zu lesen:
Wie hilflos der Spatz auf der Straße liegt.
Er hat soeben was abgekriegt.
(…)
Wen leiden zu sehn, ist nicht angenehm.
Wenn wer sterben will, ist das sein Problem.
So red ich mir zu und geh rascher voran.
Ein Glück, dass ein Spatz nicht schreien kann.
Welch ein Glück, dass das, was Gernhardt mittels des Namens „Tod“ benennt, stumm an ihm vorüberschwebt! Aber in „IX herzlich“ kommt „er“ ihm nahe. Statt „herzlich“ sollte dort „kardiologisch“ stehen, denn der eigenmächtige Dichter erlitt zehn Jahre nach der letzten Cigarette auf der selben Terrasse in Montaio in Italien einen Herzinfarct. Wer nun tieferen Sinn des Kalauerschreibers in Richtung des Jenseitigen erwartet, der tut es vergeblich. Seine tiefste egothetische Weisheit liegt hierin („Kopf hoch“):
Was soll deine Sorge,
du müsstest zu früh gehn
und könntest das Ende
des Films verpassen?
Du bist doch der Star!
Mit deinem Abtritt
endet in jedem Fall dein Film.
Und hierin („Tote Freunde“):
Einzig die Unsicherheit ist sicher.
Seine Freunde sind nicht nur gestorben, doch leben ewig in ihm, sondern, nein, sie sind in seiner Denke tot. So, wie schon vor dem Sterben ein jeder Geistvermeider.
Basileus Bibliophilos, amazon.de 23.8.2016
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Gunhild Kübler: Haltung bewahren, wenn es einem an den Kragen geht
Die Weltwoche, 31.7.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 1 17–139
Thomas Steinfeld: Pochen im Kostüm
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 139–141
Volker Hage: Da sprach der Knecht zum Herrn
Der Spiegel, 4.8.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 142–145
Sowie in: Deutsche Literatur 1997. Jahresüberblick, 1998, S. 114–120
Andrea Köhler: Im Herzkammerton. Er und sein Körper
Neue Zürcher Zeitung, 21.8.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 145–147
Elke Heidenreich: Lichte Gedichte
Radio Bremen, 15.9.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 147f.
Klaus Modick: Wo bleibt das Negative, Herr Gernhardt?
Frankfurter Rundschau, 11.10.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 148–151
Jakob Stephan: Lyrische Visite [6]
Neue Rundschau, Heft 4, 1997. S. 159–166
Dieter E. Zimmer: Der heiße Tag. Das Summen wilder Bienen
Die Zeit, 14.11.1997
Lutz Hagestedt: Licht-, luft- und geistdurchlässig
Süddeutsche Zeitung, 13./14.12.1997
Verteidigung des Gesprächs mit dem Wolf
Im Jahr 2001 war Robert Gernhardt die Poetik-Dozentur der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität übertragen. Zu den damit verbundenen Veranstaltungen gehört neben der öffentlich stets stark beachteten Poetik-Vorlesung auch ein Seminar, das Gernhardt in Form eines Lyriktribunals abhielt: Aus der Mitte des Seminars vorgeschlagene Gedichte wurden von jeweils einem Teilnehmer angeklagt und verteidigt. Das Urteil, das schließlich von allen gefällt wurde, konnte nur auf „Olymp“ oder „Orkus“ lauten. Vieles aus dieser Szenerie erinnert an Gernhardts Werk: Die Suche nach handfesten, ja handwerklichen Kriterien zur Beurteilung von Gedichten zieht sich wie ein roter Faden durch seine literaturtheoretische Schriften spätestens seit den 1990 erschienenen Gedanken zum Gedicht bis hin zu seiner Tätigkeit als „Lyrikwart“.1 Die Indienstnahme der Strafprozessualistik für die Beurteilung von Kunstwerken kennt man aus der Erzählung „1982 – Das Jahr der Kröte“,2 wo das Jüngste Gericht über den Ich-Erzähler gehalten wird. Dieser wird von einem Engel verteidigt und einem Teufel angeklagt, wobei vor allem sein – Gernhardts – Œuvre zur Debatte steht. Und so wie Strafgericht, Jüngstes Gericht und Lyriktribunal nur verurteilen oder freisprechen können, sieht sich Kunstschaffen bei Gernhardt oft dem Manichäismus des Hop-oder-Top ausgesetzt:
Es gibt in Leben wie in Kunst
nur Schrott und allererste Sahne.3
Oder noch drastischer:
Der Künstler geht auf dünnem Eis.
Erschafft er Kunst? Baut er nur Scheiß?4
Schließlich können der Logopheros aus Was bleibt5 und das überpersönliche Gericht aus „Der große und der kleine Dichter“6 die Werke nur der Ewigkeit erhalten oder dem Vergessen anheim geben. So zeigte die Einsetzung des Lyrik-Tribunals einmal mehr, wie sich Verfahrensweisen und Bilder bei Gernhardt nicht nur über die Zeiten und Gattungsgrenzen hinweg ausbreiten, sondern auch die Gräben zwischen Primär- und Sekundärliteratur,7 zwischen Praxis und Lehre, zwischen Spiel und Ernst leichtfüßig überspringen.
Ein Student machte Gernhardts Gedicht „Gespräch mit dem Wolf“8 zum Verfahrensgegenstand.
GESPRÄCH MIT DEM WOLF
Wo kommst du her?
Ich? Aus dem hohen Norden.
Wo gehst du hin?
Ich? In die tiefe Nacht.
Wen stellst du dar?
Ich? Bin ein Wolf geworden.
Wem stellst du nach?
Ich? Alles taugt zum Morden.
Wen frißt du auf?
Dich! Was hast du gedacht?
Gernhardt, der sich in Gedanken zum Gedicht nicht scheute, die handwerkliche Meßlatte auch an das eigene Gedicht („Pizzeria Europa“) anzulegen,9 hüllte sich bei dieser Verhandlung wie der Erzähler in „1982 – Das Jahr der Kröte“ in Schweigen. Um Anklagepunkte waren die Seminarteilnehmer nicht verlegen: Das Gedicht sei „nicht so knackig wie es hätte sein können“, die Pointe sei erwartbar und wahlweise zu lasch, zu bemüht, oder zu wenig subtil. Der wiederholte Zeilenanfang „Ich?“ nerve. Auch sei das Ausrufezeichen fehl am Platz, weil es die Lakonie im Part des Wolfs verwässere. Mit diesen Begründungen wurde das Gedicht vom Tribunal verworfen.10
Unterstellen wir die Berechtigung der Einwände und nehmen statt der Rolle des Richters die ohnehin recht ähnliche des Lyrikwarts ein, so ließe sich das Gedicht sehr einfach, nämlich durch reine Streichungen verbessern. Dafür, daß man mit fremden Gedichten so verfahren darf, berufen wir uns natürlich auf Robert Gernhardt.11
GESPRÄCH
Wo kommst du her?
Aus dem hohen Norden.
Wo gehst du hin?
In die tiefe Nacht.
Wen stellst du dar?
Bin ein Wolf geworden.
Wem stellst du nach?
Was hast du gedacht?
Auf den ersten Blick scheint es funktioniert zu haben. Die inkriminierten „Ich“-Fragen und das Ausrufezeichen sind eliminiert. Durch die Streichung der Zeilen 8 und 9 und die Kürzung der Überschrift kommt die Pointe überraschender und beschwingter. Auch ist das Gedicht auf einmal perfekt konstruiert. Die vier Antworten des Wolfs reimen sich nach dem Schema ABAB. Die Fragen des Menschen sind paarweise (aabb) durch je ein identisches Wort („Wo“, „stellst“) verbunden. Es ergibt sich in zwingender Kombinatorik: aAaBbAbB. Dreimal wechseln Frage und Antwort ab, die letzte Antwort auf die letzte Frage des Menschen hüllt sich in das Gewand einer rhetorischen Frage und setzt trotz des Fragezeichens gerade den Schlußpunkt. Als besonders kunstvoll erweisen sich die Kreuzreim-Antworten des Wolfs, die zugleich das Paarhafte der Fragen im Stabreim („Norden“ – „Nacht“, „geworden“ – „gedacht“) und zusätzlich im Gegensatzpaar „hoch“ – „tief“ widerspiegeln. All diese Strukturen fanden sich natürlich schon im ursprünglichen Gedicht, waren dort aber durch die nun gestrichenen Zeilen 8 und 9 etwas verunklart. Haben wir also Gernhardt verbessert?
Viel spricht dafür, daß der Mensch mit dem Wolf tatsächlich das „verbesserte“ Gespräch führen wollte. Abgesehen von den formalen Vorzügen läßt dieses Gespräch den Menschen gut aussehen. Dieser stellt die entscheidenden Fragen ohne Rücksicht darauf, ob die Antworten – wie die letzte – für ihn unangenehm sein können. Der Wolf, der die beiden ersten, harmlosen Fragen noch bereitwillig beantwortet, versucht den letzten beiden auszuweichen. Seine dritte Antwort „ Bin ein Wolf geworden“ klingt entschuldigend, so als ob er früher mal ein anderer gewesen sei und widrige Umstände dazu geführt hätten, daß er ausgerechnet die Rolle des Wolfs übernehmen mußte. Und auf die vierte Frage antwortet der Wolf sogar nur mit einer Gegenfrage. Er kneift davor, seine Absichten explizit darzulegen, und gesteht damit deren Unredlichkeit ein. Zwar setzt der Wolf damit die Schlußpointe. Aber der kluge und unbeirrbar sich der Realität stellende Mensch versteht – wie die Kritiker des Ausgangsgedichts – diese natürlich sofort. Er weiß um die Antwort, daß der Wolf ihm nachstellt, und kann mit dieser Wahrheit leben. Ob der Wolf Erfolg haben wird, steht dahin; jedenfalls kann er nach dem Gespräch nicht mehr hoffen, ein argloses Opfer zu überraschen. Dazu hätte er früher aufstehen müssen.
Ein schöner Plan des Menschen. Doch dann gibt der Wolf auf die erste Frage eine Erwiderung, die von der Erwartung des Menschen ein bißchen abweicht. Er fragt zunächst „Ich?“ und läßt sich erst dann zur Beantwortung der Frage herab. Welche Funktion hat dieses „Ich?“? Der Wolf hat doch keinen Anlaß zum Zweifel, daß er gemeint ist. Warum nervt das „Ich?“ so? Weil es jeder kennt, der einmal eine Schule besucht hat:
Wolf-Dieter, wer hat dir erlaubt, während des Unterrichts zu essen?
Wolf-Dieter entzieht sein Pausenbrot dem Blick des Lehrers und fragt mit vollem Mund:
Ich? Ich esse doch gar nicht.
Mit diesem scheinbar nichtssagenden „Ich?“ begeht der Wolf einen Stilbruch. So pennälerhaft redet keine ernst zu nehmende Metapher. Damit macht der Wolf auch den wahrheitssuchenden Menschen zum Pauker, der nur Fragen stellt, die er sich selber beantworten könnte, denn natürlich hat niemand Wolf-Dieter das Essen erlaubt.
Der Mensch unterschätzt die Relevanz dieser Planabweichung. Er hält das „Ich?“ für harmloses Geplänkel, solange der Wolf danach brav die vorausberechneten Antworten gibt. Ungerührt zieht er seinen Fragenkatalog durch. Den Effekt, daß der Wolf zunächst auf die Eingangsfragen offenherzig eingeht und ab der dritten Frage schlingert (was den Menschen als geschickten Frager ausgewiesen hätte), macht der Wolf damit zunichte, da immer schon das „Ich?“ sein schlechtes Gewissen holzschnitthaft betont.
Die ganze Tücke des „Ich?“ offenbart sich bei der vierten Frage „Wem stellst du nach?“. Was könnte der Wolf darauf antworten? „Ich? Was hast du gedacht?“ wären zwei rhetorische Fragen hintereinander. Die erste heuchelte – sattsam bekannt – Unschuld, die zweite würde als Schlußpointe gerade umgekehrt davon ausgehen, daß die Mordabsichten des Wolfs doch offen zu Tage liegen. Das wäre so, als würde Wolf-Dieter antworten: „Ich? Wer sollte das schon erlaubt haben?“ So selbstwidersprüchlich wird der animalische Wolf das Gespräch nicht beenden. Sollte der Wolf statt dessen „Dir! Was hast du gedacht?“ antworten, ließe auch dies den Menschen schlechter dastehen als die von ihm vorausgedachte Zeile. Denn nun bliebe dem Menschen nichts zum Auflösen übrig. Der Wolf sagt schlicht die Antwort und die abschließende rhetorische Frage erfüllt nur noch die Funktion, die Überflüssigkeit der Frage des Menschen zu dekuvrieren.
Aber es kommt noch schlimmer. Mit „Ich? Alles taugt zum Morden!“ offenbart der Wolf inhaltlich schon alles, trickst aber formal den Menschen mit einem klassischen Trugschluß aus. Er verweigert den erwarteten Kreuzreim und untergräbt den Konstruktionsplan des Menschen, indem er statt aAaBbAbB nun aAaBbAbA fortfährt. So kann der Mensch das Gespräch nicht enden lassen. Sein eigener Formwille zwingt ihn, noch einmal nachzuhaken. Doch wie, wenn doch alles geklärt ist? Ihm fällt nichts Besseres ein, als selber unter sein Niveau zu gehen: War die Frage „Wem stellst du nach?“ noch im hohen Stil gehalten und erlaubte in ihrer Abstraktion, im Wolf kein vierbeiniges Raubtier, sondern eine Bedrohung zu sehen, ist „Wen frißt du auf?“ an platter Eindeutigkeit nicht mehr zu überbieten. Der Mensch fügt sich in die Rolle des naiven Rotkäppchens, das auch wenn es eben gehört hat, daß die vermeintliche Großmutter mit den großen Händen sie besser packen kann, sich nicht vorzustellen vermag, wozu deren großer Mund da ist.
Damit ist die Bastion des Menschen sturmreif geschossen: Mit „Dich! Was hast du gedacht?“ nimmt der Wolf dem Menschen nicht nur die Beantwortung der rhetorischen Frage und damit die ehrenvolle Arbeit des Witzeverstehens ab (was er ja schon in Zeile 8 mit „Dir! Was hast du gedacht?“ hätte tun können), er setzt ihn inhaltlich und formal schachmatt: Inhaltlich, weil eben nicht mehr offenbleibt, ob seine Nachstellung von Erfolg gekrönt wird. Formal, weil mit aAaBbAbAcB der Mensch als Stümper dasteht, dessen fünfte Frage (Zeile 9) in der Luft hängt, während der Wolf seine fünf Zeilen gekonnt mit nur zwei Endreimen bestreitet. Außerdem hat er mit dem „Dich!“ (das in Zeile 8 noch nicht möglich gewesen wäre) elegant einen Anfangsreim hingelegt und damit dem so peinigenden „Ich?“ einen überraschenden Sinn gegeben. In der Notation von Schachspielen hat sich eingebürgert, gute Züge mit einem Ausrufezeichen, schwache mit einem Fragezeichen zu versehen. Spätestens damit rechtfertigt sich auch das beanstandete Ausrufezeichen.
Der Gesprächspartner, der alle Antworten seines Gegenüber vorausberechnet, bei scheinbar nebensächlichen Abweichungen dann von seinem so perfekten Plan nicht lassen kann und gerade deshalb Schiffbruch erleidet, ist ein komischer Archetyp. Gernhardt hat ihm in der ersten Geschichte der „Florestan-Fragmente“12 ein Denkmal gesetzt: Der Conte Ugo plant einen galanten Dialog, um die schöne Schäferin Beatrice zu verführen. Diese trägt jedoch wenig zum Fortgang des Gesprächs in die gewünschte Richtung bei, was Ugo dazu veranlaßt, seine geistreich ausgedachten Repliken auch ohne entsprechende Vorlagen – gewissermaßen präkoktisch – abzufeuern. Statt dessen erregt sie ihn nonverbal so sehr, daß ihm jegliche Souveränität abhanden kommt. Gernhardt erzeugt aber nicht nur mit Hilfe solcher Archetypen selber Komik, er referiert auf sie auch zur Kennzeichnung einer Situation. So erkennt Christian aus „Kornodo oder Erloschene Konten“,13 daß er in der uralten Komödie von Herrn und Knecht die undankbare Rolle des Herrn übernommen hat und leidet daran um so bewußter – freilich ohne an der Konstellation etwas ändern zu können.
Ähnlich zwangsläufig scheitert auch der Mensch in „Gespräch mit dem Wolf“. Die geniale Fortentwicklung des urkomischen Situationstopos liegt in seiner Erweiterung um das konstruktivistische Element. Wolf und Mensch reden und handeln nicht nur mit entgegengesetzten Interessen und unterschiedlichem Erfolg wie der Conte Ugo und Beatrice. Sie konkurrieren auch darum, wer den Bauplan des von ihnen gemeinsam verfaßten Gedichts bestimmt. Der Streit hierüber macht Form und Inhalt des Gedichts aus.
Die Pointe des Gedichts liegt also nur bei vordergründigster Sicht darin, daß der Mensch zum Schluß vom Wolf aufgefressen wird. Wenn überhaupt, wäre dies doch ein uralter Witz! Gernhardt führt einen Dialog zwischen dem Ordnung stiftenden Menschen und dem naturhaften Wolf auf. Der Mensch in seinem Streben nach einem perfekt gebauten Gedicht wie dem „verbesserten“ wird vom scheinbar chaotisch die Stil- und Reimregeln verletzenden Wolf aus dem Konzept gebracht und fällt seinem eigenen Konstruktionszwang zum Opfer. Der eigentliche Witz ergibt sich daraus, daß der Wolf trotz seines anarchisch anmutenden Spracheinsatzes im Endeffekt sinnfälliger, formenreicher und vor allem überraschender dichtet. Er hat sich neben dem Mittagessen auch die Dichterkrone redlich verdient.
Gernhardt kombiniert in konzentriertester Form märchenhaften Stoff mit archetypischer Situationskomik. Er inszeniert den Wettstreit zweier dichterischer Gestaltungskonzepte als Gegensatz zwischen Kultur und Natur mit einem waghalsigen, erfolgreichem Überholmanöver der Natur auf der Zielgeraden. Ganz nebenbei bringt er Form und Inhalt zu perfekter Deckung.
Hohes Weltgericht, das Urteil des Lyriktribunals Frankfurt am Main kann keinen Bestand haben. Ich beantrage dessen Aufhebung und die Aufnahme des Gedichts „Gespräch mit dem Wolf“ in den Olymp der Dichtkunst.
Johannes Möller, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, Fischer Taschenbuch Verlag, 2002
Der Zuckerguss der Komik
überdeckt den bitteren Kern der Pille
– Gespräch mit Robert Gernhardt – 15. April 1998. –
Daniel Lenz / Eric Pütz: Sie haben sich selbst einmal im „Restaurant zur deutschen Literatur“ die Position am Nebentisch oder im Bistro, keineswegs aber am Fenster zugewiesen. Würden Sie sich – nach Ihrem Anschlag auf Peter Handke in Ihrem Roman Ich Ich Ich – zu jemandem wie ihm an den Tisch setzen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?
Robert Gernhardt: Sicherlich würde ich mich mit ihm unterhalten, bloß ist Handke einer von denen, die gerade auf den Haupttisch zugesteuert sind. Insofern ist das nicht eine Frage, ob ich mich mit ihm an einen Tisch setzen würde, sondern eine Frage seiner Platzwahl. Handke hat immer eine hohe Meinung von sich gehabt. Schon sein erstes Auftreten in der Gruppe 47 machte Furore. Auf einmal wusste jeder von Handke. Keiner hatte etwas von ihm gelesen, aber alle erfuhren, dass da ein neuer Mann in der deutschen Literatur ist. Er ist sofort die Großen angegangen. So, wie Brecht zu seiner Zeit sich ausguckte: Wer ist der Größte? Natürlich Thomas Mann. Dem semmel ich jetzt verbal mal links und rechts eine rein. So ähnlich dann auch Handke, der zwar keine Namen nannte, aber den Konsens der Gruppe 47 aufkündigte. Zwar war seine Prosa, die Hornissen, ziemlich modisch, doch hatte er Erfolg beim Theater, etwa mit der Publikumsbeschimpfung. Seither ist er mit jeder Veröffentlichung ein umstrittener, auch gefeierter Autor geblieben. So ein Platz wird einem nicht zugewiesen von den Kellnern im Literaturrestaurant, den muss man sich ergattern oder ergaunern. Den hat er angestrebt und bekommen, hat allerdings viel dafür tun müssen: Das geht nicht ohne Selbststilisierung und Selbstbeweihräucherung. Ich wusste von vornherein, dass ich ganz anders gebacken war. Ich glaube, dass es die Möglichkeit derer am Nebentisch ist, die am Haupttisch sehr viel besser wahrzunehmen als umgekehrt. Ich glaube nicht, dass Handkes Wahrnehmung seiner Kollegen, seiner Branche sehr erkenntnisfördernd ist, weil er damit beschäftigt ist, seinen Platz zu verteidigen und sich an denen zu orientieren, die noch bessere Plätze haben. Derjenige aber, der sich bescheidet und sagt, da will ich gar nicht hin, ich bleib’ an der Bar und guck mal durch die offene Tür, was die an den Haupttischen da so machen, bekommt mehr mit und wird selber natürlich weniger wahrgenommen. Das muss man in Kauf nehmen, nimmt man auch gerne in Kauf.
Lenz / Pütz: Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Gernhardt: Ich habe nie geschrieben, um mich selbst zu finden oder mich meiner selbst zu vergewissern, jedenfalls als junger Mensch nicht. Dafür hatte ich die Malerei. Das war zunächst für mich das Gebiet, auf dem ich glaubte, meinen Weg gehen zu müssen. Schreiben war etwas für mich, was ich aus geselligen Gründen tat, um Mitschüler zu erfreuen, Lehrer zu leimen oder irgendwelche bunten Abende zu gestalten. So ging das los. Als ich dann zur Kunstakademie ging, habe ich das Schreiben zunächst weder betrieben noch vermisst. Doch dann traf ich in Berlin auf Fritz Weigle alias F.W. Bernstein, und als wir dann Germanistik als Beifach studierten, haben wir das, was wir dabei an Formen und Inhalten aufgriffen, durch den Wolf der Komik gedreht, um Distanz zu dem zu gewinnen, was wir uns tagsüber so anhören mussten. Das war aber nie Schreiben unter dem existentiellen Vorzeichen, und lange Zeit blieb es dabei. Bis Anfang der achtziger Jahre betrieb ich das Schreiben mit der Absicht, andere zu unterhalten sowie mich selbst zu unterhalten und zu unterhalten, im doppelten Sinne – also auch um Geld zu verdienen.
Lenz / Pütz: Der Feuilletonist Gustav Seibt hat Ihre Lebenserfahrungen seit Mitte der achtziger Jahre als die „eines bundesdeutschen Wohlstandsbürgers“ beschrieben, „dem seine eigene Welt recht suspekt war, der sich aber immer als ein Teil von ihr begriff.“ Das erinnert mich an eine Passage in Hesses Steppenwolf wo es heißt:
Die allermeisten Künstlermenschen bleiben an das schwere mütterliche Gestirn des Bürgertums gebannt. […] Nur die stärksten von ihnen durchstoßen die Atmosphäre der Bürgererde und gelangen ins Kosmische […] und gehen auf bewundernswerte Weise unter – sie sind die Tragischen. Den anderen aber steht ein drittes Reich offen, der Humor.
Könnte man so Ihre soziale Position festmachen: als die eines Grenzgängers, der das Bürgertum von innen ausleuchtet und sich dabei immer etwas abgrenzt?
Gernhardt: Der Begriff des Bürgerlichen hat lange Zeit genügt, um etwas abzuwerten oder ganz niederzumachen. Für die Boheme war der Bürger der Spießbürger, der nur in einer platten Welt des Erwerbs und des Wohlseins lebte. Für die Linken war der Bürger der Vertreter einer Klasse, die überwunden werden musste, weil ja erst, wenn das Bürgertum abgestorben war, die Diktatur des Proletariats zu ihrem Ziel kommen konnte. Ich selber habe als junger Mensch sehr genau jene Momente wahrgenommen, bei denen ich so etwas spürte wie einen instinktiven Widerstand gegen die Welt, die mich umgab. Ich wollte mir die Marschrichtung nicht vorschreiben lassen. Und ich erinnere mich daran, dass lange vor dem Abitur einer der stärksten Eindrücke das Gefühl war: Sie sollen mich nicht kriegen; wer immer auch „sie“ war oder waren: die Gesellschaft, die Familie, die Pfaffen, die Lehrer oder sonst wer. Was darauf folgte, ist schwer zu sagen: eine Fluchtbewegung, eine Anpassungsbewegung oder ein Prozess, bei dem ich lernte, mich in dieser vorgefundenen Welt zu bewegen und zugleich ihre Grenzen zu überschreiten?
Auf jeden Fall war es für mich ein wichtiger Schritt, nicht Lehrer zu werden, obwohl ich die Staatsexamen für Malerei und Germanistik gemacht habe. Damals fingen Weigle und ich dann verstärkt mit der Produktion von Komischem an, zuerst ohne daran zu denken, das Komische zu Geld zu machen. Da scheint ein wirklich existentielles Bedürfnis vorgelegen zu haben. Komik ist, glaube ich, Produkt eines gewissen Leidensdrucks, der sich nicht im Lamento, sondern im auftrumpfenden Lachen äußert. Mit Weigle bin ich dann zu Pardon gegangen, 1964 wurden wir Redakteure. Seitdem wir 1966 die Redaktion verlassen haben, bin ich freier Autor und Zeichner.
Lenz / Pütz: Würden Sie die Aussage unterschreiben, dass zwar eine Welt ohne Komik vorstellbar ist, jedoch keine Welt ohne den Ernst, da die Komik den Ernst, das Normative und Schickliche verarbeitet?
Gernhardt: Die Komik und der Nonsens schmarotzen natürlich beide vom Sinnbedürfnis der Menschen und von seiner Sinnproduktion an sich. Das wird immer so gewesen sein, schon in der Urhorde. Idealtypisch gedacht: Da wird ein Häuptling gewesen sein, der gesagt hat: Du machst dieses, du machst jenes. Dann wird da der Schamane gewesen sein, der den Leuten erklärt hat, warum sie dem Häuptling gehorchen müssen: Weil es doch noch einen Oberhäuptling gibt, der hinter den Wolken sitzt und dem Häuptling die Macht verliehen hat, stellvertretend Befehle zu geben. Und dann wird es einen gegeben haben, der den Häuptling sowie den Schamanen hinter deren Rücken nachgeäfft und veräppelt hat. Der Gruppenclown war naturgemäß nie der Erste, sondern immer der Dritte in dieser Reihe hinter König und Priester. Aber ohne diesen Clown hätten diese Gruppen nicht überlebt, glaube ich, bis auf den heutigen Tag nicht. Dauernden Ernst hält niemand aus. Man kann das Modell noch vereinfachen, dahingehend, dass es zwei Kasten gegeben hat, die es geschafft haben, die anderen für sich arbeiten zu lassen: die Krieger und Könige einerseits und die Priester und Künstler, die Intellektuellen andererseits. Deswegen sehe ich auch heute noch Zusammenhänge zwischen dem Gaukler und dem Priester. Ob da nun unter ernstem Vorzeichen gegaukelt wird oder unter lustigem, ist doch nur die Medaille mit den zwei Seiten. Bis auf den heutigen Tag muss ich über den Papst lachen, der sich einen hohen Hut aufsetzt, damit er größer ist als die anderen Menschen. Also wird auch der Narr sich irgendetwas Komisches auf den Kopf setzen, Eselsohren, eine Schelmenkappe oder ulkige Hüte.
Lenz / Pütz: Hat der Narr nicht immer das ernsthafte Vorbild im Hinterkopf?
Gernhardt: Ja, und hin und wieder treffen sich die beiden, der Narr und der Sinnstifter, sogar, etwa in der Gestalt des Künstlers. Shakespeare mit seinen Tragödien und seinen Komödien ist eine solche Synthese. Wenn man aber schematisch vorgeht, dann wird da erst einmal der Moses hergekommen sein, der die zehn Gebote verkündet hat. Und einer in der Menge der Zuhörer wird das elfte Gebot dazu gefaselt haben, etwa:
Du sollst nicht eher brechen, bevor du nicht auch was gesoffen hast.
Lenz / Pütz: Würden Sie zustimmen, dass ein Komiker bewusst eine unverbindliche Position einnimmt, eine geringe Angriffs- bzw. Kritikfläche ausstülpt, um sich rechtzeitig verstecken zu können?
Gernhardt: Nicht unverbindlich – unangreifbar. Mit Ironie, die eine wunderbare Möglichkeit eröffnet, seine Meinung zu sagen, ohne dafür haftbar gemacht werden zu können.
Lenz / Pütz: Kann man den Komikern zum Vorwurf machen, dass sie bewusst hinter der Ironie oder dem Witz ernste Anklänge verstecken, mit der Option, den Ernst immer wieder dementieren zu können?
Gernhardt: Da ist etwas dran. Aber zur Zeit wird manchmal so getan, als ob man sich vor Komikern gar nicht mehr retten könne. Wir leben, wird behauptet, in einer Spaßgesellschaft, wir lachen und amüsieren uns zu Tode. Die so reden, beziehen sich dabei immer nur auf ein Medium: das Fernsehen. Und da kann man ja aus- oder umschalten. Wenn ich es gerne ernst habe, kann ich mir im Fernsehen jeden Abend ein exquisites Ernstmenü zusammenstellen. Es gibt zwar eine Menge deutscher Comedy-Sendungen, aber man könnte genauso gut sagen, dass es zu viele Melodrame oder politische Informationssendungen gibt, mit dem Fazit: Wir informieren uns zu Tode. Oder: Wir weinen uns zu Tode. Oder: Wir denken uns zu Tode. Es gibt nur wenige genuin komische Talente. Und wenn dann jemand solch ein Talent hat, wie etwa Woody Allen, dann ist es doch ein Segen, dass der von seinem Ingmar-Bergmann-Trip runter ist. Woody Allen hat ja selbst immer wieder die schlechteste Meinung von der Komik geäußert: Sie sei ein Pappbecher, aus dem man trinkt und den man wieder wegwirft. Ich bin heilfroh, dass er sich eines Besseren besonnen hat. Ab seinem Film Deconstructing Harry ist er wieder groß in Form. Und auch in der deutschen Literatur kommt auf 100 Ernstmacher nur ein wirklich komischer Kopf. Den sollte man achten und bestätigen. Dem sollte man nicht sagen: Du traust dich im Grunde nicht, Ernst zu machen.
Lenz / Pütz: Dennoch funktioniert die Komik als ein Transportmedium?
Gernhardt: Natürlich, es gibt instrumentalisierte Komik. Sie ist beispielsweise das Transportmittel jedweder Satire. Satire ist Kritik, die nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern geäußert wird. Der Zuckerguss der Komik überdeckt den bitteren Kern der Pille. Zudem wird Komik in vielfältigster Form instrumentalisiert, nicht nur, um satirische Pillen besser rutschen zu lassen, sondern auch in der Werbung, um Produkte besser an den Mann zu bringen. Es gibt auch tendenzfreie Komik, etwa den Nonsens. Und dann gibt es sogar so etwas wie personengebundene Komik. Woody Allen, Tucholsky und Morgenstern sind unverwechselbar komisch. Komik ist nichts per se Wertvolles oder Wertloses, so wie der Ernst kein Wert oder Unwert für sich ist. Es kommt darauf an, was man aus der jeweiligen Haltung macht.
Lenz / Pütz: Sie weisen der Komik die Eigenschaft zu, einen Moment lang soziale Ordnungssysteme außer Kraft setzen zu können. Komik könne diese zwar nicht abschaffen, aber den Druck, der von ihnen ausgeht, durchaus mildern. Gibt es denn Momente, in denen die Komik diese lindernde Funktion für Sie selbst nicht mehr besitzt?
Gernhardt: Davon weiß ich ein sehr ernstes Liedlein zu singen. Ich habe erlebt, was nicht vielen Menschen widerfahren ist. Da ich über Jahre hauptamtlich Komikproduzent war, konnte mich die Komik nicht davor bewahren, abends in ein dunkles Loch zu fallen. Normalerweise verrichten die Menschen tagsüber ernste Arbeit und machen abends in der Kneipe Witze über ihren Chef. Witze über mein eigenes Metier aber konnte ich des Abends nicht mehr machen, weil es ja daraus bestand, tagsüber Witze zu machen. Gott sei Dank hatte ich aber noch die Malerei. Die betrieb ich mit großem Ernst und großer Hingabe. Auf meinen Bildern gab es überhaupt nichts zu lachen, nicht den Hauch einer Pointe. Das war meine Entlastung vom beruflichen Komikproduzieren. Über viele Jahre hatte ich Rubriken und ganze Seiten zu füllen, etwa elf Jahre „Welt im Spiegel“ in Pardon, viele Jahre „Hier spricht der Dichter“ im Zeitmagazin, „Gernhardts Erzählungen“ in Titanic, und als Letztes Zeichnungen im FAZ-Magazin zu Texten von Lichtenberg. Das habe ich immer gerne gemacht, weil ich wusste, dass nur kontinuierliches Produzieren die nötige Professionalität mit sich bringt. Zweitens sichert es den Lebensunterhalt, und drittens hat es zur Folge, dass man immer mehr abhaken kann: Weiß ich, weiß ich, was gibt es noch? So kann man die Möglichkeiten des Komischen erweitern und auf Sachen stoßen, die es in dieser Form nicht gegeben hat.
Lenz / Pütz: In Ihrem Buch Glück Glanz Ruhm erzählen Sie von einer äußerst nervenaufreibenden Dichterlesung vor einem Dutzend Zuschauern, bei der jemand dauernd mit einem Plastikbecher knackt und der Dichter eigentlich gar keine Lust mehr hat, weiterzulesen. Geht es Ihnen auch manchmal wie dem Böllschen Clown, der insgeheim todtraurig oder schlecht gelaunt ist, aber den Schein des Lachens bewahren muss?
Gernhardt: Diese Dämonisierung des Clowns und des Komischen teile ich nicht. Man weiß ja genau, worauf man sich einlässt. Ich muss ja nicht komisch sein auf einer Lesung. Ich kann schauen, dass ich eine einigermaßen unterhaltsame Auswahl von Texten zusammenstelle, aber wenn mir danach ist, kann ich die Leute auch mit Texten konfrontieren, die unpointiert sind und bei denen es nichts zu lachen gibt. Wenn ich den Band Lichte Gedichte vorstelle, dann sage ich den Leuten vorher: Es wird nicht immer etwas zu lachen geben. Das ist nicht Ihre Schuld, wenn Sie die Pointe nicht immer finden.
Lenz / Pütz: Ist es auch möglich, dass viele Komiker zunächst einen anderen Weg gegangen sind und sich an Ernstem versucht haben, daran aber gescheitert sind und so zur Komik gekommen sind?
Gernhardt: Da muss ich mal die von mir ein wenig erforschten Biografien der bekanntesten komischen Köpfe deutscher Zunge Revue passieren lassen. Lichtenberg plante einen Roman, der aber sicherlich satirisch geworden wäre. Er hat es nicht zu dieser großen Form gebracht, sich aber dann in seinen Sudelbüchern ein bleibendes Denkmal geschaffen. Ich glaube nicht, dass Lichtenberg ein verhinderter ernster Schriftsteller war. Heine war immer zweigleisig, wenn ich das richtig sehe. Das Buch der Lieder hat komische und ernste Momente wie die „Nordsee“. Wilhelm Busch wollte ernster Maler werden wie ich. Ernster Schriftsteller wollte er nie werden, also ist er auch kein verhinderter ernster Schriftsteller. Tucholsky hat gleich angefangen mit Rheinsberg, man weiß bei ihm nichts von verhinderten ernsten Geschichten. Kästner hat nicht als ernster Schriftsteller angefangen, sondern gleich mit komischen Gedichten. Auch seine Kinderbücher haben viele komische Momente. Ich glaube nicht, dass die These stimmt, dass die Spaßmacher ursprünglich ernst sein wollten und dann ins komische Fach gegangen sind, zumindest im deutschen Sprachraum nicht. Aber es gibt eine andere Entwicklung, die einige Expressionisten wie Hasenclever oder Werfel betrifft, die angefangen haben mit solchen Vatermord-Geschichten und später als Lustspielautoren geendet sind. Am Anfang ging das los mit „Oh Mensch“, und es endet mit „Jakobowsky und der Oberst“,
Lenz / Pütz: Muss ein Lyriker, der sich nicht den Zwängen des Reims unterwirft, inhaltlich weitaus mehr bieten als der reimende Dichter?
Gernhardt: Reim oder nicht Reim, das ist für mich keine Frage. Reimlosigkeit ist keine Errungenschaft der Moderne. Ein Großteil der klassischen deutschen Dichtung ist ungereimt, der ganze Klopstock etwa. Für Goethe aber war das nie ein Thema, weil der mit tausend Zungen reden konnte, im Volkslied-Ton ebenso wie in klassischen Metren. Ich höre im Moment morgens auf dem Ergo-Bike „Hermann und Dorothea“, was mir einen Riesenspaß macht, weil die Fallhöhe zwischen Hexameter und bürgerlichem Epos sehr hoch ist. Bei reimlosen wie bei gereimten Gedichten gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Der Reim selber ist nicht so schwierig, man muss zwar ein gewisses Talent mitbringen, aber man kann ja auch mit dem Steputat arbeiten, dem Reimlexikon. Ich habe das nie getan. Einige Rapper tun es und delegieren den Sinn dann ganz und gar an das Reimlexikon. Man kann reimlos oder gereimt sinnvolle oder sinnlose Gebilde zusammenbringen. Ich habe in den letzten Jahren zwei Zyklen geschrieben, den einen im Krankenhaus, der dann in Lichte Gedichte eingegangen ist: „Herz in Not“. Das sind reimlose Eintragungen. Aber da ich die Form brauche, habe ich mir selber die Regel auferlegt, dass jede Mitteilung siebenzeilig sein soll, sechs Zeilen davon zweihebig und die letzte Zeile zwei- bis dreihebig. Der andere Zyklus heißt „Würstchen im Schlafrock“ und steht im Klappaltar. Den habe ich innerhalb von zwei Wochen niedergeschrieben, insgesamt 90 Gedichte. Das fing ganz harmlos an. Ich wollte mich bloß ein wenig im Ton des reifen Goethe versuchen. Am 18. September habe ich drei Gedichte gemacht, am 19. September waren es schon sechs. Und so fortan. Dann setzte ich mir ein zeitliches Limit und sagte mir, ich tue mal so, als ob ich mir für zwei Wochen den Schlafrock des alten Goethe aus dem Kostümverleih der deutschen Literatur ausgeliehen habe:
Dichten meint Vermummen, reicht mir
jenen Rock und diese Züge,
für zwei Wochen, ich will durch sie
sprechen,
zeiht mich nicht der Lüge.
Wer da spricht, ist noch ich selber,
was er spricht ist ungeschöntes
Leben maskenhaft vermittelt,
bin ja selbst gespannt, wie tönt es.
So geht das Ganze los. Und endet damit, dass am 1. Oktober um 20 Uhr der Kostümverleih mahnt. Er will den Rock wieder zurückhaben:
Bist im Weimaraner Schlafrock
lang genug herum stolzieret,
Würstchen, leg ihn ab, ich seh doch,
wie’s dich trotz der Maske frieret.
Spür’s, nicht wärmt mehr das Geschlotter,
nun versprechen bessere Hitze,
gutes Essen, holde Eintracht,
alter Wein und neue Witze.
Dazwischen also 90 Gedichte. Zusammengehalten von einer ganz klaren Form. Vierzeiler, aber nicht wie meist bei Goethe kreuzgereimt, sondern einfach gereimt, a-b-c-b. Die Erfahrungen, die ich bei solchen reimlosen und gereimten Eintragungen gemacht habe, ist die, dass es wichtig ist, dass die Mitteilungen irgendetwas Triftiges bekommen. Das Gedicht als kurze Mitteilung muss besonders darauf achten, dass es plausibel ist: Warum erzähle ich das alles überhaupt? Das ist wie beim Unterschied zwischen Brief und Telegramm: Wenn ich ein Telegramm schicke, muss ich wirklich etwas zu sagen haben. Das Gedicht ist verglichen mit dem Roman ein Telegramm. Der Dichter muss klarmachen, warum er den Leser überhaupt mit einer solch kurzen Mitteilung belästigt. Der Epiker hat es da einfacher: Wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen.
Lenz / Pütz: Wir haben einige Gedichte gefunden, die zweifellos betroffen machen. Zum Beispiel haben Sie ein Gedicht geschrieben, das „Nach der Lektüre einer Anthologie“ heißt. Ein Ausschnitt daraus lautet:
Diesen Pissfleck am Fuß der Rolltreppe der U-Bahn-Station Miquel-Adickes-Allee,
Vor Augen gedenk ich der Stimmen
die heut zu mir sprachen, so
drucklos, so dranglos, so
schwunglos, so harmlos, so
bisslos, so zwanglos, so
harnlos, so hirnlos.
Würden Sie diesen Zustand als symptomatisch für die junge deutsche Lyrik bezeichnen?
Gernhardt: Die Anthologie, auf die ich mich da beziehe, ist im Hanser-Verlag erschienen und versammelt Lyrik der 1980er Jahre. Da fand sich eine Reihe von Dichtern, deren Attitüde ich mit dem Begriff „mürrisches Parlando“ zu klassifizieren versuchte. Die sind alle nicht so ganz einverstanden mit dem Leben und ihrer Situation darin, finden dafür aber keine grellen oder wie auch immer gearteten verstörenden Bilder, sondern klagen moderat vor sich hin. Es wäre ungerecht, jetzt Namen zu nennen. Diese Dichter sind einander so ähnlich, dass man ihre Gedichtzeilen austauschen oder zu neuen Gebilden montieren könnte, ohne zu merken, wo der eine anfängt und die andere aufhört. Das könnte man mit einem Gedicht von Rilke, Benn oder Rühmkorf nicht machen. Die haben einen sehr eigenen Sound, und das halte ich auch für eine Leistung dieser Dichter, so skeptisch ich auch manchmal dem Rilke oder dem Benn gegenüberstehe. Dieses Gedicht über die Anthologie meint also: Traut euch mehr, stimmt etwas kräftigere Gesänge an, nicht so harmlose.
Lenz / Pütz: Das wäre also Ihr Appell, den Sie an die deutschen Lyriker richten?
Gernhardt: Ja, und an mich selber auch.
Lenz / Pütz: Oder ist das vielleicht sogar eine Frage der deutschen Mentalität, auch wenn das schon ein Stereotyp zu sein scheint?
Gernhardt: Mir ist mittlerweile der Gegensatz zwischen komisch und ernst nicht mehr so wichtig wie der zwischen suggestiv und nicht-suggestiv. Das hat auch Schiller schon gesagt, dass das Gedicht den Leuten als Offenbarung oder Gespenst erscheinen soll. Es soll sie auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise beunruhigen oder beeindrucken. Und das gibt es ja Gott sei Dank immer noch, sowohl ernste wie auch komische Gedichte, die einen aus der Ruhe bringen, vielleicht sogar zum Lachen, auch ein bewegter Zustand.
Unlängst las ich in der „Frankfurter Anthologie“ der FAZ ein gewaltiges Gedicht von Christine Lavant. Es geht um eine Hündin, der das Kreuz zertreten worden ist, und um Gott, den das nicht kümmert, ein unglaublich starkes Gedicht. Ich glaube, dass kein fühlender Mensch, der das zu Augen bekommt, das Gedicht unbewegt lesen kann. Solche Gedichte gibt es. Das sind zwar Sternstunden, aber man muss darauf hinarbeiten, dass die sich hin und wieder ereignen: Gedichte außerhalb des halbwegs normalen Räsonierens.
Lenz / Pütz: In Lichte Gedichte haben Sie sich ausführlich mit dem Tod beschäftigt, der in einigen Ihrer Gedichte ja auch persönlich auftritt. Brecht hat in einem Gedicht ein Epigramm für den eigenen Grabstein vorgeschlagen:
Er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie angenommen.
Was würden Sie sich für Ihren Grabstein wünschen?
Gernhardt: Brecht hat sich immer wieder Gedanken zu seiner Grabinschrift gemacht. In einem seiner anderen Gedichte heißt es, sie solle lauten:
Rein, Sachlich. Böse.
Ich selbst habe mir die Gedanken nie gemacht. Brecht war seit seiner Kindheit herzkrank. Vielleicht hat man dann ständig das Gefühl, man könnte abberufen werden. Für mich kam meine Herzoperation sehr überraschend und in reifen Jahren. Die habe ich nicht als tödliche Bedrohung, sondern als Prüfung empfunden.
Lenz / Pütz: Schon vor mehr als zwanzig Jahren haben Sie einmal gesagt:
Ich leide an Versagensangst, besonders, wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zuschande.
In Ihrem Gedicht „Der Dichtere führen Sie aus:
Ich seh mich schon im Grabe, wenn ich nichts zu dichten habe.
Haben Sie dann Angst davor, dass Ihre Sprache eines Tages leer ist und nichts Überraschendes mehr produziert?
Gernhardt: Nein, ich habe nicht die geringste Angst davor, dass irgendwann etwas leer wäre. Ich lasse mich überraschen, im Zweifelsfall kann ich immer noch einen fremden Tonfall aufgreifen oder die Gedichte anderer verbessern oder veralbern. Außerdem kann ich ja auch wieder zum Bild zurückkehren.
Lenz / Pütz: Ist es denn nicht gerade beim Dichten ernüchternd, wenn man immer wieder auf dieselben Reimwörter stößt?
Gernhardt: Überhaupt nicht, weil es ja auch immer wieder neue Kombinationen gibt. Mein Gedicht „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ zum Beispiel enthält einen Reim, den ich zuvor noch nicht gelesen habe:
Dich will ich loben: Hässliches,
du hast so was Verlässliches.
Dann aber:
Das Schöne schwindet, scheidet, flieht –
fast tut es weh, wenn man es sieht.
Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit,
und Zeit meint stets: Bald ist’s soweit.
Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer.
Das Hässliche erfreut durch Dauer.
Bis auf das erste Reimpaar sind das alles Reimworte, die auf der Hand liegen. Bloß ist dieser Zusammenhang noch nicht hergestellt worden. Warum sollen Reimwörter ausgefallen sein? Auch die Worte an sich sind in der Regel bekannt, und es geht nur darum, wie sie neu zusammengefügt werden. Morgenstern hat mal ein schönes Gedicht geschrieben:
Ohne Wort, ohne Wort,
fließt das Wasser immer fort.
Andernfalls, andernfalls
spräche es auch nichts anderes als
Brot und Bier und lieb und treu,
und das wäre auch nicht neu.
Dieses zeigt, dieses zeigt,
dass das Wasser besser schweigt.
Alles bekannte Worte, bloß hat Morgenstern daraus etwas Neues zum alten Thema „Es gibt nichts Neues“ gemacht. Gerade wenn man mit Sprache viel und oft arbeitet, dann freut man sich über ganz minimalistische Verrückungen, die etwas unerwartet Neues herstellen:
Alles geht natürlich zu, nur meine Hose geht natürlich nicht zu.
Finder und Erfinder: Heinz Erhardt.
Daniel Lenz / Eric Pütz: LebensBeschreibungen. Zwanzig Gespräche mit Schriftstellern. Edition text + kritik. 2000
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.


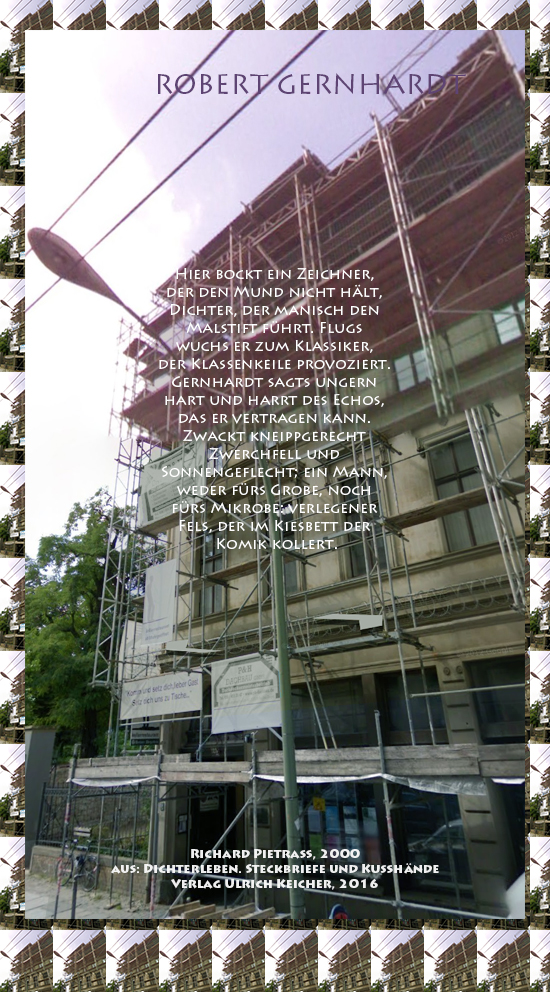












Schreibe einen Kommentar