XXV.
Auf der Nase trug er die Welt
und drehte sie so oder so herum.
Er dreht so oder anders das Ding,
ihm waren Symbol und Robe zu dumm.
Düster wie Fichten, ohnen einen Ton
schlichen flüssige Katzen durchs Gras.
Sie merkten gar nichts von der Rotation.
Die Katzen warfen Katzen, grau war das Gras.
Und die Welt warf Welten, niemand wußte was,
das Gras wurde grün, grau wurde das Gras.
Die Nase, die ist ewig, immer so herum.
Wie es ist, so war es, so wie es ist,
so wie es sein wird, ziemlich einerlei,
und ein dicker Daumen schlägt sein Ei-jei-jei.
Nachdichtung von Hans Magnus Enzensberger
XXV.
Er trug die Welt auf der Nase
Und kreiselte sie so herum.
Seine Gewänder und Symbole, ai-yi-yi −
Und wirbelte das Ding anders herum.
Düster wie Fichten bewegten sich
Fließende Katzen ohne Ton durchs Gras.
Sie wußten nicht, daß das Gras sich drehte.
Die Katzen hatten Katzen, und das Gras wurde grau,
Und die Welt hatte Welten, ei, so herum:
Das Gras wurde grün, das Gras wurde grau.
Und die Nase ist ewig, anders herum.
Dinge, wie sie waren, Dinge, wie sie sind,
Dinge, wie sie mit der Zeit sein werden…
Ein dicker Daumen schlägt ai-yi-yi.
Interlinearübersetzung von Karin Graf
![]()
Picassos berühmtes Bild
Der alte Gitarrenspieler aus der Blauen Periode inspirierte den amerikanischen Lyriker Wallace Stevens (1879–1955) zu einem seiner schönsten Gedichtzyklen. Karin Graf und Hans Magnus Enzensberger haben die dreiunddreißig Gedichte die Stevens 1937 unter dem Titel The Man with the Blue Guitar veröffentlichte, jetzt erstmals vollständig ins Deutsche übertragen.
Wallace Stevens, der heute neben Ezra Pound und William Carlos Williams zu den bedeutendsten amerikanischen Dichtern des 20. Jahrhunderts zählt, ist bei uns noch weitgehend zu entdecken. Auch im eigenen Land galt er lange als eher schwierig, als Geheimtip für Eingeweihte, bevor er spät in seinem Leben hochberühmt und zu einem der „major poets“ der amerikanischen Literatur wurde. In seiner bürgerlichen Existenz Jurist und Vorstandmitglied einer großen Versicherungsgesellschaft in Connecticut, schuf er sein lyrisches Werk in der Zurückgezogenheit eines stillen, ganz unspektakulären Privatlebens, fernab des literarischen Betriebs. Er war bereits vierundvierzig Jahre alt, als er seinen ersten Gedichtband, dem acht weitere folgen sollten, publizierte.
Das zentrale Thema von Wallace Stevens’ Dichtung ist das Verhältnis von Realität und menschlicher Einbildungskraft. Phantasie und „Imagination“ waren für ihn Schlüsselworte, die entscheidenden Orientierungsinstanzen für den Geist in einem Zeitalter ohne Mythen und Religion. „Mit der Blauen Gitarre“, schrieb Stevens im Klappentext der Erstausgabe, „wollte ich ein paar Dinge sagen, die zu sagen es mich drängte: 1. über die Wirklichkeit, 2. über die Imagination, 3. ihre Beziehungen zueinander und 4. meine grundsätzliche Haltung zu jedem einzelnen dieser vier Punkte…“ Und seine grundsätzliche Haltung hat ihren Ursprung in der Überzeugung, daß jeder Mensch mit Imagination ein Dichter sei.
Die Übertragung des formal einfachen, sprachlich und gedanklich aber sehr komplexen Gedichtzyklus stellte seine Übersetzer vor eine fast unlösbare Aufgabe. Sie entschieden sich schließlich für eine zweifache Annäherung an das Original und stellen in unserer englisch/deutschen Ausgabe den Versen von Wallace Stevens eine poetische Übertragung gegenüber, die dem Rhythmus soweit wie möglich nahekommt, und eine sogenannte Interlinearversion, die so genau wie möglich den Wortlaut wiedergibt und mit Anmerkungen versehen ist, die Stevens seinerzeit dem italienischen Übersetzer von The Man with the Blue Guitar zukommen ließ.
Schirmer/Mosel, Klappentext, 1995
Freund Luft
− Die dunklen Verse des Wallace Steven. −
Wallace Stevens ist der wohl Stillste im Land der amerikanischen Poesie. Anders als Ezra Pound hat er nie öffentlichen Lärm erregt; ja, er hat, abgesehen von zwei Kuba-Reisen, nie auch nur die Vereinigten Staaten verlassen. Seine Laufbahn war bürgerlich: In einer Versicherungsanstalt in Hartford, Connecticut, stieg er vom Anwalt zum Vizepräsidenten auf; ein Amt, das er bis zu seinem Tod 1955 innehatte. Daß der beleibte Herr mit dem holländischen Bauerngesicht Poet war, dürfte Geschäftspartnern verborgen geblieben sein. So lebte Stevens das perfekte Doppelleben, das wir von Gottfried Benn kennen. Man denkt an Benns Buddha-Gesicht hinter dem Bierglas, wenn Stevens den Dichter als den „Einsiedler“ definiert, „der allein mit Sonne und Mond lebt, aber darauf besteht, daß er seine lausige Zeitung kriegt“.
Bald nach Stevens’ Tod begannen sich deutsche Übersetzer mit seiner Lyrik zu befassen. Zu ersten Proben von Herta Elisabeth und Walther Killy, 1959, gesellten sich Übertragungen von Eva Hesse, Hans Magnus Enzensberger, Alfred Margul-Sperber, Friedhelm Kemp und anderen. So trifft Der Mann mit der blauen Gitarre auf kein unvorbereitetes Publikum. Namentlich wer die Auswahl Der Planet auf dem Tisch kennt, die 1961 und (überarbeitet) 1983 erschien, der hat bereits ein gewisses Bild, besonders dank des einfühlsamen Nachwortes, das der Übersetzer Kurt Heinrich Hansen verfaßt hat. Es zeichnet das Bild eines Dichters, dem die physische Welt alles, ein Ideen-Jenseits oder ein Sich-Verlieren an die Erinnerung jedoch nichts gilt.
Aber das Diesseits ist ihm nicht als rein Faktisches etwas wert, sondern als plötzlich sprechend, wie von innen heraus sich beseelend in der Glücksminute einer jäh umfassenden Ordnung. Es ist, mit Benn zu reden, die Erlösung der Welt in die Ausdruckswelt, in welcher sich das Chaos auf einmal schlichtet; und da es der Mensch ist, durch den hindurch sich das Chaos zum Ausdruck „aufstemmt“, ist – auch für Stevens – der Mensch Krone der Schöpfung. Der Mensch freilich als Künstler – wie jenes Mädchen, das in „The Idea of Order at Key West“ an der Meeresküste sein eigenes Lied aus sich hervorströmt.
Zwischen Ideas of Order, 1936, und The Man with the Blue Guitar, 1937, liegt Stevens’ radikaler Stilwandel zum Modernen, als welcher der Dichter geschätzt wird. Schon die Proben in Hansens Auswahl provozierten die Frage, ob solcher Umbruch nicht halb auch zu beklagen ist. Bei der Härtung ist der Schmelz auf der Strecke geblieben. Wie soll sich je zum Gedicht runden, was – bei Hansen – so beginnt:
Ist dieses Bild von Picasso, diese ,Anhäufung
Von Zerstörtem‘, ein Bild unserer selbst,
Ein Bild, vielleicht, unserer Gesellschaft?
Weder Karin Graf noch Enzensberger können der rhetorischen Frage mehr Poesie abgewinnen. Es ist die Frage eines Dozenten – Zauberwort, bei dem die Welt anhebt zu klingen, ist es nicht.
Die Lektüre des ganzen Zyklus, begleitet von Interlinear- und poetischer Eindeutschung, läßt nun den Mann mit der blauen Gitarre als ein widersprüchliches Gebilde erkennen: den Versuch eines Diskurses mit nicht-diskursiven Mitteln. Die „blue guitar“ eines Bildes aus Picassos blauer Periode steht als Zentralmetapher des dreiunddreißigteiligen Lehrgedichts für die Ausdruckswelt, die Imagination, das Poem. Tastend, auf labyrinthischer Bahn und in stammelnder Ausdrucksnot führt uns der Dichter einem Zentrum entgegen, das er mehr verhüllt als offenbart; und man muß hier – mit dem Stevens-Forscher Klaus Martens zu reden – schon eine gewisse „Frustrationstoleranz“ aufbringen. Zumal der Oberflächenreiz von Stevens’ Versen gering ist: Die Gedankenfracht behindert die Kristallisation zur Lyrik nicht minder als der Lyrismus die Verständlichkeit. Daß solch kryptische Poetik noch immer die Ideas of Order umkreist, wird aus den Briefkommentaren deutlich, die Karin Graf ihrer Rohübersetzung beigibt:
Ich will als Dichter in der Natur das sein, was das Wesen der Natur ausmacht.
Diese Fußnoten hätte Enzensberger besser eingehend studiert, als (in „Canto XX“) zu übersetzen:
Was zählt im Leben jenseits der Ideen,
die gute Luft, der gute Freund, was sonst?
Mitnichten nämlich schickt Stevens seiner Frage eine Antwort, gar eine schnippische, hinterher. Er „spreche die Luft an und nenne sie Freund“, kommentiert Stevens. Wenn schon fünf-statt vierhebig, dann also wohl eher so:
du gute Luft, mein guter Freund; was zählt?
Ärger noch verfehlt Enzensberger den komplexen Begriff der „absence“, den Stevens mit Paul Valéry gemein hat. Anwesenheit und Abwesenheit des Geistes in der Natur hängen gezeitenartig zusammen. Kehrt das „Gedicht“ in die „Dichtung“ zurück wie bei Ebbe das Wasser ins Meer, so kommt es zu einer „absence in reality, / Things as they are“. Das heißt, dann bleiben die „Dinge, wie sie sind“, übrig – unverklärt, aber gerade dadurch den Geist befähigend, sich wieder mit ihren wahren Erscheinungen (true appearances) aufzuladen und flutartig in die Welt zurückzuströmen. Das etwa will „Canto XXII“ sagen. Enzensberger mißversteht die „absence in“ als „absence of reality“ und läßt diese mit dem Schwuppdiwupp eines Taschenspielertricks verschwinden: „Das was das ist, / ist nicht mehr da. So heißt es.“
Nicht nur Verkehrungen des Sinns muß man Enzensbergers „poetischer Fassung“ vorwerfen, unnötig sind auch seine Verfehlungen der Form. Was ist poetisch an einer Fassung, die „The flesh, the bone, the dirt, the stone“ zu „Fleisch, Knochen, Dreck und Stein“ verkürzt? Da kommt ja die Interlinearversion sowohl dem Wortlauf als auch dem Versmaß des Originals näher: „Das Fleisch, der Knochen, der Dreck, der Stein“. Unschwer hätte Karin Graf hier noch den Binnenreim retten können:
Das Fleisch, das Bein, der Dreck, der Stein.
Dunkles, mehr philosophisch als poetisch lohnendes Kunstwerk, entstellend statt erhellend übersetzt und zusätzlich durch Druckfehler verdunkelt wie „grass“ statt „glass“. Immerhin: Die durchdachte Direktversion und der Selbstkommentar führen uns dem Werk näher und könnten zur Basis getreuerer Annäherungsbemühungen werden.
Ernst-Jürgen Dreyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.10.1995
Jemand baut eine Welt zusammen: Wallace Stevens
I
„Die Geschichte der amerikanischen Lyrik ist die Geschichte einer Suche nach der Disziplin, die von dem eigenen Selbstverständnis als Person autorisiert worden ist, als Person, die ganz in der Welt lebt, und doch sich vorstellen kann, wie es wäre, wenn man fern von ihr lebte“ (Roy Harvey Pearce). Die Lyrik als die Disziplin, die ein amerikanischer Dichter sucht, ist der Ausdruck der Person, ja die Person des Dichters selbst, seine Selbstverwirklichung zugleich trotz und doch in der Außenwelt. Die Frage, was es bedeute, als Dichter in den USA zu leben, ist bekanntermaßen mindestens seit Cooper als Leben mit und in einem Defizit beantwortet worden. Das Schreiben in diesem kulturellen Defizit stellt sich notorisch als ein Schreiben gegen die vorgefundene Kultursituation dar. Das Geschriebene soll einen Notzustand beheben, möglichst ersetzen oder umwerten. Der amerikanische Autor autorisiert sich selbst als Urheber und Repräsentant einer persönlichen Utopie, einer Gegenwelt zu der amerikanischen Welt, in der er lebt. Die Alternative dazu, wie sie u.a. von Henry James und T.S. Eliot gelebt wurde, sucht sich räumliche Distanz zum Amerikanischen und sucht Einbindung in (z.B. europäische) Kulturtradition. Man ist auf Distanz gegangen. Wie erreicht man zuhause, in den U.S.A., Distanz zu Zuhause? Man nimmt teil, integriert sich zum Teil, erzeugt statt Distanz Kontraste. Man abstrahiert, verwertet, wertet um.
Der Dichter, der zwischen Zigarrenläden geht,
Ryans Lunch, Hutmachern, Versicherungen und Medikamenten,
Verneint, daß Abstraktion ein Laster ist,
Es sei denn für die Abgestumpften
… Ein Mann, die menschliche Idee, das ist der Raum,
Die wahre Abstraktion, in der er geht.
Die Lösung ist Solipsismus, inneres Exil als innere Welt. Man bittet um Entlassung aus der kollektiven Identität. Man läßt sich ein auf das eigene Selbst, um Realität zu finden, Selbst zu realisieren. Dies ist die existentielle Lösung in Amerika längst vor Emerson, amerikanisch seit Whitman, die kaum hinausgingen, sondern alles in sich zu versammeln suchten. Steven schreibt: „Im fernen Süden zieht die Herbstsonne / Wie Walt Whitman an rosiger Küste entlang. / Er singt und ruft die Dinge, die Teil von ihm sind“. Teil von ihm, das heißt: durch ihn verwandelt. Er ist die Welt, in der er geht. Er macht die Welt, er macht sich, er macht sich zur Welt. Aber das ist nur eine Seite. Es ist nicht die Seite des allumarmenden Sängers, des sich volkstümlich gebenden Barden mit der Laute. Wallace Stevens Instrument, seine „blaue Gitarre“, sein „Harmonium“, ist die Imagination als aktive, informierende, suchende Kraft. Das Gedicht für Stevens ist selten fertiges Produkt der Imagination. Das Wort imagination ist bei Stevens austauschbar mit dem Wort mind = „Geist, Verstand“ usw. The poem of the mind in the act of finding, das Gedicht als Akt oder Vorgang einer Suche, diese berühmte Zeile Stevens’ (aus dem Gedicht „Of Modern Poetry“), weist auf das Gedicht als Prozeß, als explorativen gedanklichen Akt, als Sprache in der Sprache. Das meditative Gedicht ist Glied in einer Kette von sprachlich-gedanklichen Akten, die nicht kumulieren, die sich zwar aufeinander beziehen, aber sich widersprechen können, ja müssen. „Der Dichter schreibt nicht das Gedicht, wie es war, / Sondern das Gedicht, wie es ist“. Und: „Das Gedicht ist der Schrei seines Anlasses“, Äußerung der Situation, Äußerung des Objekts. Dies ist die Utopie des Gegenstands. Es ist die Utopie vom Gedicht als Welt, der Welt als Gedicht, die beide im Wandel und in der Kontinuität des Dichterlebens als Möglichkeitsform ausgedrückt sind. Die persönliche Utopie, das ist das größte Projekt für den amerikanischen Dichter Stevens in Amerika. Es ist, da nichts vorgegeben ist, außer dem, was nur ist, das klassisch amerikanische Dilemma für den Dichter: die Selbst-Erfindung des Dichters, self-made-man. Die Betonung liegt auf allen drei Bestandteilen des Kompositums: Selbst, Mann/Mensch, Machen und den Kombinationen dieser Komponenten. Eine Symbolfigur für Urheber und Produkt ist Stevens’ Emperor of Ice-Cream, der Meister, der aus Wasser, Farben und Kälte köstlichvergängliche Formen schafft, die zugleich seine vergänglichem Inkarnationen sind.
II
Die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren durch die Abkehr von der Romantik bestimmt. Es war eine Abkehr, die umso vehementer sein mußte, als das Romantische mit dem Süßlichen, Sentimentalen, Ornamentalen gleichbedeutend schien. Das synechdochische Tasten nach einem diffusen Absoluten sollte, so T.E. Hulme, einem festen, harten, klaren Ausdruck weichen. Imagismus, Objektivismus, Pound, Eliot, Williams waren die Folgen. Diese Amerikaner waren, auf Umwegen, genauso wie Stevens auf ihre Art auf dem Wege Emersons, dem es darum ging, „eine Originalbeziehung zum Universum“ herzustellen, das Unbekannte zu testen, auf Entdeckung auszugehen. Stevens’ Ziel war das gleiche, der Weg ein anderer. Stevens war Ästhet, Hedonist, war SprachverIiebter, und nahm zunächst den Umweg über die französischen Symbolisten, die ja ihrerseits und auf ihre Weise die amerikanische Tradition aus Poe entlehnt hatten. Es war eine Frage der gewählten Routen zum Ziel, des gemeinsamen Projekts der Perzeptions- und Sprachentschlackung. Man wollte sich ins Reine schreiben. Der gewählte dichterische Weg war jeweils eng mit dem gewählten Lebensweg verbunden.
WaIIace Stevens wurde 1879 in Reading, Pennsylvania geboren. Sein Vater, Rechtsanwalt, gehörte einer Gruppe von Pennsylvania Dutchmen an, die, wie es für gebildete Leute ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich war, schon mal bei Feiern auf dem Mt. Penn (dem Mt. Judge John Updikes) Gedichte auf Dutch rezitierten, einiges veröffentlichten. Man war lebensfreudig, aber wahrte die Form; man hatte sich selbst gemacht, und man hielt auf sich. Wallace Stevens besuchte Harvard etwa zur gleichen Zeit wie Frost und Eliot. George Santayana, der Philosoph, war damals Poet, Lehrer und älterer Freund. Erste Gedichte erschienen unter Pseudonymen im Harvard Advocate. Das Studium wurde nach drei Jahren abgebrochen. Stevens versuchte sich als Reporter in New York, studierte dort Jura, wurde als Rechtsanwalt zugelassen, spezialisierte sich auf Versicherungsfragen. Er war introvertiert, besaß einen skurrilen Humor, war gelegentlich frostig. Er war kein Anwalt, der in einer freien Praxis jovial kommunizierend überlebt hätte. Er war Hedonist und zugleich militant privat. Trockenbrot, „Dachkammern in violetten Städten“, La Bohème in Paris, London, Triest waren nichts für ihn. Ab 1915 erscheinen seine Gedichte in Harriet Monroes Poetry. 1916 zieht er als Anwalt einer neugegründeten Versicherung nach Hartford, Connecticut, wurde dort 1934 einer der vier Vizepräsidenten der großgewordenen Gesellschaft. Zwischendurch Dienstreisen per Eisenbahn durchs Land, Ferien in Key West, zweimal kurz in Kuba. Gedichtbände: Harmonium (1923; 1931), Ideas of Order (1934), Owl’s Clover und The Man with the Blue Guitar (1936), Parts of a World (1940), Transport to Summer (1945), The Auroras of Autumn (1948), The Rock (1954), The Collected Poems (1954), Opus Posthumous, Hg. S.F. Morse (1957), Selected Poems (1959), The Palm at the End of the Mind, Hg. Holly Stevens (1967). Theaterstücke: Three Travellers Watch a Sunrise (1916), Carlos Among the Candles (1917), Bowl, Cat, and Broomstick (1917). Prosa: The Necessary Angel (1951). Zwei National Book Awards, Pulitzer Preis, etc. Er stirbt 1955, noch im Dienst, im Alter von 75 Jahren in Hartford.
Menschen aus Pennsylvania sind Protestanten, aber keine Puritaner. Man ist auf holländische Weise sinnlich, ist knitz, scharfsinnig, tüchtig, beharrlich und widerborstig. „Es ist die größte Armut, wenn man nicht in einer physischen Welt lebt“, schreibt Stevens, „in einer Welt, in der es zu schwierig ist, Verzweiflung und Verlangen zu unterscheiden.“ Ein Zentralbegriff: Armut. Gemeint ist die Armut an imaginativer Kraft, die sich von mythenbekleisterten Anschauungen der Welt nicht lossagt. Die Armut, die die Welt nicht renovieren kann. Gemeint ist nicht die Flucht in die Weltvergessenheit. „Die metaphysischen Wandlungsmomente“, wenn sie denn, selten genug, auftreten, treten durchaus ein, wenn „wir einfach leben und dort, wo wir leben“. Wenn T.S. Eliot, der heimliche Antagonist, schließlich Realität im Glauben an Gott zu transzendieren sucht, so ist die poetische Einkehr Weltabkehr. Stevens kehrt zur Realität zurück und versucht die Transzendenz des Realen im Realen. Eliot ist Traditionalist und orthodox. Stevens ist Grenzgänger und antinomisch. Hier sind zwei zentrale Extremisten in der amerikanischen Lyrik.
III
Jemand, der aus einer Wüste eine Welt machen möchte, der eine verschlossene Dose öffnet, um aus den im Süßen erstickten Stückchen die frische Ananas wieder zusammenzubauen, darf (wie Shelley) Gebote machen, darf Disziplin auferlegen, eine Ordnung schaffen. Stevens’ großes, programmatisches Langgedicht heißt „Notes Toward a Supreme Fiction“. Es könnte heißen: Notizen für eine ästhetische Realität aus und in der Sprache. Oder: Für eine menschliche Welt. Wie schon sein frühes Langgedicht „The Comedian as the Letter C“ ist es eine indirekte Antwort auf Eliots Waste Land, die Diagnose, aufgrund derer Stevens die Medizin schreibt. Es ist eine Entdeckungsreise, die als Ergebnis und Aufzeichnung eine Karte hinterläßt, die das Gedicht ist, Spur der Imagination. Die „Höchste Fiktion“ soll „abstrakt sein, wandelbar und Freude geben“. Sie soll – dies in einem im Programm vorhandenen, aber nicht mehr ausgeführten Teil – „menschlich“ sein. Stevens hat die ersten drei Eigenschaften dieses Kompositums nicht definiert. Aber sie lassen sich erschließen. „Es ist niemals das Ding, sondern eine Version davon.“ Es geht um Transparenz, den Gegenstand als Idee, Kompositum seiner Aspekte. Als Abstraktes ist das Gedicht sowohl die äußerste Reduktionsform, das Ding-an-sich, und offenes Potential. Es muß sich wandeln. Das ist die Vorbedingung für das Leben des Gedichts. Und daraus, aus der Veränderung, ergibt sich Freude. Dies ist das Programm. Wie wird es erfüllt? Es erfüllt sich von Gedicht zu Gedicht. Das Gedicht ist eine „sich bewegende Kontur“, etwas, das in jedem Wort erneut stattfinden kann und als „Gedicht des Ganzen“ den Dichter übersteigt und überlebt. Es ist eine realitätsbezogene Fiktion, die die Realität des Dichters übersteigt. Es ist ein nicht ganz Greifbares, eine Fiktion, die, weil sie lebenswichtig ist, geglaubt werden muß – selbst wenn sie sich als unwahr herausstellen sollte. Sie ist Motiv und unverzichtbarer Antrieb, „ein Hunger, der sich nährt aus seinem Hungrigsein“. Erfüllung kann nicht gewährt werden. In einer Metapher aus den späten Gedichten: Odysseus darf nicht ankommen. Die Lösung, mit Schopenhauer, ist die Anerkenntnis des Paradoxons, die Akzeptanz des selbstimmanenten Widerspruchs, und die tapfere Überzeugung, daß solch Leben – die stetig wiederholte Bemühung um Befriedigung – ein Gut, ein Gutes sei. Dies ist die zu diesem Odysseus gehörige Penelope, die personifizierte Gewißheit trotz des Ungenügens.
Nach dem letzten Nein kommt ein Ja
Und darauf beruht die zukünftige Welt.
IV
Stevens’ Progreß als Dichter von Harmonium zu The Rock kann, mit wenigen Brechungen, als ein Ganzes gesehen werden. Es geht um ein Projekt, das von Sunday Morning (1915) bis Of Mere Being (1955) in der Selbstreferenz von Sprache, Themen und Obsessionen, durch facettierte Vielfalt und in plötzlichen Durchblicken seine Einheit transparent macht. Der Alternativtitel von Stevens’ erster Gedichtsammlung Harmonium lautete The Grand Poem: Preliminary Minutiae. „Erste Kleinigkeiten“ – darin zeigen sich stolze Untertreibung und wohl auch ein bißchen Zagen vor dem enormen Unterfangen. Aber wie wohl kaum ein anderer hatte er sich darauf vorbereitet, indem er erst spät, mit sechsunddreißig Jahren, ernsthaft zu veröffentlichen begann. Hier war plötzlich nicht nur ein Perfektionist, Meister der Nuance, sondern auch ein schon Perfekter, ein poet’s poet, aber keiner Gruppe angehörig. Außerhalb eines kleinen Zirkels während der New Yorker Zeit kannte ihn kaum jemand. Freundschaft bestand zwischen W.C. Williams und Stevens. Zu notieren ist auch eine langwährende Freundschaft zu Marianne Moore. Sonst nur Anekdoten: Kinnhaken und Niederschlag als Austausch (in dieser Reihenfolge) zwischen Stevens und Hemingway. Zwischen Frost und Stevens, ebenfalls in Key West, ein Zuprosten mit ein wenig Vitriol in den Gläsern. Aber das kam später und bedeutete nichts. Wichtig ist, daß Stevens mit seinen ersten Veröffentlichungen während des ersten Weltkriegs in die Zeit nach der epochalen Armory Show geriet, in die sogenannten „kleinen Magazine“, zu denen er zwar Zugang hatte, die aber zunehmend von den Imagisten um Pound beherrscht wurden, während Stevens sich zunächst eher ironisch ästhetisierend, dandyhaft gab, mit der poésie pure und dem französischen Symbolismus spielte, nahm, was er gebrauchen konnte, ohne sich vereinnahmen zu lassen. Das hinderte zeitgenössische Kritiker nicht, z.B. Parodien auf imagistische Gedichte, wie „Disillusionment at Ten O’Clock“, für bare Münze zu nehmen. Stevens entzog sich nicht nur räumlich von New York nach Hartford, er versuchte Etikettierungen zu entkommen. Das Ergebnis erschien als detachierter Eklektizismus, komödiantische Vollendung in der Form, kühle, kenntnisreiche Brillanz. Es wird im Rückblick deutlich, daß Stevens noch experimentierte und darum Festlegungen vermied. Noch 1923 sperrte er sich lange gegen eine erste Sammlung seiner Gedichte. Ein Vorgang, der sich bei seinen Gesammelten Gedichten charakteristischerweise wiederholte. Erst der Zwang zur Auswahl und Zusammenstellung der Texte für Harmonium formt das Programm, das im Titel angesagt wird. Die Wörter Programm, Theorie und Strategie sind austauschbar und drücken Indirektion aus: Harmonium – das ist ein kleines, transportables Begleitinstrument für Gesang in Barbarei und Öde. Es ist, für Stevens, aber auch die Vorform jener massiven Harmonie als Kunstverbund, die er später in A Primitive Like an Orb feiern wird. In Harmonium ist es der Krug in der Wildnis von Tennessee in dem kleinen Gedicht „Anecdote of the Jar“, die als „Anekdote“ – indirekt der Vorschein des Späteren ist. Das im Gegenstand Unscheinbare, mit präziös wegwerfender Geste in eleganten lyrischen Taschenspielertricks vorgeführte, der Habitus des Illusionisten, müßte wohl als strategische Selbstschutzmaßnahme richtig eingeordnet werden, damit wir nicht dem Irrtum sowohl zeitgenössischer als auch noch einiger heutiger Stevens-Kritiker verfallen, die einen Bruch zwischen Harmonium und den späteren Bänden zu Recht bemerken den Bruch zwischen (dem Anschein von) hypertropher ästhetisierender lyrischer Verspieltheit und Eloquenz und trockenerer, rhetorischerer Stilentwicklung im folgenden −, ohne allerdings das gedankliche und argumentative Kontinuum zu registrieren. Die Gedichte bis zu Harmonium und jene, die darin aufgenommen wurden, sind Ausdruck des Bestrebens, zu früher Selbstenthüllung zu entgehen. Die romanisierenden Einsprengsel, die Anklänge an Mallarmé und Valéry, dürfen wohl als (durchaus fruchtbares) Verwischen von Spuren, des Einflusses, vor allem der angelsächsischen Tradition, verstanden werden. Verdeckt werden soll das Weiter wirken und die von Stevens nun graduell vorgenommene umwertende Fort- und Umschreibung amerikanisch-romantischer Vorgänger wie Emerson und Whitman (The Idea of Order at Key West) und des mächtigen Schattens englischer Vorläufer wie Keats, Shelley, Wordsworth (vgl. Sunday Morning, Le Monocle de Mon Oncle, The Man on the Dump). Stevens stilisierte sich durchaus herausfordernd als Bewohner des Elfenbeinturms, den andere so spektakulär zu demolieren suchten, obwohl sie ihn niemals verließen (Pound). Er äußerte sich dazu in einem auf Williams abhebenden Aufsatz, der weniger auf Williams als für ihn selbst zutrifft:
Alle Dichter sind, zu einem gewissen Grad, romantische Dichter. Deshalb ist der Dichter, der sich am wenigstens dafür hält, oft ganz und gar einer. Zum Beispiel würde niemand zögern – außer jemandem, der selbst surrealiste ist −, diese ganze Schule als romantisch und mit dem allerauthentischten Purpur durch und durch gefärbt zu charakterisieren. Was ist denn nun heutzutage ein Romantiker? Er ist, wie es sich trifft, jemand, der immer noch in einem Elfenbeinturm lebt, aber darauf besteht, daß jenes Leben unaushaltbar wäre, wenn man nicht so einen ausgezeichneten Ausblick auf die städtische Müllkippe und die Reklameschilder für Snyders Ketchup, Ivory Seife und Chevrolet Autos hätte. Er ist der Eremit, der allein mit der Sonne und dem Mond lebt, aber darauf besteht, eine vergammelte Zeitung mitzunehmen.
Stevens ging es um eine Auffrischung des Lebens (auch seines eigenen) durch Farbe, Musik, exotische Gerüche, Papageien und Persimmons, objets d’art. Doch unter, neben und in diesem irisierenden Spiel scheint bereits deutlich die Rolle durch, die Stevens sich und seiner Lyrik zumißt: dem Druck der Realität den Gegendruck der Imagination entgegenzusetzen, ästhetische Konstrukte zu schaffen, die den Zeitungen und der in ihnen reproduzierten Welt standzuhalten, sie eventuell ersetzen könnten.
Das Langgedicht „The Comedian as the Letter C“ ist unter seinem Lautgeklingel („der heilige Franz mit Glöckchen an seinen Fußgelenken“, spottete Stevens), unter der (Selbst-)Ironie und der bewußt überstilisierten Rhetorik eine ernstzunehmende Meditation über die Rolle des Dichters und sein Leben in der Gesellschaft, über das drückende Erbe vergangener Kultur und Lebensmöglichkeit. Hier und in anderen Gedichten dieser Periode beginnen auch bereits die geistigen Auseinandersetzungen mit Emerson, Pater, Bergson, Santayana und Peirce und anderen Philosophen, die Stevens den Ruf eines philosophierenden Dichters oder dichtenden Philosophen eintrugen. Es ging Stevens allein darum, der Lyrik als „Geistesakt“ einen Status zu geben, der sich vor der Philosophie in ihrem Anspruch nicht zu verstecken brauchte. Lyrik, für Stevens, war eine ernstzunehmende Sache. Die Theorie der Lyrik war ihm, wie er schrieb, Lebenstheorie und Dichtung· sein eigentliches Leben. Lyrik war eine Aufgabe, die mit allen, vor allem auch intellektuellen, Kräften angegangen werden mußte. Wenn der Dichter ein Dichter seiner Zeit sein wollte, dann hatte er sich dem zu stellen, was seine Zeit bestimmte. Der mitunter für die Lyrik nach der langen Pause Stevens’ zwischen Harmonium und Ideas of Order verantwortlich gemachte Terminus „Gedankenlyrik“ trifft die neue Entwicklung nicht ganz, denn für Stevens gab es keine andere. Lyrik wurde, ganz konkret, zur Schöpfung eines reflektierenden, meditierenden, entdeckenden Menschen, der seinerseits die Abstraktion seines Schöpfers ist. Lyrik wird ihm zur Kunst des Gelehrten, der mit beiden Beinen in der Realität zu stehen hat. Realität und Imagination informieren einander.
V
Als Vizepräsident der Versicherung, in der er arbeitete, hatte Stevens 1934, im Alter von bald 55 Jahren, in schwierigster Zeit die äußere Sicherung errungen, die ihm nach dem geringen Erfolg von Harmonium auch die innere Sicherheit für seine schöpferische Tätigkeit gab. Zugleich hatte er das Glück, in einer beruflichen Umgebung zu sein, in der seine Exzentrizität toleriert wurde. Er war, nicht nur als Manager, eine Feder am Hut seiner Gesellschaft geworden, in der ja auch der Anthropologe und Linguist Benjamin Lee Whorf so ungestört seinen Studien nachgehen konnte, daß er zwar zunächst einem Ruf an die Yale-Universität folgte, aber dann bald gern in die Firma zurückkehrte. Es gab Raum zum Denken. Stevens schrieb:
Einer der Wege zur Fiktion führt über ihr Gegenteil: Realität, die Wahrheit, das Beobachtete, die Reinheit des Auges. Je exquisiter das Gesehene, desto exquisiter das Ungesehene. Schließlich gibt es einen Zustand, in dem jeder Weg zur tatsächlichen Beobachtung dessen wird, dem man sich annähert… Eine Art zu Fortschritten zu kommen besteht in bloßem Kontrast. Wenn das Gefühl für die Realität das Gefühl für die Fiktion verschärft, dann intensiviert die Würdigung der Routine, des Mechanischen etc. die Würdigung des Fiktiven.
Die Meditation solcher Gegensätze wird zum beherrschenden Thema der schnell aufeinanderfolgenden Bände Ideas of Order und The Man with the Blue Guitar. Es geht um die Gedichte, die in der alltäglich amerikanischen Umgebung möglich sind, und um die Rolle von Dichter und Dichtung in dieser Gesellschaft. „The Poems of Our Climate“, einer der Texte aus Ideas of Order, ist solch ein Dokument des Lebens aus und in Kontrasten. Es bleibt nicht bei der jeweiligen Entscheidung zwischen dem (tödlichen) Leben ästhetischer Reinheit und Transzendenz und dem (angeblich lebenspendenden) Bedürfnis nach „Freude“, die im alltäglichen „brüchigen Wort“ und „störrischen Laut“ liege. Diese urtümliche Freude liegt nicht nur darin, sie „lügt“ (lies, hieß es im Original) uns auch an. Die Lösung liegt in der Synthese von beiden, dem Dritten, das aus der Oszillation der Dichtungssprache zwischen beiden entsteht. In diesem Wechsel, der – manchmal – das gesuchte Dritte erzeugt, die Abstraktion bei der Extreme, liegt die von Stevens gesuchte erneuernde und deshalb lebenstiftende Fiktion: die er-fundene Welt, be-lebte Abstraktion.
Es war keine Wahl
Zwischen, sondern von. Er wählte die, die
Schon ineinander beschlossen sind, die ganze,
Die verflochtene, sich sammelnde Harmonie
(„Notes Toward a Supreme Fiction“).
Diese Konzeption hatte praktische Folgen für die von Stevens immer mehr bevorzugte Form des Langgedichts. Sie erlaubte es ihm, den Prozeß des Abwägens, Prüfens darzustellen und so das Gedicht zum Exempel seiner Theorie (und umgekehrt) werden zu lassen. Die folgenden Bände zeigen deshalb jeweils ein oder zwei Langgedichte, umgeben von einer Serie kleinerer Texte, die gewissermaßen ihren „Hof“ bilden, indem sie Hinführungen und Illustrationen herstellen. Das Risiko dieses Verfahrens ist eine thematische Gleichförmigkeit, der Stevens nicht in jedem Fall ausweichen kann. Der Vorläufer Stevens’ in dieser Methode der Anlagerung von Gedichten um ein gemeinsames und übergeordnetes Zentrum ist sicherlich Walt Whitman, für dessen „Song of Myself“ alle anderen Gedichte mitunter zu bloßen Hinführungen, zu Teilen eines Prozesses werden. Auch Stevens gelingt es nicht immer, dieser Gefahr zu begegnen; doch kann die Mehrzahl dieser Trabanten um den Fixstern eines dominierenden Langgedichts auch getrennt davon für sich bestehen. Die positiven Wirkungen des genannten Verfahrens überwiegen gegenüber den negativen, da dem Leser Einstiege durch Variationen erleichtert werden und Kohärenz sichtbar wird.
Das Langgedicht, in Ermangelung eines besseren Terminus, gehört zusammen mit dem Prosagedicht und der poetischen Prosa, wie Stevens sie in der Sammlung The Necessary Angel nebeneinander vorstellt, zu den grenzüberschreitenden Sprachkonstrukten, die sich – neben Vorläufern in der französischen Moderne – vor allem in den Vereinigten Staaten entwickelt haben. Die Ursprünge liegen hier in der amerikanischen rhetorischen Tradition und der Hauptvorläufer ist erneut Emerson, dessen Schriften rhetorische Strategien der gesprochenen Sprache erkennen lassen, die bei ihm oft genug auch in gebundene Sprache umschlägt. Es ist Sprache, die nicht in eine vorgegebene Form „eingefüllt“ wird, sondern sich selbst vorantreibt. Das Sprechen (Schreiben) schließt auf, öffnet das jeweils Nächste, sucht die größte Nähe zum präsentischen Moment. Sie bedient sich zyklischer Wiederholungen und der Elaboration des Gedankens als Exploration und Suche nach dem Gegenstand in der Sprache. Sie blickt nicht zurück, rekapituliert nicht, sondern ist, in der Identität von Autor und Wort, eine vorausgeschriebene Autobiografie. Das Mittel im Drehen und Wenden des Gedankens ist die syntaktisch lose, ambivalent geschachtelte, weiträumige grammatische Flux – häufig ein langer, parataktisch ausgebreiteter Satz, der, wie ein Netz geworfen, Vertikalität herstellen möchte. Stevens’ frühes kurzes Gedicht „The Snow-Man“ zeigt bereits das Prinzip: den syntaktischen Fluß eines immer wieder sich selbst qualifizierenden Sprechens an einem Ort als gedanklicher Situation, bis der Sprecher auf die semantisch negative Eigenschaft des Ortes reduziert ist, das Nichts, in dem sie in dieser Situation endlich identisch sind. Bei längeren und langen Gedichten bewirkt das ständige Hinausschieben und Vorantreiben der Sprache als „Experiment in der Sprache“ eine Suspension der Enderwartung, die das reine Spiel der Sprache zum Vorschein bringen kann. Sprache kommt in ihre eigene Realität. Es entsteht, wie Stevens sagt, eine „Dichtung der Worte in und durch die Worte“. Heideggers Satz „Die Sprache spricht“ kann, obwohl konkrete Zeugnisse fehlen, Stevens womöglich nicht unbekannt geblieben sein. Die Langgedichte sind so, im Sinne Heideggers, „unterwegs zur Sprache“. Es ergibt sich bei Stevens, über die anfängliche Strategie der Kontrastierung hinaus, das innersprachliche Streben nach der Auflösung gesetzter binärer Oppostionspaare (Realität/Imagination, Subjekt/Objekt, Ich/Welt, außen/innen), die ihn zum anerkannten Vorläufer der Postmoderne machen. Es geht um eine Dekonstruktion, die Stevens noch – in mißverstandener Anlehnung an einen Begriff von Simone Weil „Dekreation“ nennt, letztlich den Eingang in das Wort. All dies setzt eine große Frustrationstoleranz des Lesers voraus, die Bereitschaft, sich dem Ungewissen auszusetzen, sich nicht sofort vergewissern zu können, das Risiko auf sich zu nehmen, ohne die Haltegriffe der etablierten Paradigmen der Lyrik auskommen zu müssen.
Manche Leser vermissen in diesen Langgedichten Stevens’ dennoch trotz des Erreichten die persönlich betroffene Unmittelbarkeit des Tons – eine Unmittelbarkeit, zu der sich Stevens in der für ihn typischen Reserviertheit nicht durchringen mochte. Angesichts des Anspruchs dieser Lyrik, nicht nur belebend zu wirken, sondern Leben zu sein, scheint dies eher paradox. Es ist für manche ein Defizit, das auch durch Stevens’ komödiantische und häufig ironisch gebrochene Sprecher in den Gedichten nicht behoben wird. Es sprechen Gelehrte, Rabbis, Professoren, und es überwiegt der hypersensible, durchaus gedanklich involvierte, aber trotzdem emotional kühle rhetorische Gestus. Paradoxerweise, noch einmal, sind diese Schwächen in Stevens’ Anspruch für die Lyrik überhaupt begründet, den er in den 40er Jahren auch außerhalb seiner Schriften zu realisieren trachtet. Über Jahre hinweg diskutiert er mit seinem Freund Henry Church die Möglichkeit der Einrichtung eines Lehrstuhls für Lyrische Dichtung, den er in einem Memorandum beschreibt:
Es besteht nicht die Absicht, einen Literaturkurs einzurichten, ausgenommen nur der Teil, der die Dichtungstheorie als Teil der Literaturtheorie betrifft. Es ist nicht beabsichtigt, Lyrik vom Altertum bis zur Gegenwart zu lesen, noch das Schreiben von Lyrik zu lehren. Und, mit einer letzten Verneinung, es besteht nicht die Absicht, einen Kult ins Leben zu rufen.
Was beabsichtigt ist, ist das Studium der Dichtungstheorie in bezug auf das, was Lyrik war und was sie sein sollte. Die dazugehörige Literatur ist Teil davon, aber nur ein Teil. Lyrik bedeutet, zu diesem Zweck, nicht die Sprache der Lyrik, sondern die Sache an sich, wo immer man sie finden möge. Gemeint sind auch nicht Verse, genausowenig wie Philosophie Prosa bedeutet. Der Gegenstand der Dichtung muß sichergestellt werden. Einfach so gesagt ist der Gegenstand das, was einem einfällt, wenn man vom Monat August sagt…
„Ihr seid nicht August, es sei denn, ich mache Euch dazu“.
Es sind diese Aspekte der Welt und von Männern und Frauen, die ihnen durch die Dichtung hinzugefügt worden sind. Diese Aspekte sind schwer zu erkennen und zu messen.
Stevens schlug Santayana als einen möglichen Stuhlinhaber vor, doch wurde, weil Church als potentieller Stifter starb, nichts aus dem Plan. Es ist allerdings von Bedeutung, daß Stevens Santayana, Philosoph und Dichter dazu, vorschlug, dem er in einem der beeindruckendsten seiner späten Gedichte ein bewegendes Denkmal setzte. Santayana verkörpert für Stevens praktizierte Philosophie und gelebte Dichtung, die beide, in der Bescheidenheit dieses repräsentativen Mannes, zusammenkamen.
Die Ergebnisse der vergeblichen Planung mit Church schlugen sich in den Aufsätzen und Vorträgen zur Rolle von Dichter und Dichtung nieder, die in Opus Posthumous und den darin gesammelten „Adagia“ sowie, noch zu Lebzeiten, in The Necessary Angel gesammelt worden sind. Die Schriften sind, wie angedeutet, oft nahtlos im Übergang zwischen Prosa und Lyrik, sind kritische Meditationen, die zum Verständnis des Werks, als integraler Teil davon, nicht übersehen werden dürfen. Sie liegen, wie die Langgedichte, noch nicht in deutscher Übersetzung vor.
VI
Die Gedichte des alten Stevens, erschienen in The Auroras of Autumn und The Rock, reduzieren die gelegentlich schwere Fracht der Theorie früherer Bände. Es gelingen ihm Gedichte von so konstanter Qualität wie nie zuvor. Stevens findet zu einer Ruhe, Tiefe und Schlichtheit, die ohne die explizit ausgesprochene Theorie auskommt, aber auf ihr beruht, ihr Ergebnis ist. Es ist ein später Durchbruch in eine Klarheit von Sprache und Vision, die auch rückblickende Selbstkritik nicht ausläßt. Es bildet sich eine Unverstelltheit der Sicht heraus, die ihresgleichen sucht. Es ist, wie die letzte Zeile der Collected Poems lautet, „wie eine neue Kenntnis der Realität“.
Stevens, der zu Lebzeiten einen Lehrstuhl für Dichtung begründen helfen wollte, wurde nach seinem Tod zunächst zum bevorzugten Dichter amerikanischer Akademien und zum unfreiwilligen Lieferanten von Vokabular für Exponenten unter den postmodernen Literaturkritikern. Diese Akademisierung Stevens’ behinderte die Rezeption durch ein größeres Lyrikpublikum bis in die frühen 60er Jahre. Andererseits trug sie dazu bei, seine Reputation über die gelegentlich alles verdrängende Dominanz der angelsächsischen Lyrik von und im Gefolge von Eliot, Pound und Williams hinweg am Leben zu erhalten und weiter durchzusetzen, so daß er heute als der vielleicht zentralste und einflußreichste moderne Lyriker englischer Sprache gelten kann. Eine ganze Generation englischsprachiger Lyriker hat von ihm gelernt. Er selbst förderte besonders den zu früh verstorbenen Randall Jarrell, half Richard Wilbur und Richard Eberhardt. John Ashbery, A.R. Ammons, John Hollander, neben anderen, stehen, auf ihre unterschiedliche Weise, in seiner Nachfolge oder können sich der Auseinandersetzung mit ihm nicht entziehen. Im deutschsprachigen Bereich ist Stevens allerdings, trotz vorhandener Auswahlübersetzungen unterschiedlicher Qualität, bisher noch kaum angenommen worden. Dies liegt sicherlich z.T. an den Schwierigkeiten, die es bereitet, leichten Zugang zu einer Lyrik zu finden, die eher aus dem Verstand als aus dem Gefühl kommt und eine sorgfältige und einläßliche Lektüre des Gesamtwerkes erfordert. Doch ist es eine Mühe, die lohnt, weil sie auch der zeitgenössischen deutschsprachigen Lyrik Perspektiven eröffnen könnte, die als Gegengewicht gegen allzu rührselige Innerlichkeit und lyrische Selbstunterforderung lohnend wären.
Klaus Martens, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 1, Februar 1984
Indem Mr. Stevens
das Innere jener Wörter, die er für seine Gefühle passend fand, miteinander kombinierte, verwandelte er seine Wörter in Wissen. Sowohl Mr. Stevens als auch Cummings treten mit Ambiguität hervor – wie jeder gute Dichter; aber die Ambiguität von Cummings besteht in der Abwesenheit bekannten Inhalts, der Ambiguität eines Phantoms, dem keine Wörter Existenz verleihen können. Dahingegen ist Mr. Stevens’ Ambiguität die einer so mit Dasein angefüllten Substanz, daß sie der Paraphrase widersteht und nur in der Form der Wörter erblickt werden kann, in der sie vorhanden ist. Es ist der Unterschied zwischen Lyrik, die vom Dichter abhängig ist, und einer Lyrik, die sich auf sich selbst verläßt.
R.P. Blackmur, in: R.P. Blackmur: The Double Agent, „Examples of Wallace Stevens“, Gloucester, Mass. 1962
Hätte jemand Pound,
als er seinen Krieg gegen das jambische Versmaß begann; Eliot, als er das erste Mal ein kaltes Auge auf den Post-jakobitischen Blankvers warf, hätte jemand beiden prophezeit, als sie als erste Verallgemeinerungen in der Lyrik verdammten, daß in vierzig oder fünfzig Jahren der Haupteinfluß manchmal denke ich verzweifelt: der einzige Einfluß – auf jüngere amerikanische Dichter diese verallgemeinernden, meisterhaften, skandierbaren Verse von Stevens sein würden; hätten beide nicht in selbstsicherer Ungläubigkeit gelacht? Und wie viele der jüngsten englischen Dichter scheinen wie Cowper schreiben zu wollen! Eine große Revolution trifft die großen Revolutionäre am härtesten.
Stevens’ Lyrik liegt Staunen und Entzücken zugrunde; die Freude des Kindes, des Tieres, des Wilden – des Menschen – an seiner eigenen Existenz und die Dankbarkeit dafür. Er ist der Dichter des Wohlergehens:
One might have thought of sight, but who could think
Of what it sees, for all the ill it sees?
Dieser Seufzer der Ergriffenheit, des nachdenklichen Genusses, unterliegt all den Gedichten, die uns das „himmlisch Mögliche“ zeigen, all das, was noch nicht in die infernalischen Unmöglichkeiten unserer alltäglichen Erde verwandelt worden ist. Stevens ist voll der natürlichen oder aristotelischen Tugenden; er ist, in den Worten aus Hopkins’ Gedicht, ganz windhover und kein Jesuit. Ihn umgibt, unter den lichtdurchlässigen Glasuren, eine holländische Solidität und Masse. Umgeben von all den guten Dingen dieser Erde sitzt er mit roten Wangen und klaren blauen Augen, Augen, die dich nicht suchen, sondern wie Fixsterne an ihren Plätzen leuchten – oder er bewegt sich fort wie der Bischof in seinem Gedicht „globed in today and tomorrow“. Wäre er ein Tier, so wäre er zweifellos jenes vernünftige, großmütige, voluminöse Tier, der Elefant.
Randall Jarrell, in: Ashley Brown, Robert Haller (Hrsg.): The Achievement of Wallace Stevens, New York 1973
Fakten und Vermutungen zur Übersetzerin
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + Archiv + Internet Archive + IZA + KLG + IMDb + PIA + Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: Aargauer Zeitung ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ BZ ✝︎ Cicero ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ Die Presse ✝︎ DW ✝︎ Falter ✝︎ FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ FR ✝︎ Furche ✝︎ Hypotheses ✝︎ Junge Freiheit ✝︎ junge Welt ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ nd ✝︎ NDR ✝︎ NZZ ✝︎ Rheinpfalz ✝︎ RND ✝︎ Sinn und Form ✝︎ SN ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎ SRF ✝︎ Standart ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ taz ✝︎ Welt 1, 2 & 3 ✝︎ ZDF ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.
REALITY CHECK
(wallace stevens abridged)
fühlst du „den puls des gegenstands“,
der seinen namen verliert?
„die hitze des erkaltenden körpers“
den schatten unter der hand vergrößern,
die ihn fallen läßt ins niemandsland
zwischen sinn und bedeutung?
wie oft macht gewohnheit vergessen,
daß „wir an einem ort leben,
der nicht unser ist und nicht wir“?
daß wir es selbst sind, die stets
auf der „flucht vor der wiederholung“,
uns für augenblicke in zwischenwesen
verwandeln, die den geschmack des ganzen
an seinen teilen, des scheins
an der erscheinung erneuern?
im plan der schöpfung fehlte die poesie
des beobachters, um gott zu verabschieden.
der „metaphern-vagabund“ ergänzt,
was ihn umgibt, sein „ordnungswahn“
fügt „die wilden stimmen“ von wind
und meer, von blauem pfirsich und
fliegendem pferd zusammen.
wenn wir manchmal „in bildern erwachen,
mitten im gesuchten gegenstand“,
bleibt nur abstraktes besteck,
das makellose kleid der vorstellungen
anzupassen und „auf der oberfläche der dinge“
zu schlittern, bis eine unsichtbare wand
ganz abrupt? ganz abrupt
den sog des genitivs stoppt.
Daniele Dell’Agli
Hannes Hintermeier: Geschäftsmann mit lyrischer Neigung. Über die Abwesenheit von Wallace Stevens. Merkur, Heft 593, August 1998
Peer Trilcke: Lyrik auf dem Weg ins Versicherungsbüro
Joachim Zünder: Die Wirklichkeit ist das Motiv
Die Notes toward a Supreme Fiction und die Poetologie des späten Wallace Stevens
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Richard Exner: Wallace Stevens – Gedenken an den amerikanischen Dichter
Die Tat, 3.10.1959
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + KLfG + IMDb + Society + MAPS 1, 2 & 3 + PennSound + Internet Archive + Poets.org + Kalliope
Porträtgalerie: Keystone-SDA
Wallace Stevens liest Final Soliloquy Of The Interior Paramour.


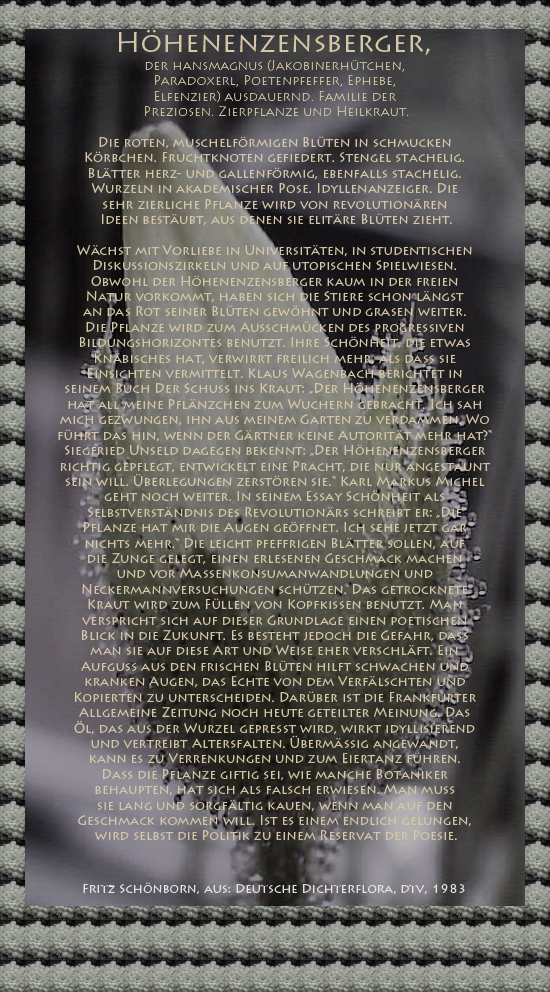
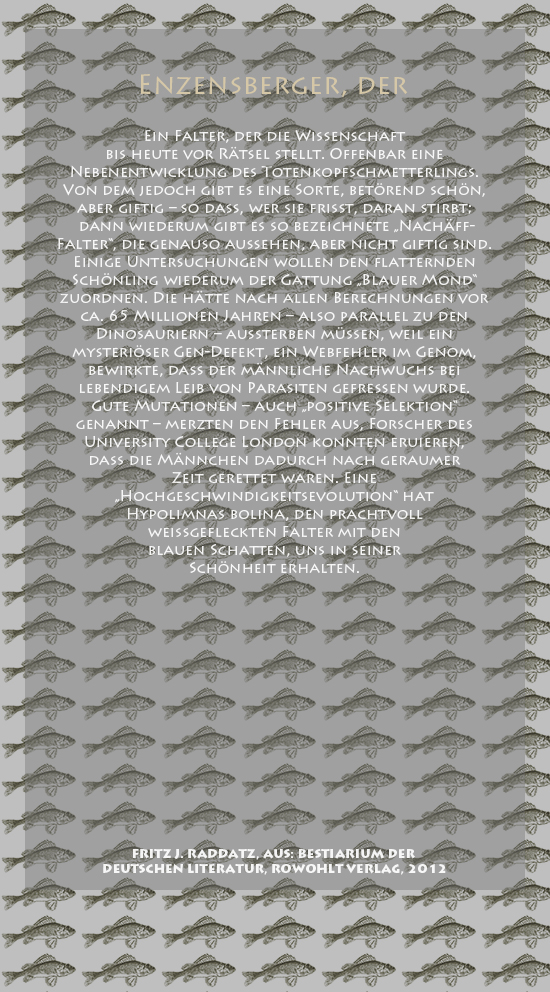












0 Kommentare