Adolf Endler: Akte Endler
BESUCH AUS MOSKAU 1954
ODER NACH DER ACHMATOWA FRAGEN
Für Bettina Wegner
Fadejew! – Paustowski! – Kornejtschuk!
Issakowski! – Bashan! – Schtschipatschow!
Ketlinskaja! – Kassil! – Katajew!
aaaaa„Ach, lebt die Achmatowa noch?“
Bek! – Lebedew-Kumatsch! – Sjomuschkin!
Scholochow! – Polewoi! – Lugowskoi!
Surkow! – Schaginjan! – Libedinski!
aaaaa„Und lebt die Achmatowa noch?“
Permomajski! – Fedin! – Lukonin!
Ja, sie lebt!, nun hören Sie doch!
Assejew! – Ashajew! – Fadejew!
aaaaa„Sie lebt, die Achmatowa, noch?“
Nachbemerkungen
aaaaa1
Die Dichtung Adolf Endlers ist fratzenhaft, aggressiv, siedend genant worden. Und tatsächlich scheint ihr Tonfall nicht mit Tönung zu tun zu haben, sondern mit Fall, Wasserfall, mit Kaskadischem. Diese Gedichte sind nicht aus Stille gemacht – wie Endler betont – sondern Grelle. Schon die ersten Attribute des ersten Gedichts, geben davon einen Vorgeschmack: schmerzend, glühend, brennend, gleißend. Selbst dort noch, wo die Sprachspiele mit vertracktem Hintersinn daherkommen, sind sie schrill; noch das kauzigste Gekicher sirrt von tätlichem Ungestüm. Man kann sich A.E. gut seine Gedichte vortragend vorstellen: spitze Geste in den kleinen Armen, über ihnen der wirrhaarige Bakuninkopf weit vorn, und aus dem schnellt die Stimme präzis, in diskantischer Zuschärfung.
Rosa und Beige – das sind (siehe das Gedicht „Absage“) Endlers Farben nicht, ebensowenig wie Umbra, Ocker oder – so jedenfalls scheint es – das Rembrandtsche Gold. Man sehe, welch frenetische Farben es selbst in der benehmend klagenden, gewiß am äußersten Rand des Lebens geschriebenen „Elegie“ sind, aus denen und in die jenes fragile Gehäus wegblaßt: Lila, Giftgrün, Stahlblau, Schlohweiß.
Also, Endlers Dichtung scheint von schneidender Einhelligkeit. Und daß das Feuer, das hinter der lohen muß, nicht von der bengalischen Art ist, zeigt Beispielsweise das Titelgedicht eines der wesentlichsten Gedichtbände der an wesentlicher DDR-Lyrik reichen siebziger Jahre, „Das Sandkorn“. Dies zerstörungsgierige Partikel durchwandert nichts geringer Gefügtes als den Staat. Auch wenn man das Tischabräumen anteilnehmend als den ersten Gang des Essens ansieht – ist hier nicht zu weitreichender Aufruhr probiert? Nun, erstens hält das Gedicht, auf Marx weisend, das berühmte Absterben des Staats in Erinnerung. Und zweitens setzt es im Finale, gewissermaßen im Vorgefühl solch erreichbaren Glücks, die Utopie appetitanregend als verwirklicht: O wunderbare Flaute. So daß jeder Staat, der als dieser sich aufzuheben strebt im spannenden Verbund egalitärer Individuen, diesen wie von einem kollektiven Ich vieltausendspitz vorgetragenen Text geruhsam als Apologie anhören wird. Durchheitert ergeht sich, was satanisch losfuhrwerkte.
Aber jener Blizzard von RI-Wörtern, der im „Lehrgedicht“ gegen Edgar entfesselt wird – er läßt doch nichts zu wünschen übrig hinsichtlich besagter blitzender Einhelligkeit? Freilich, man fühlt sich vom Wirbelsturm alsbald in dessen „Auge“ gesogen und sieht: Hinter der sarkastischen Gebärde gibt Selbstironie sich zu erkennen. Die war, gegenwärtig von Gedichtbeginn, denn was vermögen Wörter oder gar Silben, von welcher Klangekstase immer, gegen ein Superschwein. Deutlich aber wird sie, als gar FRIedRIch Schiller und der Endler ganz ferne RIlke ins Sandkorn-Gebläse einkommen. Da richtet sich die Düse auf den Schützen selber: Edgar wird unterderhand Eddy (wie Endler von Freunden. genannt wird), oder andersherum: Purer Feind ist Fiktion, denn in dem ist ein Gutteil meiner. Oder: Der Gegner siedelt immer auch in der eigenen Brust. – Was nebenher geleistet ist, ist die Schmähung der Schmähschrift.
Übrigens, die vorhin angeführten Beiwörter gleißend, brennend meinen den Regen aus Leuchtspurgeschossen und die vom Krieg verwüstete Stadt. Das Schmerzen, das Glühen von Augenbällen und Lidern ist also nicht Über-, es ist Bezeichnung. Was, wenn das Hochvoltige von Endlers Dichtung sich nicht so sehr aus ihm, Endler, heraus entlüde als vielmehr durch ihn hindurch aus den Weltläuften, in die er empfindlich hereingestellt ist?
aaaaa2
Endler ist Lyriker, (autodidaktischer) Literaturwissenschaftler (siehe sein Vorwort zum Buch Georgische Poesie aus acht Jahrhunderten) und Nachdichter (einer der Handvoll herausragender in unserem Land, spätestens Rainer Kirschs außerordentlicher Essay „Das Wort und seine Strahlung“ belegt es).
Mit Karl Mickel stellte er die gültige und ebendeshalb zur Aktualisierung herausfordernde Anthologie von DDR-Gedichten In diesem besseren Land zusammen, zunehmend verschreibt er sich der Prosa (wie mittlerweile Zwei Versuche über Georgien zu erzählen [1976] und das bissige Glossenbüchlein Nadelkissen [1980] bezeugen). Kaum mehr überschaubar ist die Reihe von Endlers Rezensionen und Essays zur Richtung. Um wie vieles weniger wüßten wir ohne sie über unsere lebenden großen Alten, Arendt und Tkaczyk. Und kennten wir die Gedichte Inge Müllers, und wann hätte sich, ohne Endler, das Werk Uwe Greßmanns (der im vorliegenden Band mit einem vergleichsweise blassen Nachruf bedacht ist) erschlossen? Diese Texte haben unsere Lyriklandschaft nicht nur ausgeleuchtet, sondern, gemodelt; der Dichtung der heute Dreißig- bis Fünfundvierzigjährigen haben sie durch Bewußtmachung von deren innersten Antrieben und zähes Drängen auf welthaltige Tiefenschärfe in einer Weise auf den Weg geholfen, die diese Arbeiten nicht ihrem Wesen, wohl aber ihrer Wirkung nach dem theoretischen Œuvre Georg Maurers zur Seite stellt.
Eine dieser Schriften, 1971 von Sinn und Form veröffentlicht, sorgte für Aufsehen. Endler brach in ihr, krachend, eine Debatte vom Zaun über die willfährige Verklemmtheit einiger Germanistik, die, statt durch Kunst hindurch die Welt zu sichten, diese – die Welt – kennen zu müssen meinte und unmißverständlich auf die Abspiegelung dieser ihrer kalokagathisch versüßten Sicht pochte. Ihre Prallhärte bezog diese Streitschrift aus der Überspitzung, und sogleich fallen einem überspitze Worte auch in den Gedichten auf: meine Heizung: der Haß (in „Bald stürz ich“).
Es muß wohl übertreiben, wer vorantreiben will. Und Endler, fern jeglicher Elfenbeintürme, will das. Seine Verse (so verlautbart das Gedicht weiter) solln beißen, und nicht ungezielt um sich, sondern Eure säuischen Seelen wund! Das Gedicht „Läusesuchen“ scheint geradenwegs zu wachsen aus brandrot lodernder, grausamer Lust: Ich knack!
Offenbar zu Unrecht war vorhin die Verve Endlerscher Verse in Frage gestellt. Wiewohl, man findet, mit Endler Läuse suchend, manches andere:
Wahrhaft lausige Zeiten sind angezeigt, man kann an die Jahre gegen Kriegsende denken. Das sanfte Herbeibiegen eines HaIses assoziiert das Henkbeil leicht, beinahe von selber. Wie von anderer Welt nehmen sich da die glückhaften Gesten geborgener Zweisamkeit aus: das Streicheln der Wange, das Lösen des Haars und ebenjenes Befreien vom Getier.
Aber geschieht dies nicht tatsächlich in einer anderen Welt: derjenigen seltsam unwirklicher hellster Lampen? Die güldene Spange – weist sie nicht auf Märchenhaftes? Das Läusesuchen ist ein Wunschtraum.
Doch wirklich ist es auch: Wir sehen das ja vor sich gehen zwischen feuchten Fingernägeln, unter hitzigem gemeinsamen Zählen. Wir atmen also auf.
Und in gleichem Atem erschrecken wir. Ich, der Henker, jetzt lediglich abgelenkt – dies wird nicht einfach so, daherparliert. Was, ein nichts als lichtes, ein schönes Paradoxon zu sein schien, nämlich ein winziges Blutbad einrichten zu müssen, um einander aus blutigen Zeiten zu ziehen, das irrlichtert plötzlich herzschlagstockend schön: Leicht, beinahe von selber hätten die beiden einander Opfer sein können. Es ist als seien die Verhältnisse, deren fingergreiflicher Relikte sich zwei Betroffene soeben entledigen, von diesen Betroffenen auch herbeigeführt. Oder hätten von ihnen doch herbeigeführt werden können. Und das Läuseknacken ist das klare Beenden von Schlimmem sowie dessen unklare Verlängerung.
So irisiert am Grund dieses Gedichts Freiwerdung und Verschuldung. Der Glanz der vielen Tropfen Blut, in dem, wir das von Blutsaugern, freie Haar schließlich sehen, changiert von Vermenschlichung und Gefährdung (und das Sprachgebilde greift staunenmachend über den staunenmachenden Vorwurf, Rimbauds „Läusesucherinnen“, hinaus).
Übrigens lese ich nun „Gedenken an zwei Stammgäste“ anders, einem Text, der von traurigen Gestalten samt und sonders zu handeln schien, von unaufstörbarer Tristesse. Über die Abscheu gegen die Delinquentin hinaus spüre ich alsbald Mitleid ob ihres ungelebten Vorlebens. Vor der kläglichen Anhänglichkeit des Rollensprechers gegenüber dem Donnerstagsritual erhält, das Greuel etwas von einer Befreiungstat. Das Gedicht, indem es Widerstrebendes gibt, gibt zu denken auf. Die Motive für Untat und Tatlosigkeit, nur scheinbar kraß voneinander unterschieden, müssen außerhalb der Tischrunde liegen.
aaaaa3
Wo Endler, 1930 geboren, aufwächst, markiert „Das Dreieck, in dem ich wohnte“. Es ist von allerlei Industrie umgeben, und früh erfährt E., wohin er, anders als sein kleinunternehmender Vater, gehört: zu jenen, die aufbrechen werden zum roten der Stürme. 1955 siedelt er in die DDR über, getrieben von Repressalien gegen den Linken und angezogen durch die Arbeit (zusammen mit Gerd Semmer) an einer Anthologie deutscher Gegenwartsprosa, die beim Verlag der Nation erscheinen sollte, sowie durch ein Studium am Leipziger Literatur-Institut. Hernach ist er an der Trockenlegung des Landstrichs Wische beteiligt, und es sind nicht unwirsch absolvierte Stippvisiten, aus denen seine Mitteilungen aus der Produktion kommen: chronistische Texte, die hinterm individuellen Lebenswandel den Wandel gemeinschaftlicheren Lebens ahnen lassen und nebenher Einblicke in das Werden Endlerschen Kunstverstands bieten. Den aufschauenden, auch formal schütteren „Winterlichen Notizen“ (1957) eines noch Außenstehenden folgen Anfang der sechziger Jahre handfeste Gebilde wie „Transportarbeiter“, die möglicherweise von Fühmanns Märchen-Ergründungen beeinflußte „Phantasie auf dem Schlackeplatz“ und „Nachts im Schwefel“, ohne die das scheinbar periphere „Damals die Balkone“ (1974), dieses gedrungene, prangend plebejische Stück, schwerlich hätte entstehen können. In einer Reihe mit dem enorm in sich ruhenden „Laubenpieperfriedhof“ steht, in seiner unangestrengten Kraftentfaltung, „Nachtschicht“: Unsre fünferlei Schritte / Sind der Geräusche Kern, deren herrschende Mitte auch dort noch, wo sie unhörbar sind, das heißt überall. Sie sind der Kern – heißt dies – allen Geschehens, mithin der Geschichte. Man besehe, mit welcher handwerklichen Noblesse Endler diese Essenz aufscheinen läßt in „Petrograd 1918“, der kongenialen Mandelstam-Übersetzung. Dämmerungen rasen über Rußland salzen, heißt es dort, und herauszulesen ist, daß Dämmerungen rasen und salzen oder daß sie salzig rasen. Wie dem auch sei: Zwielichtiges Unbeeinflußbare rast. Und als sich das Gefühl, dem ausgeliefert zu sein, ätzend einstellt, springt der Vers kostbar auf (unzulässigerweise interpunktiere ich):
Dämmerungen rasen über Rußland: salzen
Wirs mit Sprengstoff, jede Sichrung bricht.
Der Naturvorgang ist in unsere Tätigkeit gekehrt, die Dämmerungen sind wir. Geworfensein ist nun Werfen, Ohnmacht Allmacht. (Ohne daß die Ohnmacht sich ganz vergäße, denn natürlich sind wir nicht Dämmerungen.)
Merkenswürdig übrigens, wie in diesem Gedicht mit der Oktoberrevolution die antifaschistische spanische Erhebung in eins geschaut ist. Mandelstams Schwalbenflügel flüstern als Flügelflirren dicht wiedergegeben, läßt den Kugelhagel dicht des Interbrigadenlieds hallen.
aaaaa4
Der womöglichen Hoffnung, Endler nun doch – auf so andere Art – auf einen Begriff gebracht zu haben, zumal durch den Hinweis auf dessen internationalistische Texte („Santiago“, das in der ursprünglichen Druckfassung u. a. dem kämpfenden Vietnam zugedachte, im November 1965 gearbeitete Gedicht „Die abgeschnittene Zunge“), entheben ebendiese Arbeiten. Wenn die abgeschnittene Zunge, dies zuckende Fetzchen, davonschnellt, züngelnd, zündend, ein spitzes Flämmchen oder blutiges Lachen werdend, dann spürt man nebenher, daß Endlers Lyrik weniger, als es scheinen mag, dem Surrealismus nahesteht. Dieser ließ, sozusagen bewußt ordnungswidrig, das Unterbewußte ins Kraut schießen, um aus dem „Dienst einer absurden Ordnung zu treten, die auf Ungleichheit (…) besteht“ (Eluard). Sosehr diese Motivation Endler angehen mag – seine Bilder, auch dort, wo sie phantasmagorisch fluoreszieren, sind nicht rauschgeborene Gegenstücke der Dinge, wohl aber deren, der (freilich wie überhitzten) Dinge, genaue Hervortreibungen: man sieht, optisch, die materielle Gewalt der Lagerbrände aus der springenden Zunge hervorbrechen.
Wichtiger ist die Anmerkung, daß das sieghafte Frohlocken den Schmerz, den das Messer zugefügt hat, nicht unterschlägt. Das Lachen ist blutig. Man ahnt, daß Endlers Dichtung noch manch andere Art des Zungenschlagens mitteilt: lebendigstes zersingendes Hohnlachen und dessen Gegenteil, das Sich-bei-Atem-Halten, das Lebenbleiben durch Gesang (im Jessenin-Gedicht). Die Unruhe Endlerschen Sprechens erschöpft durchaus den Doppelsinn des Worts: motorische Seele des Uhrwerks sowie Verstörung. Was Wunder, daß Bewegung in den Gedichten hie die souverän weltgreifende von „Fahrerflucht“, da die verwerfende des „Bier-Holn-Laufen-Lieds“ ist – schon die frühe „Fahrradtour“ ahnt die Ambivalenz.
Ja, hie die Sehnsucht nach Bewegung („Die Brennessel“ oder „Nach einer Krankheit“), da die Sehnsucht nach Ruhe (das dies köstlich spinnert leugnende „Die Versuchung“ oder „Wünsche“) – sichtlich fällt es schwer, einen Nerv dieser Dichtung auszumachen. Denn höhnt sie, so desolat, und wo sie zirpt in schalksnärrischer Überdrehung, eben da ist sie schneidend provokant. Wenn Endler schroff anschreit (etwa die Kalten und falschen Seelenvollen in der „Ode auf eine vernachlässigte Sportart“), hört man im Oberton doch den besessen um kommunes Weltbessern einkommenden Moralisten heraus. Man beobachte, welch einander fern stehende Dichter A. E. vornehmlich konsultiert hat:. Jarry und Theodor Kramer, Chlebnikow und Karl Kraus.
Ist es freilich nicht schon deshalb überflüssig, diese Gedichte auf einen Nenner bringen zu suchen, weil das zu Nennende ja ändert? Kunst, eben indem sie im Wirklichen wurzelt, formt sich um unter dessen Umformungen. Auch wenn sie nicht nach dem sogenannten Zeitgeist greift, dem ändernden – der hat sie in Beschlag. Und so ist Änderung geradezu der Kunst Gütesiegel. Dies sei vermerkt zumal in Betracht entschlossener Versuche, die Kunst unseres Landes und ihre Brüche zur Reaktion auf das Erlebnis (bzw. Nicht-mehr-Erlebthaben) des Nazismus wegzuglätten.
Endlers (und seiner Generation) Zentrales ist (oder war) jedoch nicht die Bewältigung dieser Vergangenheit, sondern einer Zukunft, die, scheinbar in greifbarer Nähe, visionär im Oktoberlicht aufgeschienen war. Diese zu aller Anstrengung (und Überanstrengung) verlockende Vision hieß innerhalb einiger Jahrzehnte sich verschwisternde Menschheit, hieß marxsche erdumspannende Assoziation Gleicher und Freier. Wohin ging solche (zu) hochgespannte Erwartung über? In Trübsicht, in Klarsicht, in kalte Skepsis, ins Bewahren der Herausforderung in wütender Wonne? Und wie ging sie über?
Es ist ein langer Weg zwischen dem hoffnungsvollen „Ritornell“ und, zehn Jahre später, dem weltweisen optimistisch-tragischen „Februar“, zwischen dem irritierten „Verdammt das Weib aus Parterre“ und „Mit Howhannes Thumanjan“, jenem an Shakespeares 66. Sonett gemahnenden Bericht, oder aber zwischen der selbstsicheren Drastik von „Geborgenheit“ (1966) und der wärmenden Toleranz des „Liebesliedes für M.“ (1978). Ein, wie gesagt, langer und, wie gesagt, nicht unsymptomatischer Weg, der nicht durch 1956 und 1961 markiert zu sein scheint, wohl aber durch 65, 68 und das schismatische Jahr der Berliner Konferenz, 1976. Die Zeit Anfang der Siebziger schien eher zu Höhenflügen geneigt zu machen. Zunehmend gerät dieser Dichtung Regionales aus dem Blick. Dies mag mit einer (wahrscheinlich durch intensives Beschäftigen mit Arendts Werk Ende der sechziger Jahre beförderten) Kosmisierung der Sicht Endlers zu tun haben („Bilder“, „Februar“) oder mit der dringlicher sich zeigenden Selbstgefährdung der Menschheit („Reiseziel“, „Hunsrück II“). Sicher aber kommt dies auch aus dem Gefühl, daß das hier, in diesem Lande, Erfahrene und Erfahrbare von allgemeinster Geltung ist. (Belangvoll ist ja nicht ein Land, das ständig über sich denken macht, sondern inständig über sich hinaus.)
aaaaa5
Dieses Buch ist – nach Erwacht ohne Furcht (1960), Die Kinder der Nibelungen (1964), Das Sandkorn (1974), Nackt mit Brille (1975) und Verwirrte klare Botschaften (1979) – Endlers sechster Gedichtband: eine vorläufige Bilanz im fünfzigsten Lebensjahr. Die – von A.E. gebilligte – Anordnung versucht in immer engeren, innigeren Zirkeln zum Kern dieses Mannes vorzudringen. In vier Anläufen geht sie, sich vom äußeren Geschehen abstoßend, so etwas wie eine innere Biographie an, eine „Akte Endler“ eben (innerhalb der das gleichnamige Gedicht ja nur eine Seite unserm Erkennen anheimgibt). Das Wesen dieser Dichtung – so zeigt sich – ist plebejisch, und durchtränkt ist sie vom Nichtabtunkönnen (und damit Wachhalten) uneingelöster großartiger Erwartung. Der sie uns vorlegt, mag aufrührerisch-baudelairescher Kain sein wollen: doch an den wuchtenden Gelenken schimmert, schön in seiner Verwundbarkeit, Abel hervor, Diese Dichtung gibt eher den Hautlosen zu erkennen denn den Geharnischten. Bei purer Polemik jedenfalls hält sie sich nicht auf. Das kommt, weil Realismus noch immer über jedwede pappige Antinomie hinausuferte. Und Endler, wie vermutlich jeder bedeutende Künstler, ist – willentlich oder nicht – Realist. Sozialistischer? Der Begriff selber scheint bereits uferlos. Ich jedenfalls sehe kein Gedicht, in dem soziales Eingreifen nicht wenigstens mitschwänge – oder dessen Verhinderung. Die Gebilde, durch welche dieses Schwingen sich einem beinahe unmerklich mitteilt, in leisen, wie zerstreuten Widersprechungen, durchdringend wie Nieselregen – sie scheinen mir von Dauer. ,,Jessenin 1923“, oder der diesem Gedicht als illusionärer Gegenentwurf benachbarte, verzehrend lockende „Badetag“; die (vielleicht von Mickels „Freundin Schlaf“ angestoßene) „Ferien-Ballade“ oder die „Ballade vom Zionskirchplatz“ (der eine der benommenen Genossen diesseits der Tür ist kein anderer als Endler!); das von brüderlichem Mitgefühl, nicht etwa Spott eingefärbte „Epitaph auf einen Schönfärber“ oder das irritierte „Ich zog den Schlitten“, das das landläufige Zauberlehrlingslied entkindlicht und entaristokratisiert; „Grenadierstraße 1966“, von der Unmöglichkeit zu sprechen und der Unmöglichkeit zu schweigen handelnd, oder das rigoros-schüchterne Selbstverhör im Gedenken „An T.“, jene verlangende Liebende, hinter deren Zügen unversehens die der (oder einer?) Mutter nestwarm aufleuchten;. „Vor dem Abbruch unseres Hauses“,
sich in seinem dritten Teil sacht an uns alle wendend und nicht mehr nur Gemäuer meinend, oder das Gedicht von „Des Freundes Wettlauf“; in dem das gaunerhaft-ungeschlachte Wort „filzen“ vergeblich die Tränen zurückhalten soll – ist all das nicht herzschlagstockend schön?
Peter Gosse, Nachwort
Akte Endler
Und, siehe , sogar das andere „Mauer“-Gedicht, schon 1963 geschrieben, ist mit den übrigen Gedichten des Reclam-Bändchens Akte Endler (und zwischen ihnen versteckt) 1982 endlich durchgerutscht, das böse Epigramm jenem geradezu idiotischen und alsbald bitter bereuten Fehltritt der Mittleren Dichtergeneration (und auch meinem) gewidmet, zu dem wir uns Anfang der Sechziger aufputschen ließen. „Pro domo“ ist das Gedicht überschrieben; und „Nach Schließung der Zeitschrift Junge Kunst“: „Der Verse in langen Reihn / Als Mörtel zur MAUER trägt / Ach ach wie preist er den Stein / Mit dem man ihn dann erschlägt“ … Keiner vermag es im ersten Moment zu glauben; man fragt mich: „Steht das wirklich da?, gedruckt in diesem Jahr 82? Sag’ mir, daß ich träume!“ – „Kein bißchen geträumt! Den vier Zeilen wäre aber eine fünfte hinzuzufügen: ,Ja, Strafe … Strafe muß sein!’“ – PS.: Selbst Havemann müßte sich in diesen Versen wiedererkennen können, wenigstens ansatzweise.
Adolf Endler, aus Tarzan im Prenzlauer Berg, Reclam Verlag Leipzig, 1994
Die Akte Endler
– Eine Gedichtsammlung: Verlegerisches „Gefummel“ oder gelungene Zivilisationskritik in der späten DDR? –
Im Gespräch mit Jürgen Verdofsky, 2009 erschienen in der Zeitschrift die horen, bezeichnete Adolf Endler die in den achtziger Jahren bei Reclam veröffentlichte Akte Endler als „undurchschaubar“.1 Dem Dichter missfiel das Buch. Auch wenn die meisten für ihn wichtigen Gedichtarten, etwa „kritische Gedichte“ und „böse Gedichte“, zusammen „mit irgendwie heiteren aus früherer Zeit“ in dem Band abgedeckt seien, wäre Akte Endler für ihn nichts weiter als ein „Gefummel“,2 in dem der Lyriker unsichtbar werde. Bereits 1999 hatte er sich im Nachwort der gesammelten Gedichte Der Pudding der Apokalypse abwertend über die Reclam-Ausgabe geäußert. Darin sagte er, dass Akte Endler eine „ein wenig korrupte Kraut-und-Rüben-Kollektion“ sei.3 In diesem chaotischen Durcheinander gehe der wahre Endler unter.
Das genaue Gegenteil – so meine These – ist der Fall. Die Ausgabe, die Peter Gosse zusammengestellt hat, ist meines Erachtens ein akkurates Porträt von Endler und skizziert demnach die wahre Akte Endler. – Ob aber die Konzeption, über die ich im Folgenden sprechen möchte, tatsächlich von Endler, Gosse beziehungsweise dem Verlag so initiiert wurde, sei dahingestellt. Unklar ist auch, ob Endler im oben zitierten Interview mit Verdofsky auf die erste (1981) oder auf die zweite, erweiterte (1988) Ausgabe abhebt, oder ob er das gesamte Projekt Akte Endler bei Reclam meint.4 Darüber hinaus möchte ich vermitteln, in welcher Weise das Akte Endler-Projekt bei Reclam einen Dichter „durchschaubar“ macht, der in den achtziger Jahren „Undurchschaubarkeit“ gerade zum Konzept im Umgang mit der sozialistischen Diktatur erklärt hatte. Mit Blick auf die Studie „Die Verortung der Kultur“ (1994) des indischen Kulturtheoretikers Homi Bhabha möchte ich erklären, weshalb das „Gefummel“ Akte Endler der wahre Ort des Schreibens für einen Dichter in der DDR war.5
Der Ausschluss
Adolf Endlers Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR (SV) am 7. Juni 1979 auf einer Sitzung des Berliner Verbandes gemeinsam mit sechs, manche behaupten acht, Endler selbst meinte sieben6 anderen Mitgliedern, weil sie gegen die Statuten des Verbandes verstoßen hätten, steht am Beginn seines Wirkens in der deutsch-deutschen Literaturszene – aber nicht, weil er zurück in die Bundesrepublik zog oder die realexistierende Kulturpolitik in der DDR radikal bekämpfte, auch nicht, weil er sich zwischen die Stühle setzte. Seine Überlebensstrategie bestand im ständigen Hin-und-her-Bewegen zwischen den sich im deutschsprachigen Kontext anbietenden Teilkulturen. Dabei vermied Endler, sich auf eine Kultur festzulegen. Das Tempo, das er bei diesem verwirrenden ,Dialog zwischen den Kulturen‘ vorlegte, war sowohl für Autoritäten als auch für manchen Kollegen schwindelerregend schnell.7
Der Ausschluss 1979 brachte eine traumatische Erfahrung mit sich. Nicht, weil Endler jetzt Privilegien, die einem Verbandsmitglied zustanden, entzogen waren, sondern weil er und andere Ausgeschlossene, beispielsweise Martin Stade und Dieter Schubert, in der DDR blieben, und von Verbandsmitgliedern neu angeworben werden sollten, um als sogenannte Oppositionelle im Verband zu wirken, wie Endler in der Schrift Nächtlicher Besucher in seine Schranken gewiesen. Eine Fortsetzungs-Züchtigung reflektiert.8 Er habe sich allerdings bereits vor dem Ausschluss, so ist in den erkenntnisreichen Interviews mit Renatus Deckert nachzulesen, „innerlich völlig“ vom Verband distanziert. Danach besorgte er sich schleunigst einen anderen Schutzverein. An seiner Wohnungstür hing fortan die Notiz, er sei Mitglied des P.E.N.-Zentrums.9
Damit machte Endler auch erkennbar, dass er sich jetzt definitiv von der in den Statuten des SV festgeschriebenen „Schaffensmethode des sozialistischen Realismus“ abgewandt hatte. Doch hier sei Vorsicht geboten. So einfach lässt sich Adolf Endler nicht einordnen. Das Hybride, das für sein Leben und Schreiben in der SED-Diktatur ausschlaggebend ist, wird auch Endlers Platz in der Literaturgeschichte der DDR bestimmen. Nach Biermanns Ausbürgerung im November 1976 erfuhr die DDR-Literaturgesellschaft viele Veränderungen, die nicht auf einen einfachen Entweder-Oder-Nenner zu bringen sind. Erstens war, so Wolfgang Emmerich in seiner Kleinen Literaturgeschichte, eine Auswanderungswelle „von vorher unvorstellbaren Ausmaßen in Gang“ gekommen.10 Einige Schriftsteller, die in der DDR geblieben waren, wurden mit „gravierenden Drohungen“ konfrontiert, der staatsfeindlichen Hetze beschuldigt und inhaftiert.11 Andererseits kam es zu neuartigen Visa-Arrangements, die es manchem ermöglichte, mehrere Jahre im Westen zu leben, ohne die Staatsbürgerschaft zu verlieren. In beiden Fällen wurden die Autoren physisch aus der DDR ausgeschlossen. Gleichzeitig gab es „brisante Zensurfälle“ in der DDR, von denen insbesondere die Westmedien berichteten. Außerdem war es die Zeit, in der ostdeutsche Autoren begannen, engere Bindungen an westdeutsche Verlage zu knüpfen, was eine strengere Reglementierung der künstlerischen Elite nach sich zog. Am anderen Ende des Spektrums des sogenannten Leselandes DDR war eine wachsende Untergrundbewegung und die zwangsläufige Zunahme von IM-Aktivitäten zu verzeichnen. Wir wissen, dass vor allem junge Autoren den Kontakt zum Schriftstellerverband und zu sonstigen Berufsverbänden vermieden, was unter anderem dazu führte, dass sie nach neuen Foren suchten, um den Meinungsaustausch zu pflegen. Über die Stasi- und IM-Tätigkeiten von Poeten und bildenden Künstlern sowie von Musikern im DDR-Untergrund ist im Laufe der Zeit viel geforscht und veröffentlicht worden. Insbesondere Peter Böthig und Klaus Michael haben mit ihren Untersuchungen über Alternativkultur und Staatssicherheit zu diesem Thema die brauchbarsten Erkenntnisse zutage gebracht.12
Adolf Endler kann zudem als einer der wenigen Autoren gelten, die aus der älteren Generation heraus diese Foren frequentierten, um seine surrealistische, oder wie es nannte, seine Nebbich-Welt auszumalen und zu veröffentlichen. Er war also auch deshalb so schwer einzuordnen, weil er zugleich als Mentor in subkulturellen Kreisen und als Repräsentant der offiziellen DDR-Kultur fungierte. Das Besondere an Endler in den achtziger Jahren bestand aber darin, dass er sich in keine der oben beschriebenen Kategorien oder Gruppen einordnen ließ, weil er sich in verschiedenen Teilkulturen – in der offiziellen DDR-Kultur, im DDR-Untergrund und in Westdeutschland – gleichzeitig bewegte. Seine „feste Burg“ in diesem Unternehmen aber – und ich gebe zu, es klingt paradox – war der Surrealismus.
Endlers Surrealismus
Nicht beim (wahrscheinlich) unvermeidlichen Eklat mit der Kulturpolitik im Jahre 1979 wurden die Weichen gestellt, dass Endler auf die Suche nach neuen Vorbildern ging, mit denen er in eine Außenseiterposition abdriftete und seine unabwendbare poetische Wende vollzog. Im Interview mit Renatus Deckert führt Endler den, aus seiner Sicht, wahren Grund an:
Den schwarzen Humor hatte ich ja im Blut, das ist das Erbteil meiner belgischen Mutter. Und natürlich spielt der Surrealismus, auf den ich nach dem Krieg gestoßen war, eine große Rolle. Da erfuhr ich von der Existenz von André Bretons Anthologie des Schwarzen Humors, die ich jedoch erst später in die Hände bekam.13
Der Widerspruch zwischen seiner persönlichen Existenz und den optimistischen Texten, die in den sechziger Jahren entstanden waren, sei zu groß geworden.14 Er gibt zu Protokoll:
Das mußte früher oder später umkippen und sich in dem, was ich schrieb, äußern, auch wenn mir das zunächst gar nicht bewußt war. Irgendwann ist es mir aber wie Schuppen von den Augen gefallen, und von da an habe ich die DDR nur als Kuriosum abgehandelt.15
Zu seinem Stoff erklärte er fortan das Absurde, das seine Texte der achtziger Jahre prägen wird. Seit den Transportarbeiter-Gedichten, die in den frühen sechziger Jahren entstanden und im Gedichtband Das Sandkorn (1974) erschienen, war allerdings bereits deutlich seine Abkehr vom Sozialistischen Realismus und die Hinwendung zum Phantasmagorischen zum Ausdruck gekommen.16 Als ein willkommenes Projekt, das Endler motivierte, seine Poetik in der DDR neu zu bestimmen, kann die Nachdichtungsarbeit für die Anthologie Surrealismus in Paris 1919–1939, herausgegeben von Karlheinz Barck, gelten, die 1986 im Leipziger Reclam Verlag erschienen ist. Endler war hier Nachdichter von André Breton und Philippe Soupault.
Meine These möchte ich mit einem von Adolf Endler nachgedichteten Vers aus dem 1923er Gedichtband Clair de terre von Breton belegen. Darin heißt es:
In der anderen Welt die nie existieren wird.
Diese Zeile spricht Bände! Der Wunsch nach dem Anderen, die Realität neu zu ordnen, schlägt in Resignation um, doch zugleich wird die andere Welt im Akt des Schreibens, um mit Roland Barthes zu sprechen, realisiert. In seiner Nachdichtung hebt Endler die Existenz unterschiedlicher Realitäten hervor, die sich für ihn in den achtziger Jahren in der DDR auftun: in seiner Phantasie- und in seiner Publikationswelt.17
Die Anwesenheit von Abwesenden
Die erste Auswahl von Akte Endler 1981 bei Reclam ist in der heutigen Verlagswelt nicht mehr vorstellbar. Sie präsentiert einen Autor mit einem neuen Buch, der offiziell „nicht anwesend“ beziehungsweise unterrepräsentiert ist. Der Reclam Verlag in der Leitung von Hans Marquardt, mit Lektor Hubert Witt und mit Hilfe des Herausgebers Peter Gosse, der wie Endler zu den Vertretern der Sächsischen Dichterschule zählt, hat den Autor zurück in die Öffentlichkeit geholt. Oder ihn „literarisch anwesend“ gemacht. Als vergleichbares Beispiel wird bei Reclam die Entstehungsgeschichte von Wolfgang Hilbigs 1983 veröffentlichtem Band Stimme Stimme gelten. Ingrid Sonntag hat ausführlich über den verlegerischen und kulturpolitischen Werdegang des Hilbig-Buches berichtet.18 Dessen Autor hatte bis zu diesem Zeitpunkt, abgesehen von acht Gedichten in Sinn und Form (1980), keine Zeile in der DDR veröffentlicht. Als Dichter sei Hilbig in der DDR „abwesend“, aber andernorts präsent gewesen. Laut Sonntag wurde Hilbig „zähneknirschend“ „in Ostdeutschland ,literarisch anwesend‘“ gemacht.19 Endler ist nicht Hilbig. Gemeinsam ist beiden Autoren, dass sie „literarisch anwesend“ gemacht wurden: zuerst Endler mit dem Status eines „Unbequemen“, der in der ersten Ausgabe von Akte Endler wieder zu einem literarisch Anwesenden gemacht wurde, dann Hilbig mit dem Status des „Abwesenden“, dessen Stimme Stimme, zwei Jahre darauf, eine Erstveröffentlichung in der DDR darstellt.
Schon die Veröffentlichung von Akte Endler im Jahr 1981 war ein risikoreiches Unternehmen. Entgegen anderer ebenfalls bereits veröffentlichter „Unbequemer“, etwa Sarah Kirsch und Günter Kunert, die in die BRD umzogen, ist der unbequeme Dichter Endler in der DDR geblieben. Für die Veröffentlichung bei Reclam 1981 musste Endler Federn lassen. Doch es wurden auch neue Gedichte in die Auswahl aufgenommen, die weder in den Gedichtbänden Die Kinder der Nibelungen, Erwacht ohne Furcht und Das Sandkorn in der DDR, noch in Nackt ohne Brille (1975) und Verwirrte klare Botschaften (1979) in der Bundesrepublik erschienen waren.20 Nicht nur gegenüber Jürgen Verdofsky und Thorsten Ahrend beklagte sich Endler über die Ausgabe Akte Endler. Auch Reclam-Lektor Witt erinnert sich. Der Lyriker sei mit dem Band, in der Form, wie er erschien, unzufrieden gewesen. Auch fünf Jahre nach der Biermann-Ausbürgerung hatte sich nicht verhindern lassen, dass die Widmung „Für WB.“ über dem Gedicht „Der Geräuschemacher“ entfernt und andere, scheinbar kosmetische Korrekturen vorgenommen wurden. Andererseits wurde das Gedicht „Pro Domo“, in dem Endler seine anfängliche Befürwortung des Mauerbaus revidiert, stillschweigend aufgenommen.21
Das Risiko dieser ersten Ausgabe von Akte Endler bestand somit weniger in ästhetischen Auseinandersetzungen, sondern im politischen Spiegelbild seiner Auswahl. Ein Beispiel: Texte, die in den sechziger Jahren in der DDR entstanden waren (Erwacht ohne Furcht, 1960), erschienen, nahezu ein Jahrzehnt später, überarbeitet wieder in einer Westausgabe (Verwirrte klare Botschaften, 1979), bevor sie 1981 erneut in der DDR herauskamen. Bemerkenswert ist zudem an dem Gedicht „Dreieck – in dem ich wohnte – Düsseldorf“, dass darin zwei Strophen der Originalfassung, das heißt von Erwacht ohne Furcht, weder in die Rowohlt– noch in die Reclam-Ausgaben aufgenommen wurden. Warum? Die propagandistischen Verse, 1958 noch en vogue, waren nach dem Mauerbau ideologisch obsolet. Auf die Wünsche seiner Spielkameraden in der Nachkriegszeit in Westdeutschland rückblickend, hatte der in der DDR gestrandete Endler angegeben:
Manche erstickten später mit ihren Träumen
in zugeschütteten Kellern.
Manche verrieten später ihre Träume
für Braunhemd und Dolch.
Andere reiften mit ihren Träumen
später zu Klassenkämpfern.22
In Akte Endler von 1981 keine Spur mehr von diesen überpolitisierten und ästhetisch unreifen Textstellen!
Als sprichwörtlicher Aderlass muss der Verzicht auf die neuen, in den siebziger Jahren entstandenen sogenannten Nebbich-Texte gelten, die Anfang der achtziger Jahre entweder in Verlagen der Bundesrepublik oder in Kleinzeitschriften im DDR-Untergrund erschienen waren.23 Aufgenommen wurden insgesamt nur 15 unveröffentlichte, in der Mehrzahl neue Gedichte, sodass das ganze Konzept von Akte Endler 1981 tatsächlich einem editorischen Chaos glich. Auch wenn der Herausgeber Peter Gosse in seinen Nachbemerkungen das Konzept der oben ausgemalten „Kraut-und-Rüben“-Auswahl unberührt lässt, ist der Inhalt des Nachworts aus anderen Gründen gleichwohl als gewagt zu bezeichnen. Das Porträt des hier vorgestellten Dichters sei „fratzenhaft“, „aggressiv“, „siedend“, sein Schreiben „satanisch“ und „zerstörungsgierig“.24 In einer erweiterten Fassung der Nachbemerkungen mit dem Titel „Dichter Endler“, die in Gosses Essayband Mundwerk (1983) erschienen, spricht der Herausgeber in seinen Einlassungen zum Gedicht „Das Sandkorn“ sogar von „blanker Aufruhr“.25 Der Herausgeber tat, was er konnte, um den Leser auf die neue, subversive Schreibart aufmerksam zu machen. Hervorgehoben werden die drei wichtigsten Merkmale der Lyrik Endlers: erstens der Dialog mit Vorgängern und ihren sich oft widersprechender Poetiken („Jarry und Theodor Kramer, Chlebnikow und Karl Kraus“), zweitens das „blutige Lachen“ beziehungsweise das Hohnlachen und schließlich, drittens, das im Surrealismus verankerte Absurde.
Der Teil V
Erstaunlich ist, dass Herausgeber Gosse seine Nachbemerkungen zur 1981er-Ausgabe (Untertitel „Gedichte aus 25 Jahren“) in der zweiten, erweiterten 1988er-Ausgabe (Untertitel „Gedichte aus 30 Jahren“) unverändert übernimmt und mit einem „PS 1986“ versieht. Darin heißt es: „[e]ine Korrektur des Nachworts scheint mir nicht vonnöten.“26 Erstaunlich auch deshalb, weil diese Ausgabe mit einem neuen fünften Teil doch einige editorische Paukenschläge enthält. Selbstredend ist diese Erweiterung nur im Nachhinein als aufsehenerregend zu bezeichnen. Bekanntlich war Akte Endler nicht die einzige Veröffentlichung, die 1988 „außer der Reihe“ erschien. In seinem knappen, einseitigen PS geht Gosse zwar auf die Besonderheiten von Teil V ein, über das Genretechnische der Texte und die Intensivierung der surrealistischen Grundhaltung verliert er ebenso wenig ein Wort wie über die Erstveröffentlichungsorte der Texte. Doch dort lagert die Sprengladung.
Was hat es mit den Quellen der Texte in Teil V in der zweiten, erweiterten Ausgabe auf sich? Am 20. Februar 1984 hatte Endler an Lektor Witt ein – wie es im Begleitbrief heißt – „extra-ordinär absurdes Manuskript, wenigstens für unsere Verhältnisse“ geschickt. Auch wenn es bei DDR-Lektoren bloß „ratloses Achselzucken bzw. Kopfschütteln“ erzeugen wird, Reclam biete er das Manuskript aber zur Veröffentlichung an, auch wenn das Ganze ein großes „verlegerisches Risiko“ sei – ungeeignet für eine Aufnahme in die Universal-Bibliothek, doch geeignet als Sonderdruck, „sicher nicht ohne entsprechende graphische Zutaten“. Nach zwei Monaten ließ Witt schriftlich wissen, er habe „zwei gescheite Lektoren“ gewonnen, die das Projekt angingen.27 – Bei Reclam sollte die Ausgabe nicht erscheinen. Sonntag berichtet in ihrem Aufsatz auch darüber, dass Hilbigs Stimme Stimme 1983 nicht in der Universal-Bibliothek erscheinen durfte, stattdessen dafür eine neue Reihe mit Klappenbroschur kreiert wurde.28 So liegt in Endlers Angebot nicht nur ein spöttischer Ausdruck seiner gewandelten ästhetischen Positionen über das „Kuriosum“ DDR, sondern auch viel Solidarität mit dem gemaßregelten Hilbig und mit seiner Selbstempfehlung für die Reihe auch ein wohlüberlegtes Signal für Anschlussmöglichkeiten im offiziellen Literaturbetrieb der DDR. Nebbich erschien 1985 im West-Berliner Rotbuch Verlag – ohne alle „graphischen Zutaten“ und mit dem anspielungsreichen Titel Ohne Nennung von Gründen.29 Und Hilbig, der 1985 die DDR verließ, blieb der einzige Titel in der neuen Reihe vorbehalten. Hubert Witt trat 1986 eine Dozentur am Leipziger Literaturinstitut an, im Jahr darauf schied Hans Marquardt aus dem Verlag. Endler bekam einen neuen Lektor – Klaus Pankow.
Im Teil V der zweiten, erweiterten Akte Endler waren zehn von 33 Gedichten dem Rotbuch-Band Ohne Nennung von Gründen entnommen. Wiederum acht Gedichte stammen aus den Samisdat- beziehungsweise originalgrafischen Zeitschriften MIKADO, schaden, UND und USW, die nun in dem DDR-Band offiziell erschienen.30 Eine weitere Besonderheit in Teil V besteht darin, dass das Gedicht „Unterm ,Großen Wagen‘“ aus dem Jahr 1958, ersterschienen im Band Die Kinder der Nibelungen, im Rotbuch-Band Vermischtes aus dem poetischen Werk des Bobbi „Bumke“ Bergermann 1985 korrigiert wiederveröffentlicht und auch 1988 in Akte Endler. Gedichte aus 30 Jahren untergebracht wurde. Das heißt, dass Teil V alte, neue und korrigierte Gedichte enthält, darunter Politisches, Heiteres und (wie Gosse es nennt) „Wortflickflack[s]“, und es darüber hinaus von verschwimmenden Genregrenzen wimmelt.
Die Tatsache, dass die Gedichte aus Teil V erstmals entweder in westdeutschen oder in DDR-Ausgaben veröffentlicht wurden, die sowohl in offiziellen DDR-Verlagen als auch im Untergrund erschienen waren, macht die erweiterte, also 1988er-Ausgabe von Akte Endler zum Unikum in der Verlagswelt der DDR. Zusammen mit dem thematischen Durcheinander der ersten Edition kann jetzt erst recht von einer „Kraut-und-Rüben-Kollektion“ die Rede sein. Das große Durcheinander, also das „Gefummel“, erschafft die wahre Akte Endler. Mit dem hybriden Gesamtprojekt Akte Endler hat Reclam erstmals und umfassend die Ästhetik Endlers dargestellt.
Wolfgang Emmerich beschreibt in seiner Kleinen Literaturgeschichte der DDR die Literatur der (Vor-)Wende als eine „Literatur als Zivilisationskritik“. Hiermit zielt Emmerich vor allem auf die Literatur, die entweder in der DDR oder von Ausgebürgerten, Ausgereisten geschrieben im Westen erschien. Emmerich bezeichnet mit in der DDR erschienener Literatur entweder die in offiziellen Verlagen oder in der sogenannten „alternative[n] Literaturszene“ verlegte Literatur.31 Er – wie viele Literaturhistoriker, die die Spätphase in der DDR unter die Lupe nehmen – ignoriert die Gleichzeitigkeit von Editionsprozessen, wie sie in Akte Endler nachgewiesen wurden.32 Jene „hybriden“ Ausgaben entziehen sich einer eindeutigen Klassifizierung oder Verortung. Ihnen eignet ein hohes Maß an Zivilisationskritik. Akte Endler und Endlers literarische Welt existieren außerhalb des Greifbaren, des vorgegebenen Rahmens der Realität. Zugleich kehrt der Autor stets wieder in die von der offiziellen Kulturpolitik akzeptierte reale Welt zurück. Die kulturelle Identität, die Endler repräsentiert, ist deshalb so schwer zu bestimmen, weil er sich zwischen Präsenz in der DDR und Abtauchen in den Untergrund bewegt. Damit kreiert er eine sogenannte Culture in-between, die Homi Bhabha als idealen, wahren kulturellen Ort unserer Gegenwart bestimmt. Schreiben unter dem Vorzeichen dieser Verortung schließt den Kompromiss und die Assimilation aus.33 Innerhalb der kulturellen Hegemonie bestehen Teilkulturen, die unterdrückt oder marginalisiert werden. Diese frequentiert Endler. Akte Endler dokumentiert einen besonderen Ort in der Kultur. Der Ort, den Endler wählt, ist, laut Bhabha „the Third Place“, der Platz, an dem sich die eigene Stimme entwickeln kann. Diese Stimme ermöglicht ihm einen Dialog mit den verschiedenen marginalisierten und etablierten Stimmen.
Epilog
Das Jahr 1988 war ein besonderes Jahr. Es steht zwischen dem Jahr nach dem X. Schriftstellerkongress, auf dem Christoph Hein die Zensur in der DDR anprangerte, und dem Jahr vor dem Mauerfall. Das Jahr bot viel Raum für verlegerischen Anarchismus im kulturpolitischen Chaos. Mit anderen Worten, die 1988er-Ausgabe ist eine typische (Vor-)Wende-Veröffentlichung, ein Produkt von sich oft widersprechenden Bewegungen in der Verlagswelt, der herrschenden, dann wieder gelockerten oder veränderten Kulturpolitik der DDR. In der Zeit des Krawarnewall34 wurde von Autoren, Verlegern und Lektoren ein kulturpolitischer Kontext geschaffen, der zwar nicht eindeutig, doch umso spannender war. So stellt sich auch die Frage nach dem kulturellen Umfeld der zweiten Ausgabe von Akte Endler, insbesondere nach der Verlagsposition zu seinem Hausautor Adolf Endler und dessen Herausgeber Peter Gosse?
Endler hatte am 9. September 1980, also wenige Monate vor der Veröffentlichung der ersten Ausgabe Akte Endler, in einem Brief an Peter Gosse geschrieben, dass er die Auswahl als „ganz großartig“, „wirksam“ und „literaturkritische Leistung“ preise.35 Ohne Zweifel tat der Autor seine Freude über seine erste Veröffentlichung kund. Hervorzuheben an Endlers Lobpreisungen, die sich 19 Jahre später zu der „ein wenig korrupten Kraut-und-Rüben-Kollektion“ umformulierten, ist das Wort „wirksam“. Das textuelle Gewirr, jene „Kraut-und-Rüben“-Auswahl oder jenes „Gefummel“, das die beiden Ausgaben von Akte Endler ausmacht, ist deshalb „wirksam“, weil sie unterschiedliche Charakterisierungen ihres Autors je nach Sehweise ermöglichen. Dieser Autor provoziert, indem er nicht nur im einzelnen Text, sondern auch in der Art und Weise, wie die Ausgabe Akte Endler zusammengestellt wurde, eine Identität ausmalt, die unfassbar und nicht einordbar ist.
Gerrit-Jan Berendse, aus Ingrid Sonntag (Hrsg.): An den Grenzen des Möglichen. Reclam Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, November 2016
Von der Kunst des Ruinierens
Auffallend ist die Manie, mit der Endler von früh an die „tz“-Effekte (nebst „st“- und „sch“-Klängen) in seinen Texten einsetzt und mit Inhalt verknüpft. Die Manie könnten wir durchaus im Sinne von Manierismus verstehen, denn auch im späteren Werk kehrt das Spiel mit den Konsonanten zurück. Peter Gosse geht in diesem Zusammenhang ausführlich auf die Besonderheit der „schrillen Lautgruppe RI“ in dem im Auswahlband Akte Endler enthaltenen Gedicht „Für Edgar / Das Lehrgedicht aus den Heften des irren Fürsten“. Das Manieristische in der wiederholten Verwendung von scharfen, spitzen Lauten, unterdessen auch von Bildern solcher Art geht – auf den Dichter Endler selbst bezogen – ins Masochistische über. Es scheint, als brauche er das Spitze in seiner Nähe, als Antrieb für das Dichten. Sein Schreibtisch ist mit einer Brennessel geschmückt:
Auf meinem Tisch liegt eine Brennessel bereit
So daß die Zähnchen meine Hand verbrennen können
Die schreibt O öde Zeit der mangelnden Gelegenheit
Erfreut beim Dichten sich die Finger zu verbrennen
Die als Ersatz besungene Brennessel ist hier keine Waffe, die die Oberschicht einer jeweiligen Ordnung aus der externen Welt antastet, sondern eher ein der masochistischen Wollust des Dichters dienendes Instrument. Hier liegen Selbstgenuß und Selbstzerstörung nah beieinander, beide dienen sie der Entblößung.
Eine ähnlich entblößende Wirkung hat das Lachen. Das Lachen gehört mit anderen körperlichen Ausdrucksformen wie Tanzen und Singen zu den Gebärden, die oft mehr aussagen und benennen als das ausgesprochene Wort. Im Lachen stellt man nicht nur sich selbst bloß als „kopflosen Leib“, sondern auch andere, zerstört man geltende Werte. In seinem Essayband Die Auferstehung des Körpers im Text (1985) behandelt Christiaan L. Hart Nibbrig das Lachen als Sprache des Leibes, bezeichnet er diese Ausdrucksform einerseits als dionysischen Rausch der Selbstvergessenheit („Kopf-ab-Orgien“), andererseits als entlarvende Tätigkeit („das produktiv Spaltende, Aufsprengende“). Mit Nietzsche schreibt Hart Nibbrig:
In einem über-menschlichen Lachen äußert sich die befreiende Lust solcher Kopflosigkeit, das Glück, mit dem Leib zu reagieren, endlich einmal vom zerebralgelähmten Kampf befreit zu sein, alles in theoretischer Gefräßigkeit dem eigenen Willen zur Macht untertan zu machen, und zur Architektur eines Sinnzusammenhangs, dessen lachend preisgegebene Bindungskräfte Zerstörungsenergie freizusetzen, zu totalisieren […].
In der Zeitschrift Blätter und Steine erschien 1934 der Essay „Lob der Vokale“ von Ernst Jünger, in dem er im siebten Abschnitt das Lachen nach Klängen klassifiziert. Nach Jünger ist nicht jede Art des Lachens gleichwertig, denn es gibt in diesem Zusammenhang ein weites Spektrum.
Als vollkommen angenehm empfinden wir eigentlich nur das Lachen auf A, weniger das auf O, während das E bereits bedenklich klingt und das Hämische streift. Als durchaus bösartig betrachtet man ganz allgemein das Lachen auf I, aus dem man Spott, Ironie, verhüllte Schadenfreude und Schlimmeres hört.
Diese letzte Form meint Hart Nibbrig wohl, wenn er vom „über-menschlichen Lachen“ spricht. An dieser Form haftet etwas Ruinöses, da sie bestimmte menschliche Werte mißachtet, besser: zerstört. Jünger verknüpft dieses Gelächter, das Lachen auf I, mit dem Wort „Kichern“, wobei er hinzufügt, daß er diese Laute „häufig von gnomenhaften und verwachsenen, aber auch von ausgesprochen geistreichen Personen vernimmt. […] Endlich spielt in diesen Laut die Welt des Wahnsinns ein.“
Was Ernst Jünger im Jahre 1934 abwertet, ist 1962 für Karl Mickel gerade Gegenstand des Lobs in seinem „Porträt A.E.“. Die Fähigkeit des Lachens (und Weinens) ist unmittelbar mit der artistischen Begabung des Springens, Singens und Schwingens (dreimal ein I-Laut) verbunden:
Ich kann auf den Haaren laufen.
Und sie sieht, wie er springt
und sie hört, wie er singt
und sagt: Ich steh niemals mehr auf.
Und er nimmt sie und schwingt
sie durchs Zimmer und trinkt.
Als Selbstcharakterisierung betont Endler in einem Interview die gnomenhafte, geistreiche und zugleich „wahnsinnige“ Ausdrucksform im Tanz:
[…] ich kann überhaupt nicht tanzen im üblichen Sinn; hin und wieder tanze ich in meiner Bude, wenn ich allein bin und unbeobachtet, mit den skurrilsten Verrenkungen wild vor mich hin […].
Das Singen, der Tanz – jenes Springen und Schwingen –, das Lachen, in der Form des Kicherns, und das Trinken verursachen den „dionysischen Rausch der Selbstvergessenheit“, von dem Hart Nibbrig spricht.
Schon ganz früh wird aber deutlich, daß Endler den „dionysischen Rausch“ über die Beschränktheit der eigenen Lebenswelt hinaus produktiv machen will. So müssen wir die Frage im Text „Postkarte, im Regen geschrieben“ bejahen.
Wo Tiere nach Pilzen geschürft im Fichtendickicht,
hock ich geschützt und mische mir Tee und Branntwein.
Störts mich, daß niemand mein Lachen hört,
das aus dem Mund mir sprudelt irrlichterhaft,
wenn ich den Branntwein getrunken hab…?
Im Gedicht „Hohnlachen“ aus Das Sandkorn betont Endler, daß das Lachen, „das aus dem Mund mir sprudelt irrlichterhaft“ auch eine gesellschaftliche Dimension enthält. Der erste, als „Privates Hohnlachen. Für V…“ bezeichnete Teil des Gedichts geht in den zweiten Teil über; dieser trägt den Untertitel „Gesellschaftliches Hohnlachen. Für F. J. S. (Plakatverse für die Weltfestspiele 73)“.
Die letzte Lachtirade, gerichtet an den 1988 verstorbenen Bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, ist aus Versen des privaten Hohnlachens zusammengestellt. Vergleichen wir die letzte Strophe des ersten Teils mit dem Vierzeiler des gesellschaftlichen Hohnlachens:
1
[…]
Mich auszutilgen du versprachst es ach
Ich lachend lachend tanz auf deinem Dach
Ich schlürf dich aus dem Schnee ich halt dich wach
Du sollst es hören wie ich lach und lach
2
[…]
Und auszutilgen du versprachst es ach
Dem lachend ich den Viererreim vermach
Ein Lachen schmückt als Fahne unser Dach
Du kannst nicht hindern daß ich lach und lach
Das Lachen/Kichern ist nicht nur ein Instrument zur Ausstattung der fiktionalen Landschaft eines eigenbrötlerischen Dichters, sondern hatte gleichzeitig eine subversive Funktion innerhalb der umzäunten „Literaturgesellschaft“. In solcher Funktion können wir das erbarmungslose, unnachsichtige Lachen als Satire bezeichnen – sie bekämpft Normen und verurteilt Konventionen zur Lächerlichkeit. Damit fügt sich Adolf Endler in das literarische „Ensemble der Außenseiter“, das sich mit dem Lumpenproletariat und den Kriminellen verbunden fühlt und mit seinen Spottliedern „direkt auf den Feind zugehen und das ohne Rück-Sicht auf Normen“. Dieser von Walter Fähnders 1987 beschriebene „Aktionsanarchismus“ bei deutschen Dichtern wie Erich Mühsam („Der Revoluzzer. Der deutschen Sozialdemokratie gewidmet“) und Conrad Fröhlich („Selbst-Erhebung“: „Was sind mir Schiller und Göthe? / Die Dichter der Bourgeoisie! / Ich blas’ die feinere Flöte, / Und hebe mich über sie“) hat der Dichtung durch die Verwendung von einem „aufs ,Ordinäre‘ zielenden Vokabular“ ein hohes Maß an „Asozialität“ vermittelt.36
Dieser „asoziale“ Status wird von Endler im ständigen Zerkratzen der glatten „Oberschicht“ der „real existierenden“ Verhältnisse in der ihm umgebenden Gesellschaftsordnung weitergegeben. Nichts, was ganz und fertig erscheint, ist sicher, Dogmen werden durchlöchert, wonach der Alterungsprozeß eintritt. Im Ruinieren, so können wir behaupten, ist Endler ein Vorkämpfer, alle Bereiche, in denen er arbeitet, sind ephemer. In einem 1980 geführten Gespräch mit Gregor Laschen und Ton Naaijkens berichtete er:
Aus sehr komplexen, nicht am wenigsten sozialen Motiven heraus […] ist mein Schreiben seit längerem ein stetes Anschreiben gegen Festgeschriebenes geworden, und stamme es aus der eigenen Feder.
Das Festgeschriebene bezieht sich sicher nicht zuletzt auf den Staat als durchorganisiertes Gebilde, innerhalb dessen Endler mit dem Sandkorn agierte. Gerade im Titelgedicht von Das Sandkorn – geschrieben im Jahre 1967 – fügen sich die Techniken des Ruinierens zusammen, die das scheinbar Undurchdringliche und Harmonische zum Mythos machen. Etwa treten „tz“-Klänge (Ätzen) und I-Laute (Kichern) im Einzelwort vereint auf:
Witz kritzelt glitzernd spritzend, Schmerz schlitzt dich auf, ein Blitz,
Gekicher, ,O Erbarmen!‘, ringsum vieltausendspitz –
Etage um Etage durchwandre ich den Staat…
Jenes spitz-gewitzte Sandkorn, das in „dreißig, in hundert, in tausend Stück“ zerfällt, wandert, nachdem es viel Staub mit sich geschleppt hat, schließlich 1976 in die „Akte Endler “, die zu einer Kaderakte in Gestalt einer Verbrecherakte angewachsen ist:
Eine Anthologie zweibändig nicht als Bedenken
Ergo das Ganze so etwas wie Pornographie
Und wirklich nur für die privilegiertesten Leser
Charaktere die absolut nichts mehr umschmeißt.
Sich selbst als schmutzigen, „asozialen“ Vagabunden kennzeichnend, attackiert Endler jenen berühmt gewordenen Satz von Erich Honecker auf dem 11. Plenum des ZK der SED am 15. Dezember 1965, damals noch in der Funktion des Vorsitzenden der FDJ:
Unsere DDR ist ein sauberer Staat.
Direkt auf Wolf Biermann anspielend, agierte Honecker gegen die pornographische, brutale und „anti-humanistische Darstellung“ in Texten der „rebellischen Jugend“, welche von der „amerikanischen Unmoral und Dekadenz“ infiziert worden sei. Statthalter der humanistischen, sauberen und somit sozialistischen Kunst war der 1958 verstorbene Dichter und Kulturminister Johannes R. Becher. Becher vertrat die Harmonie vom Wahren und Schönen in der sozialistischen Literatur und entwickelte – zurückgreifend auf das „kulturelle Erbe“ der Weimarer Klassik – die Vorstellung von der DDR als eine „Literaturgesellschaft“. Zwei Jahre vor seinem Tod erschien in der Zeitschrift Sinn und Form Bechers Essay „Philosophie des Sonetts oder Kleine Sonettlehre“, in dem folgender kennzeichnender Satz steht:
Symmetrie, Proportionalität, Harmonie, all diese Elemente gehören zu der Architektur des Sonetts –, und kein anderer Gedanke kann sich im Sonett äußern als der, welcher auch der Gesetzlichkeit des Schönen Genüge tut.
Außer der Formulierung dieses Ausschließlichkeitsgesetzes typisiert Becher den Feind seines festumschriebenen Konstrukts der „Literaturgesellschaft“:
Den gefährlichsten Gegner findet die Sonettkunst in denen, die sie ausüben und dabei den Vierzehnzeiler an die Stelle des Sonetts setzen.
Die Deformation des Sonetts wäre ein krimineller Akt, nicht bloß eine poetologische Stellungnahme. Endler hat das Feindbild Bechers erkannt und provoziert, indem er als kriminelle, anarchistische Randfigur in Akte Endler nicht nur ein „Gegen-Sonett“ präsentiert (nehmen wir die Querstriche im ersten Teil des Gedichts als Vers-Enden, zählen wir genau vierzehn Zeilen), sondern darüber hinaus Bechers Literatur- und Kunstauffassung direkt angreift.
[…] Hält sich noch nicht einmal
wenn er wieder rumhuren / Zieht (wöchentlich bis zu
sieben Mal) und volltrunken dann / Vor ganz häßlichen
Worten über unseren Johannes R / Becher zurück und
vor allem dessen Sonettkunst
Wie festumrahmt die Kaderakte über Endler auch scheinen mag, in der „Literaturgesellschaft“ und in der eigens konstruierten Ruinenlandschaft blieb das Werk und die Person des Dichters ein unfaßbares und undurchdringliches Phänomen, sprunghaft und gesprungen, oder auch: nebulös. – NEBBICH, wie sein schon Mitte der siebziger Jahre angekündigtes (angedrohtes?) Prosa-Konvolut heißen wird. – Scharfe Konturen bekommt Endler erst in den sein Werk begleitenden Porträts der Freunde und Kollegen. Dort und im eigenen Werk wird ein Bild evoziert, das an den legendären, hündisch-anarchistischen Diogenes erinnert. In den Texten tauchen typische Merkmale des „Kynismus“ auf. Das Medium des „kynischen Protests“ des angeblich in einer Tonne lebenden Diogenes ist der groteske Leib, als die Reduktion der Existenz auf einen animalischen Kern. Die Nähe der Diogenes-Legende provoziert jedoch direkt die Relativierung dieser Verwandtschaft – die Ähnlichkeit täuscht, denn als so dogmatisch und spartanisch, wie Diogenes gegen die Vielstimmigkeit der polis agierte, darf Endler keineswegs bezeichnet werden. Vielmehr war die polis „DDR“ spartanisch und ihr Kritiker vielstimmig zu nennen. Zwar setzte Endler seinen Körper als lyrisches „Kampfmittel“ ein, dieser befand sich jedoch, wie die ganze „Endlereske“ Szenerie, im Zustand des Verfalls, ließ sich also nicht auf eine Waffe des existentialistischen Protests reduzieren.
Gerrit-Jan Berendse, 1990, in Gerrit-Jan Berendse: Die „Sächsische Dichterschule“. Lyrik in der DDR der sechziger und siebziger Jahre, Verlag Peter Lang, 1990
Anschreiben gegen Festgeschriebenes
− Gespräch mit Adolf Endler. −
Adolf Endlers Werk der 1980er Jahre einzuordnen, war für Kritiker im Westen Deutschlands eine Herausforderung, für Kritiker im Osten Deutschlands, wegen der dort praktizierten Zensur, öffentlich kaum möglich. Helmut Heißenbüttel schreibt 1981 über Endlers Textsammlung Nadelkissen. Ich kenne kaum ein Werk der unmittelbaren Gegenwartsliteratur, das so genau und so wort-ökonomisch den Zustand umreißt, in dem wir leben, ohne etwas preiszugeben. Und das dennoch immer wieder, wie durch Gucklöcher Ausblick gestattet.“ Gerrit-Jan Berendse findet [in Anlehnung an Michail Bachtin] für Endler die Formel des ,grotesken Realismus‘: „Endler entpuppte sich als ein GARGANTUA in DDR-Format. Er konsumierte und entlarvte zugleich. Er rülpste, was einmal auch seine ,Utopie‘ war, aus: und siehe, es waren die Sonntagsreden des realen Sozialismus.“ Anläßlich Endlers 75. Geburtstag, der 2005 in Berlin und Leipzig von Kollegen mit Lesungen aus seinem Werk gefeiert wurde, schrieb Katja Lange-Müller:
Nicht drucken konnten sie ihn wohl, unterdrücken aber nicht, weil das Nicht-Gedruckt-Werden ihn erst recht unter Schreibdruck setzte und nötigte, das so Gehärtete selbst vorzutragen – mit kaum konspirativ zu nennender Brillanz, und gerade das ihn populär machte, zunächst bei uns Buddelkindern vom Prenzlauer Berg, diesem ,zweifellos extraordinären Kontinent der DDR-Welt (der dennoch immer DDR-Welt blieb)‘ dessen ,Tarzan‘ er wirklich und nach eigenem Bekunden war.
Ich traf Adolf Endler am 18. Februar 2006 in dessen Berliner Wohnung. Wir saßen uns in seiner Bibliothek an einem großen Tisch gegenüber. Die Länge unseres Gespräches maß sich an Endlers Konstitution. Mehrmals wurden Pausen eingelegt, da Medikamente eingenommen werden mußten. Aber sein Interesse an der Fortführung unseres Gespräches war groß. Brigitte Endler wurde stets erfolgreich beruhigt. Meine Intention war es, dem Faszinosum Endler, der wohl seltsamsten grauen Eminenz, die jemals von den Literatur-Beamten der DDR einzuordnen war, auf die Spur zu kommen. Seine Existenz in der DDR sei ziemlich rätselhaft gewesen, sagte Endler:
Die Leute wußten nichts mit mir anzufangen, weder die Offiziellen noch die Widerständlerischen. Die wußten nicht, warum ich mich so und so bewege. Eines Tages bin ich dazu gekommen, mich als etwas Vaganten- und Zigeunergeigenhaftes zu charakterisieren, um mich für die Leute irgendwie handhabbarer zu machen.
Dies hatte u.a. zur Folge, daß er im Westen Deutschlands als eine Art DDR-Beatnik angesehen wurde, obwohl er alles andere als ein spontaner Schreiber gewesen sei und seine Texte acht bis zehn Mal umgeschrieben hatte. Seine Collagen – u.a. Ausschnitte aus dem Neuen Deutschland collagiert mit Sprüchen von der Straße, von Endler als Prä-Trash-Kunst bezeichnet – stießen weitestgehend auf Unverständnis: „Daß es sich da sozusagen um einen Schwitters in anderer Umgebung handelt, das wurde sehr schwer begriffen.“ Wir sprachen dann u.a. über Heinrich Heine, und ich wünschte mir spontan, Endlers wichtige Feststellungen würden ungekürzt in Lexika und Schulbücher übernommen, um das deutsche Heine-Bild vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es folgte ein Exkurs in die DDR-Literaturgeschichte, der so auch in keinem Lehrbuch zu finden sein wird. Etwa: wie der Rausschmiß aus dem DDR-Schriftstellerverband die nackte Todesangst vor der DDR-Staatssicherheit besiegen helfen konnte. Nach zwei Stunden lenkte Adolf Endler, die Fürsorge seiner Frau achtend, ein und beendete das Gespräch. Wir plauderten dann noch über allerlei, und tranken etwas – seine Frau und ich Wein, Adolf Endler Wasser.
Axel Helbig: Herr Endler, Sie sagten einmal Sie hatten von Ihrer Mutter „diesen etwas merkwürdigen belgischen Witz“ mitbekommen. Was darf man sich unter diesem Erbteil vorstellen?
Adolf Endler: Im Grunde empfinde ich mich, wenigstens was die Sprachmelodie betrifft, die in die Schrift übergeht, als ziemlich düsseldorferisch. Manchmal wundere ich mich über mich selbst und weiß nicht, woher eine bestimmte Art von schwarzem Humor kommt. Dann denke ich gern, daß es mit meiner Mutter zusammenhängen könnte und mit Belgien, wo es im Volksleben, wie auch in Holland, ziemlich viel von diesem schwarzen Humor und einen merkwürdigen Witz gibt. Man könnte es natürlich auch als rheinisch bezeichnen, was sich da in meinem Stil ausprägt. Vielleicht ist es das auch. Da meine Eltern seit etwa 1938 geschieden waren, lebte ich im wesentlichen unter dem Einfluß meiner Mutter, die aus der Gegend um Kortrijk stammt.
Im übrigen habe ich erst jetzt festgestellt, daß die Mutter von Heine auch nicht aus Deutschland stammt, sondern aus Holland, und eine van Geldern war. Ohne mich mit Heine vergleichen zu wollen.
Helbig: In einigen Ihrer Texte identifizieren Sie sich mit dem Grund-Melancholischen des „Zigeunergeigers“.
Endler: Meine Existenz in der DDR war ziemlich rätselhaft. Die Literaturwissenschaftler haben oft versucht, mich einzuordnen. Es ist ihnen nicht gelungen. Ich bin ihnen immer entsprungen. Die Leute wußten nichts mit mir anzufangen, weder die Offiziellen noch die Widerständlerischen. Die wußten nicht, warum ich mich so und so bewege. Eines Tages bin ich dazu gekommen, mich als etwas Vaganten- und Zigeunergeigerhaftes zu charakterisieren, um mich für die Leute irgendwie handhabbarer zu machen. Möglicherweise hat dieses Zigeunergeigerhafte auch etwas mit der böhmischen Herkunft meines Vaters zu tun. Wenngleich dies für mich eher undeutlich bleibt. Dieses „Hoch die Geige!“ [nach einem Gedicht des jungen Joseph Roth] entsprach der Haltung in der DDR: „Laß dich nur nicht niederknüppeln! Laß dich nur nicht stumm machen!“
Helbig: Entspricht die jüdische Figur des Nebbich in etwa dem Zigeunergeigerhaften?
Endler: Ja. Aber, wenn ich an nebbich dachte, dann eher an die Redensart, welche ich in einem jiddischen Lied gefunden hatte: „Zehn Brijder sind wir gewesen, haben wir gehandelt mit Wein. Ist einer, nebbich, gestorben, sind wir geblieben neijn.“ Das habe ich mir in Depressionsphasen immer so vorgesungen, mit einer eigens dafür erfundenen Melodie. Nebbich bedeutet so viel wie „ist schon egal“. Diese Haltung kann auch verkörpert werden. Daher kommt die Figur des Nebbich.
Helbig: In Nebbich, der von Ihnen veröffentlichten „Autobiographie in Splittern“, wird Ihnen dieses Wort aus dem Nebel zugerufen.
Endler: Das ist eine Vision. Nebbich, bezogen auf ein zu schreibendes 7-bändiges oder 13-bändiges Romanwerk, taucht schon relativ früh auf. Ich hatte um 1960 einen Roman von Lion Feuchtwanger gelesen, in dem das Wort vorkommt. Was ulkigerweise von Fritz Raddatz in einer Rezension in der ZEIT in Frage gestellt worden ist. Seit jener Zeit begleitet mich dieser Begriff nebbich. Irgendwann hatte sich bei mir die Vorstellung herausgebildet, ich könnte ein Romanwerk sozusagen als Karikatur zu solchen 7- oder 8-bändigen Romanwerken wie denen von Erik Neutsch schreiben. Diese Karikatur sollte „Nebbich“ heißen. Die Stasi ist seltsamerweise davon ausgegangen, daß dieser Roman schon erschienen sei. Diese Feststellung findet sich in einem Bericht über eine der Wohnungslesungen im Prenzlauer Berg. Schuld daran hat wohl Lutz Rathenow, der sich in einer unter Pseudonym in der Westberliner Literaturzeitschrift Litfaß veröffentlichten Notiz über dieses Romanwerk geäußert hatte. Aber dieses Romanwerk, das kann ich Ihnen versichern, wird nie erscheinen. Ich bin kein Anhänger des Romans. Da folge ich dann schon den Anweisungen von André Breton.
Helbig: In Die Exzesse Bubi Blazezaks im Fokus des Kalten Krieges wird der Roman von Ihnen noch angekündigt, allerdings mit dem Hinweis: „Sobald dieser Roman erschienen ist, wird mich kein Mensch mehr ernst nehmen können.“
Endler: Ich hatte kritische Einstellungen in alle möglichen Richtungen – sowohl zum Staat DDR, als auch in Richtung des Schriftstellerverbandes. Ich hatte auch eine kritische Beziehung zu manchem Bürgerrechtler. Das hatte sich in den 80er Jahren so ergeben. Es gab damals eine Trennung zwischen den widerständlerisch-literarischen Undergrounds und den Gruppen der Bürgerrechtler, die plötzlich sehr geheimnistuerisch wurden, während vorher relativ offen geredet worden war. Ich habe dann bestimmte Einladungen zu Lesungen, in denen weniger Text gelesen als die Lage diskutiert werden sollte, oft auch zurückgewiesen. Das war mir sehr zuwider. Obwohl ich zu einigen Bürgerrechtlern, wie den Poppes, relativ freundschaftliche Beziehungen hatte.
Helbig: In Nebbich steht: „Immer finde ich mich dazu verurteilt, nicht hier oder da, sondern mitten auf der Trennlinie – z.B. zwischen Hoch- und Tiefliteratur- gebannt zu sein.“
Endler: Ich halte meine Texte, wenigstens die meisten meiner Gedichte, nicht für Unterhaltungsliteratur im engeren Sinn. Ich bin durchaus der Meinung, daß es sich dabei um E-Literatur handelt. Obwohl ich nicht ungern Lachen höre. Was einigen Prenzlauer Berg Autoren allerdings schon wieder zuwider ist. Bert Papenfuß-Gorek etwa hat ein Gedicht geschrieben, worin er sich dagegen verwahrt, daß beim Lesen seiner Texte gelacht werde. Daß ich mich auf dieser Trennlinie zwischen E- und U-Literatur befinde, ist eigentlich mehr ein Witz gewesen. Es mußten ein paar Trennlinien her, und da bot sich diese natürlich auch an.
Helbig: Bezüglich Ihrer Schreibweise ist der Begriff des „Endleresken“ geprägt worden.
Endler: Von Peter Gosse im Nachwort zur Akte Endler, einem erstaunlichen Text. Die merkwürdige und zum Teil rätselhafte Zusammenstellung der Texte dieses 1981 bei Reclam erschienen Bandes hatte mich im übrigen nicht restlos befriedigt, weil auch schlechtere Gedichte aus meiner Frühzeit mit drin waren, die kritische Gedichte zugedeckt haben. Ich hatte dennoch zugestimmt. Aber Gosse hat dieses wirklich phantastische Nachwort geschrieben, welches auch noch aus heutiger Sicht erstaunlich ist. Schon der Titel „Akte Endler“. Das hätte am Ende sogar beinah die Publikation verhindert. Der Verlagsleiter Hans Marquardt hat mir später erzählt, daß das Buch im letzten Moment noch gestoppt werden sollte. Man habe dann jedoch einfach die Augen zugehalten und drauflos gedruckt. Wobei Marquardt ja selbst für die Staatssicherheit tätig gewesen sein soll. Alles sehr verwirrend.
Helbig: Auch vom „Endlersch-Exzessuösen“ war die Rede.
Endler: Ich habe eine ganze Weile lang in den Kneipen am Prenzlauer Berg sozusagen mit der Unterwelt verkehrt. Das hatte schon exzessuöse Züge. Aber auch mein Schreiben hat zum Teil exzessuöse Züge getragen. Das Phantasmagorische, Schwarzhumorige, welche sozusagen einen anderen Prenzlauer Berg erfindet, in dem die Figuren sich dann bewegen, hat auch etwas Exzessuöses. Ich bin jedoch kein spontaner Schreiber, auch wenn ich von Literaturwissenschaftlern im Westen oft so begriffen worden bin. Es gibt ein Buch von meinem Freund Gerrit-Jan Berendse, in dem ich geradezu als DDR-Beatnik dargestellt werde. Das stimmt nur sehr bedingt. Die erste Fassung ist vielleicht spontan geschrieben, aber in der Regel habe ich meine Texte sieben, acht oder zehn Mal immer wieder abgeschrieben und verbessert. Es ist nicht so, daß ich wie die Beatniks auf die Schreibmaschine losgehämmert hätte. Die Texte sind oft umgestellt und stilistisch verfeinert worden. Das Ergebnis war dann nicht mehr exzessuös zu nennen.
Helbig: Sie selbst fanden für Ihre Texte auch die schöne Formulierung „kleinbürgerlich-lumpenproletarische Bonvivant-Prosa“.
Endler: (lacht) Das ist natürlich ein Witz. Ich habe mit solchen Begriffen gespielt. Diese drei Begriffe ergeben zusammengenommen ein recht seltsames Gebilde. Ich habe mit solch widersprüchlichen Begriffen gerne gespielt, um die Leute etwas irrezuführen. Möglicherweise gibt es in meiner Prosa der letzten zwanzig Jahre der DDR auch so etwas wie Hakenschlagen. Ich zog mich immer wieder aus irgendwelchen Affären. Zum Schluß war das nicht mehr publikabel in der DDR. Ich hatte dann eine Grenze überschritten – auch mit meinen Gedichten −, von der ich genau wußte, daß die nicht überschritten werden durfte. Letztendlich kennzeichnet das auch die kritische DDR-Literatur insgesamt, daß alle wußten, eine bestimmte Grenze darfst du nicht überschreiten, sonst geht’s nicht mehr. So überschreiten auch Bücher wie der „Hinze-Kunze-Roman“ von Volker Braun eine gewisse kritische Grenze nicht.
Helbig: Sie bezeichnen sich auch als einen Prä-Trash-Autor.
Endler: Prä-Trash heißt Vor-Trash. Es gab ja in dieser Zeit in der DDR keinen Trash. Mir ist dieser Begriff erst in den 90er Jahren begegnet, für allerlei Kunstwerke und Gedichte, in denen mit Abfällen oder Zitaten gespielt wird. Darum nenne ich das Prä-Trash.
Helbig: Collagenartige Texte, die Sie im „Tarzan“ auch als „zerwürgte Bruchstücke“ bezeichnen, als radikal kaputtgemachte Prosa, die am ehesten mit den schroffen Stücken Heiner Müllers zu vergleichen sei.
Endler: Ich kannte Heiner Müller ganz gut. Wir haben uns gelegentlich getroffen. Ich habe auch Veranstaltungen für ihn organisiert. Heiner Müller ist ein Autor, der ganz sicher zur Eliteratur gehört und sich auf einem hohen sprachkünstlerischen Niveau bewegt hat. Während ich auch das Minderwertige, das sich in Zeitungen, Zeitschriften oder in der Sprache schlechthin findet, verwendet habe. Ich gehe mehr auf volkstümliche Sprechweisen ein als Heiner Müller es tut, der in seinen auch verstechnisch gut durchgearbeiteten Stücken ein hohes Kunstbewußtsein spüren läßt. Auch in vielen seiner Gedichte. Unser Verhältnis zur DDR war recht ähnlich. Ich bin einmal gefragt worden: Warum verlassen Sie denn die DDR nicht? Darauf habe ich – mit Heiner Müller quasi – geantwortet: So ein tolles Material, wie es einem die verwesende DDR anbietet, finde ich nirgendwo auf der Welt wieder.
Helbig: Ihr Trash, ihre Fundstücke sind sozusagen absurde Texte der DDR-Bürokratie, sind das, was im Hinterhof gesprochen wird und aus den Wohnungen hallt. Wenn man so will war schon Kurt Schwitters ein Trash-Künstler. Seine Materialbilder basieren auch auf Fundstücken.
Endler: Das ist der Trash. Diese Collagen, in denen ich Ausschnitte aus dem Neuen Deutschland und Sprüche von der Straße zusammenbringe, sind quasi Trash-Kunst und nicht unbedingt als politisches Fanal angelegt. Daß es sich da sozusagen um einen Schwitters in anderer Umgebung handelt, das wurde sehr schwer begriffen. Das wurde auch im Verhältnis zu den Bürgerrechtlern zum Problem. Weil die meine Vorstellung, daß es sich da um eine Art Kunst handelt, nicht akzeptieren wollten. Die haben mich u.a. auch aufgefordert, für ihre Organisation ganz direkt Texte zu schreiben. Daraufhin habe ich den Bürgerrechtlern – die ich ja bis heute zum Teil schätze – geantwortet: Da kommt ihr mir mit der gleichen Frage, die schon der Zentralrat der FDJ an mich gerichtet hat – und die ich in früheren Zeiten auch positiv beantwortet habe −: Schreib doch für uns irgendwelche Texte. So auch die Bürgerrechtler. Ich sollte ihre etwas unbeholfenen Texte literarisch ein bißchen umformulieren. Diese Forderung und Ähnliches haben zwar nicht zu einem vollkommenen Bruch geführt, sind jedoch bis in die Nach-Wendezeit spürbar geblieben. Auch bei der Auseinandersetzung um den Prenzlauer Berg und um die Frage, war der Prenzlauer Berg stasigelenkt oder nicht.
Helbig: Ich gehe davon aus, daß Ihr Wappenspruch „Anschreiben gegen Festgeschriebenes“ sich nicht nur gegen das Diktum des Sozialistischen Realismus gerichtet hat?
Endler: In meinem Fall hat es natürlich mit der DDR etwas zu tun, weil ich da wohnte und gedichtet habe. Das ist eine sehr zentrale Forderung an mich selbst gewesen, so zu schreiben, daß das Festgeschriebene, das Festgefahrene beunruhigt wird. Es ist dann allerdings passiert, daß ich mich beim Schreiben doch immer mehr von der positiven Seite dieser Forderung entfernt habe und in ein eigentlich ziemlich hoffnungsloses Geschreibsel geraten bin. Die Forderung, gegen Festgeschriebenes anzuschreiben, setzt ja voraus, daß man das Festgeschriebene ändern oder zerstören oder durcheinander bringen kann. Dieser Meinung war ich wahrscheinlich Ende der 80er Jahre nicht mehr. Aber im Grunde war diese zentrale Forderung natürlich auch an mich selbst gerichtet. Das läßt sich vor allem an den Gedichten sehen. Es gibt bei mir kaum Serien von Gedichten, nur ansatzweise. Jedes Gedicht ist wie neu erfunden. Auch wenn die Gedichte zunächst gereimt waren und dann später mehr ins Surreale oder Surrealistische geraten sind. Ich habe mich – und das hat mich dann auch von meinen Freunden der Sächsischen Dichterschule getrennt – nicht festlegen wollen auf bestimmte Formen oder auf eine bestimmte Metrik, sondern ich wollte mit jedem Gedicht etwas Neues machen. Darin steckte natürlich die Forderung, auch von mir selbst Festgeschriebenes wieder zu zerstören. Es gibt eine gewisse rote Linie in all dem, die die Texte dennoch zusammenbindet. Was aber ursprünglich nicht meine Absicht war. Das ist wie bei Picasso, der sich auch beständig neu erfunden hat. Und trotzdem haben all die Werke Picassos einen inneren Zusammenhang.
Helbig: Im Gespräch mit Gregor Laschen sagen Sie: „Es arbeiten sich die Züge eines dritten Gesichts hervor, die des Besessenen, des Irren.“ Was ist das für ein drittes Gesicht des Poeten?
Endler: Es gibt einige Texte von mir – etwa die „Gedichte und Lieder des irren Fürsten“ oder die Prosatexte der „Kriegsträume“ −, in denen ich den Irren spiele… und manchmal unsicher geworden war, ob ich nicht wirklich irre bin. Das wäre dann das dritte Gesicht gewesen. Zum einen das des normalen Prosaschreibers, dann das des Lyrikers, und schließlich das des Irren, der alle möglichen Dinge von sich gibt, die man nicht mehr mit normalen Maßstäben messen kann. Es gab eine Phase, so Ende der 70er Jahre, als ich ziemlich tief unten war, auch verbunden mit Depressionen, in der plötzlich solche Texte etwas irrer Natur entstanden waren. In der ich auch die Figur des „irren Fürsten“ erfunden habe, der die Texte für mich gesprochen hat.
Helbig: Das war die Zeit als Sie aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden waren?
Endler: Der Ausschluß aus dem Schriftstellerverband hat mich nicht sonderlich gestört. Andere schon, die das noch heute traurig kommentieren. Ich war froh, aus dem Schriftstellerverband raus zu sein. Ich hatte mit diesem nichts zu tun. Ich bin überhaupt ungern in solchen Gruppen gewesen. Jetzt bin ich in die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt gewählt worden. Das habe ich akzeptiert.
Helbig: An einer Stelle gehen Sie mit William Butler Yeats d’accord, der resigniert gesagt habe: „Stil ist etwas fast Unbewußtes. Ich weiß, was ich zu tun versucht habe, aber wenig davon, was ich getan habe.“
Endler: Das Merkwürdige bei mir ist natürlich, daß die Texte über einen langen Zeitraum entstanden sind. Ich hab oft einen Text oder ein Gedicht angefangen und dann nach fünf Jahren wieder herausgezerrt und zuende gebracht. Oder auch nicht. Es passiert mir auch, daß mir eine Gedichtzeile einfällt und erst sieben Jahre später die dazu passende zweite oder die dazu passenden zehn weiteren Zeilen. Die Entstehungsweise meiner Texte läßt oft nicht mehr an den Ursprung der Sache denken. Es ist ein langer Vorgang, der mit dem Spruch von Yeats allein nicht zu fassen ist.
Ich bin immer davon ausgegangen, daß ich plötzlich einmal nicht mehr schreiben kann. Das ist eine Urerfahrung von mir, schon in meiner Jugend. Das hat dazu geführt, daß ich mir jeden Einfall notiert und parat gelegt habe zur eventuellen weiteren Verarbeitung. Es gibt natürlich auch Texte – Gedichte etwa −, die sofort vollständig entstanden sind. Diese Art Angst, daß mir etwas verloren gehen könnte, hat zu diesem Aufbewahren geführt, auch ein bißchen zu dem Collageartigen, später. Das hat dazu geführt, daß sich die Texte über eine lange Zeit entwickelt haben. Ich weiß genau, in welchen Gedichten die erste Zeile 1980 entstanden ist und der Rest 1989. Das kann ich notfalls auch heute noch zeigen. Das ist eine Arbeitsweise, die normalerweise bei Schriftstellern nicht in dieser Striktheit zu finden ist. Natürlich arbeiten Schriftsteller auch mit mehreren Fassungen oder über Jahre an einem Text oder Roman, aber diese Art, daß erst Jahre später der Funke fliegt zwischen zwei Polen, finde ich bei anderen Schriftstellern in der Regel nicht. Das läßt das alles auch sehr schwer beschreiben. Natürlich sind Texte, die ich in der DDR geschrieben habe, dann nicht nach der DDR vervollständigt worden. Da gibt es einen Bruch sozusagen, was die Textbeziehungen betrifft. Nach der Wende hat sich jedoch diese Arbeitsweise wieder eingestellt.
Helbig: In Ihrer Laudatio auf Imre Kertesz unterstreichen Sie seinen Gedanken, daß „eine bestimmte rasante Eloquenz nichts anderes als ein modifiziertes Schweigen“ sei. Das läßt an Ihre Figuren Bobbi Bergermann oder Bubi Blazezak denken, die sich durch eine gewisse Eloquenz auszeichnen.
Endler: Die Figuren nicht, der Text, in dem sie auftauchen, ist eloquent.
Helbig: Überdeckt diese Eloquenz auch Schweigen?
Endler: Ja. Ich habe nicht zuletzt an meine Prosastücke gedacht, als ich mir Gedanken über Kertesz’ Bemerkung machte. Vielleicht habe ich auch an bestimmte eloquente Leute gedacht. Eine bestimmte Redseligkeit kann eine andere Form von Schweigen sein – über die Dinge, zu denen man sich äußert. Zum Teil habe ich das an mir selbst festgestellt und insofern auch in Hinsicht auf manche meiner eigenen Sachen formuliert.
Helbig: Sie sehen Heinrich Heine als einen „Begründer der Moderne“. Im Heine-Jahr darf man vielleicht einmal nachfragen: Was bedeutet Heine für Sie und inwieweit ist Heine für Sie ein Begründer der Moderne?
Endler: Höllerer hat in den frühen 60er Jahren an Heine das Kaleidoskopartige der wesentlichen Gedichte hervorgehoben. Der Artikel ist überschrieben „Heine als Beginn“, als Beginn der Moderne. Auch Raddatz ist der Ansicht, daß mit Heine die Moderne einsetzt. Ich habe das auch so im Gefühl. Ich habe nie verstanden, warum man nicht begriffen hat, daß es eine direkte Linie von Heine bis zum Surrealismus gibt. In Frankreich, wo Heine von dem Prä-Surrealisten Gerard de Nerval übersetzt worden ist, gibt es einen Bezug von Heine zu Mallarmé, zu Baudelaire, zu Apollinaire, bis zu Breton. Das wird auch von französischen Literaturwissenschaftlern wie Robert Minder so dargestellt: Heine als Ursprung, von dem sich die spätere Moderne ableitet. Reich-Ranicki hat das vor kurzem vollkommen anders dargestellt. Er sieht ihn in der Linie der „der Vernunft verpflichteten Dichter“: Goethe-Heine-Brecht. Diese Darstellung, die ich ablehne, ist die in Deutschland bevorzugte.
Man darf nicht das Buch der Lieder als das Zentrum des Heineschen Werkes sehen. Da fällt man ganz sicher herein. Das Eigentliche ist diese völlig andere Art und Weise, in der sich Heine – im Unterschied zu Goethe – dem Material nähert, das von allen Seiten der Welt auf ihn zukommt. Etwa Zeitungen. Wie er das sortiert und gruppiert. Auch die russischen Formalisten haben Heine als einen Beginn der Moderne begriffen. Man darf nicht nur die Gedichte sehen, man muß auch die Prosa sehen, die zum Teil etwas Visionäres hat. Die Formalisten sprechen nicht wie Höllerer vom Kaleidoskopartigen, sondern zeigen, wie einer aus verschiedenen Gegenden, auch in technischer Hinsicht, vollkommen neuartig Material zusammenbringt und präsentiert. Tynjanow hat das z.B. sehr beschäftigt. In Iris Radischs großer Heine-Betrachtung in der ZEIT taucht diese Betrachtungsweise an keinem Punkt auf. Da ist Heine der Mensch, der romantische Blümelein-Gedichte geschrieben, diese dann ironisiert und sich auf diese Weise gegen die Romantik erklärt habe. Ich finde das nirgendwo bei Heine. Auch in der Romantischen Schule beschäftigt sich Heine nicht mit Mägdeleins und Blümeleins und Brunneleins, sondern mit der Wende der meisten Romantiker zum ideologischen Obskurantismus, zur Katholischen Kirche usw., jedoch überhaupt nicht mit diesen Äußerlichkeiten. Es gibt nur wenige Gedichte von Heine, die dieses Bild des Romantikers, der die Romantik per Ironie negiert habe, belegen. Das ist ein ganz enger Blick.
Helbig: Von diesem extrem scharfzüngigen Heine, der sich mit Börne herumschlägt, spricht man ja gleich gar nicht.
Endler: Es ist auch ungeheuerlich, was Heine da in alle Richtungen verteilt hat – an Kritik, an Ironie und an Sarkasmus. Heine hat bekanntlich nicht nur Deutschland und die deutschen Fürsten geschmäht, sondern er hat auch die Spätjakobiner – wie eben Börne, der ein hervorragender Schriftsteller war – kritisiert. Er hatte ein ganz kritisches Verhältnis zu dieser Pariser Exil-Gruppe. Vielleicht war dieses In-alle-Richtungen-Hiebe-Verteilen seine Methode, das Material zusammenzuholen, sozusagen per Angriff. Dieses Material für seine Visionen. Wenn Sie die Romantische Schule lesen, dann ist das ein Riesen-Traum. Er träumt sich die Romantische Schule zusammen. Oder Deutschland. Ein Wintermärchen – das ist eine Vision. Die Sächsische Dichterschule hatte im übrigen ein eher kritisches Verhältnis zu Heine, weil der so „unordentliche“ Gedichte geschrieben hat. Die russischen Formalisten dagegen hatten erkannt, daß man das nicht mit der normalen Metrik fassen kann. Mein Freund Mickel etwa war der Meinung, daß sich, nachdem bei Goethe noch der große Zusammenhang abgebildet worden sei, nun bei Heine „haufenweise die Kleinigkeiten“ sammelten. Das stimmt. Es war aber auch die Zeit dieser Kleinigkeiten. Es waren überall so winzige Informationen über den Beginn des industriellen Zeitalters, über Aufstände hier und da, über Revolten, über Ansätze von Revolutionen. Das waren tausend Kleinigkeiten, die plötzlich zusammenkamen. Während Goethe noch in einem feudal geregelten System lebte, fand sich Heine zwischen diesen tausend Winzigkeiten. Bei Heine ist sozusagen das Zufällige schon Prinzip. Ich glaube nicht, daß Heine bewußt auf Fragmentarisches hingearbeitet hat. Die großen Bücher von Heine – auch die Romantische Schule, auch das Buch über Börne – setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Im Grunde ist bei Heine einer der Anfänge der Collage. Das sieht auch Höllerer so.
Helbig: In Ihrer Rede anläßlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises 2000 sprechen Sie von der „halsbrecherisch anmutenden Zickzackroute, die (Sie)… zwischen den extremen Polen Sozialistischer Realismus und Dadaismus/Surrealismus“ gegangen sind. Welche Einflüsse haben Ihr Schreiben geprägt, bevor Sie in die DDR übersiedelten?
Endler: Durchaus auch Heine, der ja kurz nach dem Krieg wieder entdeckt wurde und in zahlreichen kleinen Publikationen vorgestellt worden ist. Heine ist eines meiner frühen grundlegenden Erlebnisse. Wobei ich mich dann wieder von ihm entfernt habe, weil er mir nicht als der Beginn der Moderne erschien. Damals wurden in abseitigen Zeitschriften erste surrealistische Texte sichtbar. In Berlin gab es die Athena, in welcher Ausschnitte aus den surrealistischen Manifesten von Breton und Hinweise auf die Ästhetik des Paradoxen enthalten waren. Diese Dinge haben mich Ende der 40er Jahre beschäftigt. Meine allerfrühesten Gedichte, die allerdings verloren gegangen sind, waren von einer Art naivem Surrealismus geprägt. Daß Heine etwas mit mir zu tun hat, ist mir erst viel später bewußt geworden.
Meine frühen Gedichte zeigen deutlicher als spätere die Rolle des Kriegserlebnisses für mein Schreiben. „Traumsplitter“ [zuerst veröffentlicht in Krawarnewall] ist ein Gedicht, wo ich zu mir selber sage: „Ich bin der Hitler“. Dieses phantasmagorische Gedicht war natürlich auch eine Antwort auf das seltsame Verhalten der Erwachsenen ringsumher. Die nach dem Krieg alle von nichts gewußt haben. Aber ich, als Kind, habe es gewußt, was sehr merkwürdig war. Ich habe mich dann sozusagen bekannt.
Helbig: Nach dieser Berührung mit dem Absurden und Surrealen, nach der Nähe zu Traum und Paradoxon kommen Sie in die DDR und begegnen dem Konzept des Sozialistischen Realismus?
Endler: Kurz nach dem Krieg waren in Westdeutschland, neben den Besatzungsmächten, Leute bestimmend, die dem Kulturbund angehörten, der ja zunächst ein gesamtdeutsches Ereignis war. Das waren zum Teil Exilanten, die für kurze Zeit einen gewissen Einfluß auf die kulturellen Verhältnisse hatten. Die verschwanden dann im Zuge der westdeutschen Restauration, die ich vollkommen kritisch gesehen habe. Als junger Mann war ich für den Kulturbund tätig. Ich habe im Filmklub des Düsseldorfer Kulturbundes Filme vorgestellt und für dem Kulturbund nahe stehende Zeitschriften geschrieben, die dann als kommunistische Tarnzeitschriften bezeichnet worden sind. Übrigens mit Recht, wie ich wohl weiß. Ich war also in Westdeutschland in der Nähe der Kommunistischen Partei tätig. Ich hätte auch, wie Ralph Giordano, FDJler sein können. Das war ich aus irgendwelchen Gründen nicht.
Ich sollte dann in Ostdeutschland eine westdeutsche Anthologie herausgeben, zu der wir alle sichtbaren westdeutschen Autoren eingeladen hatten. Arno Schmidt hatte zwei Beiträge gesandt, auch Heinz Piontek. Ich hatte auch einige heute in Vergessenheit geratene Früh-Surrealisten mit hineingenommen. Es wäre eine ungeheuerliche Anthologie geworden. Diese Anthologie war dann natürlich nicht druckbar.
Ich hatte damals das Gefühl, ich müßte mich von meiner Vergangenheit trennen. Auch von diesem Westdeutschen, was ja, wie man weiß, seine negativen Züge hatte. Man kann es nicht nur wie Frau Merkel sehen. Nachdem diese Anthologie im Ostberliner Verlag der Nation gescheitert war, bin ich eingeladen worden, am Literaturinstitut in Leipzig zu studieren. Das war natürlich phantastisch für mich. In Düsseldorf liefen inzwischen zwei Verfahren wegen Staatsgefährdung gegen mich. In den ostdeutschen Lexika wurde dies gern als Begründung für meinen Gang in die DDR angeführt, was so nicht stimmt. Ich könnte zehn Begründungen nennen. Ich würde als die richtige Begründung nennen: Ich bin irgendwie in der DDR hängengeblieben. Ich wollte mich dann aber auch wirklich diesem Neuen gegenüber, das ich da vermutet habe, öffnen, mich radikal trennen von meiner Familie und überhaupt von meiner Vergangenheit. Mein Vater, mit dem ich ohnehin wenig zu tun hatte, war ein kleiner Unternehmer. Bei ihm hatte ich beobachtet, wie ehemalige SS-Leute und Nazis wieder Geschäfte machen konnten. Davon wollte ich mich vollkommen trennen. Ich wollte in eine neue Existenz übergehen. Das hat mich zwei oder drei Jahre lang geprägt und hat zu einigen sehr schlechten Gedichten geführt. Weil ich mir, und ich will das heute ehrlich gestehen, etwas in die Tasche gelogen habe, etwas vorgemacht habe, an das ich nicht wirklich geglaubt hatte. Allerdings war die Ärmlichkeit der DDR für mich – im Vergleich zu dem allmählich sichtbar werdenden Wirtschaftswunder in Westdeutschland – eher etwas Positives. Das war das Ehrlichere für mich in dieser Zeit, während das andere für mich fragwürdig war. Ich habe dann viele agitatorische Gedichte geschrieben im Zusammenhang mit der Zeitschrift Junge Kunst, bei der ich Heiner Müller, Karl Mickel und Heinz Czechowski kennengelernt habe. Wir haben damals alle solche Gedichte geschrieben. Ich schäme mich dieser Gedichte auch nicht, obwohl sie furchtbar sind. Und zwar nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in ästhetischer Hinsicht katastrophal. Aber sie sind, nehme ich an, die Voraussetzung dafür gewesen, daß ich plötzlich ganz radikal den Zusammenbruch dieser Illusionen erlebt habe und in diese Welt des Schwarzen Humors gefallen bin. Bedingt durch das fadenscheinige Positive, das ich zwei oder drei Jahre lang auszudrücken versucht hatte.
Helbig: In „Nachts im Schwefel“ [1964 in Kinder der Nibelungen veröffentlicht] deutet sich diese andere Sicht schon an.
Endler: Das ist noch ein positives Gedicht. Ich habe es nicht in den bei Suhrkamp erschienenen Sammelband aufgenommen, weil dort für mich ungefähr die Trennlinie verläuft. 1962/63 passierte etwas in den Gedichten, die dann klüger waren als ihr Autor. Es ging Verschiedenes nicht mehr. In „Nachts im Schwefel“ ist noch eine positive Geste enthalten, die allerdings schon, wenn man die verwendeten ästhetischen Mittel betrachtet, begonnen hatte zu bröckeln. Mickel hat dieses und andere Gedichte als einen Höhepunkt meiner Literatur definiert, was ich nicht so sehe. Das Gedicht geht auf Erlebnisse zurück, die ich als Transportarbeiter in Wittenberge hatte. Es wurde seinerzeit als befremdlich empfunden. Obwohl man nicht nachweisen konnte, daß ich etwas gegen die Arbeiter oder gegen die DDR geschrieben hatte. Letztlich war es aber noch der Bitterfelder Weg: Dichter in die Produktion! Die stilistischen Mittel, die ich da anwende, waren eher symbolistisch, und stammten, das kann man heute sagen, von Hermlin, der mit seinen Städteballaden auch kein so einfacher Dichter gewesen ist. Es war der Versuch, mit bestimmten Bildern deskriptiv zu sein, zu beschreiben, was da passiert ist. Sehr beeinflußt war ich damals auch von dem heute fast vergessenen Theodor Kramer, der u.a. Gedichte aus der Sphäre der Straßenarbeiter geschrieben hatte. Tragelehn hat einen Aufsatz über „Nachts im Schwefel“ geschrieben, in dem er von dem Märchenhaften des Gedichtes spricht, diesem Klirren und Sirren und Bingeln und Bangeln, diesen Tonmalereien, die da stattfinden. Tragelehns Text ist erst einige Jahre nach der Wende veröffentlicht worden.
Helbig: Nach Wittenberge haben Sie gemeinsam mit Karl Mickel die Anthologie In einem besseren Land herausgegeben, die später die „Forum“-Debatte ausgelöst hat.
Endler: Die „Forum“-Debatte war durch eine sehr positiv gehaltene Rezension ausgelöst worden, die Elke Erb zur Anthologie geschrieben hatte.
Die Anthologie sollte im übrigen ursprünglich „Gespräch mit dem neuen Tisch“ heißen. Der Titel ist dann – ich weiß nicht weshalb – abgelehnt worden. Wir haben daraufhin, weil das Buch auf der Kippe stand, ganz schnell gesagt: Na, dann nennen wir es nach einer Zeile von Heinz Czechowski – „In diesem besseren Land“. Was allerdings auch zu Mißverständnissen über den Inhalt dieser Anthologie geführt hat.
Die hinter der Anthologie steckende Absicht war es, eine bessere DDR-Lyrik zu erfinden als die ringsum propagierte Bechersche Liederproduktion. Wir wollten der DDR zeigen, daß sie eine ganz bedeutende Lyrik hatte und haben könnte. Dank Mickels Vorlieben hatten wir uns auf Georg Maurer, Erich Arendt, Franz Fühmann konzentriert, auch auf Peter Huchel, der eigentlich gar nicht mehr in der DDR veröffentlichen wollte. Die Anthologie enthält keine gegen die DDR gerichteten kritischen Gedichte. Reiner Kunze hatte sich beschwert, daß er nicht aufgenommen worden war. Das hatte aber etwas mit den besonderen Vorlieben und Abneigungen von Karl Mickel gegen diese Art Kurzgedichte zu tun. Obwohl er dann selbst solche Gedichte schrieb. Es fehlt auch Biermann. Diese kritische Ecke, die damals schon in Andeutungen zu erkennen war, fehlte.
Helbig: Die „Forum“-Debatte hatte zur Folge, daß sich die Arbeitsbedingungen für einige Dichter in relativ kurzer Zeit erheblich verschlechterten?
Endler: Ja. Die Diskussion war übrigens merkwürdigerweise von Rudolf Bahro angezettelt worden, der damals Redakteur des Forum war, und der ja dann eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Die Diskussion ging um Entwicklungen der jungen Lyrik – Mickel, Czechowski, Rainer Kirsch, Sarah Kirsch. All das wurde zurückgewiesen von drei hochmächtigen Literaturwissenschaftlern – Hans Koch, damals der Boss des ganzen Kulturbetriebs, und andere −, die die ganze Entwicklung in Frage gestellt haben. Die Diskussion hat dazu geführt, daß diese Autoren für drei, vier Jahre einige Schwierigkeiten hatten zu publizieren. Das hat sich erst mit einer anderen Diskussion verändert, die ich 1971 in Sinn und Form angezettelt hatte und in der dann ein Jahr lang hin und her die Literaturwissenschaftler in ihrer Betrachtungsweise der neuen Lyrik kritisiert und in Frage gestellt wurden. An dieser Diskussion hatten sich auch Heinz Czechowski und Günter Kunert mit Beiträgen beteiligt. Das war eine wüste Debatte, die dann auch noch in die literaturwissenschaftlichen Weimarer Beiträge überschwappte. Das hatte etwas verändert. Die Folge war, daß einige Autoren, die aus dem Literaturbetrieb fast verschwunden waren, wieder publizieren durften. Die hatten diese Zeit mit Nachdichtungen aus dem Russischen oder Georgischen überlebt, obwohl sie kaum Russisch oder Georgisch konnten. Als Auslöser dieser zweiten Debatte stand ich für einige Leute als Feind fest. Später hat man versucht, nicht mehr davon zu reden, so als wäre das nicht gewesen.
Helbig: 1976, mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann, haben sich die Fronten aber dann wieder verhärtet?
Endler: Das hat aber nicht dazu geführt, daß Autoren wie Mickel oder Czechowski nicht mehr gedruckt wurden. Einige andere schon. Es war ja in gewisser Hinsicht Zufall, ob einer diese Listen, die nach der Ausweisung von Biermann kursierten, unterschrieben hat. Ich hatte mich mit meiner Unterschrift gegen die Biermann-Ausweisung gewandt. Das hatte Czechowski zufälligerweise nicht getan. Das hat Mickel – vielleicht schon überlegt – ebenfalls nicht getan. Mickel war so ein ziemlich schlauer Hund. Wer es unterschrieben hatte, wurde genau ins Auge genommen. Es gab Gespräche im Schriftstellerverband, die für mich völlig absurd waren, und in denen ich erklärt habe, daß ich weiter zu dieser Unterschrift stehe. Man fühlte sich verpflichtet, zu dieser Unterschrift zu stehen, man wollte es denen mal zeigen. Das hat dazu geführt, daß einige Autoren, wie Kurt Bartsch, sehr heftige Schwierigkeiten in ihren Verlagen bekamen, andere, die zufällig nicht unterschrieben hatten, keine Schwierigkeiten hatten. Wobei Biermann sicher sehr froh war, dieses ungeheure Aufsehen erregt zu haben. Für mich allerdings war die Ausweisung von Biermann das letzte Zeichen, daß das mit der DDR nicht mehr funktionieren konnte. Schon in dem Jahr vor der Biermann-Ausweisung hatte ich das Gefühl, daß die Stimmung gekippt war. Kito Lorenc sagte mir, daß er bereits ein Jahr vorher gefragt worden war, was er denn eigentlich von dem Biermann halte. Da wurde also schon vorher herumgetastet.
Helbig: Was waren die Gründe für Ihren Ausschluß aus dem Schriftstellerverband 1979?
Endler: Die Ursache für den Ausschluß war ein Brief, den wir an Honecker geschrieben hatten – Kurt Bartsch, Klaus Schesinger und einige andere −, und in dem wir protestierten gegen einen Prozeß, den man Stefan Heym wegen „Devisenvergehen“ machen wollte. Dieser Devisenvergehen hatten wir uns alle mehr oder weniger schuldig gemacht. Ich vielleicht noch am wenigsten. Von diesem Protestbrief war dann ein, zwei Tage später in der Westpresse viel die Rede gewesen, angeblich, noch ehe Honecker das Schreiben zu Gesicht bekommen hatte. Was ich auch für möglich halte. Erst jetzt habe ich erfahren, daß sich drei oder vier der Unterzeichner bei Stefan Heym zusammengesetzt und beschlossen hatten, die Westpresse zu informieren. Zwar nicht den Brief zu übergeben, was mir unangenehm gewesen wäre, aber Mitteilung zu machen über den Vorgang. Die Folge war ein Riesen-Artikel in der BILD-Zeitung: „Sieben gegen die Partei“ und ähnliche Sachen. Dieses Westecho hat zu dem Ausschluß dieser Autoren aus dem Verband geführt. Einige haben sich noch verteidigt, ich nicht mehr. Ich war froh, aus dem Verband raus zu sein. Angeblich wollte man nicht schon wieder solch eine Geschichte wie nach der Biermann-Ausweisung entstehen lassen, sondern wollte dieses Unternehmen im Keime ersticken. Über den Ausschluß wurde dann in allen Tageszeitungen und wo auch immer berichtet. Dies bewirkte, daß man kaum noch Geld verdienen konnte. Ich, der ich als Lyriker ohnehin nie viel Geld verdient habe, hatte das nicht so schroff empfunden. Ich hatte glücklicherweise 1979 von der Akademie der Künste in Westberlin einen Förderpreis bekommen – zehntausend Westmark, die ich dann allmählich umgerubelt habe, wovon ich wohl sieben oder acht Jahre leben konnte. Dieser Preis hat mich eigentlich gerettet. Was meine DDR-Einkünfte anbetraf, so hatten sich diese von tausend DDR-Mark im Monat auf hundert DDR-Mark im Monat reduziert. Von hundert Mark im Monat konnte man selbst in der DDR kaum noch leben, auch wenn die Mieten sehr billig waren. Für einige der ausgeschlossenen Autoren, die in den Jahren zuvor als Filmemacher sehr viel Geld verdient hatten, war der Ausschluß aus dem Verband der Untergang. Die hatten im Monat vier- oder fünftausend Mark verdient und nun gar nichts mehr. Diese Autoren sind dann alle nach und nach in den Westen gegangen, weil sie in der DDR einfach verhungert wären. Bei mir hatte das Ganze die Tendenz verstärkt, mich außerhalb der Regeln zu bewegen. Ein bißchen gezwungenermaßen, aber auch aus Lust an dieser Outsider-Existenz.
Helbig: In Tarzan am Prenzlauer Berg ist ein Brief an Bernd Jentzsch vom 16.12.1980 zitiert, der von dem Druck, unter dem Sie in jener Zeit gestanden haben, Zeugnis gibt.
Endler: Es gab eine Phase, in der ich der Stasi irgendwie auf ein paar Sachen gekommen war. Ich hatte damals mehr zufällig festgestellt, daß ein Mädchen aus meinem Bekanntenkreis Beziehungen zu zwielichtigen Leuten hatte. Ich habe dann versucht, dieses Netz für mich aufzulichten. Bei diesen Bemühungen bin ich auf Merkwürdigkeiten gestoßen – auf Leute, die plötzlich neben mir standen und mich bedrohten, oder auf Autos, die vor meiner Wohnung in Weißensee standen. Ich hatte offenbar zufällig eine Art Machtzentrum berührt. Da habe ich Todesangst bekommen und mir gesagt: Die können dich nicht leben lassen. Die merken, daß du da einer Verbindung auf die Spur gekommen bist. Und dann passierte die Sache mit dem Brief und meinem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband. Plötzlich war ich berühmt. So gesehen habe ich den Ausschluß aus dem Schriftstellerverband auch als etwas empfunden, was eine gewisse Drohung gegen meine Person zunichte machen konnte. Einen, der mit einer solchen Sache aufgefallen war, konnte man nicht so ohne weiteres beiseite bringen. Der Ausschluß aus dem Verband hat diese Todesangst wieder von mir genommen.
Der Brief an Jentzsch war der Versuch, jemandem außerhalb der DDR zu sagen: Wenn mir was passiert, dann kümmere dich doch bitte um meine Sachen. Der Brief ist ein Dokument meiner Angst.
Helbig: Waren die Wohnungslesungen der 80er Jahre gewissermaßen eine Folge dieser Ausschlußpraxis?
Endler: Das gab es auch vorher schon in Ansätzen, etwa bei Frank-Wolf Matthies, einem Dichter, den man heute ungerechterweise kaum noch kennt. Da hat es überhaupt angefangen und sich von dort aus weiterentwickelt. Es hatte insofern mit der Ausschlußpraxis nichts zu tun, als da Texte vorgelesen wurden, die nirgendwo in der DDR hätten publiziert werden können. Diese Wohnungslesungen hatten sich zunächst im Zusammenhang mit der Bürgerbewegung in der DDR entwickelt, schließlich aber auch mit dem, was später als Prenzlauer Berg Szene berühmt und berüchtigt geworden ist. Diese Leute – Frank-Wolf Matthies oder Bert Papenfuß-Gorek – hatten mit dem Verband nichts zu tun. All diese Autoren hatten eine kritische Haltung zu dem, was in der DDR passierte. Die hatten sich von vornherein eine Existenz außerhalb der normalen DDR-Verhältnisse zurechtgebaut. Etwa 1976/77 hatte sich diese Szene spürbar gebildet. Insofern kann man auch nicht behaupten, daß die Prenzlauer Berg Szene eine Erfindung der Stasi gewesen sei. Die gab es bereits, ehe Sascha Anderson und Rainer Schedlinski dort aufgetaucht sind, die dort natürlich hineinmanipuliert worden sind und eine gewisse Aktivität entfaltet haben, die schon bedeutsam war. Der Prenzlauer Berg war ein Stadtviertel, welches das Wohnungsamt nicht mehr im Griff hatte. Dieses ganze Gefilde war in Unordnung geraten. Das wurde erspürt von diesen jungen Leuten, die nichts mehr mit der normalen Literatur oder gesellschaftlichen Entwicklung der DDR zu tun hatten. Wäre man nach Marzahn gewandert, hätte einen das Wohnungsamt oder die Polizei im Griff gehabt.
Helbig: Ihr Tagebuch Tarzan am Prenzlauer Berg beschreibt die Szene recht einprägsam. Nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Beschreibung der Umstände der letzten Lebenjahre von Erich Arendt habe ich den „Tarzan“ mitunter wie einen Roman gelesen.
Endler: Ich hatte zwei Schreibmaschinen. Auf der einen Schreibmaschine habe ich belletristische Texte verfaßt, auf der anderen habe ich jeden Tag Tagebuch geführt, aufgeschrieben, was passiert ist, was ich gehört habe usw. Diese Tagebuchblätter auf ganz dünnem DDR-Papier – wo man immer sieben Durchschläge machen und die irgendwo verstecken mußte – liefen sozusagen neben der belletristischen Produktion. Ich hatte vor, etwa drei oder vier belletristische Bücher zu machen und sozusagen als Schlußband das zu veröffentlichen, was wirklich passiert war. Wobei sich dann herausstellen würde, wie ich dachte, daß die Wirklichkeit genauso absurd war, wie die parallel dazu entstandenen absurden Prosatexte. Das hat sich dann irgendwie zerschlagen. Drei Prosabücher erschienen bei Rotbuch. Ein paar Texte stehen auch im Nebbich. Wenn im Tagebuch irgendetwas komponiert erscheint, dann bestenfalls innerhalb des jeweils abgehandelten Monats. Das kann durchaus sein, daß ich da aus sozusagen kompositorischen Gründen mal ein Stück drei Tage vorher eingefügt habe. Aber im großen und ganzen hält sich das an den Ablauf dieses auf der kleinen Schreibmaschine entstandenen authentischen Tagebuchs. Das zum Teil auch richtig ausgearbeitet war. Ich habe es allerdings vor der Veröffentlichung noch einmal stilistisch durchgesehen.
Als ich den Brüder-Grimm-Preis für den Tarzan am Prenzlauer Berg bekommen sollte, hat mich ein Mitglied der Jury, Karl Corino, besucht, und wollte das Tagebuch sehen. Er wollte nicht glauben, daß ich das alles in den Jahren 1981/83 wirklich in der DDR und mit dieser ironischen Geste notiert hatte. Ich konnte ihm dann glücklicherweise einen Stapel dieser Tagebuchblätter vorweisen. Und so habe ich den Brüder-Grimm-Preis für dieses Büchlein bekommen. Es gab einige Leute, die geglaubt haben, das kann doch nicht sein, daß der schon 1981/82 so eine Haltung zu den verschiedenen Gegenständen in der DDR hatte. Aber da hatte ich schon diesen ironischen schwarz-humorigen Blick, der dann auch in dem Tagebuch sichtbar wird.
Wobei ich mir natürlich, während ich all das schrieb, bewußt war, daß kaum ein Mensch in der DDR und am Prenzlauer Berg Tagebuch führte. Aus Angst vor der Stasi. Weil das nicht ungefährlich war. Das, was man da erwähnt hatte, konnte für einen selbst oder die Leute, die man beschrieb oder zitierte, gefährlich werden.
Helbig: Sie haben sich früher als andere gegen diesen Generalverdacht verwahrt, daß die Prenzlauer Berg Szene nur ein von der Stasi erdachtes Gebilde gewesen sein könnte, konstruiert mit der Absicht, eine Art Auffangbecken für junge Talente zu schaffen, die einmal „gefährlich“ werden könnten. Sie haben sich dagegen verwahrt, weil sich das Leben für Sie aus der Innensicht vollkommen anders dargestellt hat.
Endler: Nur deshalb habe ich Tarzan am Prenzlauer Berg überhaupt herausgegeben, um diese Innensicht darzustellen.
Helbig: Glauben Sie, daß mit dieser „Stasi-Debatte“ zugleich auch ein formal-ästhetischer Streit ausgetragen werden sollte?
Endler: Als Stasi-Debatte hatte das Ganze keinen rechten Sinn. Weshalb sollte man jubilieren darüber, daß irgendeiner ein Spitzel gewesen war und andere an der Nase herumgeführt hat? Ich denke schon, daß es eine Art ästhetisches Machtspiel war, was da versucht wurde. Natürlich vertraten Wolf Biermann oder Jürgen Fuchs eine bestimmte Richtung von Realismus, die überhaupt nichts zu tun hatte mit dem dadaistischen und halbsurrealistischen Herumgespiele der Prenzlauer Berg Dichter. Auf dem Grund dieser Stasi-Debatte standen sich bestimmte ästhetische Konzeptionen gegenüber. Gegen diese Art von Literatur hatte sich Biermann schon ausgesprochen, als Sascha Andersons Spitzeltätigkeit noch gar nicht bekannt war. Das war für diese Leute schon vorher alles recht fragwürdig. Es gab auch einen ideologischen Hintergrund, wie aus einem bis dato unveröffentlichten Brief von Biermann an einen Dichter am Prenzlauer Berg hervorgeht. Biermann war ja eigentlich bis zuletzt sozialistisch orientiert. Bis zur Wende eigentlich. Und diese ganze Prenzlauer Berg Szene wollte mit dem Sozialismus und mit der DDR nichts mehr zu tun haben. Im großen und ganzen ist es aber ein Machtspiel gewesen. Wie sich Biermann und Fuchs das vorgestellt haben – sozusagen die literarische Bestimmungsmacht zu übernehmen darüber, was etwas sei und was unbedeutend sei −, ist mir unklar. Ich erinnere mich nur an ein charakteristisches Foto im SPIEGEL, das Biermann zeigt, wie er sich behäbig stolz in den Sessel von Mielke setzt. Das ist für mich ein Symbol dieses Machtbestreben gewesen. Obwohl ich das vielleicht überschätze. Jürgen Fuchs hat noch eine besondere Ansicht vertreten, mit Bezug auf Havemann. Die eigentlich zentrale Gestalt der anderen Richtung, des anderen Sozialismus, war Robert Havemann. An einer Wohnungslesung, bei der die Leute sich vor Lachen auf dem Boden gewälzt haben, hatte Havemann teilgenommen. Ich glaube, er war jedoch eher erstaunt über das, was da passierte. Ich hatte zu Havemann sonst keinerlei Kontakt. Dieser utopische Sozialismus von Havemann, Biermann und Fuchs hat am Prenzlauer Berg überhaupt keine Rolle gespielt. Biermann hat es mißfallen, daß die jungen Dichter nicht mehr an eine Reformierbarkeit des Sozialismus geglaubt haben. Das geht aus Briefen Biermanns hervor.
Aber dieses Ideologische war das Nebengleis. Ich glaube, daß beide, Biermann und Fuchs, sich als ganz große Dichter empfunden haben, die angesichts dieser krümeligen Dadaisten jetzt groß herauskommen müßten. Fuchs’ Roman Magdalena über die Stasizentrale, dieser große Abrechnungsroman, ist allerdings als ästhetisches Produkt vollkommen danebengegangen.
Die Dichter vom Prenzlauer Berg sind heute, abgesehen von Papenfuß, der dort noch eine kleine Kneipe betreibt, verschwunden. Es gab da mindestens drei oder vier Begabungen, die zu unrecht unter die Räder gekommen sind, insbesondere im Zusammenhang mit dieser Stasi-Debatte um Anderson und Schedlinski.
Helbig: Eine Besonderheit stellt Ihre Beziehung zum PEN-Club der DDR dar. Einerseits haben Sie die Mitgliedschaft als eine Art Schutzschild benutzt, andererseits haben Sie in dem Bewußtsein gelebt, daß es sich bei der PEN-Spitze vermutlich um eine Unterabteilung der Auslands-Stasi handeln könnte. Wie haben Sie diesen Spagat gelebt?
Endler: Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich bin zu diesen drei oder vier Tagungen, die pro Jahr stattgefunden hatten, einfach nicht mehr hingegangen. Ich glaube noch heute, daß der Präsident und die Sekretäre des PEN alte Geheimdienstleute waren. Schon aus Exil-Zeiten. Einmal habe ich einen Skandal im PEN ausgelöst, als ich laut feststellte, daß all den PEN-Mitgliedern die PEN-Charta nicht überreicht worden war, in der ja jedwede Zensur radikal verurteilt wird. Das war aber meine letzte „Heldentat“, dann bin ich nicht mehr hingegangen. Ich war vor Zeiten von Sarah Kirsch und einigen anderen in den PEN gewählt worden. Das Schild an der Wohnungstür – WORLD ASSOCIATION OF WRITERS – war ganz nützlich. Es taucht auch tatsächlich in den Stasi-Akten auf. Das hat in gewisser Weise abgeschreckt. 1990 bin ich aus dem PEN ausgetreten, wie ich aus allem gerne ausgetreten bin, was diesen Ruch von Stasihaftem oder überhaupt Staatsnahem hatte. Ich bin ausgetreten und dann – wieder auf Vorschlag von Sarah Kirsch – in den West-PEN gewählt worden. Da bin ich zwar nie gewesen, aber ich habe das so akzeptiert. Als sich dann Ost- und West-PEN vereinigten, sind wir alle wieder ausgetreten. Diese gesamte PEN-Geschichte ist von extremer Absurdität.
Helbig: In der DDR gab es kurzzeitig Bestrebungen, ein ,Gesetz zum Schutz der Beruftbezeichnung Schriftsteller‘ zu erlassen?
Endler: Es gab, wie mir einer berichtet hat, an der Akademie der Künste sogar eine Arbeitsgruppe, die herauskriegen wollte, ob man solch ein Gesetz machen könnte oder nicht. Das Gesetz kam nicht. Wer in der DDR als freier Schriftsteller tätig sein wollte, brauchte eine Steuernummer. Über die Vergabe dieser Steuernummer konnte man schon einiges regulieren und unerwünschte Gestalten, die in den Schriftstellerstatus zu kommen versuchten, abwehren. Es gab Mittel, diese Leute zu „Asozialen“ zu machen.
Helbig: Ab einem bestimmten Zeitpunkt, kann man im Tagebuch lesen, hatte die Wanze als Überwachungsmittel von Wohnungslesungen ihren Schrecken verloren und eher eine anfeuernde Wirkung provoziert?
Endler: Sich den Stasihorchern so einfach auszusetzen und nichts zu verschweigen, hieß die „Polnische Lösung“. Wahrscheinlich hatte sich diese Verhaltensweise aus Polen auf die DDR übertragen. Das bedeutete: Wir sagen einfach alles, wir verheimlichen überhaupt nichts mehr.
Helbig: Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ostragehege, Heft 42, 2006
Gespräch mit Adolf Endler 1994
Adolf Endler: Ein bißchen überspitzt gesagt, mein Hauptwerk, wie das Hauptwerk von uns allen, besteht in den letzten drei, vier Jahren darin, Interviews zu geben, Auskunft darüber zu geben, wie wir zu der oder jener Zeitfrage stehen, wie wir die Wende verkraftet haben. Es besteht außerdem darin, Fragebögen zu beantworten, die von allen möglichen wissenschaftlichen Instituten an uns verschickt worden sind, zum Beispiel man möchte fast sagen dutzendweise Fragebögen bezüglich des Problems der Zensur, das in den ersten zwei Jahren nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der DDR vor allen Dingen kritisch durchleuchtet worden ist. Dieses, das war mir allerdings klar und ich habe mich auch in Glossen dazu geäußert, daß dieses Problem, Zensur oder nicht Zensur, ziemlich zweitrangig war, angesichts des Faktums, daß es doch die Staatssicherheit gab, die auf ganz andere Weise zensuriert hat, als man sich das dachte. Von etwa Ende 1991, Anfang 1992 an – oder wann war das? Auf jeden Fall ab etwa 1992 ist dann dieses Staatssicherheitsproblem ins Zentrum der Auseinandersetzung gerückt und auch in dem Zusammenhang hat es natürlich dann immer wieder Interviews und Fragebögen gegeben, was man weiß, wie man sich zu dem und dem verhält. Ich habe dann am Ende gesagt, warten wir, bis wir unsere sogenannten Akten haben und dann werde ich Auskunft geben. Ich äußere mich jetzt kaum noch zu diesen Problemen, obwohl ich in Diskussionen gerade in Bezug auf diese Prenzlauer-Berg-Gruppe, diese etwas avantgardistische Lyrikergruppe vom Prenzlauer Berg, bemüht bin klarzustellen, daß der Prenzlauer Berg insgesamt keineswegs eine Stasi-Erfindung war, sondern daß es da zwei oder drei Spitzel gab und die dreißig, vierzig sonst an dieser Szene beteiligten Leute Bespitzelte waren, so daß es ja ziemlich ungerecht ist, den ganzen Haufen als eine Stasi-Erfindung zu bezeichnen. Darüber hat es eine Menge Diskussionen gegeben, man war ständig auch mit solchen Diskussionen beschäftigt. Ich sage mir jetzt auch, was dieses Problem anbetrifft, ich warte bis die ersten Dämlichkeiten in den Literaturgeschichten auftreten, also der „Prenzlauer Berg“ eine Simulation der Stasi sei und dergleichen. Und das taucht sicher auf, wenn die Literaturgeschichten komplettiert werden, in den nächsten fünf; sechs Jahren werden sicherlich sämtliche Irrtümer und Unterstellungen in den Literaturgeschichten auftauchen. Sie sehen, daß ich ziemlich erbost bin. Und ich habe sozusagen meine Auseinandersetzung mit diesem Punkt auf die Zeit vertagt, in der das passiert. Ich sammle im Hinblick auf diese Zeit, auf diesen Moment, der vielleicht in zwei, drei Jahren eintritt, Material, und das kann ich dann gleich auch wieder den Literaturwissenschaftlern geben, von denen ich schon ahne, sie stürzen sich darauf und übernehmen alle Legenden, die so zutage getreten sind, zumal die meisten Literaturwissenschaftler, ob Ost oder West, ohnehin anti-avantgardistisch eingestellt sind, eher konservativ. Es gibt ein paar Ausnahmen. Nicht viele. Und Sie wissen ja, daß es jetzt so eine große, wenigstens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch anderswo – eine große Diskussion über den Zusammenhang zwischen der faschistischen Bewegung, nazistischen Bewegung und der kommunistischen mit der Avantgarde gibt. Wobei, wenn man sich das genauer anguckt, natürlich sehr viel mehr konservative Autoren an diesen radikalen Bewegungen beteiligt waren als gerade avantgardistische. Futurismus bietet sich natürlich als Beispiel sehr gut an. Aber die Tatsache, daß es jetzt doch einige Spitzel im Prenzlauer Berg, in dieser Avantgarde-Szene gab, wird als sozusagen kleines Beweisstück wieder herangezogen. Da kann man zwar wieder sehen, die Avantgarde hängt immer mit irgendwelchen Stimmungen, schrecklichen Bewegungen oder Ereignisideologien zusammen. Das ist, dieses Argument ist mir schon ein paar mal jetzt begegnet in so konservativen Blättern wie etwa der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Rande und auch in Aufsätzen, die gar nichts mit dem Prenzlauer Berg zu tun haben, so was kommt dann, zack, als Argument hoch und ist mir so fast alle drei bis vier Wochen, möchte ich mal sagen, begegnet. Gut. Ich warte darauf, daß die Literaturgeschichten erscheinen, und dann schreibe ich vielleicht zwei oder drei große Essays darüber. Ich möchte nur feststellen, unsere Zeit war sehr ausgefüllt damit, an Diskussionen teilzunehmen, Fragebögen zu beantworten und Interviews zu geben. Wenn man nicht zwischendurch gelähmt war von alledem. Ich meine, man muß auch verstehen, warum viele Leute wenig geschrieben haben, weil sie verwickelt waren in solche Geschichten. Ich selbst habe dann – es gibt da schon auch eine direkte Folge für mein Werk – ich habe vor etwa zwei Jahren angefangen, meine Tagebuchblätter, die ich so Anfang der ’80er Jahre geschrieben habe, ’81 bis ’83, aufzuarbeiten, um für mich selber, aber auch für andere natürlich, zu zeigen, wie man das damals eigentlich erlebt hat. Und das habe ich gemacht, ohne die sogenannten Akten zu berücksichtigen. Ich habe sie erst vor zwei Jahren beantragt und habe sie immer noch nicht. Ich habe also verzichtet, diese Stasiakten schnell einzusehen, einfach um diese Optik, die in den Tagebuchblättern eingenommen ist, durch Korrekturen nicht zu beschädigen. Aber ich sehe jetzt schon, ich habe furchtbar viele Akten schon zugetragen bekommen, daß nicht sehr viele Anmerkungen korrigierender Art oder erklärender Art nötig sind.
Cécile Millot: Sie denken also, daß Sie die Situation im Grunde richtig eingeschätzt haben?
Endler: Ja. Und natürlich kommt ein etwas anderes Bild zustande, ein richtigeres, denke ich, als das, was sich Leute, die nicht an dieser Szene beteiligt waren, aufgrund nur weniger Akten, weniger Einblicke zurechtgesponnen haben. Es ist also auch ein Buch, das ich fertig gemacht habe und das jetzt in zwei, drei Monaten erscheinen soll bei Reclam Leipzig, das Bezug nimmt auf diese ganze Diskussion. Es heißt Tarzan am Prenzlauer Berg37. Ich bin der Tarzan, der hin und her hüpft… Der Titel erklärt sich aus einer kleinen Randnotiz. Tarzan ist für mich der City-Mensch schlechthin. Der also sich sozusagen von Trottoir zu Trottoir, von Kneipe zu Kneipe hangelt wie im Dschungel. Das ist das, was ich jetzt zu dieser Sache sagen kann. Auf jeden Fall hat uns das eben sehr beschäftigt und dieses Buch hat mich zwei Jahre lang beschäftigt, weil es ja eigentlich Tagebuchblätter aus zehn Jahren waren. Ich hatte die zum Teil in den Westen geschmuggelt zu meiner Mutter und mir jetzt wieder zusammengeholt. Ich habe sie dann reduziert auf die Jahre ’81 bis ’83, in denen, glaube ich, der Staat und diese etwas „widerständlerischen“ Autoren ganz schroff gegeneinander gestanden haben und auch die Gefahr bestand, daß gegen den oder jenen Autor irgendwelche Prozesse geführt werden würden. Dafür gibt es auch Belege, daß so etwas wenigstens in einigen Köpfen herumgespukt hat. ln diesen Jahren zeigt sich noch einmal ganz deutlich die Konfrontation. Später in der zweiten Hälfte der ’8oer Jahre zerlappert sich das schon und die Dinge werden undeutlich. Da war dann schon der Einfluß, natürlich, von Gorbatschow und dem sogenannten – in der DDR hieß es das „Neue Denken“. Das war aber kein „Neues Denken“. Es war ein neues Denken in alten Mustern. Aber es herrschte auch auf Seiten des Staates und auch auf Seiten der Staatssicherheit zunehmende Verunsicherung über das, was ablaufen würde. Insofern habe ich mich noch mal auf solch einen Zeitpunkt konzentriert, in dem die Konfrontation ’81 bis ’83, glaube ich, es ging bis ’85 eigentlich, noch einmal ziemlich scharf zu fassen ist, greifbar wird.
Millot: Sie sagten, ein Teil dessen, was Sie in den letzten Jahren geschrieben haben, mußte sich mit diesen politischen Themen beschäftigen.
Endler: Ja, sehr zu meinem Widerwillen. Ich habe die Wende durchaus als Befreiung empfunden, wie jeder Autor. Aber ich kenne auch staatstreue Autoren, die letztendlich froh waren, aus dieser Zwickmühle heraus zu sein. Inzwischen hat sich die Stimmung, wie Sie wissen, etwas verändert. Ich wollte eigentlich richtig losspielen. Hatte aber dann sehr schnell bemerkt, daß das nicht geht und daß da ungeheure Probleme auf uns zukamen. Ich habe mir übrigens nie diese Illusionen gemacht wie andere, daß sofort irgendwelche westdeutschen Verhältnisse in Ostdeutschland einkehren würden. Wobei ja die westdeutschen Verhältnisse auch nicht unproblematisch sind. Aber meine Hoffnung war, dann mal wirklich unpolitisch losspielen zu können.
Millot: In dem, was Sie schreiben?
Endler: Ja. Ich habe mich sehr mit dem Surrealismus beschäftigt. Es gibt so eine Menge surrealistischer Literatur, der Teufel weiß wer, von wem, weswegen. Mich hat dieses Engagement immer gestört. Ich habe nie phantasmagorisch und wüst Texte zustande gebracht. Ich weiß aber, daß selbst in die automatischen Texte das Politische immer hineingeraten ist. Und das hat mich ungemein gestört. Ich wollte so frei produzieren wie die französischen Surrealisten in den ’20er Jahren, wobei ja da auch politische Dinge eine Rolle spielen, aber auf eine andere Weise. Das ist mir dann natürlich gar nicht gelungen. Und ich habe ein paar Gedichte geschrieben in dieser lockeren und unverantwortlichen Art, unengagierten Art. Sicher werde ich irgendwann noch mal einen neuen Gedichtband zusammenstellen. Aber das ist eigentlich nebenher passiert. Dazu mußte ich mich auch geradezu zwingen und sagen, so, jetzt schreibst du mal, beschäftigst du dich eine Woche lang nur mit Gedichten. Und ich mußte mich richtig dazu zwingen und dann habe ich mich in so einen nervösen, traumartigen Zustand versetzt, in den notwendig zerstreuten Zustand:
Jetzt schreibe mal zwanglos was.
Und dabei sind ein paar Texte zustande gekommen. Und sicher wird das eines Tages als kleiner Gedichtband erscheinen. Aber das nächste wird sein, daß ich mich nun doch, nachdem ich mich jetzt noch mal mit der DDR im engeren Sinne beschäftigt habe, doch mit der Wende beschäftigen möchte. Das Tagebuch ist weniger lustig als meine anderen Bücher, die sehr sarkastisch und oft zum Lachen sind. Es ist zwar ironisch geschrieben, aber nicht phantasmagorisch, nicht schwarz-humorig, wie meine früheren Texte, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben habe. Dahin komme ich jetzt wieder zurück. Aber auch nicht auf unpolitische Weise, sondern ich muß mich natürlich lustig machen über mancherlei Erscheinungen, die mit der sogenannten Wende oder der sogenannten stillen Revolution zusammenhängen. Wirklich, die einzige stille Revolution, die es jemals gegeben hat, nicht? Es wird sich mit Kuriositäten beschäftigen, die, ein paar, erlebt werden konnten. Wobei seltsamerweise und fast ganz unbeabsichtigt nämlich – denn die Leute stehen mir ja nahe – auch die sogenannten Bürgerrechtler immer mehr als komische Figuren erscheinen. Ja. Ich meine bei Biermann oder Jürgen Fuchs oder so, die von einem sehr kuriosen Selbstbewußtsein emporgesteigert werden, ist das leicht, nicht? Aber auch bei anderen Leuten, mit denen ich zu tun hatte in den ganzen Jahren, bei denen auch aufgrund ihrer Enttäuschung dann doch eigentlich ganz seltsame Züge zutage getreten sind, mit denen ich mich wahrscheinlich auch beschäftigen werde. Das wird wahrscheinlich etwas skandalös werden. Das schreibe ich jetzt. Und das ist verrückt und surreal und schwarz-humorig und absurd und jarryhaft, sag ich mal. Das wird sozusagen mein Wenderoman. Eigentlich schreibe ich keine Romane. Ich nenne das einfach so. Ich habe übrigens Ihnen so ein kleines Buch bereitgelegt. Das ist so als Kunstbuch, für Sammler, erschienen. Da reflektiere ich schon diese Probleme, oft zum ersten Mal. Es ist 42 Seiten lang und besteht aus kleinen erzählerischen Fragmenten, von mir frech Roman genannt. Ich nenne alles Romane, auch wenn ich einen Essayband veröffentliche, wird er in Zukunft zum Roman. Sie verstehen schon? Das ist postmoderne Haltung. Es wird Sie an manchen Stellen an die Surrealisten erinnern. Das ist im vorigen Jahr erschienen. 900 Exemplare. Die Antwort des Poeten38 – sagt eigentlich schon alles. Und die Antwort des Poeten ist: Schweigen. Zunächst mal Schweigen.
Millot: In dieser Wende- und Nachwendesituation haben Sie also gehofft, daß Sie sich vom politischen Schreiben ein bißchen entfernen, befreien können?
Endler: Also, das ist etwas sehr vereinfacht ausgedrückt. Im großen und ganzen ja. Aber ich habe es nicht geschafft.
Millot: Meinen Sie das in der Lyrik oder in der Satire?
Endler: Das geht bei mir ineinander über. Aber viele meiner sogenannten Gedichte nähern sich schon Prosaformen an. Außerdem habe ich seit etwa Mitte der ’6oer eher balladeske und erzählende Gedichte geschrieben, auch wenn sie noch gereimt sind und in strengen Formen gehalten. Ich nenne sie zum Teil auch „Erzählungen in Versen“. Das nähert sich bei mir an. Obwohl es immer noch deutlich getrennt bleibt für mein Gefühl, sicher auch für die Leser. Auf jeden Fall ist es mir in einigen Gedichten am ehesten gelungen, mich von der direkten politischen Polemik zu trennen. In Prosa ist mir das jedoch nicht gelungen, wie gesagt. Da habe ich erst mal die Tagebücher aufgearbeitet und dann jetzt doch wieder satirische Erzählungen angefangen. Satirische Prosa über das, was mit der Wende und nach der Wende passiert ist.
Millot: Und jetzt bei den satirischen Texten so wie bei den lyrischen Texten: einer der Ansätze der DDR-Literatur, bei Ihnen auch offenbar, ist die Beschäftigung mit der Sprache, die Kritik an der in der DDR gesprochenen offiziellen oder halboffiziellen Sprache?
Endler: Ja, das fängt im Grunde, nicht nur bei mir, in den ’70er Jahren, Mitte der ’70er Jahre an, daß man die offizielle Sprache ironisch verwendet und auf diese Weise bloßstellt. Aber es geht dann weiter. Es geht darum, nicht bei mir, aber bei anderen Autoren, die sich in sprachphilosophische Probleme vergrübeln, bis hin zu der Fragestellung, die ja auch in der neueren französischen Literatur vorkommt, ob nicht Schweigen angemessener ist, jedes Wort ist beschmutzt. Gert Neumann ist ein Fall, der ein Buch geschrieben hat: Die Schuld der Worte. Und der das bis heute, diese fast mystische Beschäftigung mit der Sprache, immer weiter getrieben hat. Es gibt da ja eine gewisse Ähnlichkeit zu den Auseinandersetzungen um Luther und Müntzer bis hin zu den Wiedertäufern, zu den deutschen Mystikern, die sogar die Bibel, das Wort der Bibel in Frage stellen, die den direkten Kontakt mit Gott vorgezogen haben. Solche Dinge spielen ja auch in der neueren französischen Literatur eine gewisse Rolle, vielleicht ohne diesen religiösen Hintergrund. Wie ist das überhaupt mit der Sprache und so? Das geht bei einigen soweit, bei mir nicht. Ich bleibe sozusagen doch in dieser sprachspielerischen, etwas satirischen Ecke. Und fast in der Weise, wie das bestimmte postmoderne Autoren tun. Da gibt es Franzosen, gibt es Amerikaner… Also die Postmoderne wird ja von einigen Neueren, gerade Prenzlauerbergern eher abgelehnt, weil ihnen das zu unernst war, nicht? Abgesehen von einigen Autoren war der Prenzlauer Berg eine tierisch-ernsthafte Angelegenheit. Ja, wenn man die Gedichte von Schedlinski und anderen so liest, das ist ja tierisch-ernst. Nun weiß man ja auch inzwischen warum.
Millot: Was aber Ihre Schreibpraxis betrifft, jetzt nach der Wende – hat sich zum Beispiel an dieser Haltung der Sprache gegenüber etwas geändert?
Endler: Ich schließe direkt an diese Texte an. Bei mir ist die Wende etwa – es gibt mehrere Brüche, aber die Wende habe ich vollzogen etwa um 1975. Und das ist auch die Zeit, in der ich anfange Prosa zu schreiben, mehr Prosa zu schreiben als Gedichte. Ich hatte noch gar keine, bis dahin, kaum erzählende Prosa geschrieben. Und das ist auch eine etwas aggressive, polemisch-dahinströmende Prosa. Es handelt sich nicht um Erzählungen im engeren Sinne. Es hat immer einen sehr polemischen Unterton. Und auch so die Motorik gewisser polemischer Texte. Wobei, was diese sprachkritische Seite anbetrifft, für mich Karl Kraus eine große Rolle gespielt hat. Eigentlich kommt bei mir schon sehr bald etwas zustande, was man ja kaum für möglich hält, nämlich so eine Symbiose von Karl Kraus und Alfred Jarry. Jarry war ein großes Erlebnis für mich, so Ende der ’70er Jahre. Und das kann man sich überhaupt nicht so richtig vorstellen. Ja, ist auch von einigen Leuten bemängelt worden.
Aber das ist auch ziemlich singulär, glaube ich, für die DDR-Literatur, die es so gegeben hat. Es fällt sehr heraus.
Millot: Jetzt ist also Ihre sprachkritische Haltung dieselbe geblieben. Aber die Sprache, die Sie kritisieren, ist nicht mehr dieselbe.
Endler: Das sprachkritische Element spielt immer mit. Es geht mir aber nicht um Sprachkritik schlechthin. Weil – ich erzähle auch Geschichten. Ich setze mich auch polemisch mit politischen Fakten auseinander. Dieses Sprachkritische bis Sprachspielerische spielt bei mir mit, steht aber nicht im Zentrum, ist eines der Mittel, die ich verwende.
Millot: Gut, aber für mich ist es sehr wichtig zu verstehen, ob sich etwas geändert hat, was sich geändert hat.
Endler: Die meisten werden sich wohl ändern müssen. Die Änderung ist mit mir, wie gesagt, Mitte der ’70er Jahre passiert. Und die Mittel, die sich einstellen bei der Beschäftigung mit dem, was jetzt oder in den letzten drei, vier Jahren passiert ist, sind kaum andere als die, die ich vor zehn Jahren verwendet habe, in der Auseinandersetzung, als Außenseiter, ja, weil ich auch aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen war, als Außenseiter, bei der Beschäftigung mit der damaligen DDR. Die Mittel ändern sich nicht gravierend. Ich spüre heute einige andere Untertöne, die, ich möchte mal sagen, etwas eisiger sind, etwas klirrender sind, ganz sicher bedingt auch durch den eigentlich desperaten Zustand der Welt, nicht? In den früheren Texten, die eigentlich mit dem Ende der DDR rechnen, habe ich weniger mit dem Ende der Welt gerechnet.
Millot: Gut, aber die Sprache zum Beispiel, die kritisiert wird oder die verballhornt wird, die ist nun einmal jetzt nicht mehr dieselbe.
Endler: Naja, ich meine: Es sind nicht ganz genau die gleichen Verballhornungen. Aber ich habe auch schon in früheren Texten nicht nur die DDR-Sprache, die offizielle Sprache der DDR oder die Sprache des Neuen Deutschlands kritisiert, sondern ich verwende in ähnlich sarkastischer Weise etwa westliche Modeworte – schon früher. Das habe ich auch schon in den ’50er Jahren gemacht. Bürokratensprache gibt es natürlich heute auch, wenn auch vielleicht eine etwas andere. Und die Zeitungssprache hat auch ihre Stereotypen, die auffallen und über die man sich lustig machen kann. Das ist eine andere Sprache. Aber im Grunde handelt es sich natürlich immer noch um die Auseinandersetzungen mit Schablonen. Wenn sich die Art der Schablonen auch etwas geändert hat.
Millot: Welche Schablonen wären für Sie besonders charakteristisch für eine neue Sprache, die jetzt entstanden ist und die es vorher in der DDR nicht gab?
Endler: Ich glaube, die Vorstellung, die DDR-Sprache habe sich so sehr von der westlichen Sprache unterschieden, war nicht ganz richtig. Die politische Sondersprache des Neuen Deutschlands war nicht die Sprache der DDR. Der normale Umgangston, der ja auch ständig Stereotype und Schablonen hervorbringt, war nicht weit entfernt von der Sprache der Westdeutschen. Es werden ständig neue und neue Floskeln hervorgebracht. Also zum Beispiel eine Sache, die sicher bei mir leitmotivisch auftauchen wird – das ist allerdings jetzt wieder sehr ostdeutsch –, ist die immer wieder verwendete Floskel:
Dafür sind wir im Herbst ’89 nicht auf die Straße gegangen.
Wobei das dann gerade von Leuten verwendet wird, die ganz bestimmt im Herbst ’89 nicht auf die Straße gegangen sind. Das wäre zum Beispiel jetzt so eine Floskel. Ich setze mich nicht nur mit offizieller Sprache auseinander, sondern beschäftige mich manchmal auch liebevoll mit der Alltagssprache. Mir gefällt manchmal die Art und Weise, wie so Berliner Leute fluchen und dann ganz bestimmte Floskeln verwenden. Da gibt es ja immer wieder verwendete Floskeln. Eine ganz seltsame Geschichte – ich habe da so eine Liste angefertigt, wie Lichtenberg, von Schimpfworten, die besagen sollen:
Du bist verrückt oder der ist verrückt.
Da gibt es so Geschichten wie:
Ihr seid woll ’45 jejen ’ne Bombe jerannt.
Also völlig absurd; taucht immer wieder auf. Und jetzt gibt es ähnliche und natürlich neue Floskeln. Man kann manchmal darüber lachen, manchmal grinsend zustimmen. Der Volksmund ist ja auch sehr produktiv, zum Beispiel auch, was die Benennung der verschiedenen Denkmäler in der Stadt betrifft.
Zum Beispiel das Thälmann-Denkmal oder das Lenin-Denkmal oder das Marx-Engels-Denkmal, was es dafür für Wörter und Begriffe gibt. Thälmann-Denkmal: Das U-Boot. Wenn Sie sich das ansehen, leuchtet das auch sofort ein. Manchmal gefällt es einem. Dagegengestellt nun immer wieder der Versuch damals in der DDR, solche halbvolkstümlichen Wendungen einzutrichtern. Zum Beispiel, das machen meistens Journalisten: zum Fernsehturm sagt die Bevölkerung schlicht Fernsehturm, aber in der Presse stand immer „Telespargel“. Also für solche Sachen habe ich einen Nerv und verwende das auch immer wieder. Dann wurde versucht, zum Beispiel, den „Telespargel“, das war vielleicht ein bißchen zu wenig vornehm – da tauchte plötzlich überall in der Presse, sicher infolge irgendwelcher Sitzungen, der Begriff, „Silberkugel“ auf. Das war natürlich viel feiner. Das sollte sich wahrscheinlich durchsetzen. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weder der Telespargel, noch die Silberkugel haben sich gegen den schlichten Begriff Fernsehturm durchgesetzt. Und solche Dinge passieren natürlich heute auch, nur auf einer anderen Ebene, mit anderen Begriffen, mit anderen Worten. Also das schönste Beispiel der neueren Zeit ist ja der jetzt von der SPD und der FDP verwendete Begriff die „Besserverdienenden“, für die Reichen. Das ist ja schon wieder so ein Ding, über das man sich kranklachen könnte. Nur damit es nicht die Reichen und „fuck the millionaires“ heißt, müssen es die Besserverdienenden sein… Das wäre zum Beispiel auch schon wieder so eine Floskel, mit der etwas zugedeckt werden soll. Und da war die DDR, die offizielle DDR-Sprache natürlich, unglaublich schöpferisch. Die Bevölkerung hat das meistens nicht mitgemacht, hat ihre eigene Produktivität gehabt, und beide Produktionen habe ich in meinen Texten verfolgt. Ich zitiere das dann immer. Das taucht dann immer auf als belebendes Element. Aber es ist nicht meine Hauptaufgabe, vielleicht mal, was den einen oder anderen Text angeht, aber mich damit zu beschäftigen, das ist nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist und waren natürlich damals die Ärgernisse, die man so erlebt hat, und viele Texte spielen sich als eine Art Wutanfälle ab. Und im Zusammenhang mit solchen Abläufen verwende ich diese Dinge sarkastisch oder zustimmend. Und das ist natürlich heute ganz leicht möglich.
Millot: Gründe, sich zu ärgern, gibt es heute immer noch.
Endler: Also erstens das und zweitens werden selbstverständlich einem ständig solche offiziellen und nicht-offiziellen Sprachproduktionen zugetragen, Wörter, Begriffe, Bilder.
Ja, ich notiere mir das. Das mache ich schon, daß ich so Notizbücher habe, in die ich das reinschreibe und dann guck ich mal nach. Im Prinzip hat sich da wenig geändert. Der Ton ist ein bißchen kälter geworden. Klärender. Weniger engagiert. Damals mußte man natürlich auf die Repression irgendwie antworten. Man hat auch ständig Angst gehabt. Später dann, in den späten ’80ern weniger, aber zumindest bis Mitte der ’8oer Jahre. Und man mußte auch ständig seine Angst überreden. Heute braucht man keine Angst mehr zu haben. Man muß Angst davor haben, daß man vielleicht wenig Geld hat. Aber das ist eine ganz andere Angst. Und das ist heißer, was ich damals geschrieben habe. Jetzt ist es distanzierter, kälter. Man könnte natürlich jetzt denken, das sei die Folge etwelcher Ernüchterung oder Enttäuschung oder so. Kann ich aber nicht sagen, weil ich mir wenig Illusionen gemacht habe. Ich gehöre überhaupt nicht zu den DDR-Nostalgikern. In meinem nächsten Buch, Tarzan am Prenzlauer Berg, tauchen, wie im Tagebuch, natürlich alle möglichen Leute auf. Manchmal nur mit Initialen. Manchmal auch mit Pseudonymen… Hermann Kant zum Beispiel als Dr. Claro Kingsize. Es war mir zu gefährlich, weil der immer Prozesse gleich macht… Kann ja sagen, das habe ich nie gesagt, wenn man im persönlichen Gespräch ist. Ja, da werden mir sicherlich einige Leute sehr böse sein, die die DDR nachträglich noch zu verschönern versuchen. Ich weiß, was passiert ist. Ich verstehe schon Leute, die bis zum Ende irgendwie geglaubt haben, es ließe sich noch etwas verändern. Aber bei mir war das dann erledigt die letzten zehn Jahre. Weggehen wollte ich allerdings auch nicht, weil es eine Menge privater Bindungen gab, und mich hat dieser seltsam dahin zerfallende Haufen DDR auch interessiert. Für mich war dann die DDR so etwas wie auf engem Raum – sozusagen die „Absurdität der Welt in der Nußschale“.
Millot: Wenn wir beim Ton sind – „klirrender“ sagen Sie immer wieder. Das verstehe ich auch. Kann man das aber genauer beschreiben? Kann man sagen: ,,lustiger“, „nicht mehr so lustig“? Oder hat vielleicht diese Frage keine große Bedeutung in dem Kontext? Für Ihre satirischen Texte.
Endler: Ja. Doch. Lustiger ist das falsche Wort. Es hat weniger Humor im natürlichen Sinne, jetzt. Es hat mehr sarkastische Züge, während es früher auch mit Humor gespielt war. Der Humor war so eine Art Lebensrettung. Man konnte auch über sich selber lachen. Kann ich heute auch noch. Diese humorige Seite ist etwas zurückgetreten. Und es ist schriller und sarkastischer geworden. Kälter. Humor ist ja was Warmes. Moralischer zum Beispiel ist es auch nicht geworden. Es war früher auch nicht moralisch in dem Sinne. Das kam mir immer an den Bürgerrechtlern so komisch vor, diese moralische Abgehobenheit. Dieser Anspruch sozusagen, die Maßstäbe zu haben, dieses oder jenes abzuurteilen oder zu begrüßen – für mich wäre der Inbegriff dieser Haltung Biermann, der das immer auch gleich mit Namen versieht. Der müßte Bundespräsident werden, denn der weiß alles. Das ist mir absolut komisch und fremd. Also, diese Art von Moral ohnehin nicht. Eine gewisse Art von Moral schon, nämlich ich kritisiere ja andauernd. Es muß da schon eine Moral drin sein. Wir waren bei der Moral. Mir sind natürlich manche menschliche Eigenarten ausgesprochen unangenehm. Zum Beispiel Spitzelei ist mir sehr unangenehm. Und ich habe durchaus ein moralisches Verhältnis, genau eben zu dieser Problematik wieder, der man schon immer begegnet ist und nicht erst seit diesen Enthüllungen. Oder gegenüber der Alltagsspitzelei des Hauswarts, den es damals gab, und solche Geschichten, und der Ämter, und der Polizei. Ich habe zu solchen Haltungen, die sicher keine ausgesprochen deutschen Haltungen sind, aber natürlich angesichts der deutschen Geschichte eine besondere Färbung haben, durchaus ein moralisches Verhältnis. Mir gelingt es also nicht, bestimmte Leute mit dem Argument zu entschuldigen, Literatur sei jenseits der Moral und könne nicht unter solchen Gesichtspunkten betrachtet werden, Ich habe mir darüber nie so sonderlich Rechenschaft gegeben. Allerdings bin ich schon doch der Meinung, daß eine gewisse Moral in der ästhetischen Konsequenz eines Schriftstellers besteht. Selbst wenn er amoralischen Weltbildern anhängt. Also Joyce zum Beispiel war ein ganz nihilistischer Mann. Aber sein Werk ist eine einzige und überzeugende ästhetische Konsequenz, angefangen von Dubliner bis hin zu Finnegans Wake. Für mich liegt eine gewisse Moral, und zwar die entscheidende im Zusammenhang mit der Literatur, in der ästhetischen Konsequenz und in der Unkorrumpierbarkeit bei der Produktion künstlerischer Texte. Das ist natürlich etwas, was Sie so vielleicht nicht akzeptieren werden, wenn Sie sich mit der engagierten Literatur befaßt haben. Ich teile in dem Punkt durchaus die Polemik, die Benjamin Péret – das ist ein surrealistischer Urvater – an manchen Gedichten von Paul Éluard, … den Sie ganz sicher kennen, weil der natürlich, wenn man sich mit engagierter Literatur beschäftigt… Er spricht von der Schande der Résistance-Literatur, weil sie partiell diese ästhetische Konsequenz vernachlässigt hat, und bringt als Beispiel Paul Éluard, vor allem dieses Gedicht „Auf meine Schulhefte, auf mein Pult… schreib ich deinen Namen… Freiheit“. Nach Péret ist das ganze Gedicht eine leere Litanei. Ich weiß nicht, wie man das in Frankreich empfindet. Wahrscheinlich wird man das nicht als ein großes Gedicht empfinden, vielleicht als eine rhetorische Leistung.
Millot: Nein, das ist beliebt.
Endler: Es ist beliebt? Aber es gehört sicher nicht zu den Gedichten, von denen man sagt, das da ist ein ungeheuer großes Gedicht. Wie so manche Texte von Brecht, die auch nicht so bedeutend sind, aber dann eine gewisse Rolle gespielt haben. Péret sieht darin natürlich ein Abgehen von der ästhetischen Konsequenz. Und da stünde ich schon doch auf der Seite von Péret. Das heißt aber nicht, daß ich amoralisch bin. Ich meine sicherlich auch, einer, der ein konsequenter Autor ist, kann nicht gleichzeitig ein Spitzel sein, oder so was. In dieser Sache bin ich mir ganz unsicher geworden. Das war eigentlich auch meine Vorstellung, daß ein ernstzunehmender Dichter kein Spitzel sein kann. Das ist eines der etwas schlimmeren Kapitel in den letzten Jahren, daß, was solche Dinge betrifft, doch Verunsicherungen entstanden sind. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen. lch habe eine große Distanz zu einigen Leuten gewonnen, ich treffe sie nicht, ich besuche nicht die gleichen Kneipen, aber ich kann nicht übersehen, daß doch der eine oder andere Text von Sascha Anderson so schlecht nicht ist. Und ich ziehe mich, was diese Geschichte betrifft, aus der Affäre, indem ich mir sage, sollen sich andere damit beschäftigen oder vielleicht in zehn Jahren. Es gibt ja 93.000 interessante Dichter, mit denen man sich beschäftigen kann, warum muß ich mich jetzt dauernd mit dem beschäftigen. Und sicher wird man auf diese Fragen noch mal eines Tages zurückkommen. Nur ich werde garantiert nicht darauf zurückkommen. Das geht dann einfach nicht mehr. Na gut, soweit zu dem verworrenen Problem der Moral. Ich bin kein Immoralist, sonst würde ich nicht dieses oder jenes kritisieren. Aber ich meine, daß das Wesentliche die ästhetische Konsequenz ist und daß darin eine bedeutende Moral steckt. Wenn man sich nicht vom Weg abbringen läßt. Das Problem ist dann eben, wie wenn Musil – die Welt geht unter oder der Weltkrieg bricht aus – sagt:
Ja, ich habe leider mit meinem Mann ohne Eigenschaften zu tun. Ich kann mich jetzt hier nicht in politische Alltagsgeschichten einlassen.
Das ist schon ein Problem.
Millot: Wird in einem solchen Kontext die Person, also das Ich in der Literatur als Instanz nicht sehr stark in Frage gestellt?
Endler: Ja, wenn schon die Sprache fragwürdig geworden ist, wenn die Wörter, die Worte fragwürdig geworden sind, dann das Ich in der Literatur erst recht. Das ist bei mir sowieso schon seit ewigen Zeiten so, daß ich unter verschiedenen Namen in meinen Büchern auftauche. Also mir leuchtet sehr so eine Gestalt ein wie der portugiesische Dichter Pessoa, der fünf Dichter war, er findet aus sich heraus fünf verschiedene Dichter, die er ist. Das leuchtet mir sehr ein. Das ist aber eine Spaltung, die in neuerer Literatur überhaupt häufiger passiert. In diesem Buch Die Antwort des Poeten tauchen Prosastücke auf – ich kann Ihnen das mal zeigen. Das ist so eine erfundene Expeditionsgeschichte, da tauchen unterschiedliche Leute auf und sehr seltsame Namen. Das sind lauter Anagramme. Es geht um die Sprache der Regenbogenesser, diese Expedition entdeckt sie und zum Beispiel gibt es einen Dialog, der geht so: Read Nd Fello!, Dof and reell, Der Defn Aoll!… Das bin ich, das ist immer mein Name, wie nennt man das? Anagramme oder? Das schöne Gedicht: „Darf Ole Endl / Darf Ole Endl“. Das ist Folklore auch von den Regenbogenessern – Od Df Er Lalen, Adolf Redeln, Adolf Redeln, Ol El Darf Ned… Das ist alles Adolf Endler. Und so auch die Namen Dore Elfland, Leda Rednfol, Loald D’Enfer. Da ist, ich habe das schon gesagt, so ein Element von Postmoderne ins Spiel gekommen. Ich habe mich überhaupt nicht sonderlich mit Postmoderne befaßt. Aber ich weiß inzwischen, daß es solche Elemente natürlich in sogenannter postmoderner Literatur mengenweise gibt. Also das Ich spielt dann schon eine geringere Rolle, wenigstens im Text. Ich meine das Ich, auch das lyrische Ich usw. das sind etwas altertümliche Vorstellungen. Natürlich ist das, wenn ich das so mache, eine provokante Zurückweisung der Vorstellung, ich sei eine fassbare Person oder es wenigstens im Text bin. Ich fasse mich ja selber nicht. Um Gottes willen!
Millot: Meine Frage ging mehr darauf hinaus: Ist es anders geworden? Also hat das „Ich“ mehr Platz oder weniger?
Endler: Dieses Spiel mit den Namen setzt bei mir auch schon Anfang der ’80er Jahre ein. Offenkundig ist das auch ein psychologisches Problem. Ich akzeptiere mich offenkundig nicht. Es hat auch jetzt mal abgesehen von der Literatur, es hat zum Beispiel auch damit zu tun, daß ich Adolf Endler heiße. Mich hat ungeheuer, solange ich denken kann, geärgert, daß ich Adolf heiße. Das sind also so Urgeschichten. Und ich habe mir dann… Gott sei Dank heiße ich außerdem noch Edmond, ich habe einen zweiten Namen Edmond. Meine Mutter ist Flämin, und die hatte mir so einen halbfranzösischen anderen Vornamen nach einem Verwandten gegeben. Und dann heiße ich natürlich für meine Bekannten Eddy und manchmal tauche ich auch als Eddy Pferdefuß Endler auf. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die eine gewisse Rolle gespielt hat. Man beschäftigt sich ständig mit dem eigenen Namen. Heute tue ich das nicht mehr so sehr. Aber als Kind oder als Junge… Warum heiße ich so? Also darin steckt auch ein gewisser Defekt, möchte ich mal sagen. Nur weiß ich ja inzwischen, daß dieser Defekt in der Postmoderne als etwas Wunderbares gilt.
Millot: Sagen Sie als Person dem Publikum oder dem Leser etwas, wenn Sie schreiben? Haben Sie den Eindruck, daß Sie sich mitteilen?
Endler: Ja. Es hat auch mit der Situation in der DDR zu tun, mit dem „Sich-Verstecken“. Geprägt worden bin ich von den Wohnungslesungen. Man konnte nicht mehr publizieren. Und dann war so ein Publikum von hundert Leuten in engen Prenzlauer-Berg-Wohnungen und da habe ich regelmäßig gelesen. Und ich habe die Texte im Hinblick auch schon auf solche Wohnungslesungen geschrieben. So kommt auch ein rhetorisches Element zustande. Da man sich mit denen so verständigt hatte, spielte ein ständiges Mitspielen von Aktualitäten eine Rolle. Es kommt ein kabarettistisches Element hinein. Und Humor, der Humor besteht natürlich, wird allein schon dadurch gefördert, daß man in dieser Situation sich produziert und weiß, vor der Türe steht die Stasi oder es wird abgehört. Und dann blinkert man sich zu und weiß schon Bescheid. Das sind so merkwürdige humoristische Elemente, die heute natürlich keine Rolle mehr spielen. Der Humor ist bedingt durch die Abschottung und durch die Bedrängnis. Also jetzt haben wir eine Menge Strähnen zusammengezogen. Wahrscheinlich kriegt man ja nie so eine Existenz zusammen. Auf jeden Fall ist es alles wunderbar postmodern, ohne daß ich das wollte. Das war eine Übereinstimmung, eine augenzwinkernde Übereinstimmung mit einer bestimmten Schicht in einem bestimmten Stadtteil.
Millot: Und jetzt? Ich nehme an, daß sich daran etwas geändert hat?
Endler: Ja, das gibt es überhaupt nicht mehr. Ich würde mal sagen, jetzt muß ich damit rechnen, daß ich irgendein beliebiges Publikum habe – das nicht so zu fassen ist. Und ich erlebe, daß es einmal nicht klappt und einmal klappt, im Prenzlauer Berg aber hat es von einem bestimmten Augenblick an, nachdem sie sich an meine Methode gewöhnt hatten, immer geklappt. Jetzt können Leute, die aus der DDR weggegangen sind, im Publikum sein, die dann reagieren und das andere Publikum mitreißen. Oder es gibt auch ein Publikum, in Frankfurt oder in Heidelberg, das überhaupt nichts damit anfangen kann, was ich produziere. Jetzt bin ich so der alternde Blues-Sänger, der mal in Bielefeld akzeptiert wird und mal in Heidelberg nicht. Das ist eine Rolle, die ich auch ein bißchen genieße. Natürlich ist das auch interessant zu sehen, hier funktioniert es und da funktioniert es nicht, oder in einem bestimmten Zeitraum funktioniert es und an demselben Ort funktioniert es ein Jahr später nicht mehr. Das ist ja sehr interessant.
Millot: Und haben Sie herausbekommen, warum das manchmal beim westdeutschen Publikum nicht funktioniert?
Endler: Ich meine, weil überhaupt diese Schreibweise in Deutschland nicht verbreitet ist. In der DDR war sie dann in einem bestimmten Kreis bekannt. Also, wenn ich in einer Volksbuchhandlung in Glauchau oder in Dresden gelesen hätte, wäre es womöglich nicht verstanden worden. Es war ein bestimmter Kreis.
Es ist nicht nur Verschlüsselung. Es ist einfach ein Spiel mit diesen Elementen. Zum Teil ist es auch ein bißchen Verschlüsselung, aber eigentlich nicht so sehr. In meinen Büchern kommen auch die Namen Honecker, Frau Honecker, die kommen alle vor, und Hermann Kant und wer noch immer. Eigentlich war das früher viel… Die haben nicht wahrgenommen, daß das dann irgendwo auch noch publiziert war. Aber heute nehmen sie es wahr, jetzt geht es um Geschäfte, da kriegt man Prozesse an den Hals. Insofern war das früher irgendwie ulkig. Da habe ich Hermann Kant erwähnen dürfen, ohne daß ich etwas befürchten mußte. Es wurde einfach nicht wahrgenommen. Jetzt würde ich einen Prozeß kriegen, weil ich selbstverständlich jetzt in den, sagen wir mal, Geschäften störe. Das ist ernster geworden. Und das ist schon eine sehr ulkige Veränderung. Sie haben das nicht wahrgenommen. Für diese Leute gab es mich nicht. Ich war ein minderwertiges Subjekt usw., das man nicht wahrzunehmen hatte. Das ist eine Nebensache, aber das hat sich geändert.
Um noch einmal darauf zurückzukommen: so wie ich schreibe, wird in Deutschland überhaupt wenig geschrieben. Ich meine, selbstverständlich verstehen auch viele Westdeutsche nicht, wenn bei Lesungen etwas schwierigere westdeutsche Autoren auftreten. Und dann sagen sie: „Ja, das ist mir zu schwierig, das kann ich nicht verstehen“, oder sie tun so, als verstünden sie es. Wenn ich dann aus dem Osten komme und sie verstehen es nicht, können sie immer sagen:
Ja, wir verstehen das nicht, weil wir die Verhältnisse nicht kennen.
Das ist eine faule Ausrede meistens. Ich meine, man versteht ja auch südamerikanische, mittelamerikanische Literatur oder Literatur aus einem speziellem Stadtteil in New York als Exotismus zumindest, als Exotisches, ohne genau zu wissen, wer dieser Name ist und was dieser Name bedeutet usw. Nein, es ist einfach vielleicht hin und wieder etwas schwierig. Und es gibt dann die leichte Ausrede, sehr schnell sich einstellende Ausrede, das kann ich nicht verstehen, ich finde es ja sehr schön, aber ich kann es nicht verstehen, weil, ich kenne diese Verhältnisse nicht. Das ist fast regelmäßig eine Ausrede.
Millot: Vermissen Sie dieses eigene Publikum?
Endler: Nein. Irgendwie war es dann auch ein bißchen zuviel geworden. Man muß ja aus einem solchen warmen Brutkasten dann auch mal raus. Dieses „In-dem-Brutkasten-Sitzen“ – ich war dessen etwas überdrüssig geworden. Jetzt wollte ich doch endlich mal ein Weltmann werden und vielleicht… Das ist mir natürlich nur zum Teil gelungen. Aber ich schreibe nicht auf ein bestimmtes Publikum hin. Dieses Tagebuch habe ich in Bezug natürlich auf bestimmte Diskussionen hin geschrieben. Also indirekt doch in Bezug auf ein Publikum. Das habe ich damals schon geschrieben, weil ich immer zu den phantasmagorischen Texten so eine Art tagebuchartigen Dokumentarband stellen wollte. Das habe ich jetzt fertig gemacht, ohne daß ich mir dieses Publikum direkt vor Augen halte. Nun kommt hinzu, daß ich immer schon ein bestimmtes unterhaltsames Element in meinen Texten habe. Auch wenn sie schwierig sind. So was Entertainerhaftes spielt da eine gewisse Rolle. Ich mußte mich dazu selber bekennen. Also, ich war mal verheiratet mit der sehr ernsten Dichterin Elke Erb. Die hat sich immer über meine Art zu schreiben, heute akzeptiert sie die, aufgeregt, weil die so unernst war. Und ich habe mir ständig so bis zu meinem vierzigsten Lebensjahr, ständig, ein Gewissen daraus gemacht, daß ich so unernst schreibe. Und dann habe ich mir eines Tages gesagt, „Nee, da bist du dieses ,Ich‘ dann doch, und du mußt das so machen“. Dieses Entertainerhafte mußte ich einfach als mein eigenes auch akzeptieren. Und das ist von vornherein natürlich auch etwas publikumsabhängig, ohne daß ich jetzt genau weiß, was das für ein Publikum ist.
Millot: Und diese Tagebücher? Sie haben vorhin gesagt, daß es im Endeffekt die frühen ’80er Jahre sind, die Sie berücksichtigen. Aber die Tagebücher haben Sie jetzt nach der Wende zu Ende geschrieben?
Endler: Manches war schon ziemlich weit gediehen. Anderes hat in rohen Notizen dagelegen. Und ich hatte da immer so einen Stapel und habe den wegschmuggeln lassen zu meiner Mutter nach Ratingen bei Düsseldorf. Wobei mir bei dieser Schmuggelei sehr oft Sascha Anderson behilflich war.
Ich wußte natürlich nicht, daß die DDR zusammenbrechen würde. Ich habe eben versucht, innerhalb der Optik zu bleiben, die wir damals hatten. Ich habe in einem Anhang einiges erklärt, weil ich Fehler hatte hier und da, nicht oft, so in der Einschätzung von Sascha Anderson zum Beispiel, den ich einfach für so eine Art schlitzohrigen Kunstagenten gehalten habe. Das steht natürlich irgendwann einmal in dem Tagebuch. Also ich bin auch, was so Irrtümer betrifft, in dieser Welt geblieben. Die Frage ist, wie hat man eigentlich diesen Prenzlauer Berg erlebt. Ja? Oder, wie habe ich den erlebt, wie haben die Leute, mit denen ich zu tun hatte, das erlebt? Und wenn ich das jetzt aus der heutigen Sicht schreibe, dann kommt was anderes raus.
Millot: Wir kommen immer wieder zu den satirischen Texten zurück. Wir haben also die Lyrik ein bißchen abseits gelassen. Oder gilt das Letzte auch für die Lyrik?
Endler: Zum Teil. Auch meine lyrischen Texte sind oft mit einem leichten ironischen und satirischen Touch versehen, oder sie sind absurd. Sie sind wortspielerisch anders als natürlich in Prosatexten, auf eine neckische, auf eine clowneske Weise. Es gibt Bilder, die bewußt falsch sind, zum Beispiel, und mit denen ich den Lesern oder dem Publikum oder den Lyriklesern sozusagen eine lange Nase mache, mit denen ich Leute reinlege. So einen Spaß gibt es auch. Nur lyrische Texte sind etwas anders organisiert, in der Regel, als Prosatexte. Manche nähern sich der Prosa an. In den neueren lyrischen Texten habe ich eigentlich versucht, sie von dieser politischen, polemischen, das habe ich schon gesagt, polemischen Sphäre freizuhalten. Und ein paar davon habe ich mal veröffentlicht. Das meiste noch nicht. Das war natürlich früher nicht so. Früher waren auch meine lyrischen Texte eine direkte Reaktion auf die Verhältnisse und zum Teil zu meinem Ärger. Wie gesagt, ich wollte nach der Wende endlich mal frei produzieren, frei von diesen Störungen. Und das ist mir nur mit ein paar lyrischen Texten gelungen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die bedeutend sind. Vielleicht sind sie zu verspielt. Das ist ja möglich. Ich bin in den letzten Jahren so zwischen mehreren Projekten hin und her geirrt, muß ich schon sagen. Diese Sache mit dem Tagebuch, dann hier diese Prosatexte, die direkt an die früheren anschließen. Jetzt kommt hier noch Konfetti, Schnickschnack, fast zufällig entstanden. Plötzlich durch Zufall so. Da ist vieles, was man wieder wegschmeißt, warum, weißt du selber nicht. Das ist dann wieder das surrealistische Prinzip, daß der Zufall einem irgendetwas zuträgt.
Millot: Ist das experimentelle Lyrik?
Endler: Nein, überhaupt nicht. Ich würde auch heute surrealistische Lyrik nicht mehr als experimentell im engeren Sinne bezeichnen. Das sind überhaupt keine experimentellen Sachen, sondern Einfälle.
Millot: Noch einmal zur Frage der Entwicklung: Ich wollte wissen, ob es in Ihrem Schreiben Wendepunkte gibt, ob sie jetzt durch die Wende oder durch andere politische Ereignisse oder Veränderungen erzeugt worden sind.
Endler: Ja, das zweifellos, aber nicht durch die Wende. Bei mir gibt es einen Schnitt. Und ich würde auch heute, zum Beispiel, die frühen Gedichte weglassen. Nicht, weil die mir politisch mißfallen, sondern weil so eine Art kitschiger, volkstümlicher Ton darin ist. Da hatte ich mich um Volkstümlichkeit bemüht, wie ein sozialistischer Realist dies ja tun sollte. Heute würde ich meine Gedichte ab ’63/64 ernst nehmen. – Ich war zum Beispiel mit allen anderen für den Bau der Mauer, weil ich für die DDR war. Die Frage war ja nicht, soll die Mauer stehen, sondern soll die DDR weiter existieren. Aber wir hatten irgendwie die seltsame Vorstellung, daß, wenn die Mauer steht, wir dann richtig im Lande loslegen könnten. Und das war sehr schnell zerstört worden. Wo das anfing, kriegten die Leute einer nach dem anderen was auf den Kopf und dann merkte man schon, daß man falschgelaufen war. In diesen ersten Nachmauerjahren hat sich bei mir etwas sehr geändert. Aufgrund solcher Ereignisse, nicht aufgrund der Mauer, sondern aufgrund einer anderen Kulturpolitik oder überhaupt einer anderen Politik als der erwarteten. Für viele hat sich damals etwas verändert, für viele Dichter. Damals entstanden so die kritischen Gedichte usw., und alle kriegten was aufs Haupt. Viele sind dann weggegangen. Von etwa ’64 an habe ich anders geschrieben. Böser. Auch weniger umgänglich, weniger volkstümlich, aber immer noch relativ fassbar. Das ist zum großen Teil in Anthologien erschienen. Aber dann erst wurde, was da anfängt, so richtig fassbar, um ’74 in dem Gedichtband Das Sandkorn39. Das umfaßt eigentlich diese Phase, auch dann im Zusammenhang mit der Biermann-Ausweisung, die ich als einen riesigen Slapstick-Vorgang empfunden habe. Da ist bei mir etwas völlig zerrissen. Und das ist so zerrissen, daß ich mir gesagt habe, dieses Widersprüchliche und Verrückte kannst du mit Gedichten überhaupt nicht mehr einfangen. Und habe dann angefangen, erzählende oder polemisch erzählende Prosa zu schreiben, schwarz-humorige, irre, verrückte, absurde Prosa und parallel dazu entsprechende Gedichte oder poetische Texte, aber immer mehr Prosa als Gedichte. Und das hängt ganz zweifellos in dem einen wie in dem anderen Fall mit politischen Erlebnissen, auch mit politischen Schocks zusammen, wobei man allerdings sehen muß, daß natürlich nicht der Schock allein diese Wandlung bewirkt hat, sondern daß im Grunde da schon jahrelang etwas in einem gearbeitet hat. Und das, was irgendwo hinwollte, wurde dann einfach durch den Schock perfekt. 1963/64 und ’75/76 waren für mich durch politische Ereignisse bedingte Schnittpunkte in dem, was ich geschrieben habe. Während die Wende als Schnittpunkt gar nicht diese Rolle gespielt hat. Ich kann dazu nur sagen, daß ich weniger Lyrik schreibe als früher. Mal nebenher und herumgespielt. Prosa steht nun im Vordergrund. Ich habe ja übrigens ein Gedicht geschrieben, in dem ich all diese Fragen beantworte – „Ich kann nix dafür“. Das ist aber dann wirklich auch schon als Text anders als die früheren Gedichte. Diese letzte Abteilung in dem Buch Akte Endler (Abteilung 5)40 ist sozusagen das Neue – und da fängt es an, verrückt zu werden:
ICHKANNNIXDAFÜR
1
Mit dem gestohlenen Laster voll Buntmetallen nach Bonn
aaaaahinuntergeschippert – um genau zu sein, nicht Bonn im
aaaaaengeren Sinn –,
Bin ich noch ganz normal ’raus, aber dann sofort von der Lade-
aaaaarampe gefallen, und zwar mit der Birne nach vorn,
aaaaaund das mit Karacho.
Seit diesem Moment bin ich Lyriker, Mademoiselle! Ja, so wird
aaaaaes gewesen sein, Mademoiselle, nicht andersherum.
2
Die Essayistik, das haben Sie richtig beobachtet, setzte erst
aaaaalange Zeit später, freilich ebenso plötzlich ein;
Und zwar nach einem ähnlich peinlichen Zwischenfall in
aaaaaAschaffenburg, einer vom Wesen her nicht unangeneh-
aaaaamen Ortschaft,
In der mir indessen die Denkmalspflege beim Mittagsgeläut aus
aaaaabeachtlicher Höhe ein Brett auf dem Kopf sausen ließ.41Der Autor siedelte 1955 in die kunstfreundlichere DDR über. (A. E.)
3
Für mein Romanwerk jedoch ist mit Sicherheit die Verdiente
aaaaaFischereigenossenschaft HERINGSSEGEN auf Rügen haft-
aaaaabar zu machen
– Ich kann, Mademoiselle, für das alles eigentlich nicht so
aaaaarichtig dafür –, welche erst die Voraussetzungen für die
aaaaaEreignisse schuf,
In deren Verlauf ich ausrutschte, wie noch nie, und zwar auf
aaaaaHeringssalat, und mir tüchtig die Schnauze aufschlug…
aaaaa(Oder waren es Sprotten?)
Das hier eigentlich beantwortet alle Ihre Fragen. Als für die Wendezeit oder Nachwendezeit besonders charakteristische Texte würde ich sonst eben die Texte in diesem Band Die Antwort des Poeten nennen. Es ist da ein anderer, etwas leicht veränderter Ton drin, aber kein radikaler Bruch.
Die Druckfassung wurde von Brigitte Schreier-Endler und Elke Erb im Sommer 2015 erstellt und leicht überarbeitet.
Sibylle Goepper und Cécile Millot (Hrsg.): Lyrik nach 1989 – Gewendete Lyrik? Gespräche mit deutschen Dichtern aus der DDR, Mitteldeutscher Verlag, 2016
Schaufenster ’86
Ich erinnere mich an den Tag, als Adolf Endler in meiner Lesereihe im Jugendklub Schaufenster in der Berliner Chausseestraße lesen sollte. Ein erwartungsvolles Publikum war da, denn Endlers Lesungen waren und sind etwas Besonderes, der Autor anwesend, es hätte losgehen können. Es ging aber nicht, zwei Männer traten auf, mit dem Auftrag, die Fenster des Klubs zu putzen, an einem Freitagabend nach 20 Uhr. Meine erste Vermutung war, daß es sich um eine subtile neue Variante der damals bei Lesungen grassierenden Rohrbruchswelle handelt. Es war in jenen Tagen kaum noch üblich, schon genehmigte Lesungen, die man behördlicherseits dann doch nicht wollte, einfach zu verbieten. Statt dessen wurden die entsprechenden Klubs etc. virusgleich von Rohrbrüchen heimgesucht, die dann zum Ausfall der Lesung aus „technischen Gründen“ führte, so bei Fühmann in Jena, bei Braun im Studentenklub der Humboldt-Uni in Berlin. Rohrbrüche, die sich bis zum nächsten Tag von selbst, ohne Einsatz von Handwerkern, quasi durch Gesundbeten, behoben. Aber nein, der Hintergrund dieser Feierabendfensterputzaktion war ein anderer. Gorbatschow war in der Stadt, und seine Ehefrau Raissa wollte am Montag darauf das Brecht-Haus besichtigen, und so wurden die beiden Fensterputzer losgeschickt, auch die Fenster der Nachbarschaft zu reinigen. So warteten wir gemeinsam, Autor, Publikum, einschließlich jener im dienstlichen Auftrag Anwesenden, den Fensterputzern zuschauend, weil den Russen gezeigt werden sollte, daß es nicht auf Perestroika oder Glasnost ankommt, sondern auf saubere Fenster.
Dieses Vorspiel zu Eddis Lesung über die Absurditäten dieses Landes war selbst so absurd, daß ich ihn für einen Moment im Verdacht hatte, er hätte diese Fensterputzer quasi als Vorgruppe selbst bestellt, angesichts des damaligen Honorars von 150 Mark der DDR (einschließlich Fahrkosten) verwarf ich diesen Gedanken aber schnell.
Man darf nicht vergessen, daß Endler zu den Autoren gehörte, die nur selten Gelegenheit hatten, in öffentlichen Räumen zu lesen. Er hat diese wenigen Gelegenheiten, wie auch die der Wohnungslesungen, gut genutzt, ohne falsche Rücksichtnahme, kannte auch hier, wie beim Schreiben, keine Tabus. Seiner Art zu schreiben, das Vermischen von Dokumenten, Zeitungsmeldungen u.ä. mit phantastischen und grotesken Geschichten, von ihm selbst „Phantasmagorisches Schreiben“ genannt, merkt man an, daß es ihm selbst viel Spaß bereitet. Es war aber eben auch Mittel, sich dieser Wirklichkeit zu erwehren. Das Lachen über diese Texte blieb einem mitunter im Halse stecken, aber zumeist war es befreiend. Am schönsten hat das Wolfgang Hilbig in seiner Laudatio auf Eddi Endler ausgedrückt:
Jedesmal, wenn man etwas von Dir liest, glaubt man, man müsse sich augenblicklich totlachen. Doch dann merkt man plötzlich, daß man schon tot war, und daß man sich wieder lebendig gelacht hat.
Gerd Adloff, 1995, aus sklaven. Migranten, Diversanten, Kombattanten, Heft 16, 1995
Gruppenbild mit Endler
– Die „Sächsische Dichterschule“ in lyrischer Korrespondenz. –
Generationsproblematik
Zur Bezeichnung der Lyrik in der DDR der sechziger und frühen siebziger Jahre finden wir in der Forschung öfters den Begriff „mittlere Generation“. Diese Bezeichnung umfaßt eine nicht eindeutig bestimmte Anzahl von Autoren, die sich wiederum in einzelne „Gruppen“ einordnen lassen. Je nach Geschmack und ideologischer Wetterlage werden verschiedene „Gruppen“ in der Literaturwissenschaft und -kritik als die favorisierten Vertreter der „mittleren Generation“ vorgestellt. In den Jahren 1971 und 1972 zum Beispiel kam es diesbezüglich in der DDR zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern von verschiedenen „Gruppen“ innerhalb der damals jüngsten Lyrik. Anläßlich des Aufsatzes „Versuch über Versuche junger Lyriker“ von dem Germanisten Hans Richter polemisierte Adolf Endler in der Zeitschrift Sinn und Form u.a. gegen das Verschweigen jener „Gruppe“ von Lyrikern, der er später die problematische Bezeichnung „Sächsische Dichterschule“ gab. Endler richtete sich an dieser Stelle gegen die Tendenz in der offiziellen Literaturwissenschaft, das Augenmerk auf die „Epigonen“ (wie etwa Helmut Richter und Axel Schulze) zu heften, „als ob sich in diesen Gestalten die Lyrik der sechziger Jahre repräsentiere“.42 Er stellt fest, daß die offizielle Literaturkritik einen weiten Bogen um die Autoren schlage, die aus dem Schaffen des Epigonentums herausgetreten sind. Er nennt unter anderem: Karl Mickel, Uwe Greßmann, Elke Erb, Rainer und Sarah Kirsch, Richard Leising und Heinz Czechowski. Zusammen mit Endler sind das jene Autoren, die in der Anthologie In diesem besseren Land die junge Lyrik vertraten.43
Es ging Endler in diesem Streitfall darum, die Teile der „Poesie, die (…) in den letzten Jahren entweder einer breiten Öffentlichkeit nur bruchstückhaft zur Kenntnis gegeben worden sind oder von Literaturwissenschaft und Literaturkritik auf selbstmörderische Weise gemieden wurden“, zu diskutieren, wie es zuvor in der Lyrik-Debatte von 1966 in der Zeitschrift Forum versucht wurde. Beiläufig fragt sich der Lyriker-Essayist, weshalb gerade in der DDR diese um 1935 geborenen Lyriker unbeachtet bleiben, während ihre Kollegen „in anderen Ländern längst im Bild der nationalen Poesie“ dominieren.44 Hinzu kommt, daß – während in der DDR lange Zeit Texte von Mickel, Endler u.a. in der Kritik vernachlässigt wurden – der Begriff „mittlere Generation“ in der westdeutschen Forschung fast zum Synonym für die von Endler vorgestellten Lyriker wurde. In seinem Essay mit dem bezeichnenden Titel „Die Generation Volker Brauns. Lyrik in der DDR seit 1962“ sieht Harald Hartung zwar verschiedene, parallellaufende Tendenzen, d.h. er erkennt, daß es neben einer „Hauptrichtung einen breiten Zusammenhang konventioneller Produktionen gab und gibt und daß deren Affirmationstendenz nicht minder bezeichnend ist als die Bestrebungen und Konflikte der ,führenden‘ Autoren“. Schon in diesem Zitat und anderswo in seinem Essay deutet Hartung aber an, welche Lyriker er zum Kanon zählt:
Damals setzte eine regelrechte Lyrikwelle ein, und mit ihr kündigte sich eine neue Generation an, (…) ein neues Verständnis von Bedeutung und Funktion des Gedichts und nicht zuletzt, mit den Leistungen der Autoren, eine positive Einschätzung dieser Lyrik in der DDR wie in der Bundesrepublik.45
Es sind vor allem die Lyriker selbst, die im nachhinein in ihren Essays und in Interviews auf eine Gruppenbildung unter Autoren wie Braun, Mickel, Rainer und Sarah Kirsch, Endler und Erb hingewiesen haben, und diese aus verschiedenen Gründen gegen andere „Gruppen“ oder Tendenzen in der Lyrik der sechziger und siebziger Jahren absetzten. Diese Abgrenzung können wir zum Beispiel der Auswahl von Texten beim Zusammenstellen von Anthologien ablesen. So entstanden Gruppenbezeichnungen wie etwa „Plejade“, „Sächsische Dichterschule“ (beide von Endler) oder einfach „Truppe“ (von Sarah Kirsch), die viel über ein bestimmtes Zusammengehörigkeitsgefühl, jedoch wenig über die genaue soziologische Kohärenz und noch weniger über die Texte der betreffenden Autoren sagen.46 Wenn also nach dieser „Gruppe“ als einer in ihrer „gesellschaftliche(n) Stellung in einem größeren Zusammenhang ideologischer, staatlicher, sozialer Umwelt“ kohärenten Formation gefragt würde, stellen sich die Gruppenbezeichnungen alsbald als vage heraus.47 Die oben genannten Autoren haben sich nicht (abgesehen von Zusammenkünften Anfang der sechziger Jahre in Halle)48 wie etwa die Schriftsteller der Literaturzirkel „alex 64“, „Maxim Gorki“ und „Leben, Liebe, Zukunft“ zusammengetan. Die Arbeiten wurden nicht im Kollektiv geschrieben und besprochen, so daß nicht von einer freiwilligen und bewußt eingegangenen Gruppenbildung von Autoren – solche Gruppierungen sind „oft mit bestimmten Zwecksetzungen verbunden“ – die Rede sein kann.49
Die im nachhinein von einer Anzahl von Autoren festgestellte Gruppenbildung ist nicht so sehr eine soziologische Kategorie, sondern in erster Linie eine (inner-)literarische, die mit Hilfe der Textanalyse ausfindig gemacht werden sollte. Dabei sollte es nicht darum gehen, bestimmte „Gruppen“ voneinander abzugrenzen; es geht vielmehr um die Charakterisierung einer literarischen Zusammenarbeit, die sich von anderen literarischen Tätigkeiten innerhalb der „mittleren Generation“ unterscheidet. Wir schließen hier u.a. bei Wolfgang Emmerich an, der 1981 in seiner Kleinen Literaturgeschichte der DDR schreibt:
Nirgends in der neueren deutschsprachigen Literatur, gibt es so viele Gedichte, wo Kollegen an Kollegen sich wenden (…).50
Er zielt damit auf die Besonderheit der Texte von Lyrikern wie Braun, Endler, Kirsch und Mickel, die Endler in seinem Aufsatz von 1978 unter dem Begriff des „Aufeinanderbezugnehmens“ faßte, das er das „Charakteristikum des Kreises“ (d.i. die „Sächsische Dichterschule“) nannte.51
In diesem Zusammenhang bringt Emmerich unter anderem das Gedicht „Ernste Mahnung 75“ von Rainer Kirsch zur Sprache, in dem auf Texte von Heinz Czechowski und Karl Mickel angespielt wird.52 Das Gedicht, in dem der „Odendichter H. Czechowski“ ermahnt wird, statt Oden auf Karpfen, (Anspielung auf „Erfahrung mit Karpfen“) zu schreiben, einen richtigen, einst versprochenen, Karpfen zuzubereiten, ist mehr als das bloße Herbeizitieren und Nennen von Kollegennamen. Es ermöglicht dem Leser nämlich, verschiedene Spuren durch die Lyrik-Landschaft der DDR zu verfolgen – so setzt Karl Mickel in dem von Kirsch angedeuteten Gedicht „Der Tisch“ das wiederholt in der jungen DDR-Lyrik auftauchende Eß- und Trink-Motiv wieder auf ganz eigene Weise in Beziehung zum Akt des Schreibens.53 Außerdem sind solche Anspielungen für den Dichter selbst wohl ein Medium der Selbstreflexion – sie verschaffen einen Blick in die ,Küche‘ des Anderen, wodurch sich Differenzen und Affinitäten schärfen. Bis in die achtziger Jahre hinein können wir die Spuren der Anspielungen in Texten von immer den gleichen Autoren verfolgen, wie etwa in Uwe Kolbes Gedicht „Zweite, überschüssige Legitimation“:
Jeder Weg macht mich wirr,
jeder Schritt erinnert mich
an den größten Anspruch bei Braun
und bei mir.54
Was sich in diesen Texten abspielt, ist ein Prozeß der Intertextualität in der Gestalt einer lyrischen Korrespondenz. Das ist eine Korrespondenz, die sich nicht auf einen einzelnen Text beschränkt, sondern die in einer Anzahl von verschiedenen und von einer beschränkten Anzahl von Lyrikern geschriebenen Texten zu verfolgen ist. Das heißt, daß wir die „Gruppe“ im nachhinein in den intertextuellen Bezügen herstellen und kennzeichnen können. Außerdem geben die Anspielungen, da sowohl Differenzen mit als auch Affinitäten zu Dichter-Kollegen ans Licht treten, Anlaß, sich ein Bild vom einzelnen Autor zu verschaffen.
Ein besonderer Fall der lyrischen Korrespondenz, die hier an Beispielen von Texten Karl Mickels, Inge Müllers, Elke Erbs und Adolf Endlers näher untersucht werden soll, ist das sogenannte Porträtgedicht. Das Gedicht über Dichter kennt eine lange Geschichte und wird häufig sowohl gegen die biographische wie gegen die struktural-analytische Methode der Literaturwissenschaft gesetzt, weil es „nicht ein begriffliches System, sondern eine lebendige Haltung“ zur Herstellung eines Dichterbildnisses anbiete.55 Das Porträtgedicht steht dabei in einer nicht unproblematischen Tradition. Es schilderte im Laufe seiner langen Geschichte vorwiegend positive Leitbilder. Da aber genug Ausnahmen bekannt sind, „reicht die Skala der Ausführungen von überschwenglichen Preisungen und nur um objektive Würdigung bemühten Darstellungen bis zu sarkastischen Bissigkeiten und aggressiven Konfrontationen“.56 Beim Porträt- und auch Widmungsgedicht, das nicht bloß darauf aus ist, einen Vorgänger oder Zeitgenossen zu verherrlichen, überwiegt ein ,Lern- und Lehrbedürfnis‘ – ein Bedürfnis, mittels einer lyrischen Korrespondenz Schreibweisen zu übernehmen, auszuprobieren, zu kritisieren oder gar zu modifizieren.
Ein solches Bedürfnis äußerten zum Beispiel Friedrich Hölderlin und seine beiden Freunde Immanuel Nast und Franz Karl Hiemer, als sie sich 1786 voneinander trennten. Nicht nur in den Briefen, sondern auch in den Widmungsgedichten versuchten sie, sich gegenseitig in ihrem sogenannten „Rezensentendreifuß“ zu fördern. Dabei lautete der Grundsatz ihrer (brieflichen und lyrischen) Korrespondenz:
Tadle, wo zu tadeln ist.57
Ihre Widmungs- und Porträtgedichte strebten statt Personenkult gerade die Zerstörung dieser „denkmalerischen Statuarik“ an, indem sie eine „Antwort“ und somit eine Fortsetzung verlangten.58
Diese lyrische Korrespondenz beschränkte sich demnach nicht auf den Dialog zwischen feststehenden Größen, wollte mehr sein als das synchrone Gespräch zwischen den Dichtern. Zwar sollte „hinter den Gedichten die Persönlichkeit nicht nur des Porträtierten, sondern auch die des Porträtierenden sichtbar“ werden,59 die Korrespondenz diente aber außerdem dazu, eine ,Fortsetzungsgeschichte‘ auszulösen. Ein ,fremder‘ Text wurde produktiv rezipiert, löste neue Texte von mehreren Lyrikern aus. In diesem Sinn ist die lyrische Korrespondenz auch auf diachroner Ebene zu verstehen. Das Porträtgedicht schafft nicht nur das Bild eines Menschen, sondern zeigt auch das artistische Können des Porträtierenden. Die sich weiterspinnenden Korrespondenzen zwischen verschiedenen Lyrikern gehen demnach über das ,Lern- und Lehrbedürfnis‘ hinaus und könnten die Entwicklung und die Art und Weise des Porträtierens in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten „Gruppe“ von Lyrikern verdeutlichen.60
Diese Entwicklung und die verschiedenen Schreibweisen, die diese Entwicklung begleiten, wollen wir im folgenden an vier verschiedenen Porträtgedichten, und zwar von Karl Mickel, Inge Müller, Elke Erb und Adolf Endler, nachzeichnen. Die ersten drei Lyriker haben in chronologischer Abfolge ein Porträt entworfen, dessen Modell, Adolf Endler, später selbst eine „Akte Endler“ anlegte. Ironisch den Terminus „Akte“ (sowohl im Sinne von Kaderakte als auch von Verbrecherakte) aufnehmend, setzt er sich kritisch mit den Bildern seiner Kollegen auseinander. Uns interessiert, wie im Porträtgedicht, in der Korrespondenz mit anderen Dichterbildnissen, Konventionen des lyrischen Menschenbildnisses in der DDR der sechziger und siebziger Jahre modifiziert werden.
Die Skizze
Es kann wohl als programmatisch gelten, wenn Karl Mickel seine Porträt- und Widmungsgedichte in der Rowohlt-Ausgabe von Vita nova mea in dem Zyklus unterbringt, der den Titel „Die Freunde, fragmentarisch“ trägt. Programmatisch deshalb, weil er damit einerseits andeutet, seine Modelle nicht mehr als sogenannte „ganze Menschen“ anzuerkennen (wie zum Beispiel noch in der Lyrik von Johannes R. Becher), und andererseits weil er – wie sich beim Lesen der Texte herausstellt – die Bilder der Freunde auf fragmentarische Weise schildert.
In seinem „Portrait AE“61 zum Beispiel läßt Mickel den Leser einen Einblick in Adolf Endlers Lebensweise nehmen, indem er das häufig bei Endler wiederkehrende Wohn- und Häuser-Motiv hervorhebt und skizzenhaft mit der Arbeitsweise des Modells montiert.
Nirgends ist er zu Haus
Wo ein Bleistift ist und Papier
Zieht er die Schuh aus:
Hier
Das Material, das Mickel am Anfang seines Gedichts verwendet, besteht unter anderem aus Entlehnungen aus Endlers Texten. So wie Endler das lyrische Ich in Gedichten wie „Ein Dichterleben“ und „Grenadierstraße 1966“ in seine äußerst schwierige Wohnlage plaziert, beschreibt Mickel sein Modell als einen wohnungslosen, sich aber jeder Situation anpassenden Poeten, der gerade in dieser existentiellen Notlage zu seiner Arbeit kommt. Bei Endler heißt es zum Beispiel in „Ein Dichterleben“:
Bei den Umzügen schreibt er seine Gedichte.
Die in diesem Text beschriebene Behausung wird bei jedem neuen Umzug schlechter: der Dichter „zieht aus hellen Wohnungen“ und landet schließlich auf den „Nadeln im Wald“.62 In vielen Gedichten von Endler scheint gerade diese Art existentieller Notlagen, in denen es dem lyrischen Ich dreckig geht und das Grelle oder Stechende (man vergleiche die vielen Dornen, Nadeln, Spitzen und Brennesseln in den Texten) vorherrscht, nebst einem Angriff auf den korrupten Trott, eine Stimulanz für seine lyrische Produktion zu sein. Diese in den Texten dargestellte artistische Haltung (im Sinne von: „Mein ganzer Reichtum ist mein Lied“) teilt Endler mit seinen oft zitierten ,Leitbildern‘ wie etwa Rimbaud, Baudelaire und Gottfried Benn. Der Letztgenannte ist – mit seinem Gedicht „Schöne Jugend“ – in Endlers „Grenadierstraße 1966“ gegenwärtig. Darin kommt die artistische Haltung erst durch das Zusammenfügen zweier Bennscher Bilder zur Geltung: „Nicht verlaß ich das Bett meine graue Kuhle“ und „Unter meiner Zunge aufjammert das Jungkatznest“.63 Bleibe und Sprache werden miteinander verknüpft.
Mickel nun hat jene Haltung sehr skizzenhaft geschildert und versucht im weiteren, diesen wesentlichen Aspekt des Porträtierten hervorzuheben. Dazu konzentriert er sich auf eine Artistik, die sich ins Akrobatenhafte steigert.
Hier
Spring ich! Und er springt
Wenns sein muß auf dem Kopf, und singt
aaaaa(Weil seine Frau einen Mantel will, er
aaaaakann ihn nicht kaufen):
Sieh her!
Ich kann auf den Haaren laufen.
aaaaaUnd sie sieht, wie er springt
aaaaaund sie hört, wie er singt
aaaaaund sie sagt: Ich steh niemals mehr auf.
aaaaaUnd er nimmt sie und schwingt
aaaaasie durchs Zimmer und trinkt.
Geht er drauf?
Der Porträtierte ist hier in gewisser Weise nur ein ,halber‘ Mensch, für den das ,Springen, Singen und Schwingen’ ein Surrogat für das Leben bedeutet: statt den Mantel zu kaufen, übt das Ich Akrobatik. Als ,halber‘ Mensch geht AE aber aufs Ganze – als Artist umtanzt er das praktische Leben, als ob es sich um eine rituelle Beschwörung handele, verzichtet (wie der arme Poet bei Spitzweg) auf Wohlleben, lebt aber von seiner Poesie.
Es tut eigentlich nichts zur Sache, ob der Porträtierte nun auch wirklich „drauf“ geht oder nicht (auf seine Frau, auf den Kopf; oder ob er an dem Verzicht auf Wohlleben krepieren wird). Was gilt, ist die Art und Weise, wie er mit dem praktischen Leben umgeht. Und es ist denn auch letztenendes dieser Umgang, der die Frau aufmerksam macht: sie „sieht“, „hört“ und „sagt“ etwas (ja sie verweist sogar auf Endlers Gedicht „Grenadierstraße 1966“).
Die Drei-Einheit ,Springen, Singen und Schwingen‘ scheint dem Porträtierenden für die Charakterisierung von AE zu genügen – Mickel fragmentiert, besser: ,halbiert‘, sein Modell, weil er sich nur für eine ,Hälfte‘ interessiert, für jene, die der Artist AE hervorbringt und die für Mickel ,verwendbar‘ ist.
Den kleinen See, den großen Schnee
Die Kerbe im Ufer, den Kahn
Das bittere Bier und den Löffel im Tee
Den ausgebrochenen Zahn
Hebt er uns auf.
Was Mickel hier skizzenhaft auflistet, sind, wenn auch nicht wortwörtlich, so doch typisch Endlersche Beobachtungen und Sprachfetzen. Das Verb „aufheben“ beschränkt sich jedoch nicht auf das Synonym „bewahren“, sondern wird auch im Hegelschen Sinn (außer Kraft setzen und auf eine höhere Ebene bringen) benutzt. In verschiedenen Gedichten von Mickel, wie etwa in „Der See“ und „’s ist Tee“, erscheinen ähnliche Bilder wie die hier oben skizzierten. Es sind Bilder von sogenannten „kleinen Dingen“, die bei vielen Lyrikern in den sechziger und siebziger Jahren in Texten wiederkehren. Mit dem „uns“ richtete sich Mickel wahrscheinlich nicht ausschließlich an den Leser, sondern vor allem auch an den Dichter-Leser, der sich einer Schreibweise wie der Endlers verwandt fühlt und der aus einem überfüllten Bilder-Arsenal schöpfen kann.
Mickel selbst führt in dem „Portrait AE“ seine produktive Rezeption vor.
Die Schreibweise des Gedichts korrespondiert mit den (kerbigen und gebrochenen) Bildern: der Rhythmus ist – bei regelmäßigem Reim – stockend; der imaginäre Dialog zwischen den verschiedenen Personen (ich, er, sie und uns) wechselt im Eiltempo; vor allem am Anfang des Gedichts folgen Stillstand („Hier“ und „Sieh her“) und Bewegung (ausgelöst von dem ,Springen, Singen und Schwingen‘) schnell aufeinander, so daß – in Analogie zu den brüchigen und fragmentierten Bildern – keine sprachliche Vollständigkeit bzw. harmonische Sprache zustande kommt.
Das Bekenntnis Mickels Endler gegenüber steigert sich noch, indem das Schaffen eines Menschenbildes thematisiert wird – eines Menschenbildes, das schon bei der Fertigstellung abbruchreif oder in Verfall geraten („halb lebendig und halb bei den Toten“)64 ist.
Im Sommer mit kleinen Steinen
Baut er im Sand und mit Holz –
Treibgut – uns einen reinen
Menschen Sehtwiestolz.
Das Gebilde, das hier entsteht, ähnelt einem Gehäuse – aufgebaut aus herumliegendem Material (Stein, Sand und Holz), welches nicht nur hier bei Mickel, sondern ebenfalls bei Endler als Bausubstanz der Texte dient.65 Das Porträt im Porträt zeigt, daß das Menschenbild nie vollständig ist, daß immer wieder daran gearbeitet werden muß, auch in der Gattung des Porträtgedichts. Die hier von Mickel betonte Schreibweise Endlers, die sich dem Fertigen und der Festlegung widersetzt, wird am Schluß des Gedichts paradoxerweise in einem moralisch-didaktischen Satz noch einmal gelobt.
Leute, der kann lachen und weinen
Leute, laßt auch uns nicht versteinen
Die direkte Aufforderung an „uns“ und das durchgehend Skizzenhafte im Text sollte eine weitere Eröffnung ermöglichen, nämlich die Fortsetzung der von Mickel angefangenen Korrespondenz. Der Schluß klingt wie eine Ermahnung, im weiteren werden wir sehen, wem sie gilt.
Das Spiegel-Bild
Inge Müller hat in dem Untertitel des Gedichts „Porträt A. E. Nach Mickel“ angegeben, daß sie die von Mickel initiierte Korrespondenz weiterführen, den ,Vortext‘ jedoch gleichzeitig einer Korrektur unterwerfen will.66 Müller erkennt die bewußt angelegte Unvollständigkeit des ,Vortextes‘, versucht diesen aber nicht etwa zu vervollständigen, sondern als Ausgangspunkt ihrer Interessen an der Person Adolf Endler zu benutzen. Sie interessiert nämlich die andere ,Hälfte‘, d.i. der Alltag, das Privatleben Endlers. Dieses Interesse äußert sich bei Müller in Neugier, Staunen und schließlich in Fragen.
Ich kenne ihn nicht
Mich interessiert wie einer ist der
Auf den Haaren laufen kann und Mickel
So ein Gedicht abzwingt
(Und seine Frau, die einen Mantel will, durchs Zimmer schwingt)
Und trinkt
Und andern seinen abgebrochnen Zahn aufhebt
Kurz: lebt
(Und wundre mich – das ist einem jungen Dichter wunderlich?)
Müller wendet sich der Person hinter dem von ihrem Vorgänger skizzierten Artisten und Akrobaten zu:
Mich interessiert wie einer ist der (…) lebt.
Sie bezieht sich bei ihrer Suche, wie Mickel, aber auf die Wohnlage und den Umgang mit der Frau von Adolf Endler, besser: von A. E. Das heißt, das Bild der Person A. E. macht sich Müller vorerst aus zweiter Hand, indem sie das Gedicht Mickels rezipiert. Sie reproduziert das vorige Gedicht jedoch nicht einfach, sondern sie verwendet Zitate, womit sie sich einen Einstieg in ihr eigenes Endler-Bild verschafft. Im Gedicht entsteht ein Ensemble von mehreren Schreibweisen, das aus Handschriften Mickels, Endlers und ihrer eigenen zusammengestellt ist. Adolf Endler selbst interpretierte die Konfrontation und Verflechtung der verschiedenen Schreibweisen bei Müller – in seinem Aufsatz „Zur Lyrik Inge Müllers“ von 1979 – als eine Methode, welche ein „rasanter Abbau der Distanz“ gegenüber einem Gegenstand oder einer Person sei, die sie der (vor allem in den fünfziger Jahren) gängigen „Bemühung um Abstand“ entgegensetze.67 Im „Porträt A. E. Nach Mickel“ spüren wir einen Drang, sich dem Porträtierten unmittelbar zu nähern. Die Annäherung wird fast familiär, wenn Müller das Gedicht Mickels verläßt und ihr eigenes Wissen um Endler (als literarisches Phänomen) aufzählend einbringt.
Ich kenne nur wie er Bahnhof Dreck und Arbeit schreibt
Und stehenbleibt
Wenn diskutiert wird auf der Straße oder wo
Aus seiner Schwefelode ein paar Zeilen
Wo er sich nicht traut
Und Pausenverse zwischen zwei Kongressen
Wie er auf eine fremde Pauke haut
Und das er sich vergessen
Über all dem wie er klagt
Daß er fragt
Was der und der wenn er schweigt sagt
Daß er leise pfeift gegen falsch und laut
Die Weiber haßt, so sagt er, die er gar nicht kennt
Den seine Frau und hier und da ein Dichter Dichter nennt
Die Art und Weise, wie sie ihr Wissen aufzählt – fragmentiert und in der Form eines Schulaufsatzes – zeigt, daß Inge Müller in erster Linie an etwas anderem interessiert ist als an demjenigen, was wir in literaturwissenschaftlichen Biographien finden würden. Sie deutet Einzelheiten an, geht aber nicht weiter auf sie ein. Natürlich steht es uns offen, dies wohl zu tun. So nennt Müller zum Beispiel die „Schwefelode“ und spielt auf das Gedicht „Nachts im Schwefel oder Transportarbeiternacht“ an, in dem Endler in pathetischer Tonart (in der Form einer Ode) den Bitterfelder Weg geht:
O Schwefel, stäube aus dem Waggon! Wir treiben dich weiter.
Schwefel, nachts wie vereister, glitzernd lockender Schnee!
Schwefel, am Morgen vergilbend, am Tag gelb wie glühender Eiter!
Her die eiserne Leiter!68
Ob Endler hier nun seriös ist oder ironisiert, uns Lesern bleibt der Eindruck einer Ungereimtheit zwischen industrieller Dreckarbeit und literarischer Tätigkeit – eine Verbindung, die in Bitterfeld zum ersten Mal 1959 verordnet wurde.
Diese auch in dem Bericht Weg in die Wische thematisierte Ungereimtheit69 deutet Müller bloß mit einer Formulierung wie etwa „Wie er auf eine fremde Pauke haut“ und mit der Verweisung auf die Kongresse (in Bitterfeld?) an. Im übrigen ist es für Müller unwichtig, ob Endler nun ein Dichter ist oder nicht. Wonach sie sucht, befindet sich nämlich auf einer ganz anderen Ebene.
Das Gedicht „Porträt A. E. Nach Mickel“ ist ein sehr intimes Gedicht – dabei untersucht Müller, ob der ,Vortext‘ und die weitere Information, die ihr zur Verfügung steht, tragfähig ist, Auskunft über ihr eigenes Leben zu geben. Die Einzelheiten um und über Adolf Endler werden aufgesogen und sollen nur einem Zweck dienen: dem der Selbstfindung. Das lyrische Ich kriecht hinter den abgehackten Sätzen und den von Mickel ,hinterlassenen‘ Fragmenten her, staunt und fragt – bleibt jedoch nach der anstrengenden Suche unbefriedigt und einsam zurück. Es ist, als ob sie beim Schreiben ständig nur in den Spiegel geschaut habe.
Daß ich mich frag: warum nicht mehr?
Ich kenn ihn wie ich mich kenne
Wer ist er?
In der Korrespondenz mit Mickel und Endler erreicht Müller ein solch hohes Maß an Verinnerlichung, daß das Bild, das vom Modell entstehen sollte, zu einem Spiegelbild wird. Das Porträt wird ein Versuch zum Selbstporträt. Es bleibt bei einem Versuch, denn das lyrische Ich bei Müller – das sich im Spiegel-Bild Endlers und Mickels sucht – geht nicht so weit, daß es den Anderen ersetzt und somit um seiner selbst Willen verdrängt. „Wie sie die Freunde als Lebenselixier brauchte, ging sie mit ihnen ins Gericht“, schreibt Richard Pietraß in seinem Nachwort zu Inge Müllers Lyrik-Band Wenn ich schon sterben muß.70 Beide Aktivitäten – die wir oben als die Einheit von Lernen und Lehren bezeichnet haben – befinden sich im Porträt. Die Suche nach der eigenen Individualität kommt auch hier nicht ohne das Andere aus.
Offenes Gebilde
Bis jetzt haben wir zwei Porträtgedichte behandelt, die – in Analogie zu dem, was in der bildenden Kunst das „eigentliche Porträt“ genannt wird – versuchen, mit einer doch ziemlich figurativen Darstellungsweise, eine „Ähnlichkeit des Bildnisses mit dem Modell“ vorzuzeigen.71 Wie in der bildenden Kunst aber gibt es in der Literatur das nicht-figurative oder abstrakte Porträt, in dem das Modell nicht so leicht als Person zu erkennen ist. In solchen Texten ist der Gehalt an ,Lügen‘ höher als sonst: das Porträt will nicht bloß dokumentieren.
Um die Analogie mit der bildenden Kunst kurz aufzugreifen: Pablo Picasso hatte 1946 vor, seine Lebensgefährtin Françoise Gilot in einer „konkret-figurativen“ Weise zu malen, was aber auf der Leinwand erschien, war eine Blume. Der Maler sah während der Arbeit, laut Gilots Memoiren, im Motiv der Blume eine Möglichkeit, das innere Wesen des Modells adäquater auszudrücken. Dafür mußte er aber die Ähnlichkeit zwischen Modell und Porträt manipulieren. Er hob, nach seiner subjektiven Sehweise, das für ihn Typische oder Wesentliche des Modells hervor – daraus entstand Picassos Gemälde Françoise Gilot. Femme Fleure.72 Picasso stand also vor einer Wahl und hat sich die optimale künstlerische Problemlösung ausgesucht: das nicht-figurative oder abstrakte Porträt. Ganz anders verlief die zeitweilige Entscheidung für das abstrakte Porträt beim Maler Oskar Kokoschka, die er 1945 während seines Exils in England mit folgendem Satz begründete:
There will be no portrait left of modern man because he lost his face and is turning back towards the jungle.73
Es war für Kokoschka damals unmöglich, weiterhin „konkret-figurative“ Bildnisse vom Menschen zu malen, weil dieser das Gesicht in der Masse der modernen Industriegesellschaft verloren habe – das Modell selbst sei schon abstrakt geworden. Im selben Jahrzehnt wie Picassos Wahl und Kokoschkas Überlegung veröffentlichte der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr eine Theorie, welche er 1948 in der Studie „Verlust der Mitte“ vorlegte. Darin behauptete er, daß „in dem gleichen Maße als die Fähigkeit, das Menschengesicht in seiner Menschlichkeit zu bilden, zurückgeht, (…) die Fähigkeit, das Außermenschliche und Außernatürliche zu gestalten, (wächst)“.74 Demnach könne das Porträt nur noch abstrakt gemalt werden.
Wir sind deshalb hier kurz auf ein paar Gedanken zum abstrakten Porträt und dessen Hintergründe eingegangen, um den Übergang von den ersten beiden Porträtgedichten zu dem dritten Gedicht in der Reihe lyrischer Korrespondenzen plausibel zu machen. Das Gedicht „Porträt A. E. (Ein Kunstmärchen)“ von Elke Erb unterscheidet sich nämlich grundsätzlich in der Wahl der Darstellungsweise des Modells von ihren Vorgängern.75 Sie nähert sich mit ihrem Text der in der Moderne fast vertraut gewordenen abstrakten Kunst.
Analog zum Beispiel von Picassos Modell ist A. E. nicht, sondern er ist „So als ob…“. A. E. wird im Gedicht mit etwas „Außermenschlichem“, sogar mit etwas „Außernatürlichem“ (Sedlmayr) verglichen, und zwar mit einem „Haus“.
So als ob das Haus an dieser Stelle zu keiner Zeit bewahrt
aaaaaaaaaawerden konnte: der Keller, die Kellerfenster
aaaaaaaaaanicht, die Fenster zum Garten.
Diese Lesart, mit der wir uns vorerst beschäftigen werden, konzentriert sich auf den Vergleich zwischen A. E. und dem Haus in den sieben Strophen. Das heißt, daß wir uns mit den ,Wesenszügen‘ des Hauses beschäftigen müssen. Das Wesentliche an dem Haus ist, daß es sich im Prozeß und letztenendes im Zustand des Verfalls befindet.
In den ersten drei Strophen sind es vor allem die Verben, die an den Abbruch erinnern: es wurde hineingegriffen, herausgerissen und eingeschlagen. Der Abbruch hat sich immer weiter verbreitet, bis nichts mehr vom Haus übrigblieb. Den hier als vollendet betrachteten Prozeß des Abbruchs können wir Strophe für Strophe rekonstruieren, wobei wir vorab bemerken müssen, daß der Prozeß ungewöhnlicherweise zuerst von unten nach oben, danach von oben nach unten verlaufen ist. In der Chronologie der Zerstörung wird zuerst der untere Teil des Hauses („der Keller, die Kellerfenster“ und „die Fenster zum Garten“) als schon beseitigt angesehen, danach wird die Aufmerksamkeit auf die fehlende Treppe gelenkt.
So als ob es jeden Krieges Meinung gewesen sei, gerade
aaaaaaaaaahier hineinzugreifen und die Treppe herauszu-
aaaaaaaaaareißen.
In der dritten Strophe sind wir schon beim Dach und bei den Wänden angelangt – diese geben nicht länger den vertrauten Schutz.
So als ob auch jedes Gewitter eingeschlagen, jeder Sturm
aaaaaaaaaain die Wände und der Wolkenbruch immer
aaaaaaaaaaWehrlose verdunkelt hätte.
Was anscheinend blieb, waren Mauerreste und herumliegende Steine, die aber in der darauffolgenden Strophe als aufgelöst betrachtet werden.
So als ob das untröstliche Weinen des Kindes gerade hier
aaaaaaaaaadie Steine erweichen durfte, hier all das geschah,
aaaaaaaaaawas von anderen abgewehrt worden ist.
Schließlich wird der Abbruch total, wenn die Ruine der Natur und den Naturkräften Platz machen muß. Sie verläßt die „Stelle“, von der in der ersten Strophe noch die Rede war, als wäre nie („zu keiner Zeit“) etwas dagewesen. Ein Abschied in erotischen Bildern.
So als ob das Grün der Büsche sich hier einschnitte wie
aaaaaaaaaaFeuer in die weich fließende Luft.
Nach dieser Lesart kann es – in Korrespondenz zum Anfang des Gedichts „Portrait AE“ von Mickel – kein „zu Hause“ mehr geben. In Mickels Text verwandelte sich diese Tatsache am Schluß in eine moralische Aussage:
Leute, laßt auch uns nicht versteinen.
Mickel stellte damit eine Beziehung zwischen dem Modell und dem Bedürfnis, sich jeder Art der Festlegung zu entziehen, her. Bei Erb wird diese Beziehung – im Bild des Abbruchs – fortgesetzt. In diesem Zusammenhang ist es legitim, das „So als ob“ als Vergleich zu lesen.76
Elke Erb geht es – in Analogie zu Picassos Françoise Gilot. Femme Fleure – in ihrem Porträt nicht so sehr um eine Ähnlichkeit, sondern eher um eine Äquivalenz zwischen Adolf Endler und dem Schicksal des Hauses im Gedicht. Der Text ist auf eine Weise strukturiert, daß die Äquivalenz nur dann zustande kommt, wenn der Leser die sieben Annahmen oder Voraussetzungen über den Abbruch des Hauses (die sich wie sieben ,Zaubersprüche‘ lesen) akzeptiert hat. Die Zahl sieben verweist somit auf den Untertitel des Gedichts: „Ein Kunstmärchen“. Auch im Märchen muß der Leser bzw. Zuhörer sich ständig bereit erklären, meist Irreales, oft Unglaubwürdiges zu akzeptieren, bevor er die Logik der Geschichte nachvollziehen kann. Erb übernimmt diese Erzählstruktur in ihrem Gedicht: sie möchte den Leser zuerst sieben Mal täuschen, bevor dieser sich ein Bild vom Porträtierten in seiner Metamorphose zurechtmachen kann und das „Märchen“ als eine „wahre Geschichte“ liest.77
Den Zusatz „Ein Kunstmärchen“ könnten wir natürlich auch anders deuten, nämlich als ein Märchen der Kunst. In seiner Studie zum deutschen Kunstmärchen des zwanzigsten Jahrhunderts definiert Jens Tismar die Kunstmärchen auf unterschiedliche Weise. Eine seiner Definitionen lautet, daß die Kunstmärchen „solche Erzählungen [sind], die künstlerisch herausragen oder die Märchenfabulieren mit Kunstreflexion verbinden“.78 Die Kunstreflexion in Erbs Text ist von zweierlei Art: einerseits nimmt sie im „Porträt A. E. (Ein Kunstmärchen)“ Bezug auf die in vielen Texten von Endler, Mickel, Müller und von ihr selbst anwesende Häuser- und Wohnungsthematik, andererseits versucht sie (wie Inge Müller), die Gattung des Porträtgedichts zu überdenken. Beiden Seiten des Reflektierens wollen wir hier unten nachgehen.
Gedichte, die die Häuser- und Wohnungsthematik behandeln, finden sich, neben Gedichten über Essen und Trinken, in fast jedem Gedichtband von (auf jeden Fall) Endler und Erb. In den Zyklus „Gedichte und Miniaturen“ des Bandes Gutachten von Erb zum Beispiel ist der Text „Wie man wohnt“ aufgenommen. In diesem Prosagedicht kommt es zu einem Wechsel zwischen Subjekt (Hausbewohner) und Objekt (Haus). Gegenstände (darunter das Haus) werden personifiziert und legen dem Menschen ihren Willen auf – der Mensch wird zu einem handlungsunfähigen Objekt:
Das Badezimmer ließ uns nicht ein, hatte sich eingeschlossen, jetzt frißt es wieder meine Kosmetika auf, dachte ich und ärgerte mich.79
Von einer Gleichsetzung (oder Äquivalenz wie in Erbs Porträtgedicht) von Haus und Person ist die Rede in einem Text Endlers mit dem Titel „Vor dem Abbruch unseres Hauses“:
Das Haus, seine Stimme gleicht der deinen
(…) Dein Mund schmeckt nach Kalkstaub und welk.
Schon hör ich dein Herz nicht mehr schlagen:
Ein Zeitzünder tickt im Gebälk.
Haus und Bewohner sind beide zum Tode bestimmt, der Bewohner lebt als erster ab, bevor das Haus zu Grabe getragen wird. Ähnlich wie in Erbs „Porträt A. E. (Ein Kunstmärchen)“ entsteht das Bild des totalen Abbruchs:
Die Treppe – bald stumm unter Steinen
Mit Mauerrest niedergewälzt.80
Sowohl bei Endler als auch bei Erb ist das lyrische Ich nicht mehr Herr im eigenen Haus (auch im Sinne Freuds).
Auch die andere Ebene der Reflexion besteht aus einer Korrespondenz mit ,Vortexten‘. In den beiden letzten Strophen zum Beispiel löst sich der Vorgang des Porträtierens von der schicksalhaften Bestimmung des Hauses bzw. des Modells. Das Haus, das Modell, oder besser das Porträt an sich, verweist einerseits auf ähnliche Schicksale, andererseits auf eine mögliche positive Deutung des hier entstandenen Bildes – es kommt zu einer zusammenfassenden Überlegung.
So als ob man von hier aus auch weiß, wo Häuser bewahrt
aaaaaaaaaaworden sind, mit ihnen befreundet ist und hin-
aaaaaaaaaagehen kann.
So als ob hier ein Haus nicht bewahrt worden ist, um ein
aaaaaaaaaaLeben zu gründen.
All die vorherigen Porträts Adolf Endler zeigen einen ähnlichen in Verfall geratenen Dichter – bei Mickel ist er der mit Rissen ausgestattete fragmentierte Artist, bei Inge Müller die ungreifbare Person. Im Porträt von Elke Erb ist überhaupt nichts mehr von einem wirklichen Menschen übrig, und auch die Metamorphose geht zugrunde. Es ist, als ob Erb hier Mickels Aufforderung („Leute, laßt auch uns nicht versteinen“) wortwörtlich folgeleiste.
Die Korrespondenz zwischen den drei Lyrikern scheint sich in Richtung einer Reflexion über die Art und Weise des Porträtierens zu entwickeln, und dabei wird die (in den Texten der fünfziger und auch sechziger Jahre) gängige Manier, den „ganzen Menschen“ als Idealtypus zu gestalten, in Frage gestellt.
Der in den drei Gedichten dargestellte Abbruch eines Menschenbildes führt aber nicht unbedingt zu einer totalen Negation des Aufbaus des „ganzen Menschen“, sondern vielmehr zu einer verfeinerten Modifikation. Elke Erb zum Beispiel stellt nur eine mögliche Sicht („So als ob“) vor, die der Leser jederzeit negieren kann. Darüber hinaus fragt sie sich in den beiden letzten Strophen, ob der totale Abbruch nicht auch eine Grundlage sei, auf der (diesmal in Korrespondenz mit der 1950 von Johannes R. Becher verfaßten DDR-Hymne „Auferstanden aus Ruinen“) das Modell nach eigenem, individuellem ,Bauschema‘ neu zur Erscheinung gelangen könne.81 Dieser Aufbau durch Zerstörung stimmt mit der ungewohnten Chronologie des Verfalls (von unten nach oben und von oben nach unten) überein.
Bild-Zerstörung
Etwa ein Jahrzehnt nach der Fertigstellung des letzten Porträts Adolf Endlers hat das Modell sich selbst porträtiert. Es entstand ein Porträt aus zwei Teilen. Dieses lyrische Diptychon will jedoch kein Selbstporträt sein, sondern etwas viel Endgültigeres – zumindest deutet das der Titel an: „Akte Endler“.82 Die Akte, die Endler von sich selbst anlegt, stellt keine endgültige Fassung der drei vorherigen Porträts dar (etwa im Sinne der DDR-spezifischen Kaderakte), sondern ist vielmehr eine Radikalisierung dieser Texte. Die Korrespondenz mit den drei ,Vortexten‘ wird im Titel des Gedichts, „A(kte) E(ndler)“, angedeutet.
Der erste Teil des Gedichts ist typographisch so gestaltet, daß eine geschlossene Form (ein Kader oder Rahmen) entsteht. Beim Lesen des ersten Teils jedoch zeigt sich, daß innerhalb dieser geschlossenen Form ein sprachliches Chaos herrscht: Sätze fangen mitten in der Zeile an, ohne Vorbereitung durch Interpunktion; manche Zusammenhänge werden erst bei wiederholtem Lesen klar, wie zum Beispiel in den letzten Zeilen des ersten Teils.
(…) Hält sich noch nicht
einmal wenn er wieder rumhuren / Zieht (wöchentlich bis zu sieben Mal) und volltrunken dann / Vor ganz häßlichen Worten über unseren Johannes R / Becher zurück und vor allem dessen Sonettkunst
Das hohe Maß an Sprach- und (beim Leser vorausgesetzter) Rezeptionsanstrengung ist ein Zeichen dafür, daß hier überhaupt keine Rede sein kann von einem tatsächlichen Anlegen einer Akte – eher ist das Gegenteil der Fall, denn die Sprache des Betrunkenen, das ,anarchische‘ Sprechen, widerstrebt jeder Festlegung. Darüber hinaus würde die Akte durch das bewußt angelegte Ausmaß an Koketterie mit einer fast aussichtslosen Randexistenz als unglaubwürdig erscheinen. Die Akte würde aus lauter Schweiß- und Mundgeruch bestehen und schließlich vermodern.
Wäscht sich oft nicht Zahnausfall Stinkt stark aus dem Rachen / Auch Schweißfuß Liest die Tageszeitung auf dem Klo / Ausschließlich Hat niemals einen Schwarzen Anzug besessen / Neigt zu Alleingängen einsamer Pilzsucher Säuft (…)
Auch hier wieder könnten wir Vergleiche mit Texten wie „Grenadierstraße 1966“ anstellen, in denen Endler das lyrische Ich als a-sozial abwertet und nicht gerade konform mit den Maßstäben des Idealtypus Mensch aufbaut. Die flapsige Formel „EtceteraetceteraMenschetcetera“ erscheint in diesem Zusammenhang denn auch ziemlich provokativ, denn sie besagt, daß man sich den Rest der porträtierten Person wohl denken kann, und daß dabei nicht mehr viel von Würde in Erscheinung treten wird. Die Provokation wird noch verstärkt durch das ,Halbieren‘ des Dichters und Kulturministers „Johannes R / Becher“, der ja gerade in Essays, Reden und Sonetten den Idealtypus des „ganzen Menschen“ prägte. So heißt es in einem seiner Sonette:
Den ganzen Menschen wollen wir erfassen.
Ihn liebend und hassend, und begreifen
Das ganze ungeheuere Menschenwesen.83
Das Ideal Bechers – zumindest in vielen seiner Sonette – beschränkte sich auf jenen Menschen, dessen gesunder Verstand mit einem gesunden Körper in Einklang, also Herr im eigenen Haus war. Endler nun kehrt diesen Harmonie-Gedanken um und verbindet den im Text dargestellten krankhaften körperlichen Zustand mit einem ungesunden Geist, wie er im zweiten Teil des Gedichts auftaucht.
Eine Anthologie zweibändig nichts als Bedenken
Ergo das Ganze so etwas wie Pornographie
Diese Schlußfolgerung ist durch das Heranziehen von Begriffen wie „Ergo“, „das Ganze“ und „Pornographie“ ziemlich endgültig. Die „Pornographie“ – als Gattung in der DDR von der Gesetzgebung verboten – gehörte noch in den sechziger Jahren zum Vokabular der DDR-Literaturkritik, und zwar als Bezeichnung einer zu sehr Ich-bezogenen bzw. „perversen“ Literatur.
Das Gedicht Endlers übernimmt Charakterzüge aus den drei vorherigen Porträts, in seinem Sprachgebrauch ist die „Akte Endler“ aber satirischer und radikaler. Die Randexistenz wird bei Endler jetzt völlig an den Rand gedrückt, der körperliche Verfall gerät in einen unkontrollierbaren Zustand. Der Zahn zum Beispiel, der bei Mickel und Müller ausgebrochen ist, fällt hier von alleine aus. Und wie bei einem Betrunkenen sind die unangenehmen Gerüche unvermeidlich. Das Ich läßt seinen Körper gehen.
Dasjenige, was Mickel in seinem Gedicht mit ,Springen, Singen und Schwingen‘ als das Artistische an der Person Endlers umschrieb, und womit dieser eigentlich gelobt wurde, verwandelt sich bei Endler selbst in ,Stinken, Schwitzen und Saufen‘. Diese Radikalisierung ins Extreme (in der Form einer Satire) ist – wenn sie sich im übrigen Werk des Dichters fortsetzt – nicht gerade jedermanns Sache.
Und wirklich nur für die privilegiertesten Leser
Charaktere die absolut nichts mehr umschmeißt
Was Endler im ersten Teil schon durch die sprachliche Form zeigte, wird im zweiten Teil noch einmal explizit formuliert: hier geht es um den ,anarchischen‘ Gedanken, der, wie bei der ,anarchischen‘ Sprache, bewahrt werden sollte. Beides soll zum Privileg erhoben werden. In der „Akte Endler“ geht es nicht darum, eine Person zu bewahren oder aufzuheben, sondern vielmehr um die Verteidigung einer doch ungewohnten Schreib- und Lebensweise, wobei der Mensch selbst „drauf“ gehen kann, wie die vielen Umkehr-Motive und Zerstör-Verben angeben. So schmeißt Endler auch Bechers „Sonettkunst“ um, und konstruiert dabei eine Art ,Gegensonett‘. Lesen wir nämlich die Querstriche im ersten Teil des Textes als Vers-Enden und schreiben wir die Verse untereinander, dann bildet sich folgendes ,Sonett‘:
Wäscht sich oft nicht Stinkt stark aus dem Rachen
Auch Schweißfuß Liest die Tageszeitung auf dem Klo
Ausschließlich Hat niemals einen Schwarzen Anzug besessen
Neigt zu Alleingängen einsamer Pilzsucher Säuft
Wäscht sich nur flüchtig wenn überhaupt Und (zahlreiche Zeugen)
Hält sich noch nicht einmal wenn er wieder rumhuren
Zieht (wöchentlich bis zu sieben Mal) und volltrunken dann
Vor ganz häßlichen Worten über unseren Johannes R
Becher zurück und vor allem dessen Sonettkunst
EtceteraetceteraMenschetcetera
Eine Anthologie zweibändig nichts als Bedenken
Ergo das Ganze so etwas wie Pornographie
Und wirklich nur für die privilegiertesten Leser
Charaktere die absolut nichts mehr umschmeißt
Die häßlichen Worte über „unseren Johannes R / Becher“ entstehen im Wendepunkt zwischen den Quartetten und den Terzetten – beim lauten Lesen kommt es auch fast zu einem Zungen-B(r)echer. Endler zerstört, indem er sprachliches Material in der Gestalt des Propagandisten des „ganzen Menschen“, somit ein Bild vom Menschen, umschmeißt. Die ,anarchische‘ Aktivität gibt es auch schon in den drei vorherigen Porträtgedichten – bei Endler erreicht sie jedoch ihren Höhepunkt. Die ,Alternative‘, Endlers eigene Schreibweise, steht widerborstig in einer noch von Bechers Schreibweise geprägten Sprach-Landschaft.
Amt des Dichters
In seiner Rede „Von der Größe unserer Literatur“ auf dem IV. Deutschen Schriftstellerkongreß im Januar 1956 stellte Johannes R. Becher u.a. folgendes fest:
Nur im Zeichen gedichteten Denkens, nur im Zeichen durchdachten Dichtens, nur als Sieg der ganzen Persönlichkeit reift ein Werk seiner Vollendung entgegen.84
Den „Sieg der ganzen Persönlichkeit“ sah Becher in der Einheit von Dichten und Denken, sowohl beim Autor als auch beim literarischen ,Helden‘:
Indem sie sich an den ganzen Menschen wendet, erzeugt Literatur im Menschen: Ordnung, Einheit.85
Literatur sollte diese „Ordnung“ und „Einheit“ bei jedem Menschen erzeugen, sie hatte eine erzieherische oder Vor-Bild-Funktion in der von Becher angestrebten „Literaturgesellschaft“. Der Mensch sollte in dem Idealbild des von Walter Ulbricht 1948 geforderten „neuen Menschen“ erscheinen.
Auch in seinen Sonetten charakterisierte Becher, wie wir schon sahen, das Idealbild. Im Sonett „Das Bild des Menschen“ sieht er den Menschen als schon vorgeformtes Geschöpf – die Aufgabe des Dichters sei es, diesem Geschöpf ein Bild zu verschaffen, das nachstrebenswert ist:
Ich möchte schreiben ein Gedicht, daß, wenn
Du dies Gedicht liest, alles klar dir würde (…).
Indem Dichten und Denken sich zusammenfügen – im schöpferischen Akt des Dichter-Denkers – entsteht das Bild, das sich der Mensch aneignen sollte:
Nach jenem Bild zu greifen durch die Wände,
Sind dir gewachsen, spürst du, tausend Hände.86
Durch die Aneignung fängt erst das richtige Leben an (vergleiche: „spürst du“).
Hans Koch umschrieb 1965 in seinem Buch Unsere Literaturgesellschaft den Menschen als „Schöpfer und Baumeister unseres neuen Lebens und der neuen, menschlichen Welt des Sozialismus“; für ihn galt diese Umschreibung als „das Kernstück des Menschenbildes in der Periode des umfassenden sozialistischen Aufbaus“.87 Das heißt, daß nicht der Mensch, sondern das Bild von ihm (häufig in der Gestalt eines mit allgemeinmenschlichen Qualitäten ausgestatteten ,positiven Helden‘) im Mittelpunkt der Literatur und Kunst stehen sollte. Das Bild wäre die Voraussetzung für etwas Höheres, nämlich – so Koch – für die Fertigstellung des sozialistischen Staates, ein Aufbau, dessen Baumaterial aus lauter „ganzen Menschen“ bestehen sollte.
Auch später noch, unter anderem in der zweiten Auflage des Kulturpolitischen Wörterbuchs (1978), wurden die Porträtleistungen (in der Malerei) gefeiert, die „ein beeindruckendes Bild vom realen Werden der sozialistischen Persönlichkeit“ geben.88 Auch aus dieser Sicht nehme der Mensch eine zweckbedingte Position ein, denn das „Werden“, nicht die „Persönlichkeit“ an sich steht hier an erster Stelle. Der Mensch erscheint dann als etwas Lebloses, ohne Fleisch und Blut, als eine dem Begriff des Typischen untergeordnete Metapher, die nur über sich hinaus verweist. Das Typische (des Menschen) wurde vom ehemaligen Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei der UdSSR, G.M. Malenkow, als das Neue, das Werdende definiert, „das die alten, absterbenden Kräfte und Erscheinungen historisch zu überwinden beauftragt ist und die nächsthöhere Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen verwirklicht“.89
Der in der Porträtkunst beabsichtigte sozialistische Realismus, so Hubertus Gassner und Eckhart Gillen in einer Studie zum Arbeiterbild in der DDR-Malerei, wurde zu einem „repräsentativen Realismus“. Die Arbeiter- und Brigadenporträts in den fünfziger und sechziger Jahren (unter anderem von Otto Nagel und Hermann Bruse) bildeten Typen in posenhafter Anordnung ab, so wie es in der Porträtmalerei des neunzehnten Jahrhunderts geläufig war. Bis in die siebziger Jahre hinein, so Gassner und Gillen weiter, gingen die meisten Einzeldarstellungen nicht „über das Helmporträt, das Raucherbildnis, über Sitz- und Standposen (…) hinaus“. Der abgebildete Mensch war somit ein „Requisitenstück sozialistischer Gesinnungsdemonstration“ geworden.90
In den vier hier oben vorgestellten Porträtgedichten von Karl Mickel, Inge Müller, Elke Erb und Adolf Endler wird das gängige Darstellungsverfahren des Porträtierens in der DDR umgedreht. Das Ganze ist nicht das Wahre, sondern eher das Unwahre (Adorno) oder vielleicht, wie Endler es formuliert, „so etwas wie Pornographie“. Statt eine „denkmalerische Statuarik“ anzustreben, die nur Distanz gegenüber dem porträtierten Menschen aufbaut, wird in den Gedichten Abstand getilgt – das kleinstmögliche Fragment, die Körper- oder Sprachfetzen werden sichtbar gemacht, wodurch das Gesamtbild (vom „ganzen Menschen“) zerstört wird.
Die Porträtierenden stellen sich damit aber keineswegs gegen das Theorem des Typischen und des Aufbaus, das in der DDR florierte. Das Provokative an jenen Texten ist eher, daß das Theorem allzu wörtlich genommen wird. Die Dichter versuchen, das Wesentliche im Modell aufzuspüren, um es dann nach eigener Sicht gestalten zu können. Sie schaffen sich so ihr eigenes Bild von einem Individuum – und dabei geht es ihnen nicht um das Endziel, sondern um den Weg des schöpferischen Gestaltens. Dieses Gestalten des eigenen Bildes vom Menschen steht in direkter Beziehung zum Prozeß der Gestaltung des eigenen Textes als sprachliches Gebilde. So wie Mickel und die anderen den Dichter Endler fragmentieren, um ihn aus eigener Sicht darstellen zu können, so werden die Porträts als Text (auf unterschiedliche Weise) aus Fragmenten verschiedener ,Vortexte‘ zusammengestellt. In diesem intertextuellen Raum erst entsteht der intersubjektive Bezug sowohl zu dem Modell als auch zu jenen Kollegen, die ähnliche Verfahrensweisen beim Porträtieren einsetzen. Die Textstruktur und das Bild des Dichters Adolf Endler bleibt in der lyrischen Korrespondenz offen. Diese Offenheit richtet sich nicht in erster Linie gegen das von Koch geprägte „Bild der Bahnbrecher, der Neuerer, der Führer, der Herren des umfassenden sozialistischen Aufbauwerks“,91 sondern sie gibt vorrangig ein Bild des suchenden, lerngierigen und sich als Poet verstehenden Porträtdichters her. Die Beschäftigung mit dem Modell geht mit der Suche nach dem eigenen Ich im eigenen (sprachlichen) Gehäuse, dem Erlernen und Entwickeln des Amts des Dichters einher. Den in den Texten vordergründigen Abbruch könnten wir, wie paradox es auch klingen mag, als Aufbau interpretieren – als Aufbau der eigenen Stilmöglichkeiten in gemeinschaftlichem Bemühen.
So wie es den „ganzen Menschen“ nicht gibt, kann es auch den ganzen Dichter nicht geben. So gilt Volker Brauns Ausruf „Kommt uns nicht mit Fertigem!“ in den vier vorgeführten Texten als ein Grundsatz des Schreibens. Der Dichter entwickelt sich, indem er (aus Altem) Neues schafft. So umschrieb ein anderer Kollege aus der sogenannten „Sächsischen Dichterschule“, Rainer Kirsch, das Amt des Dichters in einem Interview mit Rüdiger Bernhardt (1980). Das Amt besteht aus einer ständigen Auseinandersetzung mit Texten anderer. Für Rainer Kirsch, wie für Mickel, Müller, Erb, Endler und andere, bedeutete dies konkret, daß er in den sechziger Jahren in ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zu gleichaltrigen Kollegen trat, in dem er beide Rollen spielte. Kirsch sagt in dem Interview, daß er damals nur schrittweise zum Genre der Poesie kam, „dessen Baugesetze [ich] herauszufinden bzw. für mich neu zu schaffen hatte, also den Kreis meiner Möglichkeiten, bei immerwährender Neugier, langsam ausschreiten und ausweiten konnte. Dabei kam mir zustatten, daß ich ,von unten‘ kam, d.h. keinem Erwartungsdruck ausgesetzt war außer meinem eigenen und dem von ein paar Freunden und Bekannten, deren kritisches Urteil mir wichtig ist.“92 In seinem „Selbstporträt für Fernsehen“ von 1978 machte Rainer Kirsch eigentlich schon deutlich, wie wichtig ihm die Freunde bzw. Kollegen für seine schriftstellerische Arbeit waren: sein „Selbstporträt“ vervollständigte er, indem er die Porträts (Fotos) unter anderen von Mickel, Richard Leising, Sarah Kirsch, Erb und Endler herzeigte.93
Gerrit-Jan Berendse, aus Paul Gerhard Klussmann und Heinrich Mohr (Hrsg.): Die Schuld der Worte. Gert Neumanns Sprachreflexionen. Zum Werk von Peter Hacks. Über Texte von: Karl Mickel, Sarah Kirsch, Günter Weisenborn und Heiner Müller, Bouvier Verlag, 1988
„Während der Veranstaltung nahm er Alkohol zu sich“
– Adolf Endler liest und lässt lesen. –
1979 wurde Adolf Endler zusammen mit acht anderen aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, weil er gegen eine juristische Verurteilung Stefan Heyms wegen angeblicher Devisenvergehen protestiert hatte. Ein Ausschluss aus dem Verband kam einem Berufsverbot nahe. Fortan hatte Endler nur wenige Möglichkeiten, öffentlich gegen Honorar zu lesen, viele Auftrittsorte waren ihm verschlossen, denn es gehörte ein gewisser Mut der Veranstaltenden dazu, ein geschasstes Mitglied des Schriftstellerverbandes öffentlich auftreten zu lassen. Zu dieser Zeit häuften sich die sogenannten Rohrbruch-Absagen, die mehr über die DDR aussagten als offizielle Verlautbarungen – das Land war so marode, dass Ausfälle durch Rohrbrüche durchaus plausibel waren. Allerdings traten sie immer dann auf, wenn eine Autorin, ein Autor angekündigt war, die oder der ein eher kritisches Verhältnis zum Staat hatte. „Rohrbrüche, die sich bis zum nächsten Tag von selbst, ohne Einsatz von Handwerkern, quasi durch Gesundbeten, behoben“, wie es Gerd Adloff in einem Text über Adolf Endlers Lesungen, beschrieb.94 in Tarzan am Prenzlauer Berg schildert Endler einen Ausflug von Elke Erb mit Heiner Müller und anderen in einem Auto zu einer Wohnungslesung in Magdeburg, wo sie an der Berliner Stadtgrenze sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg wegen angeblicher Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten, kontrolliert und festgehalten wurden. Die Lesung in Magdeburg fand statt, aber mit Verspätung. Endler fragte danach sarkastisch:
Sollte man in Zukunft „Dichterlesungen“ nicht von vornherein als „Geschwindigkeitsüberschreitungen“ deklarieren?; was sie in gewisser Weise ja auch sind, wenn sie ernst genommen werden wollen – Verstöße gegen das vorgeschriebene poetische Tempo…95
Das Schreiben ohne Netz und doppelten Boden bedeutete eine fragile Existenz, vor allem, wenn man wie Endler noch eine Familie hatte. Wolfgang Hilbig hat es in seinem Roman „Ich“ beschrieben:
W. ging seit Jahren keiner geregelten Arbeit mehr nach. – Er lebte gleichsam auf der Nulllinie, die sein Kontostand bildete: er hatte das Gefühl eines zu Tode erschöpften Langstreckenschwimmers, wenn er an diese Linie dachte: nie tauchte er unter ihrer Oberfläche hinab, obwohl es seit langem nicht mehr weiterging, – es war dies eine der Merkwürdigkeiten seiner Existenz, welche sogar von Feuerbach96 als Phänomen bezeichnet wurde. Dieser meinte damit das Leben, das eine ganze Reihe sogenannter freischaffender Schriftsteller im inoffiziellen Kulturbetrieb von Berlin führte. Fortwährend waren sie davon bedroht, daß ihr wahrer Status benannt und zum Vergehen erklärt wurde: es war der Status von Asozialen, welche ehrlicher leben mußten als jeder wohlbestallte Bürger, denn der geringste Fehlgriff konnte die gesamte Gesetzgebung gegen sie aufbringen […].97
Um 1980 herum entstanden immer mehr inoffizielle Lesungsorte, in Ostberlin vor allem im maroden Stadtbezirk Prenzlauer Berg, aber auch in Magdeburg, Dresden, Jena, Karl-Marx-Stadt oder Leipzig. Es waren meistens Wohnungen, aber auch Ateliers und Werkstätten, in denen Eingeweihte zusammenkamen, um Texte zu hören, die zum größten Teil unveröffentlicht oder nur in der Bundesrepublik erschienen waren. Bald kamen auch Kirchenräume dazu.
Illegale Wohnungslesungen
Seit 1978 gab es den Literarischen Salon in der Wohnung von Ekkehard Maaß in der Schönfließer Straße 21; wie Peter Böthig beschrieb, eine „Art Keimzelle für einen in den 1980er Jahren sich entwickelnden staatsunabhängigen Literatur- und Kunstbetrieb“.98 Wilfriede Maaß, die am selben Ort ihre Keramikwerkstatt betrieb, erinnerte sich 1998:
Dass wir Lesungen in unserer Wohnung veranstalteten, begann damit, dass Ekke in dem Klub vom Museum für Deutsche Geschichte Lieder von Okudschawa singen sollte. Dieser Abend wurde kurzfristig verboten. Mitgeteilt wurde ihm das erst, als er mit seiner schönen neuen Gitarre ankam. Ganz spontan lud er daraufhin alle Wartenden in die Schönfließer Straße 21 ein. […] Wir legten lauter Matratzen auf den Fußboden, damit die Leute sitzen konnten, und hatten so mit viel Improvisation die erste Wohnungslesung bei uns. Daraus entstand schließlich eine Tradition.99
Wenn möglich, fanden die Lesungen am letzten Sonntag des Monats statt.
Wir kauften den Wein und machten große Berge Nudelsalat. Es wurde üblich, dass es immer auch etwas zu essen gab und so ein Abend, wenn er gut war, sich bis morgens um drei hinzog.100
Neben Ekkehard Maaß war auch Sascha Anderson an der Vorbereitung und Auswahl der Lesenden beteiligt, in seiner zweiten Funktion verfasste Anderson, einer unter mehreren Spitzeln, unter dem Decknamen „David Menzer“ Berichte von den Veranstaltungen. Selbst zu seinen eigenen kam er in dieser Funktion, eine besonders krasse Form der Persönlichkeitsspaltung:
Vorkommnisse habe es keine gegeben.101
Zu Enders Lesung gibt es keinen Stasibericht, nur eine Notiz von Ekkehard Maaß:
Am 2. Juni 1980 fand in der Schönfließer Straße die erste ,richtige‘ Dichterlesung statt, zu der fast sechzig Leute kamen. Adolf Endler las aus seinen phantasmagorischen Romanfragmenten, danach Sascha Gedichte.102
Ekkehard Maaß „interessierten besonders die Dichter, die in einer für die DDR neuartigen Weise mit der Sprache umgingen, sie bis in die Silben zerlegten und spielerisch wieder zusammensetzten, scheinbar reinigten von dem geschichtlichen und ideologischen Ballast, der in Quadraten, Rhomben, Trichtern, Treppen dann doch wieder durchschimmerte wie die Steine der Berliner Trümmerberge“.103 Dichter wie Endler, der nach diesem Auftakt zu einem regelmäßigen Gast der Salonlesungen wurde und einer ihrer Mentoren – ältere Autorinnen und Autoren wie Christa und Gerhard Wolf, Elke Erb, Heiner Müller und Volker Braun, die das Unternehmen begleiteten und mit ihrer Anwesenheit beschützten, „damit nicht der ganze Laden von der Stasi geräumt wurde“.104 Wilfriede Maaß erzählte, dass Endler „manchmal eine Tasche voll Bierflaschen bei sich“ hatte.105 Es war „im Prinzip ein fester Kreis. Die Dichter brachten meist Freunde und Kumpel mit, die ebenfalls schrieben oder malten, bildende Künstler wie Sabine Grzimek, Anatol Erdmann und Hans Scheib beispielsweise.“106 Den Literarischen Salon in der Schönfließer Straße gab es über das Ende der DDR hinaus, später dann mit einer deutlicheren Internationalisierung.
Wenn kein geschlossener Raum zur Verfügung stand, fanden die illegalen Lesungen auch unter freiem Himmel statt, wie Endler in Tarzan am Prenzlauer Berg beschrieb:
Oktober 81 INTRODUKTION // Einladung zu einer illegalen ,Lesung‘ im offenen Forst, in den Waldungen weit draußen vor der Stadt; den ,Veranstaltungsort‘ konnte man mittels einer karikaturistisch gezeichneten Landkarte finden und dank des Hinweises: „Man besteige die S-Bahn 14.04 Uhr ab Friedrichstraße in Richtung Erkner und fahre bis Wilhelmshagen; Treffpunkt ca. 10–15 min Sandweg Richtung Woltersdorf“.107
Hinzugefügt war von den Einladenden, die das hektografierte Papier in hundertfacher Ausführung verteilt haben mögen, u.a.:
… Volljährigkeit nicht Bedingung… Grenzmündigkeit108 kein Hindernis… Korkenzieher nicht vergessen!109
Von dieser Lesung gibt es Fotografien, grobkörnige Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wahrscheinlich in der Hinterhofküche selbst entwickelt, damit sie nicht schon in der Kopieranstalt der Staatsmacht in die Hände fielen. Eines zeigt den 50-jährigen Adolf Endler im Schneidersitz auf dem Waldboden, wahrscheinlich unveröffentlichte Texte aus einer Klemmmappe lesend und gleichzeitig rauchend. Um ihn herum andächtig Lauschende, dem Alter nach eine Generation jünger, Frauen wie Männer, ein Kinderwagen auch dabei, für den kulinarischen Genuss Wein und Schnaps der billigeren Sorte – Cabernet, Kristall („Blauer Würger“), Weinbrandverschnitt – und selbst gebackener Kuchen.
Anzunehmen, dass ein Spitzel mit dabei war. Wolfgang Hilbig hat einen solchen in Aktion in seinem Roman „Ich“ (1993) beschrieben. Der Spitzel mit dem Decknamen Cambert ist eine dubiose Existenz, ein Zuträger, der selbst glaubt, ein Dichter zu sein, durch eine vorgetäuschte Vaterschaftsklage zur Mitarbeit erpresst. Unter dem Decknamen Cambert ist er auf den Untergrunddichter Reader angesetzt, der nichts veröffentlicht und an einer Zusammenarbeit mit westlichen Medien nicht interessiert ist. Einmal liest Reader bei einer inoffiziellen Lesung in der 5. Etage eines verrotteten Ostberliner Gründerzeithauses. Cambert kommt zu spät.
Drinnen fand ich mich in einem eher kleinen Raum, der dicht gefüllt war mit einem in, wie mir schien, selbstvergessener Konzentration lauschenden Publikum – kaum jemand drehte den Kopf nach mir um –, das sich auf langen Bänken und zusammengerückten Stühlen aufreihte. […] Ich zog […] die vorwurfsvollen oder irritierten Blicke einiger Zuhörer auf mich, als ich mich, so vorsichtig wie möglich, hinter dem Publikum vorbeidrückte und mich auf das äußerste Ende der letzten Bank setzte, die meinem linken Oberschenkel noch Platz bot. […] Der Lesende hinter seiner Tischlampe war nun für mich nicht mehr sichtbar, da zusammengedrängte Schultern und die Phalanx teils gesenkter, teils zurückgebogener Köpfe ihn verdeckten.110
Es klingt, als wäre eine Lesung bei Ulrike und Gerd Poppe in der Rykestraße 28 Vorbild für Hilbig gewesen.
Ulrike Poppe erinnerte sich mit gemischten Gefühlen an die Abende in ihrer Wohnung:
Es wurde viel geraucht, getrunken, diskutiert. Manchmal wachten die Kinder im Nebenzimmer davon auf und ich mußte sie wieder beruhigen.111
Einmal kam die Volkspolizei, um mitzuteilen, dass die Abteilung Erlaubniswesen „keine Erlaubnis für die geplante Veranstaltung“ erteilen würde. Kein Insistieren, dass es sich um eine private Feier handele, half. Da sich unsere Veranstaltungen immer nur mündlich herumsprachen, war es fast unmöglich, den Leuten abzusagen. […] Vor der Haustür stand die Polizei, und jedem, der ins Haus wollte, wurde gesagt: „Wenn Sie hochgehen, machen Sie sich strafbar. Die Veranstaltung wurde nicht genehmigt.“ […] Kurze Zeit später bekamen wir einen Ordnungsstrafbescheid über vierhundert oder fünfhundert Mark. Das war viel, ich verdiente knapp über sechshundert Mark im Monat. Aber es kamen so viele Spenden, daß das kein Problem war.112
Die Strafe wurde trotz Einspruchs vom Lohn abgezogen. Nach dem dritten Ordnungsstrafbescheid stellten die Poppes fürs Erste ihre Veranstaltung ein, andere, wie Ludwig Mehlhorn, übernahmen. Auch Adolf Endler war bei Poppes zu Gast. Am 2. Juni 1982, schrieb er an Brigitte Struzyk, verbunden mit einer Einladung zu einer Lesung aus seinem nie eigenständig als Prosaband veröffentlichten Konvolut „Nebbich“.
Schauplatz des Dramas: Poppe, 1055 Berlin, Ryke-Straße 28, 4 Treppen (Nähe Kreuzung Prenzlauer: Dimitroff)! Die Veranstaltung steht unter der Überschrift. KAPITÄNE DES GRAUENS. KANARIENVÖGEL, KALTE BUFETTS. / Herzlichst…113
Das war auch die Lesung, zu der die junge Leipzigerin Brigitte Schreier ging, die erste von vielen ihres späteren Ehemannes und Gefährten, bei der sie anwesend war:
Ich war völlig fasziniert von seiner Art vorzutragen, ob das nun Gedichte oder andere Texte waren. Er hatte ja auch so eine Art des, wie soll ich sagen, Entertainments. Das hing natürlich mit den Wohnungslesungen zusammen, diese Art und Weise, Kontakt mit dem Publikum aufzubauen und diese kleineren oder größeren Explosionen, dass man fast bis zum Umfallen gelacht hat.114
Dieses Lachen ist etwas, das allen im Gedächtnis geblieben ist, die zu einer dieser Undergroundlesungen gegangen sind. Wolfgang Hilbig hat in seiner Laudatio zur Verleihung des Brandenburger Literaturpreises 1994 an Endler diesen „unauflöslichen Zusammenhang von Lachen und Trauer“ auf den Punkt gebracht:
Jedesmal, wenn man etwas von Dir liest, glaubt man, man müsse sich augenblicklich totlachen. Doch dann merkt man plötzlich, daß man schon tot war.115
Peter Geist schreibt im Nachwort zu den gesammelten Gedichten Adolf Enders:
Wer je Endlers Gelächter erlebte und erlebt, in der Leibhaftigkeit, im Gedicht, den fasst es wohl an für immer.116
Nicht zuletzt deshalb waren Endlers Lesungen immer ein Magnet. Selbst der IM der Staatssicherheit konnte in seinem Bericht ein Lob des Vortrags nicht verhehlen:
Der IM schätzt ein, daß die Art des Vortrags von ENDLER sehr gut war, weil er sehr akzentuiert sprach und wie ein Schauspieler mit deutlicher kabarettistischer Tendenz las. Während der Veranstaltung nahm er Alkohol zu sich.117
In der Leipziger Steinstraße
Seit März 1982 veranstaltete die in Meißen ausgebildete Klubhausleiterin Brigitte Schreier im Jugendklubhaus Arthur Hoffmann in der Leipziger Steinstraße Lesungen. Es war ein skurriler Ort.
Unten war ein militärpolitisches Kabinett und die obersten zwei Etagen waren dann das eigentliche Jugendklubhaus. Ich wollte, dass Endler auch bei mir las, besorgte mir die Adresse und wollte ihm schreiben. Aber jemand erzählte mir, dass die Post bei ihm nicht ankommt. Und dann bin ich im Mai ’83, ein paar Monate, nachdem ich ihn bei Poppes gehört hatte, nach Berlin gefahren, ins Hinterhaus Dunckerstraße 18, die ganzen Treppen hoch und hab an die Tür geklopft, so ein bisschen naiv. Dann dauerte es einen Moment, bis jemand rausguckte. Ich habe gesagt: „Herr Endler, ich wollte Sie bitten, bei mir in Leipzig zu lesen. Weil ich weiß, dass die Post nicht ankommt, bin ich selbst gekommen.“ Da sagte er: „Ich komme gleich wieder.“ Die Tür ging zu. Und dann hörte man ihn da drinnen irgendwie ein bisschen rumräumen, bis er wiederkam und sagte: „Kommen Sie mal rein.“ Und die erste Frage war: „Kennen Sie denn überhaupt dieses Büchelchen?“ Und hielt den Gedichtband Akte Endler hoch. Da sagte ich: „Klar, deswegen bin ich ja hier.“ Wir verabredeten die Lesung für September. Zwischendurch habe ich ihn aber nochmal bei einer Lesung für Uwe Greßmann in der Moritzbastei in Leipzig gesehen. Und so haben wir uns kennengelernt.118
Bald pendelte Endler nach Leipzig und Brigitte Schreier nach Berlin. Nicht nur Endler las in der Steinstraße, eigentlich alle, die in der inoffiziellen Literaturszene des Landes einen Namen hatten – und die berühmten. Adolf Endler öffnete die Türen, die Steinstraße wurde zu einem Pilgerort. Mit List und integren Kolleginnen und Kollegen gelang es Brigitte Schreier, ihre Lesereihe sieben Jahre zu veranstalten, trotz Zensurversuchen und Maßnahmen der Staatssicherheit, sie als Leiterin absetzen zu lassen, die aber im Sande verliefen.
1984 zog Endler ganz nach Leipzig. In Berlin schossen sich seit Anfang 1983 die Staatssicherheit und andere Behörden auf die illegalen Veranstaltungen ein. Auch stellten viele Autorinnen und Autoren Ausreiseanträge, die oft zügig genehmigt wurden. Die Abschiede nahmen überhand.
VERBOTEVERBOTE // Seit Wochen Nachricht über Nachricht bezüglich des ,Literaturkriegs‘ gegen renitente Autoren, auch gegen den sich entwickelnden ,Underground‘, vor allem natürlich gegen die ,illegalen Wohnungslesungen‘, ziemlich regelmäßig an bestimmten Orten veranstaltet: Kontinuierliche Präsentation dessen, was in unüberbrückbarer Distanz zum öffentlichen Literaturbetrieb produziert wird. Ja, zweifellos, die haben uns auf dem Kieker, es soll uns an den Kragen gehen! Haben wir nicht damit gerechnet?119
Gerd Adloff, der öfter bei Lesungen von Adolf Endler war und auch eine Lesereihe im Jugendklub Schaufenster organisierte, zu der er Endler mehrfach einlud, erinnert sich:
Endler hat in der Zeit, bevor er nach Leipzig gegangen ist, im Prenzlauer Berg noch eine von der Bibliothek in der Senefelder Straße organisierte Lesung gemacht. Es war knallvoll und nebenan saßen welche von der Stasi in so einem Kabuff und haben alles mitgeschnitten, ganz demonstrativ.120
In Tarzan am Prenzlauer Berg hat Endler über diese Lesung, „nach langer, nach jahrelanger Pause wieder einmal in einer quasi offiziellen ,Einrichtung‘“, geschrieben, nach der der junge Bibliothekar, der sich getraut hatte, Endler einzuladen, „tüchtig gerüffelt“ und mit „,verbindlichen Richtlinien‘“ versehen worden war, „nach denen er für jede einzelne ,Dichterlesung‘ mehrere Autoren in Vorschlag zu bringen hat, aus denen man ,höheren Orts‘ den ,geeignetsten‘ auswählen will.“121 Von den zwei Lesungen, zu denen Gerd Adloff Adolf Endler einlud, konnte auch nur die erste stattfinden. Die zweite scheiterte an der plötzlichen Anordnung, „dass man die Personenkennzahl angeben musste, um zu verhindern, dass sich Leute unter fremdem Namen einschleichen würden, und da hat Endler vom Leder gezogen, und da durfte er dann nicht kommen.“122 Die Lesung wurde im Jahr der Anarchie, 1990, nachgeholt. Nicht lange danach wurde der Klub abgewickelt.
Im Februar 1988 bekam Adolf Endler einen Pass und konnte zu Lesungen ins westliche Ausland fahren. Brigitte, die ihn 1987 geheiratet hatte und nun Schreier-Endler hieß, durfte ihn begleiten. Wahrscheinlich hofften die DDR-Literaturfunktionäre, dass sie wegblieben und die ,Akte Endler‘ sich so von alleine erledigte. Endler las in den Niederlanden und in den USA, und er las in Westberlin und in der Bundesrepublik, wo sich dem Publikum nicht jede Feinheit des Endler’schen Kosmos erschloss, wie Brigitte Schreier-Endler sich erinnert.
Endler war im Westen nicht so bekannt. Wenn er auftauchte, um zu lesen, waren viele Leute aus der DDR da, die ausgewandert sind. Und die haben das natürlich voll kapiert, im Gegensatz zu den Einheimischen. Nach der Wende ist es dann besser geworden, aus welchen Gründen auch immer. (…) Die Schullesungen waren richtig gut vorbereitet. Und die Jugendlichen waren auch interessiert daran.123
„Du bist Orplid, mein Land! / Das ferne leuchtet…“
Am 1. Oktober 1989 bat Brigitte Schreier-Endler um Aufhebung ihres Vertrages im Jugendklubhaus Arthur Hoffmann. Es gab zwei Gründe, die sie dazu veranlassten zu kündigen und Leipzig den Rücken zu kehren.
Endler hatte eine vierwöchige Lesereise in den USA. Und ich wollte mit, hätte aber keine Freistellung von meiner Arbeit gekriegt. Außerdem war alles am Zerfallen. Und es kam noch eine Sache hinzu. Endler hatte 1988 einen Herzinfarkt. Die giftige Luft in Leipzig hat ihn fertig gemacht. Also haben wir versucht, eine Wohnung zu kriegen in Berlin. Und das hat dann geklappt. Im Sommer 1990 sind wir in die Colbestraße in Friedrichshain. Und dann kam Dorothea Oehme auf Endler zu, ob er nicht in ihrer neu gegründeten Unabhängigen Verlagsbuchhandlung Ackerstraße ein Buch machen wollte, das ja dann auch noch im selben Jahr erschienen ist: Citatteria & Zackendullst. Mich hat sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Lesereihe zu machen. Wir haben das dann Orplid & Co. genannt. Als wir den Verein anmelden wollten, wurde gesagt „& Co.“ ginge aus finanzrechtlichen Gründen nicht als Vereinsname, und so waren wir fürs Finanzamt Orplid e.V.124
Angelehnt war der Name an Eduard Mörikes fernes Inselland Orplid, nur dass Endlers Orplid noch Kompagnons hatte – einen „Verein zur Pflege und Förderung der Poesie e.V“.
Bald erwies sich die Verbindung von Verlag und Veranstaltungsreihe aus mehreren Gründen als ungünstig und Adolf Endler und Brigitte Schreier-Endler machten die Veranstaltungsreihe alleine, ohne Verlag, im Café Clara – begleitet von wechselnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter ihnen Gerd Adloff, die über die Jahre durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Stipendien und Arbeitslosengeld recht und schlecht finanziert wurden. Bis zuletzt war das Budget knapp, eine Regelförderung durch den Berliner Senat gab es nicht. Endler blieb weiter freischaffender Autor, bekam aber ein kleines Honorar für die Einführungen, die er vor jeder Lesung machte.
Am Anfang haben wir das privat finanziert. Als Pastior und Mickel lasen, haben wir alle zusammengelegt und die Eintrittsgelder dazugenommen, wir hatten nicht sofort eine Förderung, das hat ein halbes Jahr gedauert.125
Am Ende die beeindruckende Bilanz: 114 Lesungen im Café Clara, 169 Lesende aus aller Welt, „man könnte diese Notiz auch ,Von Bella Achmadulina bis Ulrich Zieger‘ überschreiben“,126 51 aus dem Osten. „Sarah Kirsch hat abgesagt wegen der Anderson-Geschichte. Anselm Glück ist nicht angereist. Ansonsten sind alle gekommen, die wir eingeladen hatten“, erinnert sich Brigitte Schreier-Endler.
Einige waren sehr böse auf uns, weil sie der Meinung waren, dass die Eingeladenen nicht so gut sind wie sie. Die kannten Eddie im Wesentlichen durch Sauftouren, also dachten sie, sie kommen bevorzugt dran. Ich habe dann immer gesagt, wir sind schon seit einem Dreivierteljahr ausgebucht. Ich war die Böse, die absagen musste. Irgendwann rief uns mal István Eörsis Frau Veronika an und erzählte, Allen Ginsberg kommt nach Berlin, wir machen ein schönes Essen. Ich bin auf- und abgegangen und habe mir immer gesagt, wir machen eine Lesung, wir machen eine Lesung mit ihm. Eddie hat abgewunken, den kannst du doch gar nicht bezahlen. Ich hab mich dann dahintergeklemmt, und es hat geklappt. Wir haben an den Manager geschrieben, dass das im ehemaligen Osten ist, und Ginsberg hatte einfach Lust. Das war doch bei Endler genauso, wenn es kein Geld gab und man wollte unbedingt lesen da, dann stellt man sich doch nicht stur.127
So kam Orplid & Co. zu seinem berühmtesten Dichter.
We schon in der Steinstraße, ging die Reihe in der Clara-Zetkin-, ab 1995 Dorotheenstraße, sieben Jahre. „Nach sieben Jahren ist man immer wieder irgendwo hinausgeschmissen worden“,128 so begründete Endler das Ende. „Wir wollten nicht bis ultimo machen“, sagt Brigitte Schreier-Endler heute.
Es wurde schwieriger mit der Finanzierung. Und Endler wollte auch weiterschreiben. Orplid hat ihn schon weitaus mehr beschäftigt als ursprünglich geplant, und gesundheitlich ging es ihm auch nicht mehr so gut.129
Im Vorwort zur Abschlussdokumentation schreibt er:
„Orplid“, der Verein, wird zum U-Boot, das eines nicht allzu fernen Tages an einem anderen Strand Berlins und ein wenig anders bewimpelt – Sie merken, der Verf ist selber ’n Dichter! – ratzpatz wieder auftauchen mag. – Adios!, vorerst.130
Einstweilen schleicht das U-Boot am Grund der Wasserstraßen zwischen Müggel- und Wannsee hin und her.
Annett Gröschner, aus Text+Kritik: Adolf Endler – Heft 238, edition text + kritik, 2023
PORTRAIT AE
Nirgends ist er zu Haus.
Wo ein Bleistiftstummel ist und Papier
Zieht er die Schuh aus:
Hier
Springe ich! Und er springt
Wenns sein muß auf dem Kopf, und singt
aaa(weil die Frau einen Mantel will, er
aaakann ihn nicht kaufen):
Sieh her!
Ich kann auf den Haaren laufen.
aaaUnd sie sieht, wie er springt
aaaund sie hört, wie er singt
aaaund sie sagt: Ich steh niemals mehr auf.
aaaUnd er nimmt sie und schwingt
aaasie durchs Zimmer und trinkt.
Geht er drauf?
Den kleinen See, den großen Schnee
Die Kerbe im Ufer, den Kahn
Das bittere Bier und den Löffel im Tee
Den ausgebrochenen Zahn
Hebt er uns auf.
Im Sommer mit kleinen Steinen
Baut er im Sand und mit Holz –
Treibgut – uns einen reinen
Menschen Sehtwiestolz.
Leute, der kann lachen und weinen
Leute, laßt auch uns nicht versteinen
Karl Mickel
PORTRÄT A. E.
Nach Mickel
Ich kenne ihn nicht
Mich interessiert wie einer ist der
Auf den Haaren laufen kann und Mickel
So ein Gedicht abzwingt
(Und seine Frau, die einen Mantel will, durchs Zimmer schwingt)
Und trinkt
Und andern seinen ausgebrochnen Zahn aufhebt
Kurz: lebt
(Und wundre mich – das ist einem jungen Dichter wunderlich?)
Ich kenn nur wie er Bahnhof Dreck und Arbeit schreibt
Und stehenbleibt
Wenn diskutiert wird auf der Straße oder wo
Aus seiner Schwefelode ein paar Zeilen
Wo er sich nicht traut
Und Pausenverse zwischen zwei Kongressen
Wie er auf eine fremde Pauke haut
Und daß er sich vergessen
Über all dem wie er klagt
Daß er fragt
Was der und der wenn er schweigt sagt
Daß er leise pfeift gegen falsch und laut
Der Weiber haßt, so sagt er, die er gar nicht kennt
Den seine Frau und hier und da ein Dichter Dichter nennt
Daß ich mich frag: warum nicht mehr?
Ich kenn ihn wie ich mich kenne
Wer ist er?
Inge Müller
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK + IMAGO
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


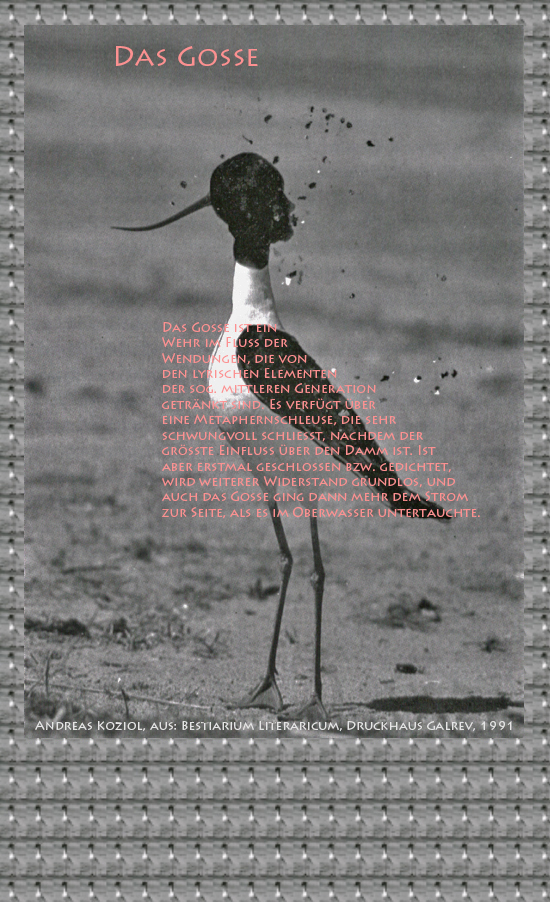
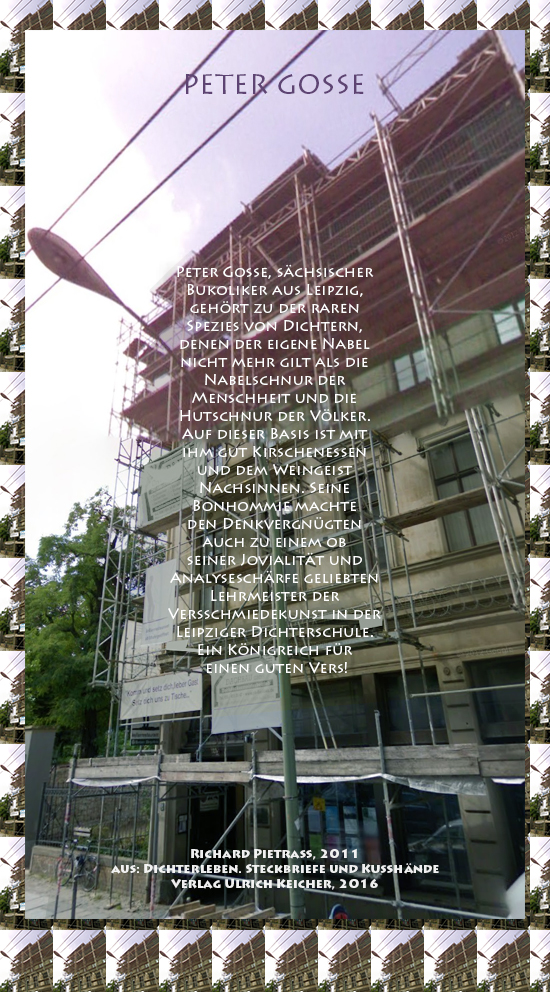
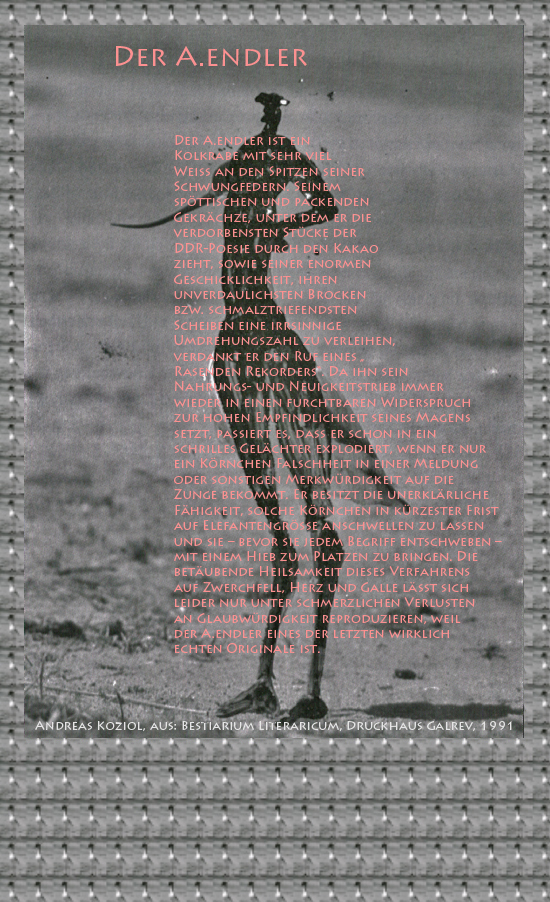
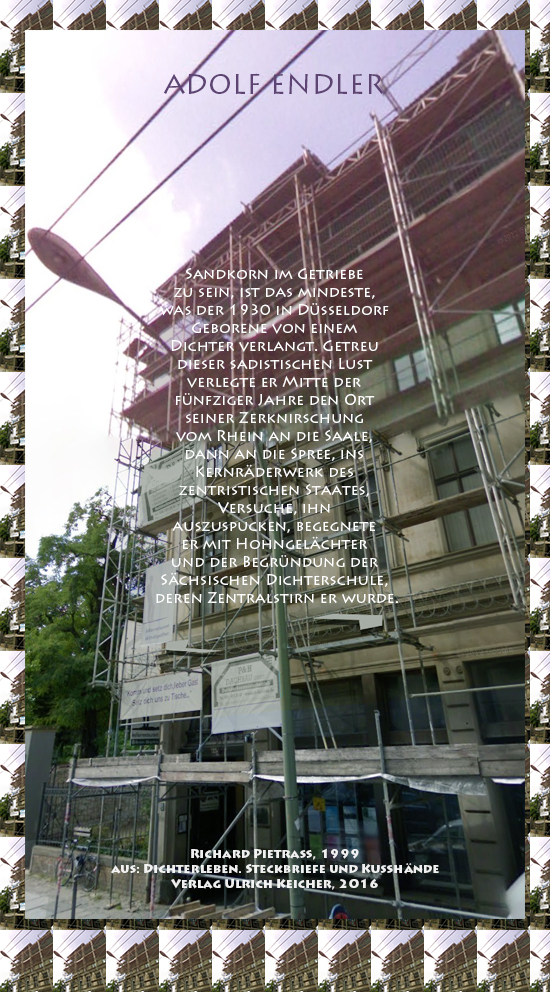












Schreibe einen Kommentar