Adolf Endler: Das Sandkorn
DAS LIED VOM FLEISS
„… die an einer fruchtbaren Impotenz leidet.“ Günter Kunert
Laßt mich allein nun! Endlich laßt michs singen,
Das Lied vom Fleiße, das ich singen will.
Einhundert Zeilen wird mein Fleiß erzwingen
Und fünfzig Doppelreime. Also still!
Hier wird das Lied auf meinen Fleiß geschrieben:
O großer Fleiß, der schon die Zeile sechs
(Sie war’s), der also schon die Zeile sieben
Mit Lippen abzählt –: Zeigt mir das Gewächs,
Das schneller wächst! Kein Wägelchen mit Reisern
Ist rascher voll als dies mein Büchlein, ja!
So, Brüder, tut der Fleiß –: kantianisch, eisern! –,
Fleiß von der Art, wie ich ihn oft schon sah
In unserm Land. Erkennt und prüft euch, Helden!:
Fleiß, eisern sinnlos, wär nicht heldenhaft?
Mich aber laßt als Zwischenmeldung melden:
Die Zeile sechzehn, seht, ist schon geschafft!
Mag unser Himmel blauen, mag er regnen,
Einhundert Zeilen her!, sei’s mit Gewalt,
Ihn, der sich selbst genügt, den Fleiß zu segnen,
Und seine Jünger, deren Chor erschallt:
„Hauptsache: fleißig! Alles andre: Scheiße!
Wer nach dem Sinn fragt, ist ein armer Tropf!“
Der Lehrling schon hört diesen Vers vom Fleiße,
Der Meister nickt mit dem Charakterkopf:
„Betrieb, Betrieb!“ So dieses Epos, Lieschen:
Nicht Geistesblitze kennts noch Phantasie,
Ich pflanze hundert Zeilen wie Radieschen,
Brech Reim um Reim wie Kleinholz übers Knie.
Der ich nicht Wochen-, Monatslohn empfange,
Ich übertreffe alle! Freunde, geht,
Ein Hymnus, lang wie eine Hopfenstange
Und spannend wie ein Defa-Film, Entsteht!
Hier schlägt der Fleiß heroischste Bataille!
Ich übertreffe alle nichts als Schweiß
Wird mir zum Lohn, nicht Orden noch Medaille
Erstreb ich oder Heinrich-Heine-Preis!
Auch nicht aus Lust und Liebe, liebe Grete,
Wird hier gedichtet, nicht aus Lieb’ und Lust
Der Hymnus, Vers an Vers wie Spargelbeete,
Hier hebt der Fleiß an sich die Heldenbrust:
Die Zeile einundvierzig ist errungen!
Die Zeile zweiundvierzig liegt schon vor!
Die Zeile dreiundvierzig wird gesungen!
Die Zeile vierundvierzig summt ums Ohr!
Der Reim auf Nest, Inzest und Pest rückt näher.
Da Ich die fünfzigste begehen kann –
Und fließt der Strom der Zeilen etwa zäher,
lch peitsch ihn weiter wie ein Reitersmann
Beim Endspurt in der letzten Zielgerade,
O Fleiß der meinen Herzschlag stottern läßt!
Dies war sie! Nummer fünfzig! Schade, schade,
Wie bald vorüber! Doch ein kleiner Rest
Heißen Triumphes wird mich weiterjagen
Vielleicht noch zwei, drei Zeilen, wenn nicht vier –
Schon fällt, ich eile mich sie einzutragen,
Die Zeile sieb’nundfünfzig, diese hier!
„Glanzlose Zahl und schlicht, wie rasch vergessen!
Und grade die Bescheidnen solltest du
Mit einem Toast und einem kleinen Essen
Zuweilen ehren! Eine Fuffzehn, nu?…“
Der Satan! Ich verscheuch ihn, zähl die Zeilen.
Vergeblich lockt des Teufels süßer Leim.
Ja, atemlos von Reim zu Reim sich seilen
Will Dichters Fleiß, zetBe zu diesem Reim:
Die fünfundsechzigste der Zeilen, Brüder!
Erheb dich, Leser, meinem Fleiße Ruhm!
Setz dich, Genosse, und erheb dich wieder.
(Der Fleiß, der Fleiß nur ist mein Heiligtum!)
Du näherst dich der siebenzicksten Zeile.
lch sage: siebenzick! Sie ists mir wert.
Wer lächelt oder lacht, verdiente Keile
Die Zeile siebenzick, in ihr mein Fleiß geehrt!
Ach, monoton ertönts von fleißiger Leier:
Die Zeile siebzig hab ich dargebracht,
Die siebzigste. „Noch immer keine Feier?
Sinds nicht schon beinah siebenzick und acht?“
Nein, nein, es sind erst siebenzick und sieben!
Vers achtundsiebzig ist erst dieser, schau!
(Ach, möchten sie wie Schnee, die Zeilen, stieben…)
Die Zeile achtzig, bitte, schöne Frau!
Die Zeile einundachtzig! – Und der Dichter,
Er überlegt: War sie nicht allzu schwach?
Ein plapperndes und meckerndes Gelichter
Die Verse, die ihn überfallen: Ach,
Ob nicht, eh ich des Liedes Schlußsatz tippe,
Freund Hein erscheint, der keinen noch verfehlt’?
Steht er schon hinter mir mit seiner Hippe?
Wie mancher fragt sich, solchem Fleiß vermählt.
Eh er sein Pensum Punkt für Punkt geschafft hat,
Fragt bänglich, ob ers noch erreicht, sein Ziel?
Ob er für solchen Fleiß noch länger Kraft hat?
„Wo ist der Sinn? Wärs wenigstens ein Spiel!“
Ja, mancher Held ward endlich schwach, mein Lieber
Ich bin ein Preuße und erfüll es strikt,
Mein Pensum, ich erfüll es notfalls über:
Die Zeile sechsundneunzig ist geglückt!
Die Zeile sieb’nundneunzig! Stolz verwundert
Seh ich das Lied auf meinen Fleiß gereift.
Hier ist der Gipfel, hier die Zeile hundert:
– „Gebt mir den Strick da, doch gut eingeseift!“
Berliner Barock
Keine Epoche, die sich jemals literarisch fixiert hat, stirbt ganz: das Wissen ist tröstlich; Aufgehobensein und verwandelte Wiederkehr unter analogen Umständen in künstlerischen Unternehmungen: das ist ein Gesetz, dem man sich nicht entzieht. Wieweit Adolf Endler diesem bewußt gefolgt ist, läßt sich nicht entscheiden, unabweislich aber ist der Eindruck von der Retournierung bestimmter Züge des schreibenden 17. Jahrhunderts, kenntlich nicht allein an den manchmal etwas gewaltsamen und gewagten Sprachübungen („Witz kitzelt glitzernd spitzend…“) oder an dem abnormen Unterfangen, ein (wenn auch polemisch gemeintes) hundertzeiliges Gedicht über das Entstehen ebendieses Gedichtes zu schreiben; auch nicht die durchgehend spürbare Bewußtheit der Form, es ist vor allem die permanente Todesnähe und eine körperliche Gewalttätigkeit in den Bildern, die weniger parabelhaft als allegorisch sind und damit ebenfalls dem erwähnten Eindruck entsprechen. Tod, Gewaltsamkeit, Allegorie stellen die signifikante Trinität des Barock.
Wo in den Gedichten der Tod nicht verbal selber erscheint (wie in „Ballade vom Zionskirchplatz“, „Traum des Schülers vom verbrannten Mönch“, „Das letzte Zimmer“,
„Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann“), da ist er mittelbar im Vorgang vorhanden (und fast alle Gedichte haben Vorgang, Handlung, Story, sind ganz vom Erzählerischen bestimmt) wie etwa im „Lied des Kompaniegehülfen“, wo es heißt:
Ich drehe mein Messer mein Messer mein Messer in weißestem Fleisch
Ich stieß es in zweitausenddreihundertsiebenundfünfzig Kartoffeln…
Ich stach über zweitausend namenlosen Kartoffeln die Augen aus…
Oder im Versteinern des Lebendigen („Wachstum“) oder selbst im ironischen Aufgefressenwerden des Dichters von seiner Dame („Gelegenheit oder Opfer der Eifersucht“) und selbstverständlich in den auf Historie bezogenen Gedichten ( „Petrograd 1918“, „Lied vom Jahr Fünfunddreißig“, „Santiago“).
Allegorie wurde gesagt: besonders auffällig in solchem Gedicht wie „Die abgeschnittene Zunge“ (Grausamkeitstopos), wo die abgeschnittene Zunge verselbständigt durch die Straßen sich bewegt, eine Bedeutung bedeutend, „Ein Etwas, züngelnd, durch die Straßen sprang“, das dem zeitgenössischen Leser sich leicht erschließt, wie einst die allegorischen Gegenstände dem ehemaligen; doch selbst, wenn auch nur als Randerscheinung, das Änigmatische, Verrätselte wie in „Sensible Armee“ ist nicht ausgespart. Und als nun doch endgültig letzter Vergleich mit dem Barock: die Sprache bleibt stets konkret, erblaßt nie im Begrifflichen, ja, es drängt in ihr geradezu ein Übermaß des Konkreten sich an die Oberfläche, die fast davon gesprengt wird; es ist dies ihr Vorzug, nicht ihre Schwäche, diese Schwäche zur Abstraktion, die Walter Benjamin (im Ursprung des deutschen Trauerspiels) als ein Kennzeichen des Barock nennt. Das Gedicht lebt vom Konkreten, und wenn, wie Marx meint, die Wahrheit immer konkret sei, so sind Endlers Gedichte wahr im Sinne des Gedichts, das mit konkreter Realität vollgesogen ist, sie enthält, ohne daß sie äußerlich an ihm sichtbar sein müßte.
Manche der Gedichte, insbesondere die balladesken, wirken durch ihren Ton wie ironische oder satirische Paraphrasen etwa des „Trunkenen Schiffes“ oder der „Ballade vom ertrunkenen Mädchen“:
Ach, schneller als der Düsenklipper unterm Himmel
Holn wir die Stürme wie die Steine ein…
– Ein Wolkenknäuel, von Blitz und Blitz durchschossen
Ein Regen plötzlich schwefelgelber Art…
doch der Beschwörung der großen Bilder metaphysischen Verschwindens folgt eine Kehrtwendung in härteste temporäre Wirklichkeit:
Vom Magistrat (gez. Finck) verkannt und ausgeschlossen,
Ich wink Adieu – im Autowrack auf Fahrt.
Und das ganze Gedicht heißt (nebst erklärendem Untertitel): „Die Versuchung – Bei seinen Mühen zur Zurückerlangung der verlorenen Aufenthaltspapiere für Berlin“.
Der gleiche Klang in dem witzigen „Die Nacht der Lauben“:
„Wohin, ihr Schiffe?“ (– „In den Arsch der Welt!“)
O bröckelnde Armada Bretterlauben,
Die vorne wächst und hinten zäh zerfällt,
Da Wogen drüberhin, die Wolken schnauben…
Ironie, Witz, Bissigkeit und Satire resultieren aus dem Gegensatz der großen Geste zu ihrem Gegenstand: den konkreten Berliner Lauben und ihren obskuren Inwohnern, dem konkreten Kampf mit der Bürokratie um Rückzug nach Berlin. Die in Brechts Wiegenliedern berufenen Energien, mit denen früher große Reiche gegründet wurden, hier erschöpfen und verbrauchen sie sich an Nichtigkeiten, und aus dieser Diskrepanz springt der Funke auf den Leser über.
Viele der Gedichte sind „Rollengedichte“. Jemand spricht, wie etwa der Einhundertsechsundsechzigjährige, der alles, auch sein Alter, der Presse verdankt; häufiger jedoch ist die noch weiter getriebene Aufspaltung in zwei oder gar drei Rollen, die miteinander dialogisieren, einander kommentieren oder beschimpfen. Die Stimmen sind zwar jeweils durch Gänsefüßchen kenntlich gemacht, doch bleibt (glücklicherweise) uneindeutig, wer mit wem spricht (letzten Endes Endlers jähzornige antithetische Geister). Es sind, über alle formalen Betrachtungen hinaus, Gedichte eines tief verletzten Subjektes, das seine Wunden der Öffentlichkeit präsentiert und zwecks Aufmerksamkeitssteigerung den Schorf abreißt – einer Öffentlichkeit übrigens, welche an diesen Wunden nicht ganz schuldlos ist.
Das Titelgedicht „Das Sandkorn“ (wiederum ein allegorischer Gegenstand, dessen Definition dem Leser überlassen bleibt: mag er es als Wort ansehen, als Gewissensdruck, als eine rächende Transfiguration des Dichters selber) bietet eine der großen literarischen Abrechnungen, wie sie seit Villon in der Dichtung ständig wiederkehren. Es wird, nachdem das neoaktive, aber noch unpräzisierte „Du“ das Sandkorn geschluckt hat, (erneut) der Tod berufen, den das Sandkorn spürbar macht oder sogar verbreitet; in diesem Moment zerfällt das „Du“ des Gedichtes in den Reigen gehaßter Erscheinungen von Scheinheiligen, Kleinbürgern, Hauswarten, Lügnern, Karrieristen, Biedermännern, Magistraten, denen das Sandkorn-Ich die Selbstentlarvung abzwingt.
In keiner Kaderakte erfaßte Lumperei,
Hoch angesehne Bürger bei Staat und Polizei,
Jetzt keuchen sie und brüllen, ich sitz auf ihrer Stirn,
Das Sandkorn (siehe oben), mein Tanzplatz: Ihr Gehirn.
Verleumdung nicht noch Knüttel, kein Trick, der mich vertreibt…
bis es in dem kursiv gedruckten, beinahe eschatologischen Satz „Es endet ihre Zeit“ triumphiert, um nach ungeheurer Selbstvervielfältigung und Verbreitung in gesättigter Stille zur Ruhe zu kommen.
Eine Entladung? Ein Lehrbeispiel psychotherapeutischer Selbstbehandlung? Eine Gesellschaftskritik? Eine Fortführung von literarischer Tradition, der Heinischen etwa? Aggressionsabbau des Schreibenden, dem der Aggressionsabbau beim Lesenden zu folgen hätte?
Wie auch immer: in den Endlerschen Gedichten ist Wirklichkeit oder besser: Haltung, Beziehung zu einer Wirklichkeit auf den Siedepunkt gebracht; im ungehemmten Eingeständnis absoluter Subjektivität erweist sich ihre Stärke wie ihr Realismus. Und die innere Erhitztheit wird von kalkulatorischer Technik und ihren immer neuen Varianten gebändigt, wodurch das Artifizielle zum Gegengewicht aller leicht ins Amorphe expandierenden Leidenschaft wird: es mag befremdlich klingen, daß diese Gedichte an Barock denken lassen, an Rimbaud, an Brecht – das jedoch, scheint mir, gereicht ihnen zur Ehre, denn ohne nachzuahmen, erinnern sie ja nur daran, wie eben in bedeutender Dichtung immer Erinnerung an vorhergehende lebt: ein überlegter Akt Endlers, dessen umfassende Kenntnisse und literarisches Wissen seinem (von Natur überschwappenden) Talent in dem Gedichtband zugute gekommen sind.
Endler hat sich und sein Schicksal (ganz unironisch gesagt) als Stoff benutzt, unter Verzicht auf jene politisierenden Scheinobjektivitäten und Äußerlichkeiten früherer Gedichte. In diesem Band ist er zu sich selber gekommen und zur Welt – was ein und dasselbe ist, wie die seit Brecht etwas vernachlässigte „Weisheit des Volkes“ zu melden weiß, wenn jemand zum Menschen wird.
Günter Kunert, Frankfurter Rundschau, 5.7.1975
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Karl Corino: Rote Taubnessel
Deutsche Zeitung, 2.4.1976
Über Adolf Endler
Unter den wichtigen Dichtern der mittleren Generation in der DDR ist Adolf Endler der älteste; was ihn von seinen wenige Jahre jüngeren Kollegen unterscheidet, ist, daß er moderne Poesie mit vergleichsweise altväterischen Mittel macht. Wo bei Mickel oder Leising die semantische Dichte des Verses zum konstruktiven Prinzip wird, ist Endlers Vers meist ausladend; er arbeitet mit bewußt gesetzten Redundanzen und scheut nicht die rhetorische Floskel, die er nur manchmal ironisch braucht; fast alle Gedichte bestehen aus kreuzgereimten Vierzeilern. Vor allem in seinen Übertragungen älterer georgischer Poesie hat Endler wahre Geniestücke der Reimkunst geliefert; immer wieder ist erstaunlich, welche Wörter er aufeinanderklingen läßt, ohne daß Syntax, Stilebene oder poetische Logik verletzt würden. Endler ist 1930 in Düsseldorf geboren, 1955, als ihm in der Bundesrepublik ein Verfahren wegen Staatsgefährdung drohte, siedelte er in die DDR über. Hier ist er, nach dem 1964 publizierten, nicht gleichmäßig starken Gedichtband Kinder der Nibelungen, vor allem als Nachdichter, Herausgeber (die wichtige Anthologie In diesem besseren Land stammt von ihm und Karl Mickel), Essayist und Kritiker bekanntgeworden und hat durch polemische Attacken, zuletzt gegen eine selbstzufriedene Literaturwissenschaft, die die Dichtung schulmeisterte, anstatt sie zu analysieren, heftige Debatten ausgelöst. Die bald offene, bald verdeckte Aggressivität seiner Gedichte läßt sich schwer auf Begriffe bringen; oft ist da, wie im Gedicht „Dies Sirren“, im Hintergrund ein Kichern, ja Fratzenschneiden, zweite, dritte Bedeutungen springen aus den Formeln und drehen sie um, jemand pocht im Keller, seltsame Stimmen reden aus dubiosen Örtlichkeiten. ,,Cui bono ihr lieben Alterchen mit der Zirpstimm cui bono“, fragt der Dichter, scheinbar lieb und versponnen irrelevant, und zusammenstürzen ganze Gebäude einander haltender Scheinthesen, in denen die Frage „Wem nützt das?“ gleichfalls irrelevant, aber höchst real als Holzhammer gehandhabt wurde. Manchmal aber, wie in der Mandelstam-Adaption „Petrograd 1918“, erhebt sich die Stimme des Dichters zu großer, expressiv geladener Rhetorik, die eine Sekunde des Weltprozesses plötzlich leuchtend und dauernd macht.
Rainer Kirsch, 1973, aus Rainer Kirsch: Amt des Dichters, Hinstorff Verlag, 1979
Gespräch mit Adolf Endler
– Aus dem von Gregor Laschen und Ton Naaijkens während seines Aufenthalts in Bielefeld zu einem internationalen Schriftsteller-Symposium mit Adolf Endler im November 1980 geführten Gespräch werden hier die von ihm in Berlin ergänzten und überarbeiteten Aussagen zum eigenen Werk und damit zusammenhängenden poetologischen Fragen abgedruckt. –
Gregor Laschen und Ton Naaijkens: Was macht einen Endler-Text zum Endler-Text? – Dann: Würdest Du den Begriff „Temperament“ als Ordnungsprinzip Deiner Poesie gelten lassen? Du erwähnst diesen Begriff im Vorwort zu dem bei Rowohlt erschienenen Band Verwirrte klare Botschaften. Der Titel dieses Bandes erklärt das Gedicht zur Botschaft an den Leser, mit der Spezifizierung eines Widerspruchs: zugleich verwirrt und klar, also nicht aufgelöst, nicht harmonisiert. Würdest Du den Versuch einer Selbstauslegung wagen können, vielleicht an hand des Vierzeilers „Dies Sirren“? – Ferner: Seit einigen Jahren arbeitest Du an einem Roman mit dem Titel Nebbich und schreibst kaum noch Gedichte. Ist das nun – ähnlich vielleicht wie bei Franz Fühmann – eine endgültige Verabschiedung des Gedichts? Einige Passagen aus diesem Roman sind bereits publiziert worden hier und da – vor allem im Westen. Jüngste Gerüchte besagen, daß er einen Umfang von 8.200 Seiten erreichen soll, aufgeteilt in dreizehn Bücher. Was ist das für ein Roman, worum geht’s und wer ist sein Held Bubi Blazezak? – Dies noch: 1966 hast Du den Vierzeiler „Die Brennessel“ geschrieben, der sich auch als Hinweis auf deine Poetologie wie auf die gesellschaftliche Funktion verstehen läßt (und den 1974 in Halle erschienenen Gedichtband Das Sandkorn eröffnet):
Auf meinem Tisch liegt eine Brennessel bereit
So daß die Zähnchen meine Hand verbrennen können
Die schreibt O öde Zeit der mangelnden Gelegenheit
Erfreut beim Dichten sich die Finger zu verbrennen
Zum Schluß: Wie beurteilst Du die Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur durch die Literaturwissenschaft der DDR? Soweit ich sehe, sind Deine eigenen Gedichtbände in der DDR nicht rezensiert worden oder Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Analyse geworden?
Adolf Endler: Zur „Brennessel“: Es handelt sich offenkundig um eine der sanfteren Formen des Masochismus, die sich in dem Gedicht ausspricht, oder? Scheint der Verfasser des Vierzeilers nicht geradezu auf zarte Mißhandlung (durch die Brennesselblätter) angewiesen zu sein, um wenigstens einigermaßen bei Laune bleiben zu können? Ersatzbefriedigung übrigens nur, das wird ersichtlich! Bleiben die vitalisierenden, fröhlich stimmenden Schläge mit der scharfen Linealkante aus, ausgeteilt zum Beispiel von strenger Literaturpolizei, muß eben Pflanzliches her! Ohne Ironie: Stellen sich ganz und gar zufällig solcherlei bezugsreiche Bilder auch für Gedichte bereit, die eigentlich von etwas ganz anderem Mitteilung machen wollen? Es könnte durchaus sein – und ich habe es mich hin und wieder nicht ohne Anlaß gefragt –, daß die zu erkundende Endlersche Eigenart entscheidend mitbestimmt wird bis ins Lautliche hinein von einer Sinnlichkeit ein wenig absonderlicher Ausprägung, die es mir nicht gelang, im realen Leben genügend zur Geltung zu bringen…
Wenn ich mich nicht täusche, wolltet Ihr aber eigentlich etwas ganz anderes vernehmen, nämlich womöglich von Wirkungsabsichten des Dichters in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht, wie sie nun allerdings aus diesem Vierzeiler nicht sonderlich scharf heraustreten, es sei denn, man würde es als Funktion des Gedichts akzeptieren, daß es eine (möglichst schmerzhafte) Reaktion bewirke, auf den Dichter zurückschlage, ihm ein, wenn auch vielleicht nur wütendes, Echo beschere… Mein Gott, viel Worte über eine in fünfzehn Jahren kaum stärker gewordene Belanglosigkeit! Aber weiter: Das Gedicht beklagt im Grunde die Echolosigkeit des Dichters oder dieses einen Dichters nur, wahrscheinlich bedingt – weshalb sonst der Hinweis auf die „mangelnde Gelegenheit“, sich Schelte oder Prügel gar einzuhandeln? – durch administrative Beschneidung seiner Wirkungsmöglichkeiten o.ä. Das, wie gesagt, an sich nicht sonderlich gewichtige Ding ist insofern immer noch aktuell für mich, als es offenbar Dauergültigkeit haben soll in bezug auf mein Verhältnis zur Öffentlichkeit, zu den Medien in der DDR, die ich übrigens im Klappentext zu dem Gedichtband Das Sandkorn ausdrücklich nur um Kenntnisnahme meiner Gedichte, sondern auch, korrespondierend mit dem Vierzeiler, um Kritik gebeten hatte… Vergeblich! Denn es stimmt, wie phantastisch es auch klingen mag: Kein einziger meiner bislang drei Gedichtbände in der DDR, erschienen 1960, 1964, 1974, ist in der Neuen deutschen Literatur, der Zeitschrift des Schriftstellerverbandes, dem ich bis Mitte des vorigen Jahres angehört habe, einer Besprechung für Wert befunden worden, kein einziger in der Germanistenzeitschrift Weimarer Beiträge rezensiert worden, kein einziger in der Zeitschrift Sinn und Form, deren permanenter Mitarbeiter ich doch bin, kein einziger in unserer kulturpolitischen Wochenzeitschrift Sonntag – und es ist ja nicht schwer festzustellen, was für literarische Mediokritäten in jedem dieser vier Organe des langen und breiten und beinahe kontinuierlich einem inzwischen in bezug auf Lyrik fast wehrlos gewordenen Publikum präsentiert worden sind! Sagt das nicht eigentlich genug über die Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur bei uns? Das Gedicht, etwa anderthalb Jahre nach dem Erscheinen meines zweiten Gedichtbandes Die Kinder der Nibelungen geschrieben, ist aber nie so aufgefaßt worden, braucht auch nicht unbedingt so einfach aufgefaßt zu werden – es hat sicher mehrere Schichten –; es ist (legitim) verstanden worden als 1. bitterer Hohn auf Jahre, in denen im Grunde an Nackenschlägen für Poeten kein Mangel war, 2. ironische Rempelei gegenüber solchen Lyrikern, die „endlich ihre Ruhe haben wollten“ und die sich gewiß nach einer Weile über die Stille ringsum beklagt hätten… Wenn der Begriff „Dialektik“ nicht im Kreis der Autoren aus der Brecht-Schule von jedem simplen und ganz normal funktionierenden Wasserstöpsel für sich in Anspruch genommen worden wäre, dann würde man die vier Zeilen vielleicht einmal gern unter diesem Stichwort auseinanderschrauben wollen, die etwas merkwürdig ineinander verkeilten und solcherart möglicherweise auf ein Drittes, Viertes, Fünftes verweisenden, nur auf zwei Bedeutungen ganz bestimmt nicht, wie sie die inzwischen verstorbene Literaturwissenschaftlerin Edith Braemer 1966 in der berühmten Forum-Diskussion unsicher erwog, nämlich ob der Autor über solche Dichter spottet, die nicht imstande sind, die „Gelegenheit“ zu erkennen und zu ergreifen, oder ob er selbst keine aktuell-historische „Gelegenheit“ zu finden glaubt… Naja, und daraufhin war man sich wieder einmal im unklaren darüber, ob man die Verse ernstlich „als Satire positiv“ auffassen dürfe, also die sogenannte „positive Satire“ (was sie ja zweifellos sind, wer ist anderer Meinung?). Einer der seltenen Fälle, in denen wenigstens am Rande die Literaturwissenschaft etwas verlauten ließ über meine Produkte, weshalb ich Frau Braemer eigentlich dankbar sein müßte und es auch bin, zumal ich anerkenne, daß sie u.U. weitergekommen wäre, wenn sie die obligatorische Frage nach der „positiven Satire“ unterlassen hätte, die noch niemals einen literarischen Text erschlossen hat; und die Leipziger Literaturwissenschaftlerin hätte, natürlich, länger leben müssen… Denn „Die Brennessel“ ist neben dem blutig ernsten Gedicht „Die abgeschnittene Zunge“ das leichtfüßige der zwei frühesten Erzeugnisse einer etwas erwachseneren Phase nach meinem fünfunddreißigsten Lebensjahr; mit diesen Gedichten fängt etwas Neues für mich an, gekennzeichnet auch durch die Zwiegesichtigkeit, vielleicht zuweilen auch Zwielichtigkeit vieler Texte, zumindest der besseren, entfernt mit der Heineschen Ironie verwandt, um es paradox zu formulieren: man könnte von einem entschiedenen Bekenntnis zum Noch-Nicht-Entschiedenen des poetischen (!) Urteils sprechen, wobei das Gedicht als Gestalt allerdings nicht offen bleiben sollte, sondern durch- und ausformuliert…
Was den letzten Punkt betrifft: Man könnte geradezu von fleißig Gebautem sprechen – auch die Gründlichkeit und das stete Training des (durch was nur motivierten?) Zirkus-Artisten, Zirkus-Clowns lägen nicht fern! –, von einem Fleiß an sich, der mindestens zwei Gesichter hat, einmal als eine allerletzte Zuflucht der Utopie und der Hoffnung – sonst könnte man ja die Balancierstange hinfallen lassen! –, und dann das andere, fratzenhafte, mit jenem ersten narbenreich verwachsen, das eines höhnisch demonstrativen Fleißes („Lied und Fleiß“), zugewandt der moralischen, folglich auch arbeitsmäßigen Schluderei, Ungediegenheit, Korruption ringsum in der Welt (die für mich vor allem eben die DDR ist), sicher nicht allein subjektiv bedingt, „positive Satire“ gleichsam in der Gestalt des schwärzesten Schwarzen Humors, etwas vollkommen Rätselhaftes für unsere Literaturwissenschaftler – zuweilen auch für mich selbst –, und nicht nur deshalb, weil sie die wahren Dimensionen des Schwarzen Humors verkennen, wie sie – nach Breton – seit Swift und dem Marquis de Sade von Autoren wie Lautréamont, Alfred Jarry, Salvador Dalí (der mich als Schriftsteller wichtiger ist denn als Maler) aufgezeichnet worden sind. Statt an den späten Peter Altenberg, an Oskar Panizza, vieles von Thomas Bernhard, manches von Heiner Müller zu denken, fällt dem Literaturwissenschaftler bei uns im Zusammenhang mit dem Begriff des Schwarzen Humors mit Sicherheit vor allem böse Witzzeichnerei ein… Ich schweife ab, wie ich sehen muß, ich bin allzu rasch in einer scheinbar anderen Ecke als kurz zuvor: Indessen, das entspricht recht genau der zuweilen in plötzlichen Weit- und Hochsprüngen sich vollziehenden Entwicklung meines literarischen Tuns im letzten Halbjahrzehnt, die manchen hierzulande schockiert, obschon es sich vorangemeldet hatte lange vorher, z.B. auch in einer solchen Randerscheinung wie der „Brennessel“, wie auch die jähe Wegwendung von der Lyrik zur erzählenden, oder wie man das nennen will, Prosa in einer Reihe von Gedichten seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre immer wieder probiert, geübt wird, auf fast manische Weise übrigens; ja, im Zuge einer Manie – hier zum ersten Mal dieses einem Autor kaum dienliche (weshalb eigentlich nicht?) auch mir selber lange Zeit verhehlte Geständnis… (schöner Fleiß das!): und es arbeiten sich die Züge eines dritten Gesichts hervor… Aber Vorsicht!: Manie allein würde höchstwahrscheinlich ins Leere fahren lassen, es lassen sich höchstens durch sie bestimmte Eigentümlichkeiten meiner Produktion erklären, falls ich das Manische nicht im Eifer der Beichte sogar überakzentuiert habe, das Ganze nicht einmal ansatzweise, nicht die Grundtendenz – Du fragst nach Poetologie und gesellschaftlicher Funktion –, die nicht nur dem größten Teil meiner Gedichte, sondern auch fast allen meiner kritischen Essays, Polemiken, Invektiven seit langem die Richtung zeigt: Aus sehr komplexen, nicht am wenigsten sozialen Motiven heraus – um die herum ich oben ein paar hilflos-unbeholfene Kreise geschlagen haben – ist mein Schreiben seit längerem ein stetes Anschreiben gegen Festgeschriebenes geworden, und stamme es aus der eigenen Feder. (Es ist unschwer zu erkennen, daß im Festgeschriebenen, im Normativen, auch in neuerer normativer Ästhetik, in der Regel jene moralische und arbeitsmäßige Schluderei, Trägheit und Inkompetenz zum Zug kommt, von der ich gesprochen habe, auf ganz ähnliche Weise, wie der über unseren Häuserblock regierende sogenannte Hauswart seine Unfähigkeit und seine Faulheit durch eine Vielzahl von Verboten, Anweisungen, Rügen etc. illuminiert, vom schnüffelnden Herumgewiesele in den Hinterhöfen der „Asozialen“ zu schweigen.) Anschreiben gegen Festgeschriebenes, so oder ähnlich würde also mein Wappenspruch lauten, wenn der nicht auch schon wieder… Nun, lassen wir’s lieber. Eines aber muß wenigstens am Rand hinzugefügt sein: nämlich, daß es nicht nur eine ausschließlich auf bestimmte Aspekte des DDR-Lebens zielende Aktivität ist, die sich im Was und Wie meines Schreibens ausdrückt… Es sollte klar sein, daß ich andernorts, und zwar an jedem Punkt der Welt, den gleichen oder einen schärferen Wappenspruch erwägen würde, ebenso „schwarz“ oder „schwärzer“ schreiben würde wie hier und jetzt! (Zweifelt jemand daran…?) Der zu Trübsinn und Unkenteichen neigende Mensch, der ich bin, wäre ich überall geworden: Vorwerfen könnte man der DDR, daß sie nicht das einzige Land der Welt geworden ist, und sie hatte es sich anscheinend vorgenommen – übrigens ein wichtiger, Vieles erklärender Punkt auch beim Blick auf andere Autoren –, daß sie nicht zu dem Wunderland wurde, in dem so einer wie ich heute Hans im Glück wäre, hell- und nicht dunkelhaarig, immer potent und nicht nur immer im falschen Moment, der Typ des eleganten „Transatlantik“-Autors und nicht dieser Zerlumpte hier… Es sollte übrigens aufgefallen sein, daß ich den Begriff Dogmatismus vermieden habe; er kreuzt deshalb nicht auf, weil er z.Z. vor allem nach links und links ausschlägt und z.B. das exemplarisch „Festgeschriebene“ im Antikommunismus bzw. Antisowjetismus nicht automatisch mit-meint. Ich opponiere indessen gegen diese ständig zur Erstarrung und Abtötung des Lebens strebende Welt sicher auch aus „Veranlagung“, und früher versuchte ich meine für manchen Kenner meiner Lebensumstände ganz und gar unbegreifliche Produktivität zu erklären mit der etwas schnoddrigen Bemerkung, ich wäre eben so etwas wie ein Zigeunergeiger, grundmelancholisch und nicht kleinzukriegen, die Verkörperung der künstlerischen Lust an sich, ob auch die Wolken und ihre Schatten als Zeichen der Vergänglichkeit über ihn hinzogen, stets bereit, und sei es nur dem Wind, sein Liedchen zu fiedeln… (Das tapfere, gegen den mörderischen Angriff der Polizistenwelt und tapfer gegen die eigenen Tränen gerichtete „Hoch die Geige!“ aus einem Jugendgedicht Josef Roths, von ihm in Briefen zeitweise gern verwendet, hat mir im Augenblick eingeleuchtet, als ich es vor vielen Jahren entdeckte.) „Hoch die Geige!“ und losgespielt!, irgendetwas solchen Zigeunergeigerwesens muß wohl doch in mir herumgeistern, auf jeden Fall erheblich stärker als eine mir gelegentlich angedichtete Hinneigung zum Terrorismus anarchistischer Prägung; diesbezügliche Nachfrage kamen vor allem, als vor einigen Jahren ein ausländischer Kritiker mit großer Zielsicherheit aus dem ziemlich langen Gedicht „Das Sandkorn“ zwei Zeilen herausgeschnitten und seinem Artikel über mich als Motto vorangestellt hatte:
Etage um Etage durchwandre ich den Staat;
Dich trifft es heut, wen morgen, mein leises Attentat?
Glücklicherweise ist es Dir nicht eingefallen, mir diese sandkornartigen spitzen Verse vorzuhalten; sonst hätte nicht mich des langen und breiten mit der Terrorismus-Szene auseinandersetzen müssen.
Nein, man betrachte mich als Zigeunergeiger! Doch das wird Dir als Auskunft nicht genügen, wenn Du – um zu einer anderen Deiner Fragen zu kommen – wissen möchtest, was einen Endler-Text macht; wie alles, was bis jetzt gesagt worden ist, das spezifisch Endlerische weder im allgemeinen bezeichnet noch dessen Ingredienzen (Sprache, Bild, Rhythmus) im Detail. Das ist nicht zufällig so und entspricht einem lähmenden Unbehagen, das mich noch jedes Mal befallen hat wie Krätze, wenn mich jemand eine Frage dieser Art gestellt hat; und so eifrig ich immer dabei war, wenn über die Arbeiten eines Kollegen auch in solcher Hinsicht zu schreiben war – über das „Endlerische“ konnte ich mich eigentlich niemals anders als mit allgemeinen Floskeln ausdrücken, über diese mehr und mehr phantasmagorische Kunstwelt (die nichtsdestotrotz bis zum letzten Bild nicht nur passiv, sondern vermutlich auch aktio mit unseren gesellschaftlichen Realitäten korrespondiert), über die partiell auch manischen Züge – schrille Lautsprache, Zählwut, Grausamkeitsmomente – meiner Verse und poetischen Bilder, ich konnte es nur stotternd, also dann lieber nicht, und so bis heute, und so nicht aus Bescheidenheit. Wenn ich es trotzdem versucht habe, aus Verbundenheit mit dem Fragenden meistens, dann war mir hinterher ausnahmslos noch erheblich schlechter als zu Beginn eines solchen Versuchs, wirklich speiübel, auch Zornesausbrüche gegenüber dem Verführer sind vorgekommen, einmal sogar… Für mein Gefühl bin ich bereits mit dem, was ich so lang und breit noch nie vor Dir hingeblättert und vor Dir ausgebreitet habe, weit über die Grenzen des von meinem Gewissen Erlaubten hinausgegangenen – nicht wahr?, bekanntlich sind manche Autoren mit der glücklichen Begabung ausgestattet, über sich selbst und ihr eigenes Tun noch viel größere Dummheiten zu Papier bringen zu können als jeder andere, der sich so oder so ihrem Œuvre nähert. – Halte dies, bitte, nicht für den Anfang eines Phase der Rückzieher nach zerknirscht erkannter Überstrapazierung des inneren Kontos! Vielleicht liest Du gelegentlich die Selbst-Interpretationen blutjunger Debütanten in der NDL, die nicht im Traum zu fürchten scheinen, daß ein grotesker Widerspruch bestehen könnte zwischen Höhe des theoretischen Anspruchs und der eventuellen Nichtigkeit dessen, was ihn begründen soll, ihres Gedichts, – was mich betrifft, fürchte ich solchen Widerspruch permanent, wenn ich mich über meine eigenen Erzeugnisse äußere, und stimme – bei aller Faszination durch Poes „Philosophy of Composition“ – viellieber als manchen Gedicht-Technologen Old William Butler Yeats zu, der resigniert gesagt hat:
Stil ist etwas fast Unbewußtes. Ich weiß, was ich zu tun versucht habe, aber wenig davon, was ich getan habe.
(Zumindest in diesem Punkt sind unsere Schüler-Lyriker dem alten Iren weit überlegen…) Ich würde ihnen vorschlagen, sich ein paar Jahre lang als Kritiker zu betätigen! Aber es kommt noch etwas hinzu, was im Grunde jeder ernsthafte Schriftsteller ahnen müßte, ein Argument allgemeinerer Bedeutung. Neulich habe ich es endlich einmal ausgesprochen gesehen, weshalb einem dieses ganze Feld so unappetitlich vorkommt, und zwar in einem Essay von Dieter Wellershoff, im Literaturmagazin 11 veröffentlicht:
Wer schreibt, wer seine Phantasien preisgibt, hat sich immer wieder zu rechtfertigen. Und fast alle Rechtfertigungsversuche sprechen eine falsche Sprache. Es ist ein Element von Verrat oder Heuchelei darin aufspürbar, und zwar gerade dann, wenn die Versuche der Selbsterklärung und Rechtfertigung besonders gediegen und vernünftig klingen…
Vollkommen richtig! Und ist es das nicht immer, wenn man über die eigene Produktion schreibt – nämlich Rechtfertigungsversuch, so oder so? Und da Du, übrigens Blattschuß, ein Gedicht wie „Dies Sirren“ als Objekt einer Selbstinterpretation in Vorschlag bringst, kann es ja wohl gesagt sein, daß ich mich jählings in der Rolle der Liliputaner sehe und Dich als den „Ich“-Helden der verrückten vier Zeilen – auch wieder nur vier Zeilen, die mir allerdings ungleich wichtiger sind als „Die Brennessel“:
Und wieder dies Sirren am Abend. Es gilt ihnen scheint es für Singen Ich boxe den Fensterladen auf und rufe He laßt mich nicht raten Ihr seid es Liliputaner das greise Zwergenpaar van der Klompen Cui bono ihr lieben Alterchen mit der Zirpstimm im Dunkel cui bono.
Wodurch nur gilt so ein Text einem Rainer Kirsch z.B., der darüber etwas geschrieben hat, als besonders „endlerisch“? Auf jeden Fall ist so etwas nicht das Ereignis bewußter und ruhmgeiler Originalitätsplanung – wie es mir auch schon einmal unterstellt worden ist von einem Kritiker, der an sich gegen Zirkus, wenn es nur der sowjetische Staatszirkus ist, nichts einzuwenden hat (womit ich gesagt haben will, daß es sicher Clowneskes in meinen Gedichten gibt, und gewiß nicht zu knapp, aber findet man etwas Anonymeres im Zirkusprogramm als den Clown?: Darüber könnte man stundenlang meditieren!) Der Text kommt aber in der Tat der besonderen ästhetisch-geschmacklichen Vision des Autors sehr nahe, einer individuellen, schwer artikulierbaren Vorstellung, über die wohl jeder ernst zu nehmende Dichter verfügt und die für ihn in der Regel in einigen wenigen Gedichten oder auch nur ein paar Verszeilen annähernd ausgedrückt ist (Benns „sechs“ oder „sieben“ Gedichte, der Becher die Wichtigkeit des lyrischen „Helden“ gegenüberstellte, wie er sich in einem möglichst riesigen Gesamtwerk ausprägen müßte, wobei man vielleicht an Goethe zu denken hat – und wenn dann noch?) In diesem Sinn ist mir von allen meinen Gedichten das winzige „Dies Sirren“, 1971 in einem für die Dichtung des Landes extrem schwarzen Jahr, für eine Weile als das eigentliche erschienen. Leider habe ich für meine Zuneigung zu diesem Gedicht noch bei niemandem Unterstützung gefunden – außer entschieden überrascht bei dem einen, bei Rainer Kirsch –, nicht einmal bei den Liliputanern. Allerdings bleibt es auch in den Äußerungen Kirschs für eine Rundfunkstation, nachzulesen in seinem Essayband Das Amt des Dichters, bei der Wiedergabe des – wie es scheint: beunruhigend-seltsamen – Eindrucks, wenn er den Endler-Sound zu greifen bekommen will:
Die bald offene, bald verdeckte Aggressivität seiner Gedichte läßt sich schwer auf Begriffe bringen; oft ist da, wie im Gedicht „Dies Sirren“, im Hintergrund ein Kichern, ja, Fratzenschneiden, zweite, dritte Bedeutungen springen aus den Formeln und drehen sie um…
Undsoweiter. Das entspricht in manchem, wie ich jetzt sehe, den Überlegungen, wie sie sich mir im Zusammenhang mit der Frage nach der „Funktion“ meiner Gedichte und im Anschluß an „Die Brennessel“ eingestellt haben, ohne daß mir Kirschs Äußerungen im Zusammenhang mit „Dies Sirren“ präsent waren – schon recht kurios!, nur: sehr viel weiter als die meinen führen Kirschs Gedanken auch nicht, der z.B. doch über Karl Mickel nahezu Endgültiges zu Papier gebracht hat; wenn es um Endler geht, hat er offensichtlich ebenso große Schwierigkeiten, seinen Eindruck und dessen Bestandteile nüchterner Prüfung zu unterziehen, wie Endler selber…
Doch plötzlich fällt mich eine Erinnerung an, die vielleicht das eine oder andere erhellt: nämlich daß eine meiner allerfrühesten Erfahrungen kurz nach dem Krieg, als ich fünfzehn, sechzehn, siebzehn war, ein selbstverständlich ganz naiv begriffener und undifferenzierter Surrealismus war, und daß ich mit kindlich-knabenhafter Beflissenheit die „Ästhetik des Paradoxen“ – bekanntgemacht in Bruchstücken durch Leute wie Hübner und Klünner in Berlin und der Zeitschrift athena – tatsächlich in die poetische Tat umsetzen wollte: ins Gedicht und in kleine spontantraumartige Prosa; es wurde sicher ein ganzes Bündel von Gedanken und Gedichten, denn ich schrieb so wild begeistert, wie dann lange nicht mehr – das alles hat sich leider in alle Winde verloren, einen dieser Texte wollte Alfred Döblin in seiner Zeitschrift Das Goldene Tor veröffentlichen, einen anderen in Die literarische Revue, die meiner Meinung nach beste Literaturzeitschrift jener Nachkriegsjahre. Ich weiß noch, wie diese Zeitschriften nach der „Währungsreform“ eine nach der anderen weg waren, erst die Literarische Revue, dann die athena, schließlich auch das Goldene Tor – es kam und wucherte und schwelte etwas hoch stattdessen für eine Reihe von Jahren, das mir allein schon meine Instinkte als etwas höchst Unsympathisches, ja, Ekles signalisierten, zwar weniger die eigentliche „Blubo“-Literatur – aber sie auch, vielleicht dann nie wieder so kompakt, wenn auch nicht in den Zentren literaturverbreitender Aktivität –, sondern auch vor allem die ganze drittrangige literarische Sippschaft, die das Exil verschmäht hatte und eine meistens reichlich dubiose „Innere Emigration“ behauptete und nachträglich mystifizierte – die „Restauration“ hatte eingesetzt: auch das gehört zum Bild, dieses zunächst nichts als verwirrende und überhaupt nicht zu kapierende Erlebnis, wie es zum Bild gehört, damals Stephan Hermlin, Ernst Bloch, Hans Mayer und Hunderte anderer Intellektueller, die schon im Westen Quartier bezogen hatten, in die DDR gingen; diesem großen Schwung folgte ich mit einer kleineren Gruppe, Peter Hacks bei ihr, um 1954/55 eigentlich nur nach. So also der Beginn, und als Beginn des Beginns ein Etwas, das mir als „Surrealismus“ galt und das ich dann, im wesentlichen politisch motiviert, zugunsten eines wahrscheinlich dann doch schimärischen Realismus weit von mir tat (schimärisch im Hinblick auf die Möglichkeiten meiner Begabung, falls sie vorhanden war), dem ich dann nur ein paarmal und ohne den Gedanken an Veröffentlichung untreu wurde, es brach einfach los und ließ sich nicht aufhalten etwa alle sieben, acht Jahre für wenige Stunden nur, ehe ich mich dann doch im Alter von sechsundvierzig dem wieder mit allen Sinnen und Nerven zuwandte, was in den besseren meiner Gedichte schon seit der Mitte der sechziger Jahre zu „flimmern“ beginnt, ohne daß ich jener frühesten Zeit auch nur beiläufig gedachte…: Mit welcher Rigorosität ich sie verdrängt hatte, führt mir die Antwort auf eine Umfrage der Weimarer Beiträge vor Augen, in der ich u.a. Auskunft gebe über meine literarische Herkunft, zwar bereits provokanterweise den damals in Vergessenheit geratenen österreichischen Dichter Theodor Kramer als den mir „liebsten“ pries – Kramer war wirklich mein lebensrettendes Manna durch viele Jahre –, aber dann doch dem aufmüpfigen Bekenntnis zum Abseitigen hinzufügte die Versicherung:
Die Grundentscheidung war aber bereits vor meinem zwanzigsten Lebensjahr gefallen, nach der richtungsbestimmenden Begegnung mit dem Realismus, den die deutsche Exillyrik in den dreißiger Jahren zumal ausgebildet hat: Becher, Hermlin, weniger Brecht.
Heute weiß ich: Die Grundentscheidung war schon früher gefallen, wenn auch für ein halbes Menschenalter und mehr suspendiert; 1971 war die Erinnerung an sie ausgelöscht, die Begegnung mit einer künstlerischen Welt – übrigens waren Hermlins Gedichte in all den Jahren immer noch auf eigentümliche Weise Brücken zu ihr –, mit einer Poetologie und einer in Bruchstücken greifbar gewordenen künstlerischen Praxis, die mich tief getroffen hatte! Trotzdem würde ich nicht von Verrat sprechen, sondern von achterbahnähnlich-zwingenden Irrfahrten bis zu genau dem Punkt, von dem aus man in einem Satz in die Geisterbahn hinüberspringen, zurückspringen konnte – mir kommt alles ganz richtig vor: prächtiges Timing! Ein bißchen mag, was mit mir geschehen ist und was ich geschehen machte, an die Entwicklungskurve Erich Arendts erinnern; übrigens auch er stets offen für seine älteren Gedichte, auch Nachdichtungen, stets auf dem Quivive, ob nicht Verbesserungen, Veränderungen sie weiter heben könnten, auch er ein Feind des Festgeschriebenen in repräsentativer Weise trotz des ungemein Geprägten seiner Gedichte, ein Vorbild in dieser Beziehung auch dann, wenn man von gänzlich anderem Habitus ist, nicht nur wegen des Altersunterschiedes; und auch bei Arendt ist Wesentliches in den neueren Poesien weiterhin mit all den Zwischenstationen verknüpft, die einen – u.U. mit Gewalt – festhalten wollten, von denen man sich – u.U. mit dem Beil – loslösen mußte… Und es ist auch in meinen Gedichten, schwerlich vergleichbar ansonsten mit denen Arendts, auf modifizierte Weise Vieles, sehr Vieles anwesend, was in früheren Phasen erarbeitet, eingeübt, letztendlich gelebt wurde, und zwar nicht als etwas Störendes vorhanden, in der nächsten Zeit, bitte, konsequenter noch auszuscheiden, sondern als konstituierende Energie in dem neu angefangenen literarischen Gebäude, es bräche zusammen oder würde ganz einfach nichts ohne diese Element… Auf eben diese zielt Deine Frage nach der Bedeutung des „Temperaments“ für mich (was mag das von mir so leichtsinnig ins Spiel gebrachte wohl sein?), nach dem Begriff „Temperament“ als eventuellen Ordnungsprinzip meiner Poesie; sie ließe sich, wie der Blinde mit dem Krückstock sieht, sogleich wieder zu einer weiteren Abschweifung bis hin zum Surrealismus benutzen, womöglich sogar bis hin zur „ecriture automatique“, sie könnte aber auch und mit größerem Recht zu der zweiten Frage führen, auf welche Weise sich denn dieses seltsame „Temperament“ (eins, das zum Ordnungsprinzip zu werden in der Lage scheint), mit welchen Mitteln es sich Ordnung verschafft. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Deiner Frage und der einer hiesigen Studentin aus Jena, die mich nach der Bedeutung der „rhetorischen Floskel“ in meinen Gedichten gefragt hat in bezug auf ein Gedicht, das eine Verabschiedung bestimmter Motive, der Kindheitsmotive, darstellt, sich aber schamhafterweise als Angriff gebärdet – „Die Flagge der Kindheit“ –, womit wir uns ganz schön weit von Breton entfernt hätten und plötzlich bei dem Begriff der „Gestik“ und der „gestischen Schreibweise“ wären und ganz schön nahe bei Bertolt Brecht, nahe auch bei Majakowski und anderen Showmen der Poesie. Gebärden, als etwas Schauspielerhaftes beziehungsweise akzentuiert Vorgeführtes verstanden, gehören tatsächlich schon lange zu meinem, ach, Instrumentarium, seit dem Band Das Sandkorn jedoch, der 1975 erschien und Gedichte seit 1965 enthält, in besonders bemerkenswertem Umfang; mein Freund B.K. Tragelehn, der Regisseur, fand in diesem Zusammenhang, meine Gedichte hätten etwas von den Bewegungen des sog. Ausdruckstanzes, was ich sofort akzeptiert habe. (Dabei bin ich ganz gewiß kein „temperamentvoller“ Tänzer beim Schwoof; ich kann überhaupt nicht tanzen im üblichen Sinn; hin und wieder tanze ich in meiner Bude, wenn ich allein bin und unbeobachtet, mit den skurrilsten Verrenkungen wild vor mich hin…) Die besondere Ausprägung hat das bei mir vermutlich erfahren u.a. nach der Beschäftigung nicht mit Brecht oder Majakowski, sondern mit etwas viel Älterem, etwas sehr direkt Gestischem, nämlich Bettelnden (Dankenden, Schmähenden), nach dem Studium mittelalterlicher Vagantendichtung, stets an der Grenze der guten Sitten und sozusagen körperlich im Hinblick auf den Adressaten operierend. Die Monate der Beschäftigung mit den verschiedenen Ausgaben Karl Langoschs – in diesem Fall war ich der Literaturwissenschaft, eben diesem fast schon trockenen Erforscher der Vagantenpoesie, über die Maßen dankbar –, diese Wochen und Monate kann ich zeitlich ziemlich genau bestimmen, weil es die gleichen in den Jahren 64 und 65, waren in denen Mickel und ich an unserer Anthologie der DDR-Lyrik arbeiteten, weil in die verschiedenen Bücher Langoschs, die ich besitze, vorne die Namenszüge des ehemaligen Besitzers hineingeschrieben sind. Karl Mickel, der sonst niemals Bücher verschenkt, warf sie mir damals mit einer jähen Geste geradezu an den Kopf, als er bemerkt hatte, daß sie für mich und mein Schreiben wichtig werden könnten…
Nun gut, „rhetorische Floskel“ – auch Rainer Kirsch kommt zu diesem Begriff –, aber dann natürlich auf keinen Fall bierernst und freiligrathisch-pathetisch, sondern sich selber in ihrer Vorläufigkeit und Beschränktheit und Uneigentlichkeit u.U. sarkastisch denuzierend, in Form einer Heine-nahen Ironie, in Gestalt auch clownesker Übertreibung etwa, die dann u.U. schon bald ins Absurde weist, also in die Richtung meiner gegenwärtigen Phase – Alfred Jarry hat einige Schuld an dieser Wendung: ein Schweben und Weben und Leben der Sprache, der Figuren begann, das mit dem kläglichen Ausgangspunkt oft nur noch schwer in Verbindung gebracht werden kann, ehe ich das selbst auch nur ahnungsweise begriff – und meine Beschreibung dokumentiert meine anhaltende Hilfslosigkeit angesichts des Vorgangs –, hat Elke Erb das wahrgenommen und einen Begleittext zu neuen Gedichten von mir (für eine jugoslawische Zeitschrift verfaßt) ganz schlicht und einfach „Umschwung“ genannt, was das Wort „Umschlag“ assoziieren läßt, den Umschlag in eine neue Qualität. Sie spricht von „lebendigem Blühen“, was in diesem Zusammenhang keine antiquierte Floskel ist, sie bemerkt aber auch: „Vorher… muß Winter gewesen sein.“ Doch solches Blühen, das dann, von einem bestimmten Augenblick an, geradezu tropisch zu wüten begann, dies Miteinander-Ins-Gespräch-kommen divergierendster sprachlicher, motivischer, gestischer Elemente ließ sich in Gedichten, so habe ich es wenigstens erlebt, mit Gedichten allein nicht mehr fassen… Fast von einem Tag zum anderen setzte Ende 1966, wozu auch aktuelle Schocks hilfreich beitrugen, ein Zustrom von Plänen und Notizen erzählender Prosa ein, die sich alsbald zu der festen Vorstellung eines montageartigen Gebildes verdichteten, das ich provisorisch „Roman“ nenne und von dem inzwischen einige Stücke in Zeitschriften oder Anthologien – auch in der Berliner Handpresse in geringer Auflage – erschienen sind…
Du fragst, ob dieser so schroffe Übergang zur Prosa, der Gedanke muß sich einstellen, gleichzeitig eine Verabschiedung des Gedichts bedeute, ähnlich wie es vor Jahren bei Franz Fühmann geschehen sei. Zugegeben: Es hätte wirklich leicht passieren können, daß ich der Lyrik für den Rest meiner Zeit Ade gesagt hätte, ja, es war mir für eine Weile zum selbstverständlichen Gedanken geworden, daß meine sämtlichen literarischen Energien, die lyrischen wie übrigens auch die essayistischen, von der Arbeit an einem blutsaugerischen Roman, der umgekehrt an mir und mit mir arbeitete, absorbiert werden würden; für Wochen, Monate, halbe Jahre ist es auch so… Die surrealen, schwarzhumorigen, phantasmagorischen Gedichte, die unter der Überschrift „Aus den Heften des Irren Fürsten“ zusammengefaßt sind und die sich vor etwa zwei Jahren noch einmal intensiv zwischen mich und die Prosa drängten, waren mir einleuchtend als Schlußstücke einer durch mehr als dreißig Jahre gehenden (natürlich gleichermaßen mit der Realität verbundenen wie imaginierten) Lebensgeschichte in Versen, wenn man es so vereinfacht bezeichnen darf. (Als Beinahe-Gesammelte-Gedichte, insofern vollständiger als das Rowohlt-Buch Verwirrte klare Botschaften, soll der Komplex Mitte 1981 in hoher Auflage und zu geringstem Preis in Leipzig als Reclam-Buch erscheinen, angekündigt vom Verlag als „eine vorläufige Bilanz im 50. Lebensjahr“, der Titel, von dem ich nicht geglaubt habe, daß man ihn akzeptieren würde, anspielungsdick: Akte Endler.) Trotzdem habe ich seither wieder eine Reihe von Gedichten geschrieben, vielleicht ein wenig zu sehr mit der linken Hand und beiläufig, was strengere Lyriker verabscheuenswert finden werden, aber immerhin… Ein rätselvoller Zigeunergeiger wie ich hört einfach nie ganz auf zu geigen! Außerdem dürfte sich auch die erzählende Prosa, wenn man schärfer hinblickt, über weite Strecken als die eines Lyrikers erweisen, was nun den richtig echten Romanciers wieder ein Greuel sein mag – so verdirbt man sichs heiter mit allen! Indessen handelt es sich keineswegs um sogenannte Kleine Lyrische Prosa (o.ä.), sondern, wie Dir Deine Gewährsleute richtig gemeldet, um etwas ausgesprochen Kolossales in dieser Branche! Daß diese neue „Menschliche Komödie“ so knappe Zeit vor dem Weltuntergang in Angriff genommen wird, das läßt sich mit rationalen Gründen allerdings kaum in Einklang bringen, so wenig wie die unerschütterbare Sicherheit der Künstler schlechthin, besser: den immer noch dominierenden konventionelleren Typs, mit Vernunftgründen erklärt werden kann, daß eines zweifelsfrei auch den schlimmsten Weltuntergang und BIG BANG überdauern wird: Die Kunst… In gewisser Weise ist das intendierte Werk – sein Titel: Nebbich – nicht denkbar ohne alsbaldigen Weltuntergang, ja, müßte wahrscheinlich, wenn es anders kommt als von Günter Kunert prophezeit, irgendwann scheitern! (Weitere Ausführungen zu diesem Punkt möchte ich mir gerne verkneifen: Du wirst mich verstehen.) Über den sittlichen Gehalt dieser literarischen Großunternehmung, die bei weiterem Ausbau sogar konzernhafte Züge annehmen mag, und über die zahlreichen Mißverständnisse, denen er ausgesetzt ist, habe ich mich schon einige Male geäußert, am entschiedensten in Neue Nachricht von Nebbich. Eine Richtigstellung, an die Öffentlichkeit gebracht von der Berliner Handpresse. Eine einzige kennzeichnende Fehlinterpretation ist bis jetzt allerdings unerwähnt geblieben, obwohl es die am weitesten verbreitete war oder ist, nämlich die in den Berliner Stadtbezirken Mitte und Prenzlauer Berg von Seemanns- zu Seemannskneipe weitergegebene Behauptung, der Autor wäre sozusagen der „Charles Bukowski der DDR-Literatur“ – umgekehrt wird wohl ein Schuh daraus: Charles Bukowski, der einzige Schriftsteller des Erdballs, dem es gelungen ist, sich hauptsächlich durch regelmäßige Bekanntgabe seines jeweiligen Bierverzehrs ein weltweites Publikum zu er-rülpsen, dieser Bukowski würde sich glücklich schätzen dürfen, wenn man ihn in seiner Heimat als den „Adolf Endler der USA“ belobigen würde: Daran zweifelt in meinem engeren Freundeskreis keiner! Eigentlich ist die unappetitliche Geschichte, die Ungediegenheit des derzeitigen Weltzustandes schrill beleuchtend, schon wieder nur mit einem ganzen langen Romankapitel als Antwort, Aufklärung, Richtigstellung unwirksam zu machen – und so entsteht es wirklich zu großen Teilen, mein Romanwerk Nebbich, ständig weiterbefördert durch die Verfolgungen, Widerstände, Schmähungen, grauenhaften Lobhudeleien, denen es ausgesetzt ist, undsoweiterundsofort…: ein wahrer Teufelskreis, der wohl in dreizehn, nach neueren Meinungen, neunzehn Bänden schwerlich auszuschreiten sein wird, wie auch die Weite und Vielfalt der erotischen Abenteuer meines Helden Bubi Blazezak nicht, des ersten Erotomanen der Gegenwart in der DDR-Literatur; gewiß zuweilen ärgerniserregend, dieser Blazezak, aber kein schlechter Kerl (und das vor allem ist es, was immer neu nachgewiesen werden muß von seinem Biographen, von mir.) – Ich bin, was man meiner Jugend als Romanautor zugute halten wird, in den Tonfall meiner Erzähl-Literatur verfallen: Auch ein Interview wie dieses könnte ja angesichts der Weitmaschigkeit von Nebbich ohne große Schwierigkeit zu einem Romankapitel werden wie beinahe alles… Mehr soll heute noch nicht verraten werden!
Jedenfalls ist es eine Prosa, welche die in der DDR geltenden Konventionen in bezug auf erzählende Literatur weit hinter sich läßt, wird mir also neuerlich Ärger bescheren. Doch vielleicht will auch der Roman, an dem Karl Mickel schreibt, in eine ähnliche Richtung, wenn auch nicht thematisch. (Volker Braun, der einiges aus Mickels Roman kennt, ist dieser Meinung und findet erstaunliche Parallelen, Volker Braun, der übrigens wohl auch selber in dieser feuergefährlichen Ecke an neuen belletristischen Flugkörpern herumbastelt, die zu dem gehören mögen, was mit dem weiten Begriff „Absurde Literatur“ gekennzeichnet wird, weit hinter sich lassend auch das, was in den siebziger Jahren in der DDR als sogenannte „Neue Phantastik“, freizügigeres Spiel mit der Phantasie, aufkreuzte – bekanntester Name: Irmtraud Morgner.) Möglicherweise sind wir überhaupt viel mehr, als wir Vereinzelten denken – in der letzten Zeit ist mir diese vage Vermutung fast zur Gewißheit geworden. Am Rande: Der Vergleich mit Franz Fühmanns Abschied von der Poesie vor nun zwanzig Jahren – wenigstens so weit es Veröffentlichungen eigener Gedichte, nicht von Nachdichtungen angeht – schiene mir auch dann nicht sehr sinnvoll, wenn ich wirklich keinen einzigen Vers mehr aufs Papier brächte: Diese Prosa Fühmanns, obwohl mit verwandter moralischer Problematik beschäftigt, wirkt nicht entfernt so direkt aus seinen Gedichten heraus entwickelt, wie es bei mir der Fall ist.
Adolf Endler, Deutsche Bücher, Heft 1, 1981
Auskunft in eigener Sache
– Fragen an den Verfasser. –
Was macht einen Endler-Text zum Endler-Text? – Dann: Würdest Du den Begriff ,Temperament‘ als Ordnungsprinzip Deiner Poesie gelten lassen? Du erwähnst diesen Begriff im Vorwort zu Deinem bei Rowohlt erschienenen Band Verwirrte und klare Botschaften!. Der Titel dieses Bandes erklärt das Gedicht zur Botschaft an den Leser, mit der Spezifizierung eines Widerspruchs: zugleich verwirrt und klar – also nicht aufgelöst, nicht harmonisiert? – Dies noch: 1966 hast Du den Vierzeiler „Die Brennessel“ geschrieben, der sich auch als Hinweis auf Deine Poetologie wie auf die gesellschaftliche Funktion verstehen läßt (und den 1974 in Halle erschienenen Gedichtband Das Sandkorn eröffnet):
Auf meinem Tisch liegt eine Brennessel bereit
So daß die Zähnchen meine Hand verbrennen können
Die schreibt O öde Zeit der mangelnden Gelegenheit
Erfreut beim Dichten sich die Finger zu verbrennen.
Zum Schluß: Wie beurteilst Du die Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur durch die Literaturwissenschaft der DDR? So weit ich sehe, sind Deine eigenen Gedichtbände in der DDR nicht rezensiert worden und Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Analyse geworden?
Adolf Endler: Zur „Brennessel“: Es handelt sich ja offenkundig um eine der sanfteren Formen des Masochismus, die sich in dem Gedicht ausspricht, oder? Scheint der Verfasser des Vierzeilers nicht geradezu auf zarte Mißhandlung (durch die Brennesselblätter) angewiesen zu sein, um wenigstens einigermaßen bei Laune bleiben zu können? Ersatzbefriedigung übrigens nur, das wird ersichtlich! Lassen die vitalisierenden, fröhlich stimmenden Schläge mit der scharfen Linealkante auf sich warten – oh, ich werde sie schon noch zu spüren bekommen! –, ausgeteilt zum Beispiel von strenger Literaturpolizei, dann muß eben Pflanzliches her! Vielleicht ist das mit weniger Ironie gesagt, als es scheint! Stellen sich eigentlich ganz und gar zufällig solcherlei bezugsreiche Bilder auch für Gedichte bereit, die eigentlich von etwas anderem Mitteilung machen wollen? Es könnte durchaus sein – und ich habe es mich hin und wieder nicht ohne Anlaß gefragt –, daß die zu erkundende Endlersche Eigenart entscheidend mitbestimmt wird bis ins Lautliche hinein von einer Sinnlichkeit ein wenig absonderlicher Ausprägung, die es mir nicht gelang, im realen Leben genügend zur Geltung zu bringen… (Aber das kann ja noch kommen! – Was ich nicht als Drohung oder Warnung aufzufassen bitte! Neulich hat unser allmählich seinem achtzigsten Geburtstag entgegenschreitender Erich Arendt bei einer Diskussion in der Evangelischen Akademie – ! – zur allgemeinen Befriedigung des nicht kleinen Publikums erklärt, daß es in erotischer bzw. sexualer Hinsicht für ihn erst jetzt so richtig interessant zu werden beginne; das zu hören von einem, der als Experte auf diesem Gebiet gelten kann!)
Wenn ich mich nicht täusche, wolltet Ihr aber letztendlich etwas ganz anderes vernehmen, nämlich womöglich von Wirkungsabsichten des Dichters in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht, wie sie nun allerdings aus diesem Vierzeiler nicht sonderlich scharf heraustreten, es sei denn, man würde es als Funktion des Gedichts akzeptieren, daß es eine (möglichst schmerzhafte) Reaktion bewirke, auf den Dichter zurückschlage, ihm ein, wenn auch vielleicht nur wütendes, Echo beschere… (Mein Gott, wie viele Worte über eine in fünfzehn Jahren kaum bedeutender gewordene Nebensächlichkeit!) Aber weiter: Der Vierzeiler beklagt im Grunde die Echolosigkeit poetischer Bemühung oder diejenige dieses einen Dichters nur, wahrscheinlich bedingt – weshalb sonst der Hinweis auf die „mangelnde Gelegenheit“, sich Schelte oder gar Prügel einzuhandeln? – durch administrative Beschneidung seiner Wirkungsmöglichkeiten o.ä. Das, wie gesagt, an sich nicht sonderlich gewichtige Ding ist insofern immer noch aktuell, als seine „Aussage“ offenbar Dauergültigkeit haben soll in bezug auf mein (durch Verbot wie Totschweigen gestörtes) Verhältnis zur Öffentlichkeit, die ich übrigens im Klappentext zu dem Gedichtband Das Sandkorn ausdrücklich nicht nur um Kenntnisnahme meiner Gedichte, sondern auch, korrespondierend mit dem Vierzeiler, um Kritik gebeten hatte… Vergeblich! Denn es stimmt, wie phantastisch es auch klingen mag: Kein einziger meiner bislang drei Gedichtbände in der DDR, erschienen 1960, 1964, 1974, ist in der Neuen Deutschen Literatur, der Zeitschrift des Schriftstellerverbandes, dem ich bis Mitte des vorigen Jahres angehört habe, einer Besprechung für wert befunden worden, kein einziger in der Germanistenzeitschrift Weimarer Beiträge rezensiert worden, kein einziger in der Zeitschrift Sinn und Form, deren permanenter Mitarbeiter ich doch bin (besser: war), kein einziger in unserer kulturpolitischen Wochenzeitung Sonntag usw. – und es ist ja nicht schwer festzustellen, was für literarische Mediokritäten in jedem dieser Organe des langen und breiten und beinahe kontinuierlich einem inzwischen in bezug auf die Lyrik fast wehrlos gewordenen Publikum präsentiert worden sind! Sagt das nicht eigentlich genug über Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur in der DDR? Zumal es ganz bestimmten anderen Autoren wie Elke Erb kaum anders ergeht? Zu diesem Thema sollten sich in Zukunft die bedeutenden Gisela Steineckert oder Uwe Berger äußern!
„Die Brennessel“, etwa anderthalb Jahre nach dem Erscheinen meines Gedichtbandes Die Kinder der Nibelungen geschrieben, ist indessen nie so aufgefaßt worden, braucht auch nicht unbedingt so einfach aufgefaßt zu werden – jeder Text hat ja mehrere Schichten –; es ist (legitim) verstanden worden als 1. bitterer Hohn in bezug auf Jahre, in denen im Grunde an Nackenschlägen für Poeten kein Mangel war; 2. als ironische Rempelei gegenüber solchen Lyrikern, die „endlich ihre Ruhe haben wollten“ und die sich gewiß nach einer Weile über die ersehnte Ruhe ringsum heulend beklagt hätten… Wenn der Begriff „Dialektik“ im Kreis der Autoren aus der Brecht-Schule nicht für jeden simplen und ganz normal und geradlinig funktionierenden Wasserstöpsel in Anspruch genommen worden wäre, dann würde man die vier Zeilen vielleicht einmal gern unter dem Patronat dieses Begriffs auseinanderschrauben wollen (wie manches andere aus meiner „Werkstatt“ auch), diese etwas merkwürdig ineinander verkeilten und solcherart möglicherweise auf ein Drittes, Viertes, Fünftes verweisenden – nur auf zwei Bedeutungen ganz bestimmt nicht, Bedeutungen, wie sie die inzwischen verstorbene Literaturwissenschaftlerin Edith Braemer in der berühmt-berüchtigten Forum-Diskussion von 1966 unsicher erwogen hat, nämlich „ob der Autor über solche Dichter spottet, die nicht imstande sind, die ,Gelegenheit‘ zu erkennen und zu ergreifen oder ob er selbst keine aktuell-historische ,Gelegenheit‘ zu finden glaubt…“ – Na ja, und daraufhin war man sich wieder einmal im unklaren darüber, ob man die Verse ernstlich „als Satire positiv“ auffassen dürfe, also als sogenannte „positive Satire“ (sind sie’s denn nicht?). „Positiv – ja oder nein?“ Einer der ganz seltenen Fälle, in denen wenigstens am Rande die Literaturwissenschaft/Literaturkritik der DDR etwas verlauten ließ über meine poetischen Produkte, weshalb ich Frau Braemer (nicht die Schlechteste übrigens) eigentlich hätte dankbar sein müssen; und ich bin es auch, zumal ich erkenne, daß sie u.U. weitergekommen wäre, wenn sie die obligatorische stalinistische Frage nach der „positiven Satire“ unterlassen hätte, eine Frage, die noch niemals einen literarischen Text erschlossen hat. Die Leipziger Literaturwissenschaftlerin hätte länger leben müssen… Denn „Die Brennessel“ ist neben dem blutig-ernsten Gedicht „Die abgeschnittene Zunge“ das leichtfüßige der zwei frühesten Zeugnisse einer etwas „erwachseneren“ Phase nach meinem fünfunddreißigsten Lebensjahr; mit diesen Gedichten fängt etwas Neues für mich an, gekennzeichnet auch durch die Zwiegesichtigkeit, vielleicht zuweilen auch Zwielichtigkeit vieler Texte, zumindest der besseren, entfernt mit der Heineschen Ironie verwandt; um es paradox zu formulieren: Man könnte von einem entschiedenen Bekenntnis zum Noch-nicht-Entschiedenen des poetischen – nur des poetischen? – Urteils sprechen, wobei das Gedicht als Gestalt allerdings nicht offen bleiben, sondern durch- und ausformuliert sein sollte.
Was den letzten Punkt betrifft: Man könnte geradezu von fleißig Gebautem sprechen (auch der Gedanke an die Gründlichkeit und das stete Training des, durch was nur motivierten?, Zirkus-Artisten, Zirkus-Clowns liegt nicht fern), von einem Fleiß an sich sogar, der mindestens zwei Gesichter hat, einmal als eine allerletzte Zuflucht der Utopie und der Hoffnung – sonst könnte man ja die Balancierstange hinfallen lassen! –, und dann das andere, fratzenhafte, mit jenem ersten narbenreich verwachsen, das Gesicht eines höhnisch demonstrativen Fleißes („Lied vom Fleiß“), präsentiert der moralischen, folglich auch arbeitsmäßigen Schluderei, Ungediegenheit, Korruption ringsum in der Welt (die für mich vor allem eben die DDR bleibt); sicher nicht allein subjektiv bedingt diese Fratze, „positive Satire“ gleichsam in Gestalt des schwärzesten Schwarzen Humors, etwas vollkommen Rätselhaftes, muß ich schließen, für unsere Literaturwissenschaftler – zuweilen auch für mich selbst –, und nicht nur deshalb, weil sie die wahren Dimensionen des Schwarzen Humors verkennen, wie sie – nach Breton – seit Swift und dem Marquis de Sade von Autoren wie Lautréamont, Alfred Jarry, Salvador Dalí (der mir als Schriftsteller wichtiger ist denn als Maler) aufgezeigt worden sind… Statt an den späten Peter Altenberg, an Oskar Panizza, vieles von Thomas Bernhard, manches von Heiner Müller zu denken, fällt dem Literaturwissenschaftler bei uns im Zusammenhang mit dem Begriff des Schwarzen Humors mit Sicherheit vor allem böse Witz-Zeichnerei (etwa im Stil der Karikaturen im New Yorker) oder ein Autor wie Roald Dahl ein… Ich schweife ab, wie ich sehen muß, und bin allzu rasch in einer scheinbar anderen Ecke als kurz zuvor; indessen entspricht das in etwa der zuweilen in plötzlichen Weit- und Hochsprüngen sich vollziehenden Entwicklung meines literarischen Tuns im letzten Halbjahrzehnt, z.B. auch der jähen Wegwendung von der Lyrik zur erzählenden Prosa, obwohl sie sich vorangemeldet hatte in einer Reihe von Gedichten, die ich „Phantastische Erzählungen in Versform“ genannt habe, die immer wieder probiert, geübt worden ist auf fast manische Weise… (Schöner Fleiß das!, und es arbeiten sich die Züge eines dritten Gesichts hervor, die des Besessenen, des Irren – aber vielleicht habe ich das nur „gespielt?“).
Mit all dem lassen sich bestimmte Eigentümlichkeiten meiner Texte erklären, nicht das Ganze, nicht die „Grundtendenz“, wie sie dem größten Teil meiner Gedichte und erzählenden Prosastücke, wie sie auch meinen kritischen Essays, Polemiken, Invektiven die Richtung zeigt: Aufgrund sehr komplexer, nicht zuletzt politisch-sozialer Motive ist mein Schreiben seit längerem ein stetes Anschreiben gegen Festgeschriebenes geworden, und stamme es aus der eigenen Feder! (Es ist unschwer zu erkennen, daß im Festgeschriebenen, im Normativen, auch in neuerer normativer Ästhetik, in der Regel jene moralische und arbeitsmäßige Schluderei, Trägheit und Inkompetenz zum Zug kommt, von der ich bereits gesprochen habe; auf ganz ähnliche Weise zum Zug kommt, wie der unseren Häuserblock regierende sogenannte ,Hauswart‘ seine Unfähigkeit und seine Faulheit durch eine Vielzahl von Verboten, Anweisungen, Rügen etc. illuminiert, vom schnüffelnden Herumgewiesele in den Hinterhöfen der auf neuartige Weise „Asozialen“ zu schweigen, zu denen selbstverständlich auch unsereins gehört.) Ja, Anschreiben gegen Festgeschriebenes!, so oder ähnlich würde mein Wappenspruch lauten, wenn ein Wappenspruch nicht auch schon wieder Festgeschriebenes wäre… Nun, lassen wir’s lieber! Eines aber muß wenigstens am Rand hinzugefügt sein: nämlich, daß es nicht ausschließlich eine auf bestimmte Aspekte des DDR-Lebens zielende Aktivität ist, die sich im Was und Wie meines Schreibens ausdrückt. Es sollte klar sein, daß ich andernorts, und zwar an jedem Punkt des Erdballs – vom Himmel weiß ich zu wenig –, den gleichen oder einen schärferen Wappenspruch erwägen würde, ebenso „schwarz“ oder „schwärzer“ schreiben würde wie hier und jetzt! Zweifelt jemand daran? Der zu Trübsinn und Unken-Teichen tendierende Mensch, der ich trotz meines Gelächters bin, wäre ich überall geworden: Vorwerfen könnte man der DDR mit vielen anderen in diesem Land, daß sie nicht zu dem Wunderland geworden ist, und sie hatte es sich anscheinend vorgenommen (oder ich hatte geglaubt, sie hätte es sich vorgenommen), in dem so einer wie ich heute Hans im Glück wäre, hell- und nicht dunkelhaarig, immer potent und nicht nur immer im falschen Moment, der Typ des eleganten „Transatlantik“-Autors und nicht dieser zerlumpte hier… Ja natürlich, es ist vereinfachende schnoddrige Witzelei!
Aber es sollte aufgefallen sein, daß ich den Begriff „Dogmatismus“ vermieden habe; er kreuzt deshalb nicht auf, weil er z.Z. vor allem nach links und links ausschlägt und z.B. das exemplarisch „Festgeschriebene“ im Antikommunismus bzw. Antisowjetismus nicht automatisch mitmeint.
Ich opponiere indessen gegen diese ständig zur Erstarrung und Abtötung des Lebens strebende Welt sicher auch aus „Veranlagung“, und früher habe ich meine für manchen schier unbegreifliche Produktivität gelegentlich mit der lockeren Bemerkung erklärt, ich wäre eben so etwas wie ein Zigeunergeiger, grund-melancholisch und nicht kleinzukriegen, die Verkörperung der künstlerischen Lust an sich, ob auch die Wolken und ihre Schatten als Zeichen der Vergänglichkeit über ihn hinzögen, stets auf dem Sprung, und sei es nur dem Wind, sein Liedchen zu fiedeln… Das tapfere, gegen den mörderischen Angriff der Polizistenwelt und gegen die eigenen Tränen gerichtete „Hoch die Geige!“ aus einem Jugendgedicht Josef Roths, von ihm in Briefen zeitweise gern verwendet, hat mir im Augenblick eingeleuchtet, als ich es vor vielen Jahren entdeckte: „Hoch die Geige!“ – und losgespielt! Irgend etwas solchen Zigeunergeigerwesens, Django-Reinhardtschen muß wohl doch in mir herumgeistern, auf jeden Fall erheblich stärker als eine mir zuweilen angedichtete Hinneigung zum Terrorismus anarchistischer Prägung. Diesbezügliche Nachfragen kamen vor allem, als vor einigen Jahren ein ausländischer Kritiker mit großer Zielsicherheit aus dem ziemlich langen Gedicht „Das Sandkorn“ zwei Zeilen herausgeschnitten und seinem Artikel über mich als Motto vorangestellt hatte:
Etage um Etage durchwandre ich den Staat;
Dich trifft es heut, wen morgen, mein leises Attentat?
Glücklicherweise ist es Euch nicht eingefallen, mir diese sandkornartig spitzen Verse vorzuhalten. Nein, man betrachte mich als Zigeunergeiger, wenn es Euch auch als Auskunft nicht genügen wird, als Antwort auf die Frage, was einen Endler-Text zum Endler-Text macht; wie alles, was bis jetzt gesagt worden ist, das spezifisch Endlerische weder im allgemeinen bezeichnet noch dessen Ingredienzen (Sprache, Bild, Rhythmus) im Detail. Das ist nicht zufällig so und entspricht einem lähmenden Unbehagen, das mich noch jedesmal befallen hat wie Krätze, wenn mich jemand eine Frage dieser Art gefragt hat; und so eifrig ich immer dabei war, wenn über die Arbeiten eines Kollegen auch in solcher Hinsicht zu schreiben war – über das „Endlerische“ konnte ich mich eigentlich niemals anders als mit allgemeinen Floskeln ausdrücken, über diese mehr und mehr phantasmagorische Kunstwelt (die nichtsdestotrotz beinahe bis zur letzten Zeile nicht nur passiv, sondern vermutlich auch aktiv mit unseren gesellschaftlichen Realitäten korrespondiert), über die partiell auch manischen Züge, die ich oben bereits eingestanden habe – schrille Lautsprache, Zählwut, Grausamkeitsmomente –, meiner Verse und poetischen Bilder; ich konnte es immer nur stotternd, also dann lieber nicht, und so bis heute, und so nicht aus Bescheidenheit…
Meinetwegen haltet das für einen flugsen Rückzieher nach zerknirscht erkannter Überstrapazierung des inneren Kontos! Vielleicht lest Ihr gelegentlich die Selbst-Interpretation blutjunger Debütanten in der NDL, der Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbandes, die nicht im Traum zu fürchten scheinen, daß ein grotesker Widerspruch bestehen könnte zwischen der Höhe des theoretischen Anspruchs und der eventuellen Nichtigkeit dessen, was ihn begründen soll, ihres Gedichts – was mich betrifft, fürchte ich solchen Widerspruch permanent, wenn ich mich über meine eigenen Erzeugnisse äußere, und stimme (bei aller Faszination durch Poes „Philosophy of Composition“) inzwischen viel lieber als manchem Gedicht-Technologen dem alten William Butler Yeats zu, der resigniert gesagt hat: „Stil ist etwas fast Unbewußtes. Ich weiß, was ich zu tun vesucht habe, aber wenig davon, was ich getan habe.“ (Zumindest in diesem Punkt sind unsere Schüler-Lyriker dem alten Iren weit überlegen…) Aber es kommt noch etwas hinzu, was im Grunde jeder ernsthafte Schriftsteller weiß oder ahnt, ein Argument allgemeinerer Bedeutung… Neulich habe ich es endlich einmal ausgesprochen gefunden, weshalb einem dieses ganze Feld der Selbsterklärungen so unappetitlich vorkommt, und zwar in einem Essay von Dieter Wellershoff, im Literaturmagazin 11 veröffentlicht:
Wer schreibt, wer seine Phantasien preisgibt, hat sich immer wieder zu rechtfertigen. Und fast alle Rechtfertigungsversuche sprechen eine falsche Sprache. Es ist ein Element von Verrat oder Heuchelei darin aufspürbar, und zwar gerade dann, wenn die Versuche der Selbsterklärung und Rechtfertigung besonders gediegen und vernünftig klingen…
Und das ist es nun, was die Germanisten nach den entsprechenden Befragungsversuchen mit nach Hause nehmen, um es vollen Ernstes in ihre Aufsätze oder Bücher einzuarbeiten; ein noch „windigeres“ Geschäft als das der Autoren selber, und das ist schon „windig“ genug! – Fassen wir also zusammen: Es gibt Leute, die meine Texte verstehen, und andere, die sie nicht verstehen; diese verachte ich, jene treffe der Blitzstrahl meiner Hochachtung! (Um mich auch einmal des Picabia-Stils zu bedienen.)
Adolf Endler, 1981/1989, aus: Gerd Labroisse und Ian Wallace (Hrsg.): DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit. Eine Dokumentation, Rodopi, 1991
DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit
– Antworten auf die neuen Fragen an die Autoren. –
Ich stehe nach wie vor zu meinen Äußerungen von 80/81; ich finde nicht, daß sie zu ergänzen oder zu modifizieren wären. Allerdings möchte ich sie gekürzt sehen um einige geschwätzige Passagen, hier und da auch stilistisch verfeinert. Die beiliegende im Jahr 89 reduzierte Fassung dürfte das „Eigentliche“ dessen enthalten, was ich vor zehn Jahren zu Papier gebracht habe. (Um ein „Interview“ im engeren Sinn handelt es sich nicht.) Das damals mitgeteilte „Programm“ braucht nicht revidiert zu werden; auch die „Wende“ in der DDR hat eine Revision nicht erforderlich gemacht. Die absurden Eigenarten der ehemaligen DDR waren für mich seit langem nur Facetten der Absurdität der Weltläufte schlechthin; die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre sind schwerlich geeignet gewesen, mich in dieser Auffassung schwankend zu machen. Ich sehe nicht, daß ich in Zukunft anders oder weniger schreiben müßte als bisher.
Adolf Endler, 1. April 1991
Das Gnadenbrikett
Nein, das Gnadenbrikett ist nicht ein Brikett, das die milde Hand einer edlen Frau dem bettelnden Kind herausreichte oder das die frierende Witwe der noch ärmeren Alten gäbe, das Gnadenbrikett ist jeweils das zweite, das der Dichter Adolf Endler einer Ratte hinterherschoß, wenn er sie mit dem ersten noch nicht zu Tode getroffen hatte, in jenem kalten Winter, da er in seiner Berliner Küche 24 Ratten erschlug.
Als wir uns auf den Tag genau zwei Wochen, nachdem er davon erzählt hatte, wieder trafen, kamen wir erneut auf Ratten zu sprechen. Diesmal erzählte Adolf Endler als Beweis dafür, daß Ratten „ein Herz“ haben, folgende Geschichte: Eine Ratte war in die Falle gegangen und darin gestorben. Als er sie entdeckte, lag eine zweite, ebenfalls tot, daneben. Ein befreundeter Tierarzt stellte fest, daß die zweite nicht an Gift oder an einer feststellbaren Krankheit gestorben sei, sondern „aus Herzeleid“. „Das war nämlich ein Weibchen“, fügte Adolf Endler hinzu. Ich war so verdutzt, daß ich zu fragen vergaß, welche Ratte das Weibchen war, die in der Falle oder die daneben.
Als ob wir nichts anderes zu reden hätten als über Ratten.
Jürgen Israel, 1986, aus Jürgen Israel: Novembersonne, St. Benno Verlag, 1988
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


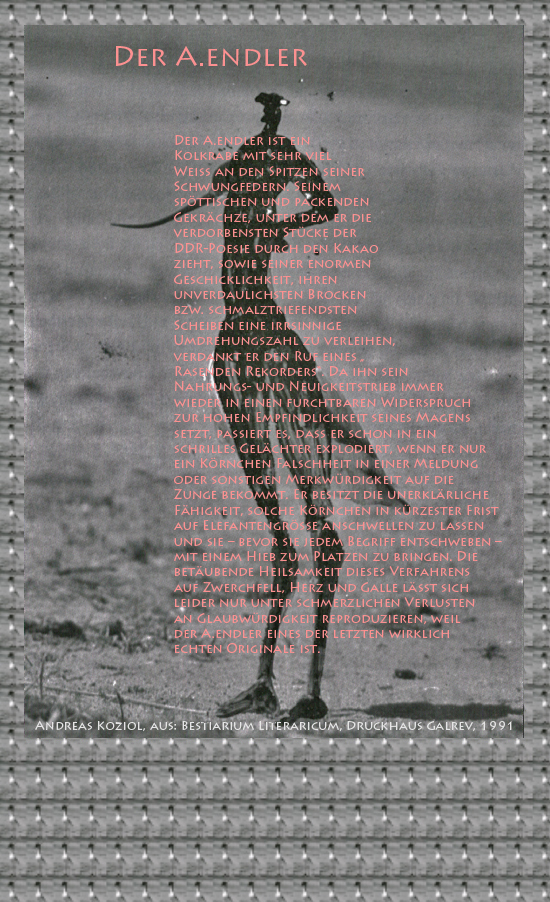
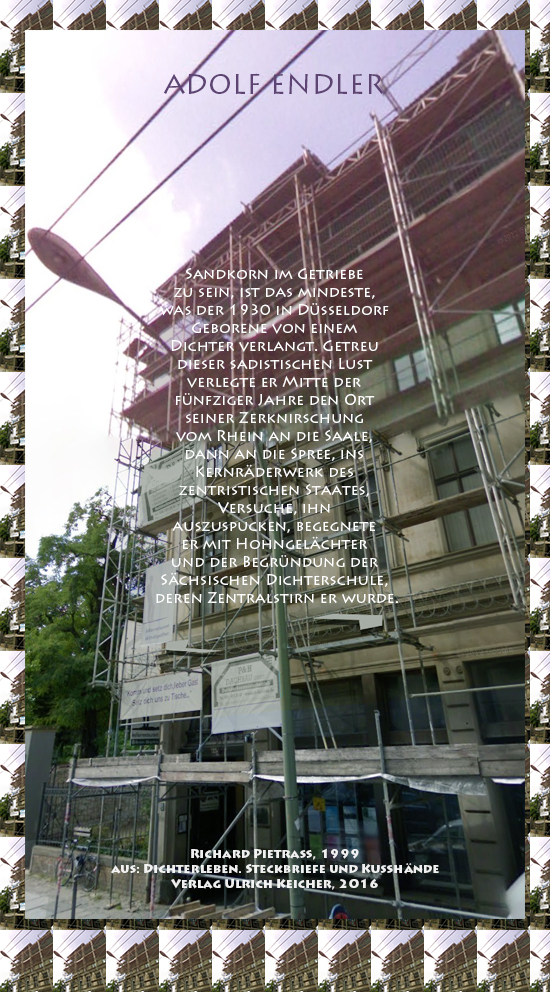












Schreibe einen Kommentar