Adolf Endler: Den Tiger reiten
AUSKUNFT IN EIGENER SACHE
Fragen an den Verfasser:
„Was macht einen Endler-Text zum Endler-Text? – Dann: Würdest Du den Begriff ,Temperament‘ als Ordnungsprinzip Deiner Poesie gelten lassen? Du erwähnst diesen Begriff im Vorwort zu Deinem bei Rowohlt erschienenen Band Verwirrte klare Botschaften! – Der Titel dieses Bandes erklärt das Gedicht zur Botschaft an den Leser, mit der Spezifizierung eines Widerspruchs: zugleich verwirrt und klar – also nicht aufgelöst, nicht harmonisiert? Würdest Du den Versuch einer Selbstauslegung wagen können, vielleicht anhand des Vierzeilers ,Dies Sirren‘?
– Dies noch: 1966 hast Du den Vierzeiler ,Die Brennessel‘ geschrieben, der sich auch als Hinweis auf Deine Poetologie wie auf die gesellschaftliche Funktion verstehen läßt (und den 1974 in Halle erschienenen Gedichtband Das Sandkorn eröffnet) … ,Auf meinem Tisch liegt eine Brennessel bereit / So daß die Zähnchen meine Hand verbrennen können / Die schreibt O öde Zeit der mangelnden Gelegenheit / Erfreut beim Dichten sich die Finger zu verbrennen.‘ − Zum Schluß: Wie beurteilst Du die Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur durch die Literaturwissenschaft der DDR? So weit ich sehe, sind Deine eigenen Gedichtbände in der DDR nicht rezensiert worden und Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Analyse geworden?“
Zur „Brennessel“: Es handelt sich ja offenkundig um eine der sanfteren Formen des Masochismus, die sich in dem Gedicht ausspricht, oder? Scheint der Verfasser des Vierzeilers nicht geradezu auf zarte Mißhandlung (durch die Brennesselblätter) angewiesen zu sein, um wenigstens einigermaßen bei Laune bleiben zu können! Ersatzbefriedigung übrigens nur, das wird ersichtlich! Lassen die vitalisierenden, fröhlich stimmenden Schläge mit der scharfen Linealkante auf sich warten – oh, ich werde sie schon noch zu spüren bekommen! −, ausgeteilt zum Beispiel von strenger Literaturpolizei, dann muß eben Pflanzliches her! Vielleicht ist das mit weniger Ironie gesagt, als es scheint! Stellen sich eigentlich ganz und gar zufällig solcherlei bezugsreiche Bilder auch für Gedichte bereit, die eigentlich von etwas anderem Mitteilung machen wollen? Es könnte durchaus sein – und ich habe es mich hin und wieder nicht ohne Anlaß gefragt −, daß die zu erkundende Endlersche Eigenart entscheidend mitbestimmt wird, bis ins Lautliche hinein von einer Sinnlichkeit ein wenig absonderlicher Ausprägung, die es mir nicht gelang, im realen Lehen genügend zur Geltung zu bringen… (Aber das kann ja noch kommen! – Was ich nicht als Drohung oder Warnung aufzufassen bitte! Neulich hat unser allmählich seinem achtzigsten Geburtstag entgegenschreitender Erich Arendt bei einer Diskussion in der Evangelischen Akademie – ! – zur allgemeinen Befriedigung des nicht kleinen Publikums erklärt, daß es in erotischer bzw. sexualer Hinsicht für ihn erst jetzt so richtig interessant zu werden beginne; das zu hören von einem, der als Experte auf diesem Gebiet gelten kann!)
Wenn ich mich nicht täusche, wolltet Ihr aber letztendlich etwas ganz anderes vernehmen, nämlich womöglich von Wirkungsabsichten des Dichters in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht, wie sie nun allerdings aus diesem Vierzeiler nicht sonderlich scharf heraustreten, es sei denn, man würde es als Funktion des Gedichts akzeptieren, daß es eine (möglichst schmerzhafte) Reaktion bewirke, auf den Dichter zurückschlage, ihm ein, wenn auch vielleicht nur wütendes, Echo beschere… (Mein Gott, wie viele Worte über eine in fünfzehn Jahren kaum bedeutender gewordene Nebensächlichkeit!) Aber weiter: Der Vierzeiler beklagt im Grunde die Echolosigkeit poetischer Bemühung oder diejenige dieses einen Dichters nur, wahrscheinlich bedingt – weshalb sonst der Hinweis auf die „mangelnde Gelegenheit“, sich Schelte oder gar Prügel einzuhandeln? – durch admimistrative Beschneidung seiner Wirkungsmöglichkeiten o.ä. Das, wie gesagt, an sich nicht sonderlich gewichtige Ding ist insofern immer noch aktuell, als seine „Aussage“ offenbar Dauergültigkeit haben soll in Bezug auf mein (durch Verbot wie Totschweigen gestörtes) Verhältnis zur Öffentlichkeit, die ich übrigens im Klappentext zu dem Gedichtband Das Sandkorn ausdrücklich nicht nur um Kenntnisnahme meiner Gedichte:, sondern auch, korrespondierend mit dem Vierzeiler, um Kritik gebeten hatte… Vergeblich! Denn es stimmt, wie phantastisch es auch klingen mag: Kein einziger meiner bislang drei Gedichtbände in der DDR, erschienen 1960, 1964, 1974, ist in der Neuen Deutschen Literatur, der Zeitschrift des Schriftstellerverbandes, dem ich bis Mitte des vorigen Jahres angehört habe, einer Besprechung für wert befunden worden, kein einziger in der Germanistenzeitschrift Weimarer Beiträge rezensiert worden, kein einziger in der Zeitschrift Sinn und Form, deren permanenter Mitarbeiter ich doch bin (besser: war), kein einziger in unserer kulturpolitischen Wochenzeitung Sonntag usw. – und es ist ja nicht schwer festzustellen, was für literarische Mediokritäten in jedem dieser Organe des Langen und Breiten und beinahe kontinuierlich einem inzwischen in Bezug auf die Lyrik fast wehrlosgewordenen Publikum präsentiert worden sind! Sagt das nicht eigentlich genug über Rezeption und Diskussion von Gegenwartsliteratur in der DDR? Zumal es ganz bestimmten anderen Autoren wie Elke Erb kaum anders ergeht? Zu diesem Thema sollen sich in Zukunft die bedeutenden Gisela Steineckert oder Uwe Berger äußern!
„Die Brennessel“, etwa anderthalb Jahre nach dem Erscheinen meines Gedichtbandes Die Kinder der Nibelungen geschrieben, ist indessen nie so aufgefaßt worden, braucht auch nicht unbedingt so einfach aufgefaßt zu werden – jeder Text hat ja mehrere Schichten −; es ist (legitim) verstanden worden als 1. bitterer Hohn in Bezug auf Jahre, in denen im Grunde an Nackenschlägen für Poeten kein Mangel war; 2. als ironische Rempelei gegenüber solchen Lyrikern, die „endlich ihre Ruhe haben wollten“ und die sich gewiß nach einer Weile über die ersehnte Ruhe ringsum heulend beklagt hätten… Wenn der Begriff „Dialektik“ im Kreis der Autoren aus der Brecht-Schule nicht für jeden simplen und ganz normal und geradlinig funktionierenden Wasserstöpsel in Anspruch genommen worden wäre, dann würde man die vier Zeilen vielleicht einmal gern unter dem Patronat dieses Begriffs auseinanderschrauben wollen (wie manches andere aus meiner „Werkstatt“ auch), diese etwas merkwürdig ineinander verkeilten und solcherart möglicherweise auf ein Drittes, Viertes, Fünftes verweisenden – nur auf zwei Bedeutungen ganz bestimmt nicht, Bedeutungen, wie sie die inzwischen verstorbene Literaturwissenschaftlerin Edith Braemer in der berühmt-berüchtigten „Forum“-Diskussion von 19622 unsicher erwogen hat, nämlich „ob der Autor über solche Dichter spottet, die nicht imstande sind, die ,Gelegenheit‘ zu erkennen und zu ergreifen oder ob er selbst keine aktuell-historische ,Gelegenheit‘ zu finden glaubt…“ – Na ja, und daraufhin war man sich wieder einmal im unklaren darüber, ob man die Verse ernstlich „als Satire positiv“ auffassen dürfe, also als sogenannte „positive Satire“ (sind sie’s denn nicht?). „Positiv – ja oder nein?“ Einer der ganz seltenen Fälle, in denen wenigstens am Rande die Literaturwissenschaft/Literaturkritik der DDR etwas verlauten ließ über meine poetischen Produkte, weshalb ich Frau Braemer (nicht die Schlechteste übrigens) eigentlich hätte dankbar sein müssen; und ich bin es auch, zumal ich erkenne, daß sie u.U. weitergekommen wäre, wenn sie die obligatorische stalinistische Frage nach der „positiven Satire“ unterlassen hätte, eine Frage, die noch niemals einen literarischen Text erschlossen hat. Die Leipziger Literaturwissenschaftlerin hätte länger leben müssen… Denn „Die Brennessel“ ist neben dem blutig-ernsten Gedicht „Die abgeschnittene Zunge“ das leichtfüßige der zwei frühesten Zeugnisse einer etwas „erwachseneren“ Phase nach meinem fünfunddreißigsten Lebensjahr; mit diesen Gedichten fängt etwas Neues für mich an, gekennzeichnet auch durch die Zwiegesichtigkeit, vielleicht zuweilen auch Zwielichtigkeit vieler Texte, zumindest der besseren, entfernt mit der Heineschen Ironie verwandt; um es paradox zu formulieren: Man könnte von einem entschiedenen Bekenntnis zum Noch-nicht-Entschiedenen des poetischen – nur des poetischen? – Urteils sprechen, wobei das Gedicht als Gestalt allerdings nicht offen bleiben, sondern durch- und ausformuliert sein sollte.
Was den letzten Punkt betrifft: Man könnte geradezu von fleißig Gebautem sprechen (auch der Gedanke an die Gründlichkeit und das stete Training des, durch was nur motivierten?, Zirkus-Artisten, Zirkus-Clowns liegt nicht fern), von einem Fleiß an sich sogar, der mindestens zwei Gesichter hat, einmal als eine allerletzte Zuflucht der Utopie und der Hoffnung – sonst könnte man ja die Balancierstange hinfallen lassen! −, und dann das andere, fratzenhafte, mit jenem ersten narbenreich verwachsen, das Gesicht eines höhnisch demonstrativen Fleißes („Lied vom Fleiß“), präsentiert der moralischen, folglich auch arbeitsmäßigen Schluderei, Ungediegenheit, Korruption ringsum in der Welt (die für mich vor allem eben die DDR bleibt); sicher nicht allein subjektiv bedingt diese Fratze, „positive Satire“ gleichsam in Gestalt des schwärzesten Schwarzen Humors, etwas vollkommen Rätselhaftes, muß ich schließen, für unsere Literaturwissenschaftler – zuweilen auch für mich selbst −, und nicht nur deshalb, weil sie die wahren Dimensionen des Schwarzen Humors verkennen, wie sie – nach Breton – seit Swift und dem Marquis de Sade von Autoren wie Lautréamont, Alfred Jarry, Salvador Dali (der mir als Schriftsteller wichtiger ist denn als Maler) aufgezeigt worden sind… Statt an den späten Peter Altenberg, an Oskar Panizza, vieles von Thomas Bernhard, manches von Heiner Müller zu denken, fällt dem Literaturwissenschaftler bei uns im Zusammenhang mit dem Begriff des Schwarzen Humors mit Sicherheit vor allem böse Witz-Zeichnerei (etwa im Stil der Karikaturen im New Yorker) oder ein Autor wie Roald Dahl ein… Ich schweife ab, wie ich sehen muß, und bin allzu rasch in einer scheinbar anderen Ecke als kurz zuvor; indessen entspricht das in etwa der zuweilen in plötzlichen Weit- und Hochsprüngen sich vollziehenden Entwicklung meines literarischen Tuns im letzten Halbjahrzehnt, z.B. auch der jähen Wegwendung von der Lyrik zur erzählenden Prosa, obwohl sie sich vorangemeldet hatte in einer Reihe von Gedichten, die ich „Phantastische Erzählungen in Versform“ genannt habe, die immer wieder probiert, geübt worden ist auf fast manische Weise… (Schöner Fleiß das!, und es arbeiten sich die Züge eines dritten Gesichts hervor, die des Besessenen, des Irren aber vielleicht habe ich das nur „gespielt“?).
Mit all dem lassen sich bestimmte Eigentümlichkeiten meiner Texte erklären, nicht das Ganze, nicht die „Grundtendenz“, wie sie dem größten Teil meiner Gedichte und erzählenden Prosastücke, wie sie auch meinen kritischen Essays, Polemiken, Invektiven die Richtung zeigt: Aufgrund sehr komplexer, nicht zuletzt politisch-sozialer Motive ist mein Schreiben seit längerem ein stetes Anschreiben gegen Festgeschriebenes geworden, und stamme es aus der eigenen Feder! (Es ist unschwer zu erkennen, daß im Festgeschriebenen, im Normativen, auch in neuerer normativer Ästhetik, in der Regel jene moralische und arbeitsmäßige Schluderei, Trägheit und Inkompetenz zum Zug kommt, von denen ich bereits gesprochen habe; auf ganz ähnliche Weise zum Zug kommt, wie der unseren Häuserblock regierende sogenannte ,Hauswart‘ seine Unfähigkeit und seine Faulheit durch eine Vielzahl von Verboten, Anweisungen, Rügen etc. illuminiert, vom schnüffelnden Herumgewiesele in den Hinterhöfen der auf neuartige Weise „Asozialen“ zu schweigen, zu denen selbstverständlich auch unsereins gehört.) Ja, Anschreiben gegen Festgeschriebenes!, so oder ähnlich würde mein Wappenspruch lauten, wenn ein Wappenspruch nicht auch schon wieder Festgeschriebenes wäre… Nun, lassen wir’s lieber! Eines aber muß wenigstens am Rand hinzugefügt sein: nämlich, daß es nicht ausschließlich eine auf bestimmte Aspekte des DDR-Lebens zielende Aktivität ist, die sich im Was und Wie meines Schreibens ausdrückt. Es sollte klar sein, daß ich andernorts, und zwar an jedem Punkt des Erdballs – vom Himmel weiß ich zu wenig −, den gleichen oder einen schärferen Wappenspruch erwägen würde, ebenso „schwarz“ oder „schwärzer“ schreiben würde wie hier und jetzt! Zweifelt jemand daran? Der zu Trübsinn und Unken-Teichen tendierende Mensch, der ich trotz meines Gelächters bin, wäre ich überall geworden: Vorwerfen könnte man der DDR mit vielen anderen in diesem Land, daß sie nicht zu dem Wunderland geworden ist, und sie hatte es sich anscheinend vorgenommen (oder ich hatte geglaubt, sie hätte es sich vorgenommen), in dem so einer wie ich heute Hans im Glück wäre, hell- und nicht dunkelhaarig, immer potent und nicht nur immer im falschen Moment, der Typ des eleganten „Transatlantik“-Autors und nicht dieser: zerlumpte hier… Ja, natürlich, es ist vereinfachende schnoddrige Witzelei! Aber es sollte aufgefallen sein, daß ich den Begriff „Dogmatismus“ vermieden habe; er kreuzt deshalb nicht auf, weil er z.Z. vor allem nach links und links ausschlägt und z.B. das exemplarisch „Festgeschriebene“ im Antikommunismus bzw. Antisowjetismus nicht automatisch mit-meint.
Ich opponiere indessen gegen diese ständig zur Erstarrung und Abtötung des Lebens strebende Welt sicher auch aus „Veranlagung“, und früher habe ich meine für manchen schier unbegreifliche Produktivität gelegentlich mit der lockeren Bemerkung erklärt, ich wäre eben so etwas wie ein Zigeunergeiger, grund-melancholisch und nicht kleinzukriegen, die Verkörperung der künstlerischen Lust an sich, ob auch die Wolken und ihre Schatten als Zeichen der Vergänglichkeit über ihn hinzögen, stets auf dem Sprung, und sei es nur dem Wind, sein Liedchen zu fiedeln… Das tapfere, gegen den mörderischen Angriff der Polizistenwelt und gegen die eigenen Tränen gerichtete „Hoch die Geige!“ aus einem Jugendgedicht Josef Roths, von ihm in Briefen zeitweise gern verwendet, hat mir im Augenblick eingeleuchtet, als ich es vor vielen Jahren entdeckte: „Hoch die Geige!“ – und losgepielt! Irgend etwas solchen Zigeunergeigerwesens, Django-Reinhardtschen muß wohl doch in mir herumgeistern, auf jeden Fall erheblich stärker als eine mir zuweilen angedichtete Hinneigung zum Terrorismus anarchistischer Prägung. Diesbezügliche Nachfragen kamen vor allem, als vor einigen Jahren ein ausländischer Kritiker mit großer Zielsicherheit aus dem ziemlich langen Gedicht „Das Sandkorn“ zwei Zeilen herausgechnitten und seinem Artikel über mich als Motto vorangestellt hatte: „Etage um Etage durchwandre ich den Staat; / Dich trifft es heut, wen morgen, mein leises Attentat?“ Glücklicherweise ist es Euch nicht eingefallen, mir diese sandkornartig spitzen Verse vorzuhalten. Nein, man betrachte mich als Zigeunergeiger, wenn es Euch auch als Auskunft nicht genügen wird, als Antwort auf die Frage, was einen Endler-Text zum Endler-Text macht; wie alles, was bis jetzt gesagt worden ist, das spezifisch Endlerische weder im allgemeinen bezeichnet noch dessen Ingredienzen (Sprache, Bild, Rhythmus) im Detail. Das ist nicht zufällig so und entspricht einem lähmenden Unbehagen, das mich noch jedesmal befallen hat wie Krätze, wenn mich jemand eine Frage dieser Art gefragt hat; und so eifrig ich immer dabei war, wenn über die Arbeiten eines Kollegen auch in solcher Hinsicht zu schreiben war – über das „Endlerische“ konnte ich mich eigentlich niemals anders als mit allgemeinen Floskeln ausdrücken, über diese mehr und mehr phantasmagorische Kunstwelt (die nichtsdestotrotz beinahe bis zur letzten Zeile nicht nur passiv, sondern vermutlich auch aktiv mit unseren gesellschaftlichen Realitäten korrespondiert), über die partiell auch manischen Züge, die ich oben bereits eingestanden habe – schrille Lautsprache, Zählwut, Grausamkeitsmomente −, meiner Verse und poetischen Bilder; ich konnte es immer nur stotternd, also dann lieber nicht, und so bis heute, und so nicht aus Bescheidenheit…
Meinetwegen haltet das für einen flugsen Rückzieher nach zerknirscht erkannter Überstrapazierung des inneren Kontos! Vielleicht lest Ihr gelegentlich die Selbst-Interpretationen blutjunger Debütanten in der NDL, der Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbandes, die nicht im Traum zu fürchten scheinen, daß ein grotesker Widerspruch bestehen könnte zwischen der Höhe des theoretischen Anspruchs und der eventuellen Nichtigkeit dessen, was ihn begründen soll, ihres Gedichts was mich betrifft, fürchte ich solchen Widerspruch permanent, wenn ich mich über meine eigenen Erzeugnisse äußere, und stimme (bei aller Faszination durch Poes „Philosophy of Composition“) inzwischen viel lieber als manchem Gedicht-Technologen dem alten William Butler Yeats zu, der resigniert gesagt hat: „Stil ist etwas fast Unbewußtes. Ich weiß, was ich zu tun versucht habe, aber wenig davon, was ich getan habe.“ (Zumindest in diesem Punkt sind unsere Schüler-Lyriker dem alten Iren weit überlegen…) Aber es kommt noch etwas hinzu, was im Grunde jeder ernsthafte Schriftsteller weiß oder ahnt, ein Argument allgemeinerer Bedeutung… Neulich habe ich es endlich einmal ausgesprochen gefunden, weshalb einem dieses ganze Feld der Selbsterklärungen so unappetitlich vorkommt, und zwar in einem Essay von Dieter Wellershoff, im Literaturmagazin 11 veröffentlicht: „Wer schreibt, wer seine Phantasien preisgibt, hat sich immer wieder zu rechtfertigen. Und fast alle Rechtfertigungsversuche sprechen eine falsche Sprache. Es ist ein Element von Verrat oder Heuchelei darin aufspürbar, und zwar gerade dann, wenn die Versuche der Selbsterklärung und Rechtfertigung besonders gediegen und vernünftig klingen…“ – Und das ist es nun, was die Germanisten nach den entsprechenden Befragungsversuchen mit nach Hause nehmen, um es vollen Ernstes in ihre Aufsätze oder Bücher einzuarbeiten; ein noch „windigeres“ Geschäft als das der Autoren selber, und das ist schon „windig“ genug! – Fassen wir also zusammen: Es gibt Leute, die meine Texte verstehen, und andere, die sie nicht verstehen; diese verachte ich, jene treffe der Blitzstrahl meiner Hochachtung! (Um mich auch einmal des Picabia-Stils zu bedienen.)
Vorbemerkung
Es beginnt damit, daß der dem Verfasser wohlgesonnene Hamburger Manfred Behn am Ende des Jahres ’88 auf den großherzigen Gedanken kommt, die Essays, Rezensionen, kritischen Notizen Adolf Endlers zu sammeln (und sogar herauszugeben), die dieser Unglücksvogel im Laufe der vergangenen dreißig bis fünfunddreißig Jahre im Hinblick auf die Lyrik der DDR zu Papier gebracht und teilweise, z.B. in der Zeitschrift Sinn und Form, veröffentlicht hat, ein wahrlich toller Plan, der uns in nicht geringe Probleme verstrickt; denn das ins Auge gefaßte Werk, wenn es auf sinnvolle, keinesfalls nur bürokratische Weise „komplett“ sein wollte, größere Zusammenhänge und differenzierte Hintergründe beleuchtend, müßte, wie sich bald erweist, mindestens 1200, besser noch 1600 Seiten stark sein. (Nun ja, derlei munkelt auch der Musik-Kritiker des Wernesgrüner Boten o.ä. über sein essayistisches Œuvre; der Verfasser des vorliegenden Büchleins jedoch mit hohem und von ersten Kräften und Häusern attestiertem Recht.) Wie kaum anders zu erwarten: Die mürrische Laune des Luchterhand-Verlags verweigert sich solchem großartigen Plan der Herren Behn und Endler; es muß, womit sich schon mancher herausgeredet hat, bei schüchternen Proben bleiben. Hinzukommt so einschneidend wie hilfreich die „Revolution“ in der DDR, die dazu zwingt, dieses Unternehmen (das ja zumindest zwölf gute Haare zumindest an den literarischen Hervorbringungen eines weltweit bekannten Bankrotteurs läßt) neu zu durchdenken, unter Umständen in Frage zu stellen. Übriggeblieben ist nach einigem skrupulösen Hin und Her etwas, was der Verfasser bereits vor ein, zwei Jahren streitschriftenartig in die „Literaturlandschaft“ einer nun schwindenden DDR hatte hineinfahren lassen wollen (als wäre da wirklich noch etwas zu retten gewesen); hundert hektographierte Exemplare eventuell…: 1. Zwei größere polemisch-literaturkritische Darlegungen über den literarischen „underground“ der achtziger Jahre. (Der Autor, zu einem ähnlichen Schicksal wie diese jüngeren Autoren verurteilt, hat sich zunächst eher zögernd in deren Zauberkreise begeben, wie sie in der ersten Abteilung dieses Buches ansatzweise beschrieben werden; die 1985 vom NDR III ausgestrahlte Rundfunksendung „Wörter, Wörter…“ kann man vielleicht als den Versuch einer ersten Annäherung betrachten, während der 1988 in der ostberliner Underground-Zeitschrift ariadnefabrik – und für dieses Buch erweiterte Aufsatz „Alles ist im untergrund obenauf…“ als Dokument einer schon differenzierteren Betrachtungsweise erscheinen mag.) 2. Essayistische oder feuilletonistische Hinweise auf einige ältere Autoren (und also auch ältere Phasen) der Lyrik in der DDR, in spürbarer, doch nicht leicht zu erklärender Weise im weiteren Vorfeld neuerer Entwicklungen agierende; mancher (und manches) in Gefahr, schon wieder vergessen zu werden (Erich Arendt), andere (und anderes) niemals in den Genuß jener Aufmerksamkeit gekommen (Uwe Greßmann), welche vergleichbare „Außenseiter“ anderer Literaturen in ihren Ländern durchaus bzw. schließlich doch noch gefunden haben. (Man denke z.B. an Raymond Roussel.) – In allen Fällen handelt es sich freilich um nicht mehr und nicht weniger als Winke, in der Regel Vernachlässigtem oder Unterdrücktem gewidmet; wie es vor Jahren einmal einem Literaturwissenschaftler (!) einfallen konnte, den Verfasser als „Theoretiker“ zu bezeichnen, ist diesem stets rätselhaft geblieben. Winke also nur, aber vielleicht nachdrücklich genug, den interessierten Leser dazu zu animieren, die sich nun wohl doch endgültig ver- oder zerlaufende DDR-Literatur im Rückblick neu, d.h. als etwas anderes, wahrscheinlich reicheres, jedenfalls verrückteres zu entdecken, als das sie in den Beschreibungen ihrer falschen Förderer wie auch ihrer blinden Gegner erscheint… (Notwendiges Postscriptum: Da inzwischen auch andersartige „Retter“ sich wieder auf den Weg gemacht haben, kann einen die oben geäußerte Hoffnung leicht in ein falsches Licht geraten lassen; nein, solche kulturellen Disziplinierungs- und Entmündigungsmaschinerien wie die von der FDJ und Margot Honeckers Volksbildungsministerium so lebhaft und zielgerichtet geförderte „Singebewegung“, wie das „Poetenseminar“ o.ä. – siehe Richard Christ in der: Weltbühne 7/90 – möchte unsereins nun lieber doch nicht zu der in irgendeiner Weise bewunderungswürdigen „Saat“ rechnen, die „auf dem Feld der Kultur… aufgegangen in dem vergangenen Jahrzehnten“, mag am Rande dabei auch das; eine oder andere herausgesprungen sein. Besser wäre es, derlei nicht allzu weit vom Delikt der Kinderschändung zu sehen.)
Adolf Endler, Vorwort, Februar 1990
Über dieses Buch:
„Welch ein Temperament und welche Verhältnisse! Als Adolf Endler sich 1955 von Düsseldorf nach Berlin-Ost absetzte, weil der Verfassungsschutz zu intim wurde, tat er es wohl nicht, um sich dort seinen Schneid abkaufen zu lassen. Schon bald verstand er sich als Sandkorn im verrosteten sozialistischen Getriebe, bedichtete und genoß wohl auch diese Rolle, wurde schikaniert, verbal gezüchtigt und 1979 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen“, schrieb die Frankfurter Rundschau, als 1987 Endlers Prosaband Schichtenflotz im Westen erschien.
Der vorliegende Band stellt zum erstenmal den „Aristokraten des Essays“, den begnadeten Polemiker, Analytiker und Stichler Endler mit Aufsätzen zur jüngsten „Szene“-Literatur in der DDR sowie zu Lyrikern wie Sarah Kirsch, Uwe Greßmann, Erich Arendt und Inge Müller vor. Seine Lyrik-Analysen greifen weit zurück in die Geschichte (nicht nur der Lyrik), sind gallig, schwarzhumorig, satirisch oder launig-liebevoll-bissig – eine faszinierende Lektüre.
Luchterhand Literaturverlag, Klappentext, 1990
Gespräche eines modernen Münchhausen
− Alles über Endler in einem Buch von Luchterhand. −
Anzuecken war für Adolf Endler nie ehrenrüchig. Die Literaturaufsichtsbehörde in der Berliner Clara-Zetkin-Straße hielt immer beide Augen weit geöffnet auf den Autor gerichtet. Ohne die Hinterstubenauftritte des Schriftstellers verhindern zu können, schloß die Zetkinstraße schleunigst sämtliche Verlagshähne, sobald die Gefahr drohte, daß die Öffentlichkeit ein kräftiger Strahl des Zeilen-Zauberers treffen konnte. Ein stillschweigend erschienenes Reclam-Bändchen aus Leipzig, das schnell die Runde machte, war eine späte, generöse Geste, die einem PEN-Mitglied „großzügig“ gewährt wurde.
Jetzt ist Endler an allen Ecken zu hören. An den literarischen, nicht den politischen. Und es ist ein Spaß, denn er kann seine Schriftsprache hörenswert sprechen. Das hat er, eher zwangsläufig, in den DDR-Jahrzehnten gut gelernt. Soviel auch von Endler zu hören und zu lesen ist, so wenig ist über ihn zu hören und zu lesen. Das spricht keineswegs gegen den Schreiber. Seine Texte sind allesamt Selbstgespräche eines modernen Münchhausen, der seine Wahrheiten – die Wahrheit?! – aus seinem gewissenhaften, geprüften Gedächtnis hervorzieht.
Über Endler ist – fast – alles bei Endler zu erfahren. Weil das so ist, kann nur erstaunt der Kopf geschüttelt werden, daß ein Band bisher unbeachtet blieb, der Endlersche Essays der schönsten Art liefert. Mit dem Titel Den Tiger reiten versehen, vereint der Band „Aufsätze, Polemiken und Notizen zur Lyrik der DDR“, die Endler in den siebziger und achtziger Jahren verfaßte und der Hamburger Endler-Experte Manfred Behn nun herausgab.
Fröhlich pfeift und knallt die satirisch-polemische Peitsche, wenn der erzählerisch-lyrische Essayist die staatlich subventionierte „Poetenseminar“- Lyrik in die muffigen FDJ-Schatullen verweist und den Geist des frühverstorbenen Uwe Greßmann durch die lyrischen Lüfte wirbeln läßt. Selbstlos, neidlos wälzt und wetzt Endler Worte, um beim Leser Liebe für seine Vers-Vorlieben zu wecken. Allen voran Sarah Kirsch, Inge Müller, Arendt, Greßmann sowieso. Oder Elke Erb, Mickel, Lorenc, Papenfuß-Gorek…
Endler sagt, wie er es sagt, hat Hand und Fuß. Der Essayist nennt Roß und Reiter der „Reim“-Szene, die er nicht nur vom Lesen und Hörensagen her kennt. Für seine Ausführungen berücksichtigt der Autor Gelebtes und Geschriebenes, das er trennt und in Beziehung setzt und das ihn vor dem tragischen Schicksal bewahrt, ein elitärer Langweiler zu werden.
Wer Franz Frühmanns feinnervigen und verdienstvollen Essay über Sarah Kirsch mit Endlers „Randnotiz über die Engel Sarah Kirsch’s“ vergleicht, wird feststellen, welchen lockeren Umgang sich der Essayist mit dem spielerischen Sinn der Kirsch ermöglicht. Zum Vorteil der Lyrikerin und der Lyrik, die Endler mit launiger Lust anschaut, um Lust auf sie zu machen. Der Essayist hält auf der Erde fest, was scheinbar über der Erde schwebt. Auch die Engel der Sarah Kirsch sind aus irdischem Lehm gemacht. Endlers Sätze schlurfen nicht dahin: mit dem Blei der Theorien an den Beinen. Sie haben die Leichtigkeit des Essayisten, der sich mit seinem Thema vertraut weiß und so zeigt.
Das Thema nicht zu verwissenschaftlichen ist die Natur des lyrischen Essayisten und essayistischen Lyrikers, der seine Sätze nicht nebenher, linkerhand aufs Papier schmeißt. In Nietzsches Sinne sind sie gemeißelt wie eine Bildsäule: solide, stabil, einprägsam. Davon kann man nicht genug bekommen, weil es davon nicht genug gibt.
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 28.5.1991
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Michael Braun: Adolf Endlers eiskalt-faktographischen Spitzfindigkeiten
Basler Zeitung, 7.9.1990
Das Abseits, die Mitte
EIN JAHRZEHNT MIT E.
Ehe du herkommst, geh zu dem Alten,
der den Nachtdienst hat vor dem Werk.
Sieh, wie er sitzt, von den Knien
fallen die Hände unträumend, sie warten, hinab.
Seine Helle des Wachraums drängt an das Fenster.
Seine flehenden Augen des Dunkels sind kalt.
Seine Kinder, die kann er nicht hüten, Hell und Dunkel
sterben vor ihm jede Nacht, die ihm hier Tag ist. Er wacht
vor dem Werk. Er löst aus
seinen Rock. Er geht, wenn er ihn anhat,
zu seinen Enkeln nach Haus.
Er geht über kindliche Wege,
lebt im Schritt.
Sieh, wie er traumlos sitzt, traumlos geht,
und dann kommm,
ich warte so sehr.
1967
Hatte ich mich verirrt, hatten die Beine fehlgewählt in den schwärzlichen Straßen nachts von der Endhaltestelle der Straßenbahn aus? Ich kam an das im flachen Lande gelegene Werk, sah die Schachtel mit dem Alten darin hell: das gleichmütigste Licht, das dir noch sagt, es ist nicht für dich, obwohl du das weißt; das dir den Rücken zuwendende Licht.
Aber dann war ich wohl nicht verirrt, – nur auf dem falschen Weg, – dann war ich anscheinend tatsächlich spazierengegangen, auf dem falschen Weg, absichtlich dort in der Öde, einverstanden, probeweise, mit ihr. Es könnte Trotz gewesen sein, oder Übermut. Gespielte Hinnahme, Übernahme des Geländes um mich herum. Nach der anderen Seite hin dehnten sich die Rieselfelder. Eine Dachkammer bewohnte ich in einem ehemaligen Dorfhäuschen des (damals erkennbaren) Dorfs Hohenschönhausen vor welchem die Straßenbahnschienen zur Endhaltestelle abbogen, eine Möbelabstellkammer bewohnte ich, Abraum, der posthum die Wohnelemente nachzeichnete: Tisch, Stuhl, Bett. Gegenpart des Kindes im Sand. Es war die an mich gerichtete Offenbarung der großen Stadt Berlin, der Hauptstadt: Du bist jung, du kommst – ich bin schon da, bin am Ende. Ich brauche dich nicht. Wir brauchen dich nicht, wir schieben dich ab, wir brauchen nicht, was wir nicht sind.
ARMUT
Ich habe zuwenig Sachen, und es sind nur solche, die notdürftig aus der Verlegenheit helfen. Wären sie besser, könnten sie wenigere sein. Und ich habe zuwenig Platz für meine Sachen. Bei ihnen bin ich eine von den Sachen, die einer wegwarf, der zuwenig hat.
Januar 1968 / Oktober 1976
Kannte ich E. schon, als ich den Alten sah draußen? Im Januar 1967 dachte ich: Ich überstehe ohne Liebe den Sommer nicht. Für meinen freiberuflichen Stand hatte ich alles weggeworfen, verworfen entschieden, womit ich hätte leben sollen.
Seine Kinder… Hell und Dunkel… Er löst aus seinen Rock… lebt im Schritt… Nahm ich das Bild des Alten nachträglich auf zu einem Porträt E.s? Ich erinnere mich an einen Traum in der Dachkammer: ein Wasserlauf, Brückchen, – ich will meiner Schwester, die da steht, erklären, was E. mir ist. Wie nur das sagen? Ich hebe die Hände: Weißt du, so –! Und vom Feld nebenan fliegt lautlos ein großer Vogelschwarm auf. E.
PORTRÄT A.E. (EIN KUNSTMÄRCHEN)
So als ob das Haus an dieser Stelle zu keiner Zeit bewahrt
werden konnte: der Keller, die Kellerfenster nicht, die Fenster zum Garten.
So als ob es jeden Krieges Meinung gewesen sei, gerade hier
hineinzugreifen und die Treppe herauszureißen
So als ob auch jedes Gewitter eingeschlagen, jeder Sturm
in die Wände und der Wolkenbruch immer Wehrlose
verdunkelt hätte.
So als ob das untröstliche Weinen des Kindes gerade hier
die Steine erweichen durfte, hier all das geschah,
was von anderen abgewehrt worden ist.
So als ob das Grün der Büsche sich hier einschnitte wie Feuer in die weich fließende Luft.
So als ob man von hier aus auch weiß, wo Häuser bewahrt
worden sind, mit ihnen befreundet ist und hingehen
kann.
So als ob hier ein Haus nicht bewahrt worden ist um ein
Leben zu gründen.
1967
Das Gedicht nimmt ungleich dem Traum-Ich nicht Natur, sondern die Nachkriegs-, die Jahrhundertzeit und ungleich dem ersten Gedicht nicht die Öde im Abseits (die von der Stadtmacht, dem Massiv, an den Rand gedrängte Bleibe), sondern die Zerstörung im Zentrum des Lebensorts. So, wie Zerstörung eine konsequente Übersetzung (Interpretation) der vom Gemeinwesen bewirkten Verdrängung ist, so sehe ich die Abseits-Stille des ersten Geruchts verwandelt in eine neue Ebene, eine der mit der wahrgenommenen Zerstörung (Wahrheit ist, was zu mir führt) eingelösten Eigenständigkeit, Selbständigkeit, Selbstbestimmung.
Mühsam erstritten wir in der grauen Baracke der Kommunalen Wohnungsverwaltung eine Hinterhaus-Wohnung (Küche-Stube-Kammer) in Berlin-Mitte: Kettenrauchen E.s auf dem Barackenkorridor, Wutanfall E.s vor dem Schreibtisch der bleichen Beamtin. Sie fand unseren Antrag nicht. Not-Karikatur des geträumten Vogelschwarm-Porträts: Alle diese Schreibtisch-Papiere (E. hatte wohl in der Wut mitsuchen wollen) flogen wirbelnd in die Luft. Mitleidig nickten die anderen fünf Angestellten in diesem Raum mir zu, als ich zwischen ihren Schreibtischen hindurch E. hinausfolgte. Der Antrag fand sich, obwohl diese Beamtin dann im Krankenhaus war, und wurde positiv beschieden beim nächsten Mal.
Wir hatten geheiratet, um den Antrag stellen zu dürfen. Nichts von wilder Ehe, Kollontai und Kommunismus im „einzig rechtmäßigen Staat auf deutschem Boden“: (Nur den Angehörigen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – VVN – wurden, erinnere ich mich recht, „Kameradschafts-Ehen“ zugestanden. Diesen Alten.)
Nachdem die untergründige Warnung und Sorge vom Januar 1967, daß ich ohne Liebe (Natur) nicht über den Sommer kommen werde, sich im Sommer prompt positiv gewendet fand, forderte die autokratische Natur promt und anhaltend den unverminderten, unveränderten Verbleib dieses positiv Entschiedenen, dieses zum Glück im Leben prompt noch rechtzeitig im Leben Erschienenen, nämlich als hätte sie, die im Untergrund heile Natur, heil auf ihr Heil wartende Natur, ein für alle Mal gesiegt und allein das Feld zu bestreiten, erwartete sie Sonnenaufgänge zumindest abends. Konzessionsbereit.
WENN ER ABENDS AM TISCH SITZT UND ARBEITET
Den Kopf in den Armen, in Kleidern,
schlafe ich ausgestreckt, barfuß,
weiß wie die Wand meine Füße,
mit je einer Rose bestückt.
1969
Eine andere Wortmeldung hatte E., dem mißtrauischen Meister meiner Lehrwerkstatt an seiner Seite, mehr zugesagt:
Nicht schlägt, wo ich bin, Geschirr an die Wand
oder kommt man gelaufen, weil etwas brennt
nicht sieht man das Tischtuch zerrissen.
1968
(Das übliche ,zerschnitten‘ offenbar reichte mir nicht.)
Hinzufügen will ich eine dritte Bekundung, die mich mit der Natur im Bunde zeigt. Unser Sohn war dreieinhalb, unsere Katze auf dem Land war schwer von ihren Jungen im Bauch. Sie hatte mich angesehn, und ich entschied:
DAS KRIEGEN WIR HIN
Ich, meine Katze. Meine Katze, ich.
Wir leben im Lande, wir schlippen die Milch.
Unser Kikeriki scheucht den Garaus.
1975
Auf das Porträt A.E. folgte drei Jahre später (Ehe, Wohnung, Werkstatt) ein Gedicht, das eine doppelte Lüge, Bauwerk des offiziellen gesellschaftlichen Bewußtseins, demontiert:
1.) baut es die heuchlerische Erhöhung der Kunst im Gemeinwesen ab, da es die Dichter-Vita entblößt bis herab auf ein kalendarisches Verbringen der Grabsteindaten, und die ,Epoche‘ (ein Selbstlob-Wort des verlautbarten vorgeblichen Gemeinsinns) mag sich ebenso geschwunden in der kahlen Zählung nach Jahrhunderten sehn!
2.) „entlarvend“ (wie man immer sagte) die sakral gesetzte Norm, der Künstler schaffe verbunden mit dem Leben des Volkes demonstriert der Text, wie das Volk wohnt, und verbunden damit des Dichters Endler reale ,Volksverbundenheit‘ im Gegensatz zur ,echten‘ der Norm-Gerechten, welche ihn an den Rand bzw. mitten hinein in die ,Tiefen d.V.‘ drängten.
Die Dichter wohnen in den Jahrhunderten
Dieser in jenem, jener in diesem, einer lappt über,
Der andere mittendrin wie der andere, der auch mittendrin wohnt.
Schön und gut. Endler erstreckt sich von 30 bis 90 in seinem.
Sonst wohnen auch die Dichter in Wohnungen wie dieser,
Die z.B. der Endler besitzt, Quartierchen fünfter Stock,
Badlos, Hinterhaus, Außenklo, aber mit Sonne.
Wenn der Dichter Endler seinen Kopf zum Fenster rausstreckt,
Sieht er nach, ob die Müllkübel leer sind.
1970
„Da beißt die Maus keinen Faden ab“, sprichts „Volk“. – Ein erboster Text. Erbost bringt er dem schlechten Gewissen der Gegenwarts-Geltung den in jedes Lexikon getragenen Maßstab posthumer Geltung in Erinnerung: „Autorität“ gegen „Autorität“. Gereizt wagt er es, um nur ja diesen Endler ihnen deutlich vorzuhalten, dessen Lebenszeit auf das Jahr ’90 zu begrenzen, rundum. Ich weiß, daß ich mich dabei gegen meine hexischen Mächte versicherte: „Das geht euch nichts an! Das geht nur uns hier, diese hier, an, haltet euch raus! Es ist nicht Eures, ihr (Fluch & Vorhersage)!“ – alle diese Jahre seitdem, wohlweislich, und durch alles, was war, hindurch wehrte ich sie ab und bestritt meinen hexischen Mächten ihr Recht an der von mir gesetzten Jahreszahl, da sie sich nur auf uns hier, auf diese DDR nämlich bezog.
Der nächste Text enthält einen Traum von E. Für mich war, was er träumte, sein Selbstporträt. Die anderen Träume, meine Träume in dieser Nacht, sagen als Malgrund, wieso. Die Hütte stand in der grünen Lausitz, an einem Ort zu dem wir vor dem Lärm um unsere Hinterhof-Wohnung geflohen waren. Der Lärm zerstörte mir die Nerven, die ich, wie die Träume zeigen, brauchte, um den Krieg im Nachkrieg zu verarbeiten.
Als ich mich kürzlich nach meinem Verhalten zur Zerstörung der Natur befragte und mit einer Erinnerung an meine Jugend in Halle begann, begriff ich, wie sehr unser gesellschaftliches Geschehen, während man es zunächst Wiederaufbau, dann Übergangszeit, dann Realsozialismus taufte, die vierzig hindurch immerfort vom Nachkrieg geprägt war.
Eine Nacht in einer einsamen Hütte
Das Ende des Krieges erschien mir im Traum. Im Lazarett, aufgewickelte Verbände, Schwestern, Betten und Mauern, lagen die Kinder und die anderen Armen, Schwachen und Kranken. Die Ellbogen aufgereckt, hielten sich alle ein Glasröhrchen an den Mund, aus ihm die Vitamme in die Hautporen eingehen könnten. Auf einer hölzernen Pritsche nahe dem Fußboden und so abgemagert, daß man ihn in seinen einzelnen Teilen vor sich hatte, sah ich dort den Bruder meines Mannes liegen. Auch auf seinen Mund war eins der Glasröhrchen gesetzt, doch er starb. Ich weinte sehr, da war er Uwe Greßmann. Eine Patientin tat kund, Dr. Scheich von der Kreispoliklinik habe zu ihr über diese Glasröhrchen gesagt: „Wozu das überhaupt, nichts wie Blödsinn.“ – „Aber, Herr Dktor, sie experimentieren ja noch und noch, ganze Klassenzimmer haben sie voll, rechnen Sie nur die Kalorienvitamine aus!“ antwartete sie. Und Dr. Scheich darauf: „So? So? Na dann solln se doch, dann solln se doch!“
Später war ich zu Gast in einem Klassenzimmer. Gerettete jüdische Kinder erhielten dort Unterricht. Ihr Stundenthema war die Berechnung des Prozentsatzes jüdischen Bluts, und zwar die Methode der phonetischen, der Aussprachemessung. Ein Junge, der empört ausrief:: „Es ist nicht wahr, wir sagen zu Hause ,se-är‘, nicht ,sär‘!“, bekam einen Verweis. „Seer“, mit langem geschlossenen „e“, galt als die nichtjüdische Aussprachenorm, und der Junge gewann, während er schrie, sogleich ein nichtjüdisch pausbäckiges, rund und gesundes Aussehen. Als die Schüler dann aus der Klasse hinausgingen, plapperten sie, halb singend: „Jetzt kriegen wir Schulfer-i-en / die Existenz wird uns erfrie-ren.“ Die Lehrerin wies mich daraufhin, wie sie das „i“ in beiden Wörtern heraushoben. „Hören Sie nur“, sagte sie andächtig und stolz, „welche schwierigen Reime sie beherrschen. Dubletten geradezu! Solche begabten Kinder…“
Edi träumte neben mir zur gleichen Zeit erst von allerlei ihm nachher nicht mehr erinnerlichen Ärgernissen, zuletzt aber: Spitzentanz. Vier Tänzerinnen, gefaßt in eine sich schlängelnde Überkreuzfigur, deren Bewegung ein Solotänzer aufnimmt und beantwortet. Von Zeit zu Zeit aber, wie einem Ausbruche der Lebensfreude folgend, bricht er in einem großen Sprung bald nach hier, bald nach dort aus der Dauer des Spiels, anscheinend in Opposition zu der der Gruppe aufgegebenen Weise, in Wirklichkeit aber auch hierin der Absicht des verborgenen Komponisten, einer Kunst-Absicht nämlich, gehorsam.
Da mir Edi das erzählt, erinnere ich mich, wie ich im Schlaf den grünen Fenstervorhang im Wind hin und her gehen hörte, seine Röllchen kratzten leise an der hölzernen Stange. Dieses Wehen und Gekratz, welchem wir, wachgeworden, noch lauschen, fand in Edis Traum eine tiefere Verwandlung als in dem meinen, ein unzerteiltes, lebendiges Bild. Das Kratzen wurde zu Tanzschritten, das Wehen zur sich schlängelnden Kreuzfigur, die Freudesprünge übertrugen den Rhythmus stärkerer Windstöße vielleicht oder des eigenen atmenden Brustkorbs. Ich setzte für das Kratzen den Kranken in ihrer Wirkung zweifelhafte Glasröhrchen an die Lippen, ich schritt beunruhigt hin und her zwischen Richtig und Falsch und befand mich in einem Fegefeuer aus Unsicherheiten der Aussprache, des Reims und der Bedeutung.
Aber ich war vor diesem Traum zwei Stunden lang nachtwach gewesen, denn wie um einen bewachten Lagerzaun war ich unablässig um das Problem herumgegangen, wie man als Zivil- und Privatperson, als umstürzlerisches Element, ein Kriegsgefangenenlager von der und der Größe ernähren könne: mit Konzentraten, aber in welcher Form und in welcher Art der Übermittlung an die Gefangenen? Kügelchen – wie groß? Und zuerst den heimlichen Führer unter den Gefangenen herausfinden, der sie verteilen würde, Zeichen geben, rufen… Ich suchte nach einem Ausweg aus Geschichten, die mir Edi vor einiger Zeit erzählt hatte, welcher in Düsseldorf als Kind von der Mutter mit seinem Bruder auf den Hof hinuntergeschickt worden war, an welchen ein Kriegsgefangenenlager grenzte; die Kinder sollten Brotstücke durch den Stacheldraht schmuggeln.
Ich stellte mir vor, wie der Junge, er hat es erlebt!, zusehen mußte, wie die eingezäunten, ausgehungerten Männer über das Brot herfielen, das vom Küchentisch der Mutter gekommene; wie sie sich, ein heutiger, stiller, knäuelnder Haufe, darum schlugen und sich am Stacheldraht die Haut zerrissen. Und ich stellte mir vor: wenn der Junge, der das sah, jetzt mit mir hier läge und begriffe, wie ich jetzt hier diesen Arm ausstrecke und hier liege, würde dieses Schreckliche in ihm erlöst. Weil ich aber wußte, daß es vielmehr eine Wunschvorstellung war als ein richtiger Gedanke, dem man nur zu folgen brauchte, wollte ich Edi, der in einem anderen Bett schlief, nicht stören, und es gelang mir einige Male, ihn nicht zu rufen. Dann rief ich ihn doch, er kam, schlief neben mir bald wieder ein, und sein ruhiges, tiefes Atmem holte auch mich wieder zurück in den Schlaf, in welchem ich dann vom Ende des Krieges träumte.
1970/71
Diese Nacht muß im Sommer 1968 notiert worden sein, – warum wurden die Notizen erst so spät zu einem Text? Es fehlte in der Werkstatt jede Freiheit. In ihr herrschte: Kommen die Worte zusammen oder nicht? Und das Werken war nicht ,Darstellen‘, ,Beschreiben‘, ,Erzählen‘, sondern Ändern. Gegen die Front des Falschen gerichtet, war die Werkstatt selbst Front. Ich schrieb Gedichte, aber ich faßte sie als Wortmeldungen auf. Gebunden, geschlossen wie die Gedichte waren auch die kurzen Prosa-Texte. Erst dank dieser Schule wurde ich – sprachlich wie politisch – sicher bei dem geatmeten gelebten ,Stoff‘: ihn zum Gegenstand zu formen, den Gegenstand in ihm zu erkennen. 1970 begannen sich Kindheitserinnerungen zu melden, anscheinend unvermittel. Sie traten über eine Angstschwelle, wie ich jetzt sehen kann. Denn davor war eine Zeit, in der ich feststellte: Ich habe nur noch zwei Gefühle – Angst und Mitleid. Ich ging unsere Straße hinauf, nachts, und an ihrem Ende erschien ein hoher Scheunenbalken, darauf ein Totenkopf… – Es war sehr aufregend, plötzlich vom Eigenen zu schreiben. – Und auf jedes Wort traf noch der Blick mit einer flammenden Strenge.
Das Frühjahr 1969 hatte uns aus unserem geschlossenen Land gehoben und für hundert Tage in Georgien freigesetzt. E. schrieb gleich nach der Reise ein ganzes Buch (er verschwand fast im Schreiben). Meine Notizen kamen erst fünf Jahre später zu einem Text. (Erst jetzt vielleicht ist es mir möglich, gleich nach einer Reise über das Aufgenommene zu schreiben.) Aber E. war mit Haut und Haar ergriffen worden. (Zweitausend Verse hatten damals E. und Rainer Kirsch in diesen hundert Tagen nachzudichten: Georgische Poesie aus acht Jahrhunderten) […]
3
Die Türen das Kurhäuschens drehen sich, knarren: E., der aus dem Zimmer geht, aus dem Haus auf dia Veranda tritt, hereinkommt, ins Badezimmer geht, ins Zimmer zückkommt, noch einmal aufsteht und hinausgeht, hin und her – noch sind unsere drei Türen nicht für den Sommer geölt, wecken mich, ich greife zur Uhr auf dem Fensterbrett: halb sechs. Es wird wieder still, E. sitzt am Tisch und schreibt. Schwarz, wie immer schwarz aussieht, was ich ihn schreiben sehe: Buchstaben, Silben, zu Blöcken wachsend, Verse, Strophen:
Warum schleichst du dich von hinten,
Tod, heran in leisem Trab?
Ach, ich kenne deine Tücken
Und bestellt ist längst mein Grab.
Plötzlich kommst du aus dem Dunkel,
Der dem Pferd die Sporen gab.
Willst du, daß ich überrascht bin
und dann keinen Helfer hab?
Schwarze Gruppen, die Seiten hinuntergestockt, Blatt raschelnd auf Blatt. Dieses Stück aus dem achtzehnten Jahrhundert, Dawit, Guramischwili, Nachdichtung, dreiundzwanzig Achtzeiler, sieben- und achtsilbig, im halbierten Vers des strahlenden, ein halbes Jahrtausend älteren Nationalepos vom Recken im Tigerfell, viermal der gleiche männliche Reim:
Warte, Tod, eh du mich anfällst,
Halt, durch mich wirst du nicht rund:
Und wird dich nicht Gott verstoßen?
Siehst du nicht den Feuerschlund?
Meine Seel fährt auf zum Himmel,
Du im Feuer, böser Hund.
Staunend rollen deine Augen,
Machtlos öffnet sich dein Mund –
Der Kopierstift der Arbeit ist stumpf, ihre Energie morgenfrisch, angeregt vom blütenreinen, wüstendurchduftenden Tee der georgischen Preßpäckchen. Ihn zu kochen, war, mit drei Türen knarrend, hin und her gelaufen worden, der Kessel mußte geleert, gereinigt, gefüllt, der frühe Park und die nach E.s Namensvetter benannte Eibe vorm Haus mußten angesehen werden. Ich schlafe noch einmal. Berlin-Mitte, wo wir herkommen, projiziert seine Hinterhausviertel in mein Hirn, wie sie ein Pilot vielleicht sieht, der gerade, jetzt früh am Morgen, die Kiefernwälder der Endmoränenmark überflogen hat, schwarzgeteilte Gruppen von Zeilen, Mauer an Mauer, angefüllt mit Baluscheks kargen Gestalten. Ich empfinde die frierenden Knie der – Kiefern auf dem Sand […]. Vor dem Mittagessen gehen wir mit R. zu G., welcher für zwei Tage aus der Hauptstadt in den Park gekommen ist. Er wohnt hier in einem Appartement für Familien, ein Schlaf-, ein Wohnzimmer, in der Ecke des Wohnzimmers das graue Fernsehquadrat; Kognak erscheint und eine Schale Äpfel auf dem Tischoval, als wir eingetreten sind. Es stellt sich im Gespräch heraus, daß beide, G. und R., einen englischen Rasierapparat besitzen, ein Umstand, welchen G. an sich lobt, während ihn R., welcher E. alles übersetzt, also alles zweimal sagen muß, weiterer Rede nicht wert findet. E., das unberührte Gläschen, das Äpfelchen vor sich zur Hand, blickt umrahmt von schwarzem Bart. Bald lassen wir wie Pingpongbälle die Namen von Dichtern aufspringen über dem Tisch. G. ist Schriftsteller und Sekretär des Verbandes. G. setzt Rilke und Pasternak, wir – zu dritt – nennen Mandelstam, aber G. stellt Rilke und Pasternak höher. Er lobt Chlebnikow und lobt auch Annenski, die kennen wir nicht, nur die Namen… Zwei Frauen kommen herein, Mutter und Tochter, G.s Familie. Die Tochter, die junge Wiederholung der schönen Mutter, besucht das Konservatorium. Die Mutter stellt dar eine georgische Dame mit schwarzen Augen, schwarzem Haar, weißer Haut der fülligen Arme, die Hände im Schmuck der alten dicken Ringe wie mit großen Käfern beglänzt. Das Weiß und das Schwarz,wie sie lächelt, sehe ich an, und die Ringe. Die reiche vornehme Dame des naiven, armen, genialen Malers Pirosmani, die wie eine Fürstin scheint, wie freigiebig freundlich sie ist! Flüchtig erwäge ich, ich wende den Blick nicht ab: Wenn solche Frauen die Geschicke lenkten, Schönheit, Fülle, angeborener Reichtum und – Entscheidungen, die ihnen ähnelten gleich ihren Töchtern […].
Und der letzte Text dieses Angebindes zum sechzigsten Geburtstag E.s, er steht vor Das kriegen wir hin in dem Bändchen Der Faden der Geduld:
LIEBESGEDICHT
Als auf dem Perron seine Stirn und Wangen um die blauen Augen weiß segelten, weiße Wölkchen über blauen Himmel, und das Schwarz der Locken flockte, Wolken schwarz auf einem Himmel blau, stach mich, daß er so verfallend aussah; verwünscht, verwünscht, ich kann ihn pflegen, das Haar ihm schneiden gleich nach meiner Rückkehr, so daß er aussieht wie ein nacktes Kind.
1975
Elke Erb, Sondeur, Heft 7, Oktober 1990
Vorwort
An einem der Pfeiler der U-Bahn-Haltestelle Dimitroffstraße/Ecke Schönhauser Allee (heute Eberswalder Straße) in Berlin-Prenzlauer Berg fand sich 1991 der Spontispruch „KR![]() WARNEWALL“ – mittlerweile von neuen Aufrufen übertüncht. Der aus der Spraydose auf die Mauer gesprühte Neologismus war einer der wenigen sichtbar gebliebenen skripturalen Rudimente aus der kurzen Revolutionszeit in der DDR. Das heißt: aus jenem ebenso historischen wie spektakulären Sommer und Herbst 1989, als Ostdeutsche die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überschritten, Honecker zurücktreten mußte und die SED-Macht ins Wanken geriet
WARNEWALL“ – mittlerweile von neuen Aufrufen übertüncht. Der aus der Spraydose auf die Mauer gesprühte Neologismus war einer der wenigen sichtbar gebliebenen skripturalen Rudimente aus der kurzen Revolutionszeit in der DDR. Das heißt: aus jenem ebenso historischen wie spektakulären Sommer und Herbst 1989, als Ostdeutsche die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überschritten, Honecker zurücktreten mußte und die SED-Macht ins Wanken geriet
„KR![]() WARNEWALL“ enthält mehrere Bedeutungsebenen, sammelt u.a. die Vokabeln „Krawall“, „war“, „warn“, „wall“ und „Karneval“ in sich und setzt das Zeichen des Anarchismus
WARNEWALL“ enthält mehrere Bedeutungsebenen, sammelt u.a. die Vokabeln „Krawall“, „war“, „warn“, „wall“ und „Karneval“ in sich und setzt das Zeichen des Anarchismus ![]() in den Brennpunkt. Das anonyme graffito sagte dem Mahnmal der realsozialistischen Repression seinen chaotischen Kampf an, war jedoch nicht in erster Linie auf die Beseitigung der vierundeinhalb Meter hohen und insgesamt hundertsechsundsechzig Kilometer langen festen Grenzanlage um Berlin herum aus, sondern benutzte sie als Projektionswand des Projekts Aufruhr. Die anarchistische Pointe: die Berührungsangst vor dem auf der Ostseite bis dahin unantastbaren Stein des Anstoßes zu überwinden. Die Inschrift durchbrach ein Tabu, rief zur Profanisierung des SED-Totems auf. Aber bevor die schon fast paralysierte DDR-Autorität es zum Karneval auf der Mauer kommen ließ, riß sie noch in den letzten Zuckungen den „Ost-Chaoten“ das neue Spielzeug aus den Händen. Sie zerstörte es lieber eigenhändig, als daß sie ihre versteinerte Legitimation der Veralberung preisgab. Mit dem 9. November, so Klaus Hartung in seinem Essay „Neunzehnhundertneunundachtzig“, begann die Niederlage der Opposition in der DDR: die „Maueröffnung war die letzte geheime Rache der SED“. Der Wunsch nach ihrer Karnevalisierung ging nicht in Erfüllung, statt dessen wurde der Spruch unbeabsichtigt zum Menetekel, denn bald sollten Bulldozer die Mauer für immer aus der Welt schaffen. Was blieb, waren die immer noch spürbaren und so bald nicht zu lindernden Phantomschmerzen.
in den Brennpunkt. Das anonyme graffito sagte dem Mahnmal der realsozialistischen Repression seinen chaotischen Kampf an, war jedoch nicht in erster Linie auf die Beseitigung der vierundeinhalb Meter hohen und insgesamt hundertsechsundsechzig Kilometer langen festen Grenzanlage um Berlin herum aus, sondern benutzte sie als Projektionswand des Projekts Aufruhr. Die anarchistische Pointe: die Berührungsangst vor dem auf der Ostseite bis dahin unantastbaren Stein des Anstoßes zu überwinden. Die Inschrift durchbrach ein Tabu, rief zur Profanisierung des SED-Totems auf. Aber bevor die schon fast paralysierte DDR-Autorität es zum Karneval auf der Mauer kommen ließ, riß sie noch in den letzten Zuckungen den „Ost-Chaoten“ das neue Spielzeug aus den Händen. Sie zerstörte es lieber eigenhändig, als daß sie ihre versteinerte Legitimation der Veralberung preisgab. Mit dem 9. November, so Klaus Hartung in seinem Essay „Neunzehnhundertneunundachtzig“, begann die Niederlage der Opposition in der DDR: die „Maueröffnung war die letzte geheime Rache der SED“. Der Wunsch nach ihrer Karnevalisierung ging nicht in Erfüllung, statt dessen wurde der Spruch unbeabsichtigt zum Menetekel, denn bald sollten Bulldozer die Mauer für immer aus der Welt schaffen. Was blieb, waren die immer noch spürbaren und so bald nicht zu lindernden Phantomschmerzen.
Adolf Endler, im ersten Augenblick wie fast alle seine poetischen Kompatrioten für die „Befestigung der Staatsgrenzen“ agitierend, hat es vor allem in seinen in den siebziger Jahren geschriebenen Prosastücken gewagt, die Grenzanlage, mitsamt ihres sie rechtfertigenden Diskurses, zum Gegenstand des Spotts zu machen. In mehreren Fragmenten seines Großprojekts „Nebbich“ wird die Mauer zum Bild, in dem die Kluft zwischen Wirklichkeit und Ideal in chaotischen Bildern karikiert wird. Radikaler als in seiner Lyrik porträtierte er ein Gesellschaftsbild, das auch jene Ecken und Kanten ausleuchtete, die im Namen der nicht-antagonistischen Gesellschaft von Staats wegen frisiert werden sollten. Endler war in der Beziehung einzigartig; er legte das Fundament einer Schreibweise, auf dem im Jahrzehnt darauf eine literarische Subkultur gedeihen konnte. Wer nicht an den zahlreichen berühmt-berüchtigten Lesungen teilgenommen hatte, mußte allerdings lange auf die Veröffentlichungen in Buchform warten. Überhaupt ist bei Endler eine fast magisch anmutende zehnjährige Verspätung in Sachen Publikation zu erkennen. Auch seine wichtigsten lyrischen Texte, die er in den Sechzigern schrieb, erschienen erst im darauffolgenden Dezennium.
Mit seiner Einwanderung in die DDR im Jahre 1955 ging Adolf Endler einem Traum nach, im Ostteil Deutschlands könne eine bessere Gesellschaft, gar ein idealer Schriftstellerhort – nach dem Konzept der Becherschen „Literaturgesellschaft“ – aus den Ruinen auferstehen. Aber die Hoffnung auf bessere Zeiten war bald geplatzt, u.a. als 1966 der Ausgang der von Kulturfunktionären gelenkten Diskussionen in der FDJ-Zeitschrift Forum über die Lyrik der später sogenannten Sächsischen Dichterschule enttäuschte. Die 1971 von ihm angezettelte Debatte über die nicht nur in seinen Augen realitätsfremde Germanistik in der DDR ging wie das Hornberger Schießen aus. 1979 erfolgte im Zuge der Biermann-Affäre der Ausschluß aus dem Schriftstellerverband, worauf das Totschweigen seiner Person und literarischen Arbeit einsetzte. Einzig das Nachdichten russisch-, georgisch-, armenisch- und englischsprachiger Literatur brachte ihm noch Aufmerksamkeit. Endler wurde unterdessen kein gebrochener Melancholiker. Statt dessen wagte er die Konfrontation mit der versteinerten Welt des autoritären Worts mit anderen Mitteln. Er „entdeckte“ André Bretons Anthologie des Schwarzen Humors und erklärte diese zu seiner Bibel. Aus ihr speiste er neue Techniken des Zersetzens, gleichzeitig fand er im Humoristischen einen Schutz, den ihm die Mauer längst nicht mehr zu gewähren vermochte. Nach wie vor blieb er dem „Volke“ verbunden, ging er auch den Berliner Weg, auf dem er nach Spuren ursprünglichen Redens suchte. Mit dem Rücken zur Mauer gewendet, ließ er in der Prosa sein fiktives Personal, etwa seine Alter egos Bobbi „Bumke“ Bergermann und Bubi Blazezak, in so manchem subversiven Volksfest toben. Das Reich der für ihn produktiven Dissonanzen fand er unterm blätternden Lackanstrich des Staatsgebildes bzw. im Untergrund:
……………………………………….
Ja geh Ich hol mir mit dem Straßenpumpenschwengel
Zum Trost die Stimmen jener zweiten Stadt nach oben
Der Rattennacht Ja geh mein ausgedienter Engel
Nicht Dich die Stadt der Ratten will ich künftig loben
Einwohner zählt die hundertmalachthunderttausend
Und tolle Tage immer und Massaker toben
Durch Katakombe und Kanal Kloake brausend
Der riesigen Rattenheere Hin- und Hergefetze
Gleich Bombensplittern Glut und Wut und Blut zerzausend
Der Ratten Krieg um Zuzug Schlupfloch Fraß und Metze
Ich lausch entzückt dem Goal wenn sie gut zugebissen
Wie fern ja geh die Welt der Alexanderplätze
Mich laß die Rattenschnauze die hier meine hissen1
Endler entpuppte sich als ein Gargantua in DDR-Format. Er konsumierte und entlarvte zugleich. Er rülpste, was einmal auch seine „Utopie“ war, aus: und siehe, es waren die Sonntagsreden des realen Sozialismus. Mit dem Dogma des sozialistischen Realismus stand er auf feindlichem Fuß, lieber stürzte er sich auf die herumliegenden Absurditäten, welche er als Abfallprodukte eines DDR-typischen „grotesken Realismus“ (Michail Bachtin) besang. Allerdings sind die von ihm beschriebenen Details immer so realistisch, wie es das offizielle Literaturprogramm einst verlangte, und werden, wenn sie unglaubwürdig erscheinen, mit wissenschaftlichem Gestus mit Quellenangaben belegt. Der Endlereske Charakter der Geschichten entsteht beim Vertauschen von Fiktion und Realität, besser: beim Vertuschen der Demarkationslinie zwischen beiden Welten, denn die Absurditäten im Alltag sind nicht immer erfunden, so fiktiv sie manchmal auch erscheinen. Im Wechsel der Maskierung und Demaskierung kreist die Prosa bis zum Schwindelanfall. Hinzu kommt eine gewollte Absage an die erzählerische Kontinuität, die den Blick auf das Reale verzerrt und das Groteske in den Geschichten mit evoziert. Die kapriziöse Prosa Endlers erinnert an jene karnevalesken Verrenkungen und Verkehrungen offizieller Weltbilder aus der Feder des Meisters des Grotesken, François Rabelais. Nach dem Vorbild des Treibens auf Jahrmärkten im Frankreich während der Zeit der Renaissance zeichnete dieser die Feste der Umstülpung und Parodie einer Hochkultur auf: Die Darstellungen animalischer Triebe, das Lob der Extravaganz und insbesondere die Vertonung des ambivalenten Lachens fanden ihren Höhepunkt im Riesen-Projekt Gargantua und Pantagruel, das Rabelais 1532 unter dem anagrammatischen Pseudonym Alcofibros Nasier antrat.
Statt in Lyon und Paris des 16. Jahrhunderts versuchen die grotesken Gestalten von Adolf Endler (bzw. Dove Elfland bzw. Dr. E. Ladenfol) in Ortschaften wie Ost-Berlin und Devils Lake, North Dakota des 20., wenn nicht sogar des 21. Jahrhunderts, mit kynischer Bravour Autorität zu unterminieren. Eine der schwindelerregenden Absurditäten, und ein häufiger Gegenstand der „Nebbich“-Capriccios, ist die Berliner Mauer. Sie wird topographisch genau situiert, nicht etwa vorsichtig metaphorisch angedeutet. – Endler und seine fiktiven Kombattanten gehen schnurstracks auf die vor November 1989 noch unbefleckten Betonflächen an der Ostseite Berlins zu, berühren sie, um wieder auf Distanz zu gehen. In rhythmischen auf und ab gehenden Tanzschritten vollzieht sich der literarische Dialog mit der Mauer/Macht. Endler akzeptiert die Einsperrung und enttabuisiert die Berührung des Schutzwalls: nur so kann er es zur entlarvenden Wirkung des literarischen Karnevals kommen lassen. Denn wer im Abseits steht, sieht nur die Folklore der skurrilen Tänze, nimmt aber nicht an der von ihr ausgehenden Subversion teil. Auch bei ihm gilt Volkskultur als Gegenkultur, wobei sich der Karneval in der DDR ebenfalls zwangsläufig von seiner Kehrseite zeigt, nämlich als Tristesse.
Ein Beispiel: In der 1978 verfaßten Kurzgeschichte „Bobbi Bergermanns Vormittagsweg“ ist die Wohngegend des (Anti-)Helden der Geschichte östliches Sperrgebiet. Dem Leser wird die Ahnung von der Einsperrung durch die Anwesenheit von an der Westseite der Mauer auf den bekannten, heute schon historisch gewordenen Plattformen mit Fotoapparaten und Fernrohren gaffenden Touristen vermittelt. Aber je öfter Bobbi „Bumke“ Bergermann bei der täglichen Tour zum Postamt an dieses „besondere Stück des ANTIFASCHISTISCHEN SCHUTZWALLS“ herantritt, desto größer kommt ihm der Spielraum im Käfig DDR vor. Die Anwesenheit der Zaungäste verstärkt den Jahrmarktcharakter. Als eine von der Mauer geprägte „Tierart“ kann er seine Künste zeigen.
An dieser Ecke unter der westlichen Zuschauertraube fühlt man sich immer wieder in die Lage versetzt, nicht nur ein BÜRGER DER DDR zu sein, sondern außerdem den BÜRGER DER DDR zu spielen, den Gang des DDR-Bürgers, die Kopfhaltung des DDR-Bürgers, die Art und Weise, in der der DDR-Bürger seine Kleidung trägt – so auch unsereins (weshalb hat noch niemand „Bravo!, Da Capo!“ gerufen?).2
Die Wiederholung der grotesken Verrenkungen an der Mauerfläche erzeugt keinen demonstrativen Ekel vor der Einsperrung. Sie ist die Bedingung für das Kunstwerk der in Gesellschaftssatire übergehenden Travestie. Was folgt, ist ein Stück reinster Bekenner-Literatur, die wir nur noch aus den heroischen Aufbaujahren des ersten sozialistischen Arbeiter-und-Bauern-Staates auf deutschem Boden kennen:
„Die DDR“, führte er Daumen und Zeigefinger gegen die herzförmig herausgestülpten Lippen, „die DDR – Zucker!!“
Wer solch ein Lob ausspricht, gerät natürlich in den Verdacht, gerade das Umgekehrte zu meinen: Süße Töne eines nur scheinbar besänftigten Tiers, das mit Ausbrechen droht.
Im schnellen Schlagabtausch von Ver- und Enthüllung, im Vermischen von Lobgesang und Ekel in einer als paradox empfundenen Welt nimmt der „Verfasser“ das einstimmige, autoritäre Wort in den Mund, verzehrt und verdaut es, um es daraufhin auszustoßen. Endler spricht dabei keine moralischen Verdikte aus – seine Satyrgeschichten vermitteln ebensowenig ein heiteres Abschiednehmen von Fehlern, um sich geläutert Gegenwart und Zukunft widmen zu können, wie Marx die Funktion der Satire einst deutete. Endler gibt sich nicht den binären Konstellationen hin; diese werden gerade im Wechselbad der Diskurse gesprengt. So heißt ein anderes Fragment aus der Mauer-Geschichte bezeichnenderweise „Eiszeit-Tauwetter / Tauwetter-Eiszeit“. Darin werden Gesprächsfetzen und Ausschnitte aus den unterschiedlichsten Zeitungen und Zeitschriften montiert, und die darin collagehaft eingesprenkelten Wiederholungen und Verdopplungen, Zurücknahmen und Umkehrungen lassen den Standpunkt des Erzählers nur ahnen. Er ist wohnhaft zwischen den Ruinen von Realität und Fiktion.
Man muß sich natürlich fragen, ob das Plädoyer für ein „Anschreiben gegen Festgeschriebenes“ nicht einfach eine der vielen Utopien war, die eher fixieren als befreien. Denn der Karneval fand nur an der Peripherie des Machtzentrums statt. Endlers Prosa hat in der DDR nie eine große Reichweite erlangt. War Adolf Endler vielleicht nicht mehr als ein belächelter, vom Staat tolerierter Sprach-Akrobat, von einem Staat, der letztendlich mit seinen konzessionierten Freiräumen den Rhythmus der Repression in Gang hielt? Der Tanz mit der Mauer wurde ihm erlaubt, da die Tanzfläche ihn isolierte. Denn das Areal, in dem er seine literarischen Orgien ausleben konnte, bestand meist aus Wohnzimmern in abbruchreifen Mietskasernen in den Stadtteilen Berlin-Prenzlauer Berg oder Leipzig-Connewitz. Das subversive Potential des Feierns verbarg sich im Ausschluß des Publikums, wobei das Versteckspiel der hedonistischen Aktionen dem asketischen Imago des Staates in die Karten spielte. An die Öffentlichkeit – falls Leser westlicher Feuilletons – drang gelegentlich eine Meldung über den subkulturellen Trubel, zum Beispiel über das 1984 in privaten Räumen stattgefundene, mehrtägige Happening während der sogenannten „zersammlung“, auf der junge Autoren der Prenzlauer-Berg-Szene nochmals ihre „Unabhängigkeit“ proklamierten. Waren aber in DDR-Zeiten die exzentrisch-privaten Bewegungen noch ein vages Zeichen einer Opposition, so drohen sie heute im kollektiven anything goes des Marktes verlorenzugehen.
Am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer den Geschichtsbüchern überlassen, der Spontispruch „KR![]() WARNEWALL“ ist unleserlich geworden. Endlers Karnevalisierungen scheinen jedoch heute nicht nur von historischem Interesse. Der Tanz mit Ruinen, mit Totem und Tabu, verläuft auf anderer, nicht weniger harmloser Ebene weiter, etwa dann, wenn er seine 1994 in Tarzan am Prenzlauer Berg niedergelegten Erinnerungen seines Wirkens im Kiez in just dem Augenblick auf den Markt bringen läßt, als die Rede von den „Stasi-Metastasen“ (Wolf Biermann) ihren Höhepunkt erreicht und die wohl bedeutendste kulturelle Bewegung in der DDR-Existenz endgültig zu degradieren droht. Sein bis jetzt erfolgreichstes Buch ist zugleich Memoire und Neuanfang einer Schaffensperiode. Endler findet neue Mauern, neue Lust an der Zersetzung und neue Gegner – nicht zuletzt in den von ihm so genannten und einst gehätschelten Dichtergefilden der Sächsischen Dichterschule und der Prenzlauer-Berg-connection. Von Ostalgie und neuer Westerfahrung hin und her gerissen, vagabundieren seine anarchistischen Schelme nach wie vor durch die Weltgeschichte, wo doch das Absurde nicht vor Nationalgrenzen und politischen Systemen haltmacht und der groteske Realismus sich gar nicht mal so radikal gewendet zu haben scheint.
WARNEWALL“ ist unleserlich geworden. Endlers Karnevalisierungen scheinen jedoch heute nicht nur von historischem Interesse. Der Tanz mit Ruinen, mit Totem und Tabu, verläuft auf anderer, nicht weniger harmloser Ebene weiter, etwa dann, wenn er seine 1994 in Tarzan am Prenzlauer Berg niedergelegten Erinnerungen seines Wirkens im Kiez in just dem Augenblick auf den Markt bringen läßt, als die Rede von den „Stasi-Metastasen“ (Wolf Biermann) ihren Höhepunkt erreicht und die wohl bedeutendste kulturelle Bewegung in der DDR-Existenz endgültig zu degradieren droht. Sein bis jetzt erfolgreichstes Buch ist zugleich Memoire und Neuanfang einer Schaffensperiode. Endler findet neue Mauern, neue Lust an der Zersetzung und neue Gegner – nicht zuletzt in den von ihm so genannten und einst gehätschelten Dichtergefilden der Sächsischen Dichterschule und der Prenzlauer-Berg-connection. Von Ostalgie und neuer Westerfahrung hin und her gerissen, vagabundieren seine anarchistischen Schelme nach wie vor durch die Weltgeschichte, wo doch das Absurde nicht vor Nationalgrenzen und politischen Systemen haltmacht und der groteske Realismus sich gar nicht mal so radikal gewendet zu haben scheint.
Gerrit-Jan Berendse, Vorwort, 1997, aus Gerrit-Jan Berendse (Hrsg.): Kr![]() warnewall. Über Adolf Endler, Reclam Verlag Leipzig, 1997
warnewall. Über Adolf Endler, Reclam Verlag Leipzig, 1997
Gespräch mit Adolf Endler im August 2005 in Berlin
Claus-Ulrich Bielefeld: Herr Endler, Ihre „Autobiographie aus Splittern“ – wie Sie sie im Vorwort nennen – trägt den Titel Nebbich. Was meint dieses Wort?
Adolf Endler: Nebbich stammt aus dem Jiddischen und kann sich sowohl auf eine Person beziehen als auch bedeuten:
nun wenn schon, ist schon alles egal
Das Wort ist mir Anfang der achtziger Jahre häufiger begegnet, und angesichts meiner immer absurder werdenden Prosa und der immer absurder werdenden DDR habe ich beschlossen, diesen Begriff als Romantitel zu verwenden, und zwar eines Romans, der nie geschrieben, aber immer wieder angekündigt werden sollte in verschiedenen Prosastücken und Fragmenten, als „Nebbich – der große dreizehnbändige Gesellschaftsroman“. Ich habe auch eine Geschichte darüber geschrieben, wie mir dieses Wort 1959/60 zugeflüstert wird von einer nebelhaften Gestalt in Plau am See. Die Geschichte ist länger und behandelt die Wanderung eines Trunkenen durch den nebelverhüllten Ort, mit allerlei seltsamen, phantasmagorischen Erscheinungen:
Eines Abends geschah es aber, daß ich ein Echo, eine Stimme hörte, als ich vor dem Buchladen stand, eine weibliche Stimme von sapphoscher Zauberkraft, die aus einem Nebelhaus mir zwei Silben zurief, aus dem nicht sichtbaren Haus, das oberhalb der Buchhandlung die Häuserzeile fortsetzte; die Stimme rief, da ich wieder einmal die Buchtitel zu entziffern versuchte, schräg zu mir herunter – sie schien aus dem zweiten, dem obersten Stockwerk zu kommen –, sie rief, erfüllt von Liebe zu mir, ein einziges Wörtchen, rief: „Nebbich…“ Und ein zweites Mal, wenn auch weniger klar und von einem typischen mecklenburgischen Räuspern gestört: „Nebbich…“ Sie sagte nicht Tekelili!, sie sagte nicht: Ulalume; sie sagte, ich schwöre es, Nebbich!, und dies war der Augenblick, der mich rettete und der mein Leben verändert hat und es verändert bis heute.
Bielefeld: Das Wort hat ja noch die Nebenbedeutung: ist nicht so wichtig, kann man auch vergessen. Wenn man seine Autobiographie Nebbich nennt, ist das auch ein programmatischer Titel.
Endler: Der Titel deutet darauf hin, daß ich die Dinge, die ich erlebt habe, auch wenn sie recht gravierend waren, immer mit einer gewissen Gelassenheit genommen, sie beiseite geschoben und gesagt habe:
ist schon nicht so wichtig
Bielefeld: Nun lautet aber der Untertitel „Eine deutsche Karriere“. Wie sieht denn diese Karriere aus?
Endler: Nebbich kommentiert diesen Untertitel natürlich ziemlich sarkastisch. Die Karriere sieht so aus, daß ich als Schriftsteller nicht besonders durchgedrungen bin und eben keine Karriere gemacht habe, auch nicht in anderen Berufen, etwa als Redakteur. Erst nach der Wende kam es seltsamerweise zu einer Art Karriere, als einige Bücher etwas mehr beachtet wurden, allerdings nicht die bereits in der DDR erschienenen.
Bielefeld: Sie wurden 1930 in Düsseldorf geboren und gingen 1955 in die DDR. Das war ja ein Schwimmen gegen den Strom.
Endler: Eigentlich bin ich in der DDR hängengeblieben. Ich kam hierher im Zuge der von Becher betriebenen Kulturpolitik, die scheinbar noch auf Vereinigung aus war. Ich sollte zusammen mit einem Autor aus der Bundesrepublik, Gerd Semmer, eine Anthologie westdeutscher Literatur zusammenstellen, sozusagen als Geste der Versöhnung. Das haben wir auch gemacht, und tatsächlich haben uns Autoren wie Arno Schmidt zwei, drei Texte geschickt, auch der vor einigen Jahren verstorbene, doch eher etwas restaurative Heinz Piontek. Fast alle wesentlichen Autoren gaben uns Arbeiten – seltsamerweise. Das war dann aber in der DDR doch nicht zu machen und ist gescheitert. Und während dieser Arbeit wurde ich plötzlich ins neugegründete Kulturministerium gerufen, zu einem Herrn Schwuppdiwupp. Dieser Herr Schwuppdiwupp war Alfred Kurella, der ein Literaturinstitut in Leipzig gründen wollte und dafür linke westdeutsche und österreichische Autoren suchte. Der fragte mich, ob ich da nicht studieren wolle. Und dann habe ich dort zwei Jahre lang studiert und später als Journalist, Rezensent und was nicht sonst noch alles in Berlin gearbeitet, vor allem für die Berliner Zeitung. Dann war ich verheiratet und konnte nicht mehr weg.
Bielefeld: Erzählen Sie doch noch etwas über die Zeit im Literaturinstitut.
Endler: Der erste Jahrgang war im Grunde geprägt vom Zynismus der Landser-Generation, von Leuten wie Loest. Die waren froh, dort bekamen sie ein bißchen Geld – ich glaube 500 Mark –, als Stipendium. Meistens waren sie betrunken, und ich eben auch. Ich habe mich aber eher fremd gefühlt an diesem Institut. Es gab ein großes Durcheinander und eine starke Renitenz in diesen ersten Jahren, auch durch den Terrorismus der Parteiversammlungen und die herrschende Scheinordnung. Auch Ralph Giordano war in diesem ersten Lehrgang. Ich erinnere mich an ihn als stolzen FDJler, der große Reden hielt. In späteren Jahren entstanden wohl viel direktere Schwierigkeiten im Institut, etwa mit Sarah Kirsch, Bernd Jentzsch, Rainer Kirsch, deren literarische Ansichten dem sozialistischen Realismus so heftig widersprachen, daß es zu Krächen kam, auch zu Ausschlüssen.
Bielefeld: Sie waren 1957 – könnte man ironisch sagen – Diplom-Schriftsteller, Diplom-Dichter, sind dann aber zur Wittenberger Zellwolle gegangen.
Endler: Ja, das war der Bitterfelder Weg. Ich ging in die Wische, auf einen Bauplatz der Jugend. Wir jungen Dichter wurden alle irgendeinem Bauplatz der Jugend zugeteilt. Karl Mickel zum Beispiel dem geplanten Flughafen Schönefeld. Und über all diese Dinge haben wir furchtbare Gedichte und Lobeshymnen geschrieben. Ich bin dann in der Wische hängengeblieben, ich hatte keine so guten Beziehungen in der DDR und plötzlich auch kein Geld mehr, mußte also irgendwo arbeiten. In der Zellwolle war ich unter anderem Lastenschlepper und habe Preßluftflaschen getragen – da sprangen immer alle beiseite, weil sie Angst hatten, daß die mir von der Schulter fallen.
Bielefeld: Der Bitterfelder bzw. Wittenberger Weg hat Sie ja nicht unbedingt zum proletarisch-revolutionären Schriftsteller gemacht. Sie kamen dann nach Berlin, zum Prenzlauer Berg, der mythischen Prenzlauer-Berg-Connection. Mittlerweile gelten Sie sogar als deren Vater oder Spiritus rector.
Endler: Das ist natürlich ein bißchen übertrieben. Im Grunde war der Prenzlauer Berg eine sehr ernste Angelegenheit. Viel Humor gab es da nicht, während sich bei mir eine Art schwarzer Humor herausgebildet hat. Ich war zunächst Redakteur bei der Schrebergärtner-Unterhaltungszeitschrift Schatulle, die ich versuchte zu einer Lyrik-Zeitschrift umzufunktionieren. Mit dieser Zeitschrift haben wir schon sehr viel Ärger gehabt. Und ich war Mitarbeiter der Jungen Kunst, in der nur positive Dinge über die DDR standen. Man sieht sich das heute nicht mehr gerne an, aber man muß es sich ansehen. Dann wurde die Mauer gebaut, was wir alle irgendwie begrüßten. Eine der Begründungen für den Mauerbau war: wenn die Grenze zu ist, dann könnt ihr hier künstlerisch machen, was ihr wollt – jetzt noch nicht. Ob uns das überzeugt hat oder nicht, dieses Argument spukte noch jahrelang in den Köpfen herum.
Bielefeld: Wie konnte man glauben, daß dann, wenn man eingemauert und abgeschirmt wird von anderen Ländern, die Freiheit beginnt? Das ist ja ein seltsamer dialektischer Sprung.
Endler: Ja, ich weiß. Es ist ein dialektischer Sprung. Aber man konnte ja nicht übersehen, daß die offene Grenze nicht zuletzt ökonomisch für die DDR etwas ungeheuer Fragwürdiges war. Dem einen Riegel vorzuschieben, hat sogar westdeutschen Kapitalisten eingeleuchtet. Natürlich hat damals keiner geahnt, wie dieses Bauwerk tatsächlich aussehen und welche Rolle es spielen würde – daß es nur darum ging, die Fluchtbewegung aus der DDR zu stoppen. Aber ganz am Anfang gab es schon allerlei Argumente für die sogenannte Befestigung der Staatsgrenze. Uns Dichtern war klar, daß das großen Teilen der Bevölkerung äußerst unsympathisch war, daß wir jetzt ungeheuer positive Gedichte über all das schreiben mußten. Wir fingen an, Lieder für FDJ-Regimenter zu dichten. Furchtbar. Das hat drei Wochen gedauert, dann war es vorbei.
Bielefeld: Sie haben sich ja letztlich nicht mit der Macht auseinandergesetzt, sondern sind – wenn ich das richtig sehe – einen anderen Weg gegangen. Sie haben sich entzogen, Ihre Opposition hat sich auch darin ausgedrückt, daß Sie ständig neue Wohnungen hatten und auch gerne mal einen Schluck nahmen.
Endler: Meine Frau sortiert gerade meinen Briefwechsel. Und aus dem ergibt sich schon, daß ich im Dialog stand mit Ministerien, mit der Macht, mit dem stellvertretenden Kulturminister Höpcke und anderen Großleuten, daß ich kritische, empörte Briefe geschrieben, auf Schicksale hingewiesen habe – das geht bis in die späten achtziger Jahre. In meinen absurden schwarz-humoristischen Texten schlägt sich das weniger nieder, in denen konnte man lesen, daß mit der DDR doch ein ziemlich lächerliches Gebilde entstanden war. Die Auseinandersetzung mit der Macht spielt auch eine Rolle in Büchern und Texten, die nicht in der DDR erscheinen konnten, sondern in den späten achtziger Jahren unter anderem im Rotbuch Verlag herauskamen. Es ist schon so, daß die ostdeutsche Literatur eine nur schwer benennbare Grenze nie überschritten hat. Das betrifft die ganze DDR-Literatur, von Christa Wolf bis Endler – falls er da überhaupt dazu gehört. Ich habe dann Texte geschrieben, die von dieser Grenze keine Notiz mehr nahmen. Die waren in der DDR nicht publikabel. Aber zur gleichen Zeit habe ich heftige Briefe an den Ministerrat geschrieben und bin dann ja auch mit einigen anderen Kollegen aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden.
Bielefeld: Es gibt ja mehrere Alter ego von Ihnen, besonders bekannt sind Bobby Bergermann und Bubi Blazezak. Welche Rolle spielen die? Bobby Bergermann ist ja 1998 gestorben.
Endler: Ja, der stirbt gelegentlich mal.
Bielefeld: Der stirbt immer wieder?
Endler: Das sind Hohnfiguren auf positive Helden. Es gab in der DDR die Tendenz, mehrbändige Romanwerke vorzulegen, in denen die Geschichte der DDR behandelt wurde, zum Beispiel von Erik Neutsch, Der Friede im Osten. Ich fand das sehr dubios, meist war es auch schlecht geschrieben, und immer gab es diese positiven Helden. Und Bobby Bergermann oder Bubi Blazezak sind Gegengestalten dazu, Leute, die sich nicht ordentlich verhalten, sondern sich von früh bis spät besaufen. Und zwar ideologisch besaufen, sie wanken aus ideologischen Gründen trunken durch die Stadt.
Bielefeld: So haben Sie es offenbar ja auch gemacht. Sie waren ein Vagant, der durch diese Stadt, also durch den Prenzlauer Berg, durch Friedrichshain und Mitte zog, der selten seßhaft war. Ist das ein idealisiertes Bild oder war das wirklich so?
Endler: Das war wirklich so. Aber natürlich nicht immer freiwillig. Es war wirklich schwer für mich, eine Wohnung zu kriegen. Auch nach meiner Scheidung mußte ich mir eine neue suchen. Dieses Hin und Her war nicht erwünscht, hat sich aber so ergeben. Aber ich war nicht so sehr Vagant wie meine Romanhelden.
Bielefeld: Sie waren ja 20, 25 Jahre älter als die Autoren vom Prenzlauer Berg, die später bekannt geworden sind. Wird diese Zeit nach Ihrer Einschätzung verklärt? Ist sie ein Mythos?
Endler: Ich glaube nicht, daß sie verklärt wird. Es war natürlich das übliche Bohemien-Getue, mit Treffen in einer der drei, vier bevorzugten Kneipen, mit einem Hin und Her von Manuskripten. Was mich betrifft, hatte ich stilistisch weniger Einfluß auf die Prenzlauer-Berg-Szene, eher auf bestimmte Autoren, auf Katja Lange-Müller etwa oder Frank-Wolf Matthies. Ich war vielleicht für einige ein Vorbild durch meine Ungebundenheit, meine Unabhängigkeit von irgendwelchen Wohnungen, Orten oder Familien, durch die Lockerheit meines Lebenswandels. Ich glaube, das hat einige jüngere Leute mehr fasziniert als das, was ich geschrieben habe. Andererseits war es für das Publikum im Prenzlauer Berg, dem ich das ja immer vorgelesen habe, sehr wichtig, diese lustigen, wüsten Geschichten zu hören.
Bielefeld: Nun gibt es die Vorstellung, daß die Prenzlauer-Berg-Connection stark von der Stasi unterwandert bzw. gesteuert war. Sie sagen aber in Nebbich, das sei, trotz Schedlinski und Anderson, die IM der Stasi waren, nicht der Fall gewesen.
Endler: Die Frage ist ganz einfach: Hätte es den Prenzlauer Berg auch ohne die beiden gegeben? Und da kann man nur sagen, den hat es vorher schon gegeben, den hätte es auch weiterhin gegeben, auch ohne die organisierenden Aktivitäten von Anderson und Schedlinski. Den Prenzlauer Berg hat es sogar ohne Prenzlauer Berg gegeben, an verschiedenen Orten der DDR, in Erfurt und anderswo, das war insofern ein republikweites Gebilde. Aber natürlich hat Anderson versucht, überall reinzukommen, oft ist es ihm auch gelungen. Es hätte den Prenzlauer Berg auch ohne diese beiden Helden gegeben. Daß sie da waren, gehört zu den unangenehmeren Erfahrungen meines Lebens.
Bielefeld: Nun kann man Ihrem Buch entnehmen, daß Sie durchaus kein DDR-Nostalgiker sind. Trotzdem die Frage, trauern Sie der Zeit auch ein bißchen nach? Es war ja eine besondere Situation: Man war dagegen, konnte aber trotzdem ganz gut existieren. Gab es in dieser Bedrückung nicht auch eine große Freiheit?
Endler: Ich trauere dem keine Sekunde nach. Aber es stimmt, was kürzlich in einer Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung stand, von einer Rezensentin, die meine Sachen gut kennt: Die Texte der achtziger Jahre enthalten noch eine besondere Zutat, die nach der Wende verlorenging, eine Prise schwarzen Humor oder Salz und Pfeffer. Das empfinde ich auch so. Der Widerstand war plötzlich weg, bestimmte satirische Bewegungen fanden nicht mehr statt. Ich sehe das auch als Mangel – aber ich habe nicht darunter gelitten.
Bielefeld: Das ist ja ein gern gebrauchtes Argument, ein bißchen Druck, ein bißchen Unterdrückung sei gerade gut für Schriftsteller, da müßten sie ihre Worte wägen.
Endler: Ich bin kein Anhänger dieser Meinung, ich glaube auch nicht, wie Jünger, daß Zensur den Stil veredelt. Ich finde es schon wichtig, daß man sich einigermaßen unbedrückt und frei artikulieren kann. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der andere Qualitäten gefordert waren, die heute nichts mehr gelten. Ich akzeptiere das.
Bielefeld: Welche Qualitäten sind das?
Endler: Schlauheit, Gerissenheit – derlei.
Bielefeld: Sie werden im September dieses Jahres 75 Jahre alt. Wenn Sie eine vorläufige Bilanz ziehen müßten, wie würden Sie Ihr Leben und Ihr Werk bilanzieren? Wie würden Sie es einschätzen?
Endler: Ich würde sagen, wenn ich einige kaputte Teile weglasse, und die kaputten sind die scheinbar gesunden, ist es eine runde Sache, auf die ich zurückblicken kann. Und die abgeschlossen ist mit Nebbich.
Sinn und Form, Heft 2, März/April 2010
Laudatio auf Adolf Endler
Empfänger der Otto Braun-Ehrengabe
„Anschreiben gegen Festgeschriebenes!, so oder ähnlich würde mein Wappenspruch lauten,“ gibt Adolf Endler „Auskunft in eigener Sache“, dieses in dem Sammelband Den Tiger reiten. Aufsätze, Polemiken und Notizen zur Lyrik der DDR, 1990 im Luchterhand Verlag. Und schränkt sofort wieder ein:
wenn ein Wappenspruch nicht auch schon wieder Festgeschriebenes wäre.
So spricht er folgerichtig dort auch von „der zuweilen in plötzlichen Weit- und Hochsprüngen sich vollziehenden Entwicklung meines literarischen Tuns im letzten Halbjahrzehnt“ (gemeint ist also das Halbjahrzehnt vor 1989). Einmal angefangen, muss ich den Satz wohl zu Ende zitieren, in dem Adolf Endler dann für die Entwicklung in „Weit- und Hochsprüngen“ ein Beispiel nennt: die „jähe Wegwendung von der Lyrik zur erzählenden Prosa, obwohl sie sich vorangemeldet hatte, in einer Reihe von Gedichten, die ich ,Phantastische Erzählungen in Versform‘ genannt habe, die immer wieder probiert, geübt worden ist auf fast manische Weise… (Schöner Fleiß das!, und es arbeiten sich die Züge eines dritten Gesichts hervor, die des Besessenen, des Irren – aber vielleicht „habe ich das nur ,gespielt‘?)“
Adolf Endler ist 1930 in Düsseldorf geboren, begann nach der Mittleren Reife eine Buchhändlerlehre, die er abbrach; er verdiente seinen Unterhalt u.a. als Transportarbeiter und Kranführer. Seine ersten Gedichte datieren aus dieser Zeit. Als Fünfundzwanzigjähriger wechselte er nach Konflikten um sein politisches Engagement in die DDR. Von 1955–1957 studierte er am Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig, anschließend nahm er an Meliorationsarbeiten der FDJ in der Wische/Altmark teil. 1979, er hatte protestiert gegen die Bestrafung von Stefan Heym und Robert Havemann, schloß der Schriftstellerverband der DDR ihn aus. Seit 1983 war er maßgeblich beteiligt an Wohnungslesungen am Prenzlauer Berg. Arbeiten von ihm erschienen in der DDR nur noch in den Untergrundzeitschriften Berlins und Leipzigs.
Das ist eine Schriftstellerbiographie, in der sich die politische Entwicklung sowohl der frühen Bundesrepublik als auch der Deutschen Demokratischen Republik – nicht „spiegelt“ – vielmehr in der ein Schriftsteller unserer Zeit von dieser Zeit exemplarisch gebeutelt wird, genauso aber auch seine Zeit beutelt. „Wer sich auf ein Nadelkissen setzt, verspürt einen stechenden Schmerz im Gesäß, aber manchmal nicht nur dort: Adolf Endlers Nadelstiche wirken bis in den Kopf,“ schreibt Bernd Jentzsch 1980. Jentzsch resümiert dort: „Endlers Texte lesen sich, als habe jemand den kritischen Extrakt aus Dutzenden von Romanen notiert – mit einer Einschränkung: Romane von einer derart provokanten Produktivkraft sind in der DDR noch nicht geschrieben worden.“ Johannes R. Bechers Forderung – in Sinn und Form –, das Sonett müsse der „Gesetzlichkeit des Schönen“ Genüge tun, beantwortet Endler 1976 mit einem als Block geschriebenen Vierzehnzeiler, der nur durch die Trennstriche im Text als solcher auszumachen ist, „Akte Endler“ überschrieben:
Wäscht sich oft nicht Zahnausfall Stinkt stark aus dem Rachen / auch Schweißfuß Liest die Tageszeitungen auf dem Klo / Ausschließlich Hat niemals einen Schwarzen Anzug besessen / Neigt zu Alleingängen einsamer Pilzsucher Säuft / Wäscht sich nur flüchtig wenn überhaupt Und (zahlreiche Zeugen) / Hält sich noch nicht einmal, wenn er wieder herumhuren / Zieht (wöchentlich bis zu sieben Mal) und volltrunken dann / Vor ganz häßlichen Worten über unseren Johannes R / Becher zurück und vor allem dessen Sonettkunst
– „Nadelstiche bis in den Kopf!“ zitierte ich Bernd Jentzsch.
Mit Tarzan am Prenzlauer Berg, untertitelt „Sudelblätter 1981–1983“, 1994 erschienen, wird Adolf Endler heute wohl am ehesten identifiziert – des schlagkräftig-eingängigen Titels wegen auch von Nichtlesern. Es ist „skizzen- und chronikhafte Sudelprosa“ eines „Ein-Mann-Undergroundes“ (Ursula März), ist, hätte Endler jenen Titel nicht schon für einen früheren Prosaband verwendet, Vorbildlich schleimlösend. Beispielhaft für Endlers Œuvre sind schließlich heranzuziehen – und mehr als beispielhaft ist im Rahmen einer solchen Laudatio nicht möglich – seine, wie er es nennt, „Satirischen Collagen und Capriccios 1976–1994“: „Die Exzesse Bubi Blazezaks im Fokus des Kalten Krieges“, der Ansatz zu einem „in unregelmäßigen Abständen angekündigten“ (A. E.) und diesem Ansatz nach gewaltigen Schelmenromans, 1995 bei Reclam, Leipzig, erschienen. Ansatz? „Endler hat die Eigenart,“ schreibt Helmut Böttiger zu Endlers späterem Reisebuch Warnung vor Utah, „all seine Bücher als vorläufige zu bezeichnen – mittlerweile weiß man, daß in diesen Versprechen […] schon die ganzen Edelsteine funkeln.“
„Anschreiben gegen Festgeschriebenes“, – und dann doch seinen Widerwillen gegen einen Wappenspruch, weil auch ein Wappenspruch Festgeschriebenes sei –, habe ich Adolf Endler eingangs zitiert. In Tarzan am Prenzlauer Berg, unterm Stichwort „Die Russen“ erzählt Adolf Endler von der Putzmethode eines Moskauer Putzgeschwaders, „das den Fliegendreck auf einer Schaufensterscheibe ledlich hin und her wandern läßt.“ Ein Besserwissser, „Inkarnation des weithin dominierenden Überlegenheitsgefühls des DDR-Deutschen gegenüber Tschechen, Polen und vor allem ,Russen‘“, bemüht sich, den Frauen „eine wirkungsvollere Reinigungs-Methode ans Herz zu legen.“ Darauf die „höhnische Reaktion einer älteren Frau“ – und Adolf Endler: das „könnte vielleicht als Motto über all meinem Geschreibsel stehen“ . „Ich – dumm! Ich mach’ anders!“
Egbert-Hans Müller, Deutsche Schillerstiftung von 1859: Ehrungen – Berichte – Dokumentationen, 1998
Tarzan in Peitz
Die Fahrt dauert Stunden, denn Endler hat seinen eigenen Wegeplan dabei, ein geographisches Fossil aus dem Tourist-Verlag der DDR anno 1977. Ich traue mich nicht, den Wagen auf die halbwegs sichere Autobahn zu lenken, denn der Dichter gibt vor, den Weg übers Land zu kennen. Weil ich ihm schon den Griff zur filterlosen Roth-Händle untersagt habe, fehlt der Mut, den Wegweisungen des Dichters zu widersprechen. Dabei kommt mir eine Passage aus seinem Tarzan am Prenzlauer Berg in den Sinn, womit die Peitzer schließlich versorgt werden sollen. Da berichtet Endler von einer russischen Putzfrau, die den Fliegendreck auf einer Fensterscheibe lediglich hin und her wandern läßt, statt ihn zu entfernen. Auf den deutschen Einwand, „eine wirkungsvollere Reinigungsmethode“ zu probieren, antwortet sie höhnisch: „Ich – dumm! Ich mach’ anders!“ Endler schlägt vor, dieses Motiv über all sein „Geschreibsel“ zu stellen. So fahren wir denn den größtmöglichsten Umweg.
Draußen ist es bereits dunkel, und die Straßen werden immer schmaler. Der Wagen driftet regelmäßig vom Weg ab, weil Baulöcher und verdrehte Umleitungsschilder den Ortsfremden foppen. Immer wieder der Blick auf die poröse Karte. Dabei muß Endler die Brille wechseln. „Bald kommt Peitz“, murmelt sein Fahrer. Da – wieder ein Schild, das Hoffnung weckt! Wilde Jazz-Orgien soll es dort gegeben haben, als es die DDR noch gab. Und Karpfen; so weit das Auge reicht. Endler macht Witze.
Gleich kommen die Karpfen über die Straße gefegt, quer rüber.
Kein Fisch, aber ein Bauzaun stellt sich in den Weg. Urplötzlich gerät der Wagen ins Schlingern, weil die eben noch freie Bahn versperrt ist. Dahinter ein tiefes Loch. Kein Licht, kein Warnschild.
Herr Endler, das war ihre letzte Lesung!
Wann kommt Peitz?
Knapp drei Dutzend Ortsansässige sitzen im kühl-feuchten Turm der Amtsbibliothek und warten geduldig auf den sich verspätenden Dichter aus Berlin. Ein kleiner Warmlüfter macht Krach. Dann kommt Endler, fummelt aus dem Beutel (der Beutel! – übrigens ein literarisches Phänomen, auch Wolfgang Hilbig, der Literaturpreisträger von 1993, führt stets einen bei sich) seine Bücher hervor und begrüßt die schweigenden Gäste. Nur die Bibliothekarin tippelt aufgeregt zwischen den Stühlen herum. Endler liest und blickt dabei immer wieder ins Publikum. Gelegentlich läßt Endler einen der Arme in die Höhe schnellen und macht dabei eine leichte Krümmung. Gesten zur Verstärkung der Pointen. Das macht er immer so. Ein gestisches Markenzeichen. Aus dem „kohlstrunkartigen Knäuel wüster“ Tagebuchnotizen, ursprünglich ein gigantischer Blätterberg, der die Zeit von ’78 bis ’86 umfaßt, gerann eine Auswahl, die sich auf die Zeit vom Oktober ’81 bis Mai ’83 beschränkt.
Solche Selbstbeschränkung ist auch das Ergebnis des Mißmuts, ja, des Trübsinns, der mich zunehmend befiel, sobald ich mich in die trostlosen Schluchten meiner damaligen Tagebuchproduktion abzuseilen überredet hatte. (Endler)
Tieftraurig zuweilen, aber immer komisch. Entertainment!
Bereits nach einer halben Stunde schlafen zwei Kinder ein und betten sich auf den Oberschenkeln der Mutter. Die Eltern bleiben wach, verziehen jedoch keine Miene. Endler wirft eine Pointe nach der anderen in den Raum. Vier ältere Herrschaften wollen lachen. Nachdem sie sich im Publikum rückversichert haben, bleibt ihnen nur ein gehemmtes Grinsen. Aber sie blieben die einzigen. Nach gut anderthalb Stunden ist Schluß, und das Publikum verschwindet leise. Nur die, die gegrinst haben, bleiben sitzen. Und ein Rentner. Endler ist müde und will nach Hause. Aber der Rentner will noch etwas loswerden. Es bricht aus ihm heraus:
Herr Endler, wir haben nichts gewußt! Buchenwald, die KZs, wir habens nicht gewußt. Glauben Sie mir.
Und da sage noch einer, Literatur habe keine Wirkung.
Henrik Röder, 1995, aus LandSicht, Heft 2, 1995
Prolegomena zu einer wünschenswerten Studie
über Adolf Endler als Kommentator des Literaturbetriebs
In seiner launigen Vorbemerkung zur bisher einzigen Buchveröffentlichung seiner kritischen Arbeiten Den Tiger reiten (1990) bemerkt Adolf Endler:
[…] das ins Auge gefaßte Werk, wenn es auf sinnvolle, keinesfalls nur bürokratische Weise ,komplett‘ sein wollte, größere Zusammenhänge und differenzierte Hintergründe beleuchtend, müßte, […], mindestens 1.200, besser noch 1.600 Seiten stark sein.3
Dass es dann nur 150 Seiten wurden, verdankte sich der Skepsis des Verlags, der 1989/1990 andere Veröffentlichungsschwerpunkte für sich sah und in Hinblick auf ein mögliches Lesepublikum wahrscheinlich nicht so ganz falsch lag. Aber immerhin: Von den 4.000 aufgelegten Exemplaren konnten ca. 1.300 verkauft werden. Die Endlergemeinde muss also deutlich über den Kreis der Literaturkritiker hinausgegangen sein. In einem Brief an den Herausgeber hatte der damalige Geschäftsführer des Luchterhand Verlags, Helmut Frielinghaus, nämlich geschrieben:
Wenn das Buch dazu beiträgt, daß der Autor Endler einem größeren Kreis von Literaturkritikern in der BRD bekannt wird, wird das Herrn Endler einige Wege ebnen […].4
Frielinghaus, kein Kritiker, der sich an der unerfreulichen Verzwergung der Literatur aus der DDR beteiligte, sah also Endler als Autor für Kritiker; man sollte ihn aber als einen Autor für Autoren und den einer eingeschworen Lesergemeinde sehen. Sein Weg auch als Kommentator5 zeigt das meines Erachtens deutlich.
In den Jahren zwischen 1957 und 1965 erschienen Dutzende von ausführlichen Rezensionen6 und Kurzkritiken in den Zeitungen und Zeitschriften Berliner Zeitung, Sonntag, Junge Welt, Schatulle, Neue Deutsche Literatur, die Endler als differenzierenden Kritiker zeigen. Er setzte sich sowohl mit der Lyrik als auch der Prosa der DDR auseinander. Nach 1965 sollte eine Pause bis zum Beginn der 1990er Jahre eintreten, bis er sich wieder in einem Essay zur Prosa äußerte. Es lassen sich aber schon vor dem Einsetzen der ,Lyrikwelle‘ ab 1962/1963 deutliche Schwerpunktsetzungen seiner kritischen Tätigkeit feststellen. Mehrfach schreibt er sympathisierend,7 schließlich aber auch vorsichtig kritisch über Johannes R. Becher.8 Aus heutiger Sicht irritierend ist die wiederholte Beschäftigung mit Bernhard Seeger und dem lyrischen Idylliker Uwe Berger. Selten geht der Blick über die Grenzen – einmal in Richtung Erich Kästner,9 dann wieder in Richtung Mao Tsetung.10 Zugleich entstehen in der ersten Hälfte der 1930er Jahre Porträtgedichte zu Blok, Majakowski und Jessenin11 – diese Traditionsbezüge gehen aber nicht in Endlers Rezensionstätigkeit ein.
Die zunächst mit deutlicher Zustimmung rezensierten Lyriker der DDR sind Erich Arendt, Franz Fühmann, Hanns Cibulka, Walter Werner, Wulf Kirsten und Heinz Czechowski. Cibulka und Fühmann sollten Endler allerdings später als Lyriker nicht mehr beschäftigen. Die Rezension „Czechowski und andere“12 von 1963 ist als Vorarbeit für den programmatischen Artikel „Lyrik und Lyriker“13 zu betrachten. In diesem Artikel werden nämlich jene Autoren und Autorinnen zusammengeführt, die nach einer späteren Idee Endlers ironisch als „Sächsische Dichterschule“ benannt wurden und unter diesem Etikett in Literaturgeschichtsschreibung eingingen.14 Karl Mickel, Volker Braun, Heinz Czechowski und Sarah Kirsch galten Endler Mitte der 1960er Jahre als wichtigste Autoren der jüngeren Generation.
Gedichte dieser Autoren und des etwas älteren Günter Kunert standen 1966 im Mittelpunkt der Debatte im FDJ-Organ Forum. Es schien für einen kurzen Augenblick noch möglich – nach dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965, das als Zäsur und Rücknahme der liberaleren Phase der SED-Kulturpolitik nach 196115 gelten kann –, eine offene Diskussion in Teilbereichen der literarischen Öffentlichkeit zu führen. Endler und andere hielten an der Idee widerstreitender Literaturvorstellungen fest. Endler profilierte sich als Polemiker, der sich zugleich von dem harmonistischen Sozialismusbild von Zeitgenossen und selbst von idyllischen Vorstellungen löste, die sich in der offiziösen Literaturkritik mit dem Namen Becher verbanden.16 Im Ergebnis aber konnte die mit wenigen Ausnahmen eher agonische Veröffentlichungspolitik bis 1971 nicht gestoppt werden.
Zu den wenigen Ausnahmen gehörte auch die von Endler und Mickel herausgegebene Lyrik-Anthologie In diesem besseren Land.17 Nach heftigen Kontroversen um Auswahlprinzipien und das Vorwort der Herausgeber konnte der Band 1966 erscheinen.18 in der Anthologie fehlten hochgelobte Lyriker wie Helmut Preißler oder Max Zimmering, wohingegen Gedichte von Autoren der jüngeren und mittleren Generation aufgenommen wurden, die uns heute geläufig sind: Volker Braun, Heinz Czechowski, Adolf Endler, Peter Hacks, Bernd Jentzsch, Heinz Kahlau, Rainer und Sarah Kirsch, Günter Kunert, Richard Leising, Karl Mickel, Inge und Heiner Müller, und B.K. Tragelehn. Zu den Auswahlgrundsätzen heißt es im Vorwort:
Was die Herausgeber verband, war eine nicht kleine Unduldsamkeit gegenüber Halbfabrikaten, die als Vorformen interessant sein mögen.19
Die Jahre bis 1971 waren für die Literaturpolitik in der DDR höchst statische Jahre. Endler konnte zwischen 1965 und 1971 wenige Rezensionen im Sonntag und in der Neuen Deutschen Literatur unterbringen; ganze sieben Gedichte erschienen in der DDR zwischen 1967 und 1973.20 Paul Wiens, Uwe Berger, Norbert Kaiser, Kurt Bartsch und Uwe Greßmann wurden rezensiert, keiner der Autoren, mit denen Endler enger freundschaftlich verbunden war, konnte vorgestellt werden, da diese wie Endler auf ihren nächsten Gedichtband warten mussten. Aber in diese Periode fällt der Beginn von Endlers intensiver Fürsprache für den 1969 mit 36 Jahren verstorbenen Autor Uwe Greßmann,21 der durch diese und weitere Bemühungen von Elke Erb, Karl Mickel, Richard Pietraß und anderen einen Platz in Verlagen in der DDR gefunden hat – westlich der Elbe ist er nie angekommen. Die Schublade war die Sammelstelle für Endlers eigene Arbeiten, denn nur selten wurde er zu Lesungen eingeladen. In ihr befanden sich zum Beispiel ausgearbeitete Referate aus dieser Zeit wie ein Vortrag, der 1968 in Weimar gehalten wurde („Wie in Thüringen gedichtet wird“).22 Er harrt wie anderes der Veröffentlichung. Immerhin begann für Endler Ende der 1960er Jahre die Zeit der Nachdichtungen. Im November 1970 veröffentlichte Sinn und Form die große Studie „Versuch über die georgische Poesie“.23 Mit dem Aufenthalt von zweieinhalb Monaten in Georgien im Jahr 1969 (gemeinsam mit Rainer Kirsch und Elke Erb) begann die intensive Auseinandersetzung mit der georgischen Lyrik, die bis heute nichts von ihrer eindrucksvollen Genauigkeit und poetischen Faszination verloren hat.24 Diese Arbeit sicherte wegen der großzügigen georgischen Honorierung für einige Zeit Endlers Lebensunterhalt.
Die Schubladengedichte, vereint in dem Band Das Sandkorn, fanden 1974 nach dem 8. Parteitag der SED 1971 den Weg in die Öffentlichkeit. In den Abschnitt „Anmerkungen zur Kulturwissenschaft“ konnte nun auch „Die düstere Legende vom Karl Mickel“ von 1967 aufgenommen werden, die im Zusammenhang mit der Lyrikdebatte 1966 entstanden war und souverän Sexualfeindlichkeit und Akademismus verhöhnte:
[…] Ob mit Eheringen, güldnen, ob mit Beilen
Zielten sie auf was man lustvoll schiebt.
(Drei Doktoren gründlich tilgen Mickels Zeilen,
Bis es keine auf der Welt mehr gibt.)
Eisig nunmehr, Heros düsterer Ballade,
Er skandierte: Each man kills the thing he loves.
Und sie taten es und schnürten ihn zum Rade.
Konnte keiner Englisch in dem Rund des Kaffs?25
Endler hat sich immer dagegen verwahrt, als Theoretiker angesehen zu werden,26 sondern sich stets als kritischer Kollege und Begleiter gesehen, als jemand, der auf Vergessenes oder Vernachlässigtes hinweist, nicht zuletzt und später immer deutlicher als Freund, der anderen das Werk des Freundes vorstellt. Dummheit und Ignoranz aber riefen beim Endler der frühen 1970er Jahre heftige Polemik hervor. Als 1970 die Aufsatzsammlung Verse, Dichter, Wirklichkeiten des Germanisten Hans Richter erschien, die die Arbeiten Bechers, Brechts und die Arbeiten ihrer und der nachfolgenden Generation als den Hauptstrang der DDR-Lyrik akzentuierte, konnte Endler seinen widersprechenden Beitrag „Im Zeichen der Inkonsequenz“27 in Sinn und Form veröffentlichen und eröffnete damit die wohl wichtigsten Debatte über die DDR-Lyrik, auf die bis heute immer wieder Bezug genommen wird, die allerdings leider nie hinreichend dokumentiert wurde. Es würde sich dann nämlich zeigen, dass Endlers berühmtes Diktum „Die Ignoranz durch die Germanistik, die immer noch als eine dürre Gouvernante einen blühenden Garten (die Lyrik der DDR) beschimpft, macht den vollkommenen Abbruch der Beziehungen zwischen Germanisten und Poeten verständlich, der inzwischen perfekt geworden ist“, absolut zutreffend für die kritisierte Arbeit war, aber eine zutreffende Kritik der Germanistik in der DDR schlechthin nicht bot. Auch wenn Endlers weitere Beiträge differenzierter ausfielen,28 so blieb nach dem Schluss der Debatte das Unbehagen, es sei da auch aneinander vorbeigeredet worden. Was bleiben sollte bis zum Ende der DDR: Zwei Endler-Rezensionen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zu Akte Endler. Beispielsweise hatte hingegen Volker Braun in Dieter und Sylvia Schlenstedt getreuliche und kompetente Germanisten und Rezensenten an seiner Seite. Letztere aber waren mit den Zeitläuften in der DDR noch im hoffnungsvollen Gespräch.
Die Lyrik-Debatte 1971/1972 hatte Endler als Autor gezeigt, der argumentativ eine andere literarische Öffentlichkeit erreichen wollte, vielleicht noch an die Reformierbarkeit des politischen Systems glaubte: Er trat auf dem Schriftstellerkongress 1973 auf, konnte in der Akademiezeitschrift Sinn und Form zwischen 1973 und 1975 Arbeiten zu Erich Arendt, Wilhelm Tkaczyk, Inge Müller und Sarah Kirsch unterbringen. Spätestens nach der Biermann-Ausbürgerung im November 1976, gegen die er zusammen mit Elke Erb protestierte,29 erledigten sich für Endler die Hoffnungen auf die Reformierbarkeit des Systems. Als er dann nach einem Protest gegen die Verurteilung Stefan Heyms wegen Devisenvergehens 1979 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wurde, waren auch die Veröffentlichungsmöglichkeiten versperrt.30
Neben Veröffentlichungen in der Bundesrepublik, in denen er seine Auseinandersetzung insbesondere in der Prosa mit Charaktermasken wie Hermann Kant,31 Erik Neutsch,32 Helmut Preißler33 und Publikumslieblingen wie Eva Strittmatter34 fortsetzte, blieb ihm nur der Weg in die Berliner und Leipziger Untergrundzeitschriften. Als Auftakt für diese Publizistik ist der 1985 vom NDR gesendete Beitrag „Wörter, Wörter. Momente neuer Lyrik in der DDR“ anzusehen. Es folgten resümierende Beiträge in den Zeitschriften ariadnefabrik, Zweite Person und Bizarre Städte, die Endler als vierten Mentor der alternativen literarischen Szene neben Franz Fühmann, Gerhard Wolf und Elke Erb zeigen.35
Von kaum zu überschätzender Bedeutung für Endlers kritisches Werk ist der Lesebetrieb, den er und Brigitte Schreier-Endler mit Orplid & Co. organisierten. Es lasen in der Zeit vom April 1991 bis April 1998 ca. 150 Autorinnen und Autoren. Wesentlich war den Endlers eine selbstverständliche Präsentation der Autoren und Autorinnen des Prenzlauer Bergs und eine Vorstellung von Konzeptionen aus Ost und West. Eine Würdigung von Endlers kritischem, hier kulminierendem Wirken hätte eine eigene Studie verdient.
Als 1994 Endlers Tagebuchblätter aus den Jahren 1981 bis 1983 Tarzan am Prenzlauer Berg36 erschienen, war die Prenzlauer-Berg-Szene durch die Enttarnung von Sascha Anderson und Rainer Schedlinski als Mitarbeiter der Staatssicherheit in Misskredit geraten.
Endler ließ nun in seinen Tagebuchnotizen erkennen, dass die Gruppe der Dichter des Prenzlauer Bergs beileibe nicht eine des literarischen Eskapismus war, sondern dass sie nach Formen der Rede suchte, die das Konzept der Fürstenerziehung (Volker Braun) oder Fürstenbeschimpfung (Wolf Biermann) als ausgeschöpft ansah. Es ist daher auch kein Zufall, dass er einen großen Teil seiner Notizen der listigen Widerständigkeit des schwerkranken Erich Arendt widmete. Es gelingt ihm das überzeugende und anrührende Porträt eines Dichters, in dessen Ästhetik Sprache zum Medium eines alternativen Denkens und Lebens wird. Endlers Tagebuch – wie zuvor schon seine Essaysammlung Den Tiger reiten – zeigt eindrucksvoll, dass sich im Berliner Untergrund eine Form des Lebens und Schreibens herausgebildet hatte, die ihre Bedeutung durch die Enttarnung zweier Spitzel nicht verlieren wird. Anmaßende Geschmacklosigkeiten des Literaturbetriebs sind deshalb noch lange nicht auszuschließen. Endler hat 1996 die unmäßigen und von keiner Kenntnis getrübten Angriffe Biermanns auf die Berliner Szene in seiner fulminanten Rede „Gelächter aus dem Akten-Whirlpool“ zurückgewiesen.37
Für seine Tagebuchaufzeichnungen ist Endler mehrfach ausgezeichnet worden. Endler pflegte das Buch „Mein Steadyseller“ zu nennen.38 Für Endler war die Zeit der Angriffe auf die Prenzlauer-Berg-Szene nur schwer zu ertragen bis unerträglich. Die Tätigkeit für Orplid und die USA-Reise im Jahre 1995 waren für das seelische Gleichgewicht sehr wichtig. 1996 erschien die Reisereflexion Warnung vor Utah. Kuriositäten und Merkwürdigkeiten des literarischen Lebens wie Steinbeck-Kult und eigenwillige Henry-Miller-Ehrung, Reste und Kontinuitäten der Beat-Literatur in San Francisco sind das Thema; aber – so die Botschaft – die subversive Kraft der Literatur lässt sich nicht tilgen, nicht aus der eines Dashiell Hammett, eines Ginsburg, schon gar nicht aus Thomas Pynchons „Vineland“, das Endler ais poetischer Leitfaden begleitet.39
In den kritischen Notizen von Belang ragt seine letzte größere kritische Arbeit über Wolfgang Hilbig heraus, bei der auch die Prosa eine Rolle spielt und das bis dato bekannte Werk des Autors wie kaum sonst bei Endler zum angespannten Leben des Autors Hilbig ins Verhältnis gesetzt wird.40 Überhaupt meine ich, dass spätestens seit 1978 Endlers kritische Reflexionen Sympathiebekundungen für Autoren wie Erich Arendt, Frank-Wolf Matthies, Eberhard Häfner, Istvan Eörsi und Autorinnen wie Sarah Kirsch und Inge Müller sind.
Man wird eines Tages Endlers letzte Jahre möglicherweise „Die Pankower Jahre“ nennen: Angenehme Wohnverhältnisse mit Brigitte Schreier-Endler, ein Verlag, an den er sich gebunden und bei dem er sich aufgehoben fühlte, die Andeutung von Anerkennung durch mehrere Literaturpreise.
1.600 beziehungsweise 1.200 Seiten werden es wohl nicht, aber doch 500 Seiten Endler-Texte nach der Definition der Anmerkung 3. Hinzukommen sollten Gedicht- und Prosaauszüge, die markante Sympathiekundgebungen und ausgewählte schroffe Ablehnungen von Autorinnen und Autoren und literarischen Konzepten enthalten. Unabdingbar wäre die Dokumentation von Stimmen der Lyrik-Diskussionen von 1966 und 1973 sowie erläuternde Anmerkungen. Das wären dann 650 Seiten. Sollten dann noch Transkriptionen von diversen Orplid-Veranstaltungen existieren, wären 800 Seiten zu erwarten – „Naja, eben die üblichen kühnen Entwürfe so!“ (Zweckentfremdetes Zitat aus Endlers Nadelkissen, S. 56)
En attendant des zweiten Bandes der Endler-Werkausgabe…
Manfred Behn, aus Text+Kritik: Adolf Endler – Heft 238, edition text + kritik, 2023
KNOCHENGELÄCHTER
(für Eddi Endler; gestorben am 2. August 2009)
Heut brennt die Suppe an.
Kein Lüftchen geht.
Der Sommer kam spät
mit Sirenengesang.
Vom Ei das Schwarze
das Horn von der Katze
vom Hund die Feder
vom Butt das Leder!
Im Bart eine Flause
im Auge ein Splitter
im Hals ein Gezitter
ums Herz eine Krause!
Heut schmorte die Suppe.
Potz, Grillenbein!
Vom Stern eine Schnuppe
fiel auch hinein.
Thomas Böhme
ADOLF ENDLER
Wackersteinlos grell getönt
Bleib verflixt und unzugenäht
Graddrum mein Fraßwanst
O diese Wonneproppentonne
Bleib unverflixt und zugenäht
Wackersteinlos
Im sandkuchenen Jenner
Einem überweinsaueren September
Mit bitterem Dumpf
Schlagt und brüllts dem Gör
vom Wege ab brüllts dem Gör ins Öhr
Wackersteinlos hell
Peter Wawerzinek
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


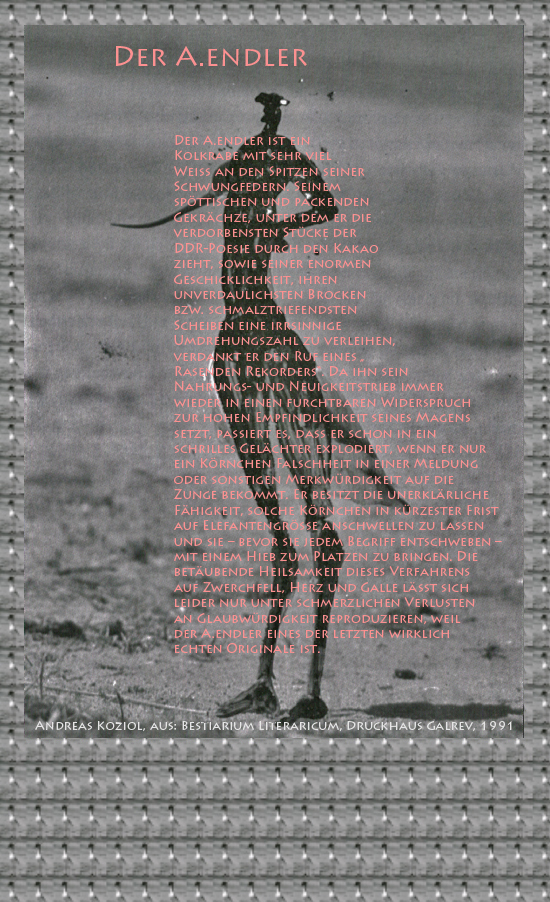
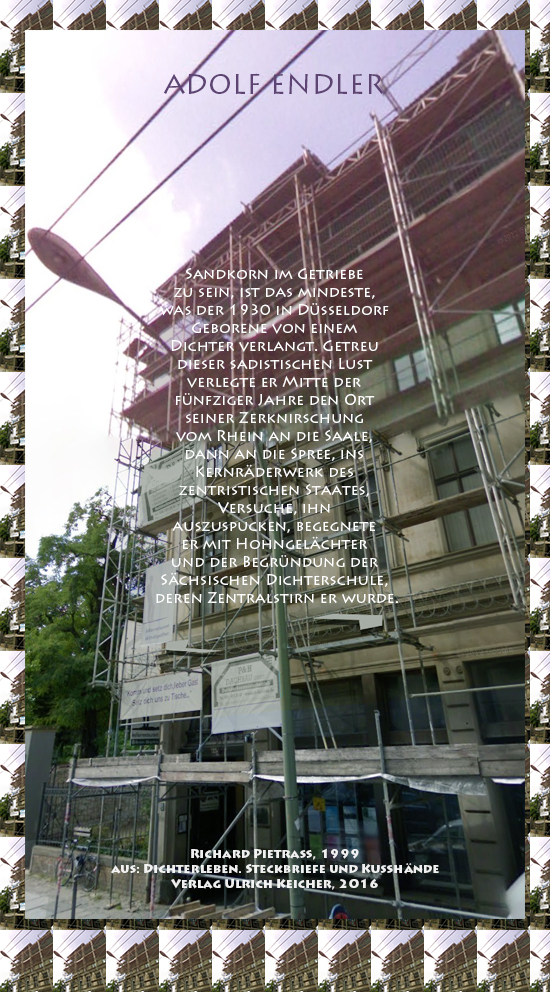












Schreibe einen Kommentar