Adolf Endler: Krähenüberkrächzte Rolltreppe
MARSCHLIED
Mein eines Aug’ leer,
Ab mein anderes Bein;
Ich marschier’ linkszwodrei
Stolz zur Höllen hinein…
–Na, nu mach schon!
Nachbemerkung
Manche dieser kurzen Gedichte begnügen sich mit einer einzigen Zeile, die meisten kommen mit fünf oder zwölf Zeilen o.ä. aus, keines findet sich in dem Sammelband „Der Pudding der Apokalypse“ (1999). Wie man sich denken kann, handelt es sich oft um sogenannte „Gelegenheitsgedichte“, auf ein bestimmtes Ereignis bezogen, einem bestimmten Adressaten gewidmet, wenn sie nicht ein mehr oder weniger zufälliges Nebenher sind. Ein Teil der Texte findet sich in früheren Gedichtbändchen, die bei der Zusammenstellung des „Pudding“ nicht berücksichtigt worden sind, eine andere Gruppe ist in den letzten Jahren entstanden. Natürlich wird die Kollektion wiederum zu einer Dokumentation der zuweilen reichlich krummen Wege meines Lebens: Frühes und Spätes kommentieren sich gegenseitig.
Adolf Endler, Dezember 2006
Adolf Endler hat ältere an entlegenem Ort publizierte
und neue unveröffentlichte Gedichte chronologisch zusammengestellt zu einer „Dokumentation der zuweilen recht krummen Wege meines Lebens: Frühes und Spätes kommentieren sich gegenseitig“.
„Eines ist bei allem Tohuwabohu sicher: Ich wollte im Grunde immer ein Lyriker sein – und sonst gar nichts“, sagte Adolf Endler in seiner „Selbstvorstellung“ zur Aufnahme in die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung in dem ihm eigenen Ton des augenzwinkernden Understatements. Das ist für einen, der nicht wenige Prosabücher aus seinem geheimnisumwitterten „sechsunddreißigbändigen Romanwerk“ veröffentlichte, so bemerkenswert wie einleuchtend. Endler hat in den fünfziger Jahren als Lyriker begonnen, und er hat zeit seines Lebens Gedichte geschrieben und veröffentlicht. Seine Leichtigkeit und seine spielerische Gestik – „Wer nicht zaubern kann, der ist verloren.“ (Ludwig Hohl) – wird seit langem geschätzt, aber erst relativ spät wurde in Endlers einzigartigem Ton auch das außerordentliche Formbewusstsein erkannt. Seinen letzten Gedichtband nannte Jens Jessen „den in Wahrheit bedeutendsten vom Ende des zwanzigsten Jahrhunderts“.
Wallstein Verlag, Klappentext, 2007
Mein Vers hat ein scharfes Ende
Der Dichter Adolf Endler, 1930 in Düsseldorf geboren, hatte in der Sächsischen Dichterschule immer einen besonderen Ton. Ein Rheinländer mit einem belgisch-böhmischen Hintergrund, den es 1955 als Gegner der Wiederbewaffnung, aber auch als Brecht- und Huchel-Leser in den Osten verschlägt.
Nicht gleich zeigen sich dort die „schlechten Besonderheiten“ (Hegel), aber Endler verlässt früher und vor allem flagranter als andere die „gepriesene Hauptstraße der DDR-Lyrik“. Nachdem er sich mit seinem lyrischen Hauptwerk „Der Pudding der Apokalypse“ vor acht Jahren zeigte, folgt jetzt eine Sammlung älterer und neuerer unveröffentlichter Kurz-Gedichte, ein Grundstock aus einem halben Jahrhundert.
In dem Band „Krähenüberkrächzte Rolltreppe“ korrespondiert Frühes und Spätes miteinander. Und sei es, dass ein poetischer Kugelblitz das Vergangene erhellt. Auch im kleinsten Gedicht versucht Adolf Endler, gegenüber den unbeherrschbaren Dingen dieser Welt seine Autonomie zu behaupten. Aber kein anschwellendes Beben, kein Schnörkel, kein selbstverliebtes Wort.
Mit Effet
Das frühe Gedicht „Neunzehnhundertsiebenunddreißig“ hat schon den Effet künftiger Verse. „Auf krausem Schuttplatz / Schwelt die sumpfige Matratze / Da hock ich einsam und / Da schnitz ich mir den Pfeil / Den hab ich noch heute.“ Wie in Endlers Prosa liest man auch in seinen Gedichten viel von seiner zersplitterten Biographie, alles hängt in seinem zerrissenen Leben miteinander zusammen. Gedichte als Lebenssplitter, zur Pointe geschnürt, mit markanten Titeln versehen. Bis in die letzten Gedichte zeigt sich der Krieg. Wer die Geräusche des Krieges gehört hat, wird sie nicht mehr los. „Im Schatten der Überroten Endgültigen Brände / Ich bin im Aschengelände mit Drei Mal Getöteten Toten // Mein Vers hat ein Scharfes Ende // Und nicht Einer für ihn Fand die Noten“.
Aber es ist nicht nur der Krieg, auch die angehaltene Zeit in der DDR erlebt Endler in Leipzig und Berlin als Unfrieden. Er wehrt sich und macht die verblüffende Entdeckung, das streng umgrenzte Leben sei in der „Hauptsache surrealistisch“. Nie wurde die DDR so verlacht. Seine Bonmots in den langen Nächten des Prenzlauer Bergs funkeln mitten aus dem Ost-Berliner-Sagenschatz. „Auf diese Weise kommst Du nie auf die vorderen Plätze, mein Alter, nein, niemals! Da reichen oft drei so ’ner Sätze!“
Endler bleibt unabhängig, unbestechlich, ungehorsam. Aber seine Auflehnung wählt die Mittel eines Dichters. Auch in seiner Outlaw-Stellung bleibt er nur der Literatur verpflichtet. „Mir war diese Vorstellung, statt mit literarischem Ruhm mit so einer Art Dissidentenruhm bekannt zu werden, unangenehm,“ sagt er in einem Interview. Adolf Endler kann nichts anderes sein als ein Dichter. So hat er auch einen Blick für das Zarte, die Frauen, die Liebe – wie in dem Gedicht „Ritornell“. „Abruptes Licht o Sonnenstrahlentraube / Der Schlag auf die Scheitellinie der Frau / Zögert und wird eine Taube.“
Adolf Endler arbeitet jetzt an einem größeren Prosawerk. Seine Lyrik betrachtet er als abgeschlossen. Der Band „Krähenüberkrächzte Rolltreppe“ könnte zu seinem letzten Gedichtbuch werden. Es sei denn, seine Schränke voller Gedichte werden noch einmal geöffnet. Es gibt noch viel zu entdecken bei diesem Dichter, gut zu machen ohnehin.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 18.1.2008
Gold- und Haifisch
Der geborene Düsseldorfer Adolf Endler, der im Jahr 1955 von der Bundesrepublik in die DDR wechselte, war nirgendwo ein Jasager, und so sahen die Genossen in dem Überläufer bald einen Irrläufer. 1979 wurde er aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Aber als Mitglied und Namensgeber der „Sächsischen Dichterschule“ und der “Prenzlauer-Berg-Connection“ war er nicht so einfach zum Schweigen zu bringen, weder von der Partei noch von den „Gouvernanten“ der linientreuen Literaturwissenschaft. Er war in der Literatur der DDR ein Gold- und ein Haifisch zugleich, ein Sprachspieler mit scharfem Biss gegen die Gängelung der Schriftsteller, im Kalten Krieg ein Liebhaber des sprachlichen Capriccios und ein Fechter mit der Waffe der satirischen Collage. Von dieser Zungenfertigkeit gibt die Sammlung von neunundsiebzig Gedichten aus einem halben Jahrhundert aber leider keine rechte Vorstellung. Der ironische „Aufruf an die Kunstakademie“, die Entlarvung von Johannes R. Bechers geschwollenem Lob des Jahrhunderts, die zornige Reaktion auf das „Störmanöver“ und die „Zwischenrufe“ bei einer Lesung in Perleberg und einige der Kurz- und Kürzestgedichte mit epigrammatischer Pfeilspitze zählen zu den Ausnahmen. Keine Ernte, sondern eine Nachlese hält Endler hier. Ein Verlegenheitsband? In seiner Nachbemerkung erklärt er viele der „Gelegenheitsgedichte“ als ein „mehr oder weniger zufälliges Nebenher“. Seiner Aufrichtigkeit bleibt Endler also auch hier treu.
WHi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.1.2008
Krähenüberkrächzter Paradiesvogelschiß
− Peter Rühmkorf und Adolf Endler melden sich mit zwei grandiosen Gedichtbänden zu Wort. −
Betrachtet man das oft verkrampfte und artifizielle Treiben der jungen Lyrikergeneration und nimmt dann einen Band wie die Krähenüberkrächzte Rolltreppe von Adolf Endler oder den jüngst erschienenen Paradiesvogelschiß Peter Rühmkorfs zur Hand wird klar: Narrenfreiheit, das ist nicht nur etwas fürs Altenteil. Angst vor der zwielichtig krummen Formulierung? Angst vorm überall lauernden Kalauer? Verbeugung vor dem politisch korrekten, vor dem Feuilletonopportunen? Oder bildungsbürgerlich aufgepimpte Hirnforschungslyrik? Nichts davon.
Aus den Bänden beider Lyriker atmet buntes Leben, bei Endler ist es im Unterschied zu Rühmkorf ein Best-of seines Schaffens, aber auch Rühmkorfs lyrischer Reigen fügt sich nahtlos in eine lebenslange Schaffenstradition.
Bei beiden Lyrikern ist die Ursuppe der eigenen Kreativität gegen jede gekünstelte Versjonglage gerichtet, der Dichter mit dem spitzen Bleistift, der sog. „poeta doctus“, bekommt eine (selbst-)ironische Zuckerung, denn, so ist bei Rühmkorf zu lesen: „poeta doctus / Er war ein Dichter vom Schuh bis zum Scheitel / mit Bildung gefüllt / wie ein Staubsaugerbeutel.“
Klar wird, Bildung und Dichtung befruchten sich, dies aber nur unter Ausschaltung höherer Instanzen, denn „Ich kannte mal eine Unschuld vom Lande, / die war praktisch zu gar nichts im Stande, / außer zu fressen, zu trinken, zu lachen / und noch ein paar weiteren Sachen.“
Also Machismus in Reinform? Viagra oder freundliches Omnipotenzgebahren eines Grand senior der lyrischen Volksmusik? Gerade dann, wenn die eigene Lebensflamme langsam weicht, wird hier die gewohnt uneitle, bisweilen einfache Sprache messerscharf eingesetzt, Kalauerklaps inbegriffen. Die Herren lassen es also noch einmal krachen, und zwar in bewährtem Hedonismus.
Dann plötzlich das drohende Verscheiden, Damoklesschwert, „Ansteckende(s) Pfeifen“: „Nach einem Tal, so tief, so tief, / daß ich wirklich geglaubt hab, / hier wär kein Rauskommen mehr – / Und es hat mich sogar noch gejuckt, vor meine Mitmenschen hinzutreten: / Sterbliche ! / Wenn Sie bittemal meinen ausgetrockneten Zeigefinger / folgen wollen, objektiv, was sehn Sie? / Na, ich will es nicht gerade schwieriger machen, / als es ist: / DIE GRUBE –“.
Das ansteckende Pfeifen, jenes auskultatorische oder bereits mit bloßem Ohr hörbare Pfeifen, Giemen und Brummen, z. B. im Rahmen einer Lungenentzündung, korrespondiert hier mit der Todesverdrängung des lyrischen Ichs und dem seiner Leserschaft, lakonisch wird alles auf ein Wort zusammengedampft, reimlos und hart heißt es: „DIE GRUBE – “, wohlgemerkt mit offenem Gedankenstrich. Der Dichter also, wie immer besoffen und alle Antworten offen? Das lyrische Ich, soviel ist klar, pfeift aus einem wie auch immer gearteten letzten Loch, wobei dieses schonungslose Selbstbekenntnis den Leser an dieser Stelle betroffen zurücklässt. Ein Erfolgsdichter lässt sein Leben Revue passieren und fragt nach seiner postumen Bedeutung: „Und es zog mir siedend durch den Sinn, / daß es, um nur einen Schein von frühem Glanz zu wahren, / mehr bedarf, als im getunten / FIAT-Ritmo aufzufahren: / Gas – Und durch! – Und vorwärts mit Gewinn.“
Hier drückt jemand auf die Fiat-Rhythmus-Tube und fordert dies auch von den jungen Kollegen ein, denn „Sag, wie hältst du’s mit der Gegenwart!? / Siehe Kant: Was kann ich wissen? / Soll ich tun? / Was darf ich hoffen? / Wo das Publikum schon ungeduldig / hörbar mit den Wanderstiefeln scharrt.“
Nur sehr wenige Dichter der aktuellen Lyrikergeneration schaffen es, so viel Welthaltigkeit und Introspektion aufeinanderprallen zu lassen. (An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auf die Lyrik Carl-Christian Elzes und Christoph Wenzels hinweisen, welche, zuletzt in wunderbaren poetologischen Aufsätzen, Krankheit und Tod sowie hiermit verbundene Ängste als Motor für lyrische Sublimationen herausarbeiten (In: Hermetisch offen. Eine Sonderausgabe der intendenzen in der Bibliothek Belletristik. Hrsg. Von Ron Winkler 2008, S. 60-72)).
Adolf Endler kommt auf dem ersten Blick etwas sperriger um die Ecke, nicht derart eingängig sind seine Texte und darum vielleicht auch letztlich ein stückweit differenzierter. Auch hier trifft Burleskes auf feine Melancholie: „VIELLEICHT IM FRÜHLING – ein lila Dunst / Spielt mit den Konturen der Blätter: / –, Noch das Stündchen, Tod! Dann probier deine Kunst!’ / –‚ Nein, auch du schreibst in jedem Wetter!’„
Auch hier ringt das lyrische Ich (das Gedicht stammt aus dem Jahre 1962!) seiner Vergänglichkeit jeden Buchstaben ab, auch hier fallen lyrische Späne, dies bei Wind und Wetter, denn „Ich schreib mürrisch mein Leben und werd es nicht leid, / Ein dickes, ein dünnes Buch?“
Nicht nur in der „EINSENDUNG ZUM SCHLAGERWETTBEWERB“ lässt sich, wie bei Rühmkorf, ein Liedcharakter ausmachen, auch in „MEIN HERZ DREHT SICH BASS / Draußen geht etwas […] Mein Herz ist schnapsversengt / Mein Fenster ist verhangen“ wirken die Melodien nach, wobei, im Gegensatz zu Rühmkorf, die harmonische Schlusspointe in einer brutalen Dissonanz ausklingt. Dies ist hier durchaus Programm, nicht zuletzt damit das Gedicht nicht zu glatt den Leserschlund herabglitschen kann, trägt es Widerhaken, denn „Mein Vers hat ein scharfes Ende / Und nicht Einer für ihn Fand [sic!] die Noten“.
Sperriger Duktus, orthographische Irritation als Kalkül, Moment des Verharrens, Innehaltens. So auch in „MIT SECHSUNDSIEBZIG“: „Ach, die Jahre kürzer und kürzer / Wie länger die Straße, die Straße –“.
Auch hier, wie schon bei Rühmkorf, ein ins Leere endender Gedankenstrich, kein weises Zurückblicken, keine selbstzufriedene Nostalgie sondern inflationäre Zunahme offener Fragen und neuer Technologien. Entgegen einer rein-selbstverliebten Sprachmontage folgt dann als finaler Paukenschlag der politische Schock, und zwar in „ENDLERS BLOG“: „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose / Und Auschwitz ist Auschwitz ist Auschwitz ist / Auschwitz“.
Was bleibt zu sagen: Junge Autoren, befragt nicht lang die Horen, lest diese Alten und – werdet (neu) geboren!
Daniel Ketteler, Poetenladen, 31.3.2008
Wer Gedichte und Prosa unter Titeln wie
Der Pudding der Apokalypse
oder „Tarzan am Prenzlauer Berg“ veröffentlicht hat, kann kein schlechter Dichter sein. Und weil es sich im konkreten Fall um Adolf Endler handelt, wissen wir ohnehin, dass er in Form-Fragen wie in seinem untergründigen Humor zu den besonders Raffinierten zählt. 1955 war Endler von der BRD in die DDR übersiedelt, studierte am Literaturinstitut Johannes R. Becher die Schriftstellerei, wurde zum Mitglied der „Sächsischen Dichterschule“ und geriet zunehmend mit dem Staat des realexistierenden Sozialismus und dessen überwachenden Behörden in Konflikt: Der 1930 Geborene wurde zum Underground Poet am Prenzlauer Berg. Nun zeichnet er, zu Zeiten der DDR gewissermaßen das literarische Pendant zu Peter Rühmkorf unter gesellschaftlich verschärften Bedingungen, die letzten fünfzig Jahre seines Lebens noch einmal in Gedichten nach: in kurzen und sehr kurzen, in neuen, in einst in der Schublade liegen gebliebenen wie in solchen, die er nach Jahrzehnten noch einmal überarbeitet hat. Manche der Kurztexte reimen sich, andere sind rhythmisiert, wieder andere wirken wie Gelegenheits-Notate. Einige sind in ihrer Substanz etwas mager geraten, andere wieder von explosiver Bildkraft – eine gemischte Angelegenheit, wie das Leben, auf das sie zurückgehen. Das älteste Gedicht, „Fragment“, stammt aus dem Jahr 1950 und fixiert einen wütenden Wind, der dem Wanderer Haar und Kopfhaut „sichelt“: Auch Natur hat bei Endler nichts Harmloses an sich. Die „Rolltreppe“ liefert dem Band die sprechende Titel-Metapher. Denn auf und ab geht es nicht nur im Dichter-Lebenslauf, auf und ab gleiten, an Gesellschaftsszenen wie an einzelnen Figuren, auch die Blicke des Dichters; ebenso wechseln seine Stimmungen, bis die eigene Geschichte mitsamt dem zeitlichen und gesellschaftlichen Umfeld, in dem sie sich ereignet hat, in aberhundert Schattierungen oszilliert. So im Gedicht „Das zwanzigste Jahrhundert“, das ganz am Anfang des Büchleins steht. Dröhnend emphatische Zeilen des Dichters und DDR-Ministers Johannes R. Becher („Gegrüßt sei, Jahrhundert! Du, herrlich wie keins!“) rahmen Endlers eigene Kürzest-Charakterisierung: „Mit kreuzweise auf den Rücken gefesselten Blicken“ sieht er das Zeitalter staatlich organisierter Massenmorde liegen. Momentweise können Gedichte wie die seinen die Fesselung im Rückblick lösen.
Frauke Meyer-Gosau, Literaturen, Dezember 2007
Poetische Inventur
Für seinen Band mit dem skurrilen Titel „Krähenüberkrächzte Rolltreppe“ hat der 1930 geborene Adolf Endler Gedichte aus fünf Jahrzehnten zusammengetragen. Der Sprachjongleur setzt in dieser Auswahl nicht nur auf Kürze und Prägnanz, sondern auch auf melancholische Herzländer.
Bereits für die Gedichtsammlung „Der Pudding der Apokalypse“ hatte der 1930 geborene Adolf Endler sein lyrisches Werk gesichtet. Auf 200 Seiten wählte er jene Gedichte von 1963 bis 1998 aus, die er am Jahrtausendende guten Gewissens der Öffentlichkeit vorlegen wollte.
Doch kommt ein Autor in die Jahre, ist nicht nur einmal eine Bilanz vonnöten. So kann in seinem Fall die frohe Botschaft verkündet werden, dass dabei ein neuer Gedichtband entstanden ist. Aus einem halben Jahrhundert wurden 79 ausdrücklich „kurze Gedichte“ ausgewählt. Und diese Kürze fängt beim Einzeiler an.
Der Nachbemerkung des Autors ist zu entnehmen, dass kein Gedicht in der 1999 erschienenen Sammlung „Der Pudding der Apokalypse“ zu finden ist und auch Gedichte aus den vergangenen Jahren aufgenommen wurden. Von Endlers virtuoser Energie, die stets neue Klangfiguren entstehen lässt, kündet bereits der skurrile Buchtitel „Krähenüberkrächzte Rolltreppe“, der vor alliterierender Lautmasse nur so strotzt. Die in ihm enthaltene Portion sinnstiftender Klänge wird im dazugehörigen Gedicht von 1971 zwar nicht erklärt, aber die Rolltreppe als ein Maß für existentielle (Lebens)Zeit und (Lebens)Raum entdeckt. Schließlich muss das lyrische Ich ja „irgendwie sozusagen vorwärts ja vielleicht weiter“ kommen.
Obwohl Endler mit seiner lyrischen Kollektion die „krummen“ Lebenswege dokumentieren will, scheinen diese Wege von solch poetischer Krümmung, so dass die Zeiten ineinander rutschen.
Plötzlich korrespondieren die Erinnerungen an die frühen Kriegserlebnisse im Gedicht „(Als der Krieg zu Ende war:)“ von 1960
„Da war ein Nest blutroten Schwalbenflaums / Da war ein Nest gebaut aus nackten Knöchlein“
mit der poetischen Metapher Gertrude Steins im Zweiteiler „Endlers Blog“ aus dem Jahr 2006:
„Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose / Und Auschwitz ist Auschwitz ist Auschwitz ist Auschwitz”.
Neben anrührenden Versen wie „Bildungsweg“ und „Übung“ stehen Einübungen in die Kunst alltäglicher Verstrickungen („Das Ei“), blubbert das „schnapsversengt(e)“ Herz allzeit beim Trennungsschmerz („Mein Herz dreht sich bass“) und zwingt die Lust am Reim zu schwarzer Konsequenz („Dilemma“). Doch der Sprachjongleur Endler, dessen verwegener Klangwitz zu Recht gerühmt wird, setzt in seiner Gedichtauswahl nicht nur auf Kürze und Prägnanz, sondern auch auf melancholische Herzländer, in denen sich die Zeiten als Zeitmaß des Alternden spiegeln. So heißt es im Gedicht “Mit sechsundsiebzig”:
Ach, die Jahre kürzer und kürzer
Wie länger die Straße, die Straße –
und in „Das Kreuzchen“
Immer, wenn ich jetzt ein Manuskript zur Veröffent-
aaaaalichung herausgebe, ach,
Denke ich: Sofern es erscheint, dann mit einem
aaaaaKreuz-
chen hinter meinem Namen.
Möge Adolf Endler seine Inventur noch viele Male wiederholen und das Kreuzchen noch lange ausbleiben.
Carola Wiemers, Deutschlandradio Kultur, 22.1.2008
Prophetisches aus dem Kartoffelsack
Zu den Schriftstellern, deren Name eine Staubwolke ergriffener Reden, geflügelter Worte, Jubiläumsausgaben und Schulaufsätze aufwirbelt, hat Adolf Endler nie gehört, nicht einmal, als er nach zehn Jahren des Verfemt- und Verschollenseins Mitte der siebziger Jahre wieder Verlage fand, auch im Westen.
Aber selbst wenn es ihm gehen sollte wie Jean Paul, den Nietzsche als Gespenst im Schlafrock verhöhnte, das an der Pforte zum nächsten, dem 20. Jahrhundert, auf nachschleichende Leser warte – selbst wenn Endler im Schulbuchkanon des Jahres 3000 nicht vorkommen sollte, er wird immer verschworene Leser haben. Das Bündnis mit ihm ist so stabil, weil es Reflexivität und Distanz voraussetzt.
Habhaft wird man seiner so leicht nicht. Das zeigen nun auch die Fundstücke aus einem halben Jahrhundert, 79 zumeist kurze Gedichte aus den Kartoffelsäcken, in die er seit Jahrzehnten seine Notizen stopft. Die gehobenen Schätze spiegeln den Schwindelanfall, dem das Leben des gebürtigen Düsseldorfers belgisch-böhmischer Abkunft vor dem Mauerfall glich, das bürgerlich Nichtunterzubringende seiner Person, das Fremde, Unzugehörige, Unbenutzbare, Freie, das ihn umgibt. Vor allem zeigen sie die dezidiert nichtpopulären Seiten seines Humors, die Kompliziertheit und spielerische Anarchie seiner Verse, das Böse. Bosheit ist der Götterfunke, ohne den bedeutende Kunst, zumal der Endlersche Humor, nicht denkbar wäre. Das Lachen bedarf der Anästhesie des Herzens.
Das bekommen vor allem die treulosen Mädchen zu spüren. Mit den Jahren machen der Liebeshader und die Kindheitserinnerungen an den Krieg am Niederrhein Platz für Breitseiten gegen alte Nazis, die unter ihren Lampenschirmen aus Menschenhaut alles vergessen haben, bloß die vom Iwan gestohlene Armbanduhr nicht. Anfang der sechziger Jahre dann verwandeln sich die Gedichte in farbig illuminierte, unerschrocken kommentierende Sendbriefe über das Leben in der DDR, deren humoristischer Widerstandsgeist und dokumentarischer Rang einzigartig ist – virtuose Alltagsgedichte, die das Lebensvoll-Ambivalente darstellen und die Melancholie des Schreibenden ins Komische wenden.
Der einst glühende, mit fliegenden Fahnen in die DDR gewechselte Jungkommunist war von der „gepriesenen ,Hauptstraße‘ der DDR-Lyrik” abgebogen und hatte begonnen, dem deklarierten Glücksfall Sozialismus die ungeschönte Erfahrung entgegenzusetzen. Während seine Schriftstellerkollegen auf Druckgenehmigungen, Reiseerlaubnisse, Telefonanschlüsse warteten und ihre Fahnenschwüre, gequälten Mahnungen oder vorsichtigen Klagen himmelwärts ans Zentralkomitee richteten, stellte Endler den Gundling- und Günderodespiegelungen, den Kassandrarufen und Diderot-Verkleidungen das strikt Hiesige, Heutige, Tatsächliche entgegen: Küchenschaben, blätternde Plafonds, kaputte Dächer, verstopfte Abflüsse, die leeren Läden ringsum, die Wanzen in der Wand. Mit den Jahren schiebt sich das Vanitas-Motiv in den Vordergrund, die elegischen Stoßseufzer über das „irgendwie sozusagen vorwärts ja vielleicht sogar weiter” gehende Leben. Der Zusammenhang zwischen Leben und Werk ist in Endlers Texten unauflösbar. Die Gedichte fluchen, hadern, zanken, kommunizieren, prozessieren, sind verwickelt in Streit, Kämpfe, Händel und reaktivieren jene elementaren Erfahrungen, die leiblich-sinnlichen, wo stoffliche Vermischungen entstehen, unmittelbare Berührungen und Kontaktzonen.
Ihrem Ursprung nach sind seine Lieder, Postkarten, Ritornelle, Leichenfunde und Sauftouren Alarm- und Ausnahmezustände, konvulsivische Ekel- und Wutanfälle an der Nahtstelle von Innen und Außen. Sie bearbeiten akute Krisen der Selbstbehauptung, in denen nichts weniger als alles auf dem Spiel steht, das Überleben als Einzelner, Intellektueller und Künstler.
Sibylle Cramer, Süddeutsche Zeitung, 9.10.2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Michael Braun: Verwirrte klare Botschaften
Neue Zürcher Zeitung, 1./2.9.2007
Frauke Meyer-Gosau: Adolf Endler: Krähenüberkrächzte Rolltreppe
Literaturen, Heft 12, 2007
„Ich sehe meine Existenz als etwas Rätselhaftes…“
– Jürgen Verdofsky im Gespräch mit Adolf Endler. Das Gespräch wurde am 24. Oktober 2007 in der Wohnung von Adolf Endler in Berlin geführt. Gesprächsanlass war das Erscheinen des Gedichtbandes Krähenüberkrächzte Rolltreppe. –
Jürgen Verdofsky: In deiner Selbstvorstellung zur Aufnahme in die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung heißt es: „Ich wollte im Grunde immer ein Lyriker sein – und sonst gar nichts.“ Und das bei einem „36-bändigen Bubi Blazezak“.
Adolf Endler: Von einem bestimmten Zeitpunkt an, so um sechzig, siebzig herum, glaubte ich, mit Gedichten den Irrsinn nicht mehr fassen zu können, der mir so in der Gesellschaft der DDR begegnet ist. Dieses Erlebnis hat mich quasi dazu gezwungen, nach anderen Formen zu suchen. Drama schloss sich aus, Schauspiel schloss sich aus. Ich habe dann so kurze Prosastücke satirischer Art geschrieben, Schwarzen Humors. Und immer drohend einen Roman angekündigt. Dieser Roman war selbstverständlich eine Fiktion. Bei Lesungen habe ich gesagt, ich lese jetzt aus meinem 97-bändigen Roman Nebbich vor. Die Leute, die da waren, haben gelacht und es nicht geglaubt. Aber in den Stasi-Berichten zum Beispiel steht drin, Endler las aus seinem 97-bändigen Roman vor, der wahrscheinlich schon in Westdeutschland erschienen ist.
Ich glaube, es gibt keinen Autor der Gegenwart, der einen 97-bändigen Roman geschrieben hat. Auf jeden Fall bin ich dann durch den Irrsinn, durch die Absurditäten, die einem im Alltag der DDR begegnet sind, die einem natürlich im Grunde in aller Welt begegnen, dazu gezwungen worden, auf lyrische Widerspiegelung der Dinge zu verzichten und überzugehen zu dieser kurzen oder längeren Prosa.
Ich bin dann immer zwischendurch zu Gedichten zurückgekommen, aber lange Zeit habe ich nur Prosa geschrieben in den 80-er Jahren. Ich habe das Gefühl, dass ich meine besten Gedichte in den 70-er Jahren geschrieben habe, so zwischendurch, dann später auch wieder. Aber es gab wirklich Phasen, in denen ich keine Gedichte geschrieben habe und in denen ich auch glaubte, nie wieder Gedichte schreiben zu können.
Verdofsky: 1999 ist bei Suhrkamp der Sammelband Der Pudding der Apokalypse erschienen, eine bedachtsame Auswahl des lyrischen Werkes. Hier sind keine Gedichte aus der Zeit vor 1963 aufgenommen. Du hast in einem haltbaren Bonmot gesagt, „1963 bin ich von der Hauptstraße der DDR-Lyrik abgewichen“. Der Pudding der Apokalypse wird nun so gelesen, als gäbe es vor 1963 keine Gedichte, die Bestand haben. In dem Band Krähenüberkrächzte Rolltreppe sind jetzt neue Gedichte erschienen, aber es wurde auch Versprengtes aufgenommen und es zeigt sich, was man auch vorher wusste, wenn man die Akte Endler kannte, die Hauptstraße hat dich gar nicht so geprägt. Man denke an Gedichte wie „Als der Krieg zu Ende war“ von 1960 oder „Du drehtest dich nicht mehr um“. Was hat die Auswahl der älteren Gedichte bei der Krähenüberkrächzten Rolltreppe bestimmt?
Endler: Ich habe den Pudding der Apokalypse zusammengestellt als meine Gedichte, zu denen ich immer noch stehe, die anfangen sollten in den Jahren 1962/63. Da ändert sich wirklich etwas in meinem Ton, er wird sachlicher und ironischer. Ich hatte aber immer das Gefühl, vorher gibt es doch noch ein paar kleine Gedichte, auch unveröffentlichte übrigens, die man noch mal zusammenstellen könnte. Das sind zu Beginn zehn oder zwölf kleine Gedichte, aus denen lässt sich kein Band herstellen. Ich habe während dieser Zeit zwischen 1960 und der Wende, und hinterher dann, immer nebenher kleine Gedichte geschrieben, die ich aber für nicht so wichtig gehalten habe. Das hat sich dann so ergeben, das waren dann hundert, ich hatte mich auf die Zahl hundert festgelegt. Es gibt auch viel Unsinn, der da noch liegt, der nicht publiziert ist. Ich hab’ dann sozusagen diese hundert Gedichte aus der ganzen Zeit seit meinem zwanzigsten Lebensjahr bis heute oder bis kurz vor heute zusammengestellt und reduziert. Und hab’ gedacht, das könnte sich halten, und darunter waren auch einige aus der Frühzeit, die aber zum Teil in keinem Band stehen.
Verdofsky: Man kann frühe Gedichte erklären, entschuldigen, aber trotzdem verwerfen. Gibt es eine Ungnade der frühen Form?
Endler: Erwacht ohne Furcht hieß mein allererster Band. Ich lese mir das ungern durch. Aber ich finde immer so ein paar kleine Fitzchen, die schon auf das Spätere hinweisen. Und diese Fitzchen habe ich ausgesucht für diesen Band Krähenüberkrächzte Rolltreppe. Und späteres auch. Was das nun ist? Es ist etwas irre Individualistisches, was da stattfindet. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich mich einiger sehr positiver Agitprop-Gedichte, die ich jetzt natürlich nicht publiziere, nicht schäme, weil ich weiß, dass sie die Voraussetzung für den Schwarzen Humor später sind.
Abgesehen von diesen Gedichten gibt es da immer irgendwelche Vorbilder, mal Eich, mal Huchel und andere – wie das so ein junger Autor eben macht, der sich nach allen Seiten umblickt. Es gibt sogar ein Gedicht, das ich im Stil des frühen Johannes R. Becher geschrieben habe. Das steht nicht in diesem Band, das steht noch in der Akte Endler, einem Buch, das im Reclam Verlag erschienen ist in den 80-er Jahren und das mir missfällt, weil ich die Ordnung nicht durchschaue, obwohl sie irgendwo einleuchtend ist, weil da kritische Gedichte, böse Gedichte abgedeckt sind mit irgendwelchen heiteren aus früherer Zeit. Wo so ein Gefummel stattfindet, das den eigentlichen Endler verdeckt, der im Grunde immer schon sehr pessimistisch war, eigentlich auch in der Zeit der FDJ-Gesänge.
Ich hab’ jetzt, darauf wollte ich eigentlich hinkommen, ein Tagebuchblatt gefunden, aus der Zeit der Institutsjahre, ich hab’ 1955/56 am Institut für Literatur in Leipzig studiert, und da stelle ich in diesem Tagebuch fest, wie seltsam es doch ist, dass ich mich einerseits so politisch engagiere und andererseits ein Gedicht schreibe, in dem ich mich als völlig „hilflos niederfallenden Ast“ bezeichne. Ein totales Depressionsgedicht, das, glaube ich, so ’ne lang andauernde Grundstimmung von mir aussagt. Diese Grundstimmung war wahrscheinlich auch in meiner Zeit der FDJ-Gesänge und Agitprop-Gesänge vorhanden.
Verdofsky: Pessimismus als Wellenbrecher gegen die politischen Moralstürme der Zeit?
Endler: Ich war immer sehr unglücklich. Ich hab’ eigentlich mein Leben bis ungefähr zu meinem vierzigsten Lebensjahr als Hölle empfunden, auch in der DDR, ähnlich wie Hilbig, der es auf andere Weise artikuliert hat. Ich habe das Leben als Hölle empfunden. Nun die DDR auf spezielle Weise, dieser tägliche Kleinkrieg, der da geführt wurde um zwei Zeilen Gedicht oder was auch immer, hatte noch ein paar Besonderheiten, die der Schreiber im Westen nicht hat.
Jetzt bin ich etwas müde geworden und empfinde das Leben nicht als Hölle, aber ich bin doch sehr pessimistisch, was die Zukunft der Menschheit anbetrifft, und das war ich eigentlich immer. Auch in der Zeit als ich Hurra-Gesänge veranstaltet habe. Ich war immer skeptisch, was die Zukunft der Menschheit anbetrifft. Da bricht so ’62 ein gewisser Ton weg und dieses andere, dieses Nicht-mehr-glauben-wollen oder -können, tritt nach vorne in Gedichten, die dann so erzählerischen Charakters sind. Auf dem Rieselfeld, wo ich mich in ein kaputtes Auto setze und damit irgendwo hinfahre.
Verdofsky: Wie wurde der neue Ton aufgenommen?
Endler: Diese Gedichte hat dann überhaupt keiner mehr in der DDR, kein Literaturwissenschaftler, ein paar Dichter wohl, verstanden. Die haben einfach nicht kapiert, warum einer plötzlich so schwarze Gedichte schreibt. Das hat dann in einer Anthologie gestanden, die zum ersten Mal, glaube ich, ’69, von Joachim Schreck herausgegeben wurde. Die hieß Saison für Lyrik und wurde dann auch gleich furchtbar verrissen im Neuen Deutschland. Schreck musste seinen Posten aufgeben. Dann erscheint ein paar Jahre später, zehn Jahre später vielleicht, mein erster Gedichtband mit diesen neuartigen, für die DDR völlig fremdartigen Gedichten, nämlich Das Sandkorn. Das ist sozusagen – zusammen mit einem Buch über Georgien, – das erste meiner Bücher, das ich wirklich ernst nehme.
Verdofsky: „Frühes und Spätes kommentieren sich gegenseitig“, hast du einmal gesagt. Gibt es nicht immer etwas aus der frühen Zeit, das bleibt?
Endler: Es stimmt, Spuren dieses Späteren sind auch vorne, sind bei mir schon als Sechzehn-, Siebzehn-Jährigem erkennbar. Mein erstes Gedicht erschien, als ich siebzehn Jahre alt war, das werde ich dir nicht zeigen. Das ist grauenhaft, es handelt von Trümmern und Leichen. Dann hatte ich jahrelang eine richtige Schreibhemmung, die sich erst als ich zweiundzwanzig war, irgendwie verloren hat. Danach habe ich wieder veröffentlicht, kleine Geschichten in Zeitschriften und hab’ dann auch die frühen Beziehungen, die ich nach dem Kriege zum Kulturbund hatte, wieder aufgenommen. Den gab es noch, der wurde dann sehr schnell verboten. Und ich habe mich dann in allerlei Aktivitäten verwickelt, die wahrscheinlich zum Teil strafbar waren.
Ich will jetzt nicht das in Einzelheiten erzählen, was ich da alles gemacht habe. Agent war ich nicht, richtige Agententätigkeit war es nicht. Aber ich hab’ zwei Mal ’ne Einladung bekommen vom Gericht, die erste wurde dann irgendwie niedergeschlagen, um mich wegen „Staatsgefährdung“ zu melden. In West-Deutschland! In Ost-Deutschland, in der DDR, war das wieder was anderes (lacht). Aber überall bin ich verboten worden und hatte Schwierigkeiten, wo ich auch auftrat. Ich sehe meine Existenz als etwas Rätselhaftes. Als etwas Rätselhaftes, über das auch andere nachrätseln, die nicht verstehen können, wie einer in der DDR solche Produktion macht und wie der überhaupt lebt und durchkommt.
„Ich habe die Kunst als etwas Heiliges empfunden.“
Verdofsky: Früher hieß es immer, ein Bohemien ist einer, von dem man nicht weiß, wovon er all die Jahre gelebt hat.
Endler: Das hat mir zum Teil auch Verdächtigungen eingebracht, ich müsste wohl bei der Staatssicherheit gewesen sein oder sogar beim KGB. Ich will jetzt nicht sagen, wer das vermutet hat, weil meine Existenz nicht erklärbar war. Es ist im Grunde erklärbar. Ich habe von Nachdichtungen gelebt, zusammen mit Elke Erb geschriebenen Kinderstücken. So etwas hat dann schon eine ganze Menge Geld eingebracht. Allerdings nach dem Ausschluss aus dem Verband habe ich mehr von Westhonoraren gelebt, die ich dann umgetauscht habe. Ich hab’ 1978 für den im Osten erschienenen Band Das Sandkorn den Förderpreis der West-Berliner Akademie der Künste bekommen. 10.000 D-Mark, davon habe ich zehn Jahre lang gelebt (lacht). Ich habe das natürlich beim Gemüsehändler um die Ecke umgetauscht, so 1:5 oder 1:6, je nachdem wie der Kurs war. Also doch einigermaßen gaunerhaft. Dieses Geld hab’ ich mir nach und nach in den Osten bringen lassen von West-Journalisten. Davon habe ich gelebt.
Ich hab’, als ich mit Elke Erb zusammen war und wir Kinderstücke schrieben, die sehr einträglich waren, so jeden Monat circa tausend Mark verdient, was sehr viel war in der DDR. Das waren Kinderstücke. Und Übersetzungen, fünf Mark pro Zeile, die konnte man ja riesenhaft, mengenhaft produzieren, weil es sich ja auch oft um charakterlose Urtexte handelte, die man zu seinen eigenen Gedichten umfunktionieren konnte. Nach dem Ausschluss habe ich pro Monat hundert Mark verdient im Durchschnitt, hundert Mark im Monat, davon konnte man auch in der DDR nicht mehr richtig leben. Da habe ich dann von diesen Westhonoraren und von diesem Westkurs gelebt.
Es lässt sich alles erklären, will ich damit sagen. Erklären lässt sich nicht mein Nicht-Mittun in der DDR, mein Absinken in so eine Art Outlaw-Stellung, während andere meiner Kollegen, auch aus der Sächsischen Dichterschule, doch Sicht genommen hatten auf das Establishment, in das sie hinein geraten wollten und auch manche krumme Haltung eingenommen haben. Ich ganz im Gegenteil war offenkundig, so schien es, für das Abtauchen und Wegsinken, im Gully verschwinden. Das war ’ne gegenteilige Haltung zu der allgemeinen, auch der meiner Freunde.
Verdofsky: Unabhängig, unbestechlich, ungehorsam waren einige wenige, aber bei dir scheint alles noch robuster verlaufen zu sein?
Endler: Ich erkläre mir das nun natürlich auch genetisch durch meine Herkunft, darüber hat Sibylle Cramer geschrieben, von einer belgischen Mutter und einem böhmischen Vater. Einem unglaublichen Gemisch, vielleicht etwas zigeunerhaftes in all dem. Ich kann mir diese Bewegung, die ich da im Raum oder in der Zeit vollziehe, selber nicht richtig erklären. Ich weiß nur, dass es Brüche gibt, die notwendig waren, um überhaupt noch weiter zu recht zu kommen mit den Dingen. Und sei es im Hinterzimmer. Weggehen wollte ich auch nicht, das schien mir dann eine zu leichte Lösung. Ich war auch immer dagegen sozusagen mit einer Art Dissidentenruhm in Erscheinung zu treten. Ich habe dann meistens in der Handpresse in Kreuzberg Titel publiziert, später auch bei Rotbuch. Das waren alles relativ schwer zugängliche Sachen, diese Texte.
Verdofsky: In deiner Auflehnung hast du immer die Mittel eines Dichters gewählt. Erreicht ein politischer Dissident nicht mehr Aufmerksamkeit, mehr Wirkung, mehr Zuwendung? War das eine Versuchung?
Endler: Mir war diese Vorstellung, statt mit literarischem Ruhm mit so einer Art Dissidentenruhm bekannt zu werden, unangenehm, was mich heute noch in ein etwas verwickeltes Verhältnis zu Rathenow, Fuchs und Biermann bringt. Mir war das unangenehm. Ich kann mir jetzt nicht erklären, was mir unangenehm war. Es war außerdem so, dass es natürlich ein außerliterarischer Ruhm war, den man da erntete. Und ich erinnere mich dunkel, dass mir in meiner Frühzeit, als ich so die ersten freien Literaturzeitschriften, Die Fähre oder Literarische Revue las mit Texten schon von Elias Canetti, von Hermann Broch, von Musil, auch den ersten Text von Joyce, der in diesen Zeitschriften erschienen ist, nämlich „Anna Livia Plurabelle“ in der Übersetzung von Goyert.
Ich habe damals nach dem Krieg als Knabe und jüngerer Mensch die Literatur, die Kunst als etwas Heiliges empfunden. Ich habe später als Verrat an dieser ursprünglichen Empfindung gesehen, dass ich dann Agitpropgedichte geschrieben habe. Als Verrat an der Vorstellung, dass Kunst etwas Heiliges ist, und da war sie dann nicht mehr heilig. Aber ein bisschen von dieser Vorstellung hat weiter in mir gearbeitet und mir verboten, nach einem Ruhm zu suchen, der außerliterarisch, außerkünstlerisch war. Und solche Dinge spielen in meiner ganzen Entwicklung eine enorme Rolle. Es ist alles sehr schwer erklärbar.
Verdofsky: Das hat den Dichter geschützt, wenn er sich zum außerliterarischen Ruhm querstellt. Niemand kann sagen, Adolf Endler hat seine Rolle durch Dissidenz gefunden. Alles was zu deinem Ruf und Rang gehört, ist literarisch begründet. Es gibt kein politisches Image, sondern ein literarisches und das ist etwas Kostbares.
Endler: Das finde ich sehr angenehm, dass es so ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sehr betonen, dass ich nicht veröffentlichen konnte, die in mir unbedingt den Widerständler sehen wollen, der ich natürlich in irgendeiner Weise auch war, wenn auch nicht auf diese spektakuläre Weise wie andere. Ich habe tatsächlich Texte geschrieben, die ließen sich in der DDR nicht mehr veröffentlichen und ich wusste das. Während andere, auch sehr begabte Leute, genau wussten, wo die Grenze des gerade Möglichen ist. Ich kannte diese Grenze nicht mehr.
Ich habe diese Texte auf Wohnungslesungen vorgelesen und die Leute fühlten sich für zwei, drei Stunden vollkommen frei, weil ich so frei mit den Dingen hantiert habe. Ich habe mir als Gewissensfrage vorgelegt, jetzt ist das mal diskutiert worden nach einer Lesung, ob das sinnvoll ist, für die Leute paar Mal im Jahr drei Stunden so ’ne Art Freiheit herzustellen, in der man alles machen, alles sagen konnte. Ob sich das nicht gegen die bürgerrechtlichen Aktivitäten ausgewirkt hat.
Später habe ich das vernachlässigt, diese Fragestellung, aber ich erinnere mich, dass ich mir diese Frage so gestellt habe: Jetzt waren die also drei Stunden frei, jetzt gehen die raus und sind wieder in ihrer Misere. Das ist für mich eine Gewissensfrage gewesen, das war natürlich eine außerkünstlerische Frage. Du siehst, in welcher komischen Situation ich war.
Verdofsky: Eine Quasi-Freiheit durch Kunst herzustellen für Momente, das gab es ja manchmal auch im Theater. Die Leute dachten, sie sind frei und alle Fragen können gestellt werden. Und dann holt sie das wieder ein. Sehr interessant, dass du diese Rote Linie vergessen hast, wo man Rücksicht nimmt auf eine unausgesprochene Zensur, sondern sich einfach der Dichter durchsetzt. Das gehört zur dichterischen Wahrhaftigkeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Breton Rücksicht genommen hätte auf eine Linie.
Endler: Nun gut, Breton und die Surrealisten darf man in diesem Zusammenhang nicht nennen. Breton hat ja sogar seinen Leuten verboten, Romane zu schreiben, und wenn sie einen Roman geschrieben haben, waren sie aus der surrealistischen Bewegung ausgeschlossen. Insofern hätte er mich in einer surrealistischen Bewegung halten können (lacht).
Verdofsky: Zurück zu dieser Roten Linie, die man vergessen kann…
Endler: Das ist ein Problem. Ich versuche immer, mir zu überlegen, wie war denn diese Linie, wo ging denn diese Linie? Warum hat Christa Wolf, und weshalb sieht man das, diese Linie nie überschritten? Auch mein Freund Volker Braun im Grunde nicht, selbst wenn er einen so kritischen, quasi-kritischen Roman wie Hinze und Kunze geschrieben hat. Es gibt da eine unsichtbare Linie, die nicht überschritten wird. Ich überlege oft, wo diese Linie verlaufen ist, wie ich empfunden habe, dass ich sie nicht mehr kannte. Für mich hat die nicht mehr existiert, diese Linie. Allerdings gibt es ja dieses Problem auch als Anstandsproblem in der westlichen Literatur. Man ist ja nicht sehr angesehen, wenn man plötzlich pornografisch schreibt.
Also de Sade, der all diese Linien überschreitet, wofür er den Beifall der Surrealisten geerntet hat, das ist ja nicht etwas, was sozusagen allerorten goutiert wird. Das wird schon als etwas gesehen, weshalb er ja auch die längste Zeit im Gefängnis war, was Grenzen überschreitet, was bestimmte Grenzen nicht mehr kennt. Ich hab’ auch ansatzweise pornografische Texte geschrieben ohne Rücksicht auf Verluste. Die habe ich nicht veröffentlicht, die sind auch nicht so gut, das sind meistens so hin gerutschte Texte. Aber dieses Nicht-mehr-eine-Grenze-kennen war noch mehr, als diese unsichtbare Grenze in der DDR zu überschreiten. Es war sehr beeinflusst, dieser Vorgang, von der Literatur des Schwarzen Humors, die im Westen nicht mehr fassbar ist, partiell durch literaturkritische Kriterien. Das ist nicht mehr fassbar. Da kann man sagen, das bewegt mich oder es bewegt mich nicht.
Dieses die Grenzen überschreiten auch in moderner Literatur, etwas Surrealismus naher Literatur oder auch bei de Sade, sehe ich durchaus als etwas, was alle Gesellschaften betrifft. Also ich spreche nicht von der islamischen Gesellschaft, das ohnehin nicht (lacht). Nein, bestimmt hätte ich in Amerika, wenn ich da einige der schlimmeren Texte veröffentlicht hätte, auch Haue gekriegt oder sonst was. Es war ein Phänomen, das nicht nur mit der DDR zu tun hat. Aber in der DDR ist es für mich schon sehr spürbar gewesen.
Ich hab’ gemerkt, da geht Christa Wolf nicht weiter, an dem Punkt hätte sie weitergehen müssen. Ich hab’ Volker Braun auch mal gesagt, du, ich halte diesen „Hinze-Kunze-Roman“ nicht für schlecht, aber für einen Roman der verschenkten Gelegenheiten. An manchen Punkten hätte er einfach weiter fahren sollen, und „Brrr“ dreht er ab. So war das aber auch bei allen kritischen Autoren, die in der DDR geblieben sind. Die anderen Fälle lassen wir mal beiseite, die hatten andere Ordnungen einzuhalten. Aber diese heimliche Trennlinie in der DDR, diese Grenzlinie, hat man sozusagen im Blut. Und ich hatte die plötzlich nicht mehr im Blut, die war für mich verschwunden. Es ist schwer zu beschreiben.
„Ich erlebe, dass ich heimlich mit Gott spreche.“
Verdofsky: Für mich bleibt erstaunlich, dass die DDR kaum als surrealistische Veranstaltung begriffen wurde. Ich sehe das konsequent durchgehalten fast nur bei Adolf Endler. Dieses schwarze Lachen, das vielleicht auch aus der Hölle kommt. Oder von den Heizern Wolfgang Hilbig oder Albert Ebert, in dessen wunderbarem Bild Heizers Geburtstagständchen Ulbricht im Feuerschlund steckt (Adolf Endler lacht). Den hochfahrenden Anspruch im Kontrast zum abstürzenden Alltag, das Partei-Deutsch im O-Ton und die Absurdität des Ganzen, das lese ich bei niemandem so, wie bei dir. Aber es muss ja auch einen Weg dahin gegeben haben?
Endler: Ja, da kann ich mir nur diese genetische Erklärung geben. Ich hab’ ein sehr intensives Verhältnis zu belgischer Kunst, zu James Ensor und solchen Dingen. Ich schätze das sehr und hab’ dann auch bei meiner Mutter diese Art von raubeinigem, schwarz-humorigem Verhältnis zum Leben erlebt. Außerdem war meine Mutter anti-hitlerisch eingestellt, aus verschiedenen Gründen. Ich versuche, mir das genetisch zu erklären: Es musste ja nicht so sein, wie ich es gemacht hab’. Aber es findet sich zum Beispiel in Ansätzen ganz bestimmt auch bei Frank-Wolf Matthies. Es findet sich in Ansätzen auch bei Katja Lange-Müller. Dass da irgendwas Absurdes abläuft, wusste Katja Lange-Müller bestimmt auch. Es deutet sich in ihren Texten diese Sicht auch an.
Verdofsky: Gab es nicht auch schwarzes Gelächter am Prenzlauer Berg?
Endler: Was den Prenzlauer Berg anbetrifft, muss man sagen, dass die wenig Humor hatten, die Leute da. Vielleicht auch weil Sascha Anderson zu wenig Humor hatte (lacht). Ich weiß nicht, die hatten alle wenig Humor. Nun konnten die natürlich auch keinen Humor haben, weil sie immer ein schlechtes Gewissen hatten, vermutlich – oder auch nicht. Der Hauptteil der Leute im Prenzlauer Berg war geprägt von einem unglaublichen Ernst und einem ungeheuren Bewusstsein für die eigene Wichtigkeit. Insofern bin ich gar nicht, wie immer gesagt wird, das Vorbild im Prenzlauer Berg gewesen, das war ein bisschen meine Lebensweise, aber nicht, wie ich geschrieben habe. So hat kein anderer geschrieben. Die haben fast alle todernste welt-, gesellschafts- und kunstvernichtende Texte geschrieben, aber dass einer anfing Jokus zu machen, welcher Art auch immer, ist relativ selten im Prenzlauer Berg. Also da bin ich schon ein ziemlicher Einzelgänger.
Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, wie das plötzlich passiert ist. Ich kann mich erinnern an Anfänge des Prosaschreibens Ende der 70-er Jahre. Da hab’ ich erst mal losgeschrieben, da hat sich diese Grenze aufgelöst, die man nicht überschreiten durfte. Da hab’ ich einfach losgeschrieben über mein Leben. Grauenhafte Texte, ja, so Selbstentlarvungstexte oder Enthüllungstexte. Später hab’ ich mir die wieder vorgenommen und hab’ die vormittags mit der Hand noch mal abgeschrieben, den einen oder anderen Teil nachmittags in die Maschine und das ist dann so ein maschineller Vorgang geworden. Daraus sind einige dieser Geschichten entstanden. Die schienen mir dann irgendwie publikabel, vorlesenswert.
Der Urvorgang ist, dass ich mir alles von der Seele geschrieben habe, was mich belastet hat, was ich getan habe, was ich nicht getan habe. Schlimme Geschichten und nicht schlimme Geschichten. Ein gröberer Henry Miller sozusagen. Es ist ein Riesenmaterial, ich kann es keinem zeigen, es ist furchtbar schlecht geschrieben. Ich hab’ einfach in einem Zug immer geschrieben. Da haben sich dann einzelne Gebilde gelöst und sind für sich abgehandelt worden. Offensichtlich war dieser Selbstenthüllungstext schon voll von Momenten irrer Absurdität. Und genau diese Momente habe ich dann rausgezogen und daraus irgendwas gemacht. Kurze Prosastücke, Erzählungen oder sonst was.
Das begann in Wuischke so Ende der 70-er Jahre. Ich hab’ dann auch Elke Erb die Texte zu lesen gegeben, die war ganz sauer auf diese Texte, weil die so schlecht waren, diese frühen Texte. Es findet dann erst Ende der 70-er Jahre so ’ne Art Prosa-Entwicklung statt, bis dahin hab’ ich hauptsächlich Nachdichtungen oder mit Elke Erb zusammen Kinderstücke gemacht, um zu leben. Und Gedichte natürlich. Ende ’77/’78 setzt diese Bemühung um Prosa eigentlich erst richtig ein. Ich würde schon sagen, dass ein gravierendes Erlebnis von Absurdität der Ausschluss von Biermann gewesen ist. Den hab’ ich ja zum Teil im Schriftstellerverband erlebt, wo wir dann zusammengerufen, informiert wurden. Und plötzlich gab es einen direkten Draht zu Honecker und es war irre, es war irre, es war vollkommen irre! Insofern ist diese Biermann-Ausweisung oder was damit zusammenhängt später doch gravierend gewesen in Bezug auf meine Entwicklung, die dann aber erst so ein, zwei Jahre später in Richtung Prosa weitergeht.
Verdofsky: Bei der Prosa ist es deutlich zu erkennen, aber auch bei der Lyrik gibt es eine „zersplitterte“ Biographie. Lebenssplitter, aus denen aneinandergereiht ein Bild vom Dichter Adolf Endler als Lebender entsteht, kein geschlossenes, aber doch ein lebhaftes Bild. Gedichte als Lebenssplitter?
Endler: Ich würde schon sagen, dass das für die Lyrik fast noch mehr gilt als für die Prosa, aber für die Prosa auch. Es ist offenkundig, dass ich verschiedene Sachen, die ich auch früher erlebt hatte, verarbeiten musste. Eine große Rolle spielt der Krieg, bis in die letzten Gedichte hinein. Da waren wirklich einige Sachen zu verarbeiten. Später zum Beispiel auch der Verrat an der Kunst, den ich begangen hatte. Das war zu verarbeiten. Es liegt eigentlich auf der Hand, wenn man als Agitpropler mal zwei Jahre existiert hat, dass man dann umkippen muss, wenn man das mit der Realität vergleicht und Schwarzer Humor herauskommt. Aber es ist wahr, dass ich auch in vielen dieser Prosastücke Momente meiner Biographie aufarbeite. Das lässt mich keinen Roman schreiben, das unterscheidet mich von anderen Schriftstellern, dass immer meine Existenz abgearbeitet werden muss oder mein schlechtes Gewissen gelegentlich. Frauen gegenüber zum Beispiel, eher als der Gesellschaft gegenüber, hatte ich manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Das alles wollte abgearbeitet sein.
Nun könnte man natürlich denken, woher kommt denn das? Der Mensch kommt aus Düsseldorf, aus dem rheinischen Katholizismus. Darüber hab’ ich überhaupt noch nie gesprochen, wirklich, fällt mir jetzt gerade ein. Das könnte zusammenhängen einmal mit den belgischen Einflüssen, anti-hitlerischen Einflüssen meiner Mutter, aber auch damit, dass ich katholisch erzogen worden bin. Ich erlebe es bis heute, darf das gar nicht laut sagen, dass ich heimlich mit Gott spreche und ein bisschen Angst habe, ob ich mich nicht doch falsch benommen habe in meinem Leben. Das gibt es als Geheimes, irgendwo sehr tief in meinem Herzen, will ich mal so sagen. Diese katholische Erziehung ging bis nach dem Krieg. Dann erinnere ich mich an einen Moment, da muss ich so vierzehn oder fünfzehn gewesen sein, da stehe ich im Benrather Park bei Düsseldorf, halte die Hände gen Himmel und rufe: Wenn es dich gibt, Lieber Gott, dann melde dich jetzt! (lacht).
Natürlich hat er sich nicht gemeldet, das wär ja noch schöner, dass der sich dann auch noch meldet. Und seitdem betrachte ich mich als Atheisten, weil er sich nicht gemeldet hat. Aber irgendwo glaube ich schon, dass es „in mir west“ wie auf deutlichere Weise bei Böll, der ja auch nicht zufälligerweise schwarzhumorige Texte geschrieben hat, und so eine Art merkwürdiger Humor manchmal zutage tritt bei Böll, der sich auch nur erklären lässt aus seiner Erziehung oder seinem Werdegang.
Ich glaube schon, dass diese frühe katholische Erziehung eine gewisse Rolle bei der Entwicklung all dieser Dinge spielt. Bei der Entwicklung meines schlechten Gewissens, bei der Bemühung diesem schlechten Gewissen mit Texten gerecht zu werden. Überhaupt so ’ne Art Gerechtigkeit in mir zu entwickeln, auch fragwürdigen Gestalten gegenüber. Einige muss ich von dieser Gerechtigkeit ausnehmen (lacht), wie du dir denken kannst. Aber es könnte sein, ich habe noch nie darüber nachgedacht, nachgedacht schon, aber noch nie darüber gesprochen, dass diese ganze Entwicklung auch ein bisschen mit dieser katholischen Erziehung zu tun hat.
Verdofsky: Das hieße dann künstlerische Beichte? Auch in den neueren Gedichten zeigen sich Motive, die es schon immer gegeben hat: Krieg, Stadt von unten, aus dem Bauch einer Stadt. Hängt das damit zusammen?
Endler: Der Krieg ist eine ganz wesentliche Sache. Vielleicht der Katholizismus auch. Aber der Krieg ist mein gravierendes Grunderlebnis. Man sollte zwölfjährige Kinder keine Leichen ausgraben lassen. Das habe ich getan und ich bin durch dieses kaputte, brennende Düsseldorf gewandert. Und war dann später drei oder vier Mal in Kinderlandverschickungsheimen, unter denen ich sehr gelitten habe. Vormittags war Schule und nachmittags sogenannter Dienst unter Leitung des Lagermannschaftsführers von der Hitlerjugend. Ich hab’ sehr darunter gelitten, war immer sehr froh, wenn ich hinkam und immer sehr froh, wenn ich wegkam. Man hat als junger Mensch auch immer Lust, irgendwo hinzugehen. Immerhin war ich vier oder fünf Mal, das spielt auch eine große Rolle, in diesen Kinderlandverschickungsheimen. Diese Disziplin da und die Begegnung mit diesen Ordnungen haben mich auch negativ geprägt. Es gibt eine ganze Reihe von Urerlebnissen. Ich bin ja nie zum Psychiater gegangen, aber es gibt eine ganze Reihe von Urerlebnissen, die schon dafür verantwortlich sind, was da später stattfindet. Der Krieg, die Luftangriffe sind sicher etwas ganz Bedeutendes für alle Leute meiner Generation gewesen. Auch für Karl Mickel und Czechowski und andere ist der Krieg ’ne ganz wesentliche Erfahrung gewesen, wobei ich noch fünf Jahre älter war als Mickel und Czechowski und natürlich noch etwas bewusster das alles erfahren habe.
„Ich dachte, das wären solche wie ich.“
Verdofsky: Wie war das in der Nachkriegszeit, als man wieder glaubte, mit Vernunft und guten Worten den Lauf der Welt beeinflussen zu können?
Endler: Natürlich war da eine Erfahrung, die mich politisch sehr beeinflusst hat. Gleich nach dem Krieg tauchte der Kulturbund auf in Düsseldorf mit Eulenberg und solchen Leuten, denen ich mich später wieder angeschlossen habe, nachdem ich mich eine Weile rumgetrieben hatte. Aber nach dem Krieg war noch was: Mein Vater war Kleinunternehmer und wollte Großunternehmer werden, womit er gescheitert ist. Er hatte so ’ne Pappendeckelfabrik, in Bayern ’ne Grüne-Strohhüte-Fabrik, weil im Sudetenland, in Böhmen grüne Strohhüte getragen wurden, das wollte er wieder einführen. Er hatte ein Radio-Geschäft, mehrere Häuser, es war so ein kleines Imperium. Ein Böhme, der nach dem Krieg, als alles verschwunden war an Industrie, diese Situation ausgenutzt hat und dabei furchtbar gescheitert ist. Und bei meinem Vater hab’ ich dann so alte Nazis getroffen, die mit ihm verhandelt haben, auch bei meinem Stiefvater, die dann irgendwelche Persilscheine, so Entschuldigungsscheine erbeten haben. Mein Vater war nicht in der Partei, aber eigentlich auch nicht gegen die Partei. Mein Vater war ein Geschäftsmann, der jede Situation so oder so ausgenutzt hat, ob das mit der SS war oder mit anderen.
Mir ist sehr bewusst geworden, was damals die Kommunistische Partei natürlich behauptet hat, was auch stimmte und was man heute weiß, dass diese ganze westdeutsche Wirtschaft nach und nach von den alten Nazi-Größen wieder übernommen wurde. Heute gibt’s darüber Bücher, damals hat das nur die Kommunistische Partei behauptet. Ich hab’ das stark empfunden und hatte eine tiefe Abneigung gegen diese westdeutsche Gesellschaft. Um so mehr als nach der Währungsreform all diese wunderbaren Literatur-Zeitschriften, die es gegeben hatte, verschwanden. Die wurden nicht mehr gekauft.
Ich hab’ da noch einige der letzten Nummern, wo dann drin steht, „wir müssen uns leider verabschieden“. Auch die von Alfred Döblin, Das goldene Tor, die hat noch ein, zwei Jahre durchgehalten. Und diese ganze Literaturwelt, mit der ich mich identifiziert hatte, mehr oder weniger, ob das nun Brecht war oder Joyce, verschwand. Es tauchten dann wieder so „Das Pfeiferhänslein“ und so ’ne Innere-Emigrations-Leute auf, Hausmann, die das Feld völlig beherrschten. Und diese tolle Literatur, die mich drei, vier Jahre lang fasziniert hatte, war verschwunden, total. Spielt ’ne gewisse Rolle in meiner politischen Orientierung, weil das weg war. Ich hab’ dann auch aufgehört zu schreiben, ich konnte nicht mehr schreiben. Habe mich dann eigentlich so vagabundenmäßig betätigt, habe ’ne Buchhändlerlehre angefangen und solche Geschichten. Und dann bin ich wieder zu diesen Kulturbund-Leuten zurückgekehrt und die haben mich beschäftigt. Und ich hab’ das mitgemacht. Aber dass ich überhaupt dafür offen war, hing schon mit der Nazifizierung der Adenauer-Gesellschaft zusammen. Meine Mutter hatte mich strikt gegen die Nazis erzogen und ich empfand das sehr stark. Zum Beispiel, wenn ich gefragt wurde, warum ich in die DDR gegangen bin. Da wäre doch zu sehen gewesen, dass es nicht so toll ist. Das war zu sehen. Für mich war das Ärmere das Wahrere und das Wirtschaftswunderliche war für mich die Lüge. Das ist sehr kurz gefasst, aber vielleicht ’ne Erklärung, für dieses oder jenes, was ich dann an Untaten begangen habe.
Verdofsky: Es gibt einen interessanten Satz von Victor Klemperer: „Deutschland ist ein in zwei Stücke zerfahrener Regenwurm; beide Teile krümmen sich, beide vom gleichen Faschismus verseucht, jeder auf seine Weise.“ In der DDR ankommend, gibt es ja immer so eine Adaptionsphase, das kann auch Jahre dauern. Wann ist das Gefühl gekommen, da stimmt auch aus dieser Richtung etwas nicht? Dieser verordnete Antifaschismus, so mancher SED-Barde war ja im Kriegsgefangenenlager einfach umgedreht worden und hatte im Grunde Nazi-Manieren in der Parteiversammlung. Die „Postkarte an M. S. in Dinslaken“ gilt auch für Bitterfeld?
Endler: Das ist mir sehr spät bewusst geworden, als ich nämlich Schwierigkeiten mit diesen Leuten kriegte und ich dann herausbekam, dass der schon in der Nazi-Zeit Kriegsberichterstatter war und der Redakteur bei irgendeiner Nazi-Zeitschrift. Das ist mir erst aufgefallen, sagen wir mal, zehn Jahre später, richtig. Aber mir ist auch eingefallen, dass ich zum Beispiel die Leute am Institut für Literatur vollkommen falsch eingeschätzt hatte. Ich dachte, das wären solche wie ich. Da war auch Ralph Giordano oder Fred Wander, der war ja auch am Institut für Literatur, der in Buchenwald gewesen war. Es war noch ein anderer, jüdischer Autor, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Dass aber der Hauptteil dieser Leute am Institut für Literatur eigentlich Landser gewesen waren, ist mir erst sehr viel später zu Bewusstsein gekommen und hat mir erst klar gemacht, warum ich mich dort so fremd gefühlt habe.
Die hatten natürlich ihren speziellen Landserzynismus, auch Loest und andere. Die haben dann gelacht darüber, da haben sie mitgemacht, schon ’52, wenn ’ne Kampfgruppe aufgemacht wurde und man wieder schießen sollte. Ich musste so furchtbar lachen, ich kam ja nun eigentlich aus der Friedensbewegung oder war für Frieden eingetreten, nun sollte ich plötzlich schießen. Da haben die mir das erlassen, ich brauchte nicht zu schießen. Es war ihnen schon klar, dass mir das unmöglich war. Aber dass zum Beispiel dieses frühe Literaturinstitut eigentlich geprägt war von ehemaligen Landsern und deren Moral, deren zersetzter Moral, muss man schon sagen, auch wenn sie im einzelnen dann relativ tapfer gewesen sind später.
Ich war wirklich ein Traumtänzer in dieser frühen Zeit, der bestimmte Sachen nicht wahrgenommen hat. Dann so etwa zehn Jahre später wurde mir klar, Mensch, dieser Mensch war doch bei den Nazis. Hab’ ich dann auch in alten Zeitschriften herumgewirtschaftet und hab’ dann den einen oder anderen entdeckt, den ich am Institut für Literatur kennen gelernt hatte (lacht). Also das ist mir dann schon klar geworden, dass da auch einiges ganz schön stinkt, aber relativ spät. Ich war zunächst ein politischer Traumtänzer.
„Ich leide nicht an DDR-Nostalgie.“
Verdofsky: Zurück zu dem Band Krähenüberkrächzte Rolltreppe. Das sind größtenteils Gedichte, die man im besten Sinne auch Gelegenheitsgedichte nennen kann. Aber auch ein Gelegenheitsgedicht schreibt man nicht im Handstreich. Puschkin spricht von des Dichters Qual: „Zwei Verse stellen sich von selbst ein, aber den dritten muss man gewinnen und der sträubt sich.“ Auch kleine Stücke sind sehr durchgearbeitet oder scheinen Jahre liegen gelassen und wieder aufgenommen worden zu sein. Ist das so?
Endler: Ja, so ist das. Überhaupt ist das bei all meinen Gedichten so, vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen, dass ich irgendeinen Text angefangen hatte und dann mir plötzlich ein anderer Text einfiel und ich dachte, der hängt ja mit dem irgendwie zusammen, du musst mal gucken, wie das zusammen passt. Also im Grunde sind dann viele meiner Gedichte über acht oder zehn Jahre hin entstanden. Im Grunde betrifft es auch die kleinen Gedichte, mit einigen Ausnahmen. Irgendein Schluss fehlte, dann fiel mir plötzlich der Schluss ein. Oder irgendwas stimmte nicht im mittleren Teil oder irgend so. Ich hab’ an all diesen Gedichten jahrelang herumgedoktert.
Spontan hab’ ich eigentlich kaum etwas geschrieben. Auch die Prosatexte sind im Grunde fünf, sechs, sieben Mal abgetippt und jedes Mal wieder ein bisschen verbessert worden. Ich war so ein manischer Schreiber, der immer was zu schreiben haben musste. Heute ist das vorbei. Was dann dazu führte, dass ich mir natürlich immer wieder Texte vorgenommen habe und geguckt habe, ein paar schmückende Beiworte reingesetzt usw. Es gibt bei mir eigentlich keine spontane Produktion, sondern eine sich über viele Jahre hin erstreckende Entwicklung von Texten, Gedichten, wie auch Prosastücken.
Verdofsky: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt keine Gedichte mehr schreiben willst. Nicht einmal ein Gelegenheitsgedicht?
Endler: Jetzt schreibe ich keine Gedichte mehr. Ich hab’ noch ’nen ganzen Schrank voll alter Gedichte, da gucke ich manchmal rein und denke, nee, das geht nicht. Nein, ich hab’ fertig gemacht so einen Uralttext, den ich vergessen hatte, nämlich eine Beschimpfung der ganzen Welt, den ich irgendwann mal bei Gerd Poppe vorgelesen hatte, bei dem Bürgerrechtler Poppe, mit großem Erfolg und den hab’ ich jetzt mal wieder ausprobiert in Göttingen. Und die Leute waren völlig hingerissen von dieser Beschimpfung, Generations-Beschimpfung, Funktionärs-Beschimpfung. Irgendwie hat das als Maschine funktioniert.
Den will Thorsten Ahrend jetzt in den Sudelheften, in dieser Reihe Sudelblätter bringen, ich habe noch eine Einleitung dazu geschrieben und erkläre, wie das entstanden ist, dass es solche Schimpfkanonaden eigentlich immer schon in der Literatur gegeben hat. Und einen Stoß von Hintergrundmaterial, wen ich da im Einzelnen beschimpfe, ich nenn ja auch Namen: Görlich! Thorsten Ahrend hat recht, der sagt, das ist völlig egal, ob da Maier oder Görlich steht, die Beschimpfung ist das eigentliche. Nun gut, ich hab’ noch einen Anmerkungsapparat gemacht und das soll als nächstes erscheinen.
Jetzt schreibe ich also keine Gedichte, ich suche aber meine ungeheuren Mengen von Zetteln zusammen, sozusagen als dritten Band solcher Dokumentarwerke wie Tarzan am Prenzlauer Berg. Ein Band, der von vierundvierzig bis heute geht. Also auch die Nachwende-Geschichten ausführlich, auch Enttäuschungen. Naja, ich leide nicht an DDR-Nostalgie, da kannst du sicher sein. Aber auch sehr viele abseitige Geschichten, die nehme ich mir vor und versuche, die zu bearbeiten. Einige muss ich neu schreiben. Ich denke, dass ich die nächsten ein, zwei Jahre damit beschäftigt sein werde, dieses die Dokumentarschriften abschließende Buch zu verfassen.
Das Ganze hat auch etwas von Schlussmachen, ja, einen Schluss-Strich ziehen. Vielleicht sollte man es so sehen. Ich hab’ gedacht, der Gedichtband ist eigentlich ein schöner Schluss: So, jetzt sagst du auf Wiedersehen, ich will mit keinen Lesungen und sonstwas noch zu tun haben. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass ich noch ein letztes Büchlein, ein dickes Buch vermutlich, ich hoffe, verfassen muss, um mein Zeugs, meine Dinge vom Hals zu kriegen.
Verdofsky: Nun soll man ja auch als Lyriker nie „nie“ sagen.
Endler: Das stimmt, aber es gibt natürlich sozusagen eine lyrische Grundvoraussetzung. Man muss Lust haben an dem Bosseln dieser kleinen Dinge. Die habe ich eben nicht. Ich habe Lust, Prosa, zwei Seiten Prosa, dokumentierender Art, zu verfassen. Mir fehlt die Lust, an solchen kleinen Gerätschaften zu basteln. Es ist nicht zufällig, dass bestimmte Autoren zu einem bestimmten Zeitpunkt – Bumm – aufgehört haben, Gedichte zu schreiben. Ingeborg Bachmann oder unser berühmter Stephan Hermlin, die von einem Tag zum andern aufgehört haben, Gedichte zu schreiben. Und das ist für mich absolut einleuchtend.
Es ist eine bestimmte Grundvoraussetzung dafür da, dass man keine Gedichte mehr schreibt. Es gibt natürlich immer die Drohungen, du musst noch Gedichte schreiben, du darfst jetzt nicht aufgeben – nicht meine Frau, die tut das nicht. Aber wenn einer aufhört Gedichte zu schreiben, ich hab’ das noch bei Hermlin in Erinnerung, auch bei der Bachmann ein bisschen, heimste man Vorwürfe ein, warum schreibst du denn keine Gedichte mehr. Also ich bin jetzt 77 Jahre alt und ich muss nicht unbedingt noch Gedichte schreiben. Es liegen noch genug in meinem Schrank, die vielleicht nach meinem Tod als Irrsinns-Gedichte publiziert werden. Ich muss mich nicht damit beschäftigen (lacht).
Verdofsky: Diese Anwandlung, jemand zu nötigen, zu sagen, du musst weiterschreiben, du darfst nicht aufhören, das hängt wahrscheinlich mit der schlichten Vorstellung zusammen, ein Vers fliegt einem zu.
Endler: Ja, ja, das ist aber nicht so.
Verdofsky: Du hast eine feine Nase für DDR-Nostalgie. Die Schlusskurve der DDR streckt sich. Zur Eigenheit ihrer Nachwirkung gehört, dass sie nicht aufhört, wenn man genug von ihr hat. Zum anderen gibt es ein unaufhebbares Nichtbescheidwissen der Mehrheit. Siehst du dich hier als Erzähler in der Pflicht?
Endler: Ja, ich schreibe darüber. Ich hab’ darüber auch schon was geschrieben, durchaus kritischer Natur, wie du dir denken kannst, wenn auch nicht gerade zu DDR-nostalgischer Art. Was die DDR-Nostalgie anbetrifft, habe ich neulich eine sehr merkwürdige Entdeckung gemacht, die von dieser Stiftung für Aufarbeitung offenkundig nicht richtig wahrgenommen wird. Du findest im Computer eine Organisation gespeichert, die 25.000 ehemalige Staatssicherheits-Leute vereinigt. Du findest eine zweite Organisation und eine dritte, die hängen alle zusammen. Die dritte Organisation ist zuständig für die Beerdigungen. Das weiß kein Mensch! Die hat sich im Laufe der Jahre, der Nachwendejahre entwickelt. Es gibt bis heute kein einziges ganz deutliches Buch eines Staatssicherheits-Menschen über seine Tätigkeit.
Es gibt alles Mögliche von Sascha Anderson und Ansätze von dem und jenem, aber es gibt bis heute kein einziges deutliches Buch, so ist das passiert, das hab ich gemacht und das ist das Ende. Das gibt es nicht und ich halte es nicht für einen Zufall, dass es das nicht gibt. Ich nehme an, dass diese Leute schlicht Angst haben, wenn die so einen Apparat im Kopf haben. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich diese Riesenenttäuschungen durch die neue Gesellschaft und durch die neuen Verhältnisse gibt, das ist ja vollkommen klar, aber ich nehme an, dass auch Angst mitspielt bei vielen Leuten.
Verdofsky: Erinnerungen, die nicht geschrieben werden, gehen verloren.
Endler: Ich warte ständig darauf, dass die großen Enthüller, die ständig ankündigen, dies und das zu enthüllen, das mal darlegen. Du kannst es im Computer nachgucken. Es gab mal ’ne Anfrage im Bundestag, ob man das nicht beobachten sollte. Das wurde abgewinkt. Wenn da 25.000 Leute organisiert sind, dann müsste das beobachtet werden, finde ich. Was ist das, was läuft da ab? Was passiert da? Warum sind zweihundert Leute bei der Beerdigung, bestimmte Leute? Was für eine Maschine! Die hatten eine Arbeitsgruppe gebildet, das Ergebnis konnte man dem Computer nicht entnehmen, die herauskriegen sollte, wer verantwortlich ist für die Anschläge auf das World Trade Center. Diese Organisation bildet Arbeitsgruppen zur Untersuchung bestimmter Geschehnisse auf der ganzen Welt, in Amerika oder in China oder sonstwo. Das ist für mich wirklich etwas ziemlich Unfassbares gewesen, als ich das gefunden habe.
Verdofsky: In der uneinnehmbaren Ruine DDR regt sich noch viel. Ursprünglich haben die Stasi-Leute sich organisiert, um ihre Renten anzufechten, weil sie sich von der Rentenregelung der letzten, freigewählten Volkskammer benachteiligt sahen.
Endler: Das ist auch diese Hilfsorganisation. Richtig, das heißt ja auch noch so, Verein für soziale Hilfe oder so ähnlich. Da geht es ja nicht nur um Renten, sondern um ganz andere Sachen. Wenn jemand bei der Stasi war und weiß, dass es diesen Verein gibt, dann wird er sich hüten, irgendwas zu machen, was denen widerspricht. Auch schon, weil die Drohung vorhanden ist, dass ihm etwas passiert. Ob ja oder nein, ist die zweite Frage. Das war diese Hilfsorganisation, die sich längst zu einem Riesengebilde entwickelt hat. Die hat schon zwei Unterabteilungen, die ganz andere Sachen machen. Mich wundert, dass das nicht untersucht wird.
Verdofsky: Wird dein neues Buch auch in diese Richtung gehen?
Endler: Ich werde sicher nur am Rande darauf eingehen, weil ich zu wenig weiß. Ich bin ja nicht in diesen Vereinen drin. Ich werde sicher so etwas am Rande erwähnen als Phänomen, dass alles Mögliche untersucht wird, die Entwicklung des DDR-Fußballs wird da untersucht von der Stiftung Aufarbeitung, Stasi und Fußball und so. Ja, ja, meinetwegen, aber an diese Dinger, sag ich dir, wagt sich keiner ran. Das ist schlicht das, was ich sehe. Da wagt sich keiner ran.
Verdofsky: Dabei wiegt sich eine informationsübersättigte Öffentlichkeit in dem Glauben, das sei alles aufgearbeitet.
Endler: Es gibt keine Aufarbeitung!
Verdofsky: Die Zeit vergeht, die Frage nicht. Umso wichtiger finde ich, dass man es nicht auf sich beruhen lässt. Aber ich beobachte etwas Neues, dass zum Beispiel Sascha Anderson über die Stasi spricht, als sei alles nur surrealistisch.
Endler: Das kommt noch hinzu. Als sei nichts gewesen. Irgendein Gesetz läuft aus zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass die Verfolgung dieser Untaten bedingt. Ich hatte das Gefühl zeitweilig, es gibt jetzt einen Befehl von oben, Leute steckt wieder eure Nasen heraus. Dann stecken die Stasi-Generäle wieder ihre Nasen heraus, schreiben ihre dicken Bücher. Da taucht dann wieder der Sascha Anderson in allen möglichen Lesungen im Prenzlauer Berg auf und macht Geschäfte mit irgendwelchen Künstlern, die unter Umständen auch darauf eingehen.
Da wird mir angeboten, über die wunderbare Kulturtätigkeit in Berlin, in den siebziger und achtziger Jahren in Leipzig, zu schreiben und zwar über die offizielle Kulturtätigkeit, als wäre die doch herrlich. Vorher bin ich aufgefordert worden, an einem Buch teilzuhaben, die Undergroundtätigkeit, die für mich auch wichtiger war, in Leipzig zu beschreiben. Ich hab das abgelehnt, aber dieses Buch, was jetzt bei Wallstein in der Reihe Sudelbücher erscheint, ist letztendlich auch eine Antwort darauf. Eine Verfluchung sozusagen dieser Leute, die einem so was zumuten. Was soll das? Ich war da nicht dabei.
Ich hab’ einmal an einer Lesung zum Gedächtnis von Maurer teilgenommen, das war’s. Ich hab eine wüste Abfuhr diesen Leuten erteilt und seitdem sind bestimmte Freundschaften überhaupt nicht mehr möglich. Ja, das alles im gleichen Moment. Und das kommt mir sehr komisch vor. Dass der Anderson auftaucht, dass der und jener auftaucht, dass einem solche Angebote gemacht werden, dass die Stasi-Generäle auftauchen, alles in dem gleichen Monat.
Ich will ja nicht sagen, dass das direkt ’ne Weisung war, die da erteilt worden ist, aber es könnte einem so vorkommen. So will ich das mal ausdrücken (lacht).
Verdofsky: Da wird ein Klima geschaffen.
Endler: Das Klima: Rückkehr. Die Aufarbeitung ist eigentlich daneben gegangen.
Verdofsky: Ich halte es durchaus für möglich, dass es wie bei dem Nationalsozialismus nach Jahrzehnten plötzlich junge Menschen gibt, die fragen, was habt ihr eigentlich damals gemacht? Habt ihr alle geschlafen?
Endler: Nur werden dann andere Probleme auf dem Tapet sein als diese. Im Grunde werden ja schon verglichen mit dem, was da mit der Klimakatastrophe auf uns zukommt, diese DDR-Geschichten klitzeklein. Was da auf uns zu kommt an Problemen, das ist so immens, dass wahrscheinlich die Beschäftigung mit der DDR (lacht) etwas sehr nebensächliches sein wird in dreißig, vierzig Jahren.
Ich glaube nicht an diese Generation, die kommen wird und fragen wird, was habt ihr denn damals gemacht (lacht).
Verdofsky: Es gilt mehr für meine Generation als deine, wir haben unsere Arbeit nicht gemacht.
Endler: Doch, ich krieg ja jede Woche drei Einladungen von der Stiftung für Aufarbeitung. Jetzt machen sie ein Denkmal, jetzt ist das nur noch eine Frage von einem Denkmal für Freiheit und Einheit (lacht schallend).
die horen, Heft 236, 4. Quartal 2009
Ein kleiner Ländler
aaaaafür Endler:
Wir blieben ein Leben lang
Pendler.
aaaaaHier das Feinste – dort das Gemeinste:
Insofern immer der Deinste
Peter Rühmkorf
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


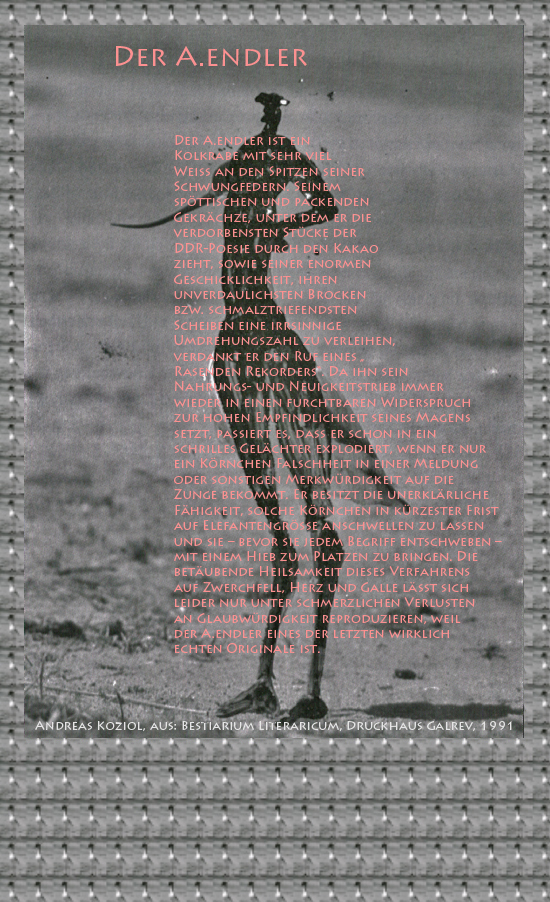
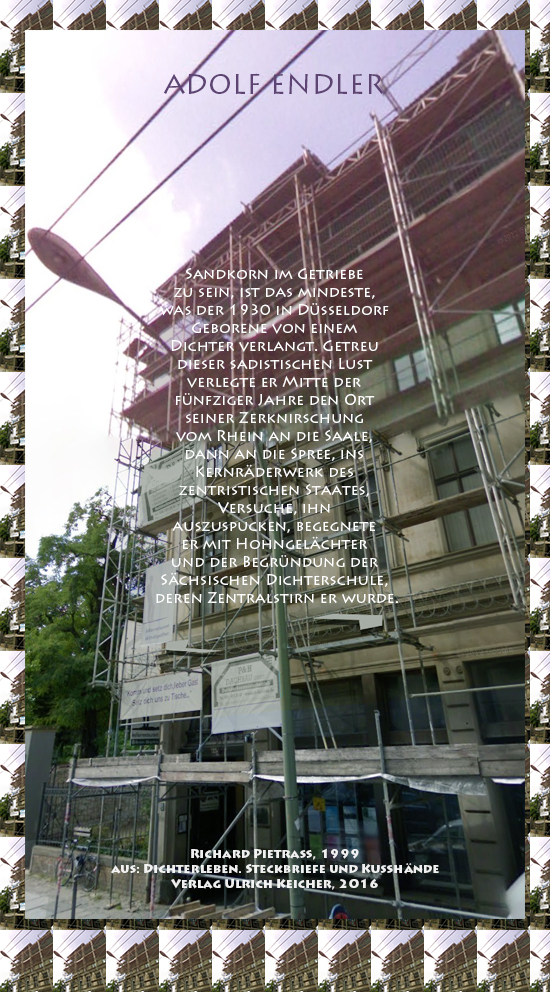












Schreibe einen Kommentar