Alas Rasanaŭ: Tanz mit den Schlangen
DIE WIRKLICHKEIT
aaaWeder dunkel noch hell.
aaaWeder gestern noch heute.
aaaDie Bäume wissen nicht, sollen sie weiter
grünen oder das Laub abwerfen.
aaaDie Krähen begreifen nicht, sollen sie
fortziehen oder auf den Bäumen sitzen bleiben.
aaaDie Nachbarn waren beim Umzug, besannen
sich aber plötzlich und tragen nun die Sachen
in die alte Wohnung zurück.
aaaAlle sind Hindernis für alle.
aaaDie Wörter wissen nicht, wohin sie ge-
sprochen werden sollen.
aaaDie von den Menschen geworfenen
Schatten fallen mit den Menschen zusammen.
aaaDie Wirklichkeit ist befleckt.
Nachwort
Nicht erst seit der Neuigkeitswert der Mitteilung zählt, hat es das Dichterwort schwer, sich bemerkbar zu machen. Schon immer konnte der Dichter sich nur auf sich selbst berufen, auf die Authentizität dessen, der sich ausspricht, und auf die Wahrheit der Aussage, die er über eine Wirklichkeit trifft. Er kann nur hoffen, dass er an Leser und Hörer gerät, die sich die Zeit nehmen, zuzuhören, seinem Wort zu lauschen, es bei sich aufzunehmen und es zu bedenken: ihre eigene Lebenswirklichkeit mit dem ins Gespräch zu bringen, was die Texte über das Leben sagen, das eigene, das fremde, das Leben an sich. Lyrik ist ein mühsames Vermitteln, erst recht, wenn die Texte übersetzt werden müssen. Und die Mühsal vervielfacht sich, wenn – wie im Fall von Ales Rasanaŭ – der Autor aus einem Land stammt, das (gemessen in Kilometern) recht nahe, im öffentlichen Bewusstsein aber Lichtjahre entfernt ist.
Weißruthenien, Weißrussland, Belorussland, Belarus – wir wissen noch nicht einmal genau, wie wir das Land im öffentlichen Diskurs nennen sollen. In jedem Fall ein weitestgehend unbekanntes Land, für das Ales Rasanaŭ nolens volens steht. Er steht für ein Weißrussland, das sich seiner eigenen Geschichte bewusst ist, während deren über mehrere Jahrhunderte byzantinisch-orthodoxe und lateinisch-westliche Traditionen miteinander auskamen, einander durchdrangen und befruchteten. Ein Grenzland. Rasanaŭ steht für Pluralismus und Selbstständigkeit in der Suche nach Sinn und Perspektiven. Damit ist er in seinem Land ein Politikum, obwohl seine Texte nicht im engeren Sinn politisch sind. Nur wenige seiner Gedichte führen uns als deutsche Leser in eine Kultur, die uns unverständlich und fremd ist. Solche Zeichen der kulturellen Differenz sind selten, meist bedient sich Rasanaŭ aus dem Vorrat der gemeineuropäischen Bilder und Erfahrungen. Da ist das Bild von der Leiter, dem Brunnen, der Kette und vieler anderer – meist jeweils in einem gleichnamigen Gedicht. Das Bekannte wird darin fremd gemacht, indem das Zeichen sich als komplizierter erweist als es anfänglich scheinen wollte. Wenn in dem Gedicht „Die Fallen“ die Menschen noch mehr Angst vor dem Wald haben, weil dort ihre eigenen Fallen und die der anderen sind, kann jeder Leser eine eigene Erfahrung benennen, wo er die Gefährlichkeit von Menschenwerk, das eigentlich vor Gefahren schützen sollte, kennengelernt hat. Was in der Wissenschaft wort- und tabellenreich als exogene Faktoren diskutiert wird, bringt Rasanaŭ in eine Szene von biblischer Einfachheit. Lediglich die Namen Symon, Taras und Dominik verraten, woher der Autor kommt.
Viele Versetten – eine von Rasanaŭ erfundene Form des freien Gedichts – tendieren zu solchen einprägsamen Szenen, die dem Thema bisweilen noch einmal in einem pointierten Ausspruch die neue Wendung geben. Die reduzierte Sprache, die sich auf das Wesentliche konzentriert, eröffnet den Zugang zu hochkomplexen Erscheinungen des Universums und des menschlichen Daseins. Die Hinwendung zum einzelnen Wort, zu seinem Klang, seiner Bedeutung und seiner Herkunft zeigt das Interesse an den elementaren Dingen und Geschehnissen, denen Rasanaŭ in seinen Gedichten auf den Grund geht. Der Leser taucht tief in die Welt der Sprache hinein, wird zur bewussten Wahrnehmung angeregt. Die raffinierten Alliterationen und Wortspiele, die die verborgenen Beziehungen zwischen den Wörtern und somit zwischen den Entitäten aufdecken bzw. erst hervorbringen, sind in dieser zweisprachigen Ausgabe auch für die Leser erkennbar, die sich bisher nur über die deutschen Übersetzungen im Gedichtband Zeichen vertikaler Zeit (1995) Rasanaŭs Gedichten nähern konnten.
Rasanaŭ weiß, dass er trotz all seiner Versuche, sich mitzuteilen, und all der Versuche des Mittlers, ihn mitzuteilen, er – letztlich – unverstanden bleibt, vielleicht bleiben muss. Das Gedicht, von dem er selbst wollte, dass es dem Band den Namen gebe, zeigt das Ich, die Schlangen und das Publikum. Die Schlangen bedrohen das Ich, es kämpft mit allen seinen Kräften und Fähigkeiten um sein Leben, und das Publikum deutet diesen Kampf in ästhetischen Kategorien. Die existentielle Situation des Dichtens, die ein Anschreiben gegen den Tod ist, lässt sich nicht einholen. Die letzte Punktierung ist gleichzeitig eine Beschreibung der Situation der Intellektuellen des Grenzbereichs Weißrussland: gehören sie nach Osten oder nach Westen, nach Rom oder nach Byzanz? Die Punktierung liefert implizit auch die Antwort: Schilfpflanzen gehören in den Uferbereich.
Elena Averkina und Norbert Franz, Nachwort
Bei Erscheinen
des ersten in deutscher Sprache erschienenen Bandes Zeichen vertikaler Zeit wurde dem Autor Ales Rasanaŭ von der Kritik bescheinigt, daß seine Radikalität im Gewand scheinbarer Einfachheit daherkomme. Da ist das engagierte, aktuelle Gedicht (z.B. „Das serbische Dorf“), das im Bewußtsein eines alten Auftrags von Dichtung, zeitkritische Wahrnehmungen festhält, politische Zustände benennt, da sind Punktierungen, von japanischer Poesie beeinflußte Kuzzeiler, die verschiedene Beobachtungen auf einen Punkt verdichten. Das sind sogenannte Quanteme, „Texte die von der lautlichen Ebene her einen neuen ungewohnten Zugang zum Gegenstand des Wortes öffnen, Laut-Sinn-Synthesen, bei denen der Übersetzer fast schon ein Konkurrent wird, weil seine Leistung einer kongenialen Mitschöpfung gleichkommt“ (Ales Rasanaŭ) Da sind Dichtungen, die den Schreibprozeß in seinem Wechsel von Induktion und Deduktion offenlegen, z.B. „Der Brunnen“. Da ist die Metapher, die nicht mehr als Vehikel zur Transkription dient, sondern reduziert ist auf ihr Wesentliches, auf das einzelne Wort, den Klang, die Alliteration: „Die verborgenen Beziehungen zwischen den Wörtern und somit zwischen den Entitäten… sind in dieser zwiesprachigen Ausgabe für die Leser erkennbar“ (Nachwort), die der weißrussischen (oder wenigstens der russischen) Sprache mächtig sind.
Ales Rasanaŭ aus Weißrußland ist z.Z. Gast in Hannover, wo er erstmals ohne Bedrohung oder Verfolgung schreiben und leben kann.
Agora Verlag, Klappentext 2002
Umzüge in alte Häuser
Alte Häuser:
ich ginge gern hinein
in ein jedes von ihnen
in jedem
eine Weile zu leben
lauten die Verse, die den in Ales Rasanaŭs Lyrikband Tanz mit den Schlangen (Agora Verlag, 2002) versammelten Gedichten wie ein Motto vorangestellt sind. Und tatsächlich geht der weißrussische Dichter, der unlängst mit dem Herder-Preis der Töpfer-Stiftung geehrt wurde, noch einmal durch die „alten Häuser“ nicht unbedingt der tradierten Formen, wohl aber durch die der beinahe allzu vertraut erscheinenden Begriffe, Topoi, Tonlagen: Fluß, Feld, Brunnen, Weg und Staub –
Wir müssen allen und auch uns erklären, was unsere Worte bedeuten, und sie an ein im Gedächtnis verborgenes Maß anlegen, um ihnen ihren ursprünglichen Inhalt zurückzugeben.
Mit diesem altehrwürdigen Anspruch – dem Rasanaŭ nicht etwa in einem poetologischen Essay, sondern in einem Prosagedicht Ausdruck gibt – verbindet sich die Sehnsucht nach Authentizität, vielleicht sogar nach jener Faktizität des Wortes, die aus der abendländischen Überlieferung nicht wegzudenken ist: um den Stellenwert des Wortes in der Mythologie des Okzidents richtig einzuschätzen, muß man nicht bibelfest sein, es genügt, daran zu erinnern, daß zum Beispiel der Straftatbestand des Meineides Ergebnis einer (Rechts-)Kultur ist, in der es üblich war, auf die Heilige Schrift zu schwören. Der „ursprüngliche Inhalt der Wörter“ steht für ihren Wahrheitsgehalt – oder, im Kontext der Dichtung, für ihre „Welthaltigkeit“ – und für einen Zustand der Unschuld.
Doch wie führt man die Worte in diesen Zustand zurück? Durch pures Vertrauen in eine ungebrochene Kraft der Wörter, die sie immun machen könnte gegen all die Veränderungen, welche die Bedeutungszusammenhänge der Sprache in immer kürzeren Abständen verschieben? Durch eine Art Kinderglauben in den unwandelbaren Wert eines Wortschatzes, den man heben kann wie den Topf voll altrömischer Münzen in Rasanaŭs Gedicht „Der Schatz“?
Gilt die geistige Währung solcher Begriffe wie „Weg“ und „Brunnen“ noch oder nehmen sie nicht einen inzwischen doch eher musealen Platz im Bewußtsein des Lesers ein, sind das nicht Bilder einer Ausstellung, die man längst zu kennen meint? Und was wäre denn der „ursprüngliche Inhalt“, kann es den angesichts der Kluft, die Rasanaŭ hier selbst anspricht, überhaupt noch geben und hätte dieser Inhalt, so man zu ihm zurückfände, einen Bezug zu dem, was heute gedacht, erlebt, erlitten wird, kurz: was könnte eine solche Rückführung beitragen zur reflektierenden Wahrnehmung der Gegenwart?
Rasanaŭs Lyrik verweigert darauf die Antwort, doch nicht zufällig trägt das zitierte Gedicht den Titel „Hoffnung, die keiner Begründung bedarf“. Gewißheiten gibt es nicht, aber ein Entwurf wird durchaus gewagt. Denn nicht die Wandlungen der Sprache im Gefolge von Zeit und Geschichte werden geleugnet, vielmehr wird die Gedächtnis- und Geschichtslosigkeit des im Augenblicklichen befangenen Menschen in Frage gestellt. Der „ursprüngliche Inhalt“, das „Maß“ der Dinge und Wörter ist „im Gedächtnis verborgen“, und es obliegt dem Leser, die Wörter an dieses Maß „anzulegen“, sie gleichsam zu bewegen und des Wort-Wertes erneut inne zu werden. Damit tauscht Rasanaŭ die entscheidenden Parameter gegeneinander aus: nicht die museal klingenden Begriffe nämlich sind uns wirklich vertraut, eben weil wir sie ja nur aus dem Museum einer nicht mehr gelebten Sprachtradition kennen, sondern vielmehr die Sprache, die zu „gebrauchen“ wir gewöhnt sind. Ein Standortwechsel, ein „Umzug“ des sprachlichen Inventars wäre nötig, heraus aus den feiertäglichen Schaukästen, um damit „eine Weile zu leben“, oder umgekehrt: heraus aus dem Kontext der Alltagssprache, wo deren Deutungskategorien die Begriffe überkommen erscheinen lassen, und hinein in einen Bezugsraum der innehaltenden, aber hier und heute stattfindenden Betrachtung.
„Die Wirklichkeit ist befleckt“
Die – allen Umzügen eigenen – Schwierigkeiten kommen in dem Gedicht „Die Wirklichkeit“ zur Sprache:
Die Nachbarn waren beim Umzug, besannen sich aber plötzlich und tragen nun die Sachen in die alte Wohnung zurück.
Alle sind Hindernis für alle.
Die Wörter wissen nicht, wohin sie gesprochen werden sollen.
Doch nimmt man den Wechsel des Blickwinkels an, läßt sich aus den Fenstern der „alten Häuser“ auf die Gegenwart sehen: der „Weg“ (aus: „Mein Weg“) ist immer noch ein existenzialistisches Bild mit „Höhen und Tiefen“, aber dieses Bild blendet die asphaltierten Straßen nicht aus; auf ihnen „rasen Busse und Autos, neben ihnen schreiten zuversichtlich Fußgänger“, und selbst wenn das lyrische Ich „eine neue Höhe hinan(steigt)“ und damit auch die Tonlage abhebt – „und begegne noch einmal der Sonne, die auf der Erde schon untergegangen ist“ –, so begegnet man doch der gegenwärtigen Realität auf Schritt und Tritt, und die ist, wie es in „Die Wirklichkeit“ heißt, „befleckt“.
Greifbar wird das in den Gedichten mit zeitgeschichtlichem Hintergrund, wie in „Die tschetschenische Kugel“ oder in „Die Abteilung“, wo Not und Bedrohung zu der eindringlich formulierten Erkenntnis gerinnen:
Ich fühle zusammen mit den anderen, daß in der Tat alles ringsum begonnen hat, für uns das Letzte zu sein.
Rasanaŭ streift in diesem Text seine Erfahrungen mit dem rigiden Lukaschenko-Regime in Weißrussland, aber natürlich geht es ihm auch hier nicht um Tagesaktualität, schon gar nicht um „Die Neuigkeiten“, auf die man, wie es in dem gleichnamigen Gedicht heißt, „überall, wie auf das Essen, wartet“ – „(…) der, der die Hand auf Neuigkeiten hat, ist beinah ein Prophet“ – und denen eine „blinde, unfaßbare, trügerische Farbe“ zugeschrieben wird:
Wie ein Tedeum der neuen Zeit, vereinen die Neuigkeiten alle Beteiligten mit nur der einen (unbekannt welcher) Erscheinung, schließen alle in ein (unbekannt welches) Ritual.
Diesem Ritual, das vor allem dazu dient, immer neue Trugbilder zu erzeugen, versucht Rasanaŭ seine poetische Arbeit zu entziehen. Am überzeugendsten gelingt ihm das, wo er auf die Klarheit konkreter Bilder vertraut. Den Mut zu Emotionalität und Verweigerung ästhetisierender Verklausulierung mindert das nicht:
Ja, also die Wein- und Schnapsflaschen, die ich im Bahnhofsladen zu ergattern vermochte, sind irgendwohin verschwunden.
Nur zwischen zerrissenem Packpapier finde ich in der Ecke der Vorratskammer eine Flasche aus noppigem Weißglas und ein langes Messer mit Holzgriff.
Mich packen Wut und Verzweiflung: (…) Auch hier ist er gewesen, der alte Säufer, mein Vater.
So anschaulich wird in dem Erzählgedicht „Das Messer mit dem Holzgriff“ das Tableau eines Vater-Sohn-Konflikts eröffnet. Der Sohn, das Messer in der erhobenen Hand, findet den Vater auf dessen „Bett, auf dem er später sterben wird“ und erkennt sich schließlich in ihm wieder: (…) wen bestrafe ich? (…)
Ich lasse den Arm langsam sinken (…) und überlasse dem Vater alles, was ich bei mir habe: das Messer mit dem schwarzen Holzgriff und die von ihm übriggelassene Flasche aus noppigem Weißglas,
und überlasse dem Vater seinen Tod.
Die moralische conclusio und die biblisch anmutende Diktion, die viele der Gedichte dominiert, fehlen auch in diesem nicht, werden jedoch mit den Gegenständen Flasche und Messer plastisch ins Bild gesetzt und so vom moralphilosophischen Überbau gelöst und geerdet.
Sylvia Geist, die horen, Heft 211, 3. Quartal 2003
Elementares Sprechen
Vielleicht ließe sich Ales Rasanaŭs vielfältige dichterische Rede am ehesten mit einem Paradox charakterisieren: komplexe Einfachheit. In diesem Paradox steckt ein weiteres: ichloses Wissen. Das klingt befremdlich in einer Zeit zügiger Trends und egomanischer Selbstdarstellungen, wo Kunst und Künstler vor allem auf (marktgängige) Originalität aus sind. Ales Rasanaŭ mag von Moden nichts wissen. Schreiben ist für ihn eine Notwendigkeit jenseits des „Betriebs“, es gehorcht der strengen inneren Formel: Etwas ruft, ich antworte. Aber von Verantwortung entbindet es nicht, ganz im Gegenteil. Allein schon durch die Wahl des Belarussischen hat Rasanaŭ eine Entscheidung mit politischen Konsequenzen getroffen. Er versteht sich als Missionar einer Sprache und Kultur, die in der Vergangenheit nur allzu oft gegen Unterdrückung anzukämpfen hatten und unter dem diktatorischen Regime Präsident Lukaschenkos systematisch verdrängt werden.
Ales Rasanaŭ, 1947 in Sjalez (Gebiet Brest) geboren, verbrachte die Kindheitsjahre auf dem Land. Als Philologiestudent der Universität Minsk wurde er 1968 relegiert, nachdem er gegen die offizielle Russifizierungspolitik protestiert hatte. Sein Studium schloß er an der Pädagogischen Hochschule in Brest ab und wurde anschließend Dorflehrer, um in den siebziger und achtziger Jahren als Zeitschriften- und Verlagsredakteur zu arbeiten. Schon sein erster Gedichtband, Adražennie (1970, Wiedergeburt), mußte Zensureingriffe hinnehmen. In der Folge erschienen die Bände Nazauždy (Auf immer, 1974), Kaardynaty byccja (Koordinaten des Seins, 1976), Šljach 360 (Weg 360, 1981), Vastrye straly (Die Pfeilspitze. 1988), U horadzie valadarycj Rahvalod (In der Stadt herrscht Rahwolod, 1992), Pavljavannie u rajskaj daline (Jagd im Tal des Paradieses, 1995), Rečaisnascj (Wirklichkeit, 1998), Taniec z vužakami (1999, dt. Tanz mit den Schlangen, 2002) sowie die Poem-Trilogie Hlina. Kamen. Žaleza (Lehm. Stein. Eisen, 2000), letztere in Białystok (Polen). Denn obwohl Rasanaŭ sich nie als ideologischer Lyriker verstand, sah das Lukaschenko-Regime in ihm eine Gefahr und setzte ihm mit Publikationsverbot und Schikanen zu.
Als er 1999 als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Kryniza (Quelle) entlassen wurde, folgte Rasanaŭ Einladungen ins westliche Ausland, nicht nur, um seine eigene Sache in Freiheit betreiben zu können, sondern auch um als Kulturvermittler tätig zu werden. Beides ist ihm gelungen. Mittlerweile liegen mehrere seiner Bücher in deutscher Übersetzung bzw. in zweisprachigen Ausgaben vor, was in Minsk genauestens registriert wird und regimekritischen Kollegen Mut macht. Rasanaŭ ist durch seinen Weggang zu einer gesellschaftlichen Größe geworden – und hat darüber hinaus seinen Ruf als bedeutendster zeitgenössischer Dichter belarussischer Sprache gefestigt.
Mit Superlativen ist dem Werk Rasanaŭs indes kaum beizukommen. Besser man wird konkret und versucht zu benennen, was daran so besonders ist. Etwa die Gattungen: Rasanaŭ hat neue lyrische Formen kreiert – gleichnishafte Prosaminiaturen, „Versetten“ genannt, sprachspielerische „Quanteme“ sowie haikuhafte „Punktierungen“, nicht zu vergessen die „gnomischen Zeichen“: aphoristische Reflexionen über Gott und die Welt. Die neuen Genres sind Ausdruck einer Suche, die das Problem der Form nicht von dem Inhalt trennen mag; es geht also um Wahrhaftigkeit, nicht um Originalitätssucht. Was die Inhalte betrifft, ist Rasanaŭ stets dem Wesentlichen auf der Spur. Seine Themen sind gewissermaßen zeitlos: Leben und Tod, Geschichte und Jetzt, Mensch und Natur, Physis und Metaphysik, Hoffnung und Scheitern, Wissen und Nichtwissen, Weg und Geheimnis. Es ist ein suchender Gestus, der hier am Werk ist, weswegen das Paradox zu Rasanaŭs liebsten Sprachfiguren zählt und das gleichnishafte Sprechen in den „Versetten“ zu seiner bevorzugten Erzählweise.
Das Subjekt hält sich im Hintergrund, überläßt den Dingen und Ereignissen das Wort. Rasanaŭs Stimme ist nicht zuletzt darum so kraftvoll, weil sie so ichlos (selbstlos) ist.
Und immer weniger habe ich in mir mich und immer mehr – Grenzenlosigkeit.
Der von Elke Erb und Uladsimir Tschapeha sensibel übersetzte Band Tanz mit den Schlangen enthält Gedichte der Jahre 1982 bis 1997, darunter einige Punktierungen und zahlreiche Versetten. Lakonisch der Tonfall der Punktierungen:
Es wird gemäht –
aber für niemanden:
Das ist dein Los,
Gras in der Stadt.
Oder:
Wintersonne.
Aufzustehn mühn sich
aus dem Schneebett
die Schatten.
Die Aufmerksamkeit des Dichters konzentriert sich – punktuell – auf einen Naturausschnitt, auf eine unscheinbare oder komische Einzelheit, und verleiht ihr einen prägnanten Ausdruck. An solcher Prägnanz ist nichts Gekünsteltes, vielmehr scheint sie der Sache selbst entsprungen: natürlich-naturhaft. Rasanaŭ ist ein stiller Meister solcher scheinbaren Natürlichkeit, nicht anders als die japanischen Haiku-Künstler.
Komplexer verhält es sich mit den Versetten, die nicht von einer Einzelwahrnehmung berichten, sondern allegorisch-symbolische Geschichten erzählen. Etwa von den Fallen im Wald, die die Menschen vor Wölfen und Bären beschützen sollen, die aber zu Menschenfängern werden, wodurch die Angst vor dem Wald erst recht zunimmt:
Dort sind Luchse,
dort sind Keiler,
Wölfe,
Bären
und – Fallen.
Das Menschenwerk rächt sich an seinem Erfinder. – Anspielungsreich gibt sich die Miniatur Hiobs Söhne. Da ist die Rede von Brüdern, die zu Festen, Beratungen und wichtigen Angelegenheiten zusammenkommen. Nur das Ich verweigert sich:
Ich aber bin wachsam gegen alles ringsum.
Meide die Zusammenkünfte.
Wenn alle anwesend sind, muß wenigstens einer fehlen.
Ich bin wachsam gegen das Schicksal. Vertraue ihm nicht.
Ich denke an Hiobs Söhne: Sie kamen um,
als sie sich alle unter einem Dach versammelt hatten.
Die biblische Allusion dient als Brückenschlag zu einem Heute im Schatten der Diktatur. – Explizit politisch wird Rasanaŭ in der Versette „Die tschetschenische Kugel“, darin Michas Tschapjalewitsch, „nicht lebend, nicht tot, mit einer blutigen Wunde in der Brust“ aus dem Krieg heimkehrt. Verwundet hat ihn ein Tschetschene im letzten Todeskampf. Dann heißt es:
Wir hören die Beichte unseres Landmanns, eines der Unsern, und in der unheilbaren Wunde werden wir verwandt mit dem grenzenlos kühnen, dem Leben grenzenlos ergebenen Volk, gegen das Tschapjalewitsch Michas kämpfte in dem Krieg, den es angeblich gab und angeblich nicht.
Rasanaŭs Sinn- oder Lehrgedichte sind von äußerster künstlerischer Ökonomie, sie verbieten sich jedes überflüssige Wort. Schlackenlos, kräftig und rhythmisch finden sie zu einer „Konklusion“, der nicht widersprochen zu werden braucht. Denn der Sprechende weiß, was er tut. Er läßt dem Rätsel sein Rätsel, enthält sich des Fingerzeigs. Und weckt gerade dadurch Vertrauen, man möchte fast sagen: ein Urvertrauen. Als redete ein Weiser, ein Naturmystiker, ein heiliger Narr. Erwähnt er die „uralte Straße“ und den „uralten Staub“, durchlaufen wir in wenigen Zeilen die Menschheitsgeschichte, läßt er uns in den tiefen Brunnen blicken, „dürsten wir mit dem gesamten Dasein nach Wasser und mit der letzten Tiefe nach dem Durst“. Wie im Märchen begegnen wir auf Schritt und Tritt Archaisch-Archetypischem, werden Zeugen von Kämpfen – so im Titelgedicht „Der Tanz mit den Schlangen“ –, doch immer wieder blitzt das Licht der Transzendenz auf, und eine Ahnung von Klarheit legt sich über die Dinge.
Wie kommt Rasanaŭ zu solcher Wesentlichkeit, wie zu seiner komplexen Einfachheit? Ein naiver Dichter ist er nicht. Die Bibel und Homer, Hölderlin und Rilke begleiten ihn ebenso wie die belarussische Volkspoesie und das Werk von Franzischak Bahuschewitsch und Janka Kupala, Inspirationen schöpft er aus dem indischen Weda, aus Kasimir Malewitschs suprematistischer Kunsttheorie und aus Welimir Chlebnikows „Sternensprache“. Damit ist einiges gesagt und doch nicht viel geklärt. Denn Rasanaŭ gehört nicht zu denen, die vereinnahmen und sich vereinnahmen lassen. Sein Einzelgängertum besteht in der Suche nach dem eigenen Weg, der eigenen Sprache, dem eigenen Ton. Kompromisse läßt der „Elementarist“, der Wortklängen und -etymologien sprachmagisch nachspürt, nicht gelten. Und wozu auch, sein Werk spricht längst für sich selbst, als einzigartiger Kosmos nicht nur innerhalb der belarussischen, sondern der gesamteuropäischen zeitgenössischen Poesie.
Ilma Rakusa, Osteuropa, Heft 54, 2004
Ich gebe, damit du gibst
– Zum Verhältnis von Dichten und Übersetzen bei Elke Erb. –
Nachdem ich sämtliche Bücher von Elke Erb vom Regal auf den Tisch umgesiedelt hatte, ergaben sich zwei hohe Türme, die innerhalb kurzer Zeit in viele kleinere umgebaut wurden. Ich sehe sie mir an und denke, ich hätte mich auf ein streng begrenztes Thema beschränken sollen. Zum Beispiel: Ziegen bei Elke Erb. Vielleicht werde ich das das nächste Mal tun. Jetzt interessiert mich das unüberschaubare Feld „Die Lyrikerin Elke Erb als Übersetzerin“. Mein Anliegen ist nicht, über ihre Übersetzungen zu sprechen, sondern über das Zusammenspiel dieser zwei Zustände: Dichten und Übersetzen.
Eine Szene vorweg: Elke Erb, beim Abschreiben ihrer alten Tagebücher (am Telefon):
Ich weiß nicht, wer ich bin. Aber das werden dir viele sagen, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Besonders jene, die es herausfinden wollen, die sich selbst begegnen wollen, sie wissen nicht, wer sie sind.
Als ich aufgelegt habe, eile ich zu meinem Notebook, um das mit möglichst wenigen der unvermeidlichen Abweichungen aufzuschreiben. Aus zwei Gründen:
Der erste: Ab und zu tue ich das, weil Elke Erbs Alltagssprache nie beiläufig und geläufig ist, sondern eine ständige Suche nach einem möglichst präzisen Ausdruck, was dazu führt, dass ihre Gesprächspartner ihrer Rede nicht immer folgen können. Sie spreche genauso schwer verständlich, wie sie schreibe, kann man manchmal hören. Ich kann weder dem einen noch dem anderen zustimmen, darauf komme ich noch zurück. Einmal sagte ihr jemand (begeistert) in meiner Gegenwart, dass sie genauso spreche, wie sie schreibe. Sie war (zu Recht) empört und meinte: Wenn dem so wäre, wozu sollte sie dann überhaupt schreiben? Das ist wahr. Aber wahr ist auch, dass ihr Sprechen und ihre Texte einiges gemeinsam haben: Sie sind konzentriert und kühn, und sie verlangen das auch von ihren Lesern oder Gesprächspartnern (im Idealfall ist ein Leser immer auch ein Gesprächspartner).
Der zweite Grund: Eine Suche nach der Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“, feine Selbstbeobachtung, die die kleinsten Bewegungen der eigenen Psyche und der wahrzunehmenden Umgebung erfasst, gehören zu den charakteristischen Eigenschaften ihrer Texte. Das hat nichts mit Befindlichkeitslyrik zu tun, mit der Selbstexpression, die Darstellung von Gefühlen zum Ziel hat. Auch nicht mit der philosophierenden Lyrik, die fertige Gedanken in Gedichtform bringt. Nein. Das ist die niemals endende Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten, die zugleich ein Erfassen von fast noch nicht entstandenen Gefühlen und noch nicht verbal existierenden Gedanken ist. Das Erfassen solch subtiler Dinge erfordert Schnelligkeit. Deshalb ist Elke Erbs Sprache oft konzentriert und komprimiert. Manche Texte können buchstäblich als Konzentrat betrachtet werden, in dem es in komprimierter Form verschiedene Möglichkeiten gibt, lyrisch zu sprechen, ohne in abgenutzter Intonation hängen zu bleiben. Dieser extremen Konzentration wegen kann man als Autor viel von ihr lernen, ohne Gefahr zu laufen, epigonal zu werden: Vieles steckt nur als Andeutung, als Atemzug im Hintergrund des Textes. Es gibt Autoren, die eine Tradition schließen, resümieren (Rilke zum Beispiel), und Autoren, die neue Möglichkeiten eröffnen (ein Beispiel aus der russischen Dichtung: Chlebnikow). Elke Erb gehört eindeutig zu den letzteren. Ich glaube, ihre Texte haben deshalb viele Autoren der jüngeren Generation beeinflusst. Aber das liegt außerhalb meines Themas.
Ich wollte nur sagen, dass, wenn ein Text von Elke Erb über etwas Auskunft gibt, dies oft wirklich aufschlussreich ist. Ich werde anhand eines ihrer Texte versuchen, über das Verhältnis von Dichten und Übersetzen zu sprechen.
Zuvor aber noch etwas anderes. Elke Erb gilt oft als ,schwierige‘, schwer zu verstehende Autorin. Ich glaube nicht an schwierige Texte. Manchmal entwickelt sich aus der Verzweiflung an der Sprache und Kommunikation ein Unsinn als ein rettendes, antikommunikatives Sprachinstrument, das beide auf anderen Bewusstseinsebenen zu organisieren versucht. Aus solchem Unsinn geborene Texte können nicht schwierig sein, weil sie rational nicht zu verstehen sind. Alle anderen Texte verstehen sich von selbst, man muss sie nur lesen. Der Sinn eines Textes erschließt sich umso leichter, je weniger sein Leser sich bemüht, ihn zu verstehen (natürlich spreche ich jetzt nur über literarische, poetische Texte). Solch entspanntes Lesen ist nicht einfach und braucht eine gewisse Übung. Hilfreich ist da zum Beispiel die Vorstellung, dass jeder Text verschiedene Sinnelemente hat, zwischen denen der Leser wählen kann.
1982 schrieb Sarah Kirsch ein Vorwort zu der von ihr ausgewählten Sammlung von Elke Erbs Gedichten Trost. Gedichte und Prosa.1 Man wird neidisch, wenn man sieht, was damals, vor noch nicht einmal 30 Jahren, dem Leser zugetraut wurde. Das Vorwort ist frei von überflüssigen Erklärungen, ein Begleitsegen von Dichterin zu Dichterin. Ihr Lektürehinweis für den Leser lautet:
Es gilt, sich wenig oder gar nicht zu wundern und dem Weißen Kaninchen mit der Taschenuhr in der Westentasche beherzt zu folgen. Ohne Mühe hat der Bauer keine Kühe, sagte die Bäuerin und ließ den Abdecker rufen. Wenn die Kuh aber durchkommt, ein Text sich erschließt, schlägt das Glück ein. Man muß trainieren in seiner Innenwelt, erst kleine Wege ums Haus, später die langen Expeditionen (…).2
Das ist eine wunderbare Empfehlung!
Aber wenn man nicht trainieren, sondern nur schnell konsumieren will?
Dann verreckt die Kuh des Sinns (entschuldigen Sie die Genitivmetapher). Um sich die angebliche Unzugänglichkeit des Textes zu erklären (deren Kehrseite oft die Unzulänglichkeit der eigenen Wahrnehmung ist), gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel, Wahnsinn und Depression zwischen den Zeilen zu erkennen. In einer Anthologie mit dem Titel Inventur,3 die den Anspruch erhebt, ein Panorama der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur zu bieten – ich habe das Buch, nebenbei bemerkt, mit Gewinn gelesen, zumal ich mich erst seit den 1990er Jahren im deutschsprachigen Sprachraum befinde –, wird die Kompliziertheit von Elke Erbs Gedichten mit der traumatisierenden DDR-Erfahrung und daraus resultierenden psychischen Problemen erklärt:
Der Dichter Erich Fried hat den Band Trost unvergesslich genannt. In seiner Rezension räumt er ein, daß Elke Erb vielleicht an einer Psychoneurose litt, lobt, daß ihre Texte uns psychische Grenzzustände besser verstehen, ,auch die Irren ernst nehmen‘ lassen. Die Auskunft, die Elke Erb in ihrem Gedicht „Auskunft nachts“ gibt, läßt die schwarzen Stimmungen einer Seele ahnen, die nicht fröhlich singen kann, weil ihr der Schnabel nicht in den blauen Himmel gewachsen ist.4
Heute noch kann ich mich an meine Verwunderung darüber erinnern, denn über Elke Erb und ihre Texte wusste ich damals bereits viel.
Oft will man einem Dichter, der in einer anderen Welt lebt, ich meine nicht die dichterische Welt im romantischen Sinne, sondern ganz einfach die DDR oder jedes andere Land jenseits der politischen Grenze, kein normales Leben gönnen. Man will ihn nur am Kreuz sehen, leidend. Nicht am Küchentisch. Nicht bei einem Spaziergang. Nicht in einem Liebesakt. Und auf keinen Fall will man in ihm einen Menschen sehen wie den, der man selbst ist. Viel interessanter und produktiver ist aber immer, die Ähnlichkeiten, nicht die Unterschiede festzustellen. Aber das würde „trainieren“ heißen, im Sinne des Vorwortes von Sarah Kirsch.
Wie gesagt, das war 2003 – heute ist Elke Erb unumstritten eine der bedeutendsten lyrischen Stimmen deutscher Sprache. Ich glaube, die Leser der jüngeren Generation kennen ihre biografischen Eckdaten überhaupt nicht mehr. Dennoch hat man sie lange Zeit ausschließlich als einen Teil der DDR-Literaturgeschichte sehen wollen. Ich habe das noch miterlebt, als ich kurz nach der Wende nach Deutschland gekommen bin.
Jahre sind seitdem vergangen. Elke Erb behielt ihre Sprachwucht und Experimentierfreude. Vielleicht, weil sie immer ein großes Interesse dafür hat, was die anderen schreiben. Das ist übrigens eine obligatorische Tugend für einen Schriftsteller, die viele im Laufe der Zeit verlieren. Aber nicht Elke Erb.
Neugier ist für einen Dichter ein Treibstoff. Auch unsere Bekanntschaft verdanke ich ihrer Neugier: Sie wollte wissen, was in der russischen Literatur gerade los war, und nahm das Angebot eines Verlages an, ein Prosabuch von Oleg Jurjew zu übersetzen. Inzwischen haben wir vieles zusammen gemacht – wir wurden von ihr übersetzt, haben sie übersetzt, übersetzten gemeinsam andere zeitgenössische Dichter. Das bringt mich endlich zu meinem Thema: Das literarische Übersetzen und das eigene Schreiben.
Wenn ein Dichter als literarischer Übersetzer tätig ist, kann das verschiedene subjektive und objektive Folgen haben: Von störend über gar keine bis hin zu fördernd und bewusstseinserweiternd. Berühmt ist das Aperçu von Anna Achmatowa:
Übersetzen bedeutet Aufessen des eigenen Hirns.
Das Übersetzen war für viele Dichter in der Sowjetunion lange Zeit nahezu die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Nicht alle haben das als so quälend empfunden. Boris Pasternak setzte viel Ehrgeiz in seine Übersetzungen, was man von Achmatowa wohl kaum behaupten kann. Ich nenne diese Beispiele, weil die Ursprünge der übersetzerischen Tätigkeit von Elke Erb ähnliche waren. In der DDR wurde viel, und viel von Dichtern, übersetzt. Bis heute sind manche Übersetzungen aus dem Russischen von dort und damals die besten. Leider sind sie oft in Vergessenheit geraten.
Elke Erb setzt diese heute und hier im Vergleich mit dort und damals schändlich schlecht bezahlte Arbeit fort. Das ist ein Teil ihrer Wahrnehmung der Welt, ihres Dialogs mit der Welt. Ein Dichter ist ohnehin ein Vermittler: zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten; zwischen dem Gefühlten und dem Formulierten; letztendlich zwischen dem Leser und einem anderen Leser, denn kaum etwas bringt die Menschen innerlich schneller zusammen als eine gemeinsame geistige Erfahrung. Und wenn ein Dichter die Schwerstarbeit eines Übersetzers auf sich nimmt, ist er ein Vermittler zwischen den Sprachen. Ich meine das buchstäblich: Die Sprachen sind in diesem Fall sich gegenseitig wahrnehmende Subjekte, die von einem Dichter einander empfohlen werden.
Es ist sehr schwierig, die eigene Arbeit als Übersetzer im Nachhinein zu erfassen. Umso spannender sind solche Versuche. Ich habe einen Text von Elke Erb ausgewählt, der meines Erachtens zu den interessantesten Zeugnissen dieses Prozesses gehört. Ich würde ihn einer zwischen Prosa und Lyrik angesiedelten Zwischengattung zurechnen, die man in manchen Büchern von ihr findet. Zu diesen Büchern gehört – neben zum Beispiel Mensch sein, nicht und Sachverstand – Der wilde Forst, der tiefe Wald.5 Dem Titel entsprechend ist das eine Sammlung essayistischer Prosa und Interviews. Einerseits. Andererseits befinden sich einige der Texte an der Grenze zwischen den Gattungen. Dazu zähle ich den 1990 geschriebenen „Zum Thema Nachdichten. Eine erste Niederschrift nach zwanzig Jahren“.6 Das ist ein langer Text, wenn wir ihn als Lyrik betrachten: Er umfasst 550 Zeilen mit Anmerkungen. Wenn wir ihn als Prosa einstufen, ist es ein relativ kurzer Text von 19 Seiten. Für ein Gedicht wird zu viel berichtet. Für einen Prosatext gibt es zu viele Zeilen, die wie „Verse“ (in Anführungszeichen, weil dieses Wort in dem Text selbst auf eine spezifische Weise behandelt wird) klingen. Vielleicht kann man diesen Text eine „Ballade“ nennen, weil er das Lyrische und das Narrative vereint, eine Ballade des Übersetzens.
Wenn Sarah Kirsch in ihrem schon erwähnten Vorwort sagt, dass ein Gedicht von Elke Erb eine Bibliothek ist, kann man dem zustimmen. Aber es ist eine Bibliothek, die aus Werken besteht, die gerade geschaffen wurden, speziell für diese Bibliothek. Ich bestehe auf dem Natürlichen, Nicht-Literarischen in Elke Erbs Gedankengängen und Bildern, obwohl ihre Texte auch viele Zitate aufweisen, die Reaktionen darauf sind, was sie gerade liest zum Beispiel, oder darauf, woran sie sich gerade erinnert. Aber es bleibt eine elementare, unverstellte Beobachtung der Welt. Man kann in einem sehr literarisch aufgeladenen Text Pflanzen oder Schmetterlinge finden, die fast keine Pflanzen oder Schmetterlinge mehr sind. Auf ähnliche Weise begegnet man in Elke Erbs Texten Zitaten, die so unmittelbar und eigen wahrgenommen und wiedergegeben sind, dass sie fast keine Zitate mehr sind.
Genauso wie sie die Gleichheit ihres Sprechens und Schreibens verneint, bestreitet Elke Erb, dass sich das Übersetzen auf ihr Schreiben ausgewirkt habe. Das verwundert nicht. Sie ist in erster Linie Autorin, eigenständig, eigenwillig. Was sie zugesteht, ist, dass das Übersetzen eine gute Übung in Disziplin ist, weil es dabei ohne die fortdauernde Jagd auf das gesuchte Wort nicht geht. Insofern gibt es doch eine Kommunikation zwischen dem eigenen Schreiben und dem Übersetzen.
In „Zum Thema Nachdichten. Eine erste Niederschrift nach zwanzig jahren“ sind Selbstbeobachtungen während des Übersetzens versammelt.7 Wir können darin durchaus eine Bibliothek finden – eine, die den Prozess der literarischen Übersetzung von verschiedenen Seiten erkundet, in seiner doppelten Natur: Einerseits ist es ein schöpferischer Akt. Andererseits ist es paradoxerweise die Schöpfung von etwas, das bereits geschaffen wurde:
Dieses Gedicht da vor mir
soll ich
will ich schreiben –
„Schreiben“ statt „übersetzen“ deutet zwar eine größere Anstrengung an, hebt den grundsätzlichen Unterschied zwischen Schreiben und Übersetzen aber nicht auf, auf den gleich darauf hingewiesen wird:
Will ich dieses Gedicht schreiben, so hilft es mir,
daß es in seiner Sprache bereits geschrieben ist.
Die Aufgabe, dieses Gedicht zu schreiben,
ist in einer anderen Sprache bereits gelöst.
Das ist eine andere Situation als die,
ein ungeschriebenes Gedicht zu schreiben.
Elke Erb spricht hier klar und deutlich. Im Weiteren werden wir sehen, wie sich das Thema entwickelt, wie aus einer einfachen Situation eine komplexere wird, wobei der Leser höflich und freundlich durch alle Wendungen und Verschiebungen geführt wird. Es stellt sich heraus, dass es außer einer Ausgangssprache und einer Zielsprache noch eine dritte Sprache gibt, die beide Gedichte, das bereits geschriebene und das noch zu schreibende, gemeinsam haben, in die das erste Gedicht sich gebracht hat und aus der das zweite Gedicht sich zu holen hat:
Die Sprache, in der das Gedicht geschrieben ist,
ist von ihm in eine eigene Sprache gebracht.
Diese eigene Sprache gibt mir das Gedicht,
Sie heißt Poetologie.*
Anmerkung (Elke Erb versieht ihre Texte gerne mit Kommentaren, die sich auf den ersten Blick oft kaum von diesen selbst unterscheiden, aber meist eine erweiternde und klärende Funktion haben – ich erinnere an das oben angeführte Gespräch über die Gleichheit von Sprechen und das Schreiben):
* Diese Sprache ist keine Fremdsprache.
Ihr begegnet ein ärgeres Unverständnis.
Diese dritte Sprache ist das Medium, in dem ein allen Übersetzern bekannter, aber schwer zu beschreibender Prozess abläuft: die Kommunikation mit einem fremden Text, aus dem ein Eigenes zu holen ist. Ich werde nicht an allen Stationen dieses Wegs Halt machen,8 nur bei einigen, meines Erachtens besonders wichtigen. Irgendwann wird das fremde Gedicht „als ein lebendiges Wesen erkannt“, Dieses Bild unterstreicht die schöpferische, demiurgische Seite des Übersetzens. Ich kann mich daran erinnern, wie Elke Erb bei einer gemeinsamen Lesung sagte, dass die Übersetzung etwas Blasphemisches an sich hat – denn wie kannst du eine Katze übersetzen?
Jetzt treffen wir auf zwei gleichberechtigte Demiurgen:
Anders gesagt: Du bist eine ebensolche Ursache
des neuen Gedichts wie das schon geschriebene.
Das heißt, dass der erste Demiurg einer Übersetzung der Übersetzer ist, der zweite Demiurg aber nicht der Autor des Originals (wie man fälschlicherweise annehmen könnte), sondern das Original selbst. Das Original hat ebenso zwei Demiurgen: einen Autor als Ursache und eine Ursache, die dem Autor den Impuls gab, es zu schreiben.
Bis jetzt wurden die Unterschiede zwischen dem eigenen Schreiben und dem Übersetzen dargestellt. Aber es gibt auch Ähnlichkeiten – sonst wäre das Ganze ja nicht der Rede wert. Zuerst wird von den Fertigkeiten anderer Übersetzer berichtet, mit aufrichtigem Respekt, dann:
Leider versäume ich solche Abenteuer,
und leider erfahren die von mir übertragenen Gedichte nicht
die Kultur solchen Belebens.
Stattdessen muß ich wohl immer wieder,
als könnte ich nicht bis drei zählen, begriffsstutzig
vor dem ersten Vers stehen wie die Kuh vorm neuen Tor.
Das ist es! Ich glaube, das werden viele, die schreiben, wiedererkennen. Vor jedem neuen Schreibakt scheint es unmöglich, nur eine Zeile hinzubringen. Man steht „wie die Kuh vorm neuen Tor“, immer wie zum ersten Mal. Dieser Zustand, der vermutlich eine Voraussetzung für jedes Schreiben ist, wird noch deutlicher erfasst:
Ich weiß nichts und habe nie etwas gehört,
und es ist nie etwas gesagt worden.
Später wird dieser Zustand „das Anfangsnichts“ genannt. Auch ein demiurgisches Wort. Alle Welt ist aus einem „Anfangsnichts“ entstanden, egal, welche kosmogonische Hypothese man zugrunde legt.
Das ist ein Leitmotiv, die Unmöglichkeit, die zu überwinden ist. Später noch einmal:
Die volle Not, das ist die Fülle, die dir Sicherheit gibt.
Und dann wieder: ein Erfassen der Verzweiflung, die einer Leistung vorausgeht:
Segen des Scheiterns, Reichtum der Not.
Die von der Grenze erzeugte Weite.
Noch später wird es das „nächtliche Tages-Licht-Suchen“ heißen. Irgendwann melden sich die Lösungen. Zum Beispiel:
Oder du wäschst dir die Hände, und irgendetwas –
in dem rinnenden Wasser – erinnert an Alexander Blok.
Ich kann mich erinnern, wie ich bei einer gemeinsamen Arbeit über eine Zeile sage: „Elke, da ist nichts zu machen“ und sie antwortet:
Warte, morgen werde ich meine Fenster putzen, also viel Zeit fürs Nachdenken haben.
So funktioniert der Kopf eines Dichters. Das Fensterputzen ist keine lästige Ablenkung, sondern eine Gelegenheit zum Nachdenken.
Wenn ein Autor als ,schwierig‘ und ,verschlüssel‘ gilt, hilft dem Leser nur eins: ihn naiv zu lesen. Umso mehr kann dieser Ansatz dem Übersetzer helfen (die Übersetzer sind bekanntlich die gründlichsten Leser). Schauen wir uns an, wie das geht: Zuerst ist die Rede davon, dass derjenige, der „ohne Übersicht und gründliche Kenntnis“ arbeitet, frei von störenden Vorgefühlen und Vorurteilen ist, aber ganz frei von Vorkenntnissen ist keiner:
War aber eins mitgeführt,
wie z.B. das Etikett Hermetik für Ungaretti: Wundere dich.
Kannst du doch, eben um ihn nachzudichten, seine Setzungen
anders nicht als per Evidenz verstehen, geheimnislos
real hergeleitet (poetologisch).
Noch etwas, das angesprochen wird, zeigt, dass es bei der Übersetzung im Idealfall um das Ringen um authentischen Ausdruck geht: Die Erinnerung daran, dass jedes Gedicht eine Lautgestalt hat und die Poesie eine mündliche Kunst ist. Nicht anfangen zu übersetzen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie der Text klingt:
– und kein Gedicht ohne die Lautgestalt,
und sei es in der Umschrift!
Die Lautgestalt hilft bei der Jagd nach der poetischen Substanz des Originals, einer Jagd, die man nicht aufgeben darf, obwohl es oft hoffnungslos scheint:
Denn: Je näher die Nachdichtung
an das Nichtübertragbare gerät,
desto sicherer kann sie nicht nur Übertragung sein, sondern
von dem Fremden auch, wortlos natürlich, sprechen.
Wortlos, wie du es empfängst, so ist es wiederzugeben.
Dieses auch in den weiteren Zeilen wiederholte „wortlos“ ist keine Unterschätzung der Wörter – im Gegenteil, es spricht von der Fähigkeit der Wörter, wiederzugeben, was ihre lexikalische Dimension übersteigt; in diesem unserem Fall ist das die poetische Substanz.
In „Zum Thema Nachdichten. Eine erste Niederschrift nach zwanzig Jahren“ nimmt das, was Elke Erb politisch nennt, viel Platz ein. Unter „politisch“ wird hier das Leben der Sprache und der Menschen, die in erster Linie mit der Sprache zu tun haben, in der Gesellschaft verstanden. Der 1990 entstandene Text meint mit Gesellschaft natürlich die DDR-Verhältnisse. Erstaunlich, wie viel in das Thema „Übersetzung“ passt! Hier wird die handwerkliche Sorgfalt mit einer politischen Notwendigkeit erklärt. Die handwerkliche Sorgfalt veranlasst dazu, „Verse“ statt „Gedichte“ zu sagen:
Unter den Bedingungen, die mich hinderten,
Gedichte statt Verse zu übersetzen,
sehe ich auch politische als entscheidend an.
Wenn ich mich erinnere,
wie jenes Dutzend junge Lyriker (wie man uns
als Mittezwanziger bis Endedreißiger beharrlich nannte)
von Anfang der 60er Jahre bis in die 70er
sich gegenseitig versicherte: „Das ist gut“, „Das ist
ein gutes Gedicht“, „X schreibt gute Gedichte“… schon das
sehe ich als Symptom für eine allgemeine Situation,
wo es nämlich auf einen anderen Wert ankam
als die Individualität der Gedichte,
obwohl eben ihre Individualität, ihre Lebensfähigkeit
diesen Wert erbrachte.
Und weiter eine deutliche Aussage, mit dem Fürwort „wir“, das selten bei Elke Erb vorkommt und nur dann (glaube ich), wenn es um jene Dichtergemeinschaft aus der DDR-Zeit geht:
Wir waren auf das heftigste beleidigt
von einer sprachlichen Mißhandlung, so als ob
wir persönlich mißhandelt würden.
Am Ende gibt es sogar einen kleinen Hinweis darauf, wie sich das Übersetzen zum eigenen Schreiben verhält:
Do, ut des. Ich gebe, damit du gibst.
Es war aber kein Handel, der Gewinn war nicht erzielt.
Worauf die Ballade hinaus will: Es passiert etwas Unerwartetes, „nach einer solchen hirnzermarternden Plackerei“ und „Steinbrucharbeit“ (die stark an Achmatowas Aufessen des eigenen Hirns erinnern) kommt der Moment der Befreiung und der Erkenntnis:
Schließlich aber war die Qual tatsächlich vorbei,
und es erwies sich,
wie ich auch im übrigen Leben zu dieser Zeit begriff:
eine Glücksvorstellung ist nur ein Reflex des Unglücks,
sie meint ein fremdes Glück oder ist überhaupt falsch.
Das ist das, was ich am Anfang meinte: Texte von Elke Erb untersuchen die feinsten psychologischen Bewegungen, erfassen und benennen sie. Was passiert nach dieser Erkenntnis? Die Arbeit ist gleich umfangreich und nimmt nicht weniger Zeit in Anspruch, aber das Gefühl der Nötigung ist weg und:
Erst nach der Arbeit spürte ich den Erfolg,
begriff, wie mein Glück war, und sprach zu jedem davon.
Es war wirklich, es verging nicht wieder,
es brachte sich unter im Alltag…
In einem Interview9 beschreibt Elke Erb, vor welche Herausforderungen das Übersetzen sie stellt und wie sie mit ihnen umgeht:
Ich werfe mich z.B. mit dem Gedicht von Aronson aufs Bett und stöhne: „Es geht nicht. Es geht überhaupt nicht“. Und auf einmal dreht es sich und dreht es sich. Du musst irgendetwas machen, was dich hinter deine eigene funktionierende Person bringt. Auf einmal kommt da viel mehr als du geahnt hast. Gut ist auch Zorn, gut ist auch eine totale tumbe Vergessenheit, Verdrossenheit. Das sind alles Jenseits-Zustände, die nicht dieses propere Können haben müssen, das aber DANN kommt. Und nachher ist es wie durch ein Wunder.10
Also: durch Verzweiflung zum Können. Es gibt keine Regel. Man hofft jedes Mal auf ein Wunder. Das ist es, was Übersetzen und Schreiben verbindet.
Olga Martynova, in Text+Kritik: Elke Erb – Heft 214, edition text + kritik, April 2017
4. Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung 2011 an Elke Erb
Alas Rasanaŭ, seit dem 1. April 2008 Stipendiat des Müllerhaus Literatur und Sprache, ist im kulturfernsehen im netz art-tv mit Ilma Rakusa zu sehen und hören.
Lesen – Spuren: Lesung im Lyrik Kabinett, München am 4.11.2003. Einführung: Urs Engeler. Aufgrund äußerer Umstände konnte Ales Rasanau nicht wie geplant persönlich teilnehmen; Elke Erb liest aus seinen Gedichten.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Kalliope
Porträtgalerie: Dirk Skiba Autorenporträts + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ales Rasanau: Kleine Zeitung ✝︎ NZZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Übersetzerin + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



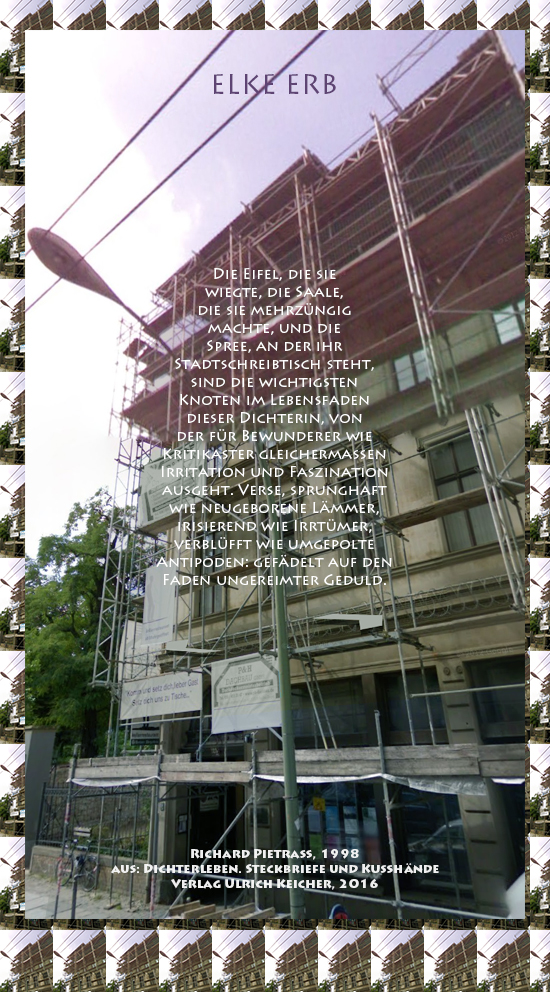












Schreibe einen Kommentar