Alexander Twardowski: Gedichte dieser Jahre
BERGPFADE
Die Pfade unter den Füßen,
Die sich den Bergen anschmiegen,
Sind jünger als die von den Flüssen
Verwildert verlassenen Liegen.
Schon vor dem Bogenbewehrten
Hinterließen, die vor ihm kamen,
Deutlich erkennbare Fährten,
Signierten per Huf ihre Namen.
Dann setzte er seine Zeichen,
Eingedenk aller Wege danach,
Wenn er für seinesgleichen
Die Zweige bedeutungsvoll brach.
Und an endloser Leine
Folgten ihm Generationen,
Räumten, versetzten Steine,
Markierten begehbare Zonen.
Begradigten Kompromisse,
Kurven der allzu bequemen,
Gefällig sich schlängelnden Flüsse,
Um kürzere Wege zu nehmen.
Jahrtausende gingen, vergingen,
Legten sich in die Schichten,
Um den Berg zu durchzwingen
Und seine Höhen zu richten…
Bedenke, gleich welche Pfade
Und Wege auf Erden du gehst:
Immer schon war wer. Auch gerade
Da, wo du momentan stehst.
Überall Zeichen und Kerben,
Die sein Dasein bekunden.
So bleibt er über sein Sterben
Hinaus mit dir noch verbunden.
Vergiß nicht, bei deinem Verlangen,
Einzig und groß zu bestehen,
Den Weg ist schon jemand gegangen
Und wir auch ein andrer noch gehen.
Autobiographie
Geboren wurde ich im Gebiet Smolensk, in der Smolenstschina, im Jahre 1910, am 21. Juni – auf dem „Chutor des Brachlands Stolpowo“ – so die amtliche Bezeichnung jenes Fleckens Erde, den mein Vater, Trifon Gordejewitsch Twardowski, mit Hilfe der Landesbauernbank auf Abzahlung erworben hatte. Dieses Stück Land – etwas mehr als zehn Desjatinen, durchzogen von kleinen Moorstreifen, bei uns „Ränftchen“ genannt, und kaum mehr als Weidengestrüpp, Tannendickicht und Birkenhain – war in jeder Hinsicht minderwertig. Aber für meinen Vater, dem es – als dem einzigen Sohn eines landlosen Soldaten – erst nach jahrelanger Schwerarbeit in der Schmiede gelungen war, die erste Abzahlungsrate zusammenzukratzen, hatte es den Wert eines Heiligtums. Und uns Kinder lehrte er beizeiten die Achtung und Liebe für diesen sauren, kargen, unergiebigen, doch uns gehörenden Boden, unseren „Gutsbesitz“, wie er bald spaßhaft, bald ernsthaft seinen Chutor nannte. Die ganze Gegend, fern aller Straßen, war verwildert und unerschlossen, und mein Vater, obwohl ein trefflicher Schmied, machte bald seine Werkstatt zu, um fortan nur noch Ackerbau zu treiben. Später mußte er gelegentlich doch wieder zum Schmiedehammer greifen, während der Saisonarbeiten auswärts pachtete er fremde Schmieden, die er halbpart bewirtschaftete.
Unsere Familie kannte gelegentlich Lichtblicke relativen Wohlstands, doch im allgemeinen war das Leben hart und schwer, besonders erschwert vielleicht dadurch, daß unser Name den Beinamen „Pan“ trug, den die Leute scherzhaftwohlwollend oder ironisch gebrauchten und den mein Vater zu rechtfertigen suchte, indem er noch emsiger wirtschaftete, sich noch mehr in die Sielen legte. Übrigens trug mein Vater mit Vorliebe einen Hut, was in unserer Gegend, wo er kein „Alteingesessener“, sondern ein Zugewanderter war, als Marotte oder sogar Provokation galt, und er verbot uns Kindern, Bastschuhe zu tragen, obwohl wir dadurch oftmals gezwungen waren, bis in den späten Herbst hinein barfuß zu laufen. Überhaupt war manches bei uns „anders als bei den anderen Leuten“.
Mein Vater war ein gebildeter, „bäuerlich“ belesener Mann. Das Buch spielte in unserem Hauswesen keine geringe Rolle. Ganze Winterabende hindurch wurde bei uns vorgelesen: auf diese Weise lernte ich Puschkins Poltawa und Dubrowski, Gogols Taras Bulba oder die bekanntesten Gedichte von Lermontow, Nekrassow, A.K. Tolstoi und Nikitin kennen. Mein Vater kannte viele Gedichte auswendig, zum Beispiel „Borodino“, „Fürst Kurbski“, fast vollständig Jerschows „Buckliges Pferdchen“. Zudem konnte er prächtig singen, worin er sich bereits als Kind im Kirchenchor hervorgetan hatte. Einmal stellte er fest, daß das bekannte Lied „Korobuschka“ nur ein kleiner Teil von Nekrassows „Korobejniki“ („Die Körbelträger“) ist, daraufhin sang er gelegentlich dieses Poem im vollen Wortlaut.
Meine Mutter, Maria Mitrofonowna, war fast bis zur Sentimentalität empfänglich für alles, was nicht mit den praktischen Aufgaben und Interessen des Bauernhofs, den Sorgen und Scherereien des kinderreichen Haushalts zu tun hatte. Zu Tränen rührten sie der Klang des Hirtenhorns fern hinter den Sträuchern und Sümpfen des Chutors oder das Echo eines Lieds, das von entlegenen Feldern herüberhallte, oder der Duft des ersten Heus, der Anblick eines einsamen Bäumchens und dergleichen mehr.
Verse schrieb ich bereits, bevor ich richtig lesen und schreiben konnte. Ich weiß noch – mein erstes Gedicht, das Altersgefährten als Vogelnestplünderer entlarven sollte, versuchte ich zu schreiben, ohne überhaupt alle Buchstaben zu kennen und natürlich auch ohne die leiseste Ahnung vom Dichten zu haben. Es wurde denn auch ein ziemliches Kauderwelsch und alles andere als ein Gedicht voll Maß und Harmonie, doch ich entsinne mich deutlich, daß in mir der heftige Wunsch nach all dem war, das Verlangen, Maß, Musik und Harmonie zu erzeugen, eine Empfindung, die bis heute mit jeder neuen Idee einhergeht.
Daß man Gedichte auch durchaus selber schreiben kann, wurde mir bewußt, als einmal ein entfernter Verwandter mütterlicherseits, ein hinkender Gymnasiast aus der Sude, der in den Hungerjahren einen Sommer bei uns verbrachte, auf Bitten meines Vaters ein selbstverfaßtes Gedicht aufsagte; es hieß „Herbst“:
Zum Himmel starren kahle Zweige,
Die Blätter sind vom Wind verweht…
Und ich erinnere mich, wie mich diese Zeilen, ihre Klarheit und Stimmigkeit, damals verblüfften: „Kahle Zweige“ – ganz einfach, ganz normale Wörter! – und trotzdem ergaben sie einen Vers, der sich wie aus einem Buch anhörte.
Seit jener Zeit schreibe ich. Von den ersten Gedichten, die mir die Gewißheit gaben, daß ich nicht ganz unbegabt sei, sind mir ein paar Zeilen erinnerlich, die ich sichtlich unter dem Eindruck von Puschkins Wurdalak geschrieben habe:
Einst bei Nacht und Windgebrause
Ging ich von Wosnow nach Hause.
Bißchen gruslig wars, gesteh ich.
Doch dann schrecklich, denn da seh ich
Bei den Weiden, die sich wiegen,
Schupen, tot, ermordet, liegen.
Das Gedicht handelt von einem Grab – einsam gelegen, auf halbem Weg zum Nachbardorf Kowaljowa, wo unser Verwandter Michailo Wosnow wohnte –, dem Grab eines gewissen Schupen, der dort, an dieser Stelle, ermordet worden war. Weiden allerdings standen da nirgends, doch keiner daheim bemängelte diese Ungenauigkeit: Immerhin hörte es sich nach etwas an!
Teils wohlwollend, teils beunruhigt nahmen die Eltern meine Dichtversuche auf. Dem Vater, der ein sehr ehrgeiziger Mann war, schmeichelte es, aber aus Büchern wußte er nur zu gut, daß Schreiben wenig Vorteil im Leben verheißt, daß es auch Schriftsteller gibt, die keine Anerkennung, keinen Verdienst finden und in Dachkammern ein Elendsdasein fristen. Die Mutter sah in meinem Hang zu so abwegiger Beschäftigung eine beklagenswerte Vorbestimmung des Schicksals und bedauerte mich.
Mit dreizehn Jahren zeigte ich meine Gedichte einem jungen Lehrer. Der sagte mir allen Ernstes, so könne man heute einfach nicht mehr schreiben: Alles sei ja Wort für Wort verständlich, nein, ein Gedicht müsse so sein, daß man es von keiner Seite her verstehe, daß man nicht erkenne, worauf es hinauswill, wovon es handelt, so seien nun einmal die modernen Ansprüche an die Literatur. Er zeigte mir Zeitschriften mit Mustern der damaligen Poesie (zu Beginn der zwanziger Jahre). Einige Zeit bemühte ich mich redlich, meinen Gedichten eine gewisse Dunkelheit zu verleihen. Doch lange hielt ich das nicht durch, und damals überkamen mich wohl die ersten, zeitweise schweren Zweifel an meiner Begabung. Und ich erinnere mich – zuletzt schrieb ich derart konfuses Zeug, daß ich heute keine einzige Zeile mehr zusammenbekomme, ja nicht einmal weiß, wovon in etwa die Rede war. Ich erinnere mich nur noch an die Tatsache, daß ich einmal so geschrieben habe.
Ab 1924 sandte ich hin und wieder kleinere Beiträge an Smolensker Zeitungsredaktionen. Ich schrieb über schadhafte Brücken, über Komsomolsubbotniks, über den Mißbrauch der örtlichen Macht und so fort. Gelegentlich wurden sie auch gedruckt. Dadurch mauserte ich mich, der kleine Dorfkomsomolze, in den Augen meiner Mitschüler und überhaupt aller Einwohner zu einer sehr gewichtigen Persönlichkeit. Man kam zu mir mit Beschwerden, mit Vorschlägen, über das und das zu schreiben, dem und dem in der Zeitung „doch mal eins auf den Deckel zu geben“… Dann faßte ich mir ein Herz und sandte auch Gedichte ein. Im Sommer 1925 erschien in der Zeitung Smolenskaja Derewnja mein erstes gedrucktes Gedicht, „Das neue Haus“. Es begann so:
Harzdüfte. tropfend aus Kiefernholzporen.
Goldgelbe Sparren und Streben.
Hier ziehen wir ein – dem Frühling verschworen
Und dem neuen, sowjetischen Leben.
Da packte ich ein gutes Dutzend Gedichte ein und fuhr nach Smolensk, zu M.W. Issakowski, der in der Redaktion der Zeitung Rabotschi Putj saß. Er empfing mich freundlich, nahm einen Teil meiner Gedichte an und zitierte einen Pressezeichner herbei, der mich skizzierte, und nicht lange darauf wurde die Zeitung mit den Gedichten und dem Porträt des „Volkskorrespondenten und Dichters A. Twardowski“ im Dorf ausgetragen.
Michail Issakowski, meinem Landsmann und späteren Freund, habe ich hinsichtlich meiner Entwicklung sehr viel zu verdanken. Ich halte ihn für den im Grunde einzigen sowjetischen Dichter, der einen direkten und fruchtbaren Einfluß auf mich ausübte. An den Gedichten Issakowskis, der damals in unseren Breiten ein bereits bekannter Dichter war, entdeckte ich: Gegenstand der Poesie kann und muß nur das unmittelbar auf mich einwirkende Leben sein, das sowjetische Dorf, unsere selbstgenügsame Smolensker Natur und Landschaft, meine Welt der Wahrnehmungen und Empfindungen, Sympathien und Antipathien. Das Beispiel seiner Dichtung lenkte meine jugendlichen Schreibversuche zum wesentlichen objektiven Thema hin, weckte das Bemühen, im Vers zu artikulieren, was allgemein von Interesse ist. – nicht nur für mich, sondern ebenso für all die einfachen, literarisch unvorbelasteten Menschen, unter denen ich lebte. Dabei sei allerdings eingeräumt, daß ich damals ziemlich schlecht schrieb, schülerhaft unbeholfen und imitativ.
Für die Entwicklung und Blüte meiner Schriftstellergeneration war, wie mir scheint, äußerst hinderlich, für viele Kollegen geradezu verderblich, daß wir von Anbeginn unserer Veröffentlichungen, oft bis hin zur „Professionalität“ Leute blieben, denen es an solider Literaturkenntnis und Allgemeinbildung fehlte. Oberflächliche Belesenheit, ungefähres Wissen um die „kleinen Geheimnisse“ des Handwerks nährten in uns gefährliche Illusionen.
Mein Bildungsgang endete im Grunde genommen mit Abschluß der Dorfschule. Die Jahre, die einer normalen, gründlichen Ausbildung gehören sollten, verstrichen. Mit achtzehn ging ich nach Smolensk, wo es mir jedoch etliche Zeit nicht gelang, ein Studium aufzunehmen, ja nicht einmal Arbeit zu finden – zu jener Zeit war dies noch recht schwierig, zumal ich keinerlei Fachausbildung vorzuweisen hatte. So mußte ich für meinen Lebensunterhalt wohl oder übel literarische Groschenarbeit leisten und Redaktionsklinken putzen. Damals auch verstand ich das Prekäre einer solchen Situation, doch ein Aufstecken gab es nicht – ins Dorf zurück konnte ich nicht, und meine Jugend beflügelte mich, in der nahen Zukunft nur Gutes zu sehen.
Als M.A. Swetlow meine Gedichte in der Moskauer Zeitschrift Oktjabr veröffentlichte und ein Kritiker davon Notiz davon nahm, machte ich mich auf nach Moskau. Aber dort erging es mir ähnlich wie in Smolensk. Selten wurde ich gedruckt, dieser und jener äußerte sich auch wohlwollend zu meinen Versuchen, wärmte kindliche Illusionen, doch ich verdiente kaum mehr als in Smolensk, hauste in Winkeln und Notquartieren. klapperte Redaktionen ab und wurde immer merklicher von dem geradlinigen, schweren Weg des wirklichen Lernens, des wirklichen Lebens abgetrieben. Im Winter 1930 kehrte ich nach Smolensk zurück und lebte dort sechs, sieben Jahre, bis zum Erscheinen meines Poems Wunderland Murawia.
Diese Periode war, glaube ich, maßgebend für mein weiteres Schriftstellerdasein. Sie fiel in die Jahre der großen Umgestaltung des Dorfs, der Kollektivierung der Landwirtschaft, eine Zeit, die mir ebensoviel bedeutete wie der älteren Generation die Oktoberrevolution und der Bürgerkrieg. Was sich im Dorf da vollzog, war für mich von Riesenbedeutung – im privat-menschlichen, gesellschaftlichen wie ethisch-moralischen Sinne. Und diesen Jahren verdanke ich meine Entwicklung zum Dichter. In Smolensk konnte ich schließlich ein reguläres Studium aufnehmen, wurde mit Unterstützung des inzwischen verstorbenen Parteifunktionärs A.N. Loktew am Pädagogischen Institut immatrikuliert, ohne die Aufnahmeprüfung ablegen zu müssen, doch unter der Bedingung, innerhalb des ersten Studienjahrs alle notwendigen Fächer einer Zehnklassenschule nachzuholen. Dies erreichte ich, glich die Diskrepanz zu meinen Kommilitonen aus, absolvierte mit Erfolg das zweite Studienjahr, schied aber im dritten auf Grund bestimmter persönlicher Umstände aus und studierte erst später, ab Herbst 1936, am Moskauer Institut für Geschichte, Philosophie und Literatur zu Ende.
Diese Jahre des Studiums und der Arbeit in Smolensk haben sich mir für immer als eine Zeit des starken seelisch-geistigen Aufschwungs eingeprägt. Namenlos, mit keinem noch so hochgreifenden Vergleich zu beschreiben war jene erste Freude, die ich mit Eintritt ins Reich der Bücher, in jene zuvor nie geahnte Welt der Ideen und Bilder erlebte. Aber vielleicht wäre für mich das alles nur ein „Durchnehmen“ von Lehrstoff geblieben, hätte mich gleichzeitig nicht auch eine andere Welt in ihren Bann gezogen – die reale, gegenwärtige Welt der Erschütterungen, Kämpfe und Wandlungen auf dem Lande. Oft trennte ich mich von Buch und Studium, reiste als Zeitungskorrespondent von Kolchos zu Kolchos, war mit Feuereifer allem auf der Spur, was die neue Lebensordnung im Dorf ausmachte, schrieb Artikel, Korrespondenzen, notierte nach jeder Reise für mich Beobachtungen und Erfahrungen, die von dem schwierigen, zum Kollektivleben führenden Entwicklungsprozeß zeugten. Um diese Zeit kam ich vom Gedichteschreiben ganz ab, zumindest in der Weise, wie ich es früher gepflegt hatte, empfand regelrecht Widerwillen gegen die „Dichtkunst“ – gegen das Fabrizieren von Zeilen in festem Versmaß, die obligatorische Anhäufung von Epitheta, die Suche nach besonderen Reimen und Assonanzen, überhaupt gegen das Bestreben, den allbekannten, in der poetischen Sprache gebräuchlichen Ton zu treffen.
Mein Poem „Weg zum Sozialismus“, benannt nach dem darin beschriebenen Kolchos, war ein bewußter Versuch, das „Schöne, Poetische“ über Bord zu werfen, den Vers sachlich und umgangssprachlich zu halten.
Im früheren Gutshaus, in einem der stattlichen Zimmer,
Liegt Hafer – ein stattlicher Berg.
Die Fenster, da noch vom Pogrom her in Trümmern,
Sind verhängt und verstopft mit Lumpen und Werg,
Damit nicht vor Sonne und Nässe
Da drinnen das Haferkorn keimt…
Das Poem erschien 1931 im Verlag Molodaja Gwardija – auf Empfehlung Ed. Bagrizkis, der sich Nachwuchsautoren gegenüber immer sehr aufgeschlossen zeigte –, wurde im allgemeinen positiv besprochen, ich selber aber konnte mich plötzlich des Eindrucks nicht erwehren, daß diese Art zu schreiben ein Ritt mit verhängtem Zügel, die Aufgabe der rhythmischen Versdisziplin ein Verlust, kurz – keine Dichtung sei. Doch zu den Versen alten Stils mochte ich nicht mehr zurück. Neue Möglichkeiten wähnte ich im Bau des Verses aus Elementen, die fest in der Gegenwartssprache verwurzelt sind: Wortfügungen und -kombinationen, Redewendungen, Sprichwörtern, dazu lautlichen oder sinnverwandten Parallelbildungen, folkloristischen Wiederholungen und so fort. Mein zweites Poem, „Einleitung“, erschienen 1932 in Smolensk, war so etwas wie ein Tribut an dieses recht einseitige Trachten nach der „Natürlichkeit“ des Verses.
Gemessen an Sprachmaterial und Inhalt, ja sogar an den in großen Zügen gezeichneten Gestalten, waren diese beiden Poeme Vorbereitung auf Wunderland Murawia, das ich 1934 bis 1936 schrieb. Doch für diese neue Arbeit sollte ich noch in eigener, nicht leichter Erfahrung die Unwirksamkeit eines Verses erkennen, dem die grundlegenden „angeborenen“ Stilelemente entzogen sind – das Musikalisch-Liedhafte, die Energie des Ausdrucks, der besondere, subjektive Emotionsgehalt.
Die intensive Beschäftigung mit der großen russischen und ausländischen Dichtung und Prosa gewährte mir noch „Entdeckungen“ wie etwa die der Legitimität des Irrealen bei der künstlerischen Darstellung der Wirklichkeit. Ich hörte auf, das Irreale, zumindest eines phantastischen Sujets, die Überhöhung und Verschiebung von Details der konkreten Wirklichkeit als überholtes, dem Realismus einer Darstellung entgegenstehendes Kunstmoment zu betrachten.
Alles, was ich im Leben beobachtet und wahrgenommen hatte und – durch mein Ich gefiltert – in mir trug, trieb mich zu neuer Arbeit, zu neuer Suche. Und alles, was ich vom Leben wußte – so schien mir damals –, wußte ich besser, genauer und wahrheitsgetreuer als alle Menschen der Welt, und darum mußte ich es erzählen. Bis auf den heutigen Tag meine ich, daß diese Überzeugung berechtigt, ja notwendig ist für die Umsetzung einer, jeder künstlerischen Idee.
Die Entstehungsgeschichte von Wunderland Murawia, dessen Idee mir von A.A. Fadejew, in einer seiner damaligen Reden, souffliert wurde, schilderte ich später in dem Artikel „Über ,Wunderland Murawia‘“.
Dieses Poem, das Leser und Kritiker freundlich aufnahmen, betrachte ich als erste meiner Arbeiten, die mich als Schriftsteller charakterisieren. Das Erscheinen dieses Bandes gab mir Anlaß zu wichtigen Veränderungen auch in meinem persönlichen Leben. Ich siedelte nach Moskau um; 1938 trat ich in die Reihen der Kommunistischen Partei ein; 1939, nach Abschluß des Moskauer Literaturinstituts, brachte ich meinen neuesten Gedichtband Dorfchronik heraus.
Im Herbst 1939 wurde ich zur Armee einberufen, um am Befreiungsfeldzug nach Westbelorußland teilzunehmen. Nach Beendigung des Feldzugs wurde ich in die Reserve entlassen, bald darauf aber wieder einberufen. Inzwischen bereits im Offiziersrang, doch wie zuvor Sonderkorrespondent einer Militärzeitung, nahm ich am Krieg gegen Finnland teil. Diese Monate an der Front, unter den Bedingungen des strengen Winters 1940, nahmen für mich in bestimmter Hinsicht Eindrücke des Großen Vaterländischen Krieges voraus. Und mein Mitwirken bei der Erfindung des Feuilletonhelden „Wassja Tjorkin“ für die Zeitung Na Strashe Rodiny ist im Grunde der Auftakt zu meiner literarischen Tätigkeit in den Jahren des Vaterländischen Krieges. Nur ist es so, daß das Ausmaß des volkshistorischen Unheils und des volkshistorischen Heldentums den Vaterländischen Krieg seit den ersten Tagen von jedem anderen Krieg und erst recht jeder Militärkampagne unterschied. Und das ist natürlich auch der Grund für den wesentlichen Unterschied zwischen dem heutigen „Wassili Tjorkin“ und jenem „Wassja“ von damals.
Wie dieser Band entstand, habe ich ausführlich in dem Artikel „Wie ,Wassili Tjorkin‘ geschrieben wurde (Antwort auf Leserfragen)“ dargelegt. Hier sei nur gesagt, daß es ein „Buch vom Kämpfer“ ist, und wie groß oder klein sein eigentliches literarisches Gewicht auch sein mag – in den Jahren des Kriegs bedeutete es mir unsagbar viel: Es bestätigte mich, gab mir das Gefühl, daß meine Arbeit einen Sinn hat, daß ich mit Wort und Vers frei schalten und walten kann – bei jeder mir auferlegten gemäßen Form der Darstellung.
„Tjorkin“ war für mich – meine Lyrik, meine Publizistik, Lied, Belehrung, Anekdote und heitere Erläuterung zugleich, vertrautes Gespräch und treffende Replik aus gegebenem Anlaß. Übrigens habe ich all das, wie mir scheint, im Epilog des Buchs etwas glücklicher formuliert.
Fast gleichzeitig mit „Tjorkin“ und den Gedichten der „Frontchronik“, also noch während des Kriegs, begann ich an dem Poem „Das Haus am Weg“ zu arbeiten. Thema ist der Krieg, doch von einer anderen Seite aus gesehen als im „Tjorkin“, von einem Zuhaus aus, einer Familie, der Frau und den Kindern des Soldaten. Motto des Bandes könnten die in ihm enthaltenen Zeilen sein:
Wir wollen es, Menschen,
Niemals vergessen.
Neben Gedichten schrieb ich zu jeder Zeit auch Prosa – Korrespondenzen, Skizzen, Artikel, Erzählungen; noch vor Murawia erschien eine kürzere Erzählung unter dem Titel „Tagebuch eines Kolchosvorsitzenden“ – Resultat meiner Dorfnotizen „für mich“ – und 1947 ein Band über den vergangenen Krieg: Heimat und Fremde, der dann zusammen mit späteren Skizzen und Erzählungen in den vierten Band meiner fünfbändigen Gesammelten Werke aufgenommen wurde. In meinen Plänen und Vorhaben für die Zukunft nimmt bei mir seit langem wohl die Prosa einen größeren Platz ein.
Mit der Smolenstschina verbindet sich mir nicht nur die Erinnerung an mein Vaterhaus, an Kindheit und Jugend, an meine literarischen Lehrjahre in Smolensk, sondern auch an die Zeit des Kriegs, als ich mit unserer Truppe in das verwüstete, von den Okkupanten befreite Heimatgebiet zurückkehrte, und diese Bindung blieb auch in den Nachkriegsjahren bestehen. Erklärlich also, daß in all meinen Gedichten, Poemen, Erzählungen und Skizzen so häufig Motive und Bilder des „Smolensker Lands“ anklingen.
Ebenso natürlich ist, daß mit den Jahren, mit der Erweiterung meiner Lebenserfahrungen, der Kenntnisse von Literatur und Gesellschaft, mit Reisen durch unser Land und über seine Grenzen hinaus, sich auch sozusagen das Feld der Wirklichkeit, Basis meiner schriftstellerischen Tätigkeit, erweiterte.
Und sagen kann ich – ist mir die Smolenstschina mit all ihren unauslöschlichen, unschätzbaren Erinnerungswerten von Vater und Mutter, wie man sagt, überkommen, so habe ich in reiferen Jahren anderes, zum Beispiel Sibirien mit seiner strengen, majestätischen Schönheit, seinen Reichtümern, gigantischen Baustellen, seinen märchenhaften Perspektiven für mich entdeckt und gewonnen. Nur daß ich die Sehnsucht dorthin, nach Sibirien oder dem Fernen Osten, bereits vorher hatte, lange vor den ersten Reisen, bereits in den Jugendjahren – geweckt durch Bücher und die schwärmerischen Umsiedlungspläne, die mein Vater, ganz im Widerspruch zu der starken Bindung an seinen sauer erarbeiteten „Gutsbesitz“, hin und wieder schmiedete. Diese neue Bindung – Bindung an „andere Regionen“ – förderte ich in mir bewußt seit Ende der vierziger Jahre, als ich zum erstenmal im Osten des Landes weilte, und sie erfuhr ihren unmittelbaren Ausdruck in meiner wichtigsten Arbeit der fünfziger Jahre, dem Poem „Fernen über Fernen“.
Meine Poeme sind dem Leser bekannter als die Lyrik, sie wurden des öfteren aufgelegt, besonders Wassili Tjorkin, und erregten weit mehr das Interesse der Kritik. Dies offensichtlich nicht zufällig. Doch ich persönlich sehe die Lyrik im Gesamtrahmen meiner Arbeiten durchaus nicht als zweitrangig an, sie steht, meine ich, in engem Kontext mit den Poemen. Ihre Motive – das weiß ich als Autor besonders gut – nehmen oft inhaltliche oder formale Grundzüge größerer Arbeiten vorweg oder ergänzen nachträglich, führen Gedanken aus, die im Poem keinen Platz fanden oder nur angedeutet werden konnten. Mehr noch, einige Gedichte, selbst bereits erschienene, wurden später vollständig oder strophenweise in den Text des einen oder anderen Poems eingebaut und hörten auf, für sich zu existieren; andere entstanden mit dem Poem, aber schnürten sich sozusagen in Zellteilung ab, machten sich selbständig. Der aufmerksame Leser wird diese Verwandtschaft, diese Wechselbeziehung zwischen Gedicht und Poem unschwer erkennen.
Natürlich ist die Genrebezeichnung „Lyrik“ für viele Gedichte nur bedingt richtig, nicht nur hinsichtlich des Umfangs, der mitunter die Norm eines lyrischen Gedichts weit übersteigt (zum Beispiel „Lenin und der Ofensetzer“ oder „Nochmals über Danil“), sondern auch hinsichtlich ihres vorwiegend erzählerisch-balladesken Charakters (besonders Gedichte der Vorkriegs- und Kriegszeit). Das trifft übrigens auch für die Einbeziehung des Poems in das rein epische Genre zu. Das lyrische Prinzip geht bei allen Poemen, wie auch die Kritik bemerkte, über den Rahmen der traditionellen „lyrischen Abschweifung“ hinaus, dient häufig kompositorischen Zielen und wird – indem durch die Gesamtdarstellung hindurch der epische und lyrische Tun ineinander überwechseln – zum Strukturelement.
In diesen Jahren schrieb ich neben dem Band Fernen über Fernen, neben Gedichten, Skizzen und Presseartikeln auch das Poem „Tjorkin im Jenseits“. Natürlich ist es keine Fortsetzung des „Wassili Tjorkin“ entsprechend den vielen Leservorschlägen, zu denen ich in „Antwort an Leser“ Stellung nahm, aber es hängt mit dem Buch vom Kämpfer insofern zusammen, als ihm die Gestalt des Helden entliehen ist. Es hat hauptsächlich ein anderes, nur satirisch umsetzbares Anliegen und richtet sich gegen bestimmte Seiten der Nachkriegswirklichkeit, im selben Sinne, wie sie auch der XX. und XXII. Parteitag werteten.
Gegenwärtig widme ich den Hauptteil meiner Arbeitszeit der Redaktion der Zeitschrift Nowy Mir.
Sobald eine Autobiographie die Vergangenheitsform verläßt, wird ihre Fortführung, gelinde gesagt, unbescheiden, auf alle Fälle kann sie nicht ersetzen, was für sie zu leisten noch aussteht – das Schreiben neuer Werke, von denen der Autor erst sprechen sollte, wenn sie vor dem Richter, dem Leser, erschienen sind.
Alexander Twardowski, Nachwort, 1947–1967
Alexander Twardowski (1910–1971)
gehört zu den eigenwilligsten Dichterpersönlichkeiten der russischen Sowjetliteratur. Über sein eigentliches Schaffen hinaus verstand er sich als Sachwalter der nachdrängenden jungen Schriftstellergeneration. Als Chefredakteur der renommierten Literaturzeitschrift NOWY MIR, der er bis 1969 vorstand, gelang ihm die Entdeckung und Förderung wesentlicher, heute über die Grenzen des Landes hinaus anerkannter Talente.
Twardowskis dichterisches Werk, das sich bewußt traditioneller Formen bediente und sie erstaunlich modifizierte, machte seinen Autor schon zu Lebzeiten populär. Im Duktus der Schlichtheit griff er – wie von ungefähr – die zentralen Themen sowjetischen Lebens auf, ohne sie zu simplifizieren und ohne: vor den Schwierigkeiten – etwa dem komplizierten Prozeß der Kollektivierung, dem harten Leben des einfachen Frontsoldaten – in die verharmlosende Metapher auszuweichen. Seine Poeme „Wassili Tjorkin“, „Wunderland Murawien“, „Das Haus am Wege“, „Fernen über Fernen“ wurden zu außergewöhnlichen Erfolgen.
Vier Jahre vor seinem Tode besorgte Twardowski die Herausgabe eines schmalen, lediglich zweiundvierzig Gedichte umfassenden Bandes. Jene Spätgedichte – „Aus der Lyrik dieser Jahre 1959–1967“ überschrieben – verblüffen durch ihre unverstellte Subjektivität, mit der von kommunistischer Position aus Bleibendes und Vergängliches, Wert und Unwert menschlichen Verhaltens geortet werden. Dieser Band – 1971 mit dem Staatspreis für Literatur und Kunst bedacht – erscheint nun in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel Gedichte dieser Jahre in der Lyrikreihe des Verlages Volk und Welt. Die von Jürgen Rennert besorgte Nachdichtung zielt, bei größtmöglicher Wahrung der formalen Eigenheiten des Originals, darauf, „hinter der Einfachheit der sprachlichen Form das vertrackte Metrum eines vom Hirn her kontrollierten Herzens hörbar werden zu lassen“.
Verlag Volk und Welt, Begleitzettel, 1975
Korrespondenz zu Twardowski
Lieber Jürgen Rennert,
für eine Lyrikreise zu Weihnachten in der Jungen Welt hatte ich ziemlich viel Literatur abgegrast, auch die „weiße Lyrikreihe“. Es war dann aber wie meist bei solcher Sache: zuviel Material. Später, im Februar, ergab sich dann doch eine Gelegenheit (ich weiß nicht, ob Du es zu Gesicht bekommen hast, deshalb geht eine Zeitung mit gleicher Post an Dich). – Reaktionen von Lesern sind nicht allzu häufig (man äußert sich meist nur dann, wenn man „Einspruch“ erhebt, eine Sache „verreißt“, oder aber, wie in diesem Falle, etwas nicht verstanden hat). Nun diese Frage und Bitte der Dörte T. – Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du dem Mädchen antworten könntest, zumal Du Dich für diesen nachgedichteten Band eingehend mit Twardowski beschäftigt hast. Mir scheint, daß solche „Erklärung“ auch in die Öffentlichkeit könnte, zu einem besseren Lyrikverständnis beitrüge. Ich würde Deinen Brief gern in der Poetensprechstunde drucken. Da sind 70 Manuskriptzeilen möglich, vielleicht auch ein paar Worte zu Twardowski (abzüglich Raum fürs Briefzitat, gerafft natürlich). Halten wir’s so, daß Du mir die Kopie Deines Briefes überläßt (oder aber ich leite ihn von hier aus weiter)? Ein erkleckliches Honorar sei Dir zugesichert (wie ich auch hoffe, daß Dir der Verlag das Nachdichtungshonorar überläßt). So bleibt mir nur, Dir schon jetzt sehr herzlich für Deine Mühe zu danken und Dir viel Schaffenskraft zu wünschen für Dein nächstes Buch, für Deine nächsten Zeitschriftenbeiträge.
Mit besten Grüßen
Hannes Würtz
An die Redaktion der Jungen Welt
Betrifft: Anfrage zum Gedicht: „Dank“ von Alexander Twardowski
Mit einer Jugendgruppe habe ich am 23. Februar unter anderem über das Gedicht von Alexander Twardowski „Dank“ (Nachdichtung: Jürgen Rennert), das in der Jungen Welt desselben Tages auf S. 13 veröffentlicht wurde, gesprochen. Die Zusammenstellung von Foto und Gedicht hatte mir zunächst gefallen, aber die letzte Strophe war mir unverständlich, und auch im Gespräch mit der Gruppe fand sich keine eindeutige Lösung; konnten die Verstehensschwierigkeiten nicht beseitigt werden.
Ob Sie uns mit einer Interpretationsmöglichkeit Ihrerseits helfen können?
Hier einige unserer Gedankengänge:
Wir gingen zunächst von der Überschrift „Dank“ aus. Wir sprechen anderen Menschen einen Dank aus, wenn wir ihnen etwas verdanken. Dank braucht ein Gegenüber. Der Gedanke, sich selbst einen Dank auszusprechen (letzte Zeile des Gedichts), war dem größten Teil von uns fremd und ungewöhnlich. Wir stellten allerdings fest, daß wir alle dieses Glücksgefühl kannten (wie es hier an Hand eines Naturgedichts beschrieben wird), wenn wir etwas Schönes erleben oder wenn uns etwas gelingt.
Wenn der Verfasser dieses Gedichts feststellt, er möchte sich beim Betrachten der Winterlandschaft bei jemandem bedanken, aber dann doch nicht so recht weiß bei wem und wofür (ist ja auch schwierig: Frost und Schnee sind keine Produkte, die beim Arbeitsprozeß des Menschen entstehen), verstehen wir das. Nur der letzte Satz ist uns dann unverständlich. Wieso dankt er sich den verschneiten Wald selber und das Glücksgefühl, das dieser Anblick in ihm auslöst?
Eine Möglichkeit der Interpretation dieses Satzes sahen einige darin: Er hat sich in den Wald begeben, einen Weg dorthin gemacht. Darum verdankt er sich dieses Glück. Andere sagten: Er hat den Waldfrieden nicht zerstört; überhaupt sich für den Frieden eingesetzt – darum verdankt er sich dieses Glück.
Schließlich und letztlich sagt er in dem Gedicht ja auch nicht, daß er sich selbst alles verdankt, sondern nur zu einem Stück und heute.
Unsere Frage ist nun: Wem verdankt er den Rest?
Wir wären Ihnen für Ihre Interpretationsmöglichkeit des Gedichtes dankbar.
Im Namen der Jugendlichen
grüßt Sie Dörte Thoms
Liebe Dörte Thoms,
Dank für Ihren mir wichtigen Brief. Er versetzt mich in eine Situation, die vermutlich jener ähnelt, aus der heraus Alexander Twardowski sein „Dank-Gedicht“ schrieb. Denn ich bin dankbar für die große Aufmerksamkeit, mit der Sie und Ihre Jugendgruppe auf zwölf Zeilen achtgaben, die 1966 von Twardowski geschrieben wurden, fünf Jahre vor seinem allzu frühen Tod. Lassen Sie mich, bitte, bevor ich zur Sache komme, kurz sagen, was mir Alexander Twardowski, dessen letzten Gedichtband ich für den Verlag Volk und Welt nachdichten durfte, bedeutet. Ich sah und sehe in ihm einen jener seltenen Zeitgenossen, die ihrer Weltanschauung bis in die Verästelungen ihres scheinbar privaten Denkens, Sprechens und Verhaltens hinein treu geblieben sind, mit ihrer Überzeugung identisch wurden. Und dies angesichts großer persönlicher Erschütterungen, herber Enttäuschungen und mancher ungerechtfertigten Kritik. Twardowskis kommunistische Überzeugung verband sich auch in der Praxis unauflösbar mit den einfachen Grundsätzen menschlicher Ethik. Zu diesen einfachen Grundsätzen gehören so schwer zu praktizierende Tugenden wie: unbedingte Aufrichtigkeit, Aufmerksamkeit für den anderen und Verantwortungsbewußtsein für das Geschick aller Menschen auf dieser Erde. Wenn Sie weitere Gedichte von Twardowski lesen, werden Sie spüren, wie unpathetisch und konkret diese nahezu pathetischen Begriffe von Twardowski gelebt und veranschlagt wurden. Wer sich nun um solche „guten Sitten“, um ein Ethos also, bemüht, wird zwangsläufig feinfühliger, achtsamer, genauer. Und mit dem sich verfeinernden Gespür für alles, was den Menschen noch belastet, beschwert und bekümmert, wächst auch das Gespür für all das, was den Menschen entlastet, erleichtert, erfreut. Und das Entlastende, Erleichternde, Erfreuende wird uns ja nicht allein durch Menschen zuteil, sondern oft genug durch jenes unverdankt vorgefundene, uns umgebende Stück Landschaft, deren Schutz uns schon von daher angelegen sein sollte. Darin stimmen wir, glaube ich, überein, denn Sie schreiben:
Wir stellten allerdings fest, daß wir alle dieses Glücksgefühl kannten (wie es hier an Hand eines Naturgedichts beschrieben wird)…
Nun wird es aber – und da verstehe ich Sie sehr gut – wirklich problematisch. Denn an wen adressieren Menschen, die noch in Begriffen und Empfindungen des Verdienten und Unverdienten, des Schenkens und des Beschenktwerdens erzogen wurden, ihre Dankbarkeit, wenn ihnen unerwartet Schönes zuteil wird, das keinen Menschen zum Urheber hat? Sollten sie überhaupt dankbar empfinden? Ich gestehe, daß ich Dankbarkeit für eine der wesentlichsten menschlichen Empfindungen halte. Denn Danken und Denken haben nicht nur aufgrund ihrer gemeinsamen sprachlichen Herkunft miteinander zu tun. Wer dankt, hat bewußt oder unbewußt erkannt, daß ihm da etwas zufiel, was sich nicht „von selbst verstand“. Wer dankbar zu sein vermag, beweist einen realistischen Blick. Ihm entgeht nicht, daß da gegeben wird und wer da wem etwas gibt. Das Gefühl der Dankbarkeit bewahrt das Geflecht unserer sozialen und kulturellen Beziehungen, ohne die der einzelne nicht zu leben vermag, vor der Verknöcherung und Erstarrung zum Gitter.
Twardowskis Dank „für diesen Morgen“ verstehe ich also als eine elementare, an das Sein, an die Welt, an die frühe Stunde gerichtete Äußerung. Sie braucht vorerst keinen anderen Adressaten. Entscheidend ist das unverkümmerte, mobilisierende Gefühl, das ihr zugrunde liegt. Doch nun zur dritten Strophe, deren letzte Zeile beim Abdruck in der „JW“ um ein „e“ im Wort „danke“ ärmer und damit metrisch holpernd gemacht wurde. Da kann ich – wie jeder andere Leser – auch, nur vom Text ausgehen, der dasteht. Und seine Offenheit im Gedanklichen erscheint mir als ein großer Vorzug. Denn das führt – wie Ihr Beispiel, liebe Dörte, zeigt – zu dem Wesentlichsten, was ein Gedicht überhaupt zu leisten vermag: zur Beschäftigung des Lesers mit seinen eigenen, subtilen Empfindungen angesichts einer vom Gedicht überzeugend vorgegebenen Fragestellung. Ich glaube, daß jede, wirklich jede Interpretation richtig ist, recht hat, die ein vom Text ausgehender Leser für sich findet. Denn es geht immer um ihn und nicht um das Gedicht. Ein Gedicht kann noch so schön sein, es wird dennoch in all seiner Schönheit sterben, wenn niemand da ist, der es sich auf seine Weise an verwandelt. Und ich erkläre mir nun die letzte Strophe aus dem Zusammenhang des ganzen Gedichts als das Ergebnis einer Empfindung und Überlegung, die im Gedicht selbst vorgeführt wird. Auf der gedanklichen Suche nach dem Adressaten für seinen Dank – ein religiöser Mensch würde ihn vielleicht an Gott als den Weltenschöpfer richten – stößt Twardowski, der Atheist, auch auf die Wurzeln dieser Dankbarkeit in sich selbst. Denn ohne menschliche Wachheit und Ansprechbarkeit könnten Welt und Wintermorgen so schön sein wie nur irgend denkbar, sie blieben dennoch ohne Belang und riefen ungesehen nichts hervor. Twardowski macht mich mit diesem Gedicht aufmerksam auf jene Eigen-Aktivität, ohne die ein scheinbar so passives Gefühl wie das der grenzenlosen Dankbarkeit nicht zu haben ist.
So also, liebe Dörte, verstehe ich das Gedicht, das heißt: so verstand ich es. Denn dank Ihres Briefes ist etwas geschehen, was mein Verstehen und Verständnis dieses Gedichts erweitert und bereichert: Ihre Fragen und Ihre Lesarten werde ich – ob ich will oder nicht – künftig „im Ohr haben“, wenn ich das Gedicht erneut lese und bedenke. Deshalb mein Dank am Anfang, den ich nun noch einmal bekräftige.
Mit guten Wünschen und Gedanken bin ich
Ihr
Jürgen Rennert
Auszugsweise veröffentlicht in der Rubrik Poetensprechstunde der Jungen Welt vom 21./22.4.1979
ALEXANDER TWARDOWSKI
Er, der bescheiden schien,
War doch so unbescheiden,
Vor niemandem zu knien
Und keinen zu beneiden.
Sein Stolz war wie sein Land:
Nicht sterblich, doch verwundbar.
Und da er Krankes fand,
Fand er auch, was gesund war.
Was er bei allem wußte,
War mehr als viele wissen:
Noch ist die alte Kruste
Nicht gänzlich aufgerissen.
Sein Wort nahm sich gelassen,
Klar und erheiternd aus,
Schlug ungezählte Trassen,
Bot Obdach wie ein Haus.
Er sah sich unter vielen
Ankommen und vergehen
Und dennoch in den Zielen
Der Menschen fortbestehen.
Jürgen Rennert
Fakten und Vermutungen zum Autor
Zum 70. Geburtstag des Übersetzers:
Roland Lampe: Ein streitbarer Anwalt der Literatur
Märkische Oderzeitung, 13.3.2013
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK


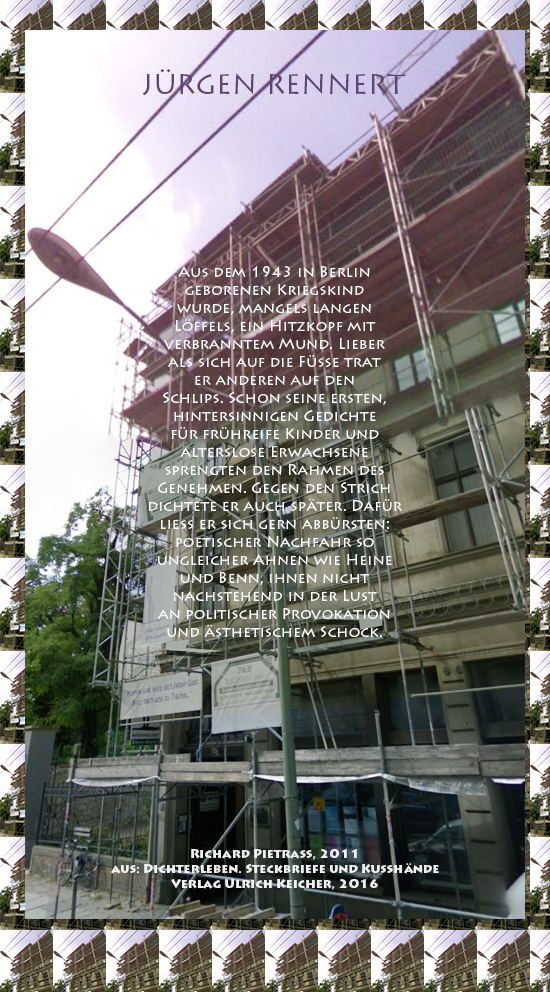












Schreibe einen Kommentar