Andrea Zanzotto: Lichtbrechung
(SONETT ÜBER WAS?)
Was tust du und denkst du? Wer denn antwortet wem?
Sind das Vögel, die ich mit Geräuschen vertausche,
welches Wasser bring ich in der Leere zum Rauschen
durch hohles Land und ausgehöhlten Lehm?
Zu wem, zu welchem Schneider kann ich noch gehen
mit der Logik, die mich zerreißt, ein Loch, ein Lauschen,
für wen laß ich Ton um Ton die Sprache entstehen
wo nur Gesanglosigkeit ist, Nichtrede, Fauchen?
Du warst nie, so kenn ich von dir nur Niegedachtes
dieses Niewort, das Nie in meinen Träumen,
den Traumort, wer weiß aus wer weiß, Niegemachtes.
Die Stimmen der Vögel, der großen Wälder, der Wasser,
das Nichts bewegt sich, formt aus nichts die Räume,
erdachte Nicht-Gedanken, denk: an was?
Zu Beginn dieses Jahrhunderts
schrieb Hugo von Hofmannsthal, mit seinem Brief des Lord Chandos, ein großartiges Manifest zum poetischen Wort, jenem, das ins Unsagbare zeigt und im Verstummen erlischt: Der Protagonist in der Erzählung von Hofmannsthal ist ein Dichter, der zum Schweigen gelangt, da die Sprache die Dinge nicht mehr sagt und dem Fluß des Lebens und seine Epiphanien erstarren läßt. Wahrscheinlich keine andere Literatur des 20. Jahrhunderts hat diese Krise der Sprache so gelebt und zum Ausdruck gebracht wie die österreichische, die im Völkergemisch des Donauraums entstand; es ist eine Krise, die die gesamte zeitgenössische Literatur betrifft, nur aus ihr kann heute noch authentische Dichtung hervorgehen.
Andrea Zanzotto, eine der bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen Lyrik, hat die Herausforderung angenommen, die von den stummen und opaken Dingen an den Helden bei Hofmannsthal erging – als wäre auch er ein rebellischer, aber zugleich ein mitleidender Erbe jener reichen österreichischen Koiné, als gehörten auch die Orte seiner Dichtung, die kleinen vergessenen Gasthäuser, die Friedhöfe und die Gehöfte seiner Heimat Venetien, zu jenem dunklen und fruchtbaren Schoß, jenem unvordenklichen Nährboden der Existenz, den das Habsburgerreich vor der Geschichte zu bewahren suchte, vor der Rationalisierung und dem Projekt der Moderne.
Die gleichermaßen moderne und archaische Dichtung Andrea Zanzottos steigt hinab zu den Ursprüngen des Sprechbaren, wo das Individuum noch nicht getrennt ist von der undifferenzierten Totalität der Welt und noch in der Geschichte lebt wie in einem Mutterleib. Zanzottos Dichtung ist ein Gang in das Reich der Toten, auf der Suche nach jenem unerreichbaren goldenen Zweig, der das Geheimnis des Todes ist – denn um das Unsagbare zum sprechen zu bringen, muß die Aphasie alle sprachlichen Formen überschreiten. Zanzottos Wort reicht bis unter den Schutt der Jahnhunderte hinab, unter das, was Geschichte, Zivilisation und Kultur angesammelt haben; Alchimist im Laboratorium der Sprache und orphischer Dichter, steigt er hinab in den Schlaf und in den Traum, die magische Sprache abzuhorchen und nachzusprechen, in der, wie Lord Chandos es sagte, die stummen Dinge zu Wort kommen.
Claudio Magris, Klappentext, 1987
Zur Dichtung von Andrea Zanzotto
Die vorliegende Auswahl stellt dem deutschsprachigen Leser eine einzigartige Erfahrung in der zeitgenössischen Dichtung vor. Das Buch umfaßt den Zeitraum der letzten zehn Jahre, nämlich die „Trilogie“ Il Galateo in Bosco (1978), Fosfeni (1983) und Idioma (1986): Der erste „Flügel“ dieses Triptychons, der Galateo, erschien zehn Jahre nach La Beltà, dem Ausgangspunkt jener Erfahrung.
Es ist nicht unwichtig, an den Schock zu erinnern, den La Beltà bei ihrem Erscheinen ausgelöst hat. Hier wurde anscheinend ein Beispiel gegeben, oder praktisch der Beweis für das erbracht, was einige der grundlegenden Bücher dieser Jahre zu den Themen Sprache, Subjekt und Geschichte behauptet hatten. Ich meine damit La pensée sauvage und die ersten Bände der Mythologiques von Claude Lévi-Strauss (1963-66), die Ecrits von Lacan (1966), Les Mots et les Choses von Foucault und De la Grammatologie von Derrida (beide 1967). Dazu ist auch der in den sechziger Jahren sehr diskutierte Cours de linguistique génerale von Ferdinand de Saussure zu zählen.
Es war klar, daß La Beltà aus einer sehr entfernten und doch zentralen Schicht des Seins zum Leser sprach, aus einem Bereich, den man als ursprünglich annimmt und in dem die Aphasie oder das Schweigen abwechseln mit babylonischem Stimmengewirr, und die großen Stimmen der Geschichte sich im heimlichen Murmeln der kleinsten Dinge noch verlieren und diese ihrerseits das Privileg des Sprechens erlangen. Die Äußerungen des Logos hingegen verbinden sich mit den Stimmen des Schlafs (und des Traums), und das Wort des Schlafenden und das kindliche Gestammel durchbrechen den Diskurs mit einer unterirdischen Kraft, die ihnen aus dem Einklang mit dem Sein erwächst.
Was war geschehen?…
Stefano Agosti, Aus dem Kommentar, 1987
L. Paulmichl und P. Waterhouse über ihre Übersetzungen von Andrea Zanzotto
Und der Wind vertreibt geschwind den Tod
Jeder spricht von ihm, keiner kennt ihn – jedenfalls in Deutschland. Andrea Zanzotto, ironischer Hermetiker, ist trotz vielbeachteter Gedichtbände in Italien (Taschenbuchausgabe im 25. Tausend) hierzulande erst noch zu entdecken. Einen wichtigen Beitrag leistet der Droschl-Verlag mit einer zweisprachigen, vom Dichter selbst besorgten Werkauswahl, die Gedichte aus Il Galateo in Bosco (1978), Fosfeni (1983) und Idioma (1986) umfaßt. – Zanzottos Hermetismus unterscheidet sich von traditionelleren Spielarten, seine Gedichte sind länger, erzählender, die babylonischen Wortkaskaden lassen an einen entfesselten Mallarmé, einen in Wortwitz sich überschlagenden Celan denken. „Die“ Sprache Zanzottos zeigt vielerlei Komponenten, wie den Dialekt des Veneto, der den sublimen Vers verfremdet, Wendungen der Alltags- und Werbesprache, mit denen Zanzotto den „Akrylismus“ unserer Zeit attackiert, unvermittelte Zitate aus der Weltliteratur und der Philosophie, der Geschichte, der Mythologie, der Wissenschaftssprache, schließlich graphische Zeichen und Symbole. In Il Galateo in Bosco umkreist Zanzotto die Landschaft um Pieve di Soligo, wo er äußerst zurückgezogen lebt, entwirft eine poetische Topographie, die immer aus Sprache geborene Gegenwirklichkeit bleibt. – Das Übersetzertrio trifft, trotz gelegentlicher Sprödigkeit, meist den aus Witz und Ernst gemischten Zanzotto-Ton (wahre Kunst-Stückchen gelingen mit den Dialektgedichten!):
Und der Wind vertreibt geschwind den Tod den tauben Vogel
oder rät ihm: hol dir die Pension beim Postamt
wenn dort jemals offen ist…
Michael Speier, Park, Heft 31/32, Januar 1988
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Anonym: Italien in Winter
Falter, Wien, 18.12.1987
Armin, Gatterer: Wenn die alten Ordnungen und Sätze aus den Fugen geraten: Zanzotto-Lyrik
Tiroler Tageszeitung, 27.10.1987
B. Goldstein (= Anita Pichlerl): Lichtbrechung
Sturzflüge, Nr. 21/1987
Lioba Happel: Andrea Zanzotto: Lichtbrechung
NDR, 2.11.1987
Hans Hinterhäuser: Das große Fragezeichen Sprache
Die Presse, 29.10.1987
Jochen Keller: Die Italianitá und die Moderne
Eslinger Zeitung, 9.10.1988
Werner Krause: Ein Gedicht
Kleine Zeitung, Klagenfurt, 10.8.1987
Hannes Obermaier: Kosmos und Chaos
Distel, Nr. 32, 1/1988
Hannes Obermaier: Lichtbrechung
Inn. Nr. 13/1987
Luigi Reitani: Andrea Zanzotto: Lichtbrechung
Italienische Studien, Heft 11, 1988
Rosalma Salina Borrello: Daß das Dunkel wachse
Süddeutsche Zeitung, 3./4.12.1988
Anton Thuswaldner: Von einer „anderen“ Literatur, die sich quer stellt
Salzburger Nachrichten, 27.2.1988
Christine Weiss: Eine Landschaft wird Sprache
Die Zeit, Hamburg, 18.3.1988
Die erfundene Sprache
− Versuch über Andrea Zanzotto. −
Ecco il primo elogio che voglio fare a Zanzotto,
egli e’un poeta libero.
Giuseppe Ungaretti, 1954
Ein Dichter, der in einer alten, lebendigen Sprache denkt und schreibt, genießt die Freiheit des Reichtums; das lange Gedächtnis der Jahrhunderte hat für ihn Namen, Formen, Bilder aufbewahrt, er braucht sie nur zu finden; so scheint es. Und doch; anders als in den anderen europäischen Sprachen, wird für einen italienischen Dichter gerade die historische Erinnerung der Wörter zu Verdammnis, zum Fluch.
Die Macht der unvergessenen, immer noch so verstandenen Bedeutungen, die seit der Antike ungebrochene Dauer der unveränderten und kaum veränderbaren Formen kennen nicht die Laut- und Silbenverschiebungen, die neuen Sinn geben, öffnen sich nicht neuen Sätzen der Grammatik, nur jenen des Stils. Sie können sich auch nicht in jene Wort-Verdoppelungen übersetzen, die den modernen, nicht aus der Prägung des Lateinischen entstandenen Sprachen ihre technische Mühe abnimmt. Die Sprache, die Wörter Dantes und Petrarcas sind immer noch jene des heutigen, italienischen Alltags.
Das alte lateinische und italienische Wort memoria bezeichnet das Erbe der Bilder und der Ideen, bedeutet aber auch Gedächtnis, wie die nahe oder die ferne Erinnerung.
Kaum ein anderer Dichter in Italien hat sich – wie Andrea Zanzotto den Reichtum und die Freiheit der historischen memoria angeeignet, ihrem Gedächtnis misstraut, ihre Erinnerungen entweiht, sich als Erbe ihrer Sprache verstanden; ein verzweifelter, ein alleingelassener Erbe, den die Kritiker mit Vorliebe ihren abgesicherten literarischen Kategorien wie Avanguardia oder Ermetismo zuordnen. „Un poeta difficile“ – sagt Giovanni Giudici, die andere brüderlich-antagonistische Stimme der italienischen Lyrik von ihm: „Ein schwieriger Dichter, über den man leicht schreiben kann.“ Leicht? Vielleicht am Anfang, wenn man die Suggestion der Laute, die onomatopoetische Macht der Wörter nur als eine virtuose Erscheinung der Neo-Avantgarde von ’63 versteht.
Zanzottos Dichtung hat wenig mit der alten obscuritas zu tun, mit der gesuchten Dunkelheit, die sich hinter dem Schleier despoeta doctus verbirgt und nur ein gelehrtes oder orakelhaftes Lesen der Enigmen zulässt.
„Seine ist eine gebildete Dichtung, ein Eintauchen in dem Vor-Ausdruck vor dem artikulierten Wort“, erkannte Eugenio Montale. „Er ist ein schlagender, aber kein lauter Dichter, sein Metronom ist vielleicht das Herzklopfen…“
Dieses Herzklopfen ist seine lyrische Invention, ein Zurückfinden, eine aggressive Trauer um das verlorene Gedächtnis, eine tiefere Suche nach der verfälschten Erinnerung, die ihren fremden Schatten auf die Zerstörung der Gegenwart wirft. Sie rettet sich in jene poetischen Experimente der Wort-Zersetzung, der entstellten Silbenordnung, in denen Teile der alten Bedeutungen aus dem Feuer der mit leidenden Vernichtung, ohne ganz Asche geworden zu sein, neu entstehen. Die Sprache Petrarcas, seine sinnliche Melancholie, aber auch seine erotische Lust nach der Übersetzbarkeit der Natur in Worte, werden von der Säure der modernen Mittel korrodiert; was sie zurücklassen, die Schönheit, vom Grauen verzerrt, die Harmonie, von der Gewalt zerbrochen.
„Ihr werdet ein Land sehen“, sagt Ungaretti von seiner Dichtung, „ein altes, verbrauchtes, ein gewalttätiges Land, das zerfällt und sich regeneriert, ein luftiges Land, ein Zauberland, ein Land der Idylle, von der Tragödie zerwühlt“.
Die Vergil-Verse, die den Text der IX Eklogen (der Gedichtsammlung aus den Jahren 1957-1960), wie ein controcanto begleiten, das süße Liebessingen in den Wäldern Arkadiens, sind Klage geworden.
mit selva un lamento
mite bisbigliate un accorato
ostinato non utile dire
Dieses „nicht nützliche Sprechen“ sendet seine elegischen Töne bis hin zu den Holzwegen, den versperrten Bezirken, den felsigen Hindernisse, die nur höhnische Silben zurückwerfen. Es ist ein deutsches Wort – Holzwege – die sie immer wieder bezeichnen.
Ich schiebe alles auf Ich empfehle viel
Holzwege, Straßen
erschöpfte Erfahrungsschatten im Treibhausklima
des Walds.
Zanzotto möchte, dass auch seine Gedichte als Holzwege, heideggerisch, verstanden werden; man soll sie nicht anders lesen als eine Topographie von abgebrochenen Versuchen, die auch graphisch in abgebrochenen Zeilen auf der weißen Seite erscheinen. Sie zeichnen eine Wanderkarte der tastenden Sinne, auf der ein System von Hinweisen, Richtungen, von erfahrenen Vermessungen zu vielleicht erreichbaren Sinn-Lichtungen führen. Nicht nur Pasolini glaubte sich jenseits jedes semantischen Feldes wiederzufinden. In seiner Sammlung Galateo in bosco (1979), spiegelt sich im ersten Teil der Trilogie die Wirklichkeit des Waldes im venezianischen Hügel des Montello mit seinen Beinhäusern die ohnmächtige Erinnerung an das Inferno des ersten Weltkrieges in der alten Metapher der selva, des Waldes, als Dickicht des menschlichen Lebens. Wie in Dantes Weg durch Hölle und Fegefeuer, fernes genetisches Muster der Trilogie, wird der Wald zum Ort der Initiation des Einzelnen und der kollektiven Erziehung. Zanzottos Sprache bricht mit der Konvention der Hirtendichtung, entdeckt die vielen Holzwege, die den realen und metaphorischen Wald durchkreuzen und zerstören. Sie klagt die falschen Richtungen an, die zum trügerischen Weiterkommen einladen, zeigt die abgeholzten Pfade der toten Sätze mit graphischen Zeichen wie Markierungen auf gefällten Baumstämmen: Holzwege, bedeckt mit Splittern von comics und spots, die auf die Ohnmacht der Schrift hindeuten, historische und soziale Holzwege mit ihren Wunden von Bränden und Vereisungen, die in Verirrung enden. Ökologische Holzwege, die zur explosiven Vernichtung führen. Ihnen gegenüber ragt, kaum erreichbar, die Herausforderung des Poetisch-Erhabenen, ein Anspruch, dem man sich nicht durch Übergänge, sondern nur durch Entgleitungen, „schmerzliche Sprünge“ nähern kann.
Diese Sprünge ohne Seil, diese zerhackten, ungefügten Versuche, die das historische Bewusstsein zerstören, entdecken die biologische Wurzel, die biopsychische Struktur der Sprache, die einzige, die der Verwesung wie der Wildnis der Wort-Überwucherungen widerstehen kann. So findet Zanzotto die Worte des Dialekts wieder, den alten betörenden Singsang: der venezianischen Wiegenlieder, der einlullenden Kinderreime, der leisen Melodie der Traumbilder: Pin / penin / Valentin / pena bianca / mi quaranta / mi un mi dói mi trei mi quatro / mi singue mi sei mi sete, mi oto… Es sind die Verse, die er für Fellinis Film Casanova dichtete, Heimweh nach der verlorenen Kindheit.
Er gibt dieser – seiner – Sprache einen Namen: petèl (L’Elegia in petèl aus der Gedichtsammlung La beltà, 1961-1967) und möchte, dass man ihm glaubt, dass sie so existiert, diese Sprache, wie er sie schreibt. In einer der ganz wenigen autobiographischen Notizen der letzten Jahre entdeckt er, der Leser Lacans, der nicht leicht Ich sagt und in der dritten Person spricht, aber selbst den fernen Ursprung dieser erinnerten, zusammengefügten, erfundenen Sprache:
„Er empfand etwas ganz unendlich Süßes, als er Kinderreime, nicht gesungene, nur gesprochene oder einfach vorgelesene kleine Strophen und Lieder hörte, gerade wegen ihrer harmonischen Verbindung mit der Funktion der Sprache, mit ihrem inneren Gesang…“
In diesem Gesang liegt Zanzottos Heimat, die Wurzel seiner nicht nur lyrischen Biographie; in den von verschneiten Feldern verschluckten Glockentönen seines Pieve di Soligo, das er so ungern verlässt, schwingen die von der Großmutter wiederholten Reime. „Sie erklärt ihm, dass die Sprachlaute nicht Gesang im gewöhnlichen Sinne sind, dass sie eben Poesie sind“. In dieser Poesie ist la matria – nicht la patria – das Mutterland verborgen, in dem das Gedächtnis der klassischen Dichtung – die Großmutter trug ihm Tassos Strophen vor – sich mit alten Volks-Weisheiten vermischt. Diese Harmonie des illustren toskanischen, so erinnert er sich, „sickerte durch ihn, wie ein wahrer, ein wirklicher Traum, eine wirkliche phonische Droge zusammen mit Fragmenten anderer Sprachen, wirkliche Xenoglossien, durch das ein wenig ,wilde‘ Continuum der parlata des Dialekts.“ (1990)
Diese wirklich phonische Droge betäubt das Bewusstsein, öffnet die Gitter der Verdrängung, befreit jenes sinnlich-lyrische Sprechen, in dem vergessene Kindheitsworte, Bildsplitter, Relikte der literarischen Erinnerung wie magische Formeln das neue Sinngewebe der Verse bilden.
Die Sprache des petèl, die noch in Idioma (1986), dem dritten Teil der Trilogie, venezianisch nachklingt, braucht onomatopoetische Beschwörungen, die sich dem biologischen Rhythmus der Silben unterordnen. Sie entstehen aus der Bewegung der Lippen, des Mundes, werden eben eine Mund-Art, ein Dialekt in seiner reinen Form, der in der Mühe des Sprechens wie in der Wiederkehr der kindlichen Aussprache seine phonische Gestalt annimmt. Lautfolgen von sinnlicher „Zauberkraft“ (noch ein deutsches Wort, das Zanzotto unübersetzt lässt) schaffen eine Alterität des Sprechens jenseits der Sprache selbst. Diese gespaltene Wort-Realität, die mit antiker toskanisch-venezianischer und mit entfremdeter Zunge redet, verwandelt sich in einen Dialekt der Intimität, der jeder etymologischen Mühe verschlossen bleibt. Dichter sind keine Linguisten; ihr Dialekt ist nur in einem metaphysischen Atlas verzeichnet, dessen Grenzen in die Tiefen des Unbewussten führen. Diesen Grenzen entlang begegnet Zanzotto der anderen Sprache der Alterität, die, wie jene des Kindes, eigenen Gesetzen unterworfen ist: die fragende, die verwirrte Sprache des Wahnsinns: „Siamo un segno senza significato“, übersetzt er, „ein Zeichen sind wir, deutungslos“; im Gedächtnis der Naturverloren, erscheinen ihm die Worte aus Hölderlins unvollendetem Gedicht Mnemosyne. Das lyrische Stammeln des kranken Dichters wird ihm zur Chiffre der vom Chaos bedrohten Existenz, zur Metapher der poetischen Sprache, der brutalen Sinntötung, entgegengestellt.
„Scardanelli faccia la pagina… Scardanelli sia compilato con i passi della Histoire d’O“… (Elegia in petèl) Scardanelli… Kein nachgeborener Dichter, der Wörter und Silben nach ihrer semantischen Erinnerung befragt, vermag besser als Zanzotto in seiner mit-leidenden Identifikation, den in der Zeit des Wahnsinns erfundenen italienischen Namen Hölderlins in seiner etymologischen und symbolischen Bedeutung zu verstehen. Sein Ohr vermag in den Silben Scarda-nelli die alte lateinische Wurzel ex und cardo-cardinis, Angel, Angelpunkt zu vernehmen; in dem italienischen Gebrauch des Zeitworts scardinare, aus den Angeln heben, die Funktion, in der Endung -nelli den bezeichneten Gegenstand und den Personennamen erkennen, mit denen das Wort sich verbindet.
In der gestörten Ordnung der Welt erscheinen ihm die Angelpunkte nicht mehr durch eine Achse bestimmbar, der sternenlose Himmel nicht erkundbar, Sinn und Zeichen der Dinge aufgelöst und nicht erlernbar. In diesem aufgehobenen Raum sucht Zanzotto nach den leeren Stellen; er wagt das Experiment, an deren Ort neue Angelpunkte zu setzen, Fragmente, Stützen des lyrischen Gedächtnisses: in der Sprache Scardanellis.
„Ihr sicher gebaute Alpen“ steht mitten im Gedicht und „Einst habe ich die Muse gefragt“ am Ende; zwei Verse aus zwei unvollendeten Gedichten Hölderlins. Sie wollen als verfremdete, aber erkennbare Orientierungszeichen für die aus den Angeln gehobene Realität verstanden werden: die Gipfel der Alpen, ihre Eiseskälte als unwirtliche, unerreichbare Höhe für den menschlichen Anspruch des Sagbaren, und die Figur der Muse, als klassisches, leeres Bild in der der Beziehungslosigkeit verloren gegangenen Inspiration.
Zanzottos Denken huldigt nicht anthropologischen Utopien. Seine biographische Zeit und das Grauen der erfahrenen Geschichte, die Trauer über die zerstörte Vernunft teilt er mit dem Dichter seiner Generation, der ihm am nächsten steht und dessen Sprache auch den Titel der deutschen Übersetzung Lichtbrechung beeinflusst zu haben scheint: Paul Celan.
Eine von der Tragödie des Krieges traumatisierte Wortsuche, die aus Last und Schrecken der Erinnerung leise anhebende Stimme, die gespannte Kühnheit der Metaphern, verbinden Zanzottos Lyrik mit jener Celans. Beide schützen ihre Bilder vor dem Dämon der Klarheit.
In den letzten Jahrzehnten ist viel von der Unmöglichkeit die Rede gewesen, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben. Beide, Paul Celan in seiner Pariser Heimatlosigkeit und Andrea Zanzotto in der Häuslichkeit seiner venezianischen Hügel, beweisen das Gegenteil. Ihre Gedichte zeigen, dass die einzige Sprache nach Auschwitz, die den Menschen wiedergegeben wird, jene der Poesie sein kann. Dass nicht die ästhetische Verfälschung, sondern die Biologie des vorbewussten Fühlens die Laute der Kindheit wiederbringen kann und dass das nur mit neuen, erfundenen und mit alten, aufgebrochenen Worten möglich ist, über die Negation des Humanen zu klagen. In einer Sprache, die auch petèl heißen kann, einer Sprache vor der Schrift, vor der Grammatik.
„Celan hat“, so schreibt Zanzotto, „in einer der unbekannten analytischen Interpretationen, die er fremder Poesie widmet, als erster verwirklicht, was unmöglich schien: nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sie ,in der Asche‘ zu schreiben, um zu einer anderen Dichtung zu kommen; gegen die totale Vernichtung anzutreten und trotzdem in ihrem Inneren, in der Vernichtung selbst zu bleiben.“
Wenn ein Dichter einen anderen Dichter versteht, gilt die Erkenntnis vor allem ihm selbst. Zanzotto, der über Celan schreibt, interpretiert sich selbst, die eigene „zerbrechliche Dichte, wie ein Phänomen der Physik“, die jede Hermeneutik herausfordert und gleichsam in Frage stellt. Und doch trennt sie ein Riss, ein Niemands-Weg. Das eintretende Dunkel lässt Celans lyrische Wortfugen weder in ein „bewusstes Jenseits der Sprache enden, noch sie zu einer Rückkehr in die Heimat führen“. Zanzottos Lyrik dagegen kehrt, nach den Sprüngen über Grenzen und Abgründe des Sagbaren, zurück in die archaische Sicherheit der Tradition, in das Mutterland der wieder hörbaren Kinderlaute, die sie vor dem Verstummen schützen.
„Von Bach und Hölderlin gesegnet“ hatte Nelly Sachs von Paul Celan gesagt. Welcher Segen begleitet Andrea Zanzotto? Vielleicht jener Vivaldis, des venezianischen Maestro der Waisenkinder und jener Petrarcas, der sich in den dichten Wald der Vaucluse zurückzog, um der geschäftigen Stadt zu entgehen und manchmal – auf Holzwegen Worte über die Liebe zu finden. Der italienische Dichter, der sein Pieve di Soligo, in der doch eine strada d’Aliemagne zu den Grenzen führt, nie verlassen will, hat mit seinem Dialekt, mit seiner Sprache, die sich Entfremdung, Sinnlosigkeit, Zerstörung widersetzen, der europäischen Lyrik nicht nur eine antike geographische Provinz, sondern eine poetische Heimat gegeben.
Lea Ritter-Santini, Schreibheft, Heft 44, November 1994
Andrea Zanzotto
Fragt man heute einen Lyrikliebhaber in Italien, wer denn die Erbschaft von Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba angetreten habe und als erster unter den „Späteren“ zu nennen sei, so kann man sicher sein, den Namen Andrea Zanzotto zu hören. Der 1921 Geborene ist erst spät zu dieser breiten Anerkennung gekommen, er mußte viel länger warten als die Großen der ersten Jahrhunderthälfte. Das kann wohl nicht an mangelnder Konsequenz in seinem Schaffen liegen, welches sich – von Dietro il paesaggio (1951) bis zu Idioma (1986) – beharrlich und durchaus organisch entfaltet hat. Seit dem Zyklus La beltà (1968) und vor allem mit Il Galateo in bosco aber hat er alle seine zahlreichen, z.T. ihrerseits bemerkenswerten Rivalen hinter sich gelassen. Allerdings muß dem sofort hinzugefügt werden, daß Zanzotto auch beim heutigen Lesepublikum für Lyrik noch immer eher als Name denn als Autor gelesener Texte präsent ist; zwischen Fama und wirklichem Bekanntsein besteht vielmehr ein starkes Mißverhältnis.
Sicherlich war es für Zanzottos Durchbruch ein günstiger Umstand, daß ein Rezensent vom Rang Montales auf das Erscheinen von La beltà mit einem überaus positiven Artikel (Corriere della Sera, 1.6.1968) reagierte: „Zanzotto beschreibt nicht, er umschreibt, er umhüllt, er ergreift, dann läßt er wieder los. Man kann eigentlich nicht sagen, daß er sich selbst sucht, und er versucht auch nicht, seiner Wirklichkeit zu entfliehen; die Sache ist vielmehr die, daß seine Mobilität zugleich physisch und meta-physisch ist, so daß die Eingliederung des Dichters in die Welt durchaus problematisch bleibt… Seine Dichtung ist eine höchst gelehrte und zugleich ein wahrer Kopfsprung in jenen Vor-Ausdrucksbereich, der dem artikulierten Wort vorausgeht und sich mit Litaneien von Synonymen zufriedengibt, die sich nur dank lautlicher Affinitäten zusammenschließen, die nicht mehr sind als ein Stammeln und Lallen, in Ausrufen und vor allem in Wiederholungsmustern. Er ist ein perkussiver, jedoch kein rumoröser Dichter: sein Metronom ist der Schlag des Herzens… Eine Poesie der Bestandsaufnahme von mächtiger Suggestionskraft, die wie eine Droge auf das Urteilsvermögen des Lesers wirkt.“
Aufschlußreich für die Beachtung, die ein Dichter in seiner Zeit findet, ist immer ein Blick in die Anthologien, wobei gewiß die Tendenzen und Strömungen berücksichtigt werden müssen, an denen sich Anthologien meistens orientieren. In der von Edoardo Sanguinetti (Einaudi, Turin 1969) ist Zanzotto (absichtlich oder unabsichtlich?) noch gänzlich abwesend. Bei Pier Vincenzo Mengaldo (Mondadori, Mailand 1978) wird er mit einem sehr kenntnisreichen Vorspann und mit vierzehn Texten (von Dietro il paesaggio bis Pasque und Filò angemessen vorgestellt. Bei Fabio Doplicher fehlt er in der italienischen Sektion der internationalen Anthologie Poesia della metamorfosi (Quaderni di STILB, Rom 1984), während er in der darauffolgenden Sammlung Il pensiero, il corpo von Doplicher und Umberto Piersanti (1986) mit sieben Stücken aus dem Galateo vertreten ist.
Im deutschen Sprachraum taucht sein Name sehr früh, im Italienheft 1965 der Zeitschrift Akzente auf, mit Übersetzungen von Texten aus den Neun Eklogen. 1980 war ein Gedicht von ihm in der auf sorgfältige Interlinearversionen abgestellten Anthologie Italienische Lyrik der Gegenwart von de Faveri/Wagenknecht zu lesen, 1983 eines in Poesie der Welt: Italienische Lyrik aus acht Jahrhunderten, gesammelt von Hartmut Köhler, 1986 eines in Italienische Lyrik nach 1945 von Bucciòl und Dörr. Und dann folgte, nach Vorabdrucken in den Grazer manuskripten und in Rowohlts Literaturmagazin und dennoch gewissermaßen abrupt, 1987 der vom Droschl-Verlag in Graz veröffentlichte Band Lichtbrechung – 231 Seiten ausgewählter Gedichte aus Zanzottos neuesten drei Zyklen, in hingebender zweijähriger Arbeit übersetzt von Donatella Capaldi, Ludwig Paulmichl und Peter Waterhouse (die beiden letzteren selbst junge Dichter) und begleitet durch einen „Kommentar“ des z.Zt. subtilsten Zanzotto-Spezialisten Stefano Agosti.
Körperlich präsent war der Dichter im deutschen Sprachraum erstmals 1987, bei der Vorstellung eben dieses Buchs im Italienischen Kulturinstitut in Wien. Im darauffolgenden Jahr war er zu Gast beim „Literarischen Colloquium“ in Berlin; sein dort gehaltener Vortrag Versuche und Erfahrungen mit Dichtung erschien im Dezember 1988 in der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. In der Septembernummer 1988 der Zeitschrift Akzente, die der modernen italienischen Lyrik gewidmet war, fand sich ein Gespräch mit Andrea Zanzotto, geführt und aufgezeichnet von D. Capaldi und L. Paulmichl. Nach all dem läßt sich mit einiger Sicherheit sagen, daß Zanzotto im Begriff ist, bei unseren Lyrik-Lesern an Boden zu gewinnen: der Augenblick scheint geeignet, hier über sein Werk im Zusammenhang zu berichten. Das soll in der bei seinen Vorgängern geübten Weise geschehen: in der Art einer monographischen, durch viele Zitierungen auf deutsch illustrierten Studie.
Doch muß von vornherein gesagt werden, daß die Aufgabe des Übersetzenden und Interpretierenden nun ungleich schwieriger und da und dort sogar unlösbar geworden ist. (Die Stelle aus Montales Rezension konnte und sollte eine „Vorwarnung“ sein.) Die Krise der Poesie, deren italienische Symptome wir seit der Wende zur Modernität beobachtet haben, hat sich auf dem Weg zu Zanzotto immer weiter und immer drastischer verschärft, sie ist bei ihm zur eklatanten Krise der Sprache, des dichterischen Vertrauens in die Sprache, zum sprachlichen Experimentieren mit unbestimmtem Ausgang geworden. Von Zanzottos Texten her scheinen die alten Klagen über die Schwierigkeiten der hermetischen Poesie merkwürdig unberechtigt und die berüchtigte Poetik des „Ermetismo“ kaum mehr als eine zurückhaltende Aufforderung, doch bitte ein wenig mehr Geduld und Sorgfalt in den Umgang mit Gedichten zu investieren als bisher. Wir stehen bei diesem neuen Dichter also vor der Tatsache, daß wir seine Texte leider nicht so sehr nach ihrer jeweiligen Qualität auswählen können, als wir sie (nicht immer, aber auch) nach ihrer Übersetzbarkeit auswählen müssen. Die ersten acht der Beispielgedichte habe ich selbst zu übersetzen versucht; hier erlaubte es noch die Art der Texte, relativ genaue deutsche Entsprechungen anzustreben. Bei den Übersetzungen aus dem Galateo, die von Capaldi/Paulmichl/Waterhouse stammen, konnte es nicht mehr um Entsprechungen, sondern nur noch um ungefähre Äquivalente gehen: sie sind „frei“ im Sinne selbständiger (und mir scheint, meist geglückter) Nachschöpfungen. Trotz dieser Prämissen vertraue ich darauf, dem Leser ein einigermaßen getreues und, meinem Wunsch entsprechend, vor allem suggestives Bild dieses Protagonisten der italienischen Lyrik der zweiten Jahrhunderthälfte geben zu können.
Jede ihres Gegenstands würdige Untersuchung über Zanzotto hat von einem geographischen Fixpunkt auszugehen, von seinen Ursprüngen im venetischen, voralpinen Ort Pieve di Soligo. Hier wurde er geboren, hier hat er (von ein paar Eskapaden in die Schweiz und nach Frankreich abgesehen) seinen im genauen Wortsinn festen Wohnsitz, hier unterrichtete er bis zur vorweggenommenen Pensionierung an der Mittelschule. Zanzotto ist ein extrem heimatverbundener Dichter, dessen Inspiration sich von allem Anfang an aus diesem bestimmten „Landschafts-Schlupfwinkel“ gespeist und an ihm entzündet hat; aus dem Einverständnis auch mit seinen „Nachbarn“, deren Dialekt seine eigene Umgangssprache ist – und spricht er italienisch, dann im unüberhörbaren, anrührenden Tonfall des Veneto. Was ist nach solchen Prämissen zu erwarten? Ein Heimatdichter? Oder allenfalls ein weiterer Vertreter jener Dialektdichtung, die in Italien sowohl auf eine glorreiche Tradition wie auf vorzügliche Beispiele moderner Poesie zurückblicken kann?
Verschiedene Faktoren haben zusammengewirkt, eine derartige Entwicklung zu verhindern und Zanzotto, eher als in ein Verhältnis der arglosen Liebe, in eines der inneren Spannung zu seiner „Heimat“ zu setzen. Im jüngsten und meiner Meinung nach ertragreichsten seiner Interviews spricht er in bezug auf seine Kindheit von „seltsamen, beunruhigenden Elementen“, von „irritierenden Stacheln und Dornen im Innern seiner privaten Geschichte, aber auch in der allgemeinen (so oder so vom Faschismus geprägten) Umgebung“. Indessen war und ist er ein Provinzler und ein Seßhafter, der sich die Welt auf seinen Schreibtisch holte, zuerst die Poeten, später die Wissenschaftler (Psychoanalyse Freudscher und Lacanscher Observanz, Anthropologie, Soziologie). Und zu seinen Lieblings- und Lernpoeten gehörten frühzeitig solche, die nicht auf den Bücherborden des traditionellen Heimatdichters zu finden sind: die frankophonen Surrealisten Éluard und Michaux, García Lorca, Trakl, Hölderlin, welch letzterer aus seinem frühen Werk genausowenig wegzudenken ist wie der heimische Leopardi, von dessen Magma ja nahezu alle italienischen Dichter dieses Jahrhunderts gelebt haben.
Diesen Modellen und Lehrbüchern verdankt man es, daß Zanzotto seinen Landschafts-Schlupfwinkel nicht in zärtlichen Strichen „realistisch“ abschildert, sondern daß er ihn von vornherein ins Legendäre, ins Surreale, ins Mythische transponiert hat (nicht zufällig hat er sein Opus primum Dietro il paesaggio, „Hinter der Landschaft“, genannt). Jeder Besucher aus dem Norden, der in seine Gegend kommt, wird diese als eine heiterbesonnte, durchaus südliche empfinden: eben als das, was er jenseits der großen Alpenbarriere anzutreffen erwartet und gewünscht hatte. Pieve di Soligo liegt schon in der üppigen trevisanischen Ebene, aber vor einem langgestreckten, bewaldeten Hügelrücken, dem Montello, und in der Nähe des Piave, der hier mehrere Zuflüsse hat (darunter den Soligo) und sich in viele Nebenarme verzweigt; im Norden blauen die Dolomiten. Aus diesen faktischen Gegebenheiten hat der Dichter eine Art nördlicher Fabellandschaft gemacht, mit unendlich viel Feuchte, Wasser der Flüsse, Regen und Schnee, vor allem Schnee – ein Land der kurzen Sommer und langen Herbste und Winter, in das sich die stets namentlich genannten Hänge, Brücken, Dörfer und Wasserläufe eingliedern, in dem sie sich metamorphosieren und poetisch sublimieren.
Einen Begriff davon mag das folgende Gedicht aus dem ersten Zyklus geben:
Dort oft im Frühlicht
Dort oft im Frühlicht
erweckte mich aus der Hölle
das leichte Dröhnen und das Beben
der blauen Vulkane.
Zwischen den Bergen erhabene Spiegel des Ursprungs
verfing sich mit dem zierlichen Geweih
der Hirsch geboren aus Schnee;
an den Fenstern häuftest du dich
Frühlingslava,
lebendig kamst du zu mir herab in den Windungen
der entstellten Zeitalter.
O Bucht der Erde
mir für immer bekannt,
deren uralten Falten schattenlos
Sichbegebendes entspringt;
kalte Zuflucht, deren Schoß
die ungewöhnlichen Flüsse gürten,
deine verstreuten Elemente sind
mein einsamer Ruhm,
in den Strahlen deiner Sonne
reift nichts als Schnee.
Doch noch in deinen Abgründen
dich zu suchen ist mir lieb,
in jeder deiner Formen lieg’ ich begraben,
von meinem Blut jauchzt jede deiner Quellen.
Gütig wirst du der Bilder meines
Lebens gedenken.
Es ist eine „metaphysische“ Landschaft (im Sinne der italienischen Malerei der zwanziger Jahre), der wir hier begegnen, zu der auch der irreale Hirsch gehört: eine „Bucht der Erde“, in die ein Moment tellurischer Beunruhigung eingebaut ist (das Dröhnen und Beben der blauen Vulkane); von der im Ton einer leichten, beredsamen Exaltation gesprochen wird, der an Quasimodo erinnern kann. Bis die „verstreuten Elemente“ in eine glühende Liebeserklärung münden, und diese sich wiederum in einer Schlußklausel beruhigt, deren Hölderlinscher Ursprung unverkennbar scheint. (Erwartungsgemäß wird diese Nähe in der deutschen Übersetzung viel offenkundiger als in der italienischen Originalfassung). Sagen wir bei dieser Gelegenheit, daß Zanzottos kulturelle Orientierung sich außerhalb Italiens vor allem auf Frankreich richtet, daß er sich aber auch ständig mit deutscher und österreichischer Literatur beschäftigt hat; was er davon im Original oder in Übersetzungen las oder im Original mit Hilfe von Übersetzungen (etwa Hölderlin in der Fassung von Vincenzo Errante oder Trakl in der von Leone Traverso) – das freilich vermögen wir nicht anzugeben.
Wollten wir Zanzottos bisher vorliegendes Werk periodisieren, so wäre zu sagen, daß die Weise seiner frühen Gedichte sich auch im nächsten Zyklus (Elegie und andere Verse, 1954) fortsetzt: das Zwiegespräch zwischen Ich und Landschaft und die Einsamkeitsempfindungen; nur daß die Akzente nun allmählich negativer werden. Ein echtes Werk des Übergangs ist demgegenüber das nächste, Vokativ (1957): hier werden die Spannungen zwischen Subjekt und Welt akuter, und im Verhältnis zur Sprache werden Zeichen beginnender Konflikte erkennbar. Von Giuliana Nuvoli stammt die gute Beobachtung, daß Zanzotto am Anfang eines neuen Zyklus den vorhergehenden aufzugreifen und fortzusetzen pflegt, so als könne er von den dort gestalteten Stimmungen noch nicht loskommen, als sei noch nicht alles gesagt. Diese Erkenntnis läßt sich vertiefen durch die Feststellung, daß im neuen Werk gewöhnlich auch der eine oder andere Text des früheren wiederaufgegriffen und in einer neugeschöpften Variante präsentiert wird. Das kann zu reizvollen Einsichten in den Weg der Vervollkommnung führen, der sich dabei abzeichnet. So erinnert das zweite Gedicht in Vokativ durchaus an das vorhin zitierte und besprochene „Dort oft im Frühlicht“. Nun heißt es „Fluß im Frühlicht“ und lautet wie folgt:
Fluß im Frühlicht
unfruchtbares Wasser düstres und leichtes
raub mir nicht die Sicht
nicht die Dinge die ich fürchte
und für die ich lebe
Unbeständiges Wasser unvollendetes Wasser
das du nach Larven riechst und Übergängen
das du nach Minze riechst und schon weiß ich dich
nicht Leuchtkäferwasser unruhig zu meinen Füßen
Von gefingerten Laubengängen
von allzu geliebten Blumen löst du dich los
neigst dich und fliegst
hinaus über den Montello und das liebe herbe Antlitz
denn ich verzweifle am Frühling
Der Fortschritt ist, so meine ich, unbestreitbar. Nun gibt es kein diskursives Bekenntnis zur Heimat mehr, die Ambivalenz von anhänglicher Liebe und entfremdender Qual ist schlichter und reifer formuliert, das Gefühl von Einsamkeit und Impotenz („unfruchtbares Wasser“) ist in einen Gegensatz zum Frühling gestellt (wie es einmal in einem, „Renouveau“ betitelten, Text des jungen Mallarmé geschehen war), und mitten im Gedicht findet sich die herrliche Metapher „Leuchtkäferwasser“. Noch immer ein frühes Zanzotto-Gedicht, aber schon eines von denen, die, laut Montale, „wie eine Droge auf die Urteilskraft des Lesers wirken“.
Gleich daneben befindet sich im Buch die „Kleine Elegie“, die noch ganz „jugendlich“ wirkt. Nicht anders als ein wiedergeborener Leopardi klagt hier der Dichter schamlos-spätromantisch:
… Ach, jung und unglücklich bin ich,
und nichts vermag ich
und nichts kann ich geben.
Und gewahre in meinem Herzen
aufgezeichnet die Elegie
und schäme mich nicht meiner Tränen,
und nicht, das Echo anzurufen. Ohne Ziel
und ohne Anfang, in welchem
Widerspruch, in welchem
Tal, das kreischt und glitscht und zerbricht
in den Jahrtausenden, das erdröhnt
von Eichen im Todeskampf…
Vergessen wir das dick aufgesetzte Pathos der letzten Zeilen und blättern wir dreißig Seiten weiter, um bei der Replik, betitelt „Gespräch“, innezuhalten:
Gespräch
„Jetzt ist die schöne Jahreszeit zurück die Glocken läuten abends und ich hör’ sie mit innigem Glück. Die Vögel singen festlich am Himmel warum? Bald ist Frühling die Wiesen legen ihr grünes Gewand an und ich wie eine welke Blume schau’ auf all diese Wunder.“
Inschrift auf einer ländlichen Mauer
Im enttäuschten Herbst
durch die entfärbten Wälder
erschein’ ich, in der verschwenderischen
Ruhe, fern von der Arbeit
und vom erschwitzten Übel.
Zärtlich
empfinde ich die Dahlie und die Chrysantheme
überall fruchtend auf den Schultern
des Mooses, auf dem versunkenen Herzschlag
von schwachen und süßen Wassern.
Unwahrscheinliches Da-Sein von Stunde
zu Stunde verbindet mich und die Hecken
mit dem letzten Zittern
des lieben Mondes,
Vokale Blätter verströmt
das innerste Licht des Tals. Und du weisest mir
schweratmend in einem März ohne Ende die Glocken des Abends, das Wunder
der Knospen und der waldenen Vögel und des Mattseins,
in der steilen Mauer, in der rissigen Strophe;
in der Mauer geöffnet von Regengüssen und Würmern
den glückhaften März
tust du mir auf mit demütigen
weitfernen Illusionen, mir der ich im Herzen
des Oktobers, auf andre Art vernichtet,
um andres mich sorge.
Allein wirst du sein, matter Kalk und Zeichen,
allein wirst du sein, solang die Lähmung währt
oder bis neues Leben sich regt.
Ich wie eine welke Blume
schau auf all diese Wunder
Und März fast grün fast
heißer Sonntagmittag
März ohne Geheimnisse
ist stumpf geworden in der Mauer
Hier ist (bei gleichbleibender Stimmung) alles Naive und Sentimentale aus der „Kleinen Elegie“ an die höchst opportune „ländliche Mauerinschrift“ delegiert, aus der tatsächlich zwei (kursiv gesetzte) Zeilen zitiert werden; das Gedicht selbst ist energisch davon abgerückt und seine Aussage planvoll verrätselt worden. Noch ist immerhin die Situation klar: die eines Gesprächs, von dem wir, wenn wir wollen, annehmen dürfen, es werde mit der Inhaberin des „lieben herben Antlitzes“ vom „Fluß im Frühlicht“ geführt. Noch immer ist der Leopardi-Ton da, mit der erlittenen Einsamkeit und der vitalen Verzweiflung und der „diletta luna“, und diesen Reminiszenzen getreu, habe ich die „lontanissimi errori“ nicht mit „Irrtümer“, sondern mit der Leopardi-Vokabel „Illusionen“ wiedergegeben. Doch aus welcher Jahreszeit heraus spricht der Dichter? Ist es Frühling, ist es Herbst? Das wird mir nicht erkennbar und soll wohl auch offen bleiben.
Aber ein Zug ist bereits charakteristisch für den späteren, „schwierigen“ Zanzotto. Immer stoßen wir in seinen Texten auf idyllische oder elegische, jedenfalls unverschlüsselte, den Zusammenhang zwischen dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden wahrende Sequenzen, an und in denen sich der angestrengt nach dem Sinn forschende Geist für eine kurze Weile Ruhe gönnen und sich überdies an kühnen Adjektivierungen erfreuen kann: „Zärtlich / empfinde ich die Dahlie und die Chrysantheme / überall fruchtend auf den Schultern / des Mooses, auf dem versunkenen Herzschlag / von schwachen und süßen Wassern…“ Und: „Du weisest mir / schweratmend in einem März ohne Ende die Glocken / des Abends, das Wunder / der Knospen und der waldenen Vögel und des Mattseins…“ Indem wir uns diese Verse, nun isoliert, ein zweites Mal vorsprechen, spüren wir, daß sie nichts von ihrer Magie verloren haben.
Fast unmittelbar auf dieses folgen zwei bedeutsame Gedichte, die von zwei verschiedenen Punkten her den Dichter auf dem Weg in die Neurose zeigen (was nicht rein medizinisch aufgefaßt zu werden braucht). Das erste, „Idee“, handelt von der Sprache und vom Umgang des Dichters mit ihr:
Und alle Dinge um mich her
ergreif’ ich die dem Sein vorausgegangen.
Laues Grün verbirgt den Schimmer der Tage
weich benetzt es sie
wimmelt und funkelt von Insekten und Vögeln.
Alles ist voll und verworren,
alles, dunkel, triumphiert und wirft sich nieder.
Auch du meine Sprache, Funke
und Mißgeschick, trostloser Schlaf,
Irrtümer und Ohnmachten
tiefe unzugängliche Trägheiten,
so hast du dich geformt, korrupt und absolut.
Auch du mein höchst vergängliches Leuchten
aus Geisteszellen, unterbrochener Lichthof
von Schreien und Gedanken
unvorhergesehenen und ewigen.
Und leblos das Pochen der Früchte
und der Wälder und der Seide und der
enthüllten Haare Dianas,
ihres glücklichen süßen Geschlechts
und, herb und lebhaft, das Brennen,
das unter die Nägel geht, und die Ähren
bereit zu verwunden,
und das nie schweigende nie überzeugte Herz,
alles ist reich und verloren
tot und sich aufreckend
dennoch im Licht
in meiner nutzlosen Klarheit von Idee.
Es ist wohl nicht unbedingt nötig (und möglich), diesen Text „bis ins letzte Wort hinein“ zu verstehen. Auffallend ist sofort, daß er durchgängig von Kontrasten, und in Augenblicken besonderer Pointierung von der rhetorischen Formel des Oxymorons geprägt ist: „voll und verworren“, „reich und verloren“, „tot und sich aufreckend“, und als Resümee die „nutzlose Klarheit“ (la vana chiarità) all solcher Erkenntnisse. Den Höhepunkt dieser Antithetik bildet die Kennzeichnung der Sprache als „korrupt und absolut“: eine Urformel des Mißtrauens des modernen Dichters in sein Material und Werkzeug. Die Sprache strebt im Kopf und in der Hand des Poeten dem Absoluten entgegen, aber dieser Weg wird immer wieder unterbrochen durch Zweifel, durch „Irrtümer und Ohnmachten“, durch „tiefe unzugängliche Trägheiten“ auch, und scheint einmal der Triumph im Ringen erreicht, dann folgt alsbald der Niederbruch, die Überzeugung eines unbesieglichen Ungenügens, die Verzagtheit, ob eine so korrupte (im Gebrauch korrumpierte) Materie auf die hohe, von der Poesie erforderte Voltspannung gebracht werden kann. (Auch hier wieder eine bestrickende Binnensequenz: „Und leblos das Pochen der Früchte“, und so weiter.)
Der nächstfolgende Text verlegt den Konflikt zwischen Dichter und Sprache in die Persönlichkeitsstruktur und Psyche des sprechenden Subjekts. (Man hat mit einem gewissen Recht beobachtet, daß Zanzotto im Zyklus Vokativ sich von seiner allzu geliebten Landschaft entfernt und die lyrische Szenerie zunehmend ins Innere, ins Seelenleben transponiert: „Esistere psichicamente“ ist ein tiefsinniger Text überschrieben, der sich meinen Übertragungsversuchen leider widersetzte.) Dafür also:
Erste Person
– Ich – immerzu zitternd, – ich – verstreut
und zugegen: nie kommt
deine Stunde,
nie erklingt der Himmel deiner wahren Geburt.
Du aber entquillst langsamen
Wäldern, leuchtenden Abgründen,
Sonnen die sich auftun wie lebende Saugnäpfe,
du immer gedemütigt, beleckst,
unbezähmt machst rissig du
das ausgezehrte Wesen
oder es bricht hervor in Verbrennungen.
Auf der Scheibe,
der ewig dunklen,
flieht Ostern vorüber mit den wirren Haaren
Frühling verweilt und schwindet hin.
Du schwerer Atem bezwungen und unterbrochen
nun, nun und immer,
nimmersattes mattes Micherreichen.
Nun und immer? Doch wenn von einem Glück
der Schatten, wenn er von einer Idee
nur mich berührt, o Strudel, zu dem
meine unsichern Versuche eilen, der schwache
Drang des Herzens. Und dort auf der Scheibe
gehn unter Ostern und Mai und das zänkische Licht
und des Regens unendliches Grün.
Die Straße läßt der Motor
erzittern und den Schlamm, die Überreizung
wächst, ich wachse ich falle.
Von dir wird’ ich leben bis zerstreut
dein Göttliches übersteigt meine
schon erloschene Bedeutung
bis in andern Ängsten du wieder aufkeimst,
in andern Zernichtungen.
Hier explodiert die Krise des Ich, das Zanzotto nun ganz und gar suspekt geworden ist („Pronomen, das schon immer darauf wartet, Nomen zu werden“, nennt er es an anderer Stelle). Dieses Ich stellt sich nun doch am Beginn in einer eindeutig neurotischen Situation dar: als eine Person, die in voller Auflösung begriffen ist und sich schließlich in zwei Hälften aufspaltet, die ohne viel Hoffnung, aber obstinat aufeinander zustreben („nimmersattes mattes Micherreichen“). Der Paroxysmus wird schließlich durch die (feindliche) Technik herbeigeführt, die Straße vibriert unter den Erschütterungen eines in Gang gesetzten Motors, das Ich schreit auf. Am Ende scheint es sich, wenn ich’s recht verstehe, an die numinose Lebenskraft selbst zu wenden (an die „trunkene Flut“, wie Benn es nannte), von der es sich eine erneute Galvanisierung seiner vitalen Triebe erhofft.
Der nächste Zyklus ist Neun Eklogen überschrieben und wurde nach mehrjähriger Arbeit 1962 veröffentlicht. Wiederholt, zuletzt im zitierten Interview mit Gabriella Imperatori, hat Zanzotto „gestanden“, in der Tiefe seines Wesens lebe die Idylle. Zu der Zeit, als er, sich der griechisch-lateinischen Bukolik erinnernd, seine Eklogendichtungen schrieb, hatte er sich allerdings von seinen Jugendgedichten weit entfernt, in denen wir – schon damals nicht ganz ungestörte – Idyllenstimmungen detektieren konnten. Nun aber ist der Zusammenhalt fast ganz zerrissen, erneut wird die Sprache selbst problematisiert, öfter laufen die „signifiants“ dem „signifié“ davon, die hergebrachten und gattungseigenen Schalmeienklänge münden in Dissonanzen, in Ironie, manchmal im Parodistischen. Von der klassischen Ekloge hat Zanzotto meist, aber nicht immer, die dialogische Form bewahrt, nur sind die Partner (a und b) nicht wie bei Vergil durch je eigene Namen, Neigungen und Ansprüche charakterisiert. Bemerkenswert ist die strenge Architektonik, die der Dichter diesem Zyklus geben wollte, wobei er sogar mit symbolischen Zahlen (1 und 9) operiert hat. Inhaltlich geht es u.a. um den Sinn von Dichtung, und in einer besonders schönen Ekloge („Scolastica“) um den Sinn der Schule, der Pädagogik, der überlieferten Kultur, wie sie heute gepflegt und weitergegeben wird. Diesen Text hätte ich unter allen am liebsten zitiert, aber er ist für die Proportionen dieses Essays zu lang, und unvollständig wiedergeben kann man ihn nicht. So will ich den Leser mit dem ersten Teil der zweiten Ekloge entschädigen und überraschen:
Das schweigsame Leben
Einmal mehr sitzen wir beisammen
zwischen Hügeln, im vertrauten Wald.
Zartes Laub streichen wir aus den Schläfen,
Sonnen und Disteln und lebendige Wiese entfern’ ich
von dir, Freundin. O Gräser, die ihr
zum immerwährenden Dunkel emporwachst, zum
qui omnia vincit.
Und die Winde tilgen und erneuern
bei jedem Umlauf von Stunden und Wassern
unsre Seelen.
Doch wir sitzen da, immer bedacht
auf stumme und treue Abwehr.
Zärtlich wird meine Stimme sein und leise,
doch nicht feige,
strahlend in der Kehle
− an die nie der Schatten rühren sollte −
strahlend wird deine Stimme sein,
von Hochzeit, von Festtag.
Wir werden nicht mächtig sein, nicht gelobt,
werden Haar und Stirnen aneinanderlegen,
zu erleben
Blätter, Wolken, Schnee.
Ein andrer wird sehn und kennen: die Kraft
von andern Himmeln, von üppigen
kräftigenden
Atmosphären, trunkenen Paradoxen,
ein andrer mag Geschichte und Geschicke
bewegen. Für uns
behüten die Mütter arme
Feuer in der Küche, holen
freundliches Holz aus Höfen, die schon das Nichts
umschließt. Ein wenig Milch
wird uns nähren, bis uns
törichte, nutzlose Liebende
das Alter hinwegnehmen wird, das im
nächsten Friedhof
die spärlich blühenden Beete bereitet
und des Herzens unsichre
Schläge, die Pein
und den unaufhaltsamen Stillstand.
Ich sagte, ich wolle den Leser mit diesem Text „überraschen“. Widerspricht er nicht allem vorhin über die Auflösung der Idylle beim reifen Zanzotto Gesagten? In der Tat scheint es, als habe sich der Dichter in diesen gänzlich transparenten und anrührenden Versen eine Atempause gönnen wollen. Oder hat er gesehen, daß nur solche Schlichtheit der Philemon und Baucis-Stimmung angemessen sein kann, die er uns mitteilen wollte? Doch im zweiten Teil der Ekloge, in der sich der Sprechende ganz klein macht und alle Stärke an die Gefährtin delegiert, scheint er wieder entschlossen, „andere Saiten aufzuziehen“: da entstehen Assoziationsfelder, denen man nicht ohne Mühe folgen kann.
Und damit sind wir bei dem ob seiner „Schwierigkeit“ berühmten (oder berüchtigten) Zyklus La beltà angekommen. (Der Titel wäre auf deutsch etwa mit „Überprüfung der Schönheit“ wiederzugeben: mit der Sprache ist auch der überlieferte Schönheitsbegriff in eine Krise eingetreten und soll hier der äußersten Belastung ausgesetzt werden.) Beginnen wir gleich mit einem Text, und zwar ausnahmsweise mit dem italienischen Original, denn nur am Original kann das lautspielerische Verfahren Zanzottos halbwegs erläutert werden.
Oltranza oltraggio
Salti saltabecchi friggendo puro-pura
nel vuoto spinto outré
ti fai più in là
intangibile – tutto sommato −
tutto sommato
tutto
sei più in là
ti vedo nel fondo della mia serachiusascura
ti identifico tra i non i sic i sigh
ti disidentifico
solo no solo sì solo
piena di punte immite frigida
ti fai più in là
e sprofondi e strafai in te sempre più in te
fotti il campo
decedi verso
nel tuo sprofondi
brilli feroce inconsutile nonnulla
l’esplodente l’eclatante e non si sente
nulla non si sente
no sei saltata più in là
ricca saltabeccante là
L’oltraggio
Wir wünschen uns, der Leser möchte an dieser Stelle das Buch nicht erschrocken aus der Hand gelegt haben, denn das wäre die falsche, die unangemessene Reaktion. Das Gedicht „Oltranza oltraggio“ ist nämlich ganz einfach humoristisch, es ist ein humoristisches Nonsens-Gedicht, wie es in seiner Sprache und mit seinen Mitteln der deliziöse Hans (Jean) Arp geschrieben haben könnte. Also kein angestrengtes Stirnrunzeln – schauen wir uns einfach an, was dasteht! Wir beobachten Wortspiele im Sinne der Annominatio (salta saltabecchi), wir sehen den Verfasser in der Ungewißheit des richtigen Genus (puro-pura); wir stoßen auf das erste mehrerer Wiederholungsmuster (tutto sommato, etc.); wir treffen auf scheiternde Identifikationsversuche; wir finden phantasievolle Lautassoziationen, wobei das letzte Glied, i sigh (sai), aus der Sphäre der englischen Comics stammt; wir ertappen Zanzotto bei der Einbindung einer recht vulgären französischen Redeweise: fotti il campo (foutre le camp, abhauen); wir stellen fest, daß er auch hier, wie sonst noch oft, eine Präposition (verso) ohne Folgenomen setzt, sie also in der Luft hängen läßt; den Schlußteil bildet eine Aufgipfelung der spitzen und schrillen Töne, in die sich, naturgemäß steigernd, die im Italienischen inexistente Vokabel „eclatante“ einordnet (frz. eclatant: glänzend, schmetternd, auffallend); und am Ende, optisch abgesetzt, l’oltraggio (Beschimpfung), dessen semantischer Corpus auf das erste Wort des Textes, oltranza (das Hinausgehn über) zurückverweist. Dieses „oltre“ ist folglich der Grundklang, die zusammengefaßte Wortsubstanz des Gedichts, das eben bis an die Grenze der Sprache und des rationalen Sinngefüges und darüber hinaus vorstoßen will. Aber sogar ein Inhalt läßt sich deutlich ausmachen. Das Gedicht „erzählt“ von einer unermüdlichen, immer scheiternden und stets aufs neue aufgenommenen Jagd nach etwas äußerst Leichtfüßigem und Flüchtigem. Wonach? Ich denke nach der Sprache, nach der Wirklichkeit, nach der Sprache der Wirklichkeit. Das Ganze zu verstehen ist demnach offensichtlich keine Hexerei; hier, wenn irgendwo, wird ein alter Grundsatz gültig: was von einem Menschenhirn erdacht, erfunden, ertüftelt worden ist – das muß sich von einem Menschenhirn auch wieder „aufdröseln“ und begreifen lassen.
Nicht alle Gedichte in La beltà sind so stachlig. Auf einem hübschen, gleichfalls humoristischen Einfall beruht
An die Welt
Sei nur, Welt, und sei brav;
existier nur schön;
Mach daß, such zu, tendier zu, sag mir alles,
und was tat ich? Stieß um, wich aus,
und jeder Einschluß war wirksam
und jeder Ausschluß auch;
los, wacker, existier
und roll dich nicht ein in dich selbst in mich selbst
Ich dachte die Welt so begriffen
mit diesem Super-Fallen Super-Sterben
die Welt so fakturiert
sei nur ein Ich ein schlecht entpupptes
Ich sei der Unverdauliche, schlechter Grübler
schlecht ergrübelt schlecht bezahlt
und nicht du, Herzchen, nicht du ,Heilige‘ und ,Geheiligte‘
ein bißchen mehr nach dort, seitlich seitlich
Tu alles, um zu ex- (per- kon- etc.) istieren
und über alle bekannten und unbekannten Präfixe hinaus
nimm deine Chance wahr
brav, tu ein bißchen was;
die Maschin’ muß laufen.
Vorwärts, Herzchen, vorwärts!
Vorwärts, Münchhausen!
Der Dichter spricht die Welt (gemeint ist die Welt als Globus, als „machine ronde“, wie es in einer schönen Fabel Lafontaines volkstümlich, und hier beziehungsreich, heißt); er spricht sie an, als sei sie ein kleines, ungebärdiges Kind, das man tätscheln, dem man gut zureden, dem man Kosenamen („Herzchen“) geben muß, um es bei Laune zu halten. Dieser mit alter Rhetorik überfrachteten Welt („die Heilige“) gegenüber hat das Ich ein schlechtes Gewissen, das sich in zerstörerischen Selbstbezichtigungen äußert (der „schlechte Grübler“), und wieder einmal im destruktiven Verhalten der Sprache gegenüber, die ja das Ich ist: in der Weigerung, einen begonnenen Satz zu Ende zu führen, im versuchsweisen Spiel mit Vorsilben.
Aber existiert diese Welt denn überhaupt und allen Ernstes? Wir erinnern uns der Weltverneinung beim frühen Montale (dem der Knochen des Tintenfischs), seiner Denunzierung des Illusionscharakters der Welt; diese Haltung kehrt, dezidierter und absoluter nun, beim mittleren und „späten“ Zanzotto wieder und bildet einen Grundcharakter seiner Handschrift. Wobei man allerdings nicht vergessen darf, daß bei ihm solchem Nihilismus „la contrada“, die kleinste und konkreteste Zelle heimatlicher Welt, als Gegengewicht, als „Zauberkraft“ (wie es später mit dem deutschen Wort heißen wird) gegenübersteht. Der schwierigste Dichter kehrt also das stärkste Bewußtsein seiner irdischen Realität hervor.
Unser nächstes Textbeispiel gehört zu den Perlen in Zanzottos Werk. Protagonist ist Nino, eine beurkundete Person aus dem ländlichen Lebenskreis des Dichters – ein legendärer alter „Oste“ (Schankwirt), dem der Zanzotto-Leser übrigens, zusammen mit seiner Osteria, an einem späteren Ort noch einmal begegnen wird.
Prophezeiungen oder Memoiren oder Wandzeitungen
III
Ninos Prophezeiungen.
(Was zwingst du mich zu schreiben, Nino!)
(Und wissen wir, ob all das heute
Erlaubnis bekommen kann für einen – ach, nur winzigen – Sinn?)
Nino, die schönste Prophezeiung
kann nur Knospen treiben auf Dolles Hängen
wo du, Dux durch göttliches Recht
und universale Belehnung,
die Arcana der Zeit und der Natur durchstöberst
und – wichtiger! – deinen Wein von den Himmeln selbst beziehst,
denn an deine Gärten grenzen allein
der Sternenhimmel und der sterngefiederten Fasanen Dickicht.
Hier siehst voraus du die Stürme und den Schnee von morgen
hier das Prozent von Weizen und von Milch,
hier Misere oder Herrschgewalt.
Doch immer lagert die Woge der Äpfel
in deinen Höfen ihr Bestes ab,
vierblättriges Futter lastet auf deinen Böden
und deine Weintrauben und die Ranken und die Triebe,
die kann im Leben kein Wind und keine Feuchtigkeit besiegen:
off limits für Fälschung wie für Not!
Und – da sich deinen Geistesgaben entringt
der ganzen Gegend erwartetste
und bestbezahlte Ernte – wenn du hinauf zu den nackten
Morgenhängen,
die schon bereifter Dezember ki- ki- kitzelt
(Redundanzen das, Redundanzen auf Schichten von
auf Spiegeln auf Nichtvorhandenem!)
hinauf du radelst zum tropfenden Lehnsgut,
Genie und Wundermann,
du zwischen siebzig und achtzig radelnd quasi volage,
prophezeist, daß in deinen Kellern
bald wir uns finden in erlesenster
Gesellschaft – welch ein summit! – daß wir
aufspüren werden mit aberhundert Gläschen
immer tiefer die Tiefe
deines Wertes,
Traditionalist am Abend am Morgen Neuerer:
oh Zenit deiner gesammelten Prophezeiungen!
Das Gedicht, eine gutmütige Satire, erinnert „en miniature“ an die „mock heroic poems“ des englischen und europäischen Spätbarock („Dux durch göttliches Recht“ usw. für einen Schankwirt!); es weist abermals die von Zanzotto kultivierten fremdsprachlichen Einsprengsel auf; es scheint sich mehrfach zu einer jener leicht pathetischen und unverschränkten Sequenzen aufschwingen zu wollen, die wir als konstitutiv für Zanzottos Dichten beobachten konnten – aber das geht rasch wieder in der Ironie unter, die den ganzen Text durchsäuert, und schließlich ist das Gedicht im Ganzen sicherlich ein Beleg für des Dichters radikalen Zweifel an der Wirklichkeit der „Wirklichkeit“.
Darauf – nach den Zwischenstufen von Gli sguardi i fatti e senhal (1969), den Pasque (1973) und nach den für Fellinis Casanova-Film geschriebenen Dialektgedichten Filò (1976) setzt Zanzotto sozusagen alles auf eine Karte und veröffentlicht, Schlag auf Schlag, seine bisher abschließende „Trilogie“: Il Galateo in bosco (1978), Fosfeni (1983) und Idioma (1986). Unter den italienischen Kritikern herrscht Einhelligkeit darüber, daß der Galateo im Wald (zu dem der große Philologe und Montale-Deuter und -Herausgeber Gianfranco Contini ein kurzes Vorwort geschrieben hat) die Gipfelleistung Zanzottos darstellt, daß hier die ganze Komplexität, der ganze Reichtum seiner sprachlich-dichterischen Phantasie zum Ausdruck gekommen sind. Das Buch weist eine klar erkennbare Struktur auf: achtzehn Stücke im ersten Teil, sechzehn „Hypersonette“ im Mittelteil und noch einmal achtzehn Stücke im dritten und letzten. Die Sonette sind – eine wahre Zerreißprobe für das Gestaltungsvermögen eines „Verseschmieds“ – von einem extrem verknäuelten, von den verschiedensten Reminiszenzen überfrachteten Petrarkismus geprägt, und als der Dichter das hinter sich hatte, mußte er sich erst einmal in einem unflätigen Dialektgedicht („E pò, muci“) Luft machen, ehe er weiterschreiben konnte.
Was bedeutet, was impliziert der Titel? Das hat Zanzotto selbst in einer Anmerkung erklärt, die wir nur hierherzusetzen brauchen: „Der ,Wald‘ ist… auch der Hügel des Montello. Dort verfaßte Giovanni della Casa den Galateo (ein Anstandsbuch zu Ehren von Galeazzo Florimonte da Sessa, geschrieben 1558); dort, in der Kartause und in der Abtei – die erste vollständig verschwunden, die letztere eine Ruine −, wurden italienische und lateinische Verse, Reime um Reime, geschrieben. Der große Wald, der dieses Gebiet überzog, überstand, obwohl ausgebeutet, unbeschädigt die Jahrhunderte, bis nach der Einigung Italiens die Zerstörung kam. Hier fanden die Schlachten statt, die 1918 zum italienischen Sieg über Österreich-Ungarn führten. Heute findet man an diesem einzigartigen Ort noch immer bewaldete Teile und dazwischen Wochenendhäuser und Landwirtschaft – und doch bleibt etwas von dem Großen Wald, von seiner Schönheit und Kraft, das wie reuevolle Erinnerung einen unbestimmbaren Raum durchweht. Alles ist noch möglich auf diesem aus unzähligen Ablagerungen gebildeten Boden. Die Fragen bleiben offen, wie jene aller Wälder, der pflanzlichen und der menschlichen. Wie auch die aller Blutbäder, Kriege und Menschenopfer: es bleibt die Aufforderung, ihre düstere Nutzlosigkeit einzusehen und sie zugleich bis in die Tiefe zu durchleiden und in solchem Beteiligtsein noch einmal zu begreifen, ,auf daß sie in Zukunft verhindert werden können‘. Das sagt man so leichthin (während das Blutvergießen täglich weitergeht); man müßte eine Partei des ,fortgesetzten Erbrechens‘ gründen. Zehntausende von Toten allein auf dem Montello und seiner Umgebung! Diese Tragödie ist dem Boden und den Menschen eingeprägt…“
Drei Erkenntnisse lassen sich aus dieser Stelle gewinnen: während Zanzottos Arcadia bisher im wesentlichen naturhaft gesehen war, erlangt sie nun ein kulturelles Profil aus der Erinnerung an den Renaissance-Dichter Giovanni della Casa (und gleichsam in einem Sich-Aufbäumen seines dichterischen Talents hat Zanzotto sich bewogen gefühlt, den spätpetrarkistischen Versen des ersten dichtenden Montello-Bewohners seine eigenen „Hypersonette“ entgegenzusetzen); und war er bisher im Vordergrund und an der Oberfläche geblieben, so geht er nun einerseits zurück in die nahe Historie (den Ersten Weltkrieg) und andererseits unter die Erde, um hier Schichten vermoderter Menschenleiber zu entdecken – den tragischen Humus der Opfer, aus dem sich die Wälder des Montello nähren; und endlich sind wir zum ersten Mal einer Äußerung von Zanzotto habhaft geworden, die in geradezu leidenschaftlicher Form eine politische Stellungnahme enthält.
Von den damit umschriebenen Empfindungen lebt eine Reihe von Gedichten des Galateo im Wald. Noch nicht oder kaum gilt das für das erste, das hier vorgestellt werden soll:
Zärtlichkeit. Sanftmut. Leichte Windberührung. Fingersatz kalt auf dem Glas.
Fahnen plötzliche Stürme / spüren. Fahnen, wahre, offenbare Interessen.
Zärtlich, frei und ruhelos. Locker befestigt.
Die Fahnen, wie-daß? Daß-hier?
Ferne Schlachten. Bilder von Schlachten, Trophäen.
Dörfer. Älteste. Junge Grabungen, im Himmel wird gegraben, Fahnen.
Kuppeln, ein Zirkus. Fahnen wehen in die Höhe, wehen.
Peitsche erhoben gegen mich, sie peitschen den Himmel, das Blau.
Kapillarreiche Lieder / Schaum blasen den Wind auf, erschrecken ihn. Fahnen.
Paradiesische Kartenbude. Kartenverkauf. Hier ist der Eingang.
Sterngitter, Gitterschlösser, in reicher Auswahl.
Schlüssel des Zirkus-Lichtgewitter-Kutschen Zirkus. Und Fahnen.
Lebhaftes Spielzeugdorf, darin der Spielzeugzirkus.
Winziger Zirkus. Zungen, ganz nahe. Flügel der Lunge, zwei- dreigespaltene Fahnen, Schlachten. Kugeln. Kegel.
Oh, wie ein Strahlenbündel Fahnen steige der Zirkus-Kuß auf.
Kugeln Kegeln slot-machines klirr klirr Gefangene
der schimmernden [ ] Menge der Fallen im März −
der tödliche wie immer
wie immer während lachender Folter
der lachende wie immer in lachender Dürre
Mit dem Motorrad fährt er steil über das gespannte Seil
zur Spitze des Turms hinauf, ins schwindende Blau, ins Hellrot.
Und stellt alles auf den Kopf. Fahnen. Er sägt Särge, ein herrlicher Schwindler im Spiel.
Er schwindelt bei Nässe und Sonne. Glockenspiel aus Fahnen und Ermahnen.
Er verliebt sich und führt in den Nächten einen Zirkus auf.
März, der zerschneidet. Fallen. Hall, schneidend. Kommandi wie Strahlen, Zerspalten.
Früh morgens brach der Zirkus auf −
mit Schafgetrappel, heimlich, sacht.
Ich war schon wach (warum, sag’ ich nicht gerne)
und wußte, die Frühe nimmt ihren Lauf
aaaaadie Schafe des Zirkus unter den Sternen.
aaaaaAufbruch des 19., Tag des hl. Joseph,
aaaaafließend fließend der Wald, der Reif, die Risse.
Unser Leser ist auf diesen Text durch das Beispielgedicht „Oltranza oltraggio“ aus dem Zyklus La beltà vorbereitet. Er wird bemerken, daß sich Zanzottos Instrumentarium seither beträchtlich bereichert und verfeinert hat. Auffällig ist nun die Häufigkeit von Nominalsätzen oder auch nur von Stichworten (Annotationen); geblieben ist das scheinbare Tasten nach dem treffenden Ausdruck (es gibt sogar einen durch eckige Klammern bezeichneten „blinden Fleck“); hinzu kommen jetzt Binnenreime, Alliterationen in Hülle und Fülle, Laut- und Klingwörtchen, Wortwiederholungen; Wörter werden zerlegt und mit assoziativer Phantasie neu zusammengesetzt; und wenn wir aufs Ganze des Buches schauen, so treffen wir immer wieder auf graphische Randnotizen: Pfeile, Verbotsschilder, kindliche Umrißzeichnungen und schließlich gar eine aus einem alten Buch reproduzierte Finis-Vignette.
Das Spiel mit dem Sprachmaterial, das Zanzotto seit La beltà praktiziert hatte, ist im Galateo also am Höhepunkt angekommen. Und doch tut Zanzotto etwas anderes als die Avantgardisten der „Gruppe 63“, gegen die er gern und immer heftig polemisiert. Gewiß, Zanzotto spielt; dieses Spiel läßt sich verstehen als Ventil für all die Spannungen und Verspannungen, die in seiner Natur angelegt sind und die wir an seinen Texten beobachten konnten. Bei solchem Spielen können sich öfter die Beziehungen zwischen dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden verflüchtigen, kann das letztere eine gewisse Autonomie gewinnen. Aber das freie Schalten und Walten mit dem Material der Sprache wird bei Zanzotto niemals ein Experimentieren um des Experimentierens willen, niemals purer Formalismus und in letzter Konsequenz Nihilismus. Immer bleibt en filigrane ein inhaltlicher Anlaß und Anhalt erkennbar: so hier der tiefe Kindheitseindruck eines durch den Heimatort gekommenen Wanderzirkus, das lang nachwirkende und sich in Phantasien und Träumen fortsetzende Erlebnis dieser bunten, lustigen, wagemutigen und freien Welt; dies ist die Grundtatsache, die anmutig umspielt wird durch eine quasi unversiegliche Fülle von einfalls- und geistreichen Arabesken.
Es ist nur allzu einsichtig, daß die Resultate dieses Spielprozesses nicht zur Gänze in eine andere Sprache transportiert werden können, so einfallsreich ihrerseits die Übersetzer sein mögen; ach, sie können nicht nur nicht zur Gänze, sondern nur zu einem kleinen Teil herübergenommen werden! Das Beste solcher Art von Poesie ist dazu bestimmt oder verurteilt, in der jeweiligen Nationalsprache eingeschlossen zu bleiben. Gibt es eine Abhilfe? Sie kann in diesem Fall allen Ernstes nur darin liegen, Italienisch zu lernen (wodurch der Liebhaber der Lyrik ja nicht nur in den Stand gesetzt würde, die Schätze Zanzottos, sondern im genauen Wortsinn unzählige weitere zu heben). Anderes läßt sich nicht raten, anderes nicht tun.
Das nächste Gedicht, das sechste des Buches, wendet sich, während das Zirkusthema noch am Rande fortwirkt, dem großen und tragischen Thema der „Beinhäuser“ zu:
Wenden Sie sich an die Beinhäuser. Eintritt frei.
Wenden Sie sich an die Grabsteine. Respektvoll und verzweifelt.
Wenden Sie sich an die Gaststätten. Elemente des Himmels stehen bereit.
Wenden Sie sich an die Dörfer. Dort wohnen als Mieter die Wünsche und ihre Unendlichkeit
aaaaa(sichtbar an jedem geschlossenen Fenster).
Und die Lichtung hat längst zugestimmt schon
einem Austausch mit Blättern, dort wo
die farbigste Blutschau sich bot
ein mystischer Zirkus des Bluts. Oh wieviele Nummern, und Extrarationen. Hurra.
Ich will mich von diesen chemischen Trümmern ernähren um, als eine Premiere,
im geheilten Spiegel der Wünsche und der Unendlichkeit
die Fermente und Enzyme jenes Zirkus zu sammeln
in den feinsten Säften des Morgens, der Bewegung, beim Weckruf. Und man geht.
Man geht durch Beinhäuser. Sie warten
voll ferner Sterblichkeit jetzt, wie ein Frühling in Blüte steht,
voller Glanz und Angst. Kein Widerstand, und man geht.
Bewahrt Ruhe, Beinhäuser – so viele Tode ohne Verschiedenheit mehr ohne Grabstein
und frei von Betrug (und das Vaterland Betrügergesicht
das Haus und Garten verspricht, nur verspricht,
bettelt hier um Heiligkeit und sie wird ihm gegeben).
Beinhäuser haben etwas vom Streben der Fabriken.
Dort empfängt man Befehle, ewige Bestellungen. Dort sortiert man.
In der Anstalt züchten die noch lebenden Kriegsirren
Schweine; Handel mit den Gebeinen:
Ihr habt mich überwältigt, beschmiert, verewigt, ein Blutstrahl.
Piave, offene Ader, nicht still und nicht friedlich
aber heiter fließend, jenseits von Gut und von Böse und so weiter silbergereizt in ihrem Verlauf, in ihrer Strömung.
aaaaaaaaaaVater und Mutter, in dieser Gottheit vielleicht vereint im unstillbaren Bluten
aaaaaaaaaaaaaaaaaaim unstillbaren Grün und glitzernden Licht,
in dieser Größe wo jeder Laut zu Schweigen zerbricht
habt ihr mich aufgebahrt, unter Bergen von
K wie Knochen, gut verzeichnet, lesbar
aaaaaHostien, hoch hinaus wie in ein Jenseits der Gräser und ihrer Enzyme gespieen,
aaaaaaain ein Außen das sich über mich beugt, mich erschaffend Macht über mich übt und mich höher treibt zu
So daß ich blase zum Appell
ich wechsle zwischen Stottern und schwierigen Reimen
die sich bilden und berühren,
ich gehe durch Beinhäuser, wertvolle Knochen und Schädel
folgen mir zärtlich, meiner, keiner Zauberflöte
aaaaaImmer öfter durch sie wechsle ich zart mit mir
im Strauchwerk, zwischen Kriegsresten die aufragen,
eine Blume wechselt mit einem Himmel
in Frühjahren zerfallender Knochen,
ein Ja wechselt mit einem Nein, nicht viel
unterschieden, in der Stille
in den Strichen dieses Regens, wie in einem Zirkus oder Spiel.
Noch einmal ein beeindruckendes Gedicht, mit dem wir leider die Erkundungsfahrt durch Zanzottos Werk beenden müssen. Der freie Umgang mit dem Sprachmaterial ist hier selbstverständlich nicht humoristisch getönt, sondern er wird der Evokation des Grauens vor der sinnlosen Menschenopferung dienstbar gemacht. Den Beinhäusern wird am Anfang sarkastisch-begütigend zugesprochen wie einst der „Welt“ im Münchhausengedicht. An mindestens zwei Stellen werden ideologiekritische Akzente gesetzt: dort, wo dem Vaterland ein „Betrügergesicht“ zuerkannt wird, „das Haus und Garten verspricht, nur verspricht“; und etwas später da, wo aus dem Piave-Lied zitiert wird, doch nun mit dem Zusatz der Negation. (Der Piave-Fluß, an dem die österreichische Offensive des Ersten Weltkriegs zum Stehen gebracht wurde, galt lange als heiliger Fluß und Symbol des unantastbaren Vaterlandes.) Am Ende aber scheint es, als fielen alle diese Spuren unseligen Menschenwerks wieder der Natur anheim.
In dem undatierten Interview, das am Anfang des Zanzotto-Bändchens von Giuliana Nuvoli von 1979 steht, gibt der Dichter eine bedenkenswerte Erklärung ab. Er sagt, seit dem Galateo (der 1978 erschienen ist) habe er einen großen Teil zweier anderer Zyklen geschrieben, worunter ohne jeden Zweifel Fosfeni und Idioma zu verstehen sind (die im Vergleich zum Galateo keine Neuerungen enthalten). Dann aber heißt es: „Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß ein großer Teil dessen noch ungesagt ist, was zu sagen mir am Herzen lag, worauf ich wenigstens anspielen wollte. Fast alles liegt noch ,jenseits‘. Unzugänglich. Es wird darum gehen, noch einmal vom Nullpunkt aus aufzubrechen… Oder fast vom Nullpunkt. Hätte man einen Nullpunkt, um von ihm auszugehen!“
Orakelhafte Worte, die uns wohl sagen wollen, die uns hoffen lassen, daß Zanzotto keineswegs ausgeschrieben ist, daß er uns noch mit neuen Gedichten überraschen und beschenken wird.
Hans Hinterhäuser, aus: Hans Hinterhäuser: Italienische Lyrik im 20. Jahrhundert, R. Piper Verlag, 1990
Fakten und Vermutungen zu Donatella Capaldi
Fakten und Vermutungen zu Ludwig Paulmichl + Instagram 1 & 2 +
Facebook + Kalliope
Fakten und Vermutungen zu Peter Waterhouse + Instagram +
KLG + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA + IMAGO +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
KLfG + IMDb + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Nachrufe auf Andrea Zanzotto: der Standart ✝ NZZ ✝ stol ✝ Die Welt ✝
Chicago Review ✝ Park ✝
Andrea Zanzotto zu seinem 88. Geburtstag.


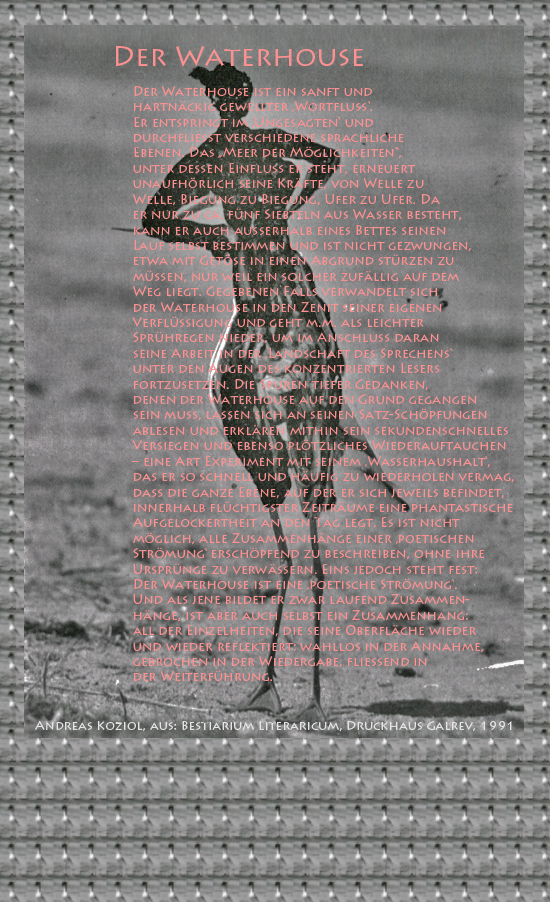













Schreibe einen Kommentar