Andrej Wosnessenski: Begegnung mit Pasternak
BEGEGNUNG MIT PASTERNAK / ICH BIN VIERZEHN…
„Ein Anruf von Pasternak – für dich!“
Entgeistert starrten mich meine Eltern an. Ich, ein Schüler der sechsten Klasse, hatte ihm heimlich einen Brief mit meinen Versen geschickt. Es war mein erster entschlossener Schritt, der über mein weiteres Leben entscheiden sollte. Und nun dieser Anruf: Er lud mich für Sonntag um zwei Uhr ein.
Es war Dezember, aber ich kam selbstverständlich eine Stunde zu früh zu dem grauen Haus in der Lawruschinski-Gasse. Ich wartete und fuhr dann bis zum dunklen Treppenabsatz des sechsten Stockwerks. Eine Minute vor zwei. In der Wohnung hatte man wohl gehört, wie der Fahrstuhl klappte. Die Tür wurde geöffnet.
Er stand auf der Schwelle.
Mir verschwamm alles vor den Augen. Verwundert sah die länglich-dunkle Flamme seines Gesichts mich an. Eine Jacke wie aus tropfendem Stearin umspannte seine kräftige Figur. Die Zugluft spielte mit seiner Stirnlocke. Nicht von ungefähr sollte er später für sein Selbstbildnis eine brennende Kerze wählen. Er stand im Luftzug der offenen Tür.
Die hagere, kräftige Hand eines Pianisten.
Mich erstaunte die Askese, die ärmliche Leere seines ungeheizten Arbeitszimmers. Ein quadratisches Majakowski-Bild und ein Dolch an der Wand. Das englisch-russische Wörterbuch von W.K. Müller – damals war er an Übersetzungen gefesselt. Auf dem Tisch duckte sich mein Schreibheft, vermutlich bereitgelegt für das Gespräch. Eine Woge von Furcht und abgöttischer Verehrung erfaßte mich. Doch fortzulaufen war es nun zu spät.
Er war gleich mitten im Gespräch.
Seine Wangenknochen bebten sacht, wie dreieckige Schwingen, wenn sie vor dem Flügelschlag eng an den Körper gepreßt sind. Ich vergötterte ihn. In ihm war Kraft und Schwung und eine himmlische Ungeschicklichkeit. Beim Sprechen ruckte und reckte er das Kinn hoch, als wollte er sich des Kragens entledigen und des eigenen Leibes.
Bald hatte ich alle Scheu überwunden und musterte ihn verstohlen.
Seine kurze Nase hatte unmittelbar unter der Nasenwurzel einen Höcker und verlief dann gradlinig, einem dunkel getönten winzigen Gewehrkolben gleich. Die Lippen einer Sphinx. Kurzgeschorenes graues Haar. Das Wichtigste aber war die rollende, dampfende Welle von Magnetismus.
Er, der mit einem Pferdeauge sich selbst verglich.1
Als ich ihn nach zwei Stunden verließ, trug ich einen Packen seiner Manuskripte in beiden Händen, zur Lektüre, und das Wertvollste – ein smaragdgrünes Heft mit einer purpurroten Seidenschnur, das seine neuesten Gedichte enthielt. Brennend vor Ungeduld, schlug ich es gleich im Gehen auf und verschlang die sich überstürzenden Zeilen:
Die Christbäume alle, die Märchen der Welt,
Die Ketten Lametta, das Flimmern der Kerzen…
Die Verse vermittelten die Gefühlswelt eines Schülers aus dem vorrevolutionären Moskau, hatten den Zauber der Kindheit, dieses größten aller Rätsel Pasternaks.
Die Ketten Lametta, das Flimmern der Kerzen…
Die Verse hatten den kristallenen Seelenzustand seiner Spätzeit bewahrt. Ich traf auf seinen Herbst. Der Herbst ist hell bis zur Hellsichtigkeit. Und das Land der Kindheit ist näher gerückt.
Die Äpfel und alle die goldenen Kugeln…
Dieser Tag entschied über mein Leben, verlieh ihm magischen Sinn und Prädestination. Seine neuen Gedichte, die Telefonate, die Sonntagsgespräche bei ihm von zwei bis vier, die Spaziergänge – es waren Jahre des Glücks und kindlicher Verliebtheit.
Was bewog ihn, mir zu antworten?
Er war einsam in jenen Jahren und der Unbilden müde; ihn verlangte nach Aufrichtigkeit, nach lauteren Beziehungen, er wollte ausbrechen aus dem Teufelskreis – aber nicht das allein war es. Diese ungewöhnlichen Beziehungen zu dem Halbwüchsigen, diese Fast-Freundschaft – sagt sie nicht etwas über ihn aus? Es war ja nicht einmal die Freundschaft eines Löwen mit einem Hund, sondern eher die eines Löwen mit einem Hündchen.
Vielleicht liebte er in mir sich selbst, wie er als Schuljunge zu Skrjabin gelaufen war?
Es zog ihn in die Kindheit. Der Kindheit Ruf verhallte niemals in ihm.
Er wollte nicht angerufen werden – er rief selbst an. Bisweilen etliche Male in der Woche. Dann wieder kamen quälende Wartezeiten. Und nie nannte er sich meinen verdatterten Angehörigen mit Vor- und Vatersnamen, immer nur – Pasternak!
Meist sprach er überstürzt, ohne Atempause, um dann, in voller Fahrt, plötzlich das Gespräch abzubrechen. Niemals klagte er, welche Wolken ihm auch den Tag verdunkelten.
„Der Künstler“, pflegte er zu sagen, „ist seinem Wesen nach Optimist. Optimistisch ist das Wesen jedes künstlerischen Schaffens. Selbst wenn man Tragisches schreibt, muß man stark und kraftvoll schreiben, Kleinmut und Schlappheit bringen nichts Starkes hervor.“ Sein Redefluß war ein einziger atemloser Monolog, es war mehr Musik als Grammatik darin. Diese Rede war nicht in Sätze geteilt, die Sätze nicht in Worte gegliedert, alles ergoß sich in unbewußtem Bewußtseinsstrom, die Gedanken wurden hingemurmelt, kehrten wieder, verzauberten. Solch ein Strom war auch seine Dichtung.
Als er endgültig nach Peredelkino umzog, wurden die Anrufe seltener. Seine Datsche hatte kein Telefon, so rief er denn aus dem Pförtnerhäuschen des Verwaltungsgebäudes an. Durch das geöffnete Fenster hallte seine Stimme in die nächtliche Weite, er wandte sich an die Sterne. Ich lebte von Anruf zu Anruf. Häufig lud er mich ein, wenn er in seiner Datsche neue Werke vorlas.
Seine Datsche erinnerte an die hölzerne Nachbildung eines schottischen Wachturms. Am Rande eines großen furchenüberzogenen quadratischen Feldes ragte sie wie ein alter Schachturm aus der Reihe anderer Datschen heraus. Vom gegenüberliegenden Ende des Feldes her, jenseits des Friedhofs, blinkten eine Kirche und ihr Glockenturm aus dem 16. Jahrhundert, als wären es König und Dame der gegnerischen Seite – zierlich geschnitzte, spielzeughaft bemalte zwergenkleine Verwandte der Wassili-Blashenny-Kathedrale.
Von den Kuppeln der Friedhofskirche drohend anvisiert, duckte sich die streng ausgerichtete Datschenreihe. Heute sind von den einstigen Bewohnern nur noch wenige übriggeblieben.
Die Lesungen erfolgten stets in seinem halbrunden erkerförmigen Arbeitszimmer im Oberstock.
Man fand sich nach und nach ein. Brachte Stühle aus dem Erdgeschoß herauf. Meist waren es an die zwanzig Gäste. Sie warteten auf die Liwanows, die sich wieder einmal verspäteten.
Die Fenster ringsum geben den Blick auf die Septemberlandschaft frei. Die Wälder lohen. Drüben rollt ein Wagen auf den Friedhof zu. Spinnweben schweben zum Fenster herein. Jenseits des Feldes lugt hinter dem Friedhof seitwärts die Kirche, bunt wie ein Hahn, hervor – wen soll ich hacken? Über dem Feld bebt die Luft. Ein ebenso erregtes Beben pulst in der Luft des Zimmers – das Fieber der Erwartung.
Um die Wartezeit zu überbrücken, zeigt uns D.N. Shurawljow, der unvergleichliche Tschechow-Rezitator, tonangebend unter der Elite vom Alten Arbat, wie man seinerzeit bei Empfängen zu sitzen hatte: den Rücken durchgedrückt, so daß man nur mit den Schulterblättern die Stuhllehne spürte. Das ist ein taktvoller Wink für mich. Ich fühle, wie ich rot werde. Aber vor Verwirrung und Widerborstigkeit mache ich erst recht einen runden Buckel und stütze die Ellbogen noch fester auf.
Endlich treffen die Nachzügler ein. Sie, befangen und nervös-grazil, rechtfertigt sich damit, daß es so schwer gewesen sei, Blumen aufzutreiben. Er, von mächtigem Wuchs, breitet in komödiantenhafter Verzweiflung die Arme aus und verdreht die faustgroßen Augen – Primus inter pares, der die Bühne des Moskauer Künstlertheaters erzittern ließ, homerischer Darsteller des Nosdrjow und des Potjomkin, fideles Haus und Grandseigneur in einem.
Es wurde still. Pasternak setzte sich an den Tisch. Er hatte eine leichte silbrige Feldjacke an, wie sie jetzt in Mode kommen. Diesmal rezitierte er die „Weiße Nacht“, „Nachtigall“, das „Märchen“ – kurz, das ganze Heft aus dieser Periode. Das Gedicht „Hamlet“ kam zum Schluß. Während des Vortrags richtete sich sein Blick auf etwas über unseren Köpfen, das nur ihm sichtbar war. Das Gesicht wurde länger, hagerer. Und die weiße Nacht schimmerte auf seiner Jacke.
Eine ferne Zeit kommt mir jetzt in den Sinn:
Irgendwo ein Haus am Stadtrand Petersburgs;
Du, die Tochter einer kleinen Gutsbesitzerin,
Bist auf Kursen hier, und du stammst aus Kursk.
Gewöhnlich dauerte die Lesung an die zwei Stunden. Wollte er den Zuhörern etwas erläutern, so wandte er sich bisweilen an mich, als tue er es meinetwegen:
Andrjuscha, hier im ,Märchen‘ versuche ich, wie auf einer Medaille ein Emblem des Gefühls zu prägen: der rettende Krieger und die Jungfrau vor ihm auf dem Sattel.
Dies war unser Spiel. Ich kannte die Verse ja auswendig; hier hatte er seine Methode der Benennung von Gegenstand, Handlung, Zustand zur Vollendung geführt. Die Zeilen klangen wie Hufgeklapper:
Lider, fest geschlossen.
Wolken himmelnah.
Fluten. Fährten. Flüsse.
Jahre. Säkula.
Er schonte die Eigenliebe der Zuhörer. Dann fragte er der Reihe nach, wem welche Verse am besten gefielen. „Alle!“ hieß es da meist, doch mit dieser ausweichenden Antwort gab er sich nicht zufrieden. Darauf wurde die „Weiße Nacht“ besonders hervorgehoben. Liwanow nannte den „Hamlet“. Es war seine Tragödie, daß er den Hamlet nie dargestellt hatte, und diesen Schmerz überspielte er mit Possen und Albereien.
Dann wird’s still, und auf die Bühne tretend,
Lehne ich mich an das Türgerüst…
Liwanow schneuzte sich. Noch wulstiger traten seine Tränensäcke hervor. Gleich darauf aber lachte er schon schallend, denn jetzt wurden alle nach unten, zu Tisch gebeten.
Man stieg die Treppe hinab und fand sich inmitten eines zerfließenden bläulichen Feuerwerks – Frauenakte, gemalt von seinem Vater, dem wohl einzigen russischen Impressionisten.
O diese Tafelrunden in Peredelkino! Es fehlte an Stühlen, und so wurden Hocker und Schemel herbeigeschleppt. Zeremonienmeister war Pasternak, der Pracht georgischen Rituals ganz hingegeben. Er war ein zuvorkommender Gastgeber. Und brachte die Gäste in Verwirrung, wenn er beim Abschied jedem eigenhändig in den Mantel half.
Wer waren sie, des Dichters Gäste?
Den trockenen Glanz des Geistes in den leicht zugekniffenen Augen, saß da der winzige mucksmäuschenstille Heinrich Gustavowitsch Neuhaus alias Harrik mit seinem ungefügen granitenen Schopf. Der zerstreute Slawa Richter, der Jüngste in der Runde, kostete mit halbgesenkten Lidern genüßlich Farben und Klänge. „Ich hab eine Frage an Slawa! Slawa, sagen Sie, gibt es überhaupt Kunst?“ verlangte Pasternak lautstark zu wissen. Neben ihm saß Nina Dorliak, schlank, melancholisch, ziseliert wie schwarze Spitze.
Was wäre eine Tafel ohne Samowar?
Der Samowar, das war bei diesen Tafelrunden Liwanow. Eines Tages erschien er im Dekor seiner sämtlichen Medaillen. Von Statur wie Peter der Große. Man placierte ihn ans Tischende, dem Hausherrn gegenüber. Er parlierte und brillierte. Vermutlich paßten etliche Eimer Flüssigkeit in ihn.
„Ich hab Katschalows Jim gekannt. Glaubt ihr wohl nicht?“ flammte er auf. ,„Gib Pfote, Jim…“2 Ein schwarzer tückischer Teufel war das! Der reinste Beelzebub! Alles zitterte vor ihm. Der kam reinspaziert und legte sich unter den Mittagstisch. Keiner getraute sich, den Fuß zu rühren. Und schon gar nicht, ihm über das seidige Fell zu streichen – gleich hätte er einem die Hand weggeschnappt. Kunststück! Und da sagt der: ,Gib Pfote, Jim…‘ Trinken wir auf die Poesie, Boris!“
Neben ihm blinzelte schüchtern und gerührt der großäugige Shurawljow, in seinem braunen Anzug einem Maikäfer gleich. Stumm grübelte Asmus. Ungeschickt wie ein Bär tappte Wsewolod Iwanow ins Zimmer und schrie:
Ich hab dir einen Sohn geboren, Boris!
Ich entsinne mich der antiken Anna Achmatowa, augusteisch in ihrer Poesie und in ihrem Alter. Gekleidet in ein weites, tunikaähnliches Gewand, blieb sie recht schweigsam. Pasternak hatte mir einen Platz neben ihr zugewiesen. So hat sich mir fürs ganze Leben ihr Halbprofil eingeprägt.
Unvergeßlich blieb auch der Besuch Hikmets. Der Hausherr brachte einen Trinkspruch auf ihn aus, zu Ehren der Revolutionsflamme, die ihn umlohe; darauf beschwerte sich Hikmet, daß niemand von den Anwesenden Türkisch verstehe – schließlich sei er ja nicht nur Lohe, sondern auch Lyriker, und er werde gleich etwas vortragen. Er rezitierte ungestüm – und schwer atmend, denn er litt an Angina pectoris. Vor seinem Weggang stopfte er sich, um einer Erkältung vorzubeugen, Zeitungen unters Hemd, russische und ausländische, von denen es auf der Datsche Unmengen gab. Ich begleitete ihn ein Stück. Auf der Brust des Dichters raschelten Weltereignisse, raschelten Erdentage.
Mitunter kam der gotische Fedin vorbei, er bewohnte die Nachbardatsche. Das Ehepaar William-Wilmont hatte die vornehme Haltung der Rokotowschen Porträts.
Pasternaks Frau, Sinaida Nikolajewna, die mit ihren schmollend geschürzten Lippen, dem schwarzen Samtkleid und dem kurzgeschnittenen schwarzen Haar einer art-nouveau-Dame glich, grämte sich, daß Stassik Neuhaus, ihr Sohn, beim Pariser Pianistenwettbewerb am Morgen spielen sollte, während er doch auf Abendspiel eingestellt sei.
Ruben Simonow rezitierte hingerissen und hinreißend Puschkin und Pasternak. Irgendwann tauchte Wertinski auf. Der brillante Irakli Andronikow parodierte unter homerischem Gelächter Marschak.
Welch eine Augenweide! Welch erlesener Geistesgenuß! Die Renaissancemalerei, nein, die Kunst eines Borowikowski und eines Brüllow feierte in diesen Tafelrunden ihre Auferstehung.
Freigebig ließ er mich die Großartigkeit seiner Geistesbrüder genießen. Es gab so etwas wie eine stillschweigende Übereinkunft zwischen uns. Mitten in einer feuchtfröhlichen Trinkrede fing ich bisweilen seinen braunen ironischen Verschwörerblick auf, der nur mir galt und etwas mitteilte, was nur wir beide verstanden. Fast schien es, als wäre er an diesem Tisch mein einziger Altersgenosse, und diese heimliche Altersgemeinschaft brachte uns einander nahe. Oftmals wich die Begeisterung in seiner Miene kindlicher Kränkung oder gar Trotz.
Es kam auch vor, daß er mich aufforderte, den Anwesenden Gedichte vorzutragen. Das war wie ein Sprung in eiskaltes Wasser! Mit schriller Stimme las und las ich…
Auf das Gekreisch der Straßenbahnen
Stützen die Wolken sich verwirrt.
Meine ersten öffentlichen Lesungen.
Manchmal war ich eifersüchtig auf die anderen. Natürlich waren mir unsere Zwiegespräche, ohne die Gäste, viel lieber, genauer gesagt, seine Monologe, die nicht einmal an mich, sondern an mir vorbei, an die Ewigkeit, an den Sinn des Lebens gerichtet waren.
Es kam auch vor, daß mein Empfindlichkeitskomplex ausschlug und ich gegen den Vergötterten aufbegehrte. Eines Tages sagte er mir am Telefon, ihm gefalle die Schrifttype meiner Schreibmaschine, und bat mich, für ihn einen Verszyklus abzutippen. Warum auch nicht! Ich aber fühlte mich in meiner kindlichen Eigenliebe gekränkt: Bin ich vielleicht seine Abschreiberin? So lehnte ich törichterweise ab mit dem Hinweis auf eine bevorstehende Prüfung. Das mit dem Examen stimmte, war aber nicht der eigentliche Grund.
Pasternak ist ein großer Junge.
Es gibt Künstler, die durch ein ständiges Altersmerkmal geprägt sind. So empfinden wir in Bunin die Klarheit des frühen Herbstes, er bleibt gleichsam allezeit vierzig. Pasternak hingegen ist für immer ein großer Junge, ein Lausejunge – „ich bin erschaffen mir selbst zur Pein und allen treuen Seelen, die Sünde ist zu quälen“. Nur ein einziges Mal nennt er in seinen Versen sein Alter:
Ich bin vierzehn.
Ein für allemal.
Wie bis zur Blindheit scheu war er unter Fremden, in der Menge, wie krampfhaft zog er die Schultern ein und beugte den Nacken!
Eines Tages nahm er mich ins Wachtangow-Theater mit, zur Uraufführung von Romeo und Julia in seiner Übertragung. Ich saß rechts von ihm. Meine ganze linke Seite – Schulter, Wange, Ohr – war wie betäubt von dieser Nachbarschaft, wie unter Narkose. Ich schaute auf die Bühne und sah dennoch ihn: das leuchtende Profil, die Stirnlocke. Stellenweise flüsterte er den Text den Darstellern nach. Im Zweikampf mit Tybalt brillierte als Romeo der Schauspieler Juri Ljubimow, damals heldischer Liebhaber am Wachtangow-Theater. Gewiß träumte er noch ebensowenig von seinem künftigen Theater wie auch davon, daß er dort den Hamlet in Pasternaks Übertragung und seine Gedichte aus der Kriegszeit inszenieren würde.
Plötzlich bricht Ljubimows Degen, die Spitze beschreibt eine unglaubliche Parabel und landet – o Wunder! – neben der Armstütze zwischen unseren Sesseln. Ich beuge mich vor, hebe sie auf. Pasternak lacht. Aber schon rauscht Beifall auf, der Saal fordert bereits wieder ganz ernst im Sprechchor:
Den Autor! Den Autor!
Man zerrt den verwirrten Dichter auf die Bühne.
Die Tafelrunden waren seine Mußestunden. Er schuftete wie ein Galeerensträfling. Zwei Monate im Jahr arbeitete er an Nachdichtungen, leistete seinen „Frondienst“ ab, um dann seine eigenen Sachen schreiben zu können. Er brachte es auf hundertfünfzig Zeilen pro Tag, sonst lohne es nicht. Und rügte die Zwetajewa, die, wenn sie nachdichtete, nur etwa zwanzig Zeilen am Tag schaffte.
Bei Pasternak lernte ich auch Simon Tschikowani, Pjotr Tschagin, Sergej Makaschin, Joseb Noneschwili kennen.
Ein Meister des sprachlichen Ausdrucks, mochte er Zoten und unflätiges Fluchen nicht. Ein einziges Mal nur hörte ich aus seinem Mund eine Anspielung auf eine vulgäre Bezeichnung. Kleinliche Puritaner waren über einen Freund von ihm hergefallen, weil er in einer Zeitschrift publiziert hatte, die ihnen nicht paßte. Da erzählte Pasternak bei Tisch eine Anekdote über Afanassi Fet. Der soll in einer ähnlichen Situation gesagt haben: „Wenn Schmidt“ – das war, glaube ich, damals der mieseste Schuster in ganz Petersburg – „ein schmutziges Blättchen herausgäbe, das einen Namen aus drei Buchstaben trüge, würde ich trotzdem meine Sachen dort drucken. Verse reinigen.“
Wie behutsam und lauter er war! Eines Tages gab er mir einen Packen neuer Gedichte zu lesen, darunter den „Herbst“ mit der kostbaren, in ihrer Reinheit, Gefühlstiefe und Plastizität echt tizianischen Strophe:
So wie der Hain sein Blattwerk jüngst
Wirfst du dein Kleid zu Boden hastig,
Eh du in meine Arme sinkst
Im Schlafrock mit der Seidenquaste.
(Ursprünglich lautete es:
Dein Kleid, weit offen, gleicht dem Laub,
Achtlos vom Hain fallen gelassen…)
Am nächsten Morgen rief er mich an:
Vielleicht finden Sie diese Stelle zu freimütig? Sina meint, ich hätte Ihnen das nicht geben sollen, es sei allzu frei.
Unterstützung und Rückhalt war mir sein Leben selbst, das neben mir leuchtete. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, ihn um was Praktisches zu bitten, etwa, daß er mir helfen möchte, etwas drucken zu lassen, oder dergleichen. Ich war überzeugt, man gelangt nicht durch Protektion in die Poesie. Als ich fand, es sei nun an der Zeit, meine Verse zu publizieren, klapperte ich, ohne ihm ein Wort zu sagen, die Redaktionen ab, wie alle anderen auch, und machte ohne hilfreiche Telefonanrufe sämtliche Anfängerqualen durch. Eines Tages gerieten meine Gedichte an das Kollegiumsmitglied einer dicken Zeitschrift. Der Mann läßt mich in sein Arbeitszimmer rufen, bietet mir Platz an und zerfließt vor Liebenswürdigkeit, der Fettwanst.
„Sie sind sein Sohn?“
„Ja, aber…“
„Kein Aber! Die Zeit ist vorbei. Jetzt brauchen Sie sich nicht mehr zu verstecken. Er ist jetzt rehabilitiert. Nun ja, es hat Fehler gegeben. Was für ein genialer Kopf er war! Gleich kommt der Tee. Und Sie als sein Sohn…“
„Ja, aber…“
„Kein Aber! Ihre Verse kommen ins nächste Heft. Man wird uns richtig verstehen. Sie schreiben meisterhaft, insbesondere gelingen Ihnen die Merkmale des Atomzeitalters – hier zum Beispiel steht bei Ihnen ,Karyatiden‘… Gratuliere!“ (Schließlich begriff ich, daß er mich für den Sohn von N.A. Wosnessenski hielt, dem ehemaligen Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission.)
„Wieso, nicht sein Sohn? Was heißt, ein Namensvetter! Was fällt Ihnen ein, uns hier blauen Dunst vorzumachen! Bringt da irgendein schädliches Zeug angeschleppt! Das könnte Ihnen so passen! Und ich dachte mir schon, wie kann solch ein Vater so einen… vielmehr, nicht der Vater… Was heißt hier Tee?!“
Irgendwie erschienen meine Gedichte dann aber doch. Die frische, nach Druckerschwärze riechende Literaturnaja gaseta brachte ich Pasternak nach Peredelkino.
Er war krank. Mußte das Bett hüten. Eingeprägt hat sich mir die über sein Lager gebeugte bekümmerte herbstliche Frauensilhouette, die der Wrubelschen Majolika-Muse glich. Sein dunkler Kopf lag schwer auf den weißen Kissen. Man reichte ihm die Brille. Wie strahlte er, wie erregt war er, wie arbeitete es in seinem Gesicht! Er las die Gedichte laut, man sah, daß er sich für mich freute. „Also steht es auch um mich nicht gar so schlimm“, sagte er plötzlich. Von den Versen gefiel ihm, was in freier Form geschrieben war. „Sicher sucht jetzt Assejew schon nach Ihnen“, scherzte er.
Assejew, der heißblütige Assejew mit dem ungestüm aufragenden, an einen Spitzbogen erinnernden Gesicht, fanatisch wie ein katholischer Geistlicher, mit schmalen höhnischen Lippen, der Dichter der „Blauen Husaren“ und der „Oksana“, Sänger der Neubauten, Reformator des Reims. Wachsam schwebte er in seinem Turm an der Gorkistraße, Ecke MChAT-Gasse über Moskau; jahrelang verließ er seinen Posten nicht, wie ein ans Telefon geschmiedeter Prometheus.
Ich bin keinem zweiten Menschen begegnet, der so selbstlos fremde Verse geliebt hätte. Ein Künstler durch und durch, Werkzeug des Geschmacks, des Spürsinns, witterte er, einem sehnigen feinnervigen Windhund gleich, kilometerweit einen Vers – so glaubte er fest an Viktor Sosnora und Junna Moriz. Majakowski und Mandelstam hielten seinerzeit viel von ihm; Pasternak war seine flammende Liebe. Als ich kam, hatten sie sich schon längst entzweit. Wie bedrückend sind doch die Zerwürfnisse zwischen Künstlern! Assejew pflegte mich verliebt und eifersüchtig auszufragen:
Was treibt denn jetzt „Ihr Pasternak“?
Dieser gab sich distanziert:
… sogar Assejew ist die letzte Sache etwas kühl geraten.
Eines Tages brachte ich ihm ein Buch von Assejew, er gab es mir ungelesen zurück.
Assejew, der Katalysator der Atmosphäre, Schaumperle im Sekt der Poesie.
„Sie heißen also Andrej Andrejewitsch? Ist ja großartig. Wir haben alle einen Doppeltreffer erzielt: Majakowski heißt Wladim Wladimytsch, ich – Nikolai Nikolajewitsch, Burljuk – Dawid Dawidytsch, Kamenski – Wassili Wassiljewitsch, Krutschonych…“ – „Und Boris Leonidowitsch?“ – „Die Ausnahme bestätigt die Regel!“
Assejew verpaßte mir den Spitznamen Washnostschenski,3 er bedachte mich mit den Versen „Ihre Gitarre ist eine Gitana, Andrjuscha“ und rettete mich in einer schweren Zeit mit seinem Artikel „Was machen wir mit Wosnessenski?“, der sich gegen die Manier gewisser Kritiker richtete, „Gedanken zu lesen“. Ritterlich wehrte er in der Tagespresse die Angriffe gegen junge Bildhauer und Maler ab. In seinem Literaturpanorama „Majakowski beginnt“ nannte er in einer stattlichen Reihe von Namen neben Majakowski, Chlebnikow und Pasternak auch Alexej Krutschonych.
Halt, hier riecht es mit einemmal nach Mäusen – ein spitzes Näschen zielt schnuppernd nach meinem Manuskript. Pasternak hatte mich vor der Bekanntschaft mit ihm gewarnt. Er kreuzte gleich nach meiner ersten Zeitungspublikation auf.
Ein Trödler in Sachen Literatur.
Man nannte ihn nur Lexej Jelissejitsch oder einfach Krutschka, am besten aber hätte auf ihn Kurtschonok4 gepaßt.
Er hatte eine kindliche Wangenhaut, übersät mit Pickelchen und bewachsen mit ergrauten, verwahrlosten Bartbüscheln – wie ein schlecht abgesengtes Hähnchen. Er war erbärmlich klein und in Lumpen gekleidet. Pljuschkin hätte neben ihm wie ein Salonlöwe ausgesehen. Sein Spitznäschen schnupperte und schnoberte unausgesetzt herum – wenn nicht ein Manuskript, gab es vielleicht ein Foto zu ergattern. Es schien, als habe es ihn schon immer gegeben – nicht einmal eine Blase der Erde, nein, der Schimmel der Zeit, eine Ausgeburt von Gemeinschaftsküchengezänk, Gespensterrascheln und Spinnwebecken. Man meint, es sei eine Staubschicht, nein, er hockt schon eine Stunde lang in der Ecke.
Er hauste in der Kirowstraße in einer kleinen Rumpelkammer.
Es stank nach Mäusen, Licht gab es keins. Das einzige Fenster war verdreckt und bis oben hin verbarrikadiert – mit Gerümpel, Bündeln, halbgeleerten Konservenbüchsen, jahrzehntealtem Staub –, und dort verbarg er, wie ein Eichhörnchen Pilze und Beeren hortet, seine Schätze: antiquarische Bücher und Manuskripte.
Fragte man ihn zum Beispiel: „Alexej Jelissejitsch, haben Sie zufällig die Erstausgabe von ,Wjorsty‘?“,5 so knurrte er: „Drehen Sie sich mal um.“ Und durch die verstaubte Glastür des Schranks sieht man, wie er behende, plötzlich verjüngt, hinter einem mottenzerfressenen Mantel die wertvolle Broschüre hervorkramt. Er gab seine Schätze spottbillig her.
Vielleicht war er schon übergeschnappt. Er stahl Bücher. Sein Auftauchen galt als böses Omen.
Um lange zu leben, nahm er, wenn er außer Haus ging, den Mund voll warmen Tee und eingeweichtes Weißbrot. Er schwieg, bis der Tee abgekühlt war, oder brabbelte, über die Pfützen hüpfend, etwas Unverständliches durch die Nase. Er kaufte buchstäblich alles. Auf Vorrat. Klebte es in Mappen und verscheuerte sie ans Archiv. Er brachte es sogar fertig, einige von meinen Kladden zu verscherbeln, obwohl ich noch kein museales Alter erreicht hatte. Und war stolz, wenn er in einem Wörterbuch das Wort „Saúmnik“6 fand.
Er verschacherte Chlebnikows Manuskripte. Breitete sie sorgfältig auf dem Tisch aus und glättete sie wie ein Zuschneider. „Für wieviel möchten Sie?“ fragte er geschäftig. „Für drei Zehner.“ Und flink wie ein Stoffverkäufer maß er ein Manuskriptstück ab und schnippelte es mit der Schere durch – genau für dreißig Rubel.
Seinerzeit war er der Rimbaud des russischen Futurismus gewesen. Schöpfer der Saum-Sprache, des „Dür bul schschül“, gab er über Nacht das Schreiben auf, weil er sich der anbrechenden Zeit des Klassizismus nicht anpassen konnte oder wollte. Rimbaud hatte ja auch in demselben Alter die Poesie an den Nagel gehängt, um sich mit Handelsgeschäften zu befassen. Krutschonych hatte einst geschrieben:
Vergaß, mich aufzuhängen,
Fliege
Amerika.
Er war hervorragend gebildet und konnte Gogol, diesen geweihten Born der Futuristen, seitenlang auswendig zitieren.
Wie ein bemoostes Gespenst, wie ein schleichender Vampir drang er ohne das mindeste Geräusch in die Wohnung ein. Großmutter kniff argwöhnisch die Lippen zusammen. Er bettelte mit tränenden Augen und quäkte, wenn ihm der Sinn danach stand, plötzlich seinen „Frühling mit Naschereien“. Diese Verse mit all ihren im Russischen seltenen Lauten „ch“, „stsch“, ,ju“ „trugen des Frühlings Stempel, wenn in der Mißgestalt die Schönheit gärt“.
Zuerst freilich sträubt er sich, brummelt dümmlich und grunzt, der Heuchler, reibt sich aus unerfindlichen Gründen die Augen mit einem Schnupftuch von vorsintflutlicher Jungfräulichkeit, das einem öligen Putzlappen gleicht, mit dem Kraftfahrer den Motor reinigen.
Dann aber ist der Blick blank gerieben, und siehe da – er ist perlgrau, sogar blau! Er reckt und streckt sich und hüpft, wie das Hähnchen in Puschkins Märchen, führt den Handteller mit der Kante an die Lippen, wie einen Hahnenkamm, jetzt strafft sich die Hand, und es geht los. Seine Stimme ist überraschend hoch und von solch überirdischer Klarheit, wie sie sich die Solisten der Pop-Ensembles heute erträumen.
,Juuiza“, hebt er an, und dir läuft das Wasser im Mund zusammen, so klar siehst du die gefärbten, auf dem Tischtuch kreiselnden Ostereier. „Chljustra“, grunzt er, und es ist wie das aalglatte Klirren von Kristall. „Suchchr“, klingt es marktschreierisch, und es kitzelt dir den Gaumen und knirscht auf den Zähnen von kandierten Dattelpflaumen, Nüssen, grünfarbenem Rachatlukum und all den sonstigen orientalischen Leckereien. Aber das Schönste kommt noch. Sich auf den Zehenspitzen reckend, den Mund wie zu einem Kuß oder Pfiff gespitzt, vor allerhöchster Qual oder Wollust verschmachtend, tiriliert er mit unglaublich hoher, brillantenfeiner Stimme:
Misjun, misjun!
Und alles schwingt mit in diesem „misjun“: milchweiße Fräulein, die mit niedlich abgespreiztem kleinem Finger manierlich Rosinen aus zierlichen Schalen nehmen; die bestrickende Frühlingsmelodie des Misgir und der Snegurotschka; und auch jene wehmütige Stimme der russischen Seele und des russischen Lebens, jenes Hangen und Bangen, jener Nachklang verlorener Illusionen, wie er vernehmbar wird in der Gestalt der Lika Misinowa und im „Haus mit dem Zwischenstock“ – dieser von dem ganzen verpfuschten Leben ausgehauchte Ruf:
Missjus, wo bist du?
Er erstarrt, die Handkante noch an den Lippen, als lausche er auf einen Nachhall aus seiner Jugendzeit, ist wieder der schlanke grauäugige Prinz, wieder die Morgenflöte des russischen Futurismus – Alexej Jelissejewitsch Krutschonych.
Mag sein, er wurde ein Schacherer, ein Taschendieb und Schieber. Nur eines verschacherte er nicht: seine Note in der Poesie. Er hörte einfach auf zu schreiben. Die Poesie war ihm nur in seiner Jugend hold. Mit ihr allein blieb er sauber und ehrlich.
Misjun, wo bist du?
Warum müssen Dichter sterben?
Warum brach der erste Weltkrieg aus? Weil man einen Erzherzog abgeknallt hatte? Und wenn er verschlafen und es ihn nicht erwischt hätte? Wäre der Krieg dann nicht ausgebrochen? Nein, es gibt keine Zufälligkeiten, es gibt Prozesse der Zeit und der Geschichte.
„Ein Genie stirbt zur rechten Zeit“, pflegte Pasternaks Lehrer Skrjabin zu sagen, der ums Leben kam, weil er ein Pickelchen auf seiner Lippe aufgekratzt hatte. Von Pasternak soll jemand gesagt haben:
Rührt diesen Narren in Christo nicht an!
Vielleicht lag es an der Biologie des Geistes, die bei Pasternak mit der Zeit übereinstimmte und die jenem unentbehrlich war?
In jener Zeit voll Sturmgebraus
– Ihr saht sie und ihr kennt sie –
Hob mich aus Reih und Glied heraus
Die Wucht der Elemente.
Wir sprachen einmal über sein Gedicht „Schneesturm“. Erinnern Sie sich? „Im Vorort, wohin noch niemand den Fuß hat gesetzt…“ Dann wird die Zeile verschoben: „Doch halt, im Vorort, wohin noch niemand…“ und so weiter, und das weckt die lebhafte Empfindung züngelnder Schneeschlangen, sich bewegenden Schnees. Und mit der Zeile bewegt sich die Zeit.
Er sagte, das Formproblem im Gedicht sei wie das „Beil in der Suppe“.7 Später vergißt man es gänzlich, aber das „Beil“ muß sein. Du stellst dir ein Formproblem, und dieses emaniert dann eine Kraft, eine Energie, die schon nicht mehr die Form berührt, sondern den Geist und andere Probleme.
Die Form ist ein Propeller, der die Luft, das Weltall in Schwung versetzt – nennt es Geist, wenn ihr wollt. Und dieser Propeller muß stark und präzise sein.
Bei Pasternak gibt es keine schwachen Gedichte. Vielleicht ein Dutzend weniger geglückte – aber keine schlechten! Wie sehr unterscheidet er sich von gewissen Reimeschmieden, die mit ein, zwei beachtlichen Versen in die Literatur kommen – und mit einem Wust farbloser mittelmäßiger Erzeugnisse. Er hatte recht: wozu schlecht schreiben, wenn man präzise schreiben kann, das heißt – gut! Dabei geht es nicht um den Triumph der Form schlechthin – sind nicht auch das Leben, die Gottheit, der Sinngehalt die Form des Gedichts? „Das Buch ist ein Würfel schwelenden Gewissens“, sagte er einmal. Das findet man besonders in seinem Band Ausgewählte Gedichte bestätigt. Hie und da wird manchen Leser die geistige Anspannung in jedem Gedicht sogar ermüden. Es liest sich schwer, um wieviel schwerer ist es, das zu schreiben, mit alledem zu leben! Das gleiche empfindet man bei Marina Zwetajewa – das war beider Lebenspuls.
In seinen Versen reimt sich „Service“ auf „trunknes Biest“. So reimte das Leben selbst – alles war durcheinandergewürfelt:
Die Wohnung, als ob’s ein Kompottglas wär,
Steckt voller diverser Produkte:
Student, Weißnäherin, Funktionär…
In meiner Kindheit hauste unsere fünfköpfige Familie in einem einzigen Zimmer. Die restlichen fünf Zimmer bewohnten weitere sechs Familien: eine Arbeiterfamilie, die von irgendwelchen Erdölfeldern gekommen und deren Oberhaupt die scharfzüngige Praskowja war; die hochgewachsenen aristokratischen Nekljudows, sieben Personen samt Schäferhund Bagira; Ingenieur Ferapontow mit Familie; die üppige, gastfreundliche Tochter eines ehemaligen Kaufmanns und ein geschiedenes Ehepaar. Unsere Kommunalwohnung galt als unterbelegt. Im Flur hingen Bettlaken zum Trocknen.
Während der Küchenbataillen an dem mit Holz geheizten Herd glitzerten über dem Petroleumkocher Mussja Nekljudowas Ohrringe, ein Familienerbstück. Auf der Toilette pfiff der geschiedene Ehemann Arien aus der „Bajadere“ und brachte damit die Warteschlange in Rage. In diese Welt war ich hineingeboren, hier war ich glücklich und konnte mir nichts anderes vorstellen.
Pasternak hatte bis zum Jahre sechsunddreißig, bis zur Zweietagenwohnung in der Lawruschinski-Gasse, ebenfalls in einer Kommunalwohnung gehaust. Das Badezimmer wurde dort von einer anderen Familie bewohnt; wer nachts auf die Toilette ging, mußte über Schlafende steigen.
Ach, wie saftig reimt sich das Petroleumlicht der „Lampe Modell Swetlana“ auf die „Jahre des Großbauplanes“!
All das stand in seinem kleinen smaragdgrünen Gedichtheft mit der purpurroten Seidenschnur. Sämtliche Verse, die er damals schrieb, wurden von Marina Kasimirowna Baranowitsch, dem verrauchten Schutzengel seiner Manuskripte, abgetippt. Sie wohnte in der Nähe des Konservatoriums, versäumte kein einziges Skrjabin-Konzert, und wie der Atem der Tasten den Richterschen Skrjabin von dem Neuhausschen unterscheidet, hatte auch die Tastatur ihrer Schreibmaschine eine unverwechselbare Handschrift. Sie ordnete die Verse in Mappen aus orangefarbenem, smaragdgrünem und grellrotem Glanzpapier und heftete sie mit einer Seidenschnur. Schlagen wir solch ein Heft einmal auf, mein Leser. Die Kindheit treibt darin ihr Zauberwesen.
Nächtliches Dunkel weit und breit,
Und solche Herrgottsfrühe!
Der Platz liegt wie die Ewigkeit
Zwischen den stillen Häuserreihn,
Und noch sind’s tausend Jahre Zeit,
Bis jung der Tag wird glühen…
Und in der Stadt, auf engem Raum,
Da drängen sich in Scharen
Vollständig nackend Baum bei Baum,
Aufs Kirchengitter starrend.
Siehst du ihn nicht, mein Leser, den Jungen mit dem Schulranzen, wie er dem Frühlingsritual lauscht, seiner Vorahnung? Alles, was rings geschieht, gleicht so sehr dem, was in seinem Inneren vorgeht.
Entsetzen liegt in ihrem Blick.
Was Wunder! Denn die Gärten lassen
Zäune und Mauern jetzt zurück…
Diese Frühe, dieses berauschende Nacherleben der Kindheit – die Gefühlswelt eines Gymnasiasten im Moskau der Vorrevolutionszeit; alles ist voller Geheimnisse, hinter jeder Ecke wartet ein Wunder, die Bäume sind beseelt, und du hast teil an der Palmsonntagswahrsagerei. Wie tief empfunden ist hier die Kindheit des Menschengeschlechts an der Schwelle vom Heidentum zur Vorahnung neuer Wahrheiten!
Diese handgeschriebenen Zeilen gab er mir zusammen mit anderen, die mit der gleichen purpurnen Seidenschnur geheftet waren. Zeilen von magischer Kraft. Damals beherrschte der Herbst seine Seele.
Wie in einer Galerie –
Säle, Säle, Säle, Säle
Voller Ulmen, Eschen, Espen, die
Golden prangen, nicht zu zählen…
Zu jener Zeit träumte ich von der Architekturhochschule, besuchte die Zeichenkurse, aquarellierte, war ganz der Magie der Malerei ausgeliefert. Im Moskauer Puschkin-Museum wurden damals die Werke der Dresdner Galerie ausgestellt, bevor man sie nach Dresden zurückführte. In der anliegenden Wolchonkastraße staute sich die Menschenmenge. Besucherliebling war die „Sixtinische Madonna“.
Ich weiß noch, wie ich inmitten der Menge versteinert vor der Schwebenden stand. Der dunkle Hintergrund, von dem sich die Gestalt abhebt, besteht aus unzähligen miteinander verschmelzenden Engelchen, der Betrachter wird ihrer zuerst gar nicht gewahr. Das dunkle Schutzglas spiegelte die Gesichter der vor dem Bild Verharrenden. Und so sah man alles zugleich: die Umrisse der Madonna, die Engelsfrätzlein und darüber die ergriffenen Gesichter der Betrachter. Die Gesichter der Moskauer gingen in das Gemälde ein, füllten es aus, verschmolzen mit ihm, wurden gleichsam Teil des Meisterwerks.
Wohl nie zuvor hatte die Madonna solche Menschenmassen gesehen. Die „Sixtinka“ konkurrierte mit der Massenkultur. Und gleich ihr flatterte auch das reizende „Schokoladenmädchen“ mit dem winzigen Tablett aus dem Pastell herab und machte auf Wachstüchern und Reproduktionen die Runde durch Stadt und Land.
„Der Trunkene ist mächtig!“ stieß hinter mir begeistert ein Mann aus. Unter dem Bild stand „Der trunkene Silen“.8
Moskau war erschüttert von der geistigen und gestalterischen Kraft eines Rembrandt, Cranach und Vermeer van Delft. Die „Heimkehr des verlorenen Sohnes“ und das „Abendmahl“ gingen in das Alltagsleben ein. Hunderttausenden Moskauern tat sich die Weltmalerei und zugleich die großartige Macht ihrer Ideen auf.
Pasternaks Verse in dem Heft mit der Seidenschnur handelten von den gleichen ewigen Themen – Menschlichkeit, Offenbarung, Leben, Reue, Tod und Hingabe.
Und sämtliche Träume der Zeiten, die Welten
Und all der Museen und Sammlungen Zukunft…
All diese großen quälenden Fragen stellten sich auch Michelangelo und Wrubel, Matisse und Nesterow, indem sie aus dem Alten und Neuen Testament Gleichnisse für ihre Gemälde entliehen. Und gleich ihnen gestaltete Pasternak diese Themen in seinen Versen keineswegs modernistisch, wie etwa Salvador Dali. Er arbeitete in der strengen Manier eines Realisten, mit klassisch zurückhaltenden Farbtönen. Wie Brueghels Weihnachtslandschaft mit holländischen Bauern besiedelt ist, füllte der Dichter seine Fresken mit Gegenständen und Dingen seiner Umgebung, seines Milieus.
Wie russisch, ja typisch moskauisch ist seine Maria Magdalena, die aus einem Eimer die Füße des geliebten Leibes wäscht.
Wie ein Schleier fiel mir auf die Augen
Meines losen Haares Lockenfülle.
Ich habe mir seine Magdalena schon immer auf unsere Art dunkelblond vorgestellt, mit gelöstem, bis zu den Ellbogen reichendem Haar.
Jene hellen Locken warfen
In die Kindheit uns zurück…
Und nur ein Weiser, ein Kenner des Frauenherzens konnte schreiben:
Allzu vielen öffnest du die Arme,
An des Kreuzes Querbalken gestreckt!
Welch leidvoll aufstöhnendes Gleichnis! Welch verzückte Trauer schwingt darin mit, entsagender Abschiedsschmerz, eine Ahnung von dem menschlichen Unvermögen, die Gebärde des Universums zu begreifen, welcher Stolz auf die hohe Berufung des geliebten Menschen und zugleich die nach außen drängende, sich verratende Eifersucht der Frau, ihre Klage, daß er sich den Menschen schenken wird und nicht ihr, ihr allein!
Der Künstler schildert das Leben, seine Umgebung und seine Nächsten, und nur so dringt er zum Sinn der Weltschöpfung vor. Als Farbe, als Material dient ihm das Leben, sein eigenes einmaliges Dasein, seine eigenen Erfahrungen, sein Tun und Lassen – ihm steht kein anderer Stoff zu Gebote.
Von sämtlichen Wesenszügen, Quellen und Rätseln Pasternaks ist am wichtigsten die Kindheit.
O Kindheit! Maß der Seelentiefe,
Die alle Wälder Heimstatt nennt!
Fest wurzelnd in der Eigenliebe,
Mein Inspirator und Regent!
Sowohl „Meine Schwester – das Leben“ als auch das Poem „Das Jahr 1905“ sind vor allem rückhaltlose Gefühlsursprünglichkeit, Kindheitsbeichte, Rebellion, erstes Weltempfinden. Wie ein Kind, das der Bevormundung durch die Erwachsenen entflohen ist, liebte er Lermontow und widmete ihm sein bestes Buch.
Hier wäre von dem lyrischen Strom seines Lebens zu sprechen. In diesem lyrischen Strom taucht manches früher Gesagte mehrmals auf, erlebt eine Wiedergeburt, immer wieder meldet sich die Kindheit zu Wort, in den strengen Fresken treten Zeilen aus älteren Gedichten hervor.
Die Zauberer, Feen mit all ihren Scherzen,
Die Christbäume alle, die Märchen der Welt,
Die Ketten Lametta, das Flimmern der Kerzen,
Der Flitter, vom Lichterglanz traumhaft erhellt…
Und wütender heult der Wind aus der Steppe…
Die Apfel und alle die goldenen Kugeln…
Und als Vergleich dazu der pittoreske Reigenrhythmus seines „Walzers mit Teufelsspuk“ oder des „Walzers mit einer Träne“, dieser atemlose Ringelreihen aus der Kinderwelt:
Welch eine Pracht! Hier versagen ja
Sepia, Tusche und Tempera…
Datteln und Bücher und Nußkonfekt,
Nadeln und Spiele und Honiggebäck.
In dieser grusligen süßen Taiga –
Menschen und Dinge einander so nah.
Ich denke oft an eine Silvesterfeier bei ihm in der Lawruschinski-Gasse zurück. Pasternak strahlte inmitten seiner Gäste. Er war Christbaum und Kind zugleich. Wie Dreiecke aus Tannennadeln schoben sich die Augenbrauen von Neuhaus in die Höhe. Der älteste Sohn Shenja, noch schneidig wie ein Offizier, schien wie aus einem Spiegel aus dem Porträt herabgestiegen, das an der Wand hing und von seiner Mutter, der Malerin Jewgenija Pasternak, stammte.
Die Wohnung hatte einen Ausgang aufs Dach, zu den Sternen. Da hieß es auf alles gefaßt sein – und der Dolch hing nicht nur zur Zierde, sondern auch zur Verteidigung an der Wand.
Die Verse fingen das irdische und überirdische schwindelerregende Geheimnis der Feierstunde ein, den Feuerreigen Skrjabinschen Präludiums:
Und man löscht die Lichter, rückt die Stühle.
Maskenzug und dichtes Mummenschanz-Gewühle…
Kleider flirren, Türen schließen krachend,
Kinder plärren, junge Mütter lachen.
Durch den schmalen Spalt des Fensterrahmens
Dringt der Luftzug kalt und löscht die Flamme…
Seinen Geburtstag ignorierte er. Das war für ihn ein Tag der Trauer, und Glückwünsche verbat er sich. Ich erfand eine List, indem ich ihm einen Tag davor oder einen Tag danach – am 9. oder 11. Februar – Blumen schenkte, ohne so gegen sein Verbot zu verstoßen. Ich wollte ihn doch irgendwie trösten.
Ich verehrte ihm weiße und blutrote Alpenveilchen, mitunter auch lilafarbene Hyazinthentrichter. Sie bebten wie kreuzgeschliffene Sektgläser aus lila Kristall. Später, als Student, brachte ich’s zu einem Fliedertopf. Wie freute sich Pasternak, wie strahlte er, wenn er die Papierhülle entfernte und ein schlanker Fliederbusch mit weißen Blütentrauben zum Vorschein kam. Er liebte Flieder über alles und verzieh mir die alljährliche kleine List.
Doch wie entsetzt waren meine Eltern, als ich, ihn nachäffend, Geburtstagsfeier und Geschenke ablehnte und allen Ernstes erklärte, dies sei ein Trauertag und mir sei im Leben nichts gelungen.
Und wütender heulte der Wind aus der Steppe…
Die Äpfel und alle die goldenen Kugeln.
Es ist naiv, Pasternaks frühes und reifes Schaffen durch sein Spätwerk verdrängen zu wollen. Naiv, sich für den abgeklärten Sabolozki zu begeistern und dabei seine „Spalten“ zu verwerfen: ist doch ohne sie der amethystene Klang seines „Wacholderstrauchs“ überhaupt nicht denkbar. Das eine erwächst aus dem anderen. Ohne Pasternaks Heuschober der „Steppe“ gäbe es auch die Heuschober im „Stern der Geburt“ nicht.
Wiederholt verwendete er in den Gedichten jener Zeit das Bild des Feigenbaums.
Ich entsinne mich eines Entwurfs von Pasternak, Lili Charasowa gewidmet, die in den zwanziger Jahren an Typhus starb. Dieser Entwurf befindet sich im Archiv des georgischen Kritikers G. Margwelaschwili.
Mittelmäßigkeit ist die landläufige Bezeichnung für einfache, gewöhnliche Menschen. Dabei ist das Gewöhnliche eine lebendige Eigenschaft, die von innen kommt und erstaunlicherweise eine entfernte Ähnlichkeit mit Begabung hat. Am gewöhnlichsten sind geniale Menschen… Und noch gewöhnlicher, atemberaubend gewöhnlich, ist die Natur. Ungewöhnlich ist nur das Mittelmaß, nämlich jene Kategorie Mensch, den man als ,interessant‘ zu bezeichnen pflegt. Seit eh und je scheut er die Arbeit und schmarotzt von der Genialität, die er als schmeichelhafte Exklusivität auffaßt, während sie doch extreme, impulsive und von der eigenen, Unbegrenztheit beflügelte Normalität ist.
Später, 1936, wiederholte er dies in einer Rede auf der Vorstandssitzung des Schriftstellerverbandes in Minsk.
Hörst du es, lieber Leser? Wie „atemberaubend gewöhnlich ist die Natur“. Wie gewöhnlich war er in seinem Lebensstil, wie wahrhaft nachtigallengleich intelligent im Gegensatz zu jeglicher Taubblütigkeit, zu unfruchtbarer Protzerei und Angeberei: schlicht gekleidet, schlicht im Alltag, unauffällig wie eine Nachtigall.
Triviale Naturen begreifen nichts vom Tun und Sein des Dichters, sie deuten es im banal irdischen Sinn, meist als durch Eigennutz bedingt; sie unterstellen dem Dichter Motive, die ihnen geläufig sind: Ruhmsucht, Habgier, Mißgunst. Während doch das einzige, was dem Dichter zutiefst am Herzen liegt und was ihm zu erhalten er das Schicksal anfleht, die Fähigkeit zu schreiben ist, das heißt die Fähigkeit, zu fühlen und aufzugehen in der Harmonie des Universums. Diese Fähigkeit kann einem niemand geben und niemand nehmen.
Der Dichter bedarf dieser Fähigkeit nicht als Mittel des Erfolgs oder des Wohlstands, auch nicht zu müßigem Papierbekritzeln, sondern als seine einzige Verbindung mit dem Weltall, dem Weltgeist, wie man früher gesagt hätte, als einziges Signal von hier nach dort und von dort nach hier, als objektive Bestätigung dessen, daß sein Leben, sein Erdendasein richtig verläuft.
Jäh im Glutstrom der Legierung
Worte festgefügt in eins…
Dem Dichter ist sein eigener Weg nicht immer verständlich. Er gehorcht höheren Rufzeichen, die ihm, wie einem Flieger, die Route vorgeben.
Ich versuche hier nicht, etwas auszulegen, seinen Weg zu deuten, ich schreibe nur, was ich sah und wie ich las, was er geschrieben.
Der Teich lag verborgen von schattigen Ästen.
Ein Teil jedoch ließ sich sehr gut überblicken
Durch Baumwipfel voller Saatkrähennester.
Sie kamen von weit her…
Halt! Wir sind angekommen. Hier ist der Damm. Und das Ufer des Teichs. Und der Stamm einer gefällten Tanne. Dies alles gehört zur Biographie seines begnadeten Schaffens.
Über die Saatkrähennester in seinen Versen ließen sich Dissertationen schreiben. Sie sind sein Wahrzeichen. „Und wie verkohlte Birnen – tausend Krähen in den Ästen“, heißt es in seinem Gedicht „Zeit des Anbeginns“. Oder die geniale Grafik der Kriegsjahre:
Krähenzug in Neuner-Ordnung,
Rabenschwarzer Kreuz-Neun-Zug.
Und nun sind seine geliebten Krähen aus den Bruchweiden bei Moskau, aus Peredelkino, aufgeschwirrt und zu den schwarzbraunen Baumkronen einer klassischen Landschaft geflogen. Und haben ihre Nester dort gebaut.
Ob er meine Stimme schulte?
Er sagte mir einfach, was ihm gefiel und warum. Beispielsweise erläuterte er mir sehr eingehend den Sinn der Zeile:
Die Pranken der Epauletten packten euch bei den Schultern.
Außer der Genauigkeit des Bildes verlangte er vom Gedicht lebendigen Atem, zeitbezogene Spannung, eine Überaufgabe, all das, was er „Kraft“ nannte. Lange Zeit existierte für mich kein anderer zeitgenössischer Dichter. Was gab es da zu unterscheiden und einzustufen! Er allein – und dann alle übrigen!
Er selbst verehrte Sabolozki. Als Vorstandsmitglied des Schriftstellerverbandes hatte er seinerzeit das Poem „Wunderland Murawia“ vor einem Verriß bewahrt. Twardowski hielt er für einen überragenden Dichter, wodurch er mich von meinem Schuljungennihilismus heilte.
Es war schwer, sich seinem Kraftfeld zu entziehen.
Eines Tages, es war nach dem vormilitärischen Sommerlager für Studenten, brachte ich ihm ein Heft meiner neuen Gedichte.
Damals bereitete er seine Ausgewählten Gedichte vor. Er modelte Verse um, wetterte gegen seine frühere lockere Art und wählte nur das aus, was ihm jetzt besonders nahe war.
Von meinen Versen sagte er:
Sie haben etwas Lockeres und Metaphorisches, aber das ist noch diesseits der Grenze, und wenn sie von mir wären, würde ich sie in meinen Band aufnehmen.
Ich strahlte – Pasternak würde sie aufnehmen!
Doch als ich dann nach Hause kam, beschloß ich, das Schreiben aufzugeben. Er würde sie ja in seinen Band aufnehmen, also waren es seine und nicht meine Gedichte. Zwei Jahre lang schrieb ich nichts. Danach folgten „Goya“ und andere Verse, das waren bereits meine eigenen. „Goya“ wurde heftig kritisiert, in der Presse gab es etliche Verrisse. Der mildeste Anwurf lautete: „Formalismus.“
Für mich klang „Goya“ wie „wojna“ – „Krieg“.
Wir waren hinter den Ural evakuiert.
Der Mann, bei dem wir wohnten, Konstantin Charitonowitsch, ein pensionierter Lokführer, drahtig und rührig, aber schüchtern, wenn er angetrunken war, hatte einst seinem Bruder die Frau ausgespannt, Anna Iwanowna, eine voluminöse Sibirierin. Und so lebten sie nun in einem abgelegenen Nest, in wilder Ehe und ständiger Angst vor dem zornigen Rächer.
Wir hatten es schwer. Alle unsere Sachen waren schon gegen Eßwaren eingetauscht worden. Vater kämpfte im belagerten Leningrad, und es hieß, er sei verwundet. Wenn Mutter von der Arbeit kam, weinte sie heimlich. Und plötzlich stand der Vater da, knochendürr, unrasiert, in schwarzer Feldbluse und mit einem Segeltuchrucksack.
Der Hausherr, feierlicher und befangener als gewöhnlich, brachte auf einem Tablett zwei Gläschen Wodka und zwei kleine Scheiben Schwarzbrot mit weißen Vierecken dünngeschnittenen Specks:
Also dann – zur glücklichen Rückkehr!
Vater kippte den Wodka, wischte sich mit dem Handrücken die Lippen ab und dankte, den Speck aber gab er uns.
Dann machten wir uns an den Rucksack und fanden dort eine mattgelbe Büchse mit amerikanischem Schmorfleisch und ein Buch über einen Maler, betitelt „Goya“.
Ich wußte nichts von solch einem Maler. Aber in dem Buch wurden Partisanen erschossen, baumelten die Leiber Gehenkter, wütete der Krieg. Von den gleichen Dingen tönte tagaus, tagein der schwarze Papplautsprecher in der Küche. Vater war mit diesem Buch über die Frontlinie geflogen. Das alles verschmolz für mich in dem furchtbaren Namen: Goya.
Goya – so keuchten die Evakuierungszüge der großen Völkerwanderung, Goya – so stöhnten die Sirenen und jaulten die Bomben vor unserer Abfahrt aus Moskau, Goya – so heulten die Wölfe nachts hinter dem Dorf, Goya – so wehklagte die Nachbarin, als die Todesnachricht kam, Goya…
Diese klangreiche Erinnerung ergoß sich später in Verse, meine ersten eigenen… Mein erstes Büchlein, frisch aus der Druckerei, brachte ich ihm an seinem Begräbnistag.
Wegen eines gebrochenen Beins nahm Pasternak nicht am Krieg teil. Er fuhr jedoch freiwillig an die Front, und ihn erschütterte die spontane Kraft des Volkes in jenen Jahren. Er trug sich mit dem Gedanken, ein Drama über Soja Kosmodemjanskaja zu schreiben – über die Schülerin und über das Grauen des Krieges.
Weil ich seit früher Kinderzeit
Vom Frauenschicksal bin versehrt…
Seine Beziehung zur Frau war echt männlich und jungenhaft zugleich. Ebenso sein Verhältnis zu Georgien.
Er sammelte Stoff für einen Roman über Georgien mit der legendären Nino als Heldin, also aus der Zeit der ersten Christen, als der Kult des Mondgottes allmählich hinüberwuchs in die Riten einer neuen Kultur.
Wie sinnlich und naturnah sind doch die georgischen Bräuche! Die heilige Nino, so will es die Überlieferung, fertigte das erste Kreuz, indem sie zwei Weinreben quer übereinanderlegte und mit einer Strähne ihres langen Haares zusammenband.
In Pasternak selbst wandelte sich die pantheistische Kultur der Frühzeit in die strenge Geistigkeit der späteren Kultur. Wie im Leben existierten diese beiden Kulturen auch in seinem Wesen nebeneinander.
Etliche Male begann ich impulsiv, ein Tagebuch zu führen. Aber jedesmal hielt mein Eifer nicht lange vor. Bis heute kann ich mir das nicht verzeihen. Und auch diese hastig hingekritzelten Notizen sind in dem Wirrwarr der ständigen Umzüge verlorengegangen. Kürzlich fanden meine Angehörigen, als sie in einem Wust alter Papiere kramten, meine Aufzeichnungen von einigen Tagen.
Um die Erregung seiner Stimme, seinen alltäglichen, lebendigen Redefluß wenigstens andeutungsweise wiederzugeben, führe ich hier wahllos einige Bruchstücke seiner Monologe an, wie ich sie damals in meinem Jugendtagebuch festgehalten habe. Dabei ändere ich nichts, nur einige persönliche Details sind weggelassen. Er sprach überstürzt, fast schluchzend.
Dies sagte er am 18. August dreiundfünfzig auf einer Bank in der Grünanlage vor der Tretjakow-Galerie. Ich war gerade von meinem Sommerpraktikum zurück, und er las mir zum erstenmal seine „Weiße Nacht“, „August“ und das „Märchen“ vor – kurz, alle Gedichte dieses Zyklus.
Warten Sie schon lange? – ich komme aus einem anderen Stadtbezirk – konnte kein Taxi kriegen – ein Lieferwagen hat mich mitgenommen – was mich selbst betrifft – Sie wissen, ich bin zeitig in Peredelkino – ein sehr früher, eigenartiger, stürmischer Frühling – die Bäume noch unbelaubt, blühen aber schon – auch die Nachtigallen haben begonnen – das klingt vielleicht banal – aber ich wollte das alles mit eigenen Worten erzählen – und hier einige Entwürfe – freilich noch alles zu trocken – wie mit einem harten Bleistift – muß später umgeschrieben werden – und außerdem Goethe – im Faust waren mehrere Stellen unklar – wie sklerotisch – das Blut fließt und fließt, und plötzlich gerinnt es – Venenverstopfung – kch-kch, und kein Tropfen mehr – es gab acht solcher Stellen im Faust – und mit einemmal öffnete sich im Sommer alles – ein ständiges Fließen – so wie damals bei „Meine Schwester – das Leben“, „Zweite Geburt“ und „Der Schutzbrief“ – nachts stand ich auf – ein Gefühl der Kraft – auch als Gesunder hätte ich nicht geglaubt, daß man so arbeiten kann – da flossen die Gedichte – Marina Kasimirowna meint zwar, so geht es nicht nach dem Infarkt – andere aber sagen, das ist wie Arznei – machen Sie sich keine Sorgen – gleich lese ich Ihnen vor – hören Sie zu…
Und hier aus einem Telefongespräch eine Woche darauf:
Mir kommt da so ein Gedanke – vielleicht klingt Pasternak übersetzt besser – Nebensächliches wird in der Nachdichtung ausgemerzt – „Meine Schwester – das Leben“ ist mein erster Schrei – als hätte der Sturm das Dach fortgerissen – die Steine begannen zu sprechen – die Dinge gewannen symbolischen Sinn – damals begriffen noch nicht alle diese Verse – jetzt werden die Dinge bei ihrem Namen genannt – ja also die Nachdichtungen – früher, als ich zu komplizierten Reimen und Rhythmen griff, gelangen mir die Nachdichtungen nicht – sie waren schlecht – in der Nachdichtung ist nicht die Kraft der Form vonnöten – da bedarf es der Leichtigkeit – um den Sinn wiederzugeben – den Gehalt – warum galt Cholodkowskis Faust-Übersetzung als schwach – weil man es gewohnt war, daß in dieser Form schlechte Originalverse und auch Nachdichtungen geliefert wurden – meine Nachdichtung ist ganz natürlich – wie großartig hat man den Faust herausgebracht – meist schreien doch die Bücher – was für ein Papier! – was für ein Kleister! – was für ein Einband! – diesmal aber ist alles ideal – Gontscharows Illustrationen sind eine Pracht – ich schenke Ihnen ein Exemplar – die Widmung ist schon fertig – was macht Ihr Diplomprojekt? – habe einen Brief von Juri Sawadski bekommen – er will den Faust inszenieren.
Jetzt mal Hand aufs Herz – ist ,Trennung‘ schwächer als das andere? – wirklich nicht? – ich habe Ihr Wohlwollen verdient, aber sagen Sie’s freiheraus – nun ja, in ,Spektorski‘ ist es das gleiche – es war ja ein und dieselbe Revolution – Stassik ist hier – er ist mit seiner Frau gekommen – er leidet an Schlaflosigkeit und hat’s mit dem Magen – und mein ,Märchen‘ erinnert Sie nicht an Tschukowskis Krokodil?
Mir schweben Verse über die russischen Provinzstädte vor – etwa nach dem aufdringlichen ,Stadt‘- und ,Balladen‘-Motiv – Licht fällt aus dem Fenster auf den Schnee – die Menschen stehen auf und so weiter – Reime de la rue – das macht sich sehr gut – ich schreibe jetzt viel – alles ins Unreine – später bearbeite ich es dann – so wie in den Zeiten der Inspiration – angespornt durch die Schönheit fertiger Stellen…
Soviel ich weiß, sind diese Verse nie geschrieben worden.
Häufig verließ er sich bei der Wahl einer Variante auf den Zufall, beriet sich mit dem erstbesten. Er führte Chopin als Beispiel an, der, wenn er sich in den Varianten nicht mehr zurechtfand, sie seiner Köchin vorspielte und diejenige auswählte, die ihr am besten gefiel. Er setzte auf den Zufall.
Einer seiner Freunde hatte an der Doppelmetapher in der Strophe Anstoß genommen:
Wie man stromab die langen Flöße schifft…
Wie Lastkahn-Züge ziehn vor mein Gericht
Dann die Jahrhunderte in steter Drift.
Er änderte sie daraufhin:
… unermüdlich ziehn die Jahrhunderte in steter Drift.
Ich bat ihn, die ursprüngliche Version stehenzulassen. Er neigte wohl selbst dazu – und stellte die Zeile wieder her. Nie ließ er sich zu etwas überreden, was gegen seinen Willen war.
Das Gedicht „Hochzeit“ entstand in Peredelkino. Aus dem Wächterhäuschen waren ins Obergeschoß seines Turmes die Tschastuschki-Klänge einer Harmonika gedrungen… In die Verse flossen städtische Motive mit ein:
Schaffer, Kranzjungfern spätnachts
Bei der Braut zu Hause.
Die Harmonika, die macht
Stimmung nach dem Schmause…
Hüftewiegend schwebt im Kreis
Die Brautwerberin…
Am nächsten Tag rief er mich an.
Also, da habe ich Anna Andrejewna9 erklärt, wie Verse entstehen. Mich hatte Hochzeitstrubel geweckt. Ich spürte, daß es etwas Schönes sein mußte, versetzte mich in Gedanken dorthin zu ihnen und am Morgen stellte sich heraus – es war eine Hochzeitsfeier. (Ich zitiere nach meinem Tagebuch.)
Er wollte wissen, was ich von den Versen hielte. Es perlte darin die Frische des Morgengrauens, ein jugendlicher Rhythmus. Ich aber, Student der fünfziger Jahre, empfand die Wörter „Kranzjungfern“ und „Brautwerberin“ als fremd und veraltet, und „Schaffer“ klang mir wie „Schaffner“. Vermutlich bestätigte ich mit meinen Vorbehalten seine eigenen Zweifel. Er diktierte mir eine andere Variante durchs Telefon.
Nun zu dem, was Sie altmodisch nennen. Notieren Sie. Nein, halt! Wir nehmen auch die Brautwerberin heraus! Und statt der Archaismen am Anfang – den Ort der Handlung konkreter: „Durch den Hof von nah und fern…“
Vielleicht improvisierte er am Telefon; möglich auch, daß es eine der Rohvarianten war. Jedenfalls erschienen die Verse dann in dieser Lesart. Ich weiß noch, der Redakteur hatte Bedenken wegen der Zeilen:
Denn das Leben ist nicht mehr als ein Traum, ein Augenblick…
Heute ist das einfach unvorstellbar.
Während meines ersten Besuchs hatte er mir eine Einlaßkarte für den Zentralen Theaterklub geschenkt, wo er aus seiner Faust-Übertragung lesen sollte. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt.
Zuerst stand er in einer Gruppe, umringt von dunklen Herren- und Damenkleidern, und sein grauer Anzug schimmerte durch die Menge wie ein schüchterner Streifen nördlichen Himmels zwischen düsteren Baumstämmen. An seinem Strahlen war er zu erkennen.
Dann setzte er sich ungestüm an den Tisch. Den Vorsitz führte Michail Morosow, wohlbeleibt, dem krausköpfigen Serowschen Knaben Mika Morosow ganz und gar entwachsen. Pasternak las im Sitzen, mit Brille. Die goldenen Locken seiner Verehrerinnen erstarrten. Jemand machte sich Notizen. Ein Zwischenrufer bat, doch die „Hexenküche“ zu lesen, wo in die Nachdichtung bekanntlich echte Zauberformeln eingeflochten sind. Im Weimarer Archiv kann man heute noch nachlesen, wie der Freimaurer und Denker Goethe mittelalterliche Werke über Kabbalistik, Alchimie und schwarze Magie studierte.
Pasternak lehnte es ab, die „Hexenküche“ zu lesen. Er trug eindrucksvolle, bewegende Stellen vor:
Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang…
Mein Leid ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.
Seine Wangenknochen bebten wie dreieckige Schwingen, wenn sie vor dem Flügelschlag eng an den Körper gepreßt sind.
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?…
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.
Und je länger er las, desto plastischer trat in seinem Gesicht das Profil seiner Frühzeit hervor, wie Kirnarski es im Porträt festgehalten hat. Es strahlte das Ungestüm und die Entschlossenheit jenes Mannes aus, der sich erneut dem Leben verschrieben· hat – und diese Willenskraft verblüfft selbst einen Mephisto oder wie er sonst heißen mag: Junker Voland, Fürst der Finsternis, „Der Herr der Ratten und der Mäuse / Der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse…“
Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf;
Gleich einer alten, halbverklungnen Sage
Kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf;
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf…
Ja, er wollte bis zum Wesen vergangener Tage vordringen, bis zu ihren Urgründen, Wurzeln, ihrem Herzstück.
Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich;
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich…
Was er da vortrug, betraf ihn selbst, deshalb hatte ihn der Faust auch so gepackt. Nicht nur des Geldes wegen oder um des Ruhmes willen übersetzte er: er suchte einen Schlüssel zur Zeit, zum Alter; über sich selber schrieb er hier zu sich selbst drang er vor; auch Gretchen war die Seine und damit quälte er sich; die Zeit wollte er erneuern und das Eigentliche hob an, „als er Faust war und Phantast…“
So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar…
dröhnten fragend und fordernd die Worte des Dichters aus dem „Vorspiel auf dem Theater“ – seine eigenen Worte.
Wäre er gleich Faust vor die Wahl gestellt worden, so hätte er, glaube ich, nicht als ein Zwanzigjähriger, sondern mit vierzehn wieder neu begonnen. Wie er ja nie aufgehört hatte, ein Vierzehnjähriger zu sein.
„So, das war’s!“ Er schien zu sich gekommen und klappte das Manuskript zu. Es folgte keine Diskussion. Als wollte er sich entschuldigen, breitete er die Arme aus, denn man zerrte ihn schon irgendwohin, nach unten, vermutlich ins Restaurant. Die Fahrstuhltür schob sich vor den hellen Himmelsstreifen.
In der Goethestadt Weimar ist die ausladende Behäbigkeit des hochgelegenen Goetheschen Wohnhauses am Frauenplan durch ein unerklärliches Kompositionsgeheimnis mit der winzigen Vertikale des Gartenhauses verbunden, das, etwas abseits, wie eine Gartenstatuette allein in der Flußniederung steht. Im Frühling reicht das Hochwasser mitunter bis dorthin. Das große ist dem kleinen Haus innig zugewandt. Dieses universale Anziehungsgesetz findet seine Vollendung in der Komposition des weißen Ensembles der großen Kathedrale von Wladimir und des in einer Niederung stehenden vertikalen Kleinods am Flüßchen Nerl. Wer den Raum zwischen beiden durchschreitet, den durchdringt der lichte Strom gegenseitiger Liebe dieser schneeweißen Meisterwerke, die einander zugeneigt sind – das große dem kleinen.
Der Ozean sieht sich ganz winzig im Traum,
Etwa als wenn er ein Kolibri wäre…
Genauso war das riesige graue Wohnmassiv in der Lawruschinski-Gasse der Datsche in Peredelkino von Herzen zugetan.
Einige Jahre danach erschien die vollständige Faust-Übertragung im Goslit-Verlag. Er schenkte mir den gewichtigen kirschroten Band. Widmungen pflegte er ohne Hast zu schreiben nach reiflichem Überlegen, meist am folgenden Tag. Vierundzwanzig Stunden lang verzehrte man sich vor Ungeduld. Und welch herrliches Neujahrsgeschenk erwartete einen anderntags, welche Feinfühligkeit gegenüber dem anderen – und welch ein Vorschuß auf die Zukunft, auf das Erwachsenwerden. Irgendwelche Wörter waren ausradiert und andere neu darüber geschrieben. In den Faust schrieb er mir:
Zweiter Januar 1957 – zur Erinnerung an unsere Begegnung bei mir zu Hause am 1. Januar. Andrjuscha, daß Sie so begabt sind und empfindsam, daß Ihre Auffassung von der jahrhundertealten Erbfolge des Glücks, Kunst genannt, Ihre Gedanken, Ihre Werturteile, Ihre Seelenregungen und Wünsche so oft mit den meinen in Einklang stehen ist für mich eine große Freude und Unterstützung. Ich glaube an Sie, an Ihre Zukunft. Ich umarme Sie. Ihr B. Pasternak.
Genau zehn Jahre zuvor, im Januar 1947, hatte er mir sein erstes Buch geschenkt. Diese Widmung nun war für mich die schönste Gabe des Schicksals. Ich habe ihn vierzehn Jahre lang gekannt. Wie oft haben mich diese Worte aufgerichtet und ermutigt, und welch eine Bitterkeit welch tiefes Leid klingt aus ihnen!
Seine späten Verse werden immer reicher an Malerei; es duftet da nach Farben – nach Ocker, Bleiweiß, Sepia, Sanguina-Rot. Ihn zieht es zu den Gerüchen, die ihn einst in seines Vaters Atelier umgaben:
Ich bin vierzehn.
Die Wchutemas10
Heißen noch Bildhauerschule.
Im Flügel der Rabfak,
Ganz oben,
Ist Vaters Atelier…
Er läßt die Arbeiten seines Vaters einrahmen, hängt sie in den Zimmern auf, insbesondere die Illustrationen zu „Auferstehung“, vor allem Katjuscha und Nechljudow – so viel bedeutet ihm der Vorsatz, das Leben neu zu beginnen. Er strebt gleichsam in die Kindheit zurück, will alles von vorn beginnen, trägt sich mit dem Gedanken, den ganzen Band Meine Schwester – das Leben neu zu schreiben, behauptet, sich genau der Empfindungen zu entsinnen die seinerzeit jeweils den Anstoß gegeben haben für die Gedichte arbeitet immer wieder Verse um, die er vor dreißig Jahren geschrieben, doch nicht die Verse modelt er um – sein Leben möchte er umgestalten. Nie hat er Poesie und Leben voneinander getrennt.
Ich bin vierzehn…
Der Jahre Staub auf der Diana.
Und die Gemälde rings…
Die Klassenzimmer vollgepfropft…
Er billigte meinen Entschluß, Architektur zu studieren, da er das Literatenmilieu nicht sonderlich schätzte. Die Hochschule für Architektur befand sich genau dort, wo einst die Wchutemas untergebracht waren, und unser künftiges Atelier, das später abbrannte, lag „im Flügel der Rabfak, ganz oben“, wo „Vaters Atelier“ gewesen.
Pasternaks Bruder, Alexander Leonidowitsch, unterrichtete Konstruktion an unserer Hochschule.
Ich erzählte ihm von unserem Institut. Wir Studenten waren damals fasziniert von den Impressionisten und der neuen Malerei, die nach langjähriger Unterbrechung im Puschkin-Museum ausgestellt war. Dies deckte sich mit seinen Empfindungen beim Besuch der neueröffneten Stschukinschen Sammlung, als er noch Student war. In meiner Jugendzeit vergötterte ich Picasso. Mit atemloser Spannung verfolgten wir, wie in einem Dokumentarfilm von Clouzot der halbnackte Maître mittels eines Filzstifts Blätter, Tauben und Gesichter miteinander kreuzte. Nie hätte ich mir damals in dem verdunkelten Hörsaal träumen lassen, daß ich zehn Jahre später den großen Picasso in seinem Atelier besuchen, ihm meine Verse vortragen würde, und was alles mir von der Staffelei her die besessene kahle Schädelkugel mit den schwarzen Dreiecken der Ellbogen darüber prophezeien sollte!
„Was macht Ihr Diplomprojekt?“ steht in meinem Tagebuch Pasternaks Frage. Wenn er sich nach meinem Tun und Treiben erkundigte, kehrte er gleichsam zu seinen Uranfängen zurück.
Tag für Tag
Steht offen das Klavier.
Musizier nach Herzenslust!
Ein Nachhall seiner kindlichen musikalischen Kompositionen und wohl auch die Erinnerung an Skrjabins Warnung vor der Schädlichkeit des Improvisierens schwingt in Pasternaks frühem Gedicht „Improvisation“ mit, zu dem er jetzt zurückkehrte. Entsinnen Sie sich?
Ich atzte die Schar aus der Hand mit der Taste
Unter Flügelgeknall und metallischem Schrei.
Ich reckt mich, die Handteller ausstreckend gastlich,
Die Nacht rieb sich an meinen Armen dabei.
Und stockfinster war es. Und dies war ein Weiher,
Und die Vögel rings der „Ich liebe dich“-Art
Wären leichter zu drosseln, so schien’s, als die Schreie
Dieser gierigen Schnäbel, so schwarz und so hart.
Vielleicht meinte er, in dieser Musik, in diesem „Ich liebe dich“, ebenso wie in dem beklemmenden „Ich trink die Bitterkeit der Tuberosen“ eine Sewerjaninsche Melodie zu hören? Er war wie verjüngt, wenn er auf Sewerjanin zu sprechen kam. Er erzählte, wie er als junger Bursche, wohl mit Bobrow zusammen, zu Sewerjanin um ein Autogramm gegangen war. Man bat sie, ein wenig zu warten. Auf dem Sofa lag ein Buch mit dem Rücken nach oben. Was mochte der große Meister wohl lesen? Sie wagten, das Buch umzudrehen – es war Über den guten Ton.
Viele Jahre später sollte mir der Direktor des Spielkasinos „Caesars Palace“ in Las Vegas, ein hochgewachsener gebürtiger Este, der Sewerjanin gut gekannt hatte, ein Gedichtheft zeigen, vollgeschrieben mit verblaßten violetten Zeilen Sewerjanins, zittrigen, bald stark aufgedrückten, bald schwacher, Schriftzügen, die im Zeitalter der Kugelschreiber so seltsam anmuten.
Wie frisch, wie köstlich sind wohl jene Rosen,
Die mir das Heimatland einst wirft aufs Grab.
Das zerflossene schiefe K, von den Heftblättern zusammengepreßt, war ausgeblichen und ähnelte einer getrockneten kreuzförmigen Fliederblüte, leider auch diesmal keiner fünfblättrigen…
Das kürzlich erschienene Sewerjanin-Bändchen ist nicht sonderlich geglückt. Darin sind sowohl die schreiende Geschmacklosigkeit als auch der charakteristische Lyrismus des Dichters verwischt, der musikalisch sogar auf das Frühwerk eines Majakowski und Pasternak abfärbte, ganz zu schweigen von Bagrizki und Selwinski.
Der späte Pasternak feilte angestrengt an seinem Stil. In einem seiner früheren Gedichte ersetzte er „Manteau“ durch „Mantel“. Auch die „Improvisation“ schrieb er um; sie heißt jetzt „Improvisation auf dem Klavier“:
Ich atzte die Schar aus der Hand mit der Taste
Unter Flügelgeknall und Geplätscher und Lärmen.
Alles wußte der Leitschwan, konnt alles erfassen,
So schien es, inmitten der schreienden Schwärme.
Und stockfinster war es, und dies war ein Weiher,
Und Wellengang war, und die stolzen Schwäne
Wären leichter zu drosseln, so schien’s, als die
Unter Flügelgeknall und metallischem Schrei.
Wären leichter zu drosseln, so schien’s, als die schreiend
Sich brechenden, gellend zerflatternden Töne.
Welch heue Wucht! Auch der Ausdruck war jetzt strenger. Und doch hatten die Verse etwas eingebüßt. Vielleicht hat der Künstler kein Eigentumsrecht auf seine Schöpfungen? Was wäre geschehen, wenn Michelangelo, seinem sich verfeinernden Kunstsinn folgend, seinen David endlos verbessert hätte?
Die Künstler kehren sich häufig von ihrem früheren Schaffen ab, weil sie es für sündhaft und verfehlt halten. Das spricht von Geistesstärke, löscht aber die Schöpfungen keinesfalls aus. So erging es Tolstoi. Davon zeugt auch die Askese des späten Sabolozki. Das Alter dürstet nach einer zweiten Geburt. Als Renoir 1889 aufgefordert wurde, sich an der Ausstellung „Hundert Jahre französische bildende Kunst“ zu beteiligen, erwiderte er:
Ich will Ihnen etwas sehr Einfaches erklären: Alles, was ich bisher gemacht habe, halte ich für schlecht, und es wäre mir überaus peinlich, das alles ausgestellt zu sehen.
Für „schlecht“ hielt er nunmehr die rosagrüne Samary, den perlfarbenen Rücken der Anna, die „Schaukel“, kurz, den „ganzen Renoir“. Zum Glück konnte er die Bilder weder vernichten noch sie in der Ingresschen oder der neuen rotbraunen Manier ummalen.
Pasternak rang mit dem früheren Pasternak – „mit sich selber, mit sich selber“.
Schade ist es auch um die berühmte, vielgescholtene Zeile, die dann in aller Munde war:
Dies hier sind süße verkapselte Erbsen,
Dies sind in Schäufelchen Tränen des Weltalls…
„Schäufelchen“ nannte man anno dazumal in Moskau die Erbsenschoten. Das hätte man ohne weiteres in einer Fußnote erklären können, wie etwa Bréguet-Uhr bei Puschkin, aber die Beckmesserei der Kritikaster machte ihm so zu schaffen, daß die Zeile gegen sein Lebensende folgende Form erhielt:
Dies sind Tränen in Schoten und Schäufelchen…
Auch hier hatte er tausendmal recht! Und dennoch war etwas verlorengegangen.
Ob vag, ob belanglos der Sinn mancher Reden – es lauscht ihrem Klange ergriffen ein jeder.
Ewig schade ist es um die ausgemerzten Zeilen, wie es auch, so töricht das klingen mag, schade ist um die verschwundenen Gassen des Alten Arbat.
Überhaupt steckt in seinem Schaffen viel von Moskau mit all den Straßen und Häusern, die endlos umgebaut und umgekrempelt werden und stets von Baugerüsten verstellt sind.
Pasternak ist ein durch und durch Moskauer Dichter. Wir finden bei ihm das Gewirr der Gassen von Samoskworetschje, die Höfe und Torwege an den Tschistyje prudy und die Sperlingsberge – ihre Sprache, ihren Alltag, die Klappfenster, die Moskauer Linden, die Moskauer Gangart – „den Mantel weit offen und vor der Brust den Schal“.
Der Frühling drängt sich frech und laut
In Moskaus stille alte Villen…
Moskau ist in seinen Gedichten wie gemalt – quicklebendig die Linien, die Umgangssprache, das unbekümmerte Stilgemisch: Der Empirestil verträgt sich mit der Ropetschen Moderne und mit der Archaik des Konstruktivismus (achthundert Jahre alt und noch halbwüchsig!), und auch die Häuser scheinen nicht gebaut zu werden, sie wachsen in ganzen Vierteln empor wie wuchernde Bäume und Büsche.
Zum Unterschied vom Nördlichen Palmyra11 mit der Stetigkeit seines Baumeisters, des Klassizismus, wunderbar nach Lineal und Zirkel erschaffen, ist die Moskauer Kultur und Lebensweise spontaner, schwungvoller, sie hat etwas von der byzantinischen Ornamentik und ist dem lebendigen Element der Sprache verwandt.
Und rings ein märchenhafter Nebelschimmer,
Gleich jenen krausen Schnörkeln an den Wänden,
Den goldverzierten, der Bojarenzimmer
Und am bizarren Wassili-Blashenny.
Sein Lehrmeister war Andrej Bely, ein Moskauer im Geiste und in seiner künstlerischen Denkart. Besonders hoch schätzte er dessen Gedichtband Asche. Einmal sagte er mir, er bedaure, Alexander Block nicht persönlich begegnet zu sein, weil dieser ja in Petrograd lebte. Übrigens ist die Einteilung in Moskauer und Petersburger Dichter recht formal: in Blocks Poem „Die Zwölf“, um nur ein Beispiel zu nennen, brodelt schon das Moskauer Element. Kindliche Schwärmerei für Block ist auch vernehmbar, wenn Pasternak diesen Dichter mit einem Tannenbaum vergleicht, dessen Lichter durch das vereiste Fenster schimmern. Man hat den Jungen leibhaftig vor Augen, der von draußen durch die Eisblumen den Weihnachtsbaum bewundert.
Frühling im Land! Man sollte
Sich in die Stadt nicht trauen!
Gleich Möwen schrein dort Schollen
Brüchigen Eises, tauend.
Wir gingen vom Haus des Wissenschaftlers durch die Lebjashi-Gasse und über die Brücken zur Lawruschinski-Gasse. Auf der Moskwa war Eisgang. Er sprach unausgesetzt über Tolstoi und dessen fluchtartigen Weggang, über die Tschechowschen Jungen, über Zufälligkeit und Vorherbestimmung im Leben. Sein Pelzmantel war aufgeknöpft, die graue Karakulmütze saß schief – nein, das stimmt nicht: mein Vater hatte eine graue, seine Persianermütze aber war schwarz –, so ging er leichten, beschwingten Schritts, ein passionierter Fußgänger, allen Winden offen, wie der März in seinem Gedicht, wie Moskau um uns her. Der Atem der Schneeschmelze, das Vorgefühl naher Veränderungen hing in der Luft…
Als wären wir von Sinnen
Oder des Ungehorsams Kinder…
Die Passanten schauten sich um, sie hielten ihn wohl für betrunken.
„Man muß verlieren“, sagte er, „verlieren muß man, damit es im Leben ein Vakuum gibt. Bei mir ist nur ein Drittel von dem, was ich geschaffen, erhalten. Alles andere ist bei den Umzügen verlorengegangen. Man darf das nicht bedauern…“ Ich fügte hinzu, in Blocks Aufzeichnungen sei auch die Rede davon, daß man verlieren müsse, und zwar die Stelle, wo der Dichter von der Bibliothek erzählt, die in Schachmatowo verbrannte. „Sieh mal an!“ staunte er. „Das wußte ich gar nicht. Da hab ich also doppeltrecht!“
Wir gingen durch Torwege und Durchgangshöfe. Vor den Hauseingängen sonnten sich alte Mütterchen, Katzen und Tagediebe aalten sich gähnend nach ihren nächtlichen Mühen und glotzten uns schläfrig-wohlwollend nach.
O diese Höfe in den Samoskworetschje-Vierteln der Nachkriegszeit! Wenn man mich fragte: „Wer hat, außer dem Elternhaus, Ihre Kindheit geprägt?“, so wäre meine Antwort: „Der Hof und Pasternak!“
Die 4. Stschipkowski-Gasse! Du Welt der Dämmerstunden, der Straßenbahntrittbretter und der Straßenbahnpuffer, der Spielknöchel und der Maikäfer – dazumal gab es diese Geschöpfe ja noch. Das Scheppern leerer Konservenbüchsen, die wir durch den Hof ballerten, vermischte sich mit dem Gekreisch der „Riorita“ aus den Fenstern und dem Kratzen des auf Röntgenplatten aufgenommenen „Murka“-Schlagers, gesungen von Lestschenko.
Der Hof war Kessel, Klub und Gemeinde, war Ferne – hungrig und gerecht. Wir waren die Grünschnäbel des Hofs, das Kroppzeug, die Hüter seiner Geheimnisse und Gesetze, seiner großartigen Folklore. Wir wußten alles. An der Toreinfahrt stand Schnobel. Er hatte sich heute heldenhaft die Hand verbrüht, um eine Woche schulfrei zu bekommen. Ein Superman, biß er nun die Zähne zusammen und pinkelte, von Bewunderern umringt, auf die krebsrote, geschwollene Hand. Die neuen gelben Knobelbecher der Gebrüder D. verrieten, wer kürzlich den Laden in der Mytnaja-Straße ausgeräumt hatte.
Und dauernd knallte es im Hof. Nach dem Krieg lagen viele Schußwaffen, Patronen und Handgranaten herum, die wurden in den Wäldern um Moskau wie Pilze gesammelt. In den Hausaufgängen übten sich die Älteren im Schießen durchs Mantelfutter.
Wo seid ihr heute, ihr Idole unseres Hofs – Fiksa, Wolydja, Schka, ihr lässigen Ritter der Schmalschirmmützen? Ja, wo…
Hin und wieder durchquerte Andrej Tarkowski, mein Klassenkamerad, den Hof. Wir wußten, daß er der Sohn eines Schriftstellers, aber nicht, daß er der Sohn eines hervorragenden Dichters war und daß er selbst einmal ein berühmter Filmregisseur werden sollte. Die Familie lebte in dürftigen Verhältnissen. Andrej hatte irgendwo eine orangegelbe Jacke mit zu kurzen Ärmeln und einen breitrandigen grünen Hut aufgetrieben. So tauchte in unserem Hof der erste „Halbstarke“ auf. In dem Alltagsgrau von damals war er der einzige bunte Fleck.
Die Fahrstühle funktionierten nicht. Der tollste Spaß von uns Kindern war es, im Schacht, einen Lappen oder alten Handschuh um die Hände gewickelt, an dem geflochtenen Stahlseil vom fünften Stock hinunterzusausen. Lockerte man den Griff hin und wieder um eine Spur, so ließ sich die Fallgeschwindigkeit regulieren. Das Seil hatte an manchen Stellen Drahtspitzen. Unten angekommen, war der Fäustling zerfetzt und rauchte glimmend. Übrigens ist keinem etwas passiert.
Ein Spiel hieß „Shostotschka“. Man wickelte eine Kupfermünze in einen Lappen und schnürte ihn mit einem Bindfaden so zu, daß oben ein Büschel entstand – etwa wie Schokoladentrüffel in Papier gewickelt werden. Das war die „Shostotschka“. Sie wurde mit der Innenseite des Fußes hochgeschleudert und fiel als schmutziges Klümpchen zu Boden. Der Champion unseres Hofes brachte es bis auf 160 Schläge. Er war krummbeinig und sein Fußgelenk nach innen verrenkt. Wir beneideten ihn darum.
O unvergeßliche „Shostotschka“, du Trüffelkonfekt der Kriegszeit…
Der große Clou der Älteren waren Goldkronen, sogenannte „Fikse“, die auf gesunde Zähne gesetzt wurden, oder gar unter die Haut genähte Perlen. Was uns betraf, so begnügten wir uns mit Tätowierungen, die wir uns mit einer Schreibfeder beibrachten.
Vorladungen zur Miliz wegen Trittbrettfahrens waren gang und gäbe. Die Eltern waren tagsüber auf Arbeit. Gewöhnlich rotteten wir uns auf dem Trockenboden oder auf dem Dach zusammen. Von dort war ganz Moskau zu sehen, und von dort konnte man bequem Patronen werfen, an deren Zündkapsel ein Nagel befestigt war. Beim Aufschlagen auf den Bürgersteig explodierte der Mechanismus… Dorthin, auf den Boden, brachte mir mein älterer Freund Shirik auch einen grünen Pasternak-Band, den ersten in meinem Leben…
Pasternak lauschte meinen Berichten über unsere Hof-Epopöen mit dem begeisterten Gesicht eines Komplizen. Er war begierig auf das Leben in jeglicher Erscheinungsform.
Heute gibt es diesen Begriff von Hof nicht mehr, auch das Gemeinschaftsgefühl nicht; die Nachbarn kennen sich nicht einmal dem Namen nach. Als ich vor kurzem dort vorbeikam, erkannte ich die Stschipkowski-Gasse nicht wieder. Unsere Heiligtümer – der Zaun und der Müllhaufen – waren verschwunden. Eine Gruppe Jugendlicher klimperte etwas auf der Gitarre. Ob es nicht gar „Die Kerze“12 war, die auf dem Tischchen brannte?
Ebenso sind dank einer zauberhaften Melodie Marina Zwetajewas Verse „Sie kranken nicht an mir, das find ich schön“ in den Alltag des Landes geflattert.
Seinerzeit schrieb ich in der Zeitschrift Inostrannaja literatura über Pasternaks Nachdichtungen, über die Verbundenheit der Kulturen, und ich zitierte dabei vollständig seinen Hamlet. Sei es nun, daß die Stenotypistin oder der Setzer sich geirrt hatten, sei es, daß das „Ave, Osa“ schuld daran war – jedenfalls war aus „Abba, Vater“ ein „Ave, Vater“ geworden. Hier, mit Verspätung, die korrekte Form:
So es möglich ist, Abba, mein Vater,
Laß diesen Kelch an mir vorübergehn!
Und in dem darauffolgenden Gedicht klingt es gleichsam als Widerhall:
Er flehte in blutigem Schweiß zum Vater,
Daß dieser Todeskelch an ihm vorübergeh…
Vor kurzem hat das Museum für Völkerfreundschaft in Tbilissi Pasternaks Nachlaß erworben. Tief gerührt begrüßte ich dort wie einen alten Bekannten den Urtext seines Hamlet, den ich einst aus dem smaragdgrünen Heft auswendig gelernt hatte. Im gleichen Archiv entdeckte ich auch meinen kindlichen Brief an Pasternak. In zwei Hamlet-Strophen kündigt fernes Donnergrollen schon das Schicksal an:
Seht, dies bin ich! Auf die Bühne tretend,
Lehne ich mich still ans Türgerüst.
Fernen Donners Widerhall verrät mir
Alles, was mir noch beschieden ist.
Horch! Von weit her dringt des Dramas Lärmen,
Fünfaktig, und ich bin Bühnenheld.
Pharisäer rings! So kleinlich und erbärmlich!
Ach, das Leben ist kein Gang durchs Feld!
Der Gang durchs Feld bringt uns auf Pasternaks ausgedehnte Spaziergänge in Peredelkino.
Angezogen wie ein Handwerker oder Streckenwärter – graue Schirmmütze und dunkelblauer gummierter Gabardinemantel mit kleinkariertem schwarzweißem Futter, wie man sie damals trug, bei Schmutzwetter die Hosenbeine in die Langschäfter gesteckt –, so trat er in seinen Dicht- und Grübelstunden durch die Gartenpforte auf die Straße und ging nach links, an dem großen Feld vorbei und hinunter bis an den Bach, bisweilen auch ans andere Ufer.
Wenn er näher kam, reckten sich mit verhaltenem Atem die goldfarbenen Ahornbäume vor der Afinogenowschen Datsche. Seinerzeit hatte Jenny Afinogenowa, eine Zirkusartistin aus San Francisco, wie es hieß, die Setzlinge aus Übersee mitgebracht und längs der Allee gepflanzt. Jahre später noch loderte in ihren Goldkronen der Widerschein jenes Schiffsbrandes, in dem die Hausherrin ums Leben gekommen war.
Das sinnliche Kraftfeld des Baches, der Silberweiden, das Raunen des Waldes stimmten die Verszeilen ein. Von jenseits des Feldes schauten drei Kiefern von einer kleinen Anhöhe seinem frei ausschreitenden Gang zu. Durch die Bäume der Allee leuchtete das buntgefärbte Kirchlein wie ein glasierter Pfefferkuchen, der am Weihnachtsbaum hängt. Dort befand sich die Sommerresidenz des Patriarchen. Es kam vor, daß die Briefträgerin „Patriarch“ mit „Pasternak“ verwechselte und dem Dichter einen Brief zustellte, der an das Kirchenoberhaupt gerichtet war. Pasternak amüsierte sich darüber und strahlte wie ein Kind.
Die Äpfel und alle die goldenen Kugeln…
Und wütender heulte der Wind aus der Steppe…
Im Juni wurde er beigesetzt.
O dieses Gefühl der schrecklichen Leere in der Datsche, die bis zum Bersten mit Menschen gefüllt war. Richter hatte soeben sein Spiel beendet.
Alles verschwamm vor meinen Augen. Das Leben hatte seinen Sinn verloren. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Paustowski soll auch dagewesen sein, aber ich schreibe nur von dem wenigen, was ich damals sah. In meinem Gedächtnis tuckert Meshirows Moskwitsch, der uns dorthin brachte.
Sie trugen ihn auf den Schultern, verzichteten auf den Leichenwagen, trugen ihn von dem Haus, dem Zufluchtsort seines Lebens, an dem berühmten Feld vorbei, das er so geliebt hatte, trugen ihn zu der sanften Anhöhe mit den drei Kiefern, auf der sein Blick oft sinnend geweilt hatte.
Der Weg führte bergan. Es war windig. Wolken flogen dahin. In diesen unerträglich blauen Tag mit den dahineilenden weißen Wolken war sein Profil hineingeschnitten, von Bronze überzogen, eingefallen und schon fremd. Es bebte unmerklich bei allen Unebenheiten des Weges.
Vor ihm der überflüssige Wagen. Hinter ihm die Menge der Trauernden, keine Schriftsteller – Herbeigereiste und Ortsansässige, Zeugen und Nachbarn seiner Tage, verheulte Studenten und die in seinen Versen Verewigten. An seinem Ältesten, Shenja, traten bestürzend die Züge des Toten hervor. Asmus war wie versteinert. Fotoapparate klickten. Die Bäume traten aus den Umzäunungen, trauervoll staubte der irdische Weg, den er so viele Male zur Station gegangen.
Irgendwer trat auf eine rote Pfingstrose, die am Wegrand lag.
Ich ging nicht mit zur Datsche zurück. Er war nicht mehr dort. Er war nirgends mehr.
Da fühlten sie mit allen ihren Sinnen,
Wie jemand sprach ganz unbefangen.
Das war meine Prophetenstimme
Von einst, die dem Zerfall entgangen…
Ich erinnere mich: Eines Tages wartete ich auf ihn jenseits des Teiches von Peredelkino am Ende des langen Holzstegs, über den er kommen mußte. Er pflegte hier gegen sechs zu erscheinen – nach ihm konnte man die Uhr stellen.
Es war goldener Herbst. Die Sonne ging unter, und ihr schräger Strahl drang durch den Wald bis zu dem Teich, dem Steg und dem Wasserrand. Das andere Ende des Teichs lag hinter dem Wipfel einer Erle verborgen.
Er tauchte in einer Wegbiegung auf und näherte sich – nicht schreitend, sondern über dem Wasser schwebend. Erst Minuten später begriff ich, woran das lag. Der Dichter trug seinen dunkelblauen gummierten Regenmantel. Seine strohgelbe Hose und die hellen Segeltuchschuhe waren von der gleichen Farbe und Tönung wie der frischgehobelte Holzsteg. Seine Beine, seine Schritte versanken im Farbton der Planken. Ihre Bewegung war kaum zu erkennen.
Ohne den Erdboden zu berühren, über dem Wasser schwebend, näherte sich die Gestalt im losen Mantel dem Ufer. Auf seinem Gesicht spielte ein kindliches Lächeln, fragend und entzückt. Belassen wir ihn in diesem goldflimmernden herbstlichen Abendschein, mein Leser.
Und hören wir die Lieder, die er uns hinterließ.
Deutsch von Johann Warkentin
Prosa des Dichters
Der frische Lakonismus des Lebens offenbarte sich mir, er überschritt die Straße, faßte mich an der Hand und geleitete mich längs des Gehsteigs.
Boris Pasternak: „Der Schutzbrief“
Zwei Begebenheiten bestimmen Wosnessenskis Poesie: die Begegnung mit Boris Pasternak und das Studium der Architektur. Nicht daß der Jüngling in der Art des großen Mannes der russischen Dichtung begonnen hätte oder die Baukunst ihm – wie dem jungen Mandelstam – die höchste Beherrschung des Materials, die Vergeistigung des Steins, gewesen wäre. Nein: Pasternak zeigte ihm, was es heißen kann, die menschliche Existenz in jedem Augenblick als elementares Ereignis wahrzunehmen, und die Beschäftigung mit der Baukunst eröffnete ihm unerwartet Räume dazu.
Bei Pasternak traf Wosnessenski noch der Anhauch einer Glut, die zu Jahrhundertbeginn Kunst und Leben ineinander umgeschmolzen hatte – alles Leben in Kunst bei den Symbolisten, alle Kunst in Leben bei den Futuristen. Dieser Mann hatte Tolstoi, Skrjabin, Block und Bely erlebt und sich mit dem Schicksal Majakowskis und der Zwetajewa, Mandelstams und der Achmatowa verbunden – seine geistige Gestalt und sein Lebensstil waren die Wirklichkeit, die lebendige Dauer jener dramatischen Übereinkünfte und Entzweiungen. Pasternaks „Schutzbrief“, in dem das alles zum erstenmal zur Sprache gekommen war, ist nach Wosnessenskis Notiz von 1968 die „Bibel“ seiner Kindheit gewesen, die er seitenlang auswendig wußte; als er dann – Jahre nach dem Tod des Dichters – seine erste Reise in die Bundesrepublik Deutschland unternahm, waren Auftritte, Fernsehen, Presse nur ein Umweg nach Marburg – in Pasternaks „Schatzkammer“, die Stadt seiner philosophischen Neigungen, die geistige Mitte des „Schutzbriefs“. Glaubte man aber Wosnessenski hier Nostalgien erlegen, so wird man durch die rigorose Wendung, mit der er das halbe Jahrhundert Abstand zwischen sich und Pasternaks Marburg überwindet, eines Besseren belehrt. „Die alte Stadt“, schreibt Wosnessenski, „war eine Inszenierung nach dem ,Schutzbrief‘“. Marburg lebte für den jungen Dichter nur auf Pasternaks Geheiß.
Es ist diese szenische, ja inszenatorische Phantasie, der das Studium der Architektur zupaß kam: Erfahrung und Annahme des Raums gipfelt in der Erfindung von Räumen. Seit Wosnessenski 1959 die Kletten-Wildheit der Moskauer Basilius-Kathedrale als den Ausgang seiner Poesie begriff und 1962 im gläsern-weltdurchlässigen New-Yorker Flughafen sein eigentliches Selbstbildnis erblickte, ist deutlich, daß sein Diplomprojekt von 1957 – ein als Spirale geführter Ausstellungspavillon – zugleich der Entwurf seiner poetischen Räume war. Der Dichter als Baumeister; der Anstrengung seiner Jugend verdankt Wosnessenski die Variabilität und Fassungskraft seiner szenischen Strukturen.
Von Anfang an ist er ein Dichter reich gegliederter Formen, die aus der Sprache die eigene Stimme, Pantomime, Tanz, Jazz, Kirchenchor, Orgel und Rock hervortreten lassen und auf die Bühne drängen. So ist seine Amerika-Dichtung von 1962, die „Dreieckige Birne“, ein verschlungener Bau aus vierzig Abschweifungen, darunter jene ironisch-philosophische, die den Namen für die erste Inszenierung seiner Poesie abgeben sollte: „Antiwelten“ – ein poetisches Spektakel, gesprochen, gesungen, getanzt im Moskauer Theater an der Taganka, achthundertmal im Hause und doppelt so oft außerhalb, 1964 konzipiert von Juri Ljubimow, klassisches Beispiel für einen szenischen Umgang mit Gedichten. 1968 dann das „Poetorio“ des Komponisten Rodion Stschedrin, das „Konzert für einen Dichter“, in dem Andrej Wosnessenskis Stimme wie ein Musikinstrument eingesetzt ist und Lichtprojektionen auf zwei Leinwänden Chor, Solisten und Orgel begleiten, wobei ursprünglich daran gedacht war, Maja Plissezkaja mehrere Passagen tanzen zu lassen. 1975 Schostakowitschs Angebot, Michelangelos Sonette für eine Komposition zu übertragen. Schließlich vor einigen Jahren Alexej Rybnikows Rock-Oper nach einem kleinen sentimentalen Versroman über die Amerika-Expedition des Wirklichen Kammerherrn Nikolai Resanow in den Jahren 1804 bis 1806, über den einst Bret Harte eine Ballade verfaßte.
Die Kunsträume, die Wosnessenski auf diese Art gewann, überwinden nicht nur die Barrieren zwischen den Kunstgattungen, sondern verändern die Wahrnehmung. Auf weniger ist der Dichter auch nicht ausgewesen. Er habe immer geglaubt, schreibt er 1971, daß eine Poesie, die Laut und Szene zur Synthese bringt, die Grundlage künftigen Bewußtseins bilden werde; im Plissezkaja-Porträt 1974 kehrt der Gedanke als Synthese von Laut und Linie wieder, in der Autobiographie von 1975 als Synthese von Wort, Plastik und Musik. Mit einem metaphorischen Ungestüm ohnegleichen bewerkstelligt Wosnessenski in diesen Räumen die Begegnung von geographisch und geschichtlich weit auseinanderliegenden und nie zuvor aufeinander bezogenen, geschweige denn zusammengeführten Welten. Pasternaks „Schutzbrief“ als Szenarium für Alt-Marburg. Die Pflasterbilder Lili Briks und Majakowskis als Zeitenbrücke auf dem Pariser Damm. In „Caesars Palace“, Las Vegas’ ehrgeizigem Spielerparadies, der Direktor ein glühender Verehrer von Igor Sewerjanin, der seinerzeit auch Majakowski und Pasternak beeindruckt hatte. Die ersten zwanzig Jahre des Jahrhunderts gespiegelt in seinen letzten, den zwanzig Jahren bis zum Jahrhundertende. In jedem Augenblick auch alles Vergangene gegenwärtig: Für die Prosa des Dichters gilt das in ganz besonderem Maße.
Prosa schreibt Wosnessenski seit seinem Debüt. Eigenwillige Reiseprosa meist, die in frappierender Kürze den Originaleindruck des Fremden bieten. 1961 – „15.000 Fragen“, das Amerika der Beatniks, die auf dem New-Yorker Washington Square ihr großes Meeting abhielten, Allen Ginsberg ihr Dichter – „wie der junge Majakowski“. 1967 – „Die Engel des Schmutzes“, das Florenz der Überschwemmung. 1971 – „Aus dem Vancouver-Heft“, Kanada, Konfrontation auch mit dem Schicksal des russischen Expeditionsreisenden von vor hundertfünfzig Jahren, dem Helden der dort geschriebenen Rock-Oper-Story. Auch die andere Art Prosa, die Wosnessenski pflegt, ist von der Unverblümtheit seiner Reisenotizen: Es sind Künstlerporträts – etwa vom Amerikaner Robert Lowell 1970, vom Armenier Paruir Sewak 1971, von der Russin Maja Plissezkaja 1974, „Mein Michelangelo“ 1975, ein Debütbeistand für junge sowjetische Dichter, „Qualen der Muse“, 1976, darin die Sätze:
Begabungen entstehen in Plejaden. Die Astrophysiker der Tschishewski-Schule erklären ihre Gemeinsamkeit mit der Einwirkung der Sonnenaktivität auf die Biomasse, die Soziologen mit gesellschaftlichen Umbrüchen, die Philosophen mit dem geistigen Rhythmus. Es könnte scheinen, als wäre die Poesie der zwanziger Jahre vorstellbar als ein phantastischer Organismus, der – eine heidnische Gottheit – über Majakowskis Potenz, Jessenins Herz, Pasternaks Intellekt, Sabolozkis Auge und Chlebnikows Unterbewußtsein verfügt. Glücklicherweise geht das nur auf den Kollagen von Rodtschenko und Salvador Dali. Die wichtigste Gemeinsamkeit der Dichter besteht in ihrer Unterschiedlichkeit. Die Poesie ist eine Einmannkunst, in der das Schicksal, die Individualität manchmal bis zum äußersten getrieben ist.
Nur wer die freie erzählerische Erfindung in diesen Texten zugunsten des Tatsachenberichts oder des dienenden analytischen Engagements übersehen hatte, konnte überrascht sein, als 1980 Wosnessenskis Pasternak-Porträt „Ich bin vierzehn…“ erschien und zwei Jahre darauf „O“. Hier ist nämlich entfaltet, was zuvor zurückgehalten worden war: ein Erzählen, das Erinnerung, Lektüre und Bekenntnis zusammenführt, plötzlich sich in Porträt-Miniaturen sammelt, um dann wieder dem Strom der Assoziationen nachzugeben.
Was man bei Wosnessenski liest, unterscheidet sich nun allerdings stark von aller gewohnten sowjetischen Prosa: von der Jahrhundert-Chronik Trifonows, von dem Moralismus Tendrjakows, von der Gewissensforschung Granins, der Soziologie der russischen Bauern bei Abramow, Below und Rasputin, von der Mythenerweckung Aitmatows und den Geschichtsanalogien Okudshawas. Angesichts dieser immensen ideengeschichtlichen, ethischen, ethnographischen, mythologischen und geschichtsphilosophischen Anstrengungen könnte Wosnessenskis Versuch, das Jahrhundert durch das Schicksal seiner Künstler zu erzählen, peripher erscheinen. Aber man muß nur einmal dem Ohr und dem Auge des Dichters getraut haben, um die Wände zwischen den Zeiten und Künsten und Namen fallen zu sehen und die Welt ungeteilt zu erfahren – aus erster Hand, wie Wosnessenski sagt, oder: mit dem „frischen Lakonismus“ Pasternaks.
Die Aktionsräume, die der Dichter erfindet, variieren von Mal zu Mal, und man sieht nun auch deutlich, wie sie konstruiert sind: von innen, von der geistigen Energie her, die hier freigesetzt wird. Im Plissezkaja-Porträt ist es der Raum des Tanzes, streng gegliedert durch Tanzschritt und Tanzfigur, dabei nach allen Seiten offen, nämlich weiter zu ertanzen – irgendwo im Hintergrund nur „die reinen Linien eines Henry Moore und der Wallfahrtskirche von Ronchamp“. In der Pasternak-Prosa „Ich bin vierzehn…“ ist es der Raum der Häuslichkeit, gegeben durch die Sicht eines Knaben und Jünglings, die – man denke an Pasternaks „Shenja Lüwers’ Kindheit“ – für den Dichter selber die einzig authentische war. „Ich bin vierzehn…“ ist ein Vers aus einem Gedicht Pasternaks über seine Jugend und ist zugleich – ohne Anführungszeichen – die Auskunft über Wosnessenskis Alter im Augenblick seiner Bekanntschaft mit Pasternak. Dies schafft die Atmosphäre der Intimität, ja der Verschworenheit der beiden: der ganz junge Wosnessenski erlebt den bald sechzigjährigen Pasternak als Jüngling. Es ist das Erlebnis der vollkommenen Hingabe an die Kunst, der Selbstvergessenheit, der Strenge und Einfachheit seines Genies. Mit der Unmittelbarkeit des Jünglings schreibt der fast siebzigjährige Pasternak an den jungen Mann:
Ich bin im Krankenhaus. Diese furchtbaren Erkrankungen wiederholen sich immer öfter. Diesmal fiel sie zusammen mit Ihrem plötzlichen, ungestümen, stürmischen Eintritt in die Literatur. Ich bin so froh, daß ich das erlebe. Ich habe Ihre Art zu sehen, zu denken, sich auszudrücken immer geliebt. Aber ich hatte nicht erwartet, daß sie so bald anerkannt und gehört werden würde. Um so mehr freue ich mich über dieses Unerwartete und Ihren Triumph… Es ist mir alles so nah…
In der „O“-Prosa endlich ist es der Raum einer ironischen Science-fiction-Kolportage, erzeugt durch den Besuch eines Schwarzen Lochs, das aus der Physik der Sterne bekannt wurde als Himmelskörper mit einem so starken Gravitationsfeld, daß selbst elektromagnetische Strahlung – Licht – es nicht verlassen kann. Das noch „sehr junge“ Schwarze Loch – eine neue Wellssche „Zeitmaschine“ – bringt mit dem Übermut seiner Anziehungskraft alle irdischen Beziehungen des Dichters durcheinander: es setzt die Zeitrechnung außer Kraft, zieht Stimmen aus entschwundenen Jahrhunderten an, lenkt Flugzeuge um, saugt Gedanken ab und – Gipfel der Kolportage – ist launisch und eifersüchtig.
Wie seinerzeit die „Antiwelten“ wird auch hier die physikalische Erscheinung zum Ausgangspunkt ironischer Metaphorisierung und schafft mit dem Namen, den der Dichter diesem Schwarzen Loch gibt – „O“ – das Sujet dieser Prosa; als graphische Entsprechung trifft „O“ das übermütige Ding aus dem Kosmos einigermaßen, es läßt sich bei diesem Namen sogar ganz gut rufen; vor allem aber ist das „O“ in Wosnessenskis Sicht für das Russische schlechthin repräsentativ – nämlich als der häufigste russische Laut, der allein als selbständiges Wort die Präpositionen „gegen“, „an“, „über“, „mit“, „von“ und „um“ umfaßt und als Interjektion Entrüstung, Staunen und Ekel ausdrückt, von seinem Vorkommen in den Wurzeln, Endungen und einem halben Dutzend Präfixen ganz zu schweigen. Zwischen kosmischer Größe und „russischstem“ Laut Raum genug, die Erzählung so leicht wie sicher zu situieren.
Was Wosnessenski in der Pasternak-Prosa und im Plissezkaja-Porträt ausprobiert hatte, nämlich die wunderbare Verschränkung der Zeiten und Begegnungen zu erzählen, ohne auf die konventionellen Zugehörigkeiten und Chronologien Rücksicht zu nehmen, das ist in „O“ mit so viel artistischer Eleganz wie verschmitztem Spiel ausgeführt: Plissezkaja als die Zwetajewa des Balletts. Pasternak als der Herr einer Häuslichkeit, einer Tischrunde, die so konträre Figuren der russischen Kunstszene vereint wie Anna Achmatowa und Alexej Krutschonych, den kindlich-orthodoxen Futuristen, Erfinder des gepriesenen und geschmähten „Dür bul schschül“, einer Sprache, die ihre Bedeutung rein aus der Lautlichkeit bezog, Lautdichter vor Kurt Schwitters, Ahne Ernst Jandls. Und nun in „O“ Entwurf und erste Szenen einer Weltgemeinschaft der Künstler-Avantgarde unseres Jahrhunderts. Die Zeitreise mit dem Schwarzen Loch erlaubt den schnellen Wechsel von Henry Moore zu Picasso oder zu Schostakowitsch („O“-Namen-Künstler allesamt), zu dem Schauspieler und Sänger Wyssozki, dem Stadt-Jessenin unserer Tage, zu Wosnessenskis Lehrer in der Baukunst und immer wieder zu den Stationen und Figuren seines Weges als Dichter: Kindheit im Krieg, seine Jugend im alten Wladimir und auf den Moskauer Höfen, der Skandal um sein erstes Buch, das Studium, die Begegnung mit Juri Ljubimow und dem Taganka-Theater, das Jahr seiner grauenhaften Brechreizkrise, die Reisen nach England und Frankreich, die unablässigen Skrupel wegen des „Verrats“ an der Architektur.
Nirgends in der Literatur von heute hat jemand etwas Ähnliches versucht. Man muß bis in die beginnenden dreißiger Jahre zurück, um Vergleichbares zu finden: Pasternaks „Schutzbrief“, Mandelstams „Reise nach Armenien“ und Marina Zwetajewas Porträts von Andrej Bely, Maximilian Woloschin, Valeri Brjussow und Michail Kusmin. Es handelt sich dabei nicht um Erinnerungen, sondern um die Erzählung von einem gemeinsamen Leben, vom Leben einer Plejade, gemeinsam in dem Sinne, daß jeder der anderen Leben und Dichtung mitgemacht und mitgetragen hat. Wosnessenski ist auf dem Wege, dies für die zweite Hälfte des Jahrhunderts, für seine Generation, für die Plejade, der er zugehört, zu erzählen. Unsere Sammlung ist der Anfang.
Fritz Mierau, Oktober 1983, Nachwort
Besuch bei Boris Pasternak – September 1958
Peredelkino heißt die Ortschaft, wo der Dichter lebt. Man gelangt dorthin mit einem Lokalzug; es ist eine knapp halbstündige Reise von Moskau.
Es ist keine der üblichen traurigen Gemeinschaftssiedlungen in der Umgebung der Hauptstadt. Man hat sie sofort gern: still und freundlich liegt sie da, eingebettet in sanfte Hügelwäldchen. In den letzten Tagen hat es geregnet. Der Weg vom Bahnhof ist naß und schmutzig. Aber die Luft ist erfüllt von der Frische des Septembers. Vom Boden steigt ein betäubender Erd- und Grasgeruch auf. Der Herbst besprenkelt schon alles mit seinen Farben: gelbe Tupfen im Birkenlaub, Vogelbeerentrauben.
Eine kleine Kirche ragt aus dem Grün empor, glattes Ziegelrot mit himmelblauer Kuppel und goldenem Kreuz. Das Glockenspiel erklingt, weittragendes brüchiges Geläute – was kann es bedeuten an einem gewöhnlichen Freitagvormittag? Auf dem Friedhof gehen einige alte Frauen umher und pflegen die Gräber, hacken, jäten Unkraut – schwarze Kopftücher heben sich von der rotgelben Blumenpracht des Spätsommers ab. Es ist, als schlüge ich die erste Seite einer russischen Novelle auf, einer etwas schwermütigen Stimmungsnovelle aus der Jahrhundertwende.
Gestern war ich oben auf dem Leninberg bei Moskau, der noch Sperlingsberg hieß, als Pasternak dort vor der Revolution an einem Pfingsttag eines seiner bekanntesten lebenstrunkenen Gedichte schrieb. Damals herrschte das „Reich der Kiefer“, heute erhebt sich dort das Riesengebäude der Universität, und Schaufeln und Krane künden in einem fort vom Wunder neuer Wolkenkratzer. Das neue Moskau sucht Lebensraum nach allen Himmelsrichtungen. Hier aber… hier in Peredelkino hat sich noch ein Stück des alten Rußland erhalten, ein kleines Reservat gerade vor den Toren der hektischen Millionenstadt.
Die Erklärung ist eigentlich einfach. Der größte Teil der Ortschaft gehört, wie sich bald erweist, dem russischen Schriftstellerverband. Die Anhöhe mit der Kirche fällt steil zu einem schmalen gewundenen Bach ab. Auf der anderen Seite erblicke ich ein Schild:
Heim für schaffende Künstler.
Aus einem Birkenwald gucken viele kleine Holzhäuser hervor, die aussehen wie Kabinen auf einer schwedischen Sportanlage. Hierher können sich also die russischen Schriftsteller zurückziehen und über die sozialistischen Wirklichkeiten nachgrübeln, obwohl man annehmen würde, daß die Stille und die Aussicht auf die Kirche schwerlich die richtigen aktuellen Gedankenverbindungen vermitteln dürften.
Doch in diesem wohleingefriedeten Schriftsteller-Reservat suche ich Pasternak vergebens. Seine Villa finde ich ein Stück weiter entfernt an einem Waldessaum, in einer Reihe alter Holzvillen, kleiner Krähenschlösser mit Türmen, Erkern und Holzschnitzereien. Sie liegen alle versteckt in verwilderten Gärten, kaum sichtbar vom Wege aus. Vielleicht waren sie vor der Revolution der Sommersitz von Moskauern; jetzt gehören sie ebenfalls dem russischen Schriftstellerverband, der sie seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Hier wohnen einige der bekanntesten Sowjetdichter: Konstantin Fedin, Wsewolod Iwanow. Die dritte Villa ist Pasternaks Haus.
Auf der Treppe treffe ich einen großen Hund, den vier Kätzchen umspielen. Er bellt nicht, sondern hebt nur den Kopf und schnüffelt freundlich, als ich vorbeigehe. Er scheint an Fremde gewöhnt zu sein. Ein abgeschlossener, isolierter Elfenbeinturm ist Pasternaks Dichterklause offensichtlich nicht. Das stimmt mich hoffnungsvoll, denn ich bin auf gut Glück hierher gefahren und komme unangemeldet. Und siehe da, als der Hausherr öffnet, fordert er mich sofort zum Eintreten auf. O ja, natürlich habe er Zeit, mich zu empfangen, obwohl man, fügt er hinzu, in Moskau vielleicht etwas anderes sage – daß er krank sei, daß er beschäftigt sei, daß er niemand einlasse. Nein, das ist nicht wahr.
Vor allem sonntags steht sein Haus offen; dann kommen Bekannte und Unbekannte aus Moskau zu ihm, um ihn zu besuchen. In der letzten Zeit finden sich auch Ausländer bei ihm ein. Über diese Besuche freut er sich sehr. Er führt eine umfassende Korrespondenz mit Westeuropa. Sie nimmt ihm viel Zeit; augenblicklich arbeitet er nicht an etwas Neuem. Er erhält viele Briefe aus Deutschland, Frankreich, England. Albert Camus hat ihm geschrieben, Henri Michaux und René Char. Man bittet ihn um Kundgebungen, um Kommentare zu seiner Dichtung. Er versucht alle diese Briefe zu beantworten. „Ja“, fügt er auf meine Frage hinzu, „die meisten meiner Antwortbriefe scheinen anzukommen.“
Pasternak sieht schlank und geschmeidig aus. Sein Haar ist weiß, aber man glaubt es kaum, daß er sich den Siebzig nähert. Sein Gesicht ist faszinierend. Es hat etwas Weiches, fast Weibliches, das in dem kleinen, gleichsam verkürzten Mund gipfelt. Aber um Augen und Backenknochen liegt ein Zug der Stärke, fast etwas Wildes, Leidenschaftliches. Seine ganze Gestalt und sein Auftreten vermitteln den Eindruck von Vitalität und Dynamik.
Während ich bei ihm sitze, spricht er unaufhörlich, ohne ein Anzeichen der Ermüdung. Bisweilen macht er eine kurze Pause, sucht den roten Faden des Gesprächs; mitunter kommt er auf eine frühere Äußerung zurück und präzisiert sie. Es ist eigentlich kein Gespräch, kein Interview, Fragen sind nicht notwendig. Manchmal habe ich den Eindruck, als führe er gewissermaßen einen inneren Monolog; mein Besuch setzt nur seine Gedanken in Gang. Er spricht zu den weißen Wänden des Zimmers, zum Septemberraum, zu jedwedem, der seinen Worten lauschen mag. Über die Verhältnisse in Sowjetrußland äußert er sich ganz offen.
„Ich habe ja aus meiner Einstellung nie ein Geheimnis gemacht“, erklärt er und hält einen Augenblick inne, als erinnere er sich an einen früheren Zuhörer.
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie verletze. Sie sind vielleicht Kommunist?
Wir sitzen im „Musikzimmer“. Das ist ein kleiner Raum, der zum größten Teil von einem Flügel eingenommen wird; der Musik galt ja sein erstes großes Interesse. An den Wänden hängen Zeichnungen und Skizzen seines Vaters, des berühmten Tolstoi-Illustrators. Auch im Eßzimmer sind die Wände voll vom Werk des Vaters. Die zweistöckige Villa hat viele Zimmer, die wie in den meisten Sowjethäusern einfach und ganz unpersönlich eingerichtet sind. Der Fernsehapparat fehlt natürlich nicht.
„Ich lebe von meinen Übersetzungen“, sagt Pasternak.
Übersetzungen sind bisher bei uns sehr gut bezahlt worden. In der letzten Zeit haben sich die Bedingungen der Übersetzer allerdings etwas verschlechtert. Aber ich kann nicht klagen. Ich leide keine Not.
Augenblicklich führt das Künstlertheater übrigens seine Übersetzung von Schillers Maria Stuart auf.
Doktor Schiwago… Natürlich kommen wir darauf früher oder später. Warum hat er den Roman geschrieben? Und wie? Ach, das wäre eine lange Geschichte. Dahinter liegt ja eigentlich sein ganzes Leben, die ganze Entwicklungsgeschichte des modernen Rußland. Man merkt, in welch hohem Grade der Roman seine Gedanken beschäftigt, wie er ihn als Zusammenfassung seines Lebens, seiner schriftstellerischen Tätigkeit betrachtet. Was er vorher geschrieben hat, das interessiert ihn nicht mehr. Seine früheren Gedichte und Prosawerke… nein, davon mag er nicht reden. Er erkundigt sich nach meiner Ansicht über Doktor Schiwago, unterbricht mich jedoch sogleich:
Ich kann verstehen, wenn Sie sich, da Sie meine Gedichte gelesen haben, verwirrt fühlen, vielleicht sogar betrogen. Ein Teil meiner Kollegen reagiert so. In offiziellen Kreisen gebraucht man als Grund für die Tatsache, daß mein Roman hier nicht gedruckt worden ist, die Ausrede, es sei ein schlechter Roman, der meinem Ruf als Dichter ,schaden‘ könne. Das ist natürlich nur ein Vorwand. Ein Dichter muß sich abkehren und wandeln können, muß in der Entwicklung leben können. Ich will kein Sklave meines eigenen Namens werden.
Er erzählt, wie der Roman aus den lyrischen Stellen entstand, wie schwer es ihm fiel, sie mit dem rein Erzählerischen zu verbinden. Viel Arbeit hat ihn das gekostet; die endgültige Fassung ist kaum ein Viertel des Geschriebenen. Der Roman ist nicht auf einmal entstanden, dadurch ist seine Komposition vielleicht in gewisser Weise beeinflußt worden. Er fing ihn gleich nach dem Krieg an; aber während der Shdanowperiode ruhte die Arbeit. In dieser Zeit zirkulierten bestimmte Teile des Romans in Abschrift unter seinen Kollegen. Es kam vor, daß man bei der Verhaftung eines Schriftstellers diese Abschrift unter den Papieren fand. Man wußte, von wem sie stammte; aber man unternahm nichts. Nein, man rührte ihn nicht an.
Es gab andere Verfahren.
Er möchte in den Jahren, die ihm noch bleiben, einen neuen Roman schreiben. Dieser Roman soll einen anderen Stil haben: heller, gelöster.
Hat der Roman einen selbst biographischen Hintergrund? Wie bei der Frage nach allen Romanen: Ja und nein. Larisa, die weibliche Hauptgestalt – ja, es hat sie in Wirklichkeit gegeben.
Das war eine Frau, die mir sehr nahe stand.
Der Gedanke an einen großen Roman hat Pasternak eigentlich seit seinen ersten Jahren als Dichter begleitet. Doch vielleicht begann Doktor Schiwagos Gestalt erst in den dreißiger Jahren zu erstehen und Form anzunehmen. Pasternak berichtet von den furchtbaren Zeiten des Ausjätens. Viele seiner Freunde wurden verhaftet und verschwanden.
„Einmal kam man auch zu mir, erzählt er.
Sie kamen mit einem Papier, das ich unterschreiben sollte. Ich sollte die Maßnahme der Partei – die Hinrichtung der Generäle – gutheißen. In gewisser Weise war das ein Beweis, daß man Vertrauen zu mir hatte. Zu denjenigen, die liquidiert werden sollten, kamen sie nicht. Meine Frau war in andern Umständen. Sie weinte und bat mich, zu unterschreiben. Aber ich konnte es nicht. An jenem Tage rechnete ich mit meinem Leben ab. Ich war überzeugt, verhaftet zu werden und jetzt an der Reihe zu sein. Ich war darauf vorbereitet: All das Blut stand mir bis zum Halse, ich ertrug es nicht mehr. Es geschah jedoch nichts. Meine Kollegen hatten mich, wie ich später erfuhr, indirekt gerettet. Kein einziger hatte sich getraut, an oberster Stelle zu melden, daß ich meine Unterschrift verweigert hatte.
Bedachtsam sagt Pasternak:
Eigentlich verlangen sie so wenig. Eigentlich nur ein Ding: Daß man haßt, was man liebt, und liebt, was man verabscheut. Aber das…
er wägt die Worte, „das ist ja das schwerste von allem.“ Er wiederholt für sich selbst:
Das ist ja das schwerste von allem.
Ich erkenne ein Zitat aus Doktor Schiwago.
Den Krieg erlebte Pasternak fast als eine Befreiung, als ein Erwachen aus einem schlimmen Traum zur Wirklichkeit. Er nahm beim Luftschutz teil, veröffentlichte zum erstenmal seit vielen Jahren ein paar kleine Gedichtsammlungen und wurde aufgefordert, sich an der Arbeit des Schriftstellerverbands aktiv zu beteiligen. Vom Kriegsende erhoffte er viel.
„Ein Krieg ist ja kein Schachspiel“, sagt er, „er kann nicht einfach damit enden, daß Weiß Schwarz schlägt. Es muß etwas anderes daraus entstehen. So viele Opfer können nicht für nichts und wieder nichts gebracht werden.“
Doktor Schiwago endet optimistisch. Wie begründet er diesen Optimismus? „Ich glaube“, antwortet Pasternak, „daß Rußland nach dem Krieg zu einer Periode der Zusammenfassung gelangt ist. Etwas Neues ist im Begriff, daraus zu erwachsen, eine neue Lebensanschauung, die Erkenntnis der eigenen Kraft des Menschen, der eigenen Menschenwürde.“ Ist er immer noch optimistisch, obwohl sein Roman nicht erscheinen durfte? Ja, das ist er. Vereinzelte behördliche Vorkehrungen haben keine Bedeutung. Das Neue ist ja etwas, das dennoch weiterwächst, trotz allen administrativen Eingriffen; es wächst organisch beim Volk.
„Es gibt überhaupt bei den Menschen unserer Zeit eine neue Einstellung“, sagt Pasternak.
Ich will nur auf etwas hinweisen. Im neunzehnten Jahrhundert herrschte die Klasse der Bürger; wir erkennen es an der Literatur, vielleicht am besten an Ibsens Dramen. Der Mensch suchte seine Sicherheit im Geld, im Besitztum, in Sachwerten. Sein Traum von der Sicherheit war schwer und fest. Heute hat der Mensch eingesehen, daß der Besitz keine Sicherheit bietet.
Das haben nicht nur die Russen erfahren. In der Periode der Weltkriege, im Atomzeitalter bedeuten Sachwerte nicht mehr das gleiche für die Menschen. Wir haben zugelernt; wir sind im Dasein bloß zu Gast, sind Reisende zwischen zwei Stationen. Wir müssen unsere Sicherheit in uns selbst suchen. In unserer kurzen Lebenszeit müssen wir unser Verhältnis zu dem Dasein, das wir kurze Zeit führen, klarstellen und unseren Platz im Weltall erkennen. Sonst können wir nicht leben. Dazu gehört, wie ich die Sache ansehe, eine Abkehr von der materialistischen Lebensanschauung des neunzehnten Jahrhunderts. Dazu gehört eine Renaissance der geistigen Werte, unseres Innenlebens, der Religion. Ich meine nicht die Religion als Dogma, als Kirche ohne Lebensgefühl… verstehen Sie, was ich meine?
Zu Gast bei der Wirklichkeit.13 Ich nenne Pär Lagerkvists Namen. Pasternaks Anteilnahme regt sich. Nein, er hat noch nie von ihm gehört. Er sagt abbittend:
Sie begreifen, es ist für mich nicht leicht, mit den Ereignissen im Westen in Fühlung zu bleiben.
Er bittet mich, ihm einige von Lagerkvists Büchern zu schicken, in französischer Übersetzung. Er gedenkt der skandinavischen Literatur. Ibsen, Strindberg, Hamsun – er hat sie alle in der Jugend gelesen. Er fügt hinzu: „Aber am meisten liebte ich wohl Jens Peter Jacobsen.“ Niels Lyhnes Schöpfer… ja, das paßt zum Bilde des jungen Pasternak. Vor einiger Zeit wurde er von einem Verlag ersucht, Ibsens Peer Gynt zu übersetzen. Das war eine Aufgabe, die ihn fesselte. Er besorgte sich das Drama auf norwegisch, deutsch und englisch sowie ein norwegisch-russisches Wörterbuch. Er glaubte, daß es ihm gelingen würde, über die deutschen und englischen Übersetzungen zum Originaltext vorzudringen. Er mußte jedoch feststellen, daß seine ausgezeichneten Kenntnisse der übrigen germanischen Sprachen zum Erfassen des norwegischen Originaltextes nicht genügten. Zu seinem Bedauern mußte er die Arbeit aufgeben.
Wir gehen in den Garten hinaus, wo Obstbäume, Birken, Blumen und Kartoffeln fröhlich durcheinander wachsen. Pasternak antwortete auf meine Frage, warum er Doktor Schiwago geschrieben habe, nie direkt. Aber sein langer Monolog über sein Leben und seine Kunst hat die Antwort doch gegeben. Es ist, als hätte ich den Roman nochmals gelesen und sähe ihn nun in einem klareren Licht. Ich sehe Pasternak als einen Menschen, der sich zur Erkenntnis und Klarheit seiner selbst und seiner Beziehung zum Dasein durchgerungen hat. Der Weg dahin hat durch den Roman geführt. Er hat eine Sicherheit und innere Harmonie gefunden, die aus seinem ganzen Auftreten sprechen. Seine strenge Einstellung zu seinem früheren Werk hängt mit der Entwicklung zusammen, die er durchgemacht hat. Es war Form, lediglich Form, jetzt sucht er den Inhalt – im Leben, in der Dichtung: Inhalt. Darum ist sein Stil klar und einfach geworden und braucht keinen Dechiffrierungsschlüssel mehr. Dennoch gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen seiner früheren und späteren Dichtung: Meine Schwester, das Leben heißt seine neu erschienene erste Gedichtsammlung, und Doktor Schiwago bedeutet ja eigentlich „Doktor Lebendig“ (Pasternak bestätigt die sinnbildliche Bedeutung des Namens). Das Leben, das Leben – es steht im Mittelpunkt seiner Dichtung, nach wie vor.
Die innere Sicherheit, die Pasternak zuteil geworden ist, hat zu etwas Auffallendem geführt: Die Maßregeln, die man wegen des Falles Doktor Schiwago gegen ihn ergriffen hat, lassen ihn vollständig kalt. Bestimmte Kreise wollten ihn sogar aus dem Schriftstellerverband ausstoßen. Das würde bedeuten, daß er seine Villa verlöre, eigentlich alle Existenzmöglichkeiten. Davon spricht er, als wäre es die gleichgültigste Sache der Welt. Man findet keine Bitterkeit bei ihm, keinen Hang, sich zu beklagen, nicht das geringste Anzeichen, den Märtyrer spielen zu wollen.
Er hat mit der Sowjetmacht seit ihren Anfängen zusammengelebt, unter den verschiedensten Zeitumständen, und keiner hat ihn anzurühren gewagt. Und ich nehme an, daß man ihn auch jetzt schließlich in Frieden lassen wird. Es scheint, daß man ihn schlechthin gelten läßt, ihn hinnimmt, wie er nun einmal ist. Das dürfte man auch mit gutem Gewissen tun. Denn Pasternak ist kein Partisan, der hinter den Kampflinien der sozialistischen Wirklichkeiten Angriffe vornimmt. Er hat nicht Schule gemacht. Es gibt keine Sekte um ihn herum. Unter den sowjetrussischen Schriftstellern ist er ein Einzelgänger, ein sehr Einsamer. Das weiß er. Er weiß aber auch, daß er trotzdem zu dieser Zeit, zu diesem Lande gehört. Und vor allem: Er weiß, daß er mit etwas Ewigem verbunden ist, das sich bei keinem Volk zerstören läßt – des Menschen Suche nach Klarheit.
„Ein Dichter soll nicht propagieren, nicht moralisieren“, sagt er.
Nein, das ist nicht der Sinn meines Romans, meiner schriftstellerischen Tätigkeit. Aber ein Dichter vermag den Menschen das Leben in all seiner Fülle und Intensität zu erschließen. Und darum kann er ihnen besser als alle Friedensdeklarationen und alle amtlichen Dekrete dazu verhelfen, in unserer Zeit zu leben.
Nils Ake Nilsson, aus Boris Pasternak: Bescheidenheit und Kühnheit. Herausgegeben von Robert E. Meister, Die Arche, 1959
Porträt des jungen Pasternak (um 1913)
Er hatte große Augen, volle Lippen, einen stolzen und zugleich träumerischen Blick, eine schöne Figur, einen harmonischen Gang und eine starke und ansprechende Stimme. Und die Passanten drehten sich (ohne zu wissen, wer er war) auf der Straße unwillkürlich nach ihm um.
Georges Annenkow
Porträt von Pasternak (1956)
Pasternak wirkt wie ein Jüngling mit grauen Haaren, was vielleicht bei vielen Dichtern der Fall ist: Längliches Gesicht, ziemlich ausgeprägte Nase, leicht spöttischer Mund, alles gekrönt von einem dichten, seitlich gescheitelten Lockenschopf; ein vollständiger Anzug von gepflegtem Schnitt – jedenfalls sitz er besser als die schlotternden, flatternden Kleider, die man gewöhnlich in Rußland sieht; all das verleiht ihm ein etwas europäisches, man könnte sogar sagen, angelsächsisches Aussehen. Nur die dunklen Augen mit dem intensiven, von Traurigkeit geprägten Blick verraten seinen Ursprung: Es sind die Augen eines Menschen, der hart angefaßt, ja vom Leben schmerzlich geprüft worden ist.
Alberto Moravia
Léon Robel im Gespräch mit Andrej Wosnessenski, Sinn und Form, Heft 6, 1972
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLfG + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum
Nachrufe auf Andrej Wosnessenski: neues deutschland ✝
russland-aktuell ✝ The NYT
Zum 70. Geburtstag von Boris Pasternak:
Flg.: Ein Dichter in der Sjetsch
Die Tat, 10.2.1960
Heinz Schewe: Boris Pasternaks 70. Geburtstag
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + KLfG +
IMDb + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Keystone-SDA + IMAGO
Nachruf auf Boris Pasternak: Tat
Gennadij Ajgi zum 100. Geburtstag von Boris Pasternak
Boris Pasternak – Dokumentarfilm Teil 1/2.
Boris Pasternak – Dokumentarfilm Teil 2/2.



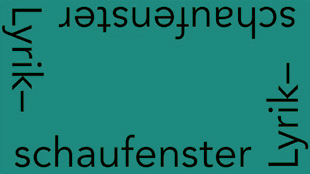
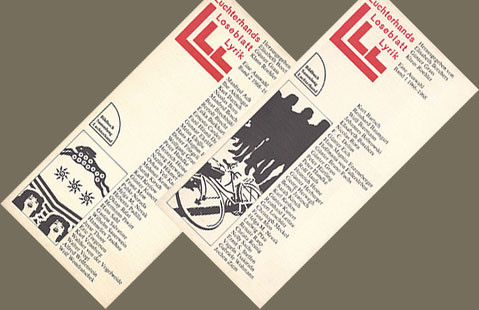



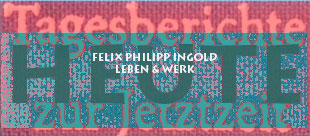
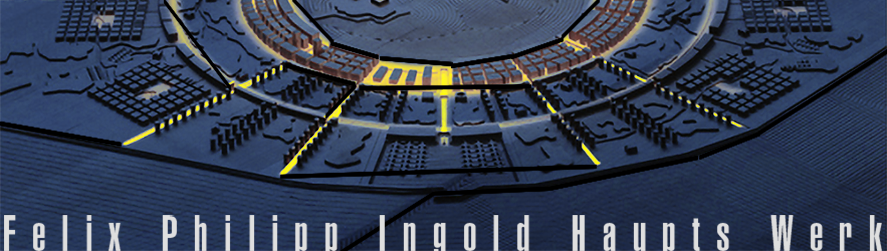
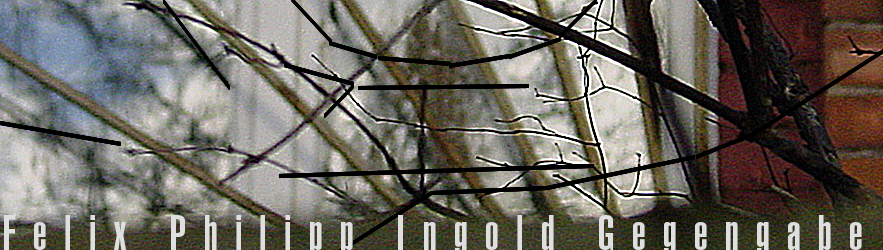
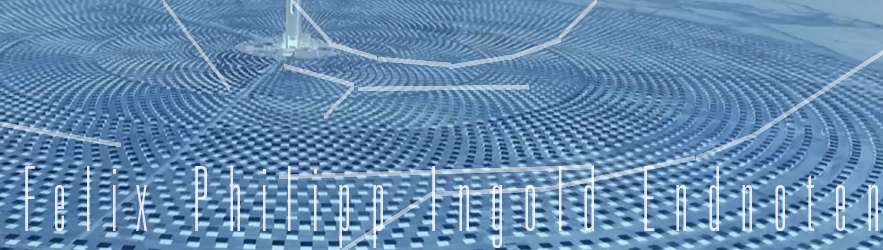

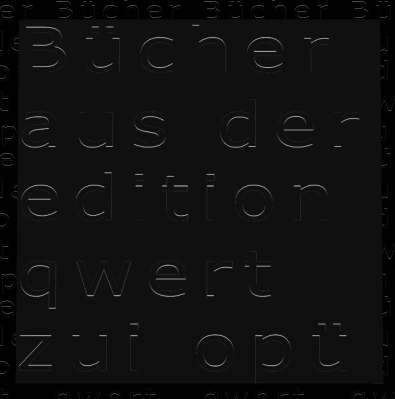
Schreibe einen Kommentar