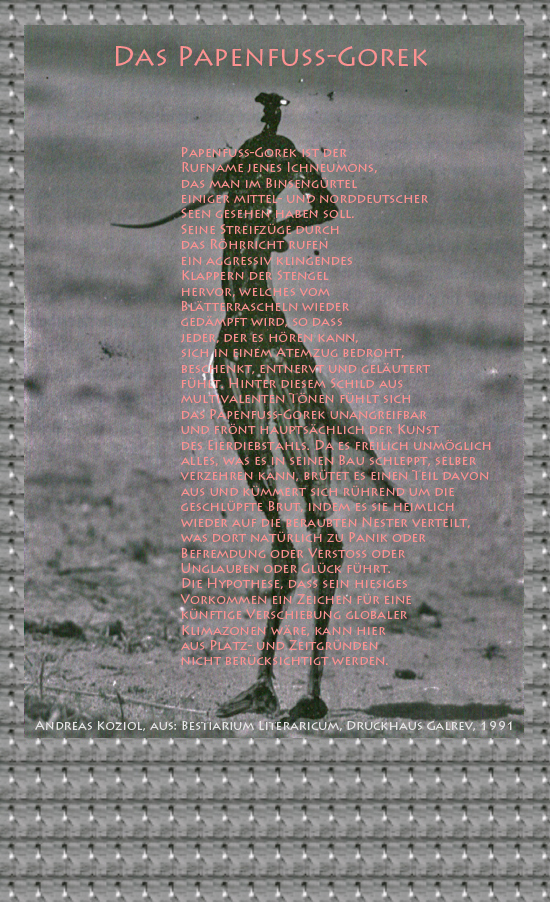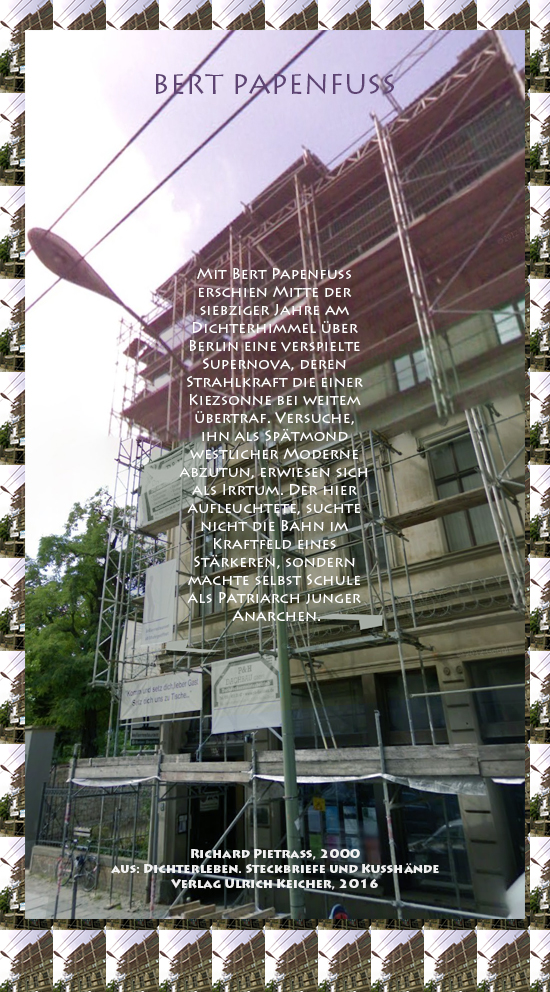Bert Papenfuß: tiské
IHR SEID EIN VOLK VON SACHSEN
so november als nur möglich
aaahabt ihr euch mal wieder erhoben
aaaaaahalswendigerweise aufgebracht
aaaaaaaaavon aufgewacht bis erwacht
aaaaaaaaaaaaseid ihr diesmal aufgebrochen
aaaaaaaaaaaaaaaeuch aufgebraucht aufzurauchen
ich sehe es ja ein, ob nun
aaasozialdemokratisch, nationalsozialistisch
aaaaaarealsozialistisch oder nationaldemokratisch
aaaaaaaaaes mußte mal wieder sein, & siehe
aaaaaaaaaaaaes ging seinen konformistischen
gründet ihr erstmal euer scheißvolk
aaaund ich dann den untergrunduntergrund
aaaaaain einem wahlweisen untergrundstaat
aaaaaaaaader mir noch den kopf zerbricht
dieser text ist ein gedicht
aaadas für die vorantrift der bastardisierung
aaaaaasprich polackisierung, sprich regionalisierung
aaaaaaaaasprich krautkrauterei spricht
aaaaaaaaaaaa& zwar sprechend, sprich
ihr seid ein pack von fischköppen
aaaradebergern, nordhäusern, richtenbergern
aaaaaaprizwalkern, flämingen & wittstöcken
genausogut könntet ihr
aaaein volk von nacktspeichern
aaaaaaaus der traufe zu heben trachten
Jammer, Jammer über alles
− Lyrik nach dem Zusammenbruch des real sprechenden Sozialismus. −
Als Mitte der siebziger Jahre in einem deutschsprachigen Gedicht plötzlich das Telephon klingelte und ein Hausbesitzer durchdrehte, die Freundin ihre Tage hatte oder nebenan der Fernseher explodierte, da nannte man das: Neue Subjektivität. Als zu Beginn der achtziger Jahre eine massenhaft dichtende Amateurliga den ästhetisch ohnehin knappen Vorsprung dieser Lyrik verspielt hatte und statt Poesie nur mehr larmoyantes Parlando produzierte, da nannte man das: Neue Schlampigkeit. So hat also auch das Schreiben von Gedichten seine Dialektik. Denn für die Profis poetischer Ertüchtigung, zumal den jüngeren unter ihnen, konnte hernach die Tendenz nur lauten: zurück zur Form.
Vor allem in der ehemaligen DDR markierten formales Experiment und Sprachkritik den Aufbruch einer jungen Generation von Lyrikern. Im Unterschied zu westlichen Verhältnissen mußten diese Autoren indes befürchten, daß ihre Texte tatsächlich so verstanden wurden, wie sie intendiert waren: als Zersetzung und Bloßlegung einer öffentlichen Sprache, in der individuelle Bedürfnisse nicht mehr vorkamen. Die Kulturpolizisten registrierten „Sinnverweigerung“ und meinten: Subversion. Denn so, wie die Worte Angriffe ihrer beäugten Poeten aufs sprachliche Monopol zielten, trafen sie immer auch ins ideologische Gebälk eines Staates, dessen Rhetorik um so hohler dröhnte, je deutlicher es im gesellschaftlichen Überbau krachte. So hat(te) auch die Sprengkraft von Gedichten ihre „Ungleichzeitigkeit“.
Seit dem 9. November 1989 ist alles anders. Und vielleicht wird der Prenzlauer Berg im Osten Berlins, seit den frühen Achtzigern das topographische Zentrum einer DDR spezifischen Subkultur aus Dichtern, Malern und Musikern, schon bald so berühmt wie der Montparnasse in Paris. Vielleicht. Ganz sicher aber wird man die Artefakte seiner Künstler nicht länger mehr nach Regimekritik und Widerstandsmut durchforsten, sondern auf ihre ästhetischen Qualitäten prüfen müssen. Erste Gelegenheit dazu bieten die neuen Gedichtbände von Jan Faktor und Bert Papenfuß-Gorek, beide von früh an der „Prenzlauer Berg Connection“ (Adolf Endler) zugehörig.
tiské nennt Bert Papenfuß-Gorek, Jahrgang 1956, seine jüngste Gedichtsammlung. Tiské? Andersherum gelesen – dem Klappentext sei Dank kommt Exit heraus. Die „Suche danach“ sei gemeint. Die Suche nach einem Aus- oder Abgang oder weg, oder was ist gemeint?
Ausgang? „hier will ich ja bleiben: aber wo“. Abgang? „wenn die schnauze proll ist & die jacke stockenprall koppheister einen hechter in den proppenvollen kanal“. Ausweg?! „ich schleiße mich ab & begebe mich aufs insondere“ Ja, was nun? „die zuckerleckerhatz sei ihnen ihr insonderes pläsierchen gewesen & in mehlschwitze hätten sie die langen traurigen wah wahs verbraten“. Papenfuß Goreks Texte sind schwierige Gebilde. Sie folgen anderen Sprachgesetzlichkeiten als den vertrauten und verschreiben sich einer eigenen Kodierung, darin den Bildern A.R. Pencks, der die Gedichte mit schwarzem Pinselstrich illustriert hat, durchaus verwandt. Die „Suche“ ist poetisches Programm, die Entschlüsselung die Botschaft. tiské weckt die Sehnsucht nach tiské, dem Sprung aus der Grammatik ins Reich einer Freiheit, das von keinen Formulierungsmodellen und Denkschablonen bevormundet wird. Denn: „kommt kommunikation auf droht langeweile“.
Klingt absolut modern, ist es aber nicht. Denn Papenfuß-Goreks Gedichte sind in Wahrheit ein Parforceritt durch die avantgardistische Ahnengalerie des 20. Jahrhunderts. So wie der Sprachmonteur vom Prenzlauer Berg sein vorgefundenes Material aus Szene- und Wissenschaftsjargon, rhetorischen Versatzstücken und Alltagsphrasen durcheinander wirbelt und in neue Wort- und Sinnzusammenhänge bringt, haben das vor ihm – von Schwitters bis Jandl – schon andere gemacht. Und es hieße, die alten Vorwürfe gegen die Formexperimente der Nierentisch Moderne noch einmal zu wiederholen, wollte man Papenfuß-Goreks Arbeiten da kritisieren, wo sie purer Wortverzückung erliegen („priemend, schmorchend, kübelnd“; „hjeld dillakfish fjüll wleff“) oder ihr Verfasser sich in esoterischer Pose gefällt („ich schließe mich ein & gebäre mich ins außergewöhnliche“). Ihren anarchischen und mitunter faszinierenden Drall haben die Gedichte aber durchaus, und zwar dann, wenn des Autors Sprachversessenheit ihre Inhalte nicht hieroglyphisch verrätselt, sondern im Gegenteil sie dynamisiert und freilegt. Dabei treten Bilder und Aussagen zutage, die in ihrer Prägnanz ungleich häufiger als in Papenfuß-Goreks früheren Texten gesellschaftspolitische Vorgänge miteinbeziehen. Das fängt an mit einer zynischen Nachlese zum 9. November („die heide wackelte ihr wart das volk“), setzt sich – bei konsequenter Kleinschreibung – fort in einem „Jammer, Jammer den kampfes- & todesmut haben sie in den delikatessenläden gelassen“) und hört mit scharfzüngigen Attacken gegen „wendegeister“ noch keineswegs auf: „die deutschen überschlagen sich, legen sie sich zusammen oder hauen sie sich in die pfanne, bzw den rest der welt“.
In tiské wird offensichtlich, daß sein Autor, dies eine weitere Lesart des anagrammatischen Titels – auch auf der „Suche“ nach einer neuen Schreibhaltung, zumindest nach flexibleren Ausdrucksformen ist. Daß nämlich mit dem Zusammenbruch des real sprechenden Sozialismus auch die Voraussetzungen für experimentelle Widerreden verschwunden sind, hat Papenfuß-Gorek erkannt: „aus des Widerstandes geborgenheit der ich so lang verlegen war muß ich mich schön schreiben“…
Michael Kothes, Die Zeit, 8.2.1991
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Michael Braun: Die „sinnfielteilung“ der Poesie
Basler Zeitung, 1.2.1991
Heinrich Vormweg: „auf wiedersehen faterland/ich such das meuterland“
Süddeutsche Zeitung, 2./3.3.1991
Annette Brockhoff: Sinnfielteilung
die tageszeitung, 6.12.1991
Jürgen Verdofsky: Wortschläge. Neue Lieder von Papenfuß
Stuttgarter Zeitung, 21.4.1995
Walter Delabar: Read loudly
Juni, Heft 1, 1991
Der Tod der Ostmoderne oder
Die BRDigung des DDR-Untergrunds:
– Zur Lyrik Bert Papenfuß-Goreks. –
Die Literatur der ehemaligen DDR ist, was die Erfassung ihrer geschichtlichen Entwicklung und Ihrer Ausdrucksformen für die 80er Jahre betrifft, noch eine Landkarte mit weißen Flecken. Dies liegt vor allem daran, daß sich die bisherige westliche Kenntnisnahme von DDR-Autoren nur an dem offiziellen Kanon des SED-Regimes oder an den Dissidenten ausrichten konnte. Mittlerweile liegen von genauen Kennern der verborgenen DDR-Literaturszene überblickshafte Darstellungen1 vor, die einer literargeschichtlichen Bestandsaufnahme der sogenannten Samizdat-Literatur, also inoffiziell und illegal publizierten Schriften, den Weg bereiten. Ich möchte jedoch im folgenden weniger auf die äußeren, historiographischen Aspekte eingehen, sondern mich vielmehr auf die Analyse einiger ausgewählter Gedichte eines Autors, nämlich Bert Papenfuß-Goreks,2 beschränken. Nur in aller Kürze soll der Hintergrund des in der Literatur thematisierten sozialen Wandels umrissen werden, da die Texte des in Berlin-Ost lebenden Lyrikers das Ende einer kollektiv erfahrenen, schriftstellerischen Praxis in der DDR reflektieren.
Schon in seinem lyrischen Tagebuch „arianrhod von der überdosis“3 (der rote Ariadnefaden der Überbau-Basis) schrieb Bert Papenfuß am 25./26.3.1988 „zögernd nur, arianrhod, habe ich mich an unser manifest gehalten / welches, nicht wahr, unklar genug war, es war nicht meine idee / unumstößlich klingt sie aus, die ära des aktiven wortspiels“ (S. 113). Unter dem Datum 7.2.1988 findet sich die Bemerkung „der untergrund ging unter, anstatt zur genüge zugrunde zu gehen“ (S. 101) Die wortspielerischen Aussagen liefern einen Hinweis darauf, wie zu Beginn des Jahres 1988 die Befindlichkeit der jungen Engagierten in Berlin-Ost zwischen Ohnmacht und Weitermachen pendelte, wobei sich der Lyriker zynisch von der „jungen opposition“ absetzt. Papenfuß’ „Opposition“ ist die radikale Selbstverwirklichung im Schreiben über sich selbst, im Aussprechen der eigenen Sexualität, im rücksichtslosen Sprechen ohne Umschreibung:
pop, wenn man’s entheikelt (S. 104).
Die Wende zu einer neuen existenziellen Position findet zwischen sozialem und „sexuellem Engagement“ des Autors statt, motiviert von der radikalen Ich-Aussprache:
es fällt mir schwer genug, meine texte als meine eignen auszugeben (S. 104).
Die ehemalige Untergrund-Literatur der Autoren des Prenzlauer Bergs (Berlin-Ost), die sich als eine Lese- und Schreibgemeinschaft durch selbstverlegte Zeitschriften und durch Lesungen in Wohnungen etabliert hatte, sieht sich einem rapiden Wandel ausgesetzt, der die eigene Existenzgrundlage betrifft. Viele Autoren werden zunehmend in die westliche, deutschsprachige literarische Öffentlichkeit eingebunden und können nun Ganzschriften publizieren, wodurch sie höhere, verkaufsorientierte Honorare erhalten. Es sind vor allem die wettbewerbsorientierten Distributionsagenturen wie Zeitung, Rundfunk oder die großen Verlage, die die Grundlage für neue kulturelle Kontexte stiften. Die literarischen Ausdrucksformen der Autoren erleben dadurch rigorose Veränderungen, was deren Funktionen, Inhalte und Formen betrifft. Die inoffizielle DDR-Literatur der 80er Jahre wird deregionalisiert, historisiert und ästhetisiert, so daß sie sich anstatt einer halböffentlichen, solidarischen Kommunikationsgemeinschaft der anonymen und absatzstrategisch angezielten Käuferschicht des Westens ausgesetzt sieht.
Der westliche Buchmarkt ersetzt die heimliche Ostberliner Leserschaft und konfrontiert die Autoren plötzlich mit postmodernen Bedingungen. Zwischen DDR-Autor und Adressat rückt die Marketingabteilung der Verlage, so daß für den Schreibenden ein neues Publikum entsteht, das sich an den internationalen Standards hinsichtlich Buchdesign, Papierqualität, Vorwortjargon oder Werbemethoden ausrichtet. Diese neue Leserschaft goutiert und sammelt die Zeugnisse des vermeintlichen oder tatsächlichen Anti-Sozialismus, so daß der interne desideologisierte Charakter der Ostmoderne erlischt. An dessen Stelle rückt nun der moralisch-politische Index „subversiv“, als kennzeichne man damit die ästhetische Gelungenheit der Werke.4
Eine adäquate Beurteilung der literarischen Texte der Schriftsteller des Prenzlauer Bergs dürfte erst durch die strukturelle Betrachtung von Einzelwerken, unter besonderer Berücksichtigung der DDR-spezifischen ästhetischen Möglichkeiten, zu gewinnen sein. Diese Blickrichtung ist allerdings zum gewissen Teil literarhistorisch motiviert, indem nun die Literaten selbst ihre Schreibweisen der 80er Jahre modifizieren; waren es zunächst die Ausreisen von Kollegen, die der Solidarität der Gruppe zusetzten, so führte schließlich die Transformation der Kommunikationsverhältnisse seit der Vereinigung beider deutschen Staaten zu einer Haltung des Selbstzweifels.
„Was bleibt“, um mit Christa Wolf zu sprechen, ist eine mittlerweile individualisierte Literatur, die zwar noch mit einer topographischen DDR-Aura versehen wird, indes schon in Autoren, Genres, Regionen zerlegt ist und mit den marktorientierten Qualitätsurteilen wie neuartig/traditionell oder subversiv/realsozialistisch einer wählerischen, anspruchsvollen Feuilletonkritik bemessen wird.
In den letzten Jahren fanden die jungen DDR-Autoren Zugang zu etablierten westlichen Literaturzeitschriften mit deren jeweils spezifischen regionalen, stilistischen Ausrichtungen und recht unterschiedlichen Auswahlkriterien. Ein Beispiel für diese Art der kulturellen Einbindung ist das Sommerheft 1990 der österreichischen Literaturzeitschrift manuskripte, in dem nun Sascha Anderson, Bert Papenfuß-Gorek und Heinz Czechowski veröffentlichten. Die Teilnahme an diesem Forum für debütierende, noch wenig oder nur regional bekannte Autoren ist bemerkenswert, da es seit seiner Entstehung die Entwicklung sprachbewußter, avantgardistischer Texte in Österreich entscheidend förderte. Die Grazer Autorengruppe hatte in den 60er Jahren unter verstockten kulturellen Bedingungen anti-traditionelle, sprachbezogene ästhetische Positionen etabliert. Wie die jungen Schriftsteller in der ostdeutschen Hauptstadt versuchten sie, etwa in Form neodadaistischer Aufführungen,5 ein innovationsfreudiges Umfeld in der Steiermark zu schaffen. Ein ähnlicher Hintergrund für eine kreative Literatur existiert(e), neben anderen Orten, im Gebiet des Prenzlauer Bergs,6 wo vergleichbare Tendenzen zur Verschmelzung von Poesie/Musik/Bildender Kunst/Performance im Verlauf der 80er Jahre entstanden, so daß man fast von einer Wahlverwandtschaft sprechen könnte. Während die Grazer Schriftsteller gegen die konservative Mentalität, Kulturpolitik und Literaturtradition in Österreich vorgingen, wendeten sich die DDR-Künstler gegen die Literaturformen und die kulturelle Praxis in einem ungleich rigideren Umfeld. Im Hinblick auf den Einbezug multimedialer Aktionsformen in der „Szene“ des Prenzlauer Bergs (aber auch in Dresden etc.) ergeben sich Parallelen zu den Auftritten Joseph Beuys, bezüglich der lyrischen Formen eine Nähe zur fulminanten Sprachartistik des Nürnberger Lyrikers Gerhard Falkner.
Bert Papenfuß-Gorek dürfte unter der jungen Generation von DDR-Autoren der inzwischen wohl bekannteste sein. Die Folge lyrischer Texte namens „tiské“7 läßt sich als ein Abschied und ein Neubeginn im literarischen Schaffen des Ostberliner Autors verstehen. Der Titel ist über das Einleitungsgedicht, gleichsam ein parodiertes Propemptikon, aufzuschließen. Man kann ihm die Anweisung entnehmen, daß die Schrift „sterbend rückwärts“ und „tot von vorn“ zu lesen sei. Sonach entspräche der Titel „tiské“ dem englischen Begriff „e-k-s-i-t“ (exit), also Ausgang, Abgang oder Ausreise.
In diesem Geleit- oder Begleit-Wort eines Arrangements von Einzelgedichten ist kaum verhohlen von dem Ende einer Autorengruppe die Rede, die sich subkutan im Verlaufe eines Jahrzehnts in der DDR entwickelt hatte. Es sind Schriftsteller, die in den 50er Jahren geboren wurden und die, ihrem Selbstverständnis nach, abseits der etablierten Staatskultur unorthodoxe Formen des Schreibens und Lebens entwickelten. Ihr Anliegen war nicht so sehr das subversive, oppositionelle Agieren gegen die offizielle Literatur oder die politische Praxis des Regimes, sondern eher der Versuch, entweder trotzig oder nahezu unbekümmert zu einer individuellen Ausdrucksweise zu finden. Es verwundert daher nicht, daß mancher Autor in dieser Phase des Vortastens im Medium Sprache die Kommunikativität bis an die Grenze des Verständlichen strapazierte. Der Einfluß linguistischer Sprachanalytik und die Adaption von Sondersprachen ging bei Papenfuß soweit, daß ein individuelles Schreibsystem entstand, welches sich für den außenstehenden Leser wie eine mittelalterliche Arkanwissenschaft ausnimmt. Es ist offensichtlich, daß sich Papenfuß ebenso wie andere Autoren seiner Generation mit ihrer Sprachauffassung implizit dem „Erbe“ der humanistischen, realistischen Schreibweisen der älteren Generation verweigerten. Unter den argwöhnischen Augen des SED-Regimes wuchs eine Autorengeneration heran, die, zwangsweise isoliert von äußeren Einflüssen, für sich selbst eine Ost-Moderne schuf. Die Klandestinität der Kesselreiniger, so der Titel eines Prosatexts von Gert Neumann, läßt sich als eine symptomatische Charakterisierung des Gruppengeistes der „Prenzlauer Berg-Connection“ (Adolf Endler) betrachten.
Auch die Gedichtfolge „tiské“, eine Veröffentlichung in einem anderen kommunikativen Bezugsfeld, weist „klandestine“ Züge auf. Neben den Anspielungen für Insider läßt sich aber ein spezifischer Umgang mit Sprache aufzeigen, der im folgenden anhand einer strukturorientierten Betrachtung erhellt werden soll, um einen Grundzug der experimentellen DDR-Lyrik zu zeigen. Ähnliche Sprachspiele finden sich bei anderen Poeten dieser Generation.
Schon zu Beginn der Folge, in dem kurzen Gedicht „zum gleit“,8 nimmt der Ostberliner Lyriker Bezug auf die Entwicklung der Schreibformen des Prenzlauer Bergs und umschreibt das Permutationsprinzip der sprachbewußten Lyrik, sowie den stilistischen Einbezug des Sexuell-Vulgären. Er übersetzt diese Gedanken in das Bild einer Bewegung, die vor und zurück, kurz und quer verläuft:
wir schreiben
im beginnen orginär, im fortlaufen orginell
über’n berg ordinär, zugrunde gar nicht mehr
überlebend kurz & quer, sterbend rückwärts; tot von vorn: (S. 92)
Die Metaphorik von Auf- und Abstieg spielt mit den konkreten und übertragenen Bedeutungen der Ortsangaben; die Aussage „über den Prenzlauer Berg schreiben (oder gehen)“ löst sich in eine zweideutige Bildlichkeit auf, die durch syntaktische Arrangements rhythmisiert wird. Indem Papenfuß einen saloppen, umgangssprachlichen Ton mit dem Wortspiel der phonetisch ähnlich lautenden Silben „origi-“ (als „orgi-“) und „ordi-“ vereint, kreiert er eine Gedichtsprache, die aus egozentrischen Wortneuprägungen und Alltagsphrasen besteht.
Die Abfolge der lyrischen Texte in den manuskripten endet mit einem offensichtlichen Verweis auf Enzensbergers „Scherenschleifer und Poeten“:9
dichter zerfallen
in orgeldreher & kritzelbuben
galeerenschleifer & scherenflicker
es gibt hervorragende hofbarden
& in der gosse auch idioten (S. 98).
Diese Strophen thematisieren die Kluft zwischen Staatsdichter und Widerstandsdichter. Zwischen den existenziellen Polen des Angewiesenseins und des Ausgewiesenseins entfaltet sich das Problem des Lebensunterhalts und des Engagements, denn „auf der anderen seite“ (im Westen) wird das verstockte Gefühl eines kritischen DDR-Autors, zumindest aus der Sicht Bert Papenfuß-Goreks, schnell zu einer euphorischen oder gemilderten Haltung. Wer in der Demokratischen Republik keine Sinekure genoß, fand oftmals in der Bundesrepublik ein förderfreudiges Verlagshaus:
jahre wechseln fronten & pfründe
derjenige im widerstand
ist nicht notwendigerweise immer
so penetrant draußen vor der tür (S. 98).
Bert Papenfuß’ Gedichte zentrieren sich nicht auf evokative, ausgesuchte Bilder und Metaphern oder auf assoziationsreiche Vokabeln der Sinneswahrnehmung und Naturerfahrung. Vielmehr wird eine subjektive Gedichtsprache geschaffen, in der Wortfelder gleichsam „umgepflügt“, d.h. neu kombiniert und optisch arrangiert werden. Um bewußt einen eigenen Tonfall zu schaffen, zerbricht Papenfuß Syntax, Orthographie und das traditionelle lyrische Formeninventar. Er schafft zwischen den kleinsten sprachlichen Einheiten, also Phonemen oder Morphemen, Bezüge, die dann nach Zeilen angeordnet werden. Durch einfachen Buchstabenaustausch, durch Zusammenstellung von Wort-Rümpfen mit gleicher Phonemprägnanz, durch die Einführung von Lexemen aus Sondersprachen werden Klanggebilde erzeugt, die erst durch die Kenntnis ihrer grammatischen Erzeugungsregeln und des Lexeminventars wieder kommunikativ funktionieren. Papenfuß-Goreks „Wort-Kombinate“, wenn man sie ironisch so bezeichnen darf, vereinen fremdsprachliche Elemente mit Jugend-, Sonder- und Umgangssprachen.
An das Geleitgedicht schließt „süßer odin“ (S. 92) an, ein Gedicht, das den altertümlichen Ausdruck „süßer odem“ mit dem Verweis auf die klassische Form der Ode und den nordischen Gott Odin verbindet. Das hymnische Formenrepertoire wird durch die Widmung „in memoriam samuel beckett“ mit dem modernen Lebensgefühl der Absurdität konfrontiert. Inhaltlich setzt sich das Gedicht mit der Diskrepanz zwischen Liebesgenuß und den Möglichkeiten, darüber offen und freizügig zu sprechen, auseinander. Die lyrische Entfaltung dieses Verhältnisses vollzieht sich durch den Dialog mit einer angesprochenen Figur. In einer Annominatio wie salbad & labsal klingt Papenfuß’ Kritik an den frömmelnden, scheinheiligen Reden und dem geschmackvoll gepflegten Stil dieser Person an. Weitere hinweisende Angaben, die in dem kurzen lyrischen Text hervortreten, z.B. auf revolutionäre Ansichten, auf Liebeserfülltheit, auf Isolation und gesellschaftliche Anfeindungen lassen vermuten, daß das Gedicht auf den Dichter Hölderlin und dessen „Irrsaal“ (Hölderlin, S. 35) anspielt. Zudem weist der skandinavische Mythos um Odin, dessen Selbstopferung mit Christi Tod vergleichbar ist, mehrere Motive auf, die an die religiösen Gedanken Hölderlins und dessen Schicksal erinnern, nicht zuletzt deswegen, weil Odin als der Gott der Dichtung und der Liebesabenteuer fungiert und somit als ein mythischer Vorläufer des schwäbischen Dichters gelten kann.10 Offensichtlich verweisen die letzten Zeilen „doch dann / befällt der himmel sein haupt“ in Papenfuß’ Poem (S. 92) auf Hölderlins „Menons Klagen an Diotima“, worin es heißt:
Ach! und nichtig und leer, wie Gefängnißwände, der Himmel
Eine beugende Last über dem Haupte mir hängt11
Die Phonemverbindung „od-“ („odin“, in anderen Gedichten „öde, alleröd“, S. 92, 93, 98) könnte an die Wortkomplexe „Heiliger Othem“, „Aber das Haus ist öde mir nun“ der gleichen Elegie Hölderlins anschließen, aber auch an dessen Eigennamen (S. 76f.)
Die Zeile „So ist der Mensch“ aus „Brod und Wein“ (S. 92) ließe sich als Paraphrase auf Papenfuß’ „schwerlich / ändert sich der mensch“ beziehen, in der eine fatalistische Haltung charakterisiert wird. Weitere Parallelen sind in Hölderlins Ode „Stimme des Volks“ (S. 49) zu finden. Die Zeilen „Und Heldenstädte sinken“ – man vergleiche bei Papenfuß: „befestigte städte niederrissest“ – sowie in der zweiten Fassung von Hölderlins „Versöhnender der du nimmergeglaubt“ (S. 133–135) – bei Papenfuß: „der du hangest / im antlitz des windes“ – gebrauchen analoge Formen der hymnischen Rede. Das Verhältnis von Heilsbringer und Stadtzerfall deutet auf den Zusammenhang von Ohnmacht- und Hoffnungsgefühl. Der messianische Held bekommt jedoch noch andere Züge verliehen, die sein Charisma der Reinheit zu beeinträchtigen scheinen. Das Hölderlinsche Gedicht schließt mit dem Halbsatz „aber das nächste gewann er zuletzt, die liebste“ (S. 135), was durchaus dem Tenor von Papenfuß’ Gedicht entspricht. Sexualität ist die Kehrseite des heldischen Verzichtens, und sie kommt in den Zeilen „in’s flüstern / abgebogenen liebesgenusses“ und „mitte hucke voll liebe“ sehr bestimmt zum Ausdruck. Ein offenkundiger Bezug auf den „Klassiker“ ist schließlich im Kontext der unterschwelligen Christus-Thematik die Formulierung „Es hänget aber an Einem / die Liebe“ (S. 155) aus „Der Einzige“, Erste Fassung (S. 153–156), und die Zeile ,,Nemlich rein / zu seyn, ist Geschik, ein leben, das ein Herz hat, / vor solchem Angesicht“ (S. 182) aus „Patmos“, Bruchstücke der späteren Fassung (S. 179–183). Mehrere Zeilen aus Papenfuß-Goreks Poem „süßer odin“ benutzen ganz ähnliche Ausdrücke („hangest“, „antlitz“, „reinen herzens“) und belegen damit die insgeheime Affinität.
Der Ostberliner Lyriker paraphrasiert Hölderlins Gedichtsprache durch das Aufgreifen einiger Schlüsselwörter und erweitert die Glaubens- und Liebes-Motive um den nordischen Mythos von Odin. Hierdurch wird die klassische Verhüllung des Sexus mit den Ausdrucksmitteln der hymnischen Lyrik parodiert, aber zugleich mit der dazu gegenläufigen Offenheit des damaligen poilitisch-radikalen Denkens konfrontiert. Das märtyrerhafte Bild Hölderlins als Revolutionär steht nach Papenfuß-Goreks Auffassung in scharfem Kontrast zu dessen Ausdrucksvermögen für das Sexuelle, wie es sich in folgenden Gedichtzeilen des schwäbischen Dichters bekundet:
Unschikliches liebt ein Gott nicht,
Ihn zu fassen, ist fast unsere Freude zu klein.
Schweigen müssen wir oft; es fehlen heilige Nahmen.
Herzenschlagen und doch bleibet die Rede zurück? („Heimkunft“, S. 99)
Die Radikalität der poetischen Behandlung von Liebe, und zwar tatsächlich als Begegnung zweier Körper, tritt auch in anderen Texten Papenfuß’ hervor. Ihnen unterliegt ebenso ein anti-moralischer Impetus, der von der Klassizität des „geistigen Erbes“ seinen Ausgang nimmt, um einen Kontext von Schreiben, Sexualität und Alltagsleben dagegenzusetzen.
In dem Gedicht „ouroboroid nach hermann von pückler-muskau“ (S. 96) ist der Lebenszusammenhang von Liebe, Kunst und Broterwerb als optischer Kreis von Einzelworten gestaltet, der nach zwei Seiten lesbar ist. Das alchemistische und romantische Symbol des „ouroboros“, der sich in den Schwanz beißenden Schlange, wird im Titel genannt und gleichzeitig im Druck sichtbar gemacht. Papenfuß knüpft damit an Vorläufer wie etwa Christian Morgenstern an, der in vergleichbarer Weise räumliche Bewegungsformen durch das Schriftbild visualisierte. Die erste Zeile in Papenfuß’ Gedicht verweist auf Goethes „Liebeslied eines Wilden“, das dieselbe symmetrische Wortfolge aufweist:
Schlange, warte, warte, Schlange12
Der Titel legt ein vergleichbares Gedicht von Pückler-Muskau nahe, doch tatsächlich war der Adlige zu sehr Reiseschriftsteller, um sich der Lyrik zu widmen.13 Eher wäre an die gärtnerische Tätigkeit und den zwischen Liebschaften und Geldnot zerrissenen Lebenslauf zu erinnern. Zwei Details sind erwähnenswert; einmal spricht der völlig unökonomisch denkende Fürst von dem „cercle vicieux“ seines Lebens,14 eine existenzielle Reflexion, die auch das Papenfußsche Gedicht ausspricht. Interessanterweise taucht aber auch die Schlangenform bei Fürst Pückler auf: vor dem Fenster seiner geliebten Lucie auf dem Landgut Branitz läßt er ein großes „S“ (für den Kosenamen Schnucke) aus blühenden Rosen anpflanzen.
Das Schlangensymbol in Kreisform steht bei den Alchimisten für Ewigkeit und geschlechtliche Vereinigung und wird in dem Widmungsgedicht „für karen“ ironisch verwendet:
kunst befriedigt zuweilen selber, wissenschaft beruhigt, ehrgeiz erfreut, aber liebe – liebe gibt nur den qualvollen genuß eines, hungers der kunst
Anstelle eines harmonischen Kreislaufs besteht eine optische Lücke bei den zwei Gliedern „Liebe“ („liebe – liebe“); zudem ist das Äquivalenzverhältnis, welches in der Flexionsform „ist“ ausgedrückt wird, bei „kunst ißt kunst“ zugunsten eines Verhältnisses der Integration oder der Vernichtung, nämlich als ein Prozeß des Selbstverzehrens, aufgehoben. In der vertikalen Leserichtung bleibt das Gleichgewichtsverhältnis jedoch wirksam, wie die folgende Zeile zeigt: „für karen / ißt (hier: ist) – “ oder „für karen / ißt kunst kunst ……liebe liebe“. Zum Vergleich kann man „arianrhod von der überdosis“, das an anderer Stelle veröffentlichte lyrische Tagebuch Papenfuß’ anführen, worin es heißt:
liebe ist kein wort, sondern die interpunktion
aller sätze, die wir machen, aller hürden, die wir stehlen
es ist keine liebe in uns, sie entsteht zwischen und
& steht zwischen uns als argument, das versagt. (S. 106)
Die körperliche Begegnung mit dem anderen Geschlecht, in der „grabfeste der otterkönigin“, ist das Thema des Gedichts „zur westandacht“ (S. 97). Die unterschwellige Beziehung vom Mythos, Eros und von der christlichen Religion findet in solchen Formulierungen ihren komprimierten Ausdruck; sie entspricht übrigens in mancher Hinsicht einzelnen Aspekten im Frühwerk Joseph Beuys. In Prägungen wie „dreifelte“ und „triskel“ (Drei, Muskel) verbindet sich die religiöse „Dreifaltigkeit“ mit sexuellen Konnotationen:
der düsternis titten
säugten mich kühl & früh
als ich dreifelte
entfaltete sich die triskel (S. 97).
Auch kunsthistorische Assoziationen stellen sich ein. Zum Beispiel wird in der Strophe „meine fraunatur frühstückte / rekelte sich überaus / & empfing das Schwert / das mich bleiben ließ“ (S. 97) auf Manets berühmtes skandalumwittertes Gemälde Dejeuner sur l’herbe angespielt und mit dem Wort- und Sinnspiel Frau Natur und Flora (vgl. „frauna“, Fauna, Flora) verknüpft. Eine derartige Behandlung der Liebesthematik ist der bisweilen vulgären Alltags-Lyrik Brinkmanns oder Wondratscheks vergleichbar, und sie dürfte gegenüber der strengen Sexualmoral in der DDR eine bewußte Enttabuisierung darstellen.
Neben dem lyrischen Motiv der Liebe im Konflikt mit herrschenden Vorstellungen tritt in der Gedichtreihe ein anderer Gegenstand hervor, den man als eine Auseinandersetzung mit dem geltenden (ost-)deutschen Kulturverständnis und dessen Mythenbildung charakterisieren könnte. In drei Texten ist von Geistestradition, Germanentum die Rede, ein anderer Text befaßt sich mit dem österreichischen Nationaldenken.
Das Gedicht „anschauung und verstand“ (S. 97) steht durch seinen veralbernden Ton in starkem Kontrast zur ersten Zeile in Kursivdruck, die als Titel fungiert und die erkenntniskritisch-idealistische deutsche Philosophietradition wachruft. Papenfuß stellt dieser Sphäre der „Dichter und Denker“ die ebenso klischeehafte Sphäre des Germanenkults und der Technik entgegen. Der teutonische Stammtisch-Nationalismus („das echt eichene erbbier“) und möglicherweise die technische Entwicklung der Rakete in Peenemünde an der Ostsee („thorketil sans phrase“) sind Bestandteil der Vorstellungswelt, die das Gedicht durch eine gegen die Alltagssprache gerichtete Wortspieltechnik evoziert. Verschiedene Formulierungen zeigen dies: ein torkelndes Projektil überdeckt sich in einem Bedeutungsaspekt mit Thors schwingendem Hammer, so daß „thorketil“ entsteht. Die Bewegung des Torkelns überträgt Papenfuß in das Schriftbild des Gedichts. Die Zeilen „das weidenband / ums bein wand“ setzen diese Bildlichkeit verstärkend fort. Diese zitierten Gedichtvokabeln aus einem altertümlichen Handwerksbereich bauen einen Sinnzusammenhang mit der Reihe „geisterhand, heidenhand, brautlauf“ und dem nordischen Gott „Thor“ auf. Der archaisierende Stabreim auf „e“ in „echt“, „Eiche“, „Erb-Bier“ im Verein mit dem Assoziationsreichtum dieser Wörter gemahnt an das alte Germanentum, welches von Lohenstein, Klopstock, Kleist, Wagner bis Hitler eine wechsel- und widerspruchsvolle Wertschätzung als Nationalmythos fand.
Die aus der politischen Geschichte Deutschlands vielfach vorgeprägten Wörter stehen in einem inhaltlichen Gegensatz zu „wahlverwandt“, „immanuel kant“, „wandeln“ und dem Gedichttitel „anschauung und verstand“, worin Goethe, Schiller und Kant ganz unmittelbar als Repräsentanten der deutschen Geistesgeschichte vor das Auge treten. Deren „Wahlverwandtschaft“, d.h. ihre intellektuelle oder psychische Nähe zueinander, steht in einem krassen Gegensatz zu dem ausgesprochenen Individualismus des lyrischen Ich, das sich anscheinend als ausgegrenzter „abhub aller klassen“ begreift. Es ist gerade diese Außenseiterposition, aus der heraus die Begriffe des gesellschaftlichen Selbstverständnisses ironisch umspielt und sprachkritisch unterwandert werden – wie die Formulierung „sans phrase“ erkennen läßt, die die französischen Einflüsse in Preußen und die gebräuchlichen inhaltsleeren Redeformeln der höheren Stände des vergangenen Jahrhunderts assoziieren läßt. Das Gedicht erzeugt durch seine anspielungsreiche Wortwahl und seine eigentümlichen Wortklitterungen eine ironische Brechung des Themas „Geistesgeschichte“. Des Deutschen Nationalbewußtsein wird in wenigen Worten ironisch charakterisiert. Die kollektive Identität erscheint als Produkt einer Tradition, die zwischen der als „Erbe“ verstandenen Geistesgeschichte und einem mit Biermief vermengten Nationalgeist des Alltagslebens gespalten ist. Indem der Ostberliner Lyriker durch den Titel an die Gedankenlyrik der deutschen Klassiker erinnert, diese Form des Gedichts jedoch mittels simpler Reimstrophen im Stile Morgensterns negiert, erreicht er eine satirische Wirkung. Es ist die krasse Kontrastik, die die humoristischen Mittel der Travestie übersteigt und einen zynischen Unterton entstehen läßt. Papenfuß-Gorek stellt in „anschauung und verstand“ verschiedene tradierte Sprach- und Lebensformen gegeneinander, welche gemeinhin als Elemente deutscher Identität gelten. Deren Uneinheitlichkeit oder Unvereinbarkeit sucht er mittels Stilhöhenbruch und durch den Gebrauch zitathafter Wendungen zu umschreiben.
Ein anderes Gedicht trägt den Titel „albanien an der elbe in hyperbeln“. Aus der Nominalgruppe läßt sich eine Phonemgruppe rb/lb herausfiltern, die unterschiedlich mit den vorangehenden oder nachfolgenden Vokalen e/a kombiniert werden; da die Wortbedeutungen kein gebräuchliches Bezugsfeld bilden, entsteht der Eindruck, es handle sich womöglich um ein Unsinnsgedicht. Liest man den lyrischen Text jedoch so, daß man, anstatt sogleich semantische Übersetzungsoperationen durchzuführen, die phonetischen Strukturen aufeinander bezieht, so bildet sich ein Klangmuster aus. Sodann kann man die Nominalgruppe des Titels als einen verkürzten Vergleich verstehen: die DDR ist ebenso ein hermetisch umschlossener Staat wie Albanien. Man kann sie „in Parabeln“ beschreiben, mit denjenigen rhetorischen Figuren, die zugleich wie „Hyperbeln“ mathematische Begriffe darstellen. Wenn hier nur die kontextuelle Fügung der Wörter sinnerschwerend wirkt, so ergeben sich demgegenüber größere Verständnisprobleme, wenn Papenfuß in einzelnen Zeilen auch die Sinnhaftigkeit eines Einzelwortes aufgibt. Dann nämlich finden sich die sprachlichen Gestaltungsmittel der Alliteration oder der Assonanz, die mit einem sinnentstellenden Buchstabenaustausch koalieren: „prall“ wird zum Beispiel durch die Permutation von a/o zu „*proll“ (* nicht-existentes Lexem). Außerdem ersetzen reine Schriftzeichen wie „&“ gebräuchliche Konjunktionen („und“), wodurch ein optischer Effekt entsteht, der die Materialität des Mediums Schrift unterstreicht. Schließlich zeugt die durchgängige Kleinschreibung (oder Großschreibung) von einer Absage an die geltenden Sprachregelungen und die Hierarchie der Wortarten, womit der Lyriker den gewohnheitsmäßigen Lesefluß unterbricht.
Wendungen wie „wenn die schnauze proll ist“ oder „die jacke stockenprall“ lassen sich auf die umgangssprachlichen Idiome „die Schnauze voll haben“, ,,die Jacke voll hauen“ und „mit dem Stock hauen“ beziehen. Papenfuß-Gorek negiert damit die genrehaft vorgeprägten Wortfelder einer „lyrischen Sprache“, die dem common sense zufolge eher zu einem gehobenen Stil neigt. Er zieht ein Vokabular aus Sondersprachen wie dem Rotwelsch oder der DDR-Jugendsprache vor. Redensarten, Slogans und modische Wendungen werden zerlegt und collagiert, wobei sich durch die Kombinationsfähigkeit der deutschen Wortbildung viele Neologismen ausschöpfen lassen. Die Gedichte gewinnen ihre Eigenart durch die kreative Verarbeitung der sprachlichen Tiefenschicht, der grammatischen Regeln. Die im Prager Strukturalismus gewonnenen Erkenntnisse von den kleinsten Sprachelementen finden ihre poetische Anwendung.
In Papenfuß-Goreks Lyrik finden sich zahlreiche Tautologien, die einen besonderen Effekt ausüben. Man könnte gleichsam von „semantischen Staus“ sprechen, die entweder dem melodischen Klangzusammenspiel in einer Zeile dienen oder zeilenübergreifende Beziehungen stiften: „koppheister einen hechter“ ist gleichbedeutend mit „kopfvor einen Hechtsprung (ins Wasser)“, wobei „koppheister“ auch die Konnotation von „blindlings“ oder „sich blamierend“ führt. Das Gedicht weist keine harmonisierenden Reimformen auf, sondern benutzt phonetische Binnenbezüge wie die erwähnte Assonanz und Alliteration. Es entstehen Phonemgerüste, in die jeweils distinktive Elemente eingesetzt werden können: „kopp/propp“; „heister/hechter“; „koppheister/peiker“. Neben diese lautbezogenen Operationen treten semantische Verschiebungen. Dies kann bis zur Verwendung von Lehnwörtern in verfremdeter Form führen, zum Beispiel, wenn der englische Begriff „pisces“ – was mit dem astrologischen Terminus „Fische“ zu übersetzen ist – und englisch „pike“ (Hecht) mit dem deutschen Wort „pieken“ zusammenfallen und dadurch die Doppelbedeutung von „Köcher“ (für Fische und Pfeile) mitschwingen lassen:
peiker in den köchern vollauf
Ausgesprochen kafkaesk nehmen sich die Formulierungen aus, in denen ein Umstand bezeichnet, aber im selben Augenblick wieder zurückgenommen wird: „aber ich befürchte es haargenau“ gibt konzise den paradoxen Zustand zwischen „etwas (nicht) haargenau wissen“ und „etwas (nicht nur) vage ahnen, vermuten, befürchten“ wieder, der das ganze Gedicht bestimmt.
Die lyrische Technik verfährt gleichsam textkritisch, denn die „Kontamination“ eines Registers aus Redewendungen mit dem Register ihrer Verzerrungen und Sinnverkehrungen ruft „Konjekturen“ hervor, die sowohl für das Mitgeteilte wie für den Mitteilungsträger gelten. Das Mitgeteilte ist die Befindlichkeit des lyrischen Subjekts in der DDR-Sprachgemeinschaft, der Mitteilungsträger ist das Wortspielgeflecht, das das lesende Subjekt zu einer kommunikativen Gedichtsprache rekonstruieren und aktualisieren kann. Insofern ließe sich sagen, daß die lyrischen Texte Papenfuß-Goreks den Umgang eines DDR-Bürgers mit Sprache reproduzieren, indem Vermutungen über die Semantik von Aussagen verlangt werden; jedoch liegt dies nicht an der Geschlossenheit der Texte, wie sie die Repetitionsmuster des offiziell geregelten, öffentlichen Sprachgebrauchs hervorbringen, sondern umgekehrt an der Offenheit des betont individuell gehaltenen poetischen Sprachgebrauchs. Der realsozialistische Alltag mit der Furcht vor Gewalt und dem Elend von Fernseheinheitsbrei, Staatsverehrung und biederer Wohnzimmergeselligkeit bei Schnaps und Stulle ist im Gedicht nur erahnbar. Papenfuß thematisiert in den Wortfetzen die Lücke zwischen flüchtiger Erregtheit und dem „Runterspülen“ der Verärgerung, zwischen Alltagsverdruß und schweigender Übersättigung.
Weniger komplexe Sinnverschiebungen im Wortmaterial dieses Gedichts sind etwa solcher Art, daß ein Ausdruck wie „steigt auf“ und dessen Synonym „empor“ zu „empört sich“ verschmilzt („gelächter steigt auf, empört sich“). In einer anderen Zeile, „warme semmeln, beknackt wie bemme / stulle, stulle & nochmal stulle“, verbindet sich die abwertende Formulierung „beknackt sein“ mit den regionalen Ausdrücken „Bemme“ (Scheibe Brot), „Stulle“ und „Semmel“, so daß sie den neuen Sinn „Brötchen, belegt mit einer Knackwurst“ erhält. Ähnliches findet sich in den Wörtern „dattel“ statt „Daten“ (im Zusammenspiel mit dem nachfolgenden Ausdruck „Bohne“ für eine Information), „waffeln“ statt (Waffen Schutz-) „Staffeln“ oder in der Formulierung „was paßhoch fahneschwenkend“ für „den Paß bzw. die Fahne schwenken“. Es entsteht ein Inventar neuer Wendungen, die den zynisch-ernsten Ton des frühen Enzensberger mit den humorvollen Lautspielen Ernst Jandls verbinden. Sprache wird, bildlich gesprochen, so durch den „Zungenfleischwolf“ gedreht, daß die Ohnmacht des Staatsbürgers gegen die DDR-Schweigepolitik und zugleich der Anspruch auf eine Individuelle derb-sarkastische Außenseitersprache als die mutmaßliche Haltung des lyrischen Ich spürbar werden. Damit aber negieren die Gedichte implizit solche kritischen Positionen, die an dem optimistischen Glauben festhalten, die Verhältnisse in der DDR durchschauen zu können. Es sei nur beiläufig erwähnt, daß diese skeptische Haltung den Aussagen Baudrillards und Lyotards über „fatale Strategien“ und die Simulationsphänomene der Postmoderne ähnelt, jene aber die Bedingungen der Medien- und Informationsgesellschaft anzielen. Eine gesuchte Affinität zeigt sich trotzdem in der Rezeption dieser Theoretiker durch die Autoren der Berliner Ostmoderne, vor allem durch Rainer Schedlinski.
Das Gedicht „ledriges kilogemetere“ (S. 96) baut ein Assoziationsfeld auf, das sich um Machtekel, Kunsthandwerk, amerikanischen Kommerz und nationale Gedenkstätten gruppiert. Der Titel deutet auf das Gemeckere von Ziegen und das Ablaufen einer Langstrecke. In der Tat geht Papenfuß in dieser sechsstrophigen Schimpftirade an die Grenze des Verständlichen. In konsonantenreichen fremdsprachlichen Klängen schiebt der Lyriker Kassiber hin und her, die kaum erkennbar eine Veränderung in „drogheda“ (Anagramm für „Gor(ek)“, „Droge“, „Ade“?) umschreiben. Die „eidbrüche“ einer zerfallenden Gruppe, die „unverständlich unterwandert“ wurde, bilden den Hintergrund dieser Klage.
Es geht jedoch, über die Beschäftigung mit dem Gruppengeist hinaus, um die nationale Identität des Individuums. In der zweiten Strophe wird in der Wendung „totally brechted out“ sowohl auf Bertolt Brecht wie auf Johannes R. Becher15 als den nationalen Kulturstiftern der DDR Bezug genommen. Der Kontext der deutschen Identität ist durch assoziationsgeladene Wörter wie „ledriges“ oder „blondmähnen“ geschaffen, da sie mittelbar auf Ariertum, Rocker oder Neonazis verweisen; Kürzel wie jotkiz haben einen englischen Beiklang und sind daher mit „J-kids“ (FDJ?) assoziierbar. Phonemkombinationen wie „jakroto kritj“ klingen nach russischen Vokabeln, weisen jedoch eine Struktur auf, die Kryptonyme bzw. quer zu lesende Akronyme (vgl. „akro“) vermuten lassen (vgl. die Symmetrie „j-a-kro-to-kri-t-j“ aus der sich ein „Jack wrote to crit.“, „jack wrote OK.“, oder mittels Umstellung ein „ja .. tot“ bilden lassen). Es entstehen phonetische Verbindungen mit anderen Zeilengliedern wie „bjokroi“ (b-j-o-kro-i) oder anagrammatische Übereinstimmungen mit dem Eigennamen Gorek. Ganze Wortketten lassen sich als individuelle Lautschrift lesen: „hjeld dillakfish fjüll wleff / in turuf finsk“ („he yelledd: do ya like fish, you’ll (be) well-off in turuf finsk“? oder „yield — delicate fish — fuel — well-off“?). Die mittlere Strophe ist am einfachsten zu lesen, denn sie zeigt die Verbindung von Kunsthandwerk und Machtausdruck in Anspielung auf Adolf Loos’ Losung „Ornament ist Verbrechen“ und auf Papenfuß’ gleichnamige Musikband:
guns’n’roses, arts’n’crafts, ornament & erbrechen
und & und, alle jahre wechselt die belegschaft der reihe nach
Die Kunstausübenden sind lediglich wechselnde Garnituren für die internationalen Auftraggeber, sei es KPD, die DM („KPDMLSD“) und Flicks Aktienkonzern („verflickt nochmal“) oder sie sind Teilnehmer im amerikanischen Wettbewerb der Sponsorenausschreibungen („heineken-budweiser…“). Das melodische Kürzel „idwiriworik“ ist mit „ID — wire — I (eye) – war“ oder „ID — wire — I worry“ und dem Berlinerischen „ik“ für ich („- ik nicht du“) auflösbar.
Wie ein buntes Set von Lego-Bausteinen (lat. „lego“ zusammenlesen, auslesen, vorlesen) bilden die Phonemkombinationen eine Vielzahl von semantischen Konfigurationen. Man ist versucht, von einem Ostberliner Legoismus zu sprechen, da eine egozentrische Besinnung auf das eigene Selbst sich mit einem sprachlichen Zusammensetzspiel vereint.
Aus geläufigen Worthülsen entsteht eine kreative Gedichtsprache, die offensichtlich auf eine kleine Kommunikationsgemeinschaft hin angelegt ist, jedoch genügend Elemente aufweist, um auch dem Außenstehenden den Reiz des Umgangs mit Sprache zu entdecken.16 In „wortschläge“ experimentiert Bert Papenfuß mit Morphemaustausch. Die wortspielerische Zergliederung der staatlichen Mediensprache vermischt sich mit zungenspielerischen Wortfindungen, so daß Zeilen wie die folgende entstehen: „salvange schwangen ihre praxen, lurlten einen tuck“ (S. 95) Erst durch den Einbezug der Vokabeln Revanche, Salvage, Savage fächert sich diese Kassiberzeile in konventionelle Satzmuster wie „savage(s) (Wilde) schwangen ihre Äxte“, „Ärzte revanchierten sich in ihren Praxen“ oder „Bergung oder Rettung in den Praxen/Ärzten“. Gemeint sind wohl medizinische Gutachten, die im Kontext mit dem Gedichtmotiv der Ermordung stehen. Die Halbzeile „lurlten einen tuck“ ließe sich auf die anglophonen Wendungen „to make a truck“ (einen Tauschhandel machen), „to lure with tucks“ (mit Leckereien ködern) oder auch auf deutsche Wendungen wie „kurbelten ein Stück“, „tucken“ (Schleppnetz ziehen), „einlullender Druck“, „lallten ,tuck‘“ (nichts) beziehen. Das vorausgegangene Zeilenglied „mit eisgängigem wulst-bug“ wäre als eine Verstümmelung von „mit eingängigem Schwulst, Humburg“ zu lesen.
Der kritische Impetus des Gedichts richtet sich gegen das „machtwort laut hermann kant“ und gegen die variantenreichen Formulierungen der offiziellen Verlautbarungen. Im lyrischen „wir“ drückt sich ein Gruppengeist aus, der Sprachversatzstücke kritisch befragen will:
fragwürde, trauer & hohnspott prallten ab
von den bollwerken des wort „reichtums“, die uns galten
es mit suworow halten; keine frage beantworten.
aber das irgendetwas mit dem tode nicht stimmt, stimmt. (S. 95)
Der Name „suworow“ verbindet sieht mit „Sacharow“ oder ist möglicherweise als „Such-Wort-row“ (Reihe) entzifferbar. Der Name macht sich so eine Spannweite von Bedeutungen zunutze, angefangen von „what’s the row?“ (Was ist denn los?) und engl. „row“ für „Krawall, randalieren, rudern“ bis hin zu „Kahn fahren“. Letztere Sinnebene schwingt noch in dem Bild „vorbei driftete eine prunkjurte mit eisgängigem wulstbug“ mit. Prunk und Punk bilden ein Gegensatzpaar, das nicht nur semantisch, sondern ins erster Linie phonetisch unterschieden wird.
Mehr auf das österreichische Umfeld der manuskripte ist schließlich „imagining the ‚salzfust arms‘“ bezogen (S. 94). Die englischen Begriffe „fustian“ (hohles Pathos, Schwulst), „fusty“ (muffig, verstaubt) oder „frustration“ klingen durch. Das anglophone Vokabular als Bestandteil eines modischen, internationalisierten Jargons beziehungsweise der Jugendsprache kollidieren mit obsoleten deutschen Wortfügungen („-umwrungen“, „höchstselbst“) und Wörtern höherer Stillage („behütete“, „beschirmte“). Wie auch in anderen Texten verwendet Papenfuß prähistorische Epochen als Fixpunkte für die ironische Darstellung regionaler Kulturen, die nicht als Umschreibung einer mythischen Heimat, wie sie bei Gottfried Benn oder Arno Holz eingesetzt wurde, angesehen werden kann.
Papenfuß streift in mehreren Wörtern („ur-“, „keltenspieß“, „kessel-“ etc. ) die archaische Zeit. Er evoziert das keltische Siedlungswesen der Hallstattzeit, das sich mit Bronze und Eisen eine hochstehende Kulturgrundlage schuf. Später wurde diese Alpenlandschaft von der landesfürstlichen Salzkammer verwaltet, worauf sich das Gedicht direkt bezieht. Die barocke, erzbischöfliche Tradition, das österreichische Dienerwesen, das Problem des Antisemitismus und die kulinarische Küchensprache werden behandelt und „über die gesalzene schere gekämmt“ („mit einem Salzkörnchen Wahrheit“ oder „gesalzen gesagt“, „über einen Kamm geschoren“). Das Gedicht höhlt die stereotypen Anpreisungen der Landesgeschichte und des Essens, wie sie die Tourismusbranche verwendet, durch einfache Übersetzungen („,hallstatt caviar‘ / sprich; frischen fischeiern auf toast mit sauerkrautsalat“) oder witzige Klischeefiguren („der lederbehoste gewährsmann“, „von norman dem blitzmähnigen blondreporter“) aus.
Der Germania-Kult bezüglich einzelner Landschaften spielt ebenso in „exoterische zengoladengo sapiens sapiens“ (S. 93) eine Rolle. Schon im Titel kommt der thematische Hintergrund des Naturgeschichtlichen und das Spiel mit esoterischen Lexemen, die „im duden gut aufgehoben sind“ zum Ausdruck. Wie ein Gebet hebt die monolithische Strophe in Anspielung auf das Johannes-Evangelium an („und das wort“) und endet in diesem biblischen Ton („schloß das wort“), gleichwohl um ein lakonisches Post-Scriptum ergänzt:
& die linkselbischen jungpaläolithiker
des spätglazials spielten weiter
In der Tat geht es um die Beschäftigung mit Sprache, und zwar in Auseinandersetzung mit der Geschichte der Prenzlauer Lego-Lyrik, die mittlerweile vom Westen entdeckt („unter mitnahme der stein- / & knochenartefakte“), imitiert („die linkselbischen jungpaläolithiker / des spätglazials spielten weiter“, Herv. E.G.) und gönnerhaft (,,die heranfliegenden raben von gönnersdorf“) aufgekauft wird. Die Dokumentaristen aus dem Westen, nämlich „die armstarken schnurkeramiker“ (vgl. Wörter wie engl. „arms“, dt. „ur-“, „Ami“, „Kerker“, „Amerikaner“) und „die wendegeister aus den bimsaschen des alleröds“ (BRD, ARD, Wende, „sasch-“ + „-nde-“ für Sascha Anderson?) werden nichts als „eine urnenfelderkultur“ hervorbringen. In dem Gedicht „dichter zerfallen“ ist noch einmal die Rede von dieser Öde. Sie meint die Krise im Selbstverständnis der Prenzlauer Autoren („gähnender kunst beidseitiger kluft“) angesichts eines vereinten „allumarmten“ Deutschlands, in der Widerstand und Anpassung neu definiert werden müssen.
Auch dieses Gedicht benutzt übrigens die einzelstehende Endzeile, um eine lakonisch formulierte Einsicht festzuhalten. Wie in den „albanien“-, „westandacht“- oder „dichter zerfallen“-Gedichten wird dabei ein inhaltlicher Spannungsbogen von Gegensätzen zum offenen Abschluß gebracht und zusätzlich durch den fehlenden Schlußpunkt angezeigt. Die darin formulierte Pointe ist grundsätzlich sarkastischer oder humoristischer Art, wie es etwa die Zeilen „aber ich befürchte es haargenau“, „was blieb mir übrig“ demonstrieren. Lakonik war und ist offensichtlich die Antwort auf die Erfahrung der Ohnmacht im Honecker-Regime und auf die Auflösung der subkutanen Autoren(not)gemeinschaft des Prenzlauer Bergs, wie sie in „tiské“ geschildert werden: Exit oder der Tod der Ostmoderne. Bleibt nur zu wünschen übrig, daß die poetische Verfahrensweise des Legoismus ihre Fortsetzung mit anderen Mitteln findet.
Erik Grimm, in: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge, I–1/1991, Peter Lang Verlag, 1991
Interview Birgit Dahlke mit Bert Papenfuß
Dahlke: Durch den Vorwurf, Sascha Anderson sei inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen, wurde die gesamte inoffizielle Kunst- und Literaturszene vom Prenzlauer Berg in ein anderes Licht gerückt. Einst hochgelobt, erscheint sie nun manchem als Ziehkind der Staatssicherheit. Geht Dich das alles an? Werden jetzt Auseinandersetzungen geführt, die früher nicht ausgetragen wurden?
Papenfuß: Ja, es geht mich schon an. Ich habe noch nie so oft das Feuilleton gelesen wie in der letzten Zeit, das interessiert mich normalerweise überhaupt nicht, aber man muß es nun halt notgedrungen ab und zu mal lesen; da habe ich erst mal gemerkt, wie fürchterlich das eigentlich ist…
Ich glaube nicht, daß das jetzt so eine Art „Kampf“ ist, der eben bis jetzt nicht ausgetragen wurde, also literarische Auseinandersetzungen, die es vorher nicht gab, weil wir eben vorher so eine Art…
Dahlke: Kritiklosigkeit?
Papenfuß: … – ja, ich hab’ das mal „synthetische Solidarität“ genannt – miteinander hatten, obwohl wir literarisch und auch persönlich sehr unterschiedlich waren, also wir sind eben mit Rathenow und Kolbe aufgetreten … Kolbe ist mir literarisch und auch persönlich viel näher als z.B. Rathenow. Aber wir konnten uns, glaube ich, in den 80er Jahren nicht leisten, uns auch noch zu zersplittern. Es kam eigentlich nie zu einer literarischen Debatte, außer auf der Veranstaltung Anfang 1984, die wir damals Zersammlung genannt haben, und dort auch nur im Ansatz. Wir haben die Veranstaltung ja damals gemacht, um rauszufinden, was wir zusammen wollen. Möglicherweise wäre so was wie ein alternativer Schriftstellerverband rausgekommen. Die Frage war: wollen wir das oder wollen wir das nicht. Das Fazit war, wir wollten’s eigentlich nicht, niemand wollte es so richtig. Und insofern blieb auch damals die literarische Auseinandersetzung im Phlegma stecken, sie verlief im Sande.
Dahlke: Kannst Du andeuten, was Du mit „literarischer Auseinandersetzung“ meinst? Hier geht’s ja wohl nicht um Rathenow und Kolbe, hier ist doch die Auseinandersetzung im engeren Kreis gemeint, oder?
Papenfuß: Ich glaube, zwischen Stefan (Döring), Sascha (Anderson) und mir gibt’s schon irgendwie einen Konsens. Wir reden über unsere Sachen, im privaten Rahmen, und stellen vielleicht nach außen hin auch sowas dar wie was Zusammengehöriges, obwohl wir sehr unterschiedlich sind.
Dahlke: Ja, klar, aber unabhängig davon kommt vielleicht auch durch Euer Manifest ein solcher Gruppen-Eindruck zustande?
Papenfuß: Das Manifest ist aber mit Döring und Faktor zusammen entstanden. Es gab schon literarische Probleme, mit Lutz Rathenow z.B., aber es gab nie eine wirklich klare und direkte Auseinandersetzung zwischen uns. Wie hätte das auch groß aussehen sollen? Hätte man sagen sollen, also das ist vielleicht ’n Scheiß … oder wie?
Dahlke: Lorek z.B. hat sowas gemacht: Kritiken zu Flanzendörfer, Zieger, Jansen. Ein paar solcher Kritiken sind doch in schaden, Anschlag usw. zu finden…
Papenfuß: Wichserei. Wir wollten sowas nicht schreiben, mich interessiert das nicht. Ich würde mich nicht hinsetzen und ’ne Kritik schreiben. Das einzige, was ich noch in der Lage zu verfassen bin, sind beileibe Manifeste, weißt du, und dann ist Schluß.
Dahlke: Viele andere „Szene“-Aktivisten haben Theorien entworfen, Du eigentlich als einziger nicht.
Papenfuß: Na außer…
Dahlke: … Du hast „Poetik-Gedichte“ gemacht…
Papenfuß: Ja, stimmt, ich hab’ versucht, was andere Leute in Essays abhandeln, auch im Text abzuhandeln. Es widerstrebt mir eigentlich, mich hinzusetzen und ’nen Essay zu schreiben. Mir widerstrebt es, ’ne Satzstruktur zu machen, die ich normalerweise nicht benutze.
Dahlke: Aber das hat nicht den Grund, daß Dir die Wirkung Deiner Texte egal ist? Koziol und Schedlinski schreiben im Editorial der ariadnefabrik von einem „Theorienotstand“ und einem Erklärungsbedürfnis.
Papenfuß: Ja, also das war ihr Problem.
Dahlke: Also Deins war es nicht?
Papenfuß: Nein. Ich meine, ich hab’ es begrüßt, daß eine neue Zeitschrift entsteht. Und ich war ja in dieser Zeitschrift auch immer ein Grenzfall, denn eigentlich wollten sie ja keine Gedichte. Sie haben meine dann aber doch gemacht, weil sie da essayhafte Ansätze erkannt haben, also wie ein Thema abgehandelt wird. Das mache ich aber normalerweise auch so, also auch, wenn ich Texte schreib’, die nicht in der ariadnefabrik veröffentlicht worden wären. Ich meine, ich schreibe nie ein Gedicht, sondern immer diese Zyklen und die beschäftigen sich mit bestimmten Themen und erörtern diese auch. Der Zyklus insgesamt ist schon was Zusammenhängendes, wenn Du so willst, Essayhaftes. Es sind da Texte drin, die man in einen Anthologiezusammenhang stellen kann, und es sind auch Texte drin, die im Zyklus liegen, die Überleitungen sind von einem Text zum anderen.
Hm, Du wolltest, daß wir nochmal auf die Stasi zurückkommen.
Dahlke: Ja, die Frage: mußt Du jetzt Literatur umwerten? Faktor sagt. z.B., er müßte sich die ganzen Texte (Andersons) jetzt neu angucken, man müßte die jetzt anders lesen…
Papenfuß: Das sind für mich zwei verschiedene Sachen, wenn einer im Spiegel meint, die Literaturgeschichte müßte neu geschrieben werden…
Dahlke: … „Spitzelprosa“, der Begriff taucht im Spiegel auf.
Papenfuß: … das ist für mich ein anderes Faktum, als wenn Jan Faktor meint, …
Dahlke: Es ist aber Faktor, der das sagt!
Papenfuß: Ja, der meint das anders. Ich will das versuchen zu erklären. Ich glaube, daß die Art Literatur, die wir im Prenzlauer Berg geschrieben haben, als DDR- und Oppositionsliteratur gut und brauchbar war, besonders für die West-Medien. Aber jetzt, wo die Grenzen weggefallen sind, droht es eben, auch deutsche Kultur zu werden. Ich hatte nie vor, daß es dazu kommt, aber es droht so zu werden, und da ist eben eine starke Lobby dagegen.
Dahlke: Ihr seid die letzte „Autorität“, die letzten, die noch sprechen können … (zusammen mit der Kirche, die ja jetzt auch demontiert wird) …
Papenfuß: … und insofern versucht eben diese starke Literaturwissenschaftler-Lobby, das Neue zu kategorisieren. Im Prinzip ist es ’ne marginale, häretische Literatur, die wir gemacht haben, die eigentlich überhaupt nicht in den Hochkultur-Zusammenhang paßt. Und niemand wollte da rein…
Dahlke: … die jetzt also auch wieder stört sozusagen…
Papenfuß: Ja, genau. Und ich meine, dafür gibt’s ’ne lange Tradition. Die Surrealisten, die Grazer Autorenversammlung oder Wiener Schule … die stehen auch alle in dieser Tradition, oder die Situationisten oder was weiß ich: in den 60er Jahren Oulipo in Frankreich oder Tel Quel oder sowas. Ich meine, das sind Leute, mit denen wir auch in Verbindung stehen, die uns anerkennen in ihrer Tradition. Das ist eine jahrhundertealte oder meinetwegen auch schon jahrtausendealte Tradition und da sind wir eben im Gegensatz zur Hochkultur. Ich weiß, daß von der Art Literatur, die ich schreibe, zwei- oder dreitausend Exemplare von Büchern innerhalb von zwei, drei Jahren verkauft werden, das ist viel, soviel Leute interessieren sich dafür und ich hab’ nicht vor, das zu forcieren, ist völlig o.k. so. Das ist vielleicht das eine. Wenn Jan Faktor das sagt, dann ist das was anderes, das ist ein psychologisches Phänomen. Das hat nix mit der allgemeinen Literaturwissenschaft oder Kulturpolitik zu tun. Ich finde das ein bißchen unfair, deshalb nehme ich auch mal eine etwas unfaire Metapher dafür: Also, wenn ich erfahre, daß die Frau, die ich jahrelang geliebt habe, mich betrogen hat, dann liebe ich die doch nicht weniger … Insbesondere, wenn ich mich inzwischen sowieso von ihr getrennt habe – was ja bei Sascha und Jan Faktor der Fall ist. Warum soll ich mich dann hinsetzen und ein Jahr lang über Geschichten nachdenken und versuchen, dort irgendwelche Details neu zu interpretieren. Ebenso…, na gut, wenn ihm das was nutzt, dann soll er das machen, dann soll er das für sich tun, aber er sollte nicht sein psychologisierendes Problem veröffentlichen und der Öffentlichkeit antragen, es auch zu tun. Das ist Quatsch. Jeder, der schreibt, arbeitet mit quasi paranoiden oder schizophrenen Techniken, d.h., das könnte man mit jedem machen. Du könntest also jedem unterschieben, daß er, was weiß ich, für die Stasi gearbeitet hat oder irgend ein großes persönliches Unglück verursacht hat, sein Kind ins Unglück gestürzt hat o.ä. … Das geht nicht.
Dahlke: Nochmal zum Manifest „zoro in skorne“ von 1984. Wie liest Du das heute?
Papenfuß: Mit dem Inhalt bin ich heute noch sehr einverstanden, das war irgendwie auch zeitgenössisch. Ich hab’ vor kurzem Texte der amerikanischen konspirativen Moderne gelesen, und da tauchen die selben Begriffe auf: „Unkontrollierbarkeit“, „temporäre autonome Zone“, das sind Begriffe, die ich z.B. auch für die Situation am Prenzlauer Berg verwenden würde. „Temporär“ auch in dem Sinne, daß es eben nur für eine gewisse Zeit bestand. Man kann ungefähr lokalisieren, wann es anfing und wann es aufhörte. Daß es heute nicht mehr ist, daß heute was ganz anderes ist, ist klar. Aber ich glaube, wenn jemand bewußt marginal oder häretisch arbeitet, dann wird er’s darauf anlegen, immer wieder Situationen zu erzeugen, wo so etwas entsteht, so eine temporäre autonome Zone.
Daß dieser Zustand mit vielen komplizierten Sachen verbunden ist, wie z.B. auch Verrat, was jetzt diskutiert wird, das ist vielleicht auch normal. Wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, kommt’s immer drauf an, sie so zu akzeptieren, wie sie sind, und nicht einem Dogma unterzuordnen oder gar ’ne eigene Doktrin aufzustellen. Ich glaube, das größte, was ich in einer Beziehung zu einem Menschen tun kann, ist, ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Das hat den Nebeneffekt, daß du natürlich auch die Katze im Sack liebst. Ich glaube, das ist normal in zwischenmenschlichen Beziehungen, ob du das nun Liebe nennst oder Freundschaft, damit signalisiere ich aber auch die Bereitschaft, die Problematik des anderen mitzutragen und in gewissen Situationen mitzuverantworten. Deshalb versuche ich auch, trotz der heftigen, jetzt auch für mich kaum zu leugnenden Anwürfe gegen Sascha, ihn zu verteidigen.
Dahlke: Du sagst, es ist etwas zu Ende gegangen und etwas Neues hat begonnen. Ist nicht die „Hochphase“ der Prenzlauer-Berg-Szene, der gemeinsamen Arbeit, der Manifeste, schon früher zu Ende gegangen, so um 1986?
Papenfuß: Ja, ich denke schon, daß 1986 der absolute Schluß dieser Phase war, wenn nicht früher. Sascha ist ’86 weggegangen, damit war auch definitiv Schluß. Von dem Augenblick an gab’s auch keine Organisation mehr. Es hat sich dann mehr aufgesplittert. Inzwischen war ariadnefabrik ziemlich fest installiert und auch Liane existierte schon, schaden oder verwendung – das lief noch, aber es gab keinen zentralen Anlaufpunkt mehr, was irgendwie auch ganz gut war. Auf die Dauer wär’s auch langweilig geworden, Sascha hatte eben eine Art „Hauptquartier“ aufgebaut, das war schon o.k., es gab einen Sammelpunkt, man konnte immer dahin gehen und in bestimmten Situationen zusammenarbeiten und sich austauschen, bestimmte Leute treffen, das war o.k. Aber was sich dann nach Saschas Weggang wirklich geändert hat, war, daß er dann ja drüben „normal“ weitergearbeitet hat, also nicht mehr marginal. Damit wurde auch unsere Arbeit „normal“.
Dahlke: Daß Ihr Eure Editionen verkauft und vom Erlös gelebt habt, das ging aber schon früher los, oder?
Papenfuß: Das gab’s, seit wir angefangen hatten, Lyrik-Grafik-Editionen zu machen. Die Idee war von vornherein, eine kleine Edition für sich zu haben, die dann an Freunde zu verschenken, aber auch, ein paar Exemplare zu verkaufen. Die ersten kosteten 20 Mark, die letzten so 300 oder 1000 … 1986 war dann auch in der DDR ’ne andere Situation. 1985 war Berührung ist nur eine Randerscheinung erschienen (in der BRD), 1986 hat Elmar Faber uns in den Aufbau-Verlag eingeladen und damit begann dann eine Normalisierung der literarischen Situation hier in der DDR. Es hat noch ein paar Jahre gedauert: mein Buch ist dann Anfang ’89 erschienen. Inzwischen konnten wir aber schon Lesungen machen, es gab nur noch selten Verbote usw.
Dahlke: Das alles würdest Du so 1986 ansetzen?
Papenfuß: Ja, 1986 wurde ich in die Akademie der Künste eingeladen, das war noch vor Aufbau, ich nehme an, auf das Bestreben von Gerhard Wolf und Karl Mickel hin. Das war nur für die Mitglieder der Akademie, Volker Braun, Heiner Müller, Gerhard Wolf, Karl Mickel und noch ein paar andere, und die haben mich quasi rehabilitiert. Schon bevor ich überhaupt was sagen oder lesen durfte, haben Mickel und Wolf Reden gehalten, wie gut das alles sei und daß es unbedingt veröffentlicht werden müsse…
Dahlke: … 1986 wurden auch erstmals Texte von Dir in Sinn und Form veröffentlicht, mit Mickels „Geleitwort“.
Papenfuß: Ja, genau, das war die Konsequenz davon. Sinn und Form hat dann, um ein Zeichen dafür zu setzen, daß ich jetzt nicht mehr so extrem marginal bin, eben die ersten Texte veröffentlicht. Dann ging das los mit dem Aufbau-Verlag.
Dahlke: Du hast jetzt von den alten Texten gesprochen. Wie stehst Du heute zu Deinen Anfängen? Denn Deine Anerkennung durch die Literaturwissenschaft bezog sich ja auf Texte, die zum Teil 10, 15 Jahre zurücklagen.
Papenfuß: Es gibt vor harm [dem ersten veröffentlichten Band) noch zwei Manuskripte, naif, woraus die Texte in Temperamente waren (Heft 2/1977), und tilI. Mit den ersten beiden bin ich eigentlich noch sehr einverstanden, die sind sehr radikal, sehr unliterarisch –
Dahlke: – zu harm hast Du Dich mehrfach negativ geäußert.
Papenfuß: Ja, es kam mir ein bißchen spanisch vor, daß ich damit Erfolg hatte. Ende der 70er Jahre waren die ersten Lesungen und die waren für meine Begriffe übernatürlich erfolgreich. Nicht auf literarischer Ebene, aber auf so ’ner Kultebene. Es kamen sehr viele Leute zu den Lesungen, die Lesungen gingen stundenlang, so anderthalb Stunden, und ich hab’ mich dann auch mitreißen lassen von der Bewegung, die vom Publikum ausging. Das ganze Buch spielt mit Publikumserwartungen, erfüllt sie nie richtig, sie werden immer angerissen, diskutiert, ziemlich witzig diskutiert. Das hat ausgereicht, vielen Leuten ein minimales Identifikationsmuster zu geben. Ich rede über Sachen, mit denen ich oft sehr im Zweifel bin. Zuspruch oder eine positive Reaktion aus dem Publikum erfährst du nicht für Zweifel, sondern für irgendeine definitive Sache. Ich glaube, das Problem an dem harm-Manuskript war, daß zu viele definitive Sachen drin waren, daß zu viele Sachen definitiv geäußert waren.
Dahlke: Das meinst Du, wenn Du sagst, Du hättest in diesem Band mit „Popstrukturen“ gearbeitet, ja?
Papenfuß: Ja, was ich mit spielerischem Umgang mit Publikumserwartungen meine. Ich hab’ die nie erfüllt. Dann wärs noch peinlicher gewesen. Daraufhin habe ich Soja geschrieben und hab’ mir dann viel, viel mehr Zeit damit gelassen. Die anderen Bände sind jeweils in einem Jahr entstanden, naif ’75, tilI ’76, harm ’77. SoJa war erst ’81 fertig, da habe ich mir viel mehr Raum genommen für experimentelle Strukturen, die ich in den ersten beiden Bänden angefangen habe. Bin aber heute mit SoJa nicht mehr so zufrieden. Ist mir zu verstiegen, zu lange dran gearbeitet, zu überarbeitet, überstrukturiert.
Dahlke: Auch die Erklärungen zu dem Text „SOndern“ in der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung sind so hin und her gewendet. Es geht um Denkgesetze, um Logik, nicht mehr um Spiel, sondern es ist ganz ernsthaft, auch, was Du mit den Konjunktionen „aber“ und „sondern“ machst.
Papenfuß: Die Veränderungen, die ich im Alphabet vornehme, sind alle logisch, ich wußte von Anfang an, daß es Quatsch ist, also Pseudologik…
Es konnte so nicht weitergehen, das war so durchstrukturiert, daß es steife und sterile Züge bekam. Es hat ’ne Weile Spaß gemacht, so zu arbeiten, aber dann war Schluß. Die wenigen Leute, die SoJa gut finden, sind Leute, die konkrete Poesie mögen oder selbst machen, denn da sind viele Methoden der Konkreten aufgegriffen, teilweise persifliert, manchmal wird auch richtig mit denen gearbeitet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Im Schreiben entsteht manchmal eine Eigendynamik, die Du nicht mehr richtig steuern kannst. Ich war der skeptisch gegenüber von Anfang an, aber ich mußte es eben machen. Aber wie gesagt, ich wußte, daß es so nicht weitergehen konnte.
Dahlke: Diese Feststellung, daß es so nicht weitergehen könnte, bezieht sich aber nicht auf die beiden ersten Bände?
Papenfuß: Nein, die sind richtig anarchisch, der Grundgestus ist für mich auch heute noch sehr sympathisch.
Dahlke: Meine Frage zielt nicht auf die damalige Position, den Gestus, sondern auf die Art der poetischen Bewegung, auf die Entwicklung einer eigenen Sprache, eine Bewegung, die eigentlich unendlich ist. Ich halte die so gefundene Technik für eine, die auch heute angesichts der Medien- und Werbe-Flut produktiv wäre. Warum sagst Du trotzdem, die „ära des aktiven wortspiels“ klinge aus?
Papenfuß: Da muß ich nochmal auf die ersten beiden Manuskripte zurückgehen. Das ist eben das, was ich als anarchisch bezeichnen würde, in dem Sinne, daß die Sprache nicht institutionalisiert ist, auch nicht für eine subkulturelle Institution, was auf eine bestimmte Art harm und SoJa haben. Harm für ’ne bestimmte Szene, die man schon anarchistisch nennen könnte, und SoJa hat einen ähnlichen Duktus, arbeitet aber mehr mit den konkreten Methoden und führt die meiner Meinung nach auch ad absurdum, auf jeden Fall für mich; aber ich mußte es eben machen. Danach hab’ ich auch ganz anders weitergearbeitet, nicht mehr in so klaren Strukturen, ich hab’ nicht mehr einen Band nach dem anderen produziert, sondern die Zyklen wurden wichtiger als der gesamte Band. Der gesamte Band ist sehr umfangreich, 500, 600 Seiten, der wird auch erscheinen. Das ist im Prinzip alles, was ich zwischen ’82 und ’88 geschrieben habe. Das ist sehr viel, ich weiß nicht, ob es viel Sinn hat, das groß zu kürzen, dann soll man lieber ein bißchen oberflächlicher lesen.
Dahlke: Du schreibst ein „TrakTat zum ABER“, dann den „Appendix zum TrakTat zum ABER“, den „Affen zum Appendix…“ usw., also immer neue Untergliederungen?
Papenfuß: Ja, das ist immer noch mal neu und sich selbst persiflierend und auch ergänzend und zurückgreifend.
Dahlke: Das fordert aber vom Leser sehr viel Bereitschaft, sich einzulassen, den Strukturen zu folgen…
Papenfuß. Ich weiß nicht. Hast Du Sachen von Kathy Acker gelesen? Der wichtigste Roman ist Empire of the Senseless, Im Reich ohne Sinne, das ist ein bißchen wie ein Trip: Wenn du Lust hast, das Ganze zu lesen, kannst du das Ganze lesen, es reichen aber auch ein paar Seiten oder: eine Seite ist wie ein Hologramm, das heißt, in einer Seite ist schon alles drin. Ich denke, daß das bei den Sachen nach SoJa ähnlich ist. Wenn man einen guten Text rausnimmt, dann ist da schon alles drin. Durch die Lektüre kannst du das vertiefen.
Dahlke: Die Texte nach SoJa machen meiner Meinung nach andere Entdeckungen als die ganz frühen. Die frühen halten ganz unterschiedliche Entdeckungen an der Sprache bereit, Syntax, Worte, Seme, Buchstaben betreffend. Damit kann ich als Leser/Hörer spielen, ich kann eine Entdeckung mitmachen, eine andere nicht; sie sind für mich also „konsumierbarer“. Die nach SoJa machen Entdeckungen, die sehr viel mehr an Deine Person gebunden sind, auf die ich mich dann einlassen muß … Ich gerate in den Sog oder eben nicht.
Papenfuß: Dieses ganze Manuskript, das sich in den Jahren angesammelt hat, Odium wird es heißen, ist, glaube ich, insgesamt anarchisch. Aber das Anarchische und Anarchistische wird in den Texten diskutiert. Insofern war für mich die Arbeit an „zoro in skorne“ mit Faktor und Döring sehr wichtig, die sind skeptischer … und fanatischer. In der Zeit war ich vom Anarchischen ins Anarchistische, also Institutionalisierte, abgerutscht und wollte das aber eigentlich nicht. Auch in SoJa gibt’s schon diese Auseinandersetzung, wo jeder Ismus, also auch der Anarchismus angezweifelt wird. Aber immerhin war es die einzige Direktive für meine Lebenshaltung, die wollte ich nicht so gern aufgeben. In „zoro in skorne“ hab’ ich’s durch die Arbeit mit den beiden eher wieder relativieren können, sind es eher wieder Schläge gegen Anarchismus und gegen Wilhelm Reich, den ich damals fanatisch rezipiert habe.
1988 hab’ ich dann „notdichtung“ geschrieben, das ist, was in dem Buch led saudaus drin ist; dann kam tiské, und der zweite Teil von led saudaus ist dann „karrendichtung“. Mit den beiden Büchern bin ich sehr einverstanden, weil ich eigentlich ab da für mich die Möglichkeit erobert hatte, mit allen meinen, wenigstens linguistischen, Erfahrungen frei umzugehen.
Dahlke: Aber Du wendest sie doch nicht mehr so exponiert an?
Papenfuß: Ja, der Text sieht nicht mehr wie ein experimenteller aus. Aber all diese Erfahrungen sind in diesen Texten mit angewandt.
Dahlke: In tiské: finde ich ganz viele „normale“ Worte, auch politische Vokabeln: „ihr wart das volk“, „frühreifer oktober“, „die deutschen überschlagen sich“, „die überwältigten sieger“ usw.
Papenfuß: Das war eigentlich immer da, ich war eigentlich immer sehr … politisch. Aber in den ersten beiden Manuskripten war es für mich eher wichtig, die Politsprache der DDR zu persiflieren, die Zeitungen, die Transparente. Wir hatten großen Spaß daran; wir sind durch die Straßen gegangen und haben uns gebogen vor Lachen. Das wäre in dieser Situation, 1989, jedenfalls für mich, schlechter möglich gewesen. Ich hab’ mich ja schon ernsthafter damit auseinandergesetzt, deshalb ist das Spiel auch ernster, aber es ist immer noch dasselbe Spiel. Ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, mich auf die Sprache der Werbung usw. einzulassen. Die nutzen ja sehr effektiv die Technologie der Konkreten. Dann müßte ich richtig hart arbeiten, ständig Medien rezipieren, würde mich also in einen jahrelangen Klinch mit der Sprache der Medien begeben. Ich hätte auch Lust dazu, ich habe das ja probiert, als ich ein halbes Jahr für Die Andere gearbeitet habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich verliere zu viel…, ja: poetische Energie dabei. Mit „poetisch“ meine ich jetzt nicht streng Poesie im literarischen Sinne, sondern auch im schöpferischen Sinne überhaupt.
Dahlke: Laß uns nochmal auf die „Hoch-Zeit“ der Prenzel-Berg-Szene, so 78 bis 85, zurückkommen. Wie stellt sich diese Vergangenheit von heute aus für Dich dar? Ich lese da in tiské: „wählten wir ja die zurückgeborgenheit & in dieser die freiheit, die einkehrt, so sehr sie einkerkert“, oder: „die exilelfen der unbegrenzten möglichkeiten / verwandelten das kultspiel der machthabenden / in ein medienspektakel für die ohnmächtigen“. Hier wird ja ziemlich vordergründig gesprochen und hart ins Gericht gegangen.
Papenfuß: Ja, aber das bezieht sich zu sehr auf die konkrete Situation 1989. Ich war in Irland und wollte eigentlich ein Buch schreiben. Ich hab’ mich sehr viel mit Irland und mit Keltentum, mit keltischer Mythologie beschäftigt. Als ich ungefähr fünfzehn war und quasi politisiert, hatte ich Sympathien für radikale politische Organisationen – die RAF hat eben mit der IRA zusammengearbeitet und die IRA mit der PLO – … und dann der deutsche Anarchismus. Ich meine, ich mußte nicht mehr Biermann hören, wir hatten schon „Ton, Steine, Scherben“. In der Szene, wo ich damals war, da war es normal, man hat eben „Ton, Steine, Scherben“ gehört, irische Folklore, hat sich eminent politisch gegeben, Geländespiele gemacht und Waffen usw. Dann gab’s eben auch eine theoretische Auseinandersetzung, also Geschichte Irlands, später Mythologie. Bei tiské hatte ich mir eigentlich vorgestellt, ich gehe nach Irland und versuche herauszufinden, wie ich vor Ort auf all meine Vor-Erfahrungen und Vor-Urteile reagiere, Ist mir aber nicht so richtig geglückt, weil dann in der DDR das anfing, die Grenze wurde aufgemacht, die Zeitungen waren voll davon und dann mußte ich mich notgedrungen eben auch damit auseinandersetzen und hab’ das getan.
Dahlke: Es treffen also im Band zwei verschiedene Problemkreise aufeinander.
Papenfuß: Ich finde tiské heute eigentlich insgesamt ziemlich homogen. Ich meine, ich wollte nicht über Irland schreiben. Es ist insofern homogen, weil es meine Erwartungen und Vorurteile über Irland und die Kelten – die ich ja auch in Frage stelle, es ist ja nicht so, daß ich besonders keltophil bin – in Relation zu den Ereignissen in Deutschland darstellt, was ja nur natürlich ist, weil ich eben hier aufgewachsen bin und meine Grunderfahrungen gemacht habe. Viele Texte, die sich mit Deutschland auseinandersetzen, sind sehr direkt.
Dahlke: Genau das war meine Kritik.
Papenfuß: Ich war zu betroffen, ich mußte so drauf reagieren.
Dahlke: Also kann man die „harten Worte“ eigentlich nicht so direkt auf die Prenzel-Berg-Geschichte beziehen.
Papenfuß: Nein, das bezog sich wirklich auf die Situation 89 und kurz davor, aber es ist nie eine Abrechnung oder ein Rückblick auf die Phase vorher −
Dahlke: – aber es fängt an mit „wir schreiben / im beginnen originär, im fortlauf originell / über’n berg ordinär, / zugrunde gar nicht mehr.“
Papenfuß: Das ist poetologisch, individuell, subjektiv.
Du mußt ein bißchen vorsichtiger damit umgehen, ich meine, das Wir in meinen Texten ist rhetorisch, ich benutze es nur, um eine höhere Ansprechbarkeit zu erzielen. Die Leute, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, also Faktor, Döring und Anderson, sind sehr unterschiedlich; eigentlich ist es schwer, überhaupt „wir“ dazu zu sagen. Wenn ich in Texten Sascha oder Stefan erwähne, dann ist es meistens abstrakt, es bezieht sich nicht haargenau auf Sascha, sondern, sagen wir, auf einen Aspekt meiner Persönlichkeit, den ich transformiere.
Dahlke: Zu einer Besonderheit Deiner Kunst, die ja nicht „nur“ Literatur ist: manche Texte muß man sehen, andere wirken erst beim Sprechen, dann die Musik … Ich habe schon Schwierigkeiten, das zu benennen, „Kunst“ sagt wieder gar nichts aus, ich würde es vielleicht „Gesamtkunstwerk“ nennen, aber Du sprichst auch von „Lesungen“…
Papenfuß: Ich würde eigentlich kaum rein literarische Lesungen machen, wenn die nicht so gut bezahlt würden. (…) Wenn ich mit Musikern und Malern auftrete, gibt’s dieselbe Summe, aber eben für alle … Mir macht es Spaß, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und auch, dabei zu „verschwinden“. Beim neuen Buch möchte ich so ein Projekt mit einer Gruppe von Künstlern machen, mit „Endart“, mit einer Gruppe von Musikern, „Novemberklub“, und dann bin ich auch noch irgendwo, das gefällt mir, mich in einem Kontext zu finden. Man kann das noch anders sagen, nicht nur Kontext, sondern ein Großteil der Arbeit ist ja daran, überhaupt diese Situation zu kreieren, daß eben die Leute so zusammenarbeiten, zu motivieren, auch den Verleger zu motivieren, daß er soviel Geld ausgibt, und dann muß man wahrscheinlich wieder den Leser motivieren, ein ziemlich teures Produkt zu kaufen, d.h. man muß dann wahrscheinlich wieder touren und so was. Das ist eigentlich meine Vorstellung von Arbeit, und die Tendenz dabei ist, zu verschwinden, als subjektiver Dichter zu verschwinden. Ich habe inzwischen zu viele Dichter erlebt, auf Festivals und auf Lesungen, denen es nur darauf ankommt, sich zu exponieren und sich immer mehr aufzublasen.
Dahlke: Noch mal zu der Präsentationsform Deiner Texte. Du sagst, Du verschenkst lieber Manuskripte als fertige Bücher, d.h., wenn ein Buch gedruckt vorliegt, ist das gar nichts Besonderes für Dich? Ist das Besondere eher der Punkt, an dem Du einen Zyklus oder Band abgeschlossen hast?
Papenfuß: Das ist eigentlich das Besondere. Und zunehmend ist es die Arbeit daran, also, je mehr ich mit anderen Leuten daran arbeite, ist es die Arbeit daran. Die Arbeitsversion der Texte von tiské habe ich Penck gegeben. Ich kannte seine Skizzenbücher. Dann entsteht so langsam ’was Definitives und dann tritt der Verlag in Kraft, dann kommt der Herausgeber und bringt seine Vorstellungen ein, die nie die sind, die ich habe oder die der Künstler hat, das stimmt nie ganz überein, das Buch wird nur ungefähr das, was man eigentlich wollte.
Dahlke: Der Verlag GALREV, den Anderson, Hesse und Schedlinski gegründet haben, ist also für Dich keine besondere Möglichkeit zur Veröffentlichung?
Papenfuß: Bei Galrev war SoJa das erste Buch, was die überhaupt gemacht haben, da war die Situation so hektisch, daß es gar nicht ging, da sind Fehler drin, Fehlsetzungen, eigentlich müßte unbedingt drin stehen, daß es alte Texte sind … Nee, nee, da sind auch viele Sachen passiert, mit denen ich nicht einverstanden bin. Bei led saudaus war es so, daß ich zu lange an diesen komischen Zeichnungen da gearbeitet habe –
Dahlke: – die Zeichnungen sind von Dir?
Papenfuß: Ja. Hier war’s eben so, daß ich zu lange am Kopierer und am Computer gearbeitet habe, daß ich heilfroh war, die Sache endlich fertig zu haben. Ich wußte schon vorher, daß das Buch nie so wird, wie ich mir das vorstelle; so ist es eben auch gekommen. Ich meine, so ist es jedesmal. Bei harm war’s ein bißchen anders. Das war das erste Buch, das gedruckt wurde; aber danach wird es so normal: Du kriegst es irgendwann, regst dich drüber auf, legst es weg, hast eben so ’nen Stapel, den man ein paar Leuten schenken kann, dann ist es gut und dann vergißt man es auch langsam.
Dahlke: Noch was anderes: In Sprache und Antwort finde ich die Aussagen zur Eigendynamik des Schreibens sehr interessant. Auch das, was als Projekt vorgeführt wird und was man dann anschließend „praktisch“ nachlesen kann, die Texte zum „landlauf“.
Wenn man so lange schreibt, 15, 20 Jahre, kann man da Naivität, die wahrscheinlich zum Schreiben nötig ist, immer wieder herstellen?
Papenfuß: So was gibt’s immer wieder, man verändert sich ja im Laufe des Lebens, durch persönliche Erfahrungen und sowas und irgend wie verändert sich auch die Technologie, wie man schreibt. Das ist nicht kongruent zueinander, da ist es immer wieder sehr erstaunlich, was dann in bestimmten Situationen wie dabei herauskommt. Meine Intention ist dabei nicht, das Staunen herzustellen, oder wie Du sagtest, Naivität zu bewahren, sondern es überhaupt hinzukriegen.
Dahlke: Stichwort Literaturkritik. Interessiert sie Dich, ärgerst Du Dich darüber, fühlst Du Dich ermutigt?
Papenfuß: Eigentlich interessiert sie mich nicht groß. In der letzten Zeit eigentlich sowieso nicht, die Verlage waren auch ziemlich schlampig, ich habe kaum Kritiken zugeschickt bekommen. Aber vor ein paar Jahren …, was mich am meisten gefreut hat, war, daß die Feministinnen ganz positiv drauf reagiert haben. Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Was irgendwelche bezahlten Leute darüber denken, ist mir völlig egal.
Dahlke: Wie arbeiten eigentlich Lektoren mit Dir? Stilistische Anmerkungen sind ja schlecht vorstellbar bei einer solchen Poesie.
Papenfuß: Überhaupt nicht. Harm – da gab’s kein Lektorat. Ich habe das Manuskript abgegeben und die haben das so gemacht. Bei dreizehntanz bestand die Aufgabe der Lektorin darin, sich nicht einzumischen. Ansonsten …, es gab nie ein Lektorat. Ich glaube, daß es auch sehr schwierig wäre.
Dahlke: Abschließend noch die berühmten Fragen:
Stichwort Mentoren. Pietraß hat damals die Veröffentlichung in Temperamente ermöglicht, Mickel schrieb das Geleitwort in Sinn und Form. Wie stehst Du überhaupt zur Mentorenschaft in der Literatur? In der DDR war ja die Mentorenrolle nicht nur eine ästhetische, sondern oft auch politisch eine Art Bürgschaft.
Papenfuß: Ja, das war für mich sehr peinlich. Ich habe vor zwei Jahren zufällig bei einem Musiker, mit dem ich zusammenarbeite, ein paar Texte rumliegen sehen von einer jungen Frau. Ich fand die gut und wollte, daß die in der verwendung veröffentlicht werden. Ich habe die Egmont (Hesse) gegeben. Der meinte, das sei ihm zu chaotisch, schließlich war die Forderung: O.k., wir machen’s, aber du mußt ein Vorwort schreiben. Plötzlich befand ich mich in der Mentorensituation. Karen Matting heißt die Frau, ich finde die nach wie vor gut, kräftig und sehr anarchisch. Das Vorwort habe ich nicht geschrieben, ich habe ein Interview mit ihr gemacht, hab’ mir einfach aus der Zeitung so Standardfragen rausgesucht: Wie haben Sie sich heute morgen gefühlt … Die Fragen habe ich ihr gestellt, sie hat drauf geantwortet und damit ging’s. Dann haben sie das gemacht. Ich fand das eher ein schlechtes Zeichen für die Zeitschrift, daß sie sowas braucht.
Weiter habe ich keine Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß natürlich, welche Rolle Gerhard Wolf und Mickel für mich gespielt haben, aber ich habe die eher als politische Persönlichkeiten begriffen, als Persönlichkeiten, die das kulturpolitisch motivieren können, daß ich überhaupt irgendwas machen kann, veröffentlichen oder Lesungen machen kann. Es waren keine poetischen Mentoren für mich.
Dahlke: Volker Braun reagierte sehr empfindlich auf eine Aussage von Dir im Interview im Freilag (Nr. 24/1991), die lautete: „… Andere, Volker Braun und Hermann Kant etwa, haben darüber ganz anders gedacht: Man sollte das lieber nicht drucken, weil man nicht weiß, was man sich da für schlimme Sachen ins Nest setzt. Außerdem halten sie formale Probleme damit…“. Braun darauf: „Wie hätte ich meinen können ,man sollte das lieber nicht drucken‘ – ich, dessen jedem Manuskript dieser Satz entgegenschlug? (…) Ihre Sätze jetzt, lieber Freund, sind säuisch“. Was steckt da eigentlich dahinter?
Papenfuß: Da steckt gar nichts dahinter. Es klingt jetzt vielleicht ein bißchen böse, aber ich habe so an diese Situation damals gedacht in der Akademie der Künste. Eigentlich hätte ich sowas sagen sollen· wie Noll, der ist mir nicht eingefallen, da ist mir eben „Volker Braun“ rausgerutscht. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Dann war ich so ziemlich erschrocken, wie ernst sowas genommen wird. Ich würde das nicht ernst nehmen. Das nächste, was mich erreichte, war nicht der Brief Brauns, sondern Richard Pietraß, der zu mir kam und sagte: „Was hast du da gemacht, du mußt dich entschuldigen…“. Oh Gott, was habe ich getan, gut, gut, ich entschuldige mich. Am nächsten Tag kam Gerhard Wolf mit dem selben Ding, und dann wars mir zu fett. Ich habe dann Braun irgendwann gesehen, und gesagt, Du, tut mir leid. Ich fand ihn ziemlich kulant. Das wars. Ich meine, ein bißchen was ist ja auch dran, das hat ja immer einen realen Hintergrund, wenn sowas passiert…
Dahlke: Ja, wenn ich da an den Rimbaud-Essay denke … (in Sinn und Form 1985, Heft 5).
Papenfuß: Ja, genau, daran mußte ich dann später auch denken.
DAHLKE: Die Frage nach den „Vätern“ will ich nicht stellen. Ist es so, daß man mit dieser Frage wirklich etwas herausbekommt über den Dichter Papenfuß-Gorek?
Papenfuß: Nein, das ist völliger Quatsch. Als Mickel das geschrieben hat, war das Mickels Problem, das hat nichts mit mir zu tun. In dem Interview im Freitag habe ich dann versucht, das zu relativieren, habe mir Franz Jung so als Wunsch-Vater hingestellt, was ich im nachhinein auch bedaure. Ich hätte damals eigentlich sagen sollen, nicht die Väter-Frage ist entscheidend, sondern die der Mütter…
Natürlich steht das ja alles in einer bestimmten Tradition. Mich interessieren in der Literatur ganz bestimmte Sachen und ich sehe mich da auch in einer bestimmten Tradition.
Dahlke: Die ist aber eher eine kulturelle als eine poetische?
Papenfuß: Ja, kann man sagen.
Dahlke: Ist Deutschland ein Thema für Dich? Manchmal kann man so etwas finden wie: „gegen das hochdeutsche / für das niederdeutsche unterdeutsche / in aller deutlichkeit undeutsche“.
Papenfuß: Ja, aber nachträglich. Ich fand das richtig peinlich, wie Sascha und Kolbe Deutschland thematisiert haben, Deutschland war für mich nie ein Thema. Region schon, ich hatte eben bestimmte Probleme, dann bin ich woanders hingegangen, da gab’s wieder andere regionale Probleme, die in Greifswald sind anders als die in Schwerin, dann kam ich nach Berlin usw. Aber Deutschland als Ganzes hat mich nie interessiert. Das hat auch was mit meinen politischen Überzeugungen zu tun, ich bin eben gegen jeglichen Staat, prinzipiell. Deutschland ist nichts, ein Sammelsurium, das sich irgendwann zum Staat aufgeschwungen hat.
Dahlke: Wird aber nicht Deutschland für jeden, auch den, der’s nicht will, zum Thema?
Papenfuß: Ja, ist es dann ja auch geworden. Ich habe mich auf meine anachronistische Weise dann doch damit auseinandergesetzt, als es zu spät war. Aber damals nicht. Meine Verflechtungen sind eher international, ich kann hinkommen, wo ich will, London, Leningrad oder Toronto. Ich finde sofort Leute, mit denen ich mich gut verstehen kann. Ich glaube, ich habe immer eher internationalistisch gedacht.
Das Gespräch führte Birgit Dahlke am 3.12.1991 in Berlin
Sprachgewand(t) – Ilona Schäkel: Sprachkritische Schreibweisen in der DDR-Lyrik von Bert Papenfuß-Gorek und Stefan Döring
Heribert Tommek: „Ihr seid ein Volk von Sachsen“
Robert Mießner: Entschlossenes Leben
Mark Chaet & Tom Franke sprechen mit Bert Papenfuß im Sommer 2020 und ein Auftritt mit Herbst in Peking beim MEUTERLAND no 16 | 1.5.2019, im JAZ Rostock
Kismet Radio :: TJ White Rabbit presents Bertz68BirthdaySession_110124_part 2
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Lorenz Jäger: ich such das meuterland
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.1.2016
Zeitansage 10 – Papenfuß Rebell
Jutta Voigt: Stierblut-Jahre, 2016
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Thomas Hartmann: Kalenderblatt
MDR, 11.1.2021
Zum 69. Geburtstag des Autors:
Mareile Fellien-Papenfuß auf Facebook, 11.1.2025
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram +
KLG + IMDb + Archiv + Internet Archive
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Bert Papenfuß: FAZ ✝︎ taz 1 & 2 ✝︎ BZ 1, 2 & 3 ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ LVZ ✝︎ telegraph ✝︎ lyrikkritik 1 & 2 ✝︎ NDR ✝︎
junge Welt 1 & 2 ✝︎ freitag ✝︎ nd 1 & 2 ✝︎ Zeit ✝︎ MZ ✝︎ Facebook ✝︎
Abwärts! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✝︎ Volksbühne ✝︎ Faustkultur ✝︎ DNB ✝︎
artour ✝︎ Fotos
Nachruf auf Bert Papenfuß bei Kulturzeit auf 3sat am 28.8.2023 ab Minute 27:59
Bert Papenfuß liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.
Bert Papenfuß, einer der damals dabei war und immer noch ein Teil der „Prenzlauer Berg-Connection“ ist, spricht 2009 über die literarische Subkultur der ’80er Jahre in Ostberlin.
Bert Papenfuß, erzählt am 14.8.2022 in der Brotfabrik Berlin aus seinem Leben und liest Halluzinogenes aus TrakTat zum Aber.