Björn Kuhligk & Jan Wagner (Hrsg.): Lyrik von JETZT
EINE LUNGE VOLL TEXT
I atemzug rauch befreit mich von ihm
aufatmend das gefuehl von ersparnis
ausatmend die frage wozu auch
die penetranz des entlohnt und belohnt sein wollens
hinterhaeltig wie hoffnung
wie dieser atem
nicht abstellbar
Knud Gerwers
Vorwort
Was ist eine dokumentarische Anthologie?
Kennerschaft und Überblick sind die Grundvoraussetzungen, die der Herausgeber einer Anthologie mitbringen muß. Selbst aber wenn diese beiden Vorzüge gegeben sind, stecken in ihnen Tücken. Kennerschaft ist ein Ausschlußverfahren, geprägt und eingeschränkt von persönlicher Akzeptanz, und Überblick eine Standortfrage. Beides sind wertende Systeme, die durch Auswahl, Anordnung und Umfang der Repräsentation Hierarchien bauen oder bestätigen. Ohne Zweifel können so beeindruckende Sammlungen entstehen, man denke an Benns Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts, an Enzensbergers Museum der modernen Poesie oder an Under-Cover-Klassiker wie Ergriffenes Dasein. Die Regel ist dies allerdings nicht. In der Regel bemühen sich Anthologien um Rahmen, Fächer oder jene oft äußerst prekären Themenkomplexe, die das Gedicht in Zusammenhänge hineinvergewaltigen, in denen es vollkommen den Faden verlieren kann. Außerdem entsprechen Auswahl und Zusammenhang, besonders wenn es sich um zeitgenössische Sammlungen handelt, sehr oft nicht dem aktuellen oder dem tatsächlichen Kräfteverhältnis der poetischen Produktion. Dieses nämlich ist instabil und beinhaltet oft starke Stimmen, die der Literaturbetrieb nicht oder noch nicht legalisiert hat. Oft sind aber gerade diese Texte die Tankstellen jener Autoren, die ihren gemieteten Anthologieplatz nur noch müde und ums eigene Ei kreisend besetzen. Die dokumentarische Anthologie versucht dieses Dilemma zu unterlaufen. Sie instrumentalisiert die Kräfte der Selbstorganisation literarischer Szenen.
Was heißt das?
Die Kraft von Texten, sich zum Vorschein zu bringen, wird durch unzählige Vorgänge gehemmt. Konkurrenz, Neid, Vorurteil, Unverständnis und vor allem durch den Einfluß der Throninhaber! Last but not least natürlich durch das Parteigängertum entweder lokaler oder spartenspezifischer Provenienz. Beispielsweise die Konkreten oder die Performer gegen die Enigmatischen. Gedichte, die da sind, öffentlich greifbar, haben oft schon lange Wege hinter sich bis zu ihrer ersten Veröffentlichung in Buchform. Vorarbeit, hier die Spreu vom Weizen zu trennen, leisten die kleinen Zeitschriften, die Zirkel, Szenen und Wettbewerbe. Sie sind die Börsen für die Anfänger. Hier entstehen Gerüchte, Geheimtips, die neuen Namen. Diese Kräfte ersetzen mühelos, einfach weil sie viel komplexer sind, die Qualitätskriterien von Juroren oder Herausgebern. Das Prinzip der dokumentarischen Anthologie ist also zuerst einmal positivistisch. Was sich gezeigt hat, besitzt per se den Wert, in Betracht gezogen zu werden. Auf einer ganz anderen Ebene und jenseits der Manipulateure in eigener Sache wird dann eh mit ganz anderen Striegeln gebürstet.
Heute kommt allerdings zu all dem etwas hinzu, das in seiner Bedeutung überhaupt nicht zu überschätzen ist.
Die neue Generation, die Generation, die hier zum ersten Mal in solcher Vollständigkeit sich vorstellt, besitzt eine Verknüpfungsdichte und einen Beobachtungsumfang, der erst durch die Hypertrophierung von Kommunikation in allerletzter Zeit überhaupt möglich wurde und die es so bisher nie gegeben hat. Bisher waren literarische Szenen Ausstrahlungsphänomene, die erstens noch stark von der Dualität zwischen Großstadt und Provinz geprägt waren, zweitens Ausstrahlungszeit benötigten. Das hatte den Vorteil, daß die Nischen für Ausreifungszeiten zahlreicher waren, während heute das Überfischen der Jugendgewässer und das vollkommen enthemmte Absammeln erster Früchte in allen Sparten binnen kurz oder lang dazu führen wird, den Bestand überdurchschnittlich entwickelter Kunst abzuschließen und durch konstante, mittellagige Beunruhigungs- oder Belustigungspegel zu ersetzen. Wir sind dann wieder dort, wo alles einmal angefangen hat, bei Magie und Spiel.
Eine Generation wird gegründet
Im Jahre 1999 hatte ich zusammen mit Orsolya Kalász eine Anthologie junger ungarischer Lyrik zusammengestellt, die bei DuMont unter dem Titel Budapester Szenen erschienen ist. Diese Sammlung war strikt auf die Generation der Zwanzig- und Dreißigjährigen beschränkt und ermittelte ihre Beiträge aus den verschiedenen und in Ungarn relativ gut aufspürbaren Szenen, ohne sich dem Druck von „Empfehlungen“ zu beugen, die vorwiegend aus der „herrschenden Generation“ kamen.
Als diese Arbeit abgeschlossen war, begann ich mich etwas gründlicher als vorher in Berlin umzusehen.
Während die Lyriklesungen in Literaturhäusern oft phänomenal leer bleiben, also einen Saal, der vielleicht mit zwanzig Leuten besetzt ist, noch leerer aussehen lassen, als er sowieso schon ist, entstanden in Berlin aus den vor den 90er Jahren noch etwas staubigen Spielstätten der Alternativkultur Cafés, Clubs, Kinos und andere Auftrittsorte, die nicht immer, aber oft zum Bersten voll waren, wenn Gedichte gelesen wurden.
Das hatte mehrere Gründe. Der erste liegt in der eingangs schon erwähnten neuen Qualität der Kommunikation. Da ging eine SMS oder eine Mail an die Leute raus, die man sich als Zuhörer wünschte, und die kamen dann auch. Der zweite Grund liegt wohl am Hintergrund. Man hört Gedichte dort, wo man sonst vielleicht sowieso hingehen würde. Mit etwas Glück waren die Brüder und Schwestern aus der neuen Musik, der bildenden Kunst oder vom Theater auch noch da, und man hatte nicht die krampfhafte Unterbrechungskunst mit Saxophon, Harfe oder Klanginstallation zu fürchten, welche die vom Lyrikgenuß schwirrenden Gehirne noch weiter intoxifizieren und durchklingeln. Und anschließend tanzt man vielleicht und kennt die Leute, von denen die Musik stammt oder die sie auflegen. Und schließlich geht es in den Gedichten oft um etwas, das nahtlosen Wiedererkennungswert bei gleichzeitig real zeitlichen Wallungswerten besitzt. Folgerichtig werden diese Veranstaltungen nicht von der Mimik seelischer Niedergeschlagenheit begleitet, sondern von Neugier und Konzentration. Angesiedelt haben sich diese Auftritte um eine Handvoll Zeitschriften und Spielstätten, dem Club Eschschloraque, dem SchokoLaden, dem Bastard Club im Prater, dem Kaffee Burger, dem Fischladen, dem Roten Salon, der Kalkscheune, dem Friedrichshainer Weinsalon und um die Zeitschriften Intendenzen, die Literaturschachtel Die Außenseite des Elements, die Losen Blätter, die Veröffentlichungen des Kook Labels, Lauter Niemand oder aber der Leipziger Edit. Anders als bei den groß gepowerten Literaturevents, bei denen die Elixiere des „Dabeiseins“ überwiegen, blieb oder bleibt auf diesen Lyrikbühnen die Hörspannung persönlich und intim.
Als ich nach etwa einem Jahr den Eindruck hatte, die Namen jenseits derer, die man sowieso weiß, zu kennen und ihren Ton im Text und die Nennungsdichte unterscheiden zu können, und auch bereits Texte zusammengestellt hatte, eröffnete mir Björn Kuhligk, daß er zusammen mit Jan Wagner bereits seit zwei Jahren an gerade dieser Anthologie arbeite, daß das Projekt so gut wie abgeschlossen sei und ob ich nicht das Vorwort dazu schreiben könnte. Mit einem leichten Anflug von Bedauern erkannte ich, daß dies natürlich viel mehr Sinn macht, denn die fingen ja die Fische im Pool und ich mußte sie mir vom Ufer aus angeln.
Es gelang mir, Jan Wagner und Björn Kuhligk davon zu überzeugen, ihren „Jahrgang 1965“ als Altersgrenze unbedingt zu halten, diese Grenze aber zu den Jüngeren und ganz Jungen hin großzügig zu öffnen und all jene mit aufzunehmen, die in ihren Augen hervorragende oder aufregende Gedichte geschrieben hatten, ohne Rücksicht, ob da nun schon ein Buch vorliegt oder ob die schon mal zum open mike oder zum Leonce-und-Lena-Preis eingeladen waren.
Zum weiten Feld der bereits vorhandenen, tadellosen Sammlung trat nun noch der breite Rand der Besten unter den Noch-kaum-Bekannten, die Björn Kuhligk und Jan Wagner sozusagen in einer zweiten Runde zusammenstellten. Die Herausgeber gaben jedem Autor, jeder Autorin, vier Sprach-Fenster. Nachdem die Arbeiten und Nachrüstungen abgeschlossen waren, fiel über dieses Werk nun fast ein Schatten von synchronisierter Vollzähligkeit. Dies wird auch den Rang dieses Buches sichern, egal ob Wölfe heulen oder Schafe blöken, denn es ist ein Buch, das eine Generation komplett aus dem eigenen Boden gestampft hat.
Zum Gesang – oder über „das verlangen einen kirschkern gespuckt zu haben“
Bei vielen oder sogar den meisten Gedichten handelt es sich um Texte, die im Ton oft einen sehr trockenen Ausklang der Postmoderne erkennen lassen, immer wieder auch ein lakonisches Parlando einschlagend, am Schluß häufig mit dem Pathos eines poetischen Abwinkens. Das Moment der poetischen Überraschung bricht klammheimlich aus einem gehobenen Umgangston oder verwandelt sich aus der zufälligen Beobachtung osmotisch in die verdichtete Dosis von Verszeilen. Die Struktur der Gedichte ist intelligent, durchmischt von der Multilingualität der Popkultur – den Grooves, den Freezes und den Loops – die Korrespondenzen kommen als Tunnelblick oder Trockenmeldung. Oft sind es neusprachliche Töne auf herkömmlichen Tonträgern. Reine Sprachakrobatik ist im Schwinden, ebenso wie rap oder ähnliche Moden. Wahrscheinlich haben bei Letzterem einfach viele inzwischen begriffen, daß man den echten (inzwischen auch nur noch in Anführungszeichen) rap oder hiphop im Royal Bunker oder der Beatfabrik findet und nicht in den Literaturhäusern.
Dann wiederum eröffnen sich in diesen Texten feine Zuspitzungen, in die das urbane Lebensgefühl, vorzugsweise der Hauptstadt, einschießt, die auch den intellektuellen Overkill der späten 80er und frühen 90er scheinbar überwunden haben. Sie kommen so gelassen daher, daß sich bildungsmelancholische Partikel fast unbemerkt ansiedeln können.
Gleichzeitig bestückt man die in der Moderne geschnürten Pakete großstädtischer Getriebenheit mit den stimmungsmäßigen oder nomenklaturischen Updates. Lediglich der Umgang mit Sex wirkt manchmal, als wäre dieses Thema den Dichtern wie eine heiße Kartoffel zwischen die Finger geraten, während sie sich lieber weiter mit der Technizität der Bewegungen von Aquarienfischen befaßt hätten. Delikatesse der Bilder und stilistische Schlankheit sind oft hervorstechend. In Gesprächen habe ich versucht, Selbstdeutungsbereitschaften aufzuspüren oder Generationsbestimmungen zu erkunden. Dies allerdings erwies sich als schwierig. Man bewegt sich scheinbar in einem Dickicht des Jederzeit-Möglichen, ohne der Wahrheit oder dem Guten einen prinzipiellen Vorzug einzuräumen. Die Verbindung zur Welt ist die der Gleichzeitigkeit, und gedruckte Programme gibt’s dafür nicht.
Vielleicht handelt es sich bei den „Neuen Leuten“, wie wir sie auf den ersten Präsentationen vorgestellt hatten, um die erste schlagwertlose, die erste „No-Name-Generation“ überhaupt.
„Ich lebe in Deutschland aber / Viele sagen ich sehe jünger aus.“ Das Leben blendet. Die Lyrik erschafft daraus einen Blick. Der Blick klingt gut. Der einzige Prüfstein scheint das nach Maßgabe des Möglichen gelungene Gedicht.
Um den Fallen schematischer Kapitel oder der Katalogisierung zu entgehen, haben Jan Wagner und Björn Kuhligk in einem letzten Arbeitsdurchgang die Texte quasi nach Geruch, Farbe und Geräusch und in freier Aleatorik komponiert, und das Konzertstück, das daraus entstand, heißt: „Lyrik von Jetzt“.
Gerhard Falkner, Vorwort, 2003
Nachbemerkung der Herausgeber
Daß die Lyrik lebt, bedarf keines Beweises. Es wird jeden Tag offenbar, sei es bei Lesungen oder dank einer der zahlreichen Publikationen, die vor allem vom Idealismus ihrer Herausgeber zehren. Zeit dagegen wurde es für eine Bestandsaufnahme dessen, was in der jüngeren und jüngsten Generation deutschsprachiger Poesie geschieht, für eine kompakte und annähernd umfassende Sichtung der dichterischen Werke, die als Drucke oft nur verstreut zu entdecken sind und in einigen Fällen ausschließlich durch mündlichen Vortrag übermittelt werden.
Die Kriterien bei der Auswahl waren so lose gefaßt wie möglich und so willkürlich wie nötig: Das Geburtsjahr der Autorinnen und Autoren sollte nicht vor 1965 liegen; sie selbst sollten, ob durch Veröffentlichungen oder Auftritte vor Publikum, dauerhaft in der neueren Lyriklandschaft präsent sein; und es sollten vier Gedichte gefunden werden, die als repräsentativ für den jeweiligen Stil und die jeweilige Ästhetik, in einigen Fällen auch für die Wandlungen im Rahmen des jeweiligen lyrischen Programms gelten können. So sind letztlich 74 Dichterinnen und Dichter und knapp 300 Gedichte zusammengekommen, die zeigen, wie vielfältig die gegenwärtige Lyrikszene ist und aus wie vielen Traditionen sie sich speist – eine Auswahl jenseits aller oft willkürlichen Ein- und Unterteilungen, so hoffen wir, jenseits eines Schubladendenkens, das dem unvoreingenommenen Leser ohnehin fremd sein dürfte.
Bleibt uns noch, all jenen herzlich zu danken, die mit ihrer Fachkenntnis und ihrem Engagement dazu beigetragen haben, daß dieses Buchprojekt realisiert werden konnte – vor allem Gerhard Falkner, der weitaus mehr hierfür tat als das Vorwort zu verfassen.
Björn Kuhligk und Jan Wagner, Nachwort, Februar 2003
Für die Lebendigkeit
der jüngeren und jüngsten deutschsprachigen Lyrik bedarf es keines Beweises. Zeit hingegen ist es für eine Bestandsaufnahme: eine neue Generation organisiert sich ihre Öffentlichkeit.
DuMont Verlag, Klappentext, 2003
Wenn der Dichter im Tiefkühlfach die Biere explodieren lässt
– Freiwillige Abstürze in die poetische Unterkomplexität: „74 Stimmen“ vereinigen sich zum misstönenden Konzert einer „Lyrik von JETZT“. –
Uralte Echos wehen da heran, undeutliche Töne des Aufbegehrens, Zitate aus einem sehr fernen Säkulum. Es sind Echos, Töne und Zitate von Rolf Dieter Brinkmann, dem wilden Poeten aus Vechta/Niedersachsen, der bis heute die anarchische Vorbildfigur für viele eigensinnige Jungdichter geblieben ist. Als die erlebnissüchtigen Alltagslyriker der „Neuen Subjektivität“ vor zwanzig Jahren von der Bühne der Poesie abtraten, begann auch der Heroen-Glanz des lyrischen Solitärs Brinkmann zu verblassen. Seine Wiedergänger belagern nun die allerjüngste Versammlung einer neuen Dichter-Generation, die sich unter dem grammatisch eher zweifelhaften Titel Lyrik von JETZT ihr anthologisches Manifest gegeben hat.
Natürlich ist diese neue Generation nicht so naiv, sich gänzlich dem Traditionszertrümmerer Brinkmann hinzugeben. Was sich da mit sehr eigenen Wahrnehmungsweisen und Abweichwinkeln in dieser Anthologie tummelt, bewegt sich durch die unterschiedlichsten lyrischen Galaxien: von Mandelstam bis Brinkmann, von Rilke bis Rühmkorf, von Leonard Cohen bis Jimi Hendrix – und weit darüber hinaus. Aber trotz der varietätenreichen Artikulationsformen verblüfft doch die Bewunderungsbereitschaft, mit der Rebellen-Posen der Altvorderen gecovert werden.
Wieder steht ein Realismus rum
Bei mindestens vier der insgesamt 74 Autoren (Jan Volker Röhnert, Crauss, Björn Kuhligk, Tom Schulz) ist Brinkmann die überlebensgrosse Figur, die mittels stilistischer Mimesis und peinlich devoter Reminiszenzen angerufen wird. Und hätten sich die lyrischen Erbschaftsanwärter Brinkmanns nicht jedes allgemeingültige Bekenntnis verboten – sie könnten von dem radikalen Anti-Traditionalismus ihres Vorbilds durchaus profitieren. Denn der Aufbruchs-Behauptung dieser neuen Anthologie liesse sich als Motto eine lässige Sentenz Brinkmanns aus dem Band Westwärts implantieren:
Ein neuer Realismus entstand, er stand rum.
Denn es ist – schon wieder – ein „neuer Realismus“, ein sehr alter Bekannter also, der sich da in sehr vielen Texten der Anthologie breit macht. Dieser Realismus ist bislang relativ erfolgreich als jüngste Metamorphose einer Berliner Grossstadtpoesie herumgereicht worden, ohne dass er über wirklich neue sprachdynamisierende Elemente verfügte. Es kennzeichnet die trübe Sprachrealität dieser Gedichte, dass die Realien des Alltags schon für Poesie genommen werden und sich eine hemmungslose Sentimentalität Bahn bricht.
Ihre Zahnbürste in seinem Bad
„Lass besser im Tiefkühlfach die Biere explodieren“, empfiehlt etwa Björn Kuhligk, „wenn du den Bezirken zusiehst / wie sie wachsen, / verkommt auch der Wodka / weisst du, die Strassen, sie kommen / alle aus dem selben Mutterleib / aus einem Sonntag-Nachmittag-Spielfilm / und drüber dieser Richard-Wagner-Himmel / in dem ich alles zu sagen weiss / wenn ich die Hände an der Haut / der Liebe hab / es gibt hier / keine Küstenstrassen.“ Das ist, in seiner rührenden Unmittelbarkeits-Gestik und der schmeichelnden Du-Anrede, ein Aufguss des alten Gefühligkeits-Kitsches eines Wolf Wondratschek oder Jörg Fauser. Diese Realismus-Posen sind beängstigend zahlreich in der Anthologie vertreten, selbst dürftigste Elaborate einer hilflosen Beziehungskisten-Poesie haben die Herausgeber in ihrer unerschütterlichen Grosszügigkeit aufgenommen. Kersten Flenter bedichtet in furchtloser Schlichtheit das Einmaleins der Liebe:
Wir verbringen schon lange
Zeit
Miteinander reden
Sitzen im Café
Oder vögeln
Dann eines Abends
Danach
Bemerke ich
Deine Zahnbürste in meinem Bad
solche unbedarften Notate hat der strenge Lyrik-Leser Peter Wapnewski vor vielen Jahren schon treffend „Tagebuch im Stammel-Look“ genannt. Leider haben sich solche freiwilligen Abstürze in die lyrische Unterkomplexität als poetischer Normalfall in der Lyrik von JETZT etabliert. Wenn man einmal bei schönen Entdeckungen aufatmen will, etwa bei den mythengetränkten Geschichtserkundungen des grossartigen Uwe Tellkamp oder bei den bildertrunkenen Exaltationen des hoch begabten Hendrik Jackson, wird man umgehend wieder böse frustriert durch ranzig gewordene Sprachgesten verspäteter Beat-Dichter oder vollmundiger Slam-Poeten. In rührender Naivität hat die Kritik schon vor dem Erscheinen dieser Anthologie das Marketing-Signal aus dem DuMont Verlag aufgenommen und die pathetische Formel von einer „neuen Generation“ umstandslos nachgeplappert. Dabei ist gerade dieses Insistieren auf der Existenz einer neuen „Generation“ das Hauptärgernis dieser Gedichtsammlung. Denn es gibt keinerlei soziologische oder ästhetische Merkmale, die in der Gemengelage Lyrik von JETZT die Rede von einer „Generation“ rechtfertigten, einzig das biologische Faktum, dass die beteiligten Autoren nach 1965 geboren sind.
Und sie haben sich doch bewegt
Die Willkürlichkeit dieser biografischen Grenzziehung ist dabei nicht das zentrale Problem, obwohl ihr exzellente Autoren wie Michael Lentz oder Ulf Stolterfoht zum Opfer fallen, weil sie gerade mal ein bzw. zwei Jährchen älter sind. Die Fokussierung auf das Jahr 1965 hat immerhin eine verborgene literaturgeschichtliche Pointe. In diesem Jahr erschienen nicht nur Walter Höllerers bahnbrechende „Thesen zum langen Gedicht“, sondern auch die ersten Hefte des Kursbuchs, welche die Politisierung der Studentenbewegung ungemein beschleunigten. Nicht zufällig setzt auch eine bedeutende lyrikgeschichtliche Studie von Jürgen Theobaldy und Gustav Zürcher (Veränderung der Lyrik, München 1977) als lyrikgeschichtliche Markierung das Jahr 1965: „Über westdeutsche Gedichte nach 1965“. Auch in der „Generations“-Debatte hat eine Textsammlung von Jürgen Theobaldy die entscheidenden Zeichen gesetzt, nämlich 1977 in der Anthologie Und ich bewege mich doch. Hier artikulierten sich die von der Studentenrevolte geprägten Dichter, die in trotziger Selbstbehauptung das Recht auf die Selbstwahrnehmung des Ich deklarierten.
Ein ästhetisch taubes Dokument
In der Lyrik von JETZT wird überhaupt nichts mehr verkündet oder deklariert, denn es gibt kein lyrisches Kollektivsubjekt mehr, dem ein gemeinsamer Artikulationswille unterstellt werden könnte. Es ist eine Anthologie, die aus einem Juvenilitäts-Bonus ästhetische Distinktionsgewinne schöpfen will. Poetologisch hat diese Gedichtsammlung schon vorab kapituliert. Björn Kuhligk und Jan Wagner, die Herausgeber der Lyrik von JETZT, haben sich von jedweder Differenzierungsanstrengung dispensiert und lassen sich lediglich im Vorwort von Gerhard Falkner ihre Entschlossenheit zu einer „dokumentarischen Anthologie“ attestieren. Tatsächlich haben Kuhligk und Wagner das weite Feld der jungen Lyrik in seiner ganzen Ausdehnung durchschritten. Die 74 Stimmen, die sie eingesammelt haben, repräsentieren – in quantitativer Hinsicht – durchaus den poetischen Orientierungsrahmen der jungen Lyrik-Szene, dessen Konturen bislang nur in den Zeitschriften der Szene, intelligenten Periodika wie Edit, intendenzen oder Die Aussenseite des Elementes sichtbar geworden sind. Aber was ist das doch für ein ästhetisch taubes Ding, diese „dokumentarische Anthologie“! Wer nur „dokumentiert“, der sieht ab von stilistischen und qualitativen Differenzen, der verlässt sich auf positivistischen Sammelfleiss, ohne dem Stimmen-Konzert eine lyrische Kontur zu geben. Der stellt biedere Stilübungen neben avanciertes Sprechen, gibt sich mit dem Bündnis von Mittelmass und Einzigartigkeit, von Epigonalität und Avantgarde zufrieden. Wer jedem Autor unterschiedslos vier „Sprachfenster“ zugesteht, der sorgt für die rigide Nivellierung der himmelweiten Rangunterschiede.
Zwei Dutzend Solitäre
Die Nivellierungswut geht so weit, dass gerade von den besseren Autoren – etwa vom österreichischen Sprach-Verballhorner Franzobel oder von der mit schönen syntaktischen und semantischen Verschiebungen arbeitenden Anja Utler, teilweise auch von Hendrik Jackson – nur sehr konventionelle, mitunter biedere Exempel ausgewählt worden sind, um auch hier noch eine Qualitätsbereinigung nach unten durchzuführen. Das Ergebnis ist ein lyrischer Gemischtwarenladen, in dem man die wirklich singulären Dichter mit der Lupe suchen muss. Von den „74 Stimmen“ sind – bei grosszügiger Betrachtung – gerade mal zwei Dutzend als lyrisch eigenständige Dichter ernst zu nehmen, der übergrosse Rest geht den Weg des geringsten ästhetischen Widerstands. Aber wer mit ein wenig Geduld die Lyrik von JETZT studiert, wird auch auf die originären Sageweisen, die kühnen Artikulationen jener Dichter stossen, die wirklich Aufmerksamkeit verdienen. Da sind die Wahrnehmungs-Exerzitien eines Nico Bleutge, optische Feineinstellungen als Vorschule eines neuen Sehens; da sind die intensiven, ganz auf das Rätsel der Physis konzentrierten Körperbilder Silke Andrea Schuemmers; da sind die überwältigenden mystischen Schöpfungsgeschichten Christian Lehnerts oder die kalten Stillleben der Liebe von Marion Poschmann. Da trifft die lyrische Mentalitätshistorikerin Sabine Scho, die mit schroffen Montagen die vom Faschismuskontaminierte Sprachlandschaft der Adenauer-Zeit durchquert, auf den Anti-Idylliker Hauke Hückstädt, einen Spezialisten für die ironische Unterminierung von Genrebildern und Alltagsszenen. So wird man doch ein wenig entschädigt für die beträchtliche Anzahl lyrischer Totalausfälle, die sich in dieser Bestandsaufnahme des lyrischen Jetzt-Zustands eingefunden haben.
Entwutschendes Schwimmviech
Wer aber nach den vielen grausamen Ernüchterungen dieser Anthologie noch immer nach einem gemeinsamen Merkmal der neuen Lyriker-„Generation“ fragt, sei auf die Ungreifbarkeiten in Dirk von Petersdorffs Diskurs-Analyse verwiesen:
Am Grund der Diskurse ein Fisch, ein
Fisch, der nicht zu fassen ist, es ist
ein Fisch, am Grund der Diskurse
schwimmt ein Fisch, nicht zu fassen,
am Grund ein Fisch, der schwimmt, am
Grund der Diskurse schwimmt ein Fisch,
ein Fisch, der nicht zu fassen ist.
Michael Braun, Basler Zeitung, 25.7.2003
Baumfällen
– Zur Phänomenologie des Niedermachens in der deutschen Literaturkritik am Beispiel Michael Brauns und des Bandes Lyrik von Jetzt. –
Vor zwanzig Jahren, Anfang der 80er Jahre, sollte im damals literarisch noch sehr renommierten Darmstädter Luchterhand Verlag in der Sammlung Luchterhand ein Band mit dem Titel Gegenschlag – die Literatur kontert die Kritik erscheinen. Im Einladungsbrief, der an fast alle deutschen Autoren ging, die zur „Literatur“ gerechnet wurden, war darauf hingewiesen worden, daß weder Racheschreiben noch Wutprosa erwünscht wären, sondern brillante Demontage falscher Attacken. Wir hatten uns höchstens die Bosheit Heinrich Heines oder das Skalpell Nietzsches an den Abszessen falschen und faulen Argumentierens gewünscht. Aber was heißt hier höchstens und wie falsch wäre erst mindestens. Das Unternehmen scheiterte an der blamablen Uncouragiertheit deutscher Autoren. Lieber blieben sie beim Bellen hinter dem Zaun, als Zähne zu zeigen gegen miese Tritte. Wäre es denn darum gegangen, die Hand zu beißen, die den Autor füttert? Dies ist eine schwierige Frage. Inwieweit hat der Kritiker Anteil daran, daß der Autor zu fressen hat, und nach welchen Maßstäben entscheidet er, ob er den Hund streichelt oder züchtigt. Sein Anteil am Erfolg eines Buches ist sicher erheblich und im Zuge von immer größerer eigener Meinungsrückbildung tendenziell zunehmend. Kritiker beeinflussen den Kurs eines Buches, auch wenn sie ihn nicht ausschließlich bestimmen. Die Verlage zahlen strenggenommen nur die Kursanteile aus.
Aber worum geht es eigentlich?
Es geht darum, daß in Deutschland in der Literaturkritik eine Distanzlosigkeit bis hin zur persönlichen Beleidigung und Verbalinjurie gegen Autoren an der Tagesordnung ist, für welche die Täter weder über die Provenienz ihrer Urteilsfindung noch über das verhängte Strafmaß an irgendeiner Stelle Rechenschaft ablegen müssen. Auf keinem Gebiet gibt es wohl so viele „unfachgemäße“ Kritiker wie in der Literatur. Aber auch die „fachgerechte“ Kritik leidet unter ziemlichen Mißständen. Neben Süßholzgeraspel, Gedankenflucht oder Gedröhne grassiert ein von den Medien protegierter Beißzwang, von dem besonders Menschen mit ungeordnetem Selbstbewußtsein und schwacher persönlicher Präsenz bereitwillig Gebrauch machen.
Man muß sich das vorstellen, jemand, der weiter nichts angerichtet hat, als ein womöglich mittelmäßiges Buch geschrieben zu haben, was neben einer so bedauerlichen wie weitverbreiteten Selbstüberschätzung trotz alle dem oft ein respektables Stück Arbeit bedeutet und jedenfalls kein Verbrechen darstellt, muß damit rechnen, neben gellendem Hohn infamste persönliche Beschimpfungen einstecken zu müssen. Bei diesem Vorgang muß der Kritiker keinerlei Nachweis von Zuständigkeit oder Rechtschaffenheit erbringen; seiner Phantasie aber, dem Autor Namen zu geben und Niedrigkeiten zu unterstellen, sind keine Grenzen gesetzt.
Intelligente Schriftsteller lernen daher sehr schnell, ihre Kritiker ins Trockene zu bringen, und für die meisten bildet dies inzwischen, neben dem Schreiben und einer betriebsmäßigen Hyperemsigkeit, die Hauptbeschäftigung. Eine höchst einflußreiche Dame im deutschen Literaturbetrieb sagte mir einmal, sobald man sie alle persönlich kennt, schadet einem kaum noch einer. Sie allerdings alle persönlich zu kennen setzt wirklich eine Roßnatur voraus, und viele, die diese Prozedur hinter sich haben, haben dann zwar ihr Auskommen, aber keinen Funken Leben mehr im Leib und keinen Funken Anstand. Von ihnen bleibt nichts außer einem Säuseln.
Für beide Seiten, vor allem aber für den Kritiker, ergibt sich aus „Bekanntschaften/Freundschaften“ mit Autoren das Dilemma, nur um den Preis der persönlichen Integrität eine Gemeinheit begehen zu können. Die Zeitung aber lebt von Gemeinheiten, besonders, seit sie zu den Medien gehört, und die Literaturgemeinde liebt sie, also müssen sie, auch im Interesse der Karriere, begangen werden. Man sitzt gemeinsam beim Wein, führt ein gepflegtes Gespräch und vernichtet anschließend den Autor. Kritiker mit schwachen Nerven schützen sich vor diesem Szenario, indem sie befreundete Autoren im logischen Unschärfebereich kritisieren und ihr Mütchen an Autoren kühlen, mit denen sie nicht oder nur sehr ferne in Berührung stehen. Vielleicht erkennt man gerade deshalb in einem Publikum die Kritiker immer sofort an den leicht eingezogenen Schultern und dem etwas schief gehaltenen Kopf, kurz gesagt, am Geduckten, weil sie, so ungeschützt der Öffentlichkeit und womöglich den von ihnen Beleidigten ausgesetzt, fürchten mögen, Prügel, die sie so gerne austeilen, könnten auf sie zurückfallen.
Dabei gäbe es durchaus die schöne Möglichkeit, ein Buch zu kritisieren, was hieße, ihm aus einer ausgewiesenen Sicht seinen Rang zuzuweisen, ohne seinen Autor als Menschen zu verunglimpfen. Sozusagen das Buch, wenn es mißlungen ist oder unbedeutend, hinter dem Glanz der Kritik erst verblassen und dann verschwinden zu lassen. Überlegene Beweisführung statt Invektive. Mit Behutsamkeit die Schwächen zerlegen, damit diese in ihren Zügen erkennbar bleiben, und nicht bloß Matsch zu hinterlassen, der seinen Beweis, ob es Mist war, schuldig bleibt. Schließlich gilt es ja, das Buch zu verreißen und nicht den Autor.
In dem eindrucksvollen Buch Der grausame Gott, einer Studie über den Selbstmord, schreibt Alvarez in seinem Kapitel über Sylvia Plath:
Da ich für den Observer regelmäßig Lyrik besprach, verkehrte ich wenig mit Schriftstellern, Bekanntschaft mit denen, die ich rezensierte, schien allzuviele Schwierigkeiten zu machen: Nette Menschen schreiben oft schlechte Verse, gute Dichter können Ungeheuer sein, in den meisten Fällen waren beide, sowohl der Mensch als auch sein Werk, scheußlich.
Dem kann man wohl im großen und ganzen zustimmen.
Wenn es um Prosa geht, um Romane, um etwas, für das potentiell viele Leser bereitstehen, dann erfindet die Zeit Möglichkeiten gegen die Ungerechtigkeit, dann berichtigt sich das Falsche durch das Richtige oder der jetzige Irrtum durch die spätere Einsicht, dann kann das, was zuerst viele begeistert, gegen das, was anfangs nur wenige begeistern konnte, auch ausgetauscht werden, wenn die Wenigen einfach den besseren Blick hatten, was der Normalfall sein dürfte.
Wenn es um Lyrik geht, ist das schon entschieden oder sogar unvergleichlich viel schwieriger, besonders natürlich in Deutschland, wo einfach der Respekt fehlt, und erst recht, wenn dann auch vom Verstand nicht viel da ist. Ich weiß, daß dieser letzte Satz grammatikalisch nicht einwandfrei ist, aber ich mag ihn so, gerade deshalb. Die Lyrik, ein literarisches Mikroklima im Schatten der breiten Kulturmassive, ist inzwischen schon beinahe ein selbstreferentielles System, was heißt, es organisiert sich weitgehend ohne Bezug auf Außenpositionen und ist wegen des Mangels großer, konkurrierender Kontingente manipulierbar wie die Hölle. Wichtiger, als den Faden für die Poesie nicht zu verlieren, ist es, die Fäden des Betriebs in der Hand zu halten. Aus dem Hexenkessel berichten dann die dominanten Figuren, unter ihnen die Kritiker, wer gerade die besten Texte mixt, und kassieren dafür 50 Prozent vom spirituellen Erfolg. Der Einfluß wird durch Autorenhäufung ausgebaut, ein Vorgang, an dem die Kritik langsam verspeckt. Die Eifrigen, Glatten, Geschäftigen und Einflußreichen dominieren aus diesen Gründen die Leisen, Sperrigen und erst recht die Unzugänglichen.
Ich bin mir durchaus der Tatsache bewußt, daß es problematisch ist, eine Kritik zu kritisieren. Eigentlich gibt es nur zwei Umstände, die dies rechtfertigen. Erstens, wenn anhand der Kritik einer Kritik strukturelle Fehler oder bewußte Falschstrategien aufweisbar sind, welche sich auf dem jeweiligen Gebiet, in unserem Falle der deutschsprachigen Lyrik, durch den Einfluß des Kritikers fortzusetzen drohen; zweitens, wenn der kritisierte Gegenstand nicht nach nachvollziehbaren oder zumindest ausgewiesenen Kriterien analysiert wird, sondern offensichtlich aufgrund einer narzißtischen Kränkung oder Gekränktheit attackiert wurde. Beide Umstände scheinen mir in Michael Brauns in der Basler Zeitung und anderswo erschienenen Kritik an Lyrik von Jetzt gegeben.
Bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, erst einmal einiges Grundsätzliche zur Lyrikkritik. Wir haben es beim Gedicht mit einer nicht nur gedemütigten, sondern auch mit einer demütigenden Kunst zu tun. Volle Kraft für keinen Lohn. Nur die Ehre ist der Sold, wollte man über etwas spotten, was nichts als beschämender Ernst ist. Lohn kommt nur aus allem, was nicht eigentlich im Geschäft des Dichtens liegt, kurz gesagt, aus Beziehungen. Allein dieser Umstand, vom riskanten Emotionsgitter, das die Dichtung fordert, noch gar nicht geredet, müßte ein bestimmtes Zartgefühl oder eine Spur von Respekt und Redlichkeit in die kritische Auseinandersetzung bringen. Es ist meine feste Überzeugung, daß kein Gedichtband so schlecht ist, daß er persönliche Beleidigung oder jenes Gemisch aus Haß und Hohn verdienen würde, in das manche Kritiker entgleisen. Schlechte Gedichtbände kann man auch mit freundlichen Worten ins Vergessen befördern. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, sollte die einzige Strafe für ein unnötiges Gedicht seine Nichtveröffentlichung sein.
Nun ist leider jenes eingangs angeführte Argument, daß es nicht als opportun gilt, eine Kritik zu kontern, auch der Grund, daß so viele Kritiker sich in der trügerischen Ansicht wiegen, zu Recht richtig satt vom Leder gezogen zu haben, und sich für bestätigt halten von der Stille, die ihrem Angriff folgt. Die im allgemeinen eingehaltene Reglosigkeit der Angegriffenen bewirkt, daß die Kritiker quasi nie von den Argumenten der Betroffenen schikaniert oder vom Einspruch der Autoren zu mehr Selbstkontrolle erzogen werden. Dadurch werden sie, was sie im Grunde ja sind: rechthaberisch wie die Lehrer – Besserwisser, die übersetzend, verständlich und trotzdem konfus, davon berichten, was auf den Streckbänken der Dichtung für Laute ausgestoßen werden.
Das zweite Übel ist die Hilflosigkeit, mit der die Literaturkritik insgesamt neuer Lyrik im allgemeinen gegenübersteht. Ein Übel, dem abgeholfen werden könnte durch Bildung, Begriffsbildung wie Bildbildung. Durch ein Einüben in die Sprache des Zeitgenössischen. Das Zeitgenössische ist allerdings nur sehr bedingt in den sogenannten experimentellen Avantgarden zu finden, denn die Avantgarden waren die Sprachmaschinen des Industriezeitalters – in diesem aber leben wir nicht mehr, wir leben im Informationszeitalter, also liegt alles wirklich Zeitgenössische in der Verknüpfung, und die Avantgarden, so sie denn wirklich noch den Mut aufbringen, sich so zu nennen, sind weiter nichts als eine von unendlich vielen Verknüpfungsmöglichkeiten. Allerdings scheut sich der auf rasche Textumsetzung eingestellte Normal-Kritiker, Arbeit zu leisten für etwas, das sich mit Sicherheit nicht auszahlt, und genau dies vertieft die Kluft zwischen Dichter und Kritiker immer mehr.
Was aus alledem folgt, ist der Umstand, daß auf einem Gebiet, auf dem sich kaum einer auskennt, die, die behaupten, sich auszukennen, auf so gut wie keinen Widerstand stoßen, gesetzt, sie befolgen die Regeln und lassen die Schranzen und jene, die ihren Ruf ausschließlich ihrem Einfluß verdanken, in ihrem Wahn, große Dichter zu sein, unbehelligt, prügeln die Jungen, wenn ihnen keine anderslautenden Rauchzeichen gegeben worden sind, pflegen die Institutionen und bauen einigermaßen geschickt an ihrer Hausmacht, bestehend eben auch aus Dichtern, die in ihren Demutsbezeugungen gar keinen Halt mehr kennen, wenn ihnen der Halm der Gunst und der finanziellen Entschädigung geboten wird. Als Ersatz dafür, sich in der Sache nicht auszukennen, genügt es bis ganz weit an das eigentliche Gedicht heran, die Namen zu kennen und fallen zu lassen, was natürlich viele Autoren ermuntert, der Person deutlicheren Umriß zu geben als dem Werk. Auskennen aber würde heißen, in der Fließrichtung des gesamten poetischen Sprechens, das ich als den inneren Monolog des sich im Flusse befindlichen jeweiligen Jetzt bezeichnet habe, bestehend aus Bereits-Wahrnehmbarem und nur erst Unbestimmt-Aussprechbarem, Strömungen und Stimmen zu erkennen und ihre Kraft zu beurteilen. Auskennen würde heißen: prüfen, checken, vergleichen, hören, hören können und vor allem ein paar Funken nicht instrumentalisierten Verstandes zu besitzen und bereitzuhalten, irgendeine freie Fläche, auf die es reine Niederschläge geben kann, irgendeinen kleinen Zipfel Ernst und Echtes für diese Wohltat auf der gegenüberliegenden Seite von Spaß.
Nun aber zur Sache: Lyrik von Jetzt ist ein schwacher Titel, zugegeben, vor allem, weil er als Untertitel entworfen wurde, und mit dem richtigen Titel wäre es auch der richtige Untertitel geworden, soviel zu meiner persönlichen Auffassung. Ein Buch mit einem schwachen Titel ist deswegen aber noch kein schwaches Buch.
Und die Argumente?
Zuerst einmal muß man sich fragen, welches Ziel eine Sache sich gesetzt hat, danach kann man urteilen, ob dieses gesteckte Ziel erreicht wurde oder nicht. Ist dieses geschehen, kann man sich auch mit der Frage beschäftigen, ob dieses Ziel nach eigenem Dafürhalten Sinn macht. Wohlgemerkt, ich spreche von der Kritik am Konzept der Anthologie, noch nicht von den Texten, denn bei einem Gedicht spielt es selbstverständlich keine Rolle, wonach es sich streckt, sondern was es erreicht. Bei einer Anthologie aber sollte sich niemand beschweren, wenn Äpfel versprochen waren, daß keine Kartoffeln geliefert wurden. Die Anthologie wollte alle zeigen, die in einem definierten Zeitrahmen nach Maßgabe untereinander geltender und, wie ich glaube, überzeugender Kriterien einer solchen Veröffentlichung für wert befunden wurden. Das hat sie getan.
Gewiß hatte Lyrik von Jetzt zwei Optionen und diese auch beide erwogen. Die erste wäre gewesen, den Schaden der neuesten Generation auf dreißig Beispiele zu begrenzen. Der Vorteil hätte darin gelegen, daß er nicht wirklich bestanden hätte. Keine so seltene Konstruktion übrigens. Es wären dann die dreißig Namen gewesen, auf die man sich gewissermaßen von oben nach unten schon verständigt hatte. Lyrik von Jetzt wäre damit den stillschweigenden Empfehlungen des Jury- und Kritikerkreises gefolgt, dessen Unabhängigkeit und Sachverstand ich an dieser Stelle einmal sehr erheblich in Zweifel stellen möchte. Das Buch hätte dann bestätigend zusammengefaßt, wovon alle, die einigermaßen Überblick haben, schon gehört hatten, alle hätten ihre jeweiligen Schützlinge wiedererkannt und der gröbste Unmut wäre besänftigt gewesen.
Die zweite Option war, den vorhandenen Bestand, der ja alles andere als kriterienlos zustande kam, sondern durch zahllose Filter gegangen war und mit seinen Krokusblüten eine dicke Schneedecke bis zur Veröffentlichung durchdringen mußte, zu kartographieren und damit noch jüngeren und unbekannteren Autoren die Chance zu geben, in das Ganze einbezogen zu werden und quasi von einer nächsten Ebene aus sich weiterentwickeln zu können.
Größere Bäume, kleinere Bäume, man wird sehen, was sich wie entwickelt. Verdoppelung des Angebots um die neuen Stimmen, gewählt von den bereits bekannteren Stimmen, das war der Deal. Gerade diesem Umstand verdankt die Anthologie Lyrik von Jetzt eine ihrer Besonderheiten, daß da Dichter/innen sind, die noch niemand eingeordet hat – außer sie selbst unter sich, und gerade dem verdanken sich, das behaupte ich, auch einige ihrer besten Texte. Klar, daß sich da mancher Kritiker, ebenso wie ein ganz bestimmter Lektor, um das „Recht der ersten Nacht“ betrogen fühlte.
Während nun Michael Braun das Projekt als „ästhetisch taubes Dokument“ bezeichnet, was beim enormen Erfolg aller bisherigen Auftritte als wenig zutreffend erscheint, schreibt er wenige Zeilen später:
Die 74 Stimmen, die sie eingesammelt haben, repräsentieren – in qualitativer Hinsicht – durchaus den poetischen Orientierungsrahmen der jungen Lyrik-Szene, dessen Konturen bislang nur in den Zeitschriften der Szene, intelligenten Periodika wie edit, intendenzen oder Die Außenseite des Elements sichtbar geworden sind.
Bereits an diesem Punkte so freimütig demonstrierter Denkungenauigkeit könnte man sich die Mühe einer weiteren Analyse dieser Kritik eigentlich sparen. Da es sich aber um wirklichen Schaden handelt, der von soviel falscher Unbescheidenheit ausgeht, folgen wir ihrem logischen Schwanken zwischen Bücklingen und Fußtritten weiter.
Gerade in diesen Periodika, die generös als intelligent bezeichnet werden, sind ja alle die Autoren erschienen, über die Braun sein, wie ich ihm in der Formulierung gerne folgen würde, „ästhetisch taubes“ Urteil fällt. Vor allem seine bei jeder Gelegenheit geschmähte Berliner Großstadtpoesie, aber eben auch ein Großteil jener, an die sein Ohr sich noch nicht gewöhnt hat oder die er noch nicht mit einer Besprechung für sein Lager kassieren konnte und die deshalb nach seiner Meinung in so einer Anthologie nichts verloren haben. Eben die Intelligenz jener Periodika – die losen blätter und lauter niemand vergaß er zu erwähnen – hätte diese „lyrischen Totalausfälle“ doch erkennen und verhindern müssen. Da sie gerade zu anderen Urteilen fanden und diese Autoren gedruckt haben und veröffentlichten und andere nicht, waren sie Teil jener Differenzierungsanstrengungen, von denen nach Brauns Vorwurf die Herausgeber sich dispensiert haben.
Aber obwohl der Anthologie expressis verbis eingeräumt wird, ihr Klassenziel erreicht zu haben, nämlich tatsächlich, sogar in qualitativer Hinsicht, den poetischen Orientierungsrahmen der jungen Lyrikszene umfassend zu zeigen – sogar ihre „varietätenreichen Artikulationsformen“ (du lieber Himmel!) werden eingangs anerkannt –, und obwohl Braun sich immer wieder verrenkt, Ovationen zu vergeben, bleibt er doch unbeirrt außerhalb der von ihm indirekt bestätigten Koordinaten und benebelt uns mit Begriffen wie „trübe Sprachrealität“ und „Nivellierungswut“ und „Qualitätsbereinigung nach unten“ (man beachte hier vor allem auch die Richtungsangabe), ohne uns irgendwelche durch Analyse gereiften Gründe für sein abschätziges Urteil zu liefern. Er bleibt bei seiner vagabundisierenden Ablehnung.
Wenn aber, und hier komme ich zu meinem ersten grundsätzlichen Argument, eine komplette und sich selbst definierende Generation verworfen wird, dann handelt es sich nicht mehr um Literatur-, sondern um Kulturkritik. Dann heißt das, daß sich Wahrnehmungen, Maßstäbe und Zielsetzungen so stark gegen die geltenden Gütesiegel und Beobachtungskriterien verschoben haben, daß die Leitung unterbrochen ist. Dafür wäre dann nicht Michael Braun zuständig, der diesen Verschiebungen nicht folgen kann oder will, sondern ein gesellschaftlicher Diskurs allgemeinerer, etwa soziologischer oder kulturwissenschaftlicher Prägung. Dann müßte geklärt werden, was die totale Kommunikation dem Gedicht raubt und was sie ihm vielleicht „Neues“ schenkt.
Natürlich könnte die Tatsache, daß diesem Buch von einigen Seiten so an den Karren gefahren wird, auch schlicht und einfach bedeuten, was am heftigsten bestritten wird: daß nämlich eine neue Generation da ist. Und so ist es auch.
Da Michael Braun die von unübersehbarer Wut auf die Berliner Szene überschattete Konfusion seines Argumentierens vielleicht ahnt, sucht er ständig nach fragwürdigen Absicherungen. So bezweifle ich sehr, daß Höllerers bahnbrechende „Thesen zum langen Gedicht“ eine viel längere Bahn als die vom ersten Stock des Literarischen Colloquiums bis vorne zum Eingangstor am Sandwerder 5 gebrochen haben. Bereits bis zu meiner Generation sehe ich keine Spur reichen, geschweige denn zur jüngeren.
Auch scheint mir das ständige Hochlebenlassen des doch oft auch ziemliches Holterdipolter liefernden Stolterfoths – ein wie Braun sich katholisch ausdrückt: „leider zum Opfer gefallener“ – neben seiner insgeheimen Pflege des Neckarkreises auch auf einer akademischen Sicht zu beruhen, die nicht wahrhaben will, daß die Avantgarden nach solchen Mustern kulturelle Antiquitäten geworden sind. Sprachen, die aus heutiger Sicht manchmal wirken wie die Wagenräder, Deichseln und Pferdejochs, die in den Vorgärten und auf den Giebeln gelandet sind, nachdem die Landwirtschaft ausgezogen ist.
Für das fatalste Eigentor der Braunschen Kritik halte ich aber (auf die Fußballsprache komme ich noch zurück), gegen Lyrik von Jetzt Jürgen Theobaldys Und ich bewege mich doch ausspielen zu wollen, als eine Anthologie, die entscheidende Zeichen gesetzt hat. Für keine Anthologie, die ich kenne, gilt so sehr Brauns eingangs seiner Kritik formulierter Einwand, daß sie über „keine wirklich neuen sprachdynamisierenden Elemente“ verfüge. Nirgends ist wohl auch der von Braun zitierte Satz Wapnewskis vom „Tagebuch im Stammellook“ durchgängiger anwendbar als auf diese Rumpelbudenanthologie. Abgesehen davon, daß die „wirklich neuen sprachdynamisierenden Elemente“ Schwarzwald-Floskeln sind im Stile jener besonders hübschen Formulierung, mit der Lyrik von Jetzt unterstellt wird, daß sie „aus einem Juvenilitäts-Bonus ästhetische Distinktionsgewinne schöpfen will“, hätten vier Fünftel der in dieser Sammlung veröffentlichten Gedichte die Lektorate der von Braun lobend erwähnten intelligenten Zeitschriften höchstwahrscheinlich nicht passiert und damit keinen Eingang in die von Michael Braun so ungeschickt kritisierte Anthologie Lyrik von Jetzt gefunden. Ich habe mir die Mühe gemacht, dieses Dokument nochmal zu studieren, und kann nur sagen: Junge, Junge! Hier haben Dreistigkeit, Zeitgeist und Unbelecktheit von allem, was Dichtung so inkommensurabel macht, wirklich fröhliche Urständ gefeiert, und mehr als eine Handvoll Namen, denen das Buch nichts anhaben konnte, sind aus diesem Katalog ja auch nicht übriggeblieben. So wenig an stilistischem Vermögen und Intelligenz wie in Und ich bewege mich doch kommt in Lyrik von Jetzt wahrhaftig nicht vor.
Nun zur nächsten ollen Kamelle. An den „heroischen Glanz des lyrischen Solitärs Brinkmann“, der nun auch nach Brauns Ansicht verblaßt ist, obwohl er gleichzeitig moniert, daß er ihm überall in dieser Anthologie begegnet (ja was isser nun, verblaßt oder allgegenwärtig?), habe ich schon, als er angeblich noch glänzte, nicht geglaubt. Ich hab ihn eher für jene Art enfant terrible gehalten, mit der eine gewisse literarische Stubenhockerphantasie versucht, sich selbst zu erschrecken. Uneingedenk der unverarbeiteten Tatsache, daß Brinkmann selbst der „Traditionenzertrümmerer“ nicht war, sondern Importeur amerikanischer Findungen und Schwimmer im Kielwasser von Ted Berrigan, Frank O’Hara und zahlreicher anderer Beats, denen die neue Poesie tatsächlich großartige und verblüffende neue Fenster verdankt, verkennt Michael Braun das Faktum, daß sich aus all dem ein fester Bestand an, wie er es nennt, „Realismus“ entwickelt hat, neben anderen Beständen, der als schlicht vorhandener jedes Recht auf Gebrauch genießt.
Dies immer wieder durch das Nadelöhr Brinkmann in die Diskussion eingefädelt zu sehen und nicht über die Beats selbst, ist ermüdend. Subtilere Einflüsse, wie die wieder wachsenden von Wallace Stephens oder Frost und Ashbery oder neuere wie der von Paul Muldoon oder Simon Armitage, um einfach mal ein paar aus dem englischen Sprachraum zu erwähnen, werden überhaupt nicht erkannt. Statt dessen werden in bedrückender Beliebigkeit Rühmkorf, Leonard Cohen oder Jimi Hendrix aufgezählt und damit ein weiterer Beweis erbracht, daß der Klamauk des Kritikers hier jedenfalls größer ist als jener der jungen Dichter.
Michael Braun, von den paar unentwegt mit fragwürdigen Superlativen bedachten Schützlingen mal abgesehen, schafft es in seiner gesamten Kritik nicht, auch nur eine einzige der mindestens ein Dutzend zählenden starken und originären Stimmen zu erkennen, die in der Hälfte der weniger oder nicht bekannten Autoren des Buches zu finden sind. Sein „Man sieht nur, was man weiß“ setzt ihm da in Verbindung mit seiner etwas gußeisernen Art wohl unüberwindliche Grenzen. Leider verbietet es sich mir als Schreiber des Vorworts, in Namen zu denken. Einzige Ausnahme vielleicht die letztes Jahr auf Schloß Solitude verstorbene Beatrix Haustein, die mit ihrem Gedicht „Heilig Heilig“ fast die beklemmende Wucht großer Sylvia-Plath-Gedichte aufbringt. Keinem der bisherigen Kritiker ist sie aufgefallen, und so geht es einigen der besten Dichter/innen in diesem Buch.
Um nun gewissenhafterweise noch einmal auf die Fußballsprache zurückzukommen und damit indirekt auf die Erfüllung jener Kriterien, die es rechtfertigen, eine Kritik zu kritisieren: Bereits bevor Michael Braun Lyrik von Jetzt in Händen hielt, wurde von vielen Autoren mit einer Attacke „aus seiner Feder“ gerechnet, so daß, was schließlich kam, auch gar nicht den Rahmen einer selffulfilling ignorance sprengte, den man bei ihm vermutet hatte. Ließ der Kritiker sich doch immer wieder vernehmen, wie zuletzt beim Leonce-und-Lena-Preis, die Berliner Szene „entzaubern“ zu wollen. Eine so eindeutig vorgefaßte Meinung, verbunden mit gedopter Blindheit gegen jede Qualität außerhalb sozusagen der Klientel, mit soviel sachlicher und logischer Unschärfe, hätte Michael Braun wahrscheinlich auch über den Koran herfallen lassen, wenn er ein Elaborat der Berliner Szene dahinter vermutet hätte.
Aber was der Kritik an Argument, Glaubwürdigkeit und Klarheit mangelt, konnte sie ja wenigstens an Auflage wettmachen. Ebenso wie der unselige Karl Krolow, ebenfalls die Kategorie: „Einflußreich, aber gedankenarm!“, ist er ein Meister der Vielfachverwertung, so daß man nachfühlen kann, wenn einer der Autoren entnervt fragt, ob „mit diesem Teil wohl der halbe süddeutsche Raum vermüllt werden soll(te)“.
Das bringt mich abschließend zu dem Punkt, zu bekennen, daß ich dieser Anthologie durchaus auch mit Kritik begegnen würde. Sie enthält sicher eine Anzahl von Gedichten, die ich mir nicht aufs Nachtkästchen legen würde. Sie enthält Autoren und Autorinnen, die in einer dokumentarischen Anthologie Berechtigung haben, nicht aber in einer „Auswahl“, wie der Name schon sagt. Das ist doch klar. Nach meiner Meinung sind es aber trotzdem nur wenige, die man nicht an den Start hätte lassen sollen, denn um einen solchen handelt es sich ja für viele. Einen Bücherstart allemal. Im Gegenteil, bei Lyrik von Jetzt handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um stilsichere und intelligente Lyrik, formbewußt und unverkrampft. Gedichte, die über eine oft sehr subtile Nervlichkeit versorgt werden mit Gegenwart. Aus dieser Anthologie werden vermutlich fast alle Namen hervorgehen, über die man in zehn Jahren sprechen wird.
Gerade dieses Buch aber könnte über die Literaturkritik hinaus Gelegenheit zu einer kulturkritischen Debatte Anlaß bieten, wenn man sich denn in diesen Abmessungen zu rüsten verstünde. Durch genaue Analyse müßte geprüft werden, welchen Stand und Status Lyrik erreicht beziehungsweise nicht erreicht und warum es dieses riesige Loch in der Gesellschaft gibt, durch das sie allemal fällt. Man müßte fragen, warum es, obwohl es sich fast durchweg um intelligente, zeitnahe und sich ihrer Mittel sehr bewußte Lyrik handelt, so wenig deutlich Herausragendes gibt. Alles im oberen Bereich, aber kaum Gipfel. Gegenfrage: In welcher Anthologie der letzten zwanzig Jahre gab es viel Herausragendes? Als Erklärung heute würde sich anbieten, daß es sich um eine vollkommen durchkommunizierte, disziplinierte und eigentlich brave Generation handelt, die rebellische Gesten eher zitiert als lebt. Ihre Freundlichkeit wird sie noch umbringen. Sofort müßte dann aber zurückgefragt werden, welche Umstände Wirklichkeiten schaffen, in denen das Brave und das Amüsante zwingende Erfolgsmuster bilden, und warum sich viele unter Abweichung heute höchstens noch eine andere Frisur vorstellen können. Wo steckt die Gefahr heute, wenn das Gedicht Alarm schlägt – neben Liebesdingen liegt da ja immer auch ein gesellschaftlicher Hintergrund vor. Zu welchem Sprachansatz verleitet das ja fast von allen mitgetragene gesellschaftliche Beliebigkeitsparadigma, und wie beliebig darf Beliebigkeit sein, um noch als Signal gelten zu können und nicht bereits als Vorfall gerechnet werden zu müssen. Und dann müßte über den Charakter der Zähmung nachgedacht werden, der von Schreibwerkstätten, Literaturinstituten und dem Betrieb seinen Ausgang nimmt. Mit dem heraufziehenden Sozialfaschismus, der die Nischen für junge Dichter/innen noch weiter reduzieren wird – und somit unabhängiges Gedeihen von Eigensprachen –, wird eine Anlehnung an den Literaturbetrieb noch zwingender.
Der aber erwirkt eine Generalumwandlung vom Dichter zum Lyrikdarsteller und erzwingt eine für diese Kunst absolut rötliche Geschäftigkeit. Weiter wäre dann zu fragen, wie weit wir damit, daß der Dichter an den Betrieb angebunden wird, bereits eine Strecke zurückgelegt haben, die uns mit den akademischen Dichtern der USA vergleichbar machen wird, bei denen es praktisch gar keinen Bauchschuß mehr gibt, sondern so gut wie jedes Gedicht durch Kopfschuß erledigt wird. Einer Poesie des goodwill, die es schafft, auch ohne einen Lebensfunken auszukommen. Wenn wir allerdings Erstarrung der poetischen Kraft und Verglimmen des Lebensfunkens konstatieren wollen, müssen wir erst einmal beweisen, daß wir nicht in fremden Taschen nach unseren eigenen Abenteuern suchen, schließlich war es unsere Generation, die das Abenteuer abgeschafft hat, und vielleicht vermitteln uns ja die Leidtragenden, wodurch sie es ersetzt haben.
Gerhard Falkner, neue deutsche literatur, Heft 554, März/April 2004
[Appendix von Gerhard Falkner zu Baumfällen – Zur Phänomenologie des Niedermachens in der deutschen Literaturkritik am Beispiel Michael Brauns und des Bandes „Lyrik von JETZT“ im Mai 2016: „In der Kampfsache Lyrik von JETZT war Michael Braun der Einzige, der nicht vom allgemeinen Unrecht Gebrauch gemacht hat, sich durch nichts betroffen zu fühlen. Er reflektierte später seine brüske Ablehnung als Fehlstart, als »zu kurz gegriffen« und zog sich mit sympathischer Selbstkritik aus der Affäre. Dies eröffnete einen Dialog, während dem ich ihn mehr und mehr schätzen lernte als subtilen Dentisten, umfassenden Kardiologen und zupackenden Chirurgen. Seine raffinierten Texte zur Lyrik sind oft viel substantieller als die in ihnen Gepriesenen. Ich fühle mich ihm mittlerweile freundschaftlich verbunden und bitte für meinen damals rauhen Ton um Entschuldigung.“]
Wie man Leser killt
– Der verpasste große Wurf – die chaotische Lyrikanthologie Lyrik von JETZT. –
Allein die Poesie verleihe der menschlichen Existenz wahres Lebendigsein, meint der irische Literatur-Nobelpreisträger Seamus Heaney und verkündet:
Das Gedicht schenkt einen Schluck von klarem Wasser transformierter Erkenntnis und erfüllt den Leser mit einem momentanen Gefühl der Freiheit und des Heilseins.
Die Generation der Enkel wie Bastian Böttcher aber will vor allem eines: das „coole“ Gedicht – Coolness als ästhetische Kategorie. Die heiligen Hallen der literarischen Gurus und Propheten sind ihnen fremd. „komm an die luft und laß uns bummeln / gehn im Weltlokal“, ermuntert der 1975 geborene Björn Kuhligk den Leser. Ungeachtet solcher generationsspezifischer Statements spielt Poesie im heutigen öffentlichen Leben nach wie vor eine geringe Rolle. Gedichte auf Zuckertüten, Plakatwänden, Litfasssäulen und Bahnsteigen täuschen eine allgegenwärtige Präsenz zeitgenössischer Lyrik im Alltag nur vor. Aufgeblähte Literatur-Events rauschen mit Vehemenz vorüber und hinterlassen bestenfalls ein paar Zeilen oder Wortschöpfungen wie den Hund „elektro-holunder“ (Monika Rinck) oder die „Taschenlampe Ariels“ (Mirko Bonné). Die Verkaufszahlen von Gedichtbänden aber bestätigen nach wie vor die Enzensbergersche Konstante, der zufolge die Zahl der Leser, die einen neuen Gedichtband in die Hand nehmen, bei ± 1354 liege. Daran hat auch der Poetry-Slam nichts geändert. Um das kühle geistige Klima für Lyrik zu erwärmen, müsste schon ein großer Wurf kommen. „Man liest Dante, weil er die Göttliche Komödie geschrieben hat, nicht weil man einen Bedarf nach ihm empfunden hätte“ so einst Joseph Brodsky in seiner Ansprache in der Library of Congress in Washington.
Ist die Anthologie Lyrik von JETZT solch ein Wurf, ein Hammer etwa, der die Trennwand zwischen der so genannten E- und U-Kultur zertrümmern könnte? Die Herausgeber Björn Kuhligk und Jan Wagner haben mit ihrem „Prinzip der dokumentarischen Anthologie“ durchaus diese Wand eingerissen, weil sie etliche (nicht alle) einschlägige Quellen, also auch Zeitschriften und Szenespielstätten abgeschöpft haben. Gerhard Falkner verweist in seinem Vorwort auf „Lyrikbühnen“, bei denen die „Hörspannung“ persönlich und intim bleibe. Aber was da nun in rund 300 Gedichten von 74 Autoren und Autorinnen durch jeweils vier „Sprachfenster“ guckt, mag im mündlichen Vortrag das Lebensgefühl einer Generation artikulieren; in der Schriftform kann es kaum nebeneinander bestehen. Zu unterschiedlich ist die Qualität. Die Texte der „Performer“ Crauss oder Kersten Flenter etwa verblassen neben den aus Tönen, Klängen und Farben gebauten Zwielichtwelten des Marcel Beyer, in denen eine seltsame Ästhetik des Grauens herrscht: absurd, makaber und geschichtlich geerdet. Und Mirko Bonnés UmschaufeIn des „Jahrhundertunrats“ ist nicht zu vergleichen mit den Computech-Reimen des Pop-Poeten Bastian Böttcher, die erst so recht lebendig werden, wenn der Rapper mit „Mediengeschwindigkeit“ übers Parkett tänzelt und sich dabei „online die chips reinzieht“. Böttchers Texte erzeugen bestenfalls einen rhythmischen Klangrausch – leicht und gleitend. Locker verbundene Momentaufnahmen aus einem Erinnerungsfilm mit schnellen Schnitten wie frisch aus dem Videoclip-Studio bieten die Verse Dirk von Petersdorffs. Sich kreuzende Linien und ironische Sentenzen machen zum großen Teil die Struktur seiner postmodernen Gedichte aus. Auch er greift – wie Alexander Nitzberg oder Stan Lafleur – auf den guten alten Reim zurück. Zertrümmerer wie die Großen der Moderne sind diese allesamt 1965 und später Geborenen (welch willkürlich starr gezogene Altersgrenze!) keineswegs. Nicht nur Rolf Dieter Brinkmann und Peter Rühmkorf auch andere Großväter und Großmütter stehen in den Texten herum, liefern Strom, gute Ratschläge oder Rezepte. Nicolai Kobus variiert gar Rilke und Nietzsche.
Verglichen mit den Ahnen bewegen sich die Jungen geradezu im Maleratelier. Das Farbenverbot, das der Freiburger Romanist Hugo Friedrich vor nunmehr 47 Jahren in Die Struktur der modernen Lyrik kreierte, kümmert die Nachgeboren wenig. Nicht nur Alexander Nitzberg, Mirko Bonné und Volker Sielaff greifen kräftig in die Farbtöpfe. Manches scheint dabei allzu grelle, plakathafte Dekoration zu bleiben, wie der rote Tod zwischen Ampelgrün und -gelb bei Nitzberg. Der den Farbcodes nachspürende Volker Sielaff mischt die Farben am überzeugendsten („Farbe, innen und außen“). Das Geheime, der Traum und der vergangene Augenblick sind in seinen Versen aufgehoben. Das Gedicht als Gegenpol zur Wirklichkeit? Nico Bleutge hält mit konkreter Optik dagegen; Marion Poschmann mit Körpertexten; Anja Utler entwirft eine eigene Grammatik.
Der innerliterarische Diskurs ist lebendig. Nicht nur, dass etwa Björn Kuhligks Gedicht „Die sieben Geliebten“ auf das vor Jahren in der Zeitschrift Merkur gedruckte „sieben geliebte“ von Gerhard Falkner antwortet; poetologische Überlegungen darüber, was ein Gedicht ist, was es nicht ist und wie es beschaffen sein müsste, werden zum Gegenstand der Texte selbst. Programmatisch Albert Ostermaiers „ratschlag für einen jungen dichter“:
als dichter musst du wissen wie
man leute killt köpfe zwischen
zeilen klemmt sie plätten satz für
satz das ist das blei das du hast
ein gutes gedicht braucht heut
zutage einfach einen mord damit
die quote stimmt sie nicht zum
pinkeln gehen wenn du um ihre
herzen wirbst musst du sie brechen
Während manche dem lyrischen Ich, dem Zentrum der Befindlichkeitslyriker, nach wie vor huldigen, reiten andere Attacke:
Glauben Sie an das lyrische Ich? (Bitte ankreuzen)
a) vollkommen
b) eher ja
c) eher nein
d) überhaupt nicht
heißt es ironisch bei Tom Schulz. So werden Säulenheilige respektlos zur „losen Wurst“ erklärt. Nicht das einsame lyrische Ich ist interessant, sondern das Umfeld, die Wirkungsmöglichkeit, die gesellschaftliche Realität in ihrer Komplexität. Uwe Tellkamp beschwört sie in kraftvollen Wortkaskaden, die Geschichte und Mythologie bildhaft erzählend und beschreibend in die Gegenwart holen. Sprachfracht jüngster Geschichte einschließlich DDR-Wirklichkeit transportieren die Gedichte des Zeichendeuters Johannes Jansen. Hier geht es vor allem um Haltungen angesichts der „großen Brüder hinter den Spiegeln“. Wo Jansen vom „Niemandsland“ spricht, erinnert Renatus Deckert Todesstreifen, Stacheldraht und Grenzgänger von einst. Seine Verse sind hart, genau und alles andere als flockig-locker und gefällig. Sein Odysseus mit den schwarzen und vom Aufreißen des Straßenpflasters blutigen Nägeln nimmt der mythischen Gestalt alles Melodiöse. Die Lieder der Jungen klingen ohnehin trotz eingängiger Rhythmen rauer. Stan Lafleurs sarkastisches „siegeslied am stahlwaeldchen“ mit der virtuellen „humanitaeren sinfonie no 1 der jagdgeschwader nato-music“ und dem „mit einem grafik-programm von adobe geschliffenen“ Lächeln einer Vergewaltigten steht den Metaphorikern in nichts nach. Auch die an die Poetologie Thomas Klings anknüpfende Sabine Scho widmet sich dem Nachhall von Historie. So wirkt Vergangenheit in der Gegenwart mancher Textgewebe zumeist als Bild- oder Tonassoziation nach.
Zukunft scheint völlig unmöglich zu werden. Das bloße Wort „Zukunft“ lässt Dirk von Petersdorffs „Engelnächste Generation“ gähnen, und Björn Kuhligks Gedicht „Der Stoff, aus dem die Welt“ hält dazu manifestartige Sätze bereit:
dass die Zukunft uns brauchen würde
war ein landesübergreifender Witz, in dem die ersten
den dritten das Bewusstsein runterfahren
lch bin eine gräuschlose Maschine
Und werde gewartet mit dem Versprechen auf Zeit
heißt es bei Tom Schulz, und: „Die Zukunft ist ein Kind der Diagnostiker“. Selbst ein so gestandener Autor wie Volker Sielaff hält fest:
Vergangenheit
und Zukunft existieren nicht, sagt
im Fernsehn der Physiker, man könne da nur
von einer Folge von Augenblicken sprechen.
Womit wir wieder beim innerliterarischen Diskurs sind: das Gedicht als eine Folge von Augenblicken, in denen die reale Welt nur Bausteine für Sprachwelten liefert. Das wäre der kleinste gemeinsame Nenner der Texte dieser Anthologie, die – neben längst bekannten und durchgesetzten Autoren – eine Fülle von Neuentdeckungen mit poetologisch höchst unterschiedlichen Schreibweisen bereithält, aber auch eine Fülle von Flops. Dass alle 74 Beiträger „dauerhaft in der neueren Lyriklandschaft präsent“ bleiben, wie die Herausgeber meinen, darf bezweifelt werden. Der Verzicht auf jegliche – wie auch immer geartete – Auswahl nach Qualität, poetischer Gruppenzugehörigkeit oder thematischer Ordnung hat ein editorisches Sammelsurium hervorgebracht, eine chaotische Anthologie, die dennoch – eben wegen ihrer großen Bandbreite heterogener Stimmen – ein Kompendium für den ist, der sich selbst ein Bild von der Lyrik der „Generation Golf“ machen will. Für Autoren, die dabei durch das Auswahl-Raster der Leser fallen, bleibt – wie es in einem Gedicht von Daniela Seel heißt – die Befriedigung, „einen Kirschkern gespuckt zu haben“. Das ist für ein solches Vorhaben, das ein großer Wurf mit viel Publikum hätte werden können, zu wenig.
Dorothea von Törne, neue deutsche literatur, Heft 553, Januar/Februar 2004
Die „Menschheitsdämmerung von heute“
Lyrik von Jetzt halte ich für eine wichtige Sache, denn praktisch alle wichtigen jungen Lyrikerinnen&Lyriker – oder auch nur solche, die oft in Literaturzeitschriften auftauchen – stehen da drin. Ganz toll sind die ausführlichen Biografien, so dass man sich schnell und übersichtlich informieren kann, wer sich in der aktuellen Lyrikszene so tummelt. Von der Sache her also ganz toll (vom völlig verquasten Vorwort mal abgesehen, da hat sich ein Germanist hölzern wie nur was verbreitet). Auffällig ist, dass sehr viele der Autorinnen&Autoren nicht wirklich mit der Sprache arbeiten, sondern im Prosastil bleiben. Das pendelt dann zwischen banal und Schrott. Andere dagegen sind wunderbar lyrisch, die kneten ihr Sprach-Material wie Wachs zu kleinen Kunstwerken. Kuhlig und Wagner haben hier eine tolle Sache gemacht, das Buch sollte ein Standardwerk werden für alle, die sich für zeitgenössische Literatur interessieren. Etwas mehr Analyse wäre vielleicht schön gewesen. Andererseits kann man sich so ganz unvereigenommen nähern. Ich bin jedenfalls gespannt, wer von den Autorinnen&Autoren in zehn Jahren noch da ist.
Ein Kunde, amazon.de, 28.6.2003
Trauergelatine
Neue Generation. Hm. Kann es das gewesen sein? Klar KANN wie bei der abstrakten Malerei etwa auch bei der Lyrik Lebensweltliches weitestgehend außen vor bleiben – aber muß es das derart geballt und – größtenteils – derart verschwurbelt tun? Mir drängt sich der Eindruck auf, dass diese neue Generation in großen Teilen schlicht nichts zu sagen hat und sich aus Mangel an Mitzuteilendem lieber mit schiefen Bildern auf Unverständliches zurückzieht, das aber eben bis in die Stimmungen und Bilder hinein unverständlich ist! Dabei gibt es hier und da Stilblüten, die diesem Rückzug eine unfreiwillig komische Note verleihen: „des windes saugen an den warzigen pupillen der felsen“ (S. 85) oder „nichts geschehen, doch Verschiebungen… vage“ (S. 87), besser noch „Die Brust. Die Milch. Die Trauergelatine“ (S. 94). Die Trauergelatine! Ein gutes Bild, aber nur für das Buch. Oder „Ich war nie ein Land und Ich war nie ein Wir.“ (S. 102). Aha. Ich auch nicht. Ein gutes Bild für den Mißstand auch „das verlangen einen kirschkern gespuckt zu haben“ (S. 147). Warum tust Du es nicht einfach? Oder: „… die lähmende Geometrie einer Berührung zu beschreiben“ (S. 209). Das Einfachste wird verschwurbelt und erscheint merkwürdig ungelebt, hölzern und blutleer in diesem Buch. „… kein gänsefüßiges Vollstopfen mit Anmerkungen zu dieser und jener unersetzlichen Lotophagentinktur“ (S. 192). Aber genau so scheint es doch! „Am Grund der Diskurse schwimmt ein Fisch“ (S. 167), ein Fisch von Germanisten für Germanisten, um nicht zu sagen: von promovierten Germanisten für promovierte Germanisten, gespickt auch mit Chiffren von Bildungsangebern für Bildungsangeber:
nur die sonden blieben von den rückzügen
des pelagischen amniom, das uns umgab, reckten
sich langsam wie schwarze astern bei wachsendem
turgor, blüten, denen seltsame kinder entstiegen: wir.
(S. 232)
Ja, seltsame Kinder. Zitate so auszuwählen, mag unfair sein, und natürlich gibt es da hier und da auch das, das besser oder zumindest weniger schlecht gelungen ist, zum Teil von den selben Autoren. Disambiguierende Kontexte gibt es jedoch nicht. Über 95%, vielleicht bis zu 99% der Bevölkerung würden dieses Buch sehr schnell wieder zu Seite legen, falls es ihnen – zufällig – begegnen sollte. Dieser Prozentsatz ist viel zu hoch. Trotzdem und trotz der – von Ausnahmen abgesehen (Rinck, Lafleur, Flenter, Preckwitz, weitere) – sehr anstrengenden Lektüre: wer als „literarisch gebildeter Nichtgermanist“ die deutsche Gegenwartslyrik kennen will, sollte sich diesen Band besorgen. Wegen der wenigen Perlen und auch einfach, um die Augen nicht zu verschließen vor der Realität der deutschen Gegenwartslyrik, die sich nicht „ihre Öffentlichkeit organisiert“, wie der Klappentext verheißt, sondern offenbar auf der Flucht vor einem breiteren Publikum suizidiert.
d_kammerjaeger, amazon.de, 1.8.2004
Zeitgeist erfolgreich eingefangen
Man kann die einzelnen Facetten und Impressionen einer Lyriksammlung nicht wiedergeben und in einer Rezension beschreiben, aber es lohnt sich jedesmal, diese Lyriksammlung aufzuschlagen und ein, zwei oder mehr Gedichte zu lesen. Es ist sinnlos, mit einem streng wertenden Maßstab an eine solche Publikation zu gehen, in der so viele neue und junge Stimmen zusammengefunden haben. Dennoch ist die eine oder andere lyrische Momentaufnahme Lichtblick und Entdeckung zugleich – eine gelungene Kompilation zum lyrischen Zeitgeist des beginnenden 21. Jahrhunderts! Und dennoch sind nicht alle Stimmen in dieser Veröffentlichung versammelt. Aber auch dies ist wohl charakteristisch für eine Publikation, die den lyrischen Zeitgeist erfassen will: sie bleibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch sind die unterschiedlichen Wort-, Sinn- und Farbspiele der jungen enthousiastischen Autoren eine Glanzleistung und der Reiz dieser Sammlung liegt wohl gerade in der radikalen Unterschiedlichkeit ihrer Stile.
Rolf Kohnen, amazon.de, 17.8.2009
Das Verlangen, gerne Kirschkerne zu spucken
Natürlich gibt es eigentlich keine gedachten Grenzen, die zeigen: ab hier wird es interessant im Leben (die Pubertät vielleicht ausgenommen!). Und doch ist es immer wieder etwas, das einen bewegt, wenn eine bestimmte Generation in den Blickpunkt des Interesses gerückt wird.
So auch hier in diesem durchaus (äußerlich) kräftig zu bezeichnenden Buch (aber nicht nur, was Dicke oder Schwere betrifft!), in dem die geschriebene Lyrik einer (eben!) etwas jüngeren Generation vorgestellt wird.
Natürlich kann man es so machen, eine Generation sozusagen auch meinetwegen gründen. Aber, was immer das auch bedeutet, mir bedeutet es schon etwas.
Es hätte jedoch nicht zusätzlich eines solch ausführlich-gewichtigen Vorwortes bedurft, um die Nöte und Lüste einer Generation vorzustellen.
Einfach hinein ins Vergnügen, so wie es vielleicht eines ist, auf dem Kirschbaum zu sitzen und Kerne zu spucken, sich dabei noch zusätzlich zu unterhalten, sich zu nähren von schmackhaften Früchten und den lieben halben Tag so zu verbringen (wie es die Jugend in der Vorderpfalz gelegentlich auf wild wachsenden Kirschbäumen gerne tut).
Berlin aber hatte immer eine Literatur-Szene und vor der Wende schon hat es dort mächtig gerauscht, nicht immer nur zaghaft und spröde nur. Die Meinung mancher damals schon sehr emanzipierten Kritik war dann auch entsprechend (oh, zu sexistisch!). Und dann diese Richtung, die eingeschlagen wurde (entsetzlich, wo das noch hinführen mag!). Wir sehen es heute, und das ist gut! Bert Papenfuß oder Michael Laser seien nur genannt.
Hier nun (und heute) macht es sich deshalb bezahlt, daß in Berlin wieder etwas wie urbane Literatur entstehen konnte (nach diesen fürchterlichen Kriegs – und Nachkriegszeiten) und daß Anschluß gefunden wurde an alte, gute Gepflogenheiten (nicht nur Döblin, weit früher, ach, weit früher schon, lang ist es her!).
Aber vor der Wende war alles etwas bodenständiger, etwas fester, nicht so etabliert, wie heute, wo z.T. wohlhabendes Völkchen sich dem Nimbus des darüberstehenden Verstehens und Machens anheimgibt (vielleicht sogar aus fränkischer oder badischer Provinz kommend?).
Es ist aber fast in kurzen Worten alles zu sagen über diesen mutigen Versuch, eine Generation vorzustellen (mit all ihren… siehe oben!), aber es muß auch hinzugefügt werden, daß man durchaus im Internet ähnliches findet, was zu dem Genre gehört.
Und es ist schön, daß man literarische Flickflacks auf einfache Weise eben so findet und sich zudem zusätzlich oftmals auch noch austauschen kann.
Übrigens können auch schon Kinder dichten, das wäre doch mal einen Versuch wert („Der Hase um die Ecke rennt, der Hund vom Nachbar hat verpennt.“), hierüber eine Anthologie zu bringen, sie wäre wahrscheinlich noch dicker gebunden als diese hier.
Trotzdem bin ich nicht der Meinung eines Kritikers einer großen Tageszeitung, der die etwas zu üppige Auswahl der Autoren und Autorinnen anmahnt. Im Gegenteil, jeder findet bestimmt etwas, womit er/sie etwas anfangen kann (und wenn es auch nur einlullende „Anästhesistenhände“ sind oder eine Ermunterung: „komm Baby, das / Meer ist fünf Minuten weit.“), es langt allemal.
Ein Dankeschön an die Herausgeber Björn Kuhligk und Jan Wagner und dem durchaus humorvollen Vorwortler Gerhard Falkner sowie dem Verlag DuMont. Demnächst vielleicht mehr, unter Umständen unter größerer Einbeziehung des Internet?
Klaus Grunenberg, amazon.de, 9.8.2003
Die Neue Lässigkeit
HABERMASCHINE & KUHLIGKLONE
G&GN-Report / Wie lassen sich Phänomene erklären, die einen sprachlos machen, solange die Notwendigkeit von Sprache als Voraussetzung gilt, um sich so verständlich zu machen, daß eben jene Bürger sich endlich die Augen reiben und doch noch an Aufwachen denken, die in den letzten Tagen nichtsahnend und gutgläubig zu zwei Großereignissen in der Hauptstadt rannten, deren Vermarktung nicht darüber hinweg täuschen kann, daß es sich dabei um gänzlich aufgeblasene Hohlkörper handelt, deren bloße Beachtung an Nekrophilie statt Philosophie grenzt, und jedes noch so schlechte Gedicht, das ich in derselben Zeit niederschreibe, noch eher zu rechtfertigen wäre als dieser eindeutig zu lange Kettensatz, dessen unausgesprochener Kerngedanke all Deine Ketten sprengen wird, die Dich Dein bröckelndes Weltbild seit Jahren schon spüren läßt – Du bist an der Schwelle zu einem Sprung in die bodenlose Freiheit Deines Bewußtseins, dessen absolute (quantenmechanische) Verortung in keine einzige Religion paßt und doch so tief in der Existenz siedelt wie nichts, aber auch nichts anderes, das Dir je in Deinem Leben widerfahren kann: DU BIST DA und Du weißt es, ganz ohne Warum, ohne Woher und ohne Wohin. Einfach nur, DASS Du da bist, genügt Dir und Du schaust Dir die beiden Spektakel an und fragst Dich: Was wollen die eigentlich damit bezwecken, wem soll es nützen außer ihnen selbst und hat der Planet nicht schon lange genug an dem Koma gelitten, das ihm die Menschheit mit all ihren Ersatzdrogen verabreichte??? Nichts gegen abstrakte Hyperreflexionen und metapoetologische Bandwürmer aus Spaß an der Freude, aber wenn 500 akademische Alphapluswesen dem orwellschen Jargon des 20. Jahrhunderts verfallen, lautet mein einziges Thema für diesen Abend: WOHIN MIT EUROPA, wenn sogar Sondermüll wieder im Supermarkt landet! Nachdem Jürgen Habermas Pazifismus als anachronistisch bezeichnet und Wolfgang Schäuble gegen Antiamerikanismus wettert, spüre ich dieses mulmige Unbehagen im brodelnden Hinterkopf: mir liegen sämtliche sublimierte Floskeln wie eine zu große Tüte Süßigkeiten im leeren Magen, die Sprache der Intellektualen erzeugt bei mir eine fundamentale Aversion gegen Wörter, die nur einen Sinn haben: den Status Quo schön zu reden, so schön, daß sowohl Laien wie Leseratten in eine Eventhypnose versetzt werden, als ob jede Realität, nur weil sie real-existent ist, im selben Atemzug auch schon legitim sei – nein, dieser pseudoradikale, nämlich kommunikationslose Konstruktivismus imperialistischer Egomanie muß ein Ende finden, wenn wir ins echte 21. Jahrhundert hinüberwechseln wollen, um zu einer poetischen Vision spiritueller Weltbürgerschaft zu gelangen. Kein „Aufstand der Braven“ (Zitat: Johannes Jansen, Neuer Pop von 1984) mithilfe „Neuer Zerbrechlichkeit“ (Zitat: Björn Kuhligk, Neue Peinlichkeit Jahrgang 74 plusminus) oder „Ein bißchen Pathos haben meine Texte ja schon, aber etwas Pathos ist doch wieder erlaubt“ (Zitat: Jahrgang 66, Neue Pathetik?) steigert das fehlende Lebensgefühl geschweige denn lindert die Schmerzen alter Wunden, Europa ist nicht mehr als ein Kontinent, auf dem wir leben und Amerika ist nur ein Flugticket entfernt, für den, der es sich leisten kann. Wer aus konkreten Bezeichnungen metaphysische Begriffe macht, jongliert nicht mit echtem Leben sondern mit seiner eigenen Schizophrenie! Was wirklich im Alltag zählt, sind reale Menschen, die sich als einfache Menschen statt Darsteller von Prestigerollen begegnen, ohne Überkopf voller Definitionen und Schablonen. Aber Du, lieber Leser, was hast Du bis hier hin verstanden, kannst Du eigentlich wissen, wovon ich hier rede oder wirkt es auf Dich einfach nur durchgeknallt? Ich sage Dir: DICHTERISCHES DELIRIUM braucht die Welt, nicht dieses schöngeistige Zeug(nis) anständiger Repräsentanten. Ich sah und ich hörte zwei Abende lang zwei Generationen, die meilenweit auseinander liegen und doch innerlich eins sind: Sie vertuschen gleichermaßen Ihre Hilflosigkeit im Applaus einer Masse, die höflich genug ist, „Die Neue Vollständigkeit“ eines unsäglich anmaßend poppertierenden Großverlages vollständig auszusitzen (diesmal Dumont – Suhrkamp und Kiepenheuer & Witsch legen eine Verschnaufpause ein) und wie in der Kirche auf die Erlösung zu warten und froh darüber zu sein, daß zwischen dem Abendmahl und dem Glockenläuten wenigstens zwei Riesen aus einer anderen Dimension den stickigen Bühnenraum ausfüllen und aufmischen (es sind diese: stan lafleur dicht gefolgt von Kersten Flenter) und mit ihren wuchtigen Stimmen routinemäßig tabubrechend zur existenziellen Erheiterung beitragen. Danach sinken alle wieder in stille Andacht zurück, die Gebetsmühle einer der angeblich „meistgeschätzten Dichter“(-Moderatoren) kurbelt mit vorgetäuschter Bedeutungsschwere die nächsten austauschbaren Metaphern in die neo-celangweilten Hörgänge und hackt weiter ein auf meine Sehnsucht nach Inhalt und Intensität, die keine echte Provokation sondern nur wichtigtuerische Prävention halbstarker Mittzwanziger vernimmt. Und ich verlasse den Weihrauchkellerdunstkreis, wo die vermeintliche Dichtung sich selbst in einem isolierten abwesenden Jetzt gleichsam befeiert und heimlich laut beerdigt und denke nur: LYRIK MUSS JETZT mal ungehorsam sein, sonst wird sie niemals das Volk erreichen, das sowieso ALLE Dichter für überflüssig hält, weil sie am Zustand der Welt nichts ändern, als ob irgendein anderer Beruf irgendwas änderte. Es will niemand irgendwas wirklich ändern, sie wollen nur alle ihre Schäfchen ins Trockene bringen und führen dazu dementsprechende Klüngelkriege, so einfach ist das. Mein Nachbar ist Metzger im Land der Denker, und der sagt mir glatt: „Ich lebe in Deutschland, aber die Dichtung sagt mir nichts.“ Und ich kann es ihm keine Spur übel nehmen und traue mich nicht, ihm mein bestes Gedicht zu zeigen. Auch ich tanze lieber in einer leeren Disco zur stundenlangen Stille von John Cage als bei DaimlerChrysler am Potsdamer Platz herum. Und ich kaufe meine Laugenbrötchen in einer türkischen Bäckerei um die Ecke, esse Tortellini Gorgonzola beim Italiener gegenüber, rupfe Grashalme mit Walt Whitman oder im Gegenteil: besser mit Allen Ginsberg, wenn der seelische Schwerpunkt auf einer Kritik am System liegen soll (statt im voreiligen Kitsch eines riskanten Nationalstolzes zu münden) und maile meinem Bruder in Australien. Die Achse der Welt resultiert für mich nicht aus „Gut & Böse“ sondern aus kosmischer Rotation und meine Lieblingsfrage beim Aufwachen lautet jeden Morgen: „Sind die Außerirdischen heute nacht unbemerkt gelandet?“ Aber damit etwas verständlicher wird, wovon ich eigentlich rede, bedarf es auch hier der Enttarnung solch praktischer Wörter wie „Tag & Nacht“ als äußerst relativ, denn vielleicht landet ein Raumschiff ja lieber auf der sonnigen Seite des Planeten, während ich noch im Halbdunkel der sommerlichen Dämmerung davon träume, meine Traumfrau nicht nur im Traum zu treffen sondern unter dem klaren Sternenhimmel im Park, der seit Einführung der 74-Cyberstunden-Woche menschenleer bleibt. Natürlich komme ich nun wieder von Hölzchen auf Stöckchen, aber: kennen Sie einen wahren Unterschied zwischen Holz und Stock? Sehen Sie, das ist die Sprache, das sind die Wörter, unser Gebrabbel seit Jahrtausenden: nichts als Redewendungen und keine wirklich ernstgemeinte Wende in Sicht! Deshalb behaupte ich immer noch, daß ein Gedicht mindestens drei Wörter umfassen muß, um ein echtes Gedicht zu sein. Alles dadrunter ist billige Mystik und alles dadrüber meist blumige Wiederholung, um nicht auf den löchrigen Punkt zu kommen. Und so schleichen die Dichter um den heißen Brei, besonders die Gattung der Jungautoren, denn deren Zungen sind nicht gut genug durchblutet, um kochende Grundlosigkeiten schmerzfrei durchs neuronale Netzwerk zu schleusen. Aber gute Dichtung muß ätzen wie geistige Antibiotika gegen Dummheit, ja, muß sich sogar an sich selbst verbrennen, denn wenn ich mir schon die Zeit nehme, Gedichte auf Tauglichkeit für meinen Seinsgewinn zu überprüfen, dann gibt es nur 1 Methode, die funktioniert: Das Große Ät-Zen. Ansonsten bleibt nur noch die Liebe. Aber das soll mal jemand Politikern wie Johannes Rau erzählen, der sich neuerdings „Schirmherr verfolgter Kunst“ schimpfen darf, nachdem er ein paar Jährchen vorher Joseph Beuys aus seinem Amt werfen konnte, weil der seine Professur nutzte, um jedem Menschen den Künstlertest zu ermöglichen. Manchmal schleicht sich da der Verdacht ein, daß Basisdemokratie in Demokratien nicht richtig erwünscht ist, sondern die Diktatur nur mit demokratischen Mitteln weitergeführt wird. Und da schließt sich der Kreis und ich falle wieder in die Sprachlosigkeit eines Sofas mit Rosenmustern zurück, während die Kaffeeklatschrunde meine Versunkenheit überhaupt nicht bemerkt, denn die Kekse schmecken einfach zu lecker…
Tom de Toys, 27.–29.6.2003
(27.6. Akademie der Künste: „EUROPA WOHIN“ mit Habermas & Handlangern & 28.6. Backfabrik: „LYRIK VON JETZT“ mit Kuhligk & Konsorten)
Lyrik von Jetzt
Äußerlich erinnert der Plastikeinband an Thomas Klings Sprachspeicher. Und dieser Anthologietradition wird leider auch in der weitgehenden Aussparung bestimmter Strömungen gefolgt: Wie man im Sprachspeicher weder Morgenstern noch Ringelnatz und auch keinen Autor der Neuen Frankfurter Schule findet, so ist auch in Lyrik von Jetzt die komische Lyrik kaum vertreten. Das Fehlen von Namen wie Max Goldt oder Wiglaf Droste läßt sich mit der Grenze Jahrgang 1965 begründen; dieser vorzuwerfen, sie sei willkürlich, wäre unfair, weil beinahe jede Altersgrenze das ist. Aber da im Vorwort Bezug auf Poetry Slam-Literatur genommen wird, müßten mehr jüngere Autoren komischer Lyrik, die beim Live-Publikum meist mehr Beachtung findet als bei der Literaturkritik, vertreten sein.
Weiter ist im Vorwort von einer „neue[n] Generation“ die Rede und in der Nachbemerkung der Herausgeber von Vertretern der „Jüngeren und jüngsten Generation deutschsprachiger Poesie“. Daß es sich um eine solche handelt, kann angesichts eines Altersunterschieds von bis zu sechzehn Jahren und der Tatsache, daß nur fünfzehn der vierundsiebzig Autoren unter dreißig und gerade einmal drei jünger als fünfundzwanzig sind, jedoch bezweifelt werden. Und diese Einwände entkräftet auch nicht Gerhard Falkners Postulat, die „synchronisierte[] Vollzähligkeit“ werde „den Rang dieses Buches sichern, egal ob Wölfe heulen oder Schafe blöken, denn es ist ein Buch, das eine Generation komplett aus dem eigenen Boden gestampft hat“. – Eine Generation aus dem Boden stampfen konnten die Herausgeber dieser Anthologie aber nicht: Die versammelten Lyrikerinnen und Lyriker verbindet auf den ersten Blick nichts, außer, geniale Lösung dieses Problems, eben die Heterogenität der vielleicht „erste[n] schlagwortlose]n]“, der „erste[n] ,No-Name-Generation‘ überhaupt“.
Dem durch die Formulierung „das Konzertstück, das daraus entstand, heißt Lyrik von Jetzt“ suggerierten Vergleich zu Kurt Pinthus’ Menschheitsdämmerung. Eine Symphonie zeitgenössischer Dichtung hält die Sammlung in puncto Geschlossenheit nicht stand. Jedoch vermeidet sie auch die durch das kompositorische Anordnen von Gedichten verschiedener Autoren stattfindende Kontextualisierung und damit Bedeutungseinschränkung der Texte, die Pinthus’ Anthologie vorgeworfen werden kann. Auch die Gefahr einer aus späterer Sicht falsch gewichteten Aufteilung des zur Verfügung stehenden Platzes auf die Autoren ist umgangen worden: Jeder Autor, unabhängig von seinem gegenwärtigen Bekanntheitsgrad, ist mit vier Gedichten vertreten. Das ermöglicht, sich ein zwar relativ differenziertes Bild von einem Autor zu machen, nicht aber, sich wirklich hineinzulesen in seinen Ton und seine Themen. Doch zum Weiterlesen sind in einem umfangreichen Anhang neben Biographien auch Bibliographien zu den einzelnen Autoren enthalten.
So bietet Lyrik von Jetzt – mit den angeführten Einschränkungen – ein recht repräsentatives Bild der aktuellen Lyrik. Gemieden werden Reim und Metrum, vom Manko der Nähe zur Trivialliteratur befreit scheint dagegen das ausgiebige Verwenden von Adjektiven. Auch die Wahl der Topoi scheint unbeeindruckt von der Problematik des schon Gesagten, des in der Moderne problematisch Gewordenen zu erfolgen: Natur, Großstadt, Reisen, Liebe und das Dichten selbst stehen im Zentrum der meisten Texte, das Verhältnis zu Gesellschaft und Sprache, die Abhängigkeit auch der Wahrnehmung von beiden, werden hingegen nur selten thematisiert. Das Ich, das sich, wenn auch nicht gerade breitbeinig, so doch in seiner Existenz meistens recht unangefochten, durch die Gedichte bewegt, nimmt zwar gelegentlich lakonisch und recht desillusioniert wirkend seine Umwelt wahr, unterwirft diese Wahrnehmung selbst aber nur selten einer Reflexion. Wenn an lyrische Traditionen angeknüpft wird, dann am ehesten an Brinkmanns Snap-Shot-Poetik (etwa in Thomas Heinolds „am ölberg“: „[…] / wie der schnappschuß eines unbekannten fotografen / […] / beweise sammelnd wie du“), das Meiste wirkt aber erstaunlich unbekümmert. Darin einen „sehr trockenen Ausklang der Postmoderne“ sehen zu wollen, erscheint angesichts der nur selten erkennbaren Selbstreflexion oder Ironie nicht ganz unproblematisch. Die meisten Texte erwecken eher den Eindruck, als wolle man sich die Ausdrucksmöglichkeiten nicht durch Theorien einschränken lassen, ein bißchen „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“, nur ohne Fröhlichkeit und ohne die Aggressivität des gezielt reaktionären Schlagers.
Daß dabei schöne, interessante und auch großartige Texte entstehen, soll hier gar nicht in Abrede gestellt werden. Auch gibt es keine wirklichen Ausfälle, was bei 296 Gedichten eine enorme Leistung der Herausgeber Björn Kuhligk und Jan Wagner ist. Die herausragenden Texte sind aber die, in denen die eigene Perspektive relativiert wird, wie in Maik Lipperts „z.b. bananen“ durch das Einbeziehen der gesellschaftlichen Dimension:
[…]
und doch vergaß und vergesse ich mich noch heute
beim lösen der schalen
mit jedem biß ins mark
und ich gestehe
nicht an juanita gedacht zu haben
nicht an ihren vater miguel
nicht an jaime julio und atahualpa
ich weiß deren schule
sind geschwollene hände
und das modernde alphabet der stauden
[…]
und ich kaue gewissenlos
im gebiß tastet die zunge
vergeblich nach sehnsucht
zur buße
In den wenigen Texten, die vom Prototyp des ernsten, reim- und metrumfreien Gedichts, in dessen Zentrum ein wahrnehmendes Ich steht, abweichen, finden sich oft gleich mehrere der bei den anderen vermißten Merkmale. Daß der Reim, zuweilen auch gegen den Willen des Autors, komische Effekte erzeugen kann, ist nichts Neues. Wohl aber, daß das Einbeziehen der historischen Dimension Humor nicht mehr auszuschließen scheint. Bei Stan Lafleur steht zwischen grotesken Kindheitserinnerungen („[…] / die nachbarn schluckten / viele kabel, bis hinein in die leber / & groszvater gab strom / das waren so die tanzveranstaltungen“, „tanz“) und einem komischen Gedicht über eine vielleicht verpaßte Liebe („[…] // ein einfall & es waer geschehen / zb dasz ich rosen klaute / ich werd dich niemals wiedersehen / weil ich stattdessen doener kaute // […]“, „bei murat“) plötzlich:
[…]
sieh: hier fiel dein groszvater
wofuer, das wuszte er nicht, er war blind
falls glaubhaft ist, was seine tochter so sagt
die angeblich bis aufs zahnfleisch
vergewaltigt worden war
von den anderen & den unseren
[…]
(„sieges lied ,am stachelwaeldchen‘“).
Der Umgang mit der künstlerischen Tradition ist, wenn sie denn einmal thematisiert wird, durchaus entspannt:
wie auf Raffaels Madonna:
Am unteren Bildrand lehnen
die Engel – nächste Generation.
Die müssen fast gähnen,
[…]
(Dirk von Petersdorff: „Die Zukunft beginnt“)
Auch Nicolai Kobus’ Rilke-Kontrafaktur „der dichter“, eine der wenigen direkten Auseinandersetzungen mit der literarischen Tradition, ist kein wütender Bildersturm, sondern ein nüchternes Befragen des Rilke-Textes bezüglich seiner Anwendbarkeit auf das Leben:
[…]
man wirft dir fleisch tagtäglich durch die stäbe
zu fressen hast du also, und warum
wünschst du dir, daß es keine stäbe gäbe?
die freiheit bringt dich doch nur um.
Mit einer gewissen, wenn vielleicht auch der Resignation entspringenden Leichtigkeit wird auch auf philosophische Fragen wie die nach der Determiniertheit des eigenen Handelns („[…] / Ob auch in mir jemand haust, // der seine hand durch die meine / zwängt und sie zappeln läßt? / […]“) reagiert:
[…]
Da zog ich zurück die Hand
und sperrte weit auf den Mond,
der lange noch offen stand
ferne am Horizont…
(Alexander Nitzberg: „Clair de Lune“)
Natürlich erproben auch die vertretenen etablierten Autoren wie Franzobel, Tanja Dückers, Albert Ostermaier, Marcel Beyer oder Mirko Bonné neue, zwischen Subjekt und Umwelt vermittelnde Ausdrucksmöglichkeiten. Der Reiz dieser Anthologie liegt aber in der Suche nach noch unbekannten Autoren und der Möglichkeit zu Beobachtungen wie den hier gemachten.
Es scheint dennoch unwahrscheinlich, daß Lyrik von Jetzt einen ähnlichen Status wie die Menschheitsdämmerung erlangen wird. Das liegt weniger an den Herausgebern als an den Autoren selbst, die im Gegensatz zur sogenannten expressionistischen Generation mehrheitlich nichts weniger zu wollen scheinen, als die Lyrik zu revolutionieren. Ein nicht unsympathischer, aber naturgemäß unspektakulärer Rückzug ins Private findet statt, und nie erschien die Aussage, ein Autor schriebe nur für sich selbst, glaubhafter als bei dieser Generation, die gar keine sein will.
Martin Rehfeldt, Deutsche Bücher, Heft 4, 2003
Die Neue Schlichtheit in Lyrik von Jetzt:
– Poetische Diskursverschiebungen in der deutschsprachigen Gegenwartsdichtung nach 2000. –
1. Einleitung: Über die Überschaubarkeit der aktuellen Lyrik
Unter den deutschsprachigen Lyrik-Anthologien, die seit Anfang der neunziger Jahre vor allem unter dem Vorzeichen des retrospektiven Überblicks in beträchtlicher Anzahl erschienen sind, sticht eine Gedichtsammlung hervor, deren Herausgeber, die Lyriker Björn Kuhligk und Jan Wagner, es sich zur Aufgabe machten, den aktuellen Stand der Gegenwartslyrik umfassend zu dokumentieren. Der Band Lyrik von Jetzt stellt vierundsiebzig, zum großen Teil noch wenig bekannte Stimmen zusammen.1 Beachtenswert ist die Anthologie aus dreierlei Gründen:
1.) Sie bietet der Literaturwissenschaft einen direkten Zugang zu einem recht beträchtlichen Ausschnitt aus der gegenwärtigen Lyrikproduktion. Aus der Unmasse von Zeitschriften, Webseiten, Audio-Kassetten, CD-Aufnahmen und der saisonalen Produktion der Klein- und Kleinstverlage, ragt nach wie vor die umfassende Textsammlung in Buchform heraus, weil sie den Jetztstand der Lyrik in der bibliothekarischen Ordnung der Bücher festhält und dem Urteil professioneller Kritiker aussetzt. Anders als die in Zeiten des Internets und der Minipressen oft äußerst verstreut und auf diversen medialen Trägern an die Öffentlichkeit tretenden Gedichte, bieten die in Lyrik von Jetzt versammelten Texte ferner die Möglichkeit die Unterschiede zwischen der tonangebenden, d.h. marktführenden Lyrik, und der Grauzone der jungen Lyrik von ,Jetzt‘ zu erfassen: die Konturen werden erkennbarer.
2.) Die Anthologie macht eindrücklich klar, daß kulturelle Resonanz auf der Beobachtung des Sprungs von der Ebene der regionalen Szenen, Selbstverlage und Books on Demand zur Ebene der Großverlage, Literaturwettbewerbe und Feuilletonbesprechungen. Das Erscheinen der Gedichtsammlung bei einem der renommiertesten deutschen Kunst- und Literaturverlage ist daher an sich schon ein Faktum, das für Aufmerksamkeit sorgt.
3.) Vor allem macht die gezielte Aufnahme noch wenig bekannter Namen – im Vorwort ist die Rede von „den Jüngeren und ganz Jungen“ bis zum Jahrgang 1965 (S. 10)2 – auch für kursorische Beobachter schlagartig transparent, was sich häufig dem kritischen Blick entzieht, nämlich welch große Zahl von Lyrikern alljährlich in den Literaturbetrieb eintritt. Es ist kein Zufall, daß in den Neunzigern vor allem Debüts Beachtung fanden, sind sie es doch, die uns angesichts der abzählbaren Menge wieder Überschaubarkeit und Bekanntheit mit Namen suggeriert. Unzählige Festivals, Salon-Lesungen, Slam-Wettbewerbe und Schreibwerkstatt-Begegnungen tragen dazu bei, diese Namen laufend zu aktualisieren, woraus sich der eminente Anreiz zur ,Entdeckung‘ des Frischen, Jungen, Unverbrauchten ergibt – und das Bedürfnis nach rascher Wertung. Als Komplementärphänomen zu den anwachsenden Textmassen und Namensdateien bilden Wettbewerb und Preise, die gängige Hypertrophie von Lob oder Verriß, die Signatur des heutigen Literaturbetriebs. Was die große Menge von Lyrikern als Mangel an Schwellenerfahrung erleben muß, wird wiederum durch das Pathos der (Ent-)würdigung für eine kleine Gruppe kompensiert. Deswegen spielen im institutionalisierten Kulturmanagement die Ereignis-werte des Auftritts und der Kurzbiographie eine zunehmend wichtige Rolle; gutes Marketing versieht jede Vita mit illustren Wohnorten, exquisiten Preisen, fotogenen Konterfeis. Kein Gedicht ohne Gesicht.
In den folgenden diskurstheoretischen Betrachtungen soll es daher gerade nicht um herausragende Vertreter einer neuen Altersgruppe gehen. Anstatt ausgewählte Fallgeschichten zu präsentieren, die das Gedicht auf eine jeweilige Kurzbiographie beziehen und auf rasche Wertung angelegt sind, werden in einer Art Gedankenexperiment die Grundtendenzen der Anthologie aufgespürt. Damit läßt sich hinter einer gedanklich zu durchdringenden Motivlage und Sprachgestalt ein Problemfeld umreissen, das sich zweifelslos auch transindividuell entfaltet und aus dem kleinen Grenzverkehr unter Kohorten, Regionen und Netzwerken erwächst. Wie sich poetische Idiome einer Zeit entwickeln, hängt nicht allein von der individuellen Prägekraft ab. Vielmehr ist gerade an der Gedichtsprache von Autoren, die heute in den Literaturverkehr eintreten, wahrzunehmen, wie bestimmte Zeichen, Signalwörter oder Verständigungsgesten angenommen, verstärkt oder ignoriert werden. Dieser kapillare Austausch von Reizmaterial bildet über bloße Motiv- und Themenbeschreibung hinaus den zu untersuchenden Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung mit der aktuellen deutschsprachigen Gedichtproduktion. Ob nun Autoren die Codes so manipulieren, daß sie als ,komplex‘, ,raffiniert‘, ,originell‘, oder ,innovativ‘ identifiziert werden können, soll für die Diskursbeschreibung erst dann von Belang sein, wenn ein detaillierter Kategorienraster erstellt wurde, der es erlaubt, die ästhetische Vergleichsarbeit auch argumentativ abzusichern.
Ihrer Absicht nach versuchen die Herausgeber einen panoramatischen Überblick zu liefern, der ähnlich wie die in den achtziger Jahren erschienene, der damaligen DDR-Literatur gewidmete Textesammlung Berührung ist nur eine Randerscheinung die Vielfalt einer dem allgemeinen Publikum nur wenig bekannten Literaturlandschaft darstellen soll.3 Indessen sind selbst Überblicke immer arbiträr. Sie ummanteln mit einer Vision vom Ganzen, was notwendigerweise Einblick in favorisierte Teilbereiche bleiben muß. Der relevante Einblick von Lyrik von Jetzt bezieht sich auf diejenigen Lyriker, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, oder auf die sogenannten jungen Autoren mit vertrauten Namen wie Marcel Beyer, Steffen Jacobs, Albert Ostermaier, die vor dem recht willkürlichen Schwellendatum „Jahrgang 65“ liegen. Ein derartiger Einblick umgreift dann Autoren, die zwar nicht so bekannt sind wie Hans Magnus Enzensberger, aber auch nicht so regional verbunden wie Georg Fox oder Garip Yildirim. Literaturkritiker haben sich ganz folgerichtig an markanten und vertrauten Eckpunkten orientiert, wie z.B. an den wenigen, jedoch auffällig expliziten Rückbezügen auf Rolf Dieter Brinkmann.4 Die ebenso deutlichen Anleihen an Vorbilder wie Goethe, Hölderlin, Rilke, Trakl, Williams, aber auch Zeitgenossen wie Falkner, Grünbein, Kling, Kolbe etc. blieben unerwähnt. Wichtiger noch: Die Faktenlage, was zentrale Motive, Sprachgestaltung, Reizwörter und Tonlage betrifft, ist nach wie vor ausgesprochen diffus. Die analytische Arbeit liegt nun darin, diese detailliert zu bestimmen. Fernerhin sind dadurch Verschiebungen in der Haltung zu relevanten Groß-themen und dominanten Idiomen der deutschsprachigen Lyrik zu kennzeichnen. Vorab sei gesagt, daß gerade die intellektuellen Auseinandersetzungen der neunziger Jahre, sei es die Kanondebatte, die Antikerezeption oder der Luftkrieg der vierziger Jahre, die so nachhaltig die Gedichtpublikationen von Enzensberger, Grünbein, Kling oder Raoul Schrott bestimmten und die Rezeption entsprechend auf die poetisch artikulierte Erinnerungspolitik dieser Autoren lenkten, offenbar keinen deutlichen Einfluß auf die Gedichte der Anthologie hinterlassen haben.
2. Kontroverse Bestimmungsversuche: Gegenwartslyrik zwischen „Naturschriften“ und Großstadtpoetik
Welche generelle Ausrichtung ist eigentlich in den neu vorgestellten Texten, trotz ihrer Diversität, auf Anhieb auszumachen? Eine Antwort deutet sich in den Einschätzungen von Autoren wie z.B. Enno Stahl und Ulrike Draesner an, da sich in deren Lesart dezidierte Hinweise auf aktuelle Poetikpositionen und Schreibweisen finden. Beide Autoren bezogen aufgrund ihrer Nähe zu Schreibprozessen direkt Stellung zum Reizvokabular der jüngsten Gegenwart. Ihnen zufolge springen bei der Begegnung mit Gegenwartslyrik die traditionsbesetzten Lyrik-Großthemen Natur und Großstadt ins Auge, und zwar insbesondere bei denjenigen Lyrikern, die in Lyrik von Jetzt zu den noch nicht etablierten zu rechnen sind. So hebt die Lyrikerin und Prosaautorin Ulrike Draesner hervor, daß seit Mitte der neunziger Jahre ein Riß bestehe „zwischen einer Avantgarde des Sprachexperimentes und einer Tradition eher narrativen Dichtens“, womit sie freilich zwei Stichstellen markiert, die sich sehr frei etwa mit Friederike Mayröcker, Elke Erb oder Franz-Josef Czernin und einer endlosen Reihe von ,erzählenden‘ Autoren assoziieren lassen. Daraus erkläre sich die derzeitige „seltsame Rückwärtsbewegung“, die sich einer geschichtsbewußten „Verbindungsarbeit“ widme, nämlich dem „Aufgreifen verlorener Fäden, Bereicherung, Ausweitung“. An einigen Neuveröffentlichungen der in Lyrik von Jetzt vertretenen jungen Autoren erkennt Draesner demzufolge „Naturschriften überall“, nämlich „Blüten, Teiche, Gräser, Nadeln, Farne, Moose, Sümpfe, Dünen, Meere, Karste, Strände, Berge, Parks, bevölkert von Herden von Ziegen, Schafen, Pferden, Kühen, Vögeln und Insekten. Doch warum?“ Diese Tendenz sei „unmittelbar mit dem Aufleben alter Formen verbunden“,5 was anhand der Anthologie freilich nur sehr bedingt am eher spärlichen Einsatz der Sonettform zu bestätigen ist.
Überraschend andere Schlüsse zieht indessen der Performer Enno Stahl, der in seiner Stellungnahme zu zeitgenössischen Stadtgedichten, darunter auch Lyrik von Jetzt, an den jungen Autoren bemerkt, daß sie sich wieder mit der Stadt befaßten, indem sie gegen „zynischen Fatalismus“ einige „Einzelfälle symbolisch aufladen“, und sich damit einer Tradition verpflichteten, die bewußt mache, daß die Großstadt auch ein „Ort der Entfremdung, der Entmenschlichung“ sei.6 Beide Autoren zentrieren ihre völlig entgegengesetzte Betrachtungen auf vertraute Suchbilder, die sich aus Interpretationstraditionen speisen, woraus die ganz Schwierigkeit einer Festlegung auf Grundtendenzen erhellt. Anders als bei einer Suche nach Einflüssen und Auswahl der Top Ten finden sich hier bedenkenswerte Hinweise auf einen möglichen Zugang zu Grundthemen neuerer Dichtung. Jedoch bleibt durch Draesners und Stahls spontanen Rückbezug auf literarhistorische Klassifikationsmuster die zeittypische Art der Anverwandlung von Motiv-Traditionen ebenso unberücksichtigt wie die subjekt-bezogene Problematik der sprachlichen Bewältigung und Beobachtbarkeit von Umweltaspekten wie Natur und Großstadt. Anders gesagt: nach wie vor bilden die kulturpolitisch überbesetzten Vorstellungskomplexe Großstadt und Natur ein Kräftefeld, das infolge der antagonistischen Einstufung von Neuerung und Bewahrung, Moderne und Tradition, noch über Adorno hinaus den ästhetischen Reflexionshorizont bestimmte. Obschon politische Depolarisierungstendenzen und ökologische Strömungen der siebziger Jahre diese Oppositionen aufweichten und in widersprüchliche und facettenhafte Denkmuster überführten, hallt die ehemals brisante Nachkriegs-Unterscheidung zwischen modernistischer Großstadtlyrik und traditionalistischer Naturlyrik, zwischen Metropole und Provinz, offenbar auch in den ernstzunehmenden aktuellen Positionsbestimmungen von Stahl und Draesner nach. Die anvisierten Themenfelder Großstadt und Natur ließen sich indessen auch weniger polarisiert verstehen: sie sind im Anschluß an Simmel, Hellpach und Uexküll als reizarme bzw. reizstarke Umwelt aufzufassen, die ebensosehr an die Beobachtbarkeit bzw. Meßbarkeit durch die menschliche oder maschinelle Sinnesapparatur wie an ihre sprachliche Benennbarkeit gebunden bleibt.
Unter Beachtung der inneren Verflechtung von zeichenhaft erscheinender Umwelt, Benennungspotential und Wahrnehmungsleistung soll die in dieser Anthologie gesammelten Gedichte sondiert werden, um mit freischwebender Aufmerksamkeit die auffälligsten Motivstränge und Sprachgestaltungsansätze im Sinne einer überindividuellen Diskursformation zu sortieren. Also so, wie auch nicht-germanistisch konditionierte Leser, Lyrik von Jetzt zunächst einmal als Gesamttext lesen, mit dem Unterschied, daß das weite Feld der Gedichte hier der Methode des „mowing the lawn“ unterzogen wird, wie es unter Ozeanographen heißt, also einer sich systematisch wiederholenden, schleifenartigen Durchmusterung eines vorgeschriebenen Parcours. Statt der Einzelanalyse und vorschnellen Auswahl von bemerkenswerten Autoren steht also eine nüchterne Datenerhebung an, um dadurch
a.) Kategorien genauer Beschreibung abzuleiten;
b.) die Konturen eines Motiv- und Problemfeldes zu erfassen, das sich aus dem Austausch zwischen sprachbildender bzw. beobachtender Instanz und Umwelt ergibt;
c.) zu einer Kritik seiner eingeschriebenen Denkfiguren und insgeheimen Phantasmen, insbesondere des Konstrukts einer quasi-wissenschaftlichen Beobachter-Position, zu gelangen.
3. Küsten, Gärten, Parks im Gedicht von Jetzt: Zugänge zur Kunstwelt von Natur und Großstadt
„Naturschriften überall“, so brachte Ulrike Draesner ihre Eindrücke von einer Lyrik, die vor allem nicht-urbanisierte Bereiche evoziere, auf den Begriff. In der Tat stechen die Verweise auf noch unbebaute, menschenleere Bereiche der Umwelt in Lyrik von Jetzt ins Auge. Doch kann sich heutige Raumerfahrung noch im romantischen Sinne auf ganzheitlich einbildbare Umgebungen beziehen? Wald, Wiese, Wüste sind der neueren Dichtung suspekt. Diese nämlich stellen langzeitig beobachtbare Ganzräume dar, die Schnittflächen zum raschen Einblick vermissen lassen. Stattdessen finden wir häufig städtische Ruhezonen, vor allem stille Parks, Gärten und Teiche (S. 22, 46, 95, 190, 285). Sie sind Areale der imaginativen Verwandlung und Erinnungsprojektion, Mahnmale für die Erosion des Vertrauten in der wechselgestaltigen Stadt, die in „ein kopfarchiv“ eingeht (S. 171). Wie aber werden diese Seh-Felder wahrgenommen? Was in das Blickfeld gerät, sind kontrollierte, minimale Bewegungsabläufe, ganz der alltäglichen Fenster- und Fernseherfahrung entsprechend: Das Welt-Bild ist wesentlich durch Zug- und Autofenster, Monitore und Sehschlitze geprägt. Zum anderen sind es immer wieder optisch verstärkte Signalelemente, die inmitten der stillgelegten Grauzonen allein noch Aufmerksamkeit erregen: eine Elster (S. 21), ein Plakat (S. 58), „rot oder rapid eye“ (S. 128). Das Auge ist dabei ebenso wie der Körper einem automatisierenden „Reiz-Reaktions-Schema“ (S. 31) unterstellt.7 Da aber die Landschaftsbeobachtung gerade nicht mehr in lebensweltlich verankerte Benennungsautomatismen eingebunden ist, verwischen sich dem beobachtenden Subjekt einfachste Differenzen:
eine lerche scheißt auf mein herz:
es ist frühling. könnte auch eine amsel sein (S. 243).
Die so drastisch vorgestellte Deformierung des Shakespeareschen Lerchen-Motivs erhellt die urbane Prägung des Beobachters, dem buchstäblich der Unterschied zwischen Amsel und Ampel einleuchtender ist als der zwischen Amsel und Lerche. Andernorts wird klargemacht, daß Vogelstimmen ohnehin der technischen Simulation überantwortet wurden, wenn man im Deutschlandfunk „seit vier Stunden / Das Zwitschern einer Amsel von CD ROM“ spielt (S. 183). Entscheidend ist gerade für die auf Wahrnehmung fixierten Autoren die illusionslose Darstellung einer Kunstfarbenwelt, die in ihrer unendlichen Fülle nach Aufmerksamkeit für das Rare heischt. Oder, genauer noch, das urbanisierte Bewußtsein verlangt nach dem Raren an sich, der konzentrierten Aufmerksamkeit. Denn poetische Konzentration bedeutet: Intensivierung des Zeitbewußtseins durch selektive Nichtwahrnehmung oder, im Sinne Freuds, Reizschutz gegen das Rauschen.
Nicht ohne tieferen Grund spielt die Asynchronität von Rhythmen eine beherrschende Rolle in der Anthologie. Das langsame „herz dieser stadt“ (S. 24), die „metallische Stunde“ (S. 350) oder der langsame „Takt des Meeres“ (S. 162) werfen ein unbestimmt bleibendes Ich, häufig auch ein abstraktes Wir, auf das unaufhaltsame Vergehen der Zeit zurück. Im Grundton elegisch umspielen diese Gedichte, die vom immer schon nachträglichen ,Jetzt‘ handeln, ein epochales Bewußtsein von der aufklaffenden Schere zwischen Weltzeit und Lebenszeit (Hans Blumenberg). Doch die bisweilen dunkle Abtönung des Gedichts kann im Einzelfall auch etwas überdreht erscheinen. Wer spürt und wer beobachtet die Müdigkeit in Zeilen wie „Wir sahen müde aus, von fern, in der Vergeblichkeit der Ufer / zu allem Übel kam noch die Nacht“ (S. 317)? Hier wird man gewahr, daß zeitgenössische Lyrik die Tonlagen nicht anders einsetzt als die Musikbranche. So wie im Studio die fremden Klänge des trance hop abgemischt werden, so überblenden sich Stimmen zum Gemurmel. Man könnte sagen: das Gedicht ist heute das prädisponierte Medium, um Befindlichkeit durch Abmischung zu inszenieren. Das heißt: keine Empfindsamkeit entspringt einem vorgeblich authentisch erlebenden und sich selbst sinnlich erfahrenden Subjekt, sondern Außensicht, Mutmaßung und ironischer Rätselvers indizieren Stimmungsmöglichkeiten in einer Surrogatwelt. Das atmosphärisch arbeitende Gedicht kreiert mithin eine ,merkwürdige‘ Parallelwelt, wie sie z.B. in der russischen Literatur für Jurij Mamlejews „Metaphysischen Realismus“ typisch ist.
Überblickt man diejenigen Gedichte, die am ehesten der von Enno Stahl annoncierten „urbanen Szenerie“ entsprechen könnten, so entdeckt man rasch eine innere Distanzierung der meisten Autoren von der Flanerie der achtziger Jahre. Dies entspricht einem „Ende des Flanierens“, wie es zwar am Ende des vorangegangenen Jahrzehnts von Peter Handke verkündet wurde, jedoch erst in den Folgejahren, im Zeichen der postmodernen Städteerkundung von Hanns-Josef Ortheil bis Gerhard Falkner und Durs Grünbein, ausgiebig thematisiert wurde. Um 2000 war das an der architektonischen Entwicklung von Frankfurt und Berlin orientierte Metropolenfieber weitgehend abgeklungen. Dem neuesten Zeitgefühl entspricht imaginationsgesättigte Erinnerung, die einher geht mit gelegentlichen Attacken gegen eine vergnügungssüchtige Neue Mitte (S. 198, 223, 352). So ist zwar bei Ron Winkler,8 sicherlich infolge seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem grünbeinschen Frühwerk, noch der Baudelaire-Impuls wirksam (S. 304); bei Alexander Nitzberg oder Tanja Dückers wirkt das Pathos der Moderne indessen schon klassizistisch gedämpft (S. 164, 278). Die von Enno Stahl anvisierte urbane Bewegtheit und Anrufung der Stadt findet sich eigentlich nur in einigen rap-artig rhythmisierten Erzählgedichten (S. 114, 183, 198, 242); doch deren eingängige Rhythmisierung widerruft den von ihm diagnostizierten Entfremdungstopos. In der Anthologie findet man statt der Stadtdschungelexpedition ein Ausharren an urbanen Ruhezonen. Zum Beispiel gehen in der tranceähnlichen Annäherung an städtische Grünareale diese ganz unversehens in bizarre Märchenparks über (S. 60, 208, 289). Ähnlich werden auch die häufig umschwärmten großelterlichen Gärten als Erinnerungsorte konstruiert, die an widersprüchliche Empfindungen für die Verwandten geknüpft sind und die Idylle aushöhlen (S. 44, 49, 95, 285, 306). Parks, wie in einigen Gedichten Jan Wagners oder Monika Rincks, provozieren Meditationen über die Ungleichzeitigkeit von Jahreszeit und Erlebniszeit (S. 23, 250). Ganz im Gegensatz zu den die literarische Landschaft des vorangegangen Jahrzehnts bestimmenden Fernreisen und Hotelaufenthalten (Joachim Sartorius, Raoul Schrott u.a.), konzentrieren sich die in Lyrik von Jetzt zusammengestellten Texte ziemlich unspektakulär auf Wohnbereiche im vertrauten Umfeld: „Zuhause bin ich ausgezogen / Nach Hause kehr ich wieder ein“, heißt es in Florian Voss’ „O.T.“, das glöckchenartig mit einem fernen Heine-Nachhall endet (S. 173). Somit steht weder moderne Entfremdung, noch die flanierende Erkundung der Fremde im Zentrum der Auseinandersetzung mit Urbanität. Das artifizielle Ambiente ist vielmehr als zweite Natur derart vertraut, daß die Passage oder der Aufenthalt an Besinnungsorten innerhalb oder jenseits der Innovationsmaschine Stadt den Blick auf nicht-mechanisierte Bewegungsverläufe und Weltzeitvorgänge freigibt.
Ein weiterer Schritt ist zu gehen, um detailliert darzulegen, wie und warum sich die poetische Zuwendung zu einer stadtnahen, aber unbebauten, oft menschenleeren Umwelt in wiederkehrenden Kernmotiven wie der Scheidung von Räumen niederschlägt. Erste Hinweise finden sich in Gedichten, die das Ufer, die Landstraße, die „hartgezeichnete, klare Linie“ (S. 313), Ränder und Nahtstellen (S. 121, 143, 257) umspielen. Das Eintauchen in ganzheitliche „Sphären“ (Peter Sloterdijk) oder ihre Durchquerung wird offenbar konsequent vermieden. Offenbar lassen sich an den Schnittflächen von Räumen, darunter auch dem „Todesstreifen“ an der ehemaligen DDR/BRD-Grenze, noch bedeutungsstiftende Scheidelinien erkennen (S. 143, 221, 315, 331). Motivisch konsistent werden in der Anthologie im wesentlichen Grenzräume im wörtlichen und im figürlichen Sinne anvisiert, nämlich Durchdringungs- und Scheidezonen, die Bewegtes und Unbewegtes, Vergangenes und Heutiges, Signale und Rauschen aufeinander beziehen. Diese Zonen forden den mentalen Akt der Beobachtung, Erinnerung und vor allem auch der metaphorischen Benennung heraus.
Diese Beobachtung läßt sich an einem Schlüsselthema jüngster Lyrik illustrieren, nämlich an der Begegnung mit dem maritimen Bereich. „Du brauchst eine Küste“ (S. 154), heißt es symptomatisch bei Björn Kuhligk. Auch hier wieder ist es also nicht das Meer selbst, sondern die Trikolore von Land, Himmel und Wasser, die motivisch hervorsticht. Es handelt sich um die spielerische Setzung eines liminalen Raums, der sich in Gestalt von Häfen und Werften an Ostsee und Nordsee auch als Restareal des Industriezeitalters darbieten mag (S. 162, 315). Anders als in der Romantik von 1800 stellt die Küste dem Individuum keine Projektionsfläche für die sublime Einbildung von Transzendenz dar. Sie ist um 2000 wesentlich Schauplatz von grotesken Phänomenen wie einem Vogel-Duett. Die Küste wird in der Vision z.B. zum Ort, an dem „die Möwen zweistimmig sangen“ (S. 16). Hier noch scheinen zyklische Bewegungen, vor allem der Wolken und Wellen, als Weltzeitphänomen beobachtbar, hier scheint der sprachbildnerischen Instanz die Möglichkeit gegeben, sich einen unverstellten Horizont einzubilden, der ebenso richtungsweisend wie unverfügbar dem Besitzergreifungswunsch eine Grenze setzt (S. 315). Nicht transzendenzsüchtige Entgrenzung ist Ziel, sondern ein Innehalten auf halber Strecke, um Zeit zu stauen, sich der durchaus überschreitbaren Grenzen zu vergewissern und sich keiner falschen Versprechungen hinzugeben (S. 295). Mit dieser Schwellensetzung geht in der Anthologie die Distanzierung von Groß- und Zentralthemen einher, die den tonangebenden poetischen Diskurs der Gegenwart besetzt halten: Medien, Naturwissenschaften, Metropole und Hauptstadt, Luftkrieg, Antike, Kulturnation. Diese (prätendierte) Indifferenz gegenüber dem derzeit in Debatten und im Feuilleton favorisierten Themenkatalog bei Enzensberger, Grünbein, Schrott u.a. deutet eine Suche jüngerer Lyriker nach neu zu besetzenden Arealen an.
4. Richtungsmangel und Losungen: Haus ohne Heim, Wärme ohne Wert, Matrosen ohne Meer
Die ohne Dringlichkeit zur Sprache kommende Sondierung des Gegenwartsbewußtseins oszilliert in der Anthologie zwischen einer erinnerten und einer erwünschten Existenz im deutschen Sprachraum. Trotz des gelegentlich anzutreffenden Gedankens zu reisen, „einfach (zu) verschwinden“ (S. 262), herrscht die repräsentative Einsicht, „verharren & / fortlaufen bleibt / sich gleich“ (S. 261). Man findet sich damit ab, letztlich in einem „zerfressenen heim“ oder einer bezweifelten Heimat zu wohnen (S. 261, 294). Zu hören ist daher häufig vom Rückzug in die eigene Wohnung (S. 54, 185, 192), vom Vorsatz, „allein im Haus zu bleiben“ (S. 18), die Nacht zu durchwachen (S. 148) oder dem Regen vor der Haustür zu lauschen (S. 50). Diese Einengung der Welt auf den häuslichen Bereich erlaubt es, bisweilen recht empfindsame Beobachtungen zu Alltagssituationen anzustrengen oder, eher selten, auch einmal die eigenen Angsterlebnisse aufzuspüren (S. 100). In Schilderungen trauter Zweisamkeit wird jedoch gleichermaßen deutlich, daß dieses Zurückziehen auf eine abgeschottete, rein monadische Existenz zurückwerfen kann. Marion Poschmann zufolge ist das häusliche Ambiente dazu angetan, durch bloßes Beiandersein die „verschlossene[n] Kammern“ der Subjekte zu überwinden (S. 31), während Kersten Flenter etwas skeptisch das Zuhause im Dialog zu dem Ort erklärt, „wo ich mich nicht erklären muss“ (S. 185). Die eigene Wohnung ist demnach für eine Reihe von Autoren der zentrale Ort, an dem das Gewicht der Welt spürbar leichter wird. Von hier aus lassen sich letzte Bestände mustern (S. 314) und die Ränder des eigenen Gesichtskreises, der „ereignishorizont“ (S. 271), inspizieren. Damit ist angezeigt, daß das seit den frühen achtziger Jahren nicht abschwellende „Archivfieber“ (Derrida), der Impuls des Reklassifizierens, Sortierens und Ausmusterns – verstärkt durch das Endzeit- bzw. Neuzeit-Bewußtsein an der Milleniumsgrenze und durch neue medientechnologische Möglichkeiten –, maßgeblich die Bestandssicherung jüngerer Autoren beeinflußt. Jedoch: in weitaus kleineren Format als bei den Vorgängern der neunziger Jahre. Mit fast Eich’schem Gestus schlägt Björn Kuhligk eine generelle Inventur vor:
du brauchst zwei, drei
Wege, die du gehen kannst, zwei
Richtungen, ein Haus, das ist alles (S. 154).
Monadische Existenz, Ungewißheit über die Wege, Beschränkung des Horizonts – das sind offenkundig Zeichen eines latenten Unbehagens, Zeichen einer Suche nach Gewißheiten in einer reizgesättigten Moment-Kultur, die sich durch permanentes Krisenbewußtsein gegen Krisen immunisiert hat. Weder die neue Währung (S. 52, 96) noch die Offenheit Europas halten das Versprechen, tatsächlich einen Neubeginn darzustellen, denn sie „handeln“, laut Boris Preckwitz, „deinen Aufbruch zu Aufenthalten ab“ (S. 201). Was z.B. für Eva Carina anläßlich eines Friedhofsbesuchs als Versprechen bleibt, ist „nur Nippes der Ewigkeit“ (S. 339). Und von einem realen oder imaginierten Flugerlebnis bleiben nur „die wolken im fluglärm“ erinnerlich, vielleicht noch mit einem Dessert und einem Whisky in der Hand, so Lars-Arvid Brischke in einem vergnügten Neunstropher. Im Hinblick auf den verlockenden Abflug, eine Fernreise nach China, bleibt dem Sprecher nur das Rauchen einer Zigarette und die ironische Frage, „sind wir denn bodenpersonal“ (S. 320)? Letztlich verweist diese Vision von einer touristischen Eskapade das „Bodenpersonal“ in Zeiten des „rasenden Stillstands“ (Virilio) wieder auf sich selbst, auf die eigene Unbewegtheit und Traumresistenz. Im Klartext erinnern poetische Zeit-Reflexionen von Björn Kuhligk oder Tom Schulz sarkastisch an das Versprechen, „daß die Zukunft uns brauchen würde“ (S. 157), doch in der Jetztzeit findet sich keine lebbare Alternative:
Vorwärts und rückwärts
Sind ausgeschlossene Richtungen (S. 349).
Deswegen finden sich Titel in der Anthologie wie „Requiem“, „Psalm“, „am ölberg“ – Markierungen einer ehemals verbindlichen Richtungsanzeige – oder die metaphysikträchtige Frage Nitzbergs:
Doch wer verursacht die Winde? (S. 279).
Deswegen auch die leitmotivisch durch den Band laufende Suche nach verläßlichen Zyklen wie den Jahreszeiten,9 abzulesen an einem Text Marcel Diels:
wahlplakate die künder der zukunft
aaaaaes kommt wieder aufstieg
aaaaaes kommt konjunktur
aaaaaes kommt wieder herbst
ich wechsle die färbe ich wechsle
den blick das aussehn ich
bin ein baum ich spende
schatten ich bin ein schirm
(S. 264)
Wie einst Ingeborg Bachmann demontiert Marcel Diel die viel versprechende ,Reklame‘ der Parteien, um dem chamäleonhaften ,Ich‘ wieder ein sorgloses Wachstum zu bescheren. Zu erörtern wäre an dem Wiedereinsatz der Demontage aus der Nachkriegszeit (à la Bachmann und Enzensberger) vielerlei; besonders augenfällig ist indessen die überaus hohe Aufmerksamkeit für das Marktgeschehen, also nicht Gesellschaft, Staat oder Politik. Es ist gerade die Konjunktur, die trotz oder wegen uneinlösbarer politischer Versprechen wächst und wächst und wächst. Wie immer die Ankunft in der Marktwirtschaft bewertet wird, sie allein verspricht dem ,Ich‘ Farbe, Schatten, Wachstum und ein Auskommen, auch wenn die politischen Optionen sich wandeln. Dennoch: wendet sich ein Gedicht von der flimmernden Moment-Kultur im „Konsumismus“ (Norbert Bolz) zum Emotionskomplex Heimat, fließen durchaus vertraute Einschätzungs-muster in die Verse ein. Nach wie vor ist auch Heines Wintermärchen von Deutschland ein Topos, der die Reflexion über den eigenen Standort im zeitgenössischen Gedicht begleitet. Wenn man nicht, wie Johannes Jansen in herzhaft ironischem Tonfall, die nationale Identität völlig von sich weist – „Ich war nie ein Land und / Ich war nie ein Wir“ (S. 102) –, so ist andernorts immerhin noch zitathaft die Rede vom „wunden land“ (S. 146) oder einem Land als „Nachkriegshotel“ (S. 187). Während aber namhafte Juristen-Schriftststeller wie Bernhard Schlink weiterhin einer Heimat als Utopie (2000) nachfragen, herrschen unter vielen Autoren dieser Anthologie, wenn sie überhaupt an die in den späten siebziger Jahren problematisierte Heimatfrage anknüpfen, vielfach Zweifel an der Generalisierbarkeit dessen, was ihnen zur geläufigen Alltagserfahrung wurde: allein im transistorischen Moment des Grenzübergangs glaubt sich das Ich auf eine staatsbürgerliche Identität verwiesen zu werden Es ist eine Situation, die wiederum in Spannung zu einem personalisierten Begriff von „heimat“ (S. 294) steht, der vor allem im Hinblick auf die eigene Familie faßbare, doch z.T. unheimliche Konturen annimmt, wie eine ganze Reihe von Gedichten über die Großeltern (S. 44, 88, 95, 101) oder Eltern belegen (S. 273, 321).
Sicherlich ist es nicht mehr der bleierne Himmel der Siebziger, der sich über den Köpfen derer wölbt, die in Lyrik von Jetzt von Küsten, Schwalben und zweistimmigen Möwen schreiben. So wie die deutschsprachige Lyrikproduktion sich selbst mittlerweile zwar unabhängig von abstrakt-intelligiblen Größen wie Staat (Stasi, Terroristenerlaß) und Gesellschaft (intellektuell-moralische Verantwortung) wähnt, aber eben nicht mehr ohne Web-Werbung, Buchdesign und Eventplanung auskommt, so ist auch die Frage nach der Macht der Währung, das heißt nach Geld und Haltbarkeit, ins einzelne Gedicht eingewandert (S. 53, 96). Wie der Sommer, so entstehen „unterm Regiment / des neues Gelds“ (S. 53) überhitzte Kreisläufe, die für Marcus Hammerschmitt die irritierende Frage nach letzten Gewißheiten aufwerfen:
wo ist der Schmerz die Wahrheit
(S. 53)?
Auch ehemals empfindsame lyrische Ichs beobachten ja nun an sich selbst die Konjunkturverläufe, und sie tun das, indem sie
1.) das Ich als Objekt setzen und zugleich verwerfen, denn es ist zur „losen Wurst“ degradiert (S. 351);
2.) das Zerfallen der eigenen Verse beim Genuß von Champagner und Kuchen beklagen (S. 158); oder
3.) in geradezu betriebswirtschaftlichem Kalkül auf die Geltung von Geld verweisen, auch oder gerade für die Erzeugung von Affektwerten:
was kaufe ich? Heute ist Wärme teuer (S. 96).10
Immaterielle Ressourcen wie Luft, Wasser, Wärme gewinnen für dieses Ich an symbolischem Wert, doch bleiben sie doch unablösbar in die Kapitalkreisläufe eingespannt.
Das Phantombild von einer im Sinne Foucaults diffus gewordenden Macht erlaubt es nicht, sich Widerstand anders auszumalen denn als inszenierten Protest gegen eine anonyme Rede ohne Adresse. Das konsumfreudige Alltagsleben durchdringt alles, denn „alles (ist) verseucht mit Genuß“ (S. 54), es herrscht, z.B für Franzobel, eine „Gaunersprache“, die alles „trocken“ redet (S. 124 ), oder ein routinierter Berichtston, der in den Tagesnachrichten die Sprache auf eine monotone, doch „genaue beschreibung der sachschäden“ reduziert, so Daniel Falb in seiner kecken Katastrophen-miniatur über „umgeworfene BMWs“ (S. 77). Design, technische Mobilisierung und allseitige Vermittlung durch Nachrichtenagenturen, so der Grundtenor dieser lyrisch formulierten Gegenwartsbestimmungen, schaffen eine Gleichheit zwischen Objekt und Repräsentation, so daß selbst „Menschenrechtsverletzungen“ in der virtuellen Welt der Medien als Stoff einer anderen Zeit erscheinen (S. 157). Auffällig ist bei den wenigen Gedichten, die aufflackernde Aggressivität zum Thema machen, die kunstvoll betonte Performativität des gewaltsamen Aktes. Bei Daniel Falb wird Straßenvandalismus mit detektivischem Spürsinn in sich metallisch reibenden Modellbau-Sätzen nachgestellt. Aber diese nur vorgestellte Handgreiflichkeit wird auch andernorts wie in einer Art Gangster-Rap in Situationen inszeniert, die überdeutlich Zitatcharakter haben, sei es durch einen märchenhaften Unterton (S. 281, 291) oder die betonte Nachstellung einer provokanten Brinkmann-Haltung (S. 336).11
Es bedürfte einer genaueren Herausarbeitung der Bezüge zu Vorbildern, um personale und textinterne Performativität als wichtiges Charakteristikum der Gegenwarts-Lyrik seit den neunziger Jahren zu zeigen. Schon an den auffälligsten Anleihen oder Fortführungen ist jedoch abzulesen, daß die Auseinandersetzung mit den Kölner und Ost-Berliner Schulen der Schreibdeformation eine beherrschende Rolle spielt, selbst wenn die ausgefeilteste ostdeutsche Wortbruch-Ästhetik (z.B. von Bert Papenfuß) nach den Kulturdebatten der frühen neunziger Jahre nur noch subkutan wirken konnte. Die Geltungsreichweite der Alltagsästhetik der siebziger Jahre ist, statistisch nachweisbar, dadurch eingeschränkt worden, daß Aufpropfverfahren und Schnittechniken popularisiert und tradiert wurden.12 Insbesondere die Klingsche cut-up- und Modul-Technik affizierte die Schreibweise von Nico Bleutge, Annette Brüggemann, Sabine Scho, Anja Utler und ist über Lyrik von Jetzt hinaus auch an einer Reihe schon etablierter Autoren (Marcel Beyer, Ulrike Draesner, Dieter M. Gräf) nachzuweisen. Um so auffälliger sind daher Stimmen, die auf eine anders gelagerte Poetik hindeuten. Epigrammartig zugeschnürte 8–9 Zeiler wie die von Thilo Schmid oder Uljana Wolf deuten auf größte Konzentrationsbereitschaft für Minimaleindrücke, jenseits der mittlerweile popularisierten Okulationstechniken. Kennzeichnend hierfür auch die sanft fordernde Bestimmtheit in Daniela Seels Gedichten: Zuversichtlich bewegen sich ihre Verse auf die Einsicht zu, daß ein Blickwechsel von der starren „ordnung der apparatewelt“ (S. 150) auf das Körperliche, ein Sprung vom Ufer in die Strömung ratsam sei:
wer jetzt, im rücken des horizonts,
auf die losung vertraut,
soll gerettet sein
(S. 153).
Humanistisch untermalt klingt diese Bestrebung, ein Grundvertrauen in die Strömung der Zeit herzustellen, bei Ron Winkler, der, gleichsam zwischen Volker Braun und Grünbein vermittelnd, durch retrospektive Inspektion einen „Restposten Mensch“ (S. 305) in der virtuellen Welt auszumachen versucht. Losungen, Anweisungen, Rezepturen oder auch einzelne Schlüsselwörter zeigen an, wie aktuelle poetische Verfahren wieder stärker auf ein gruppenbezogenes oder dialogisches Verständlichmachen hinarbeiten, ohne sich den Zwängen der Epochenübersicht und der Inventurmaßnahmen im Sinne von „das bleibt“ (Jörg Drews) ausgesetzt zu fühlen.
Einer wertenden Kritik bleibt die Aufgabe, die Bildkräftigkeit der Texte vergleichend zu überprüfen. Uwe Tellkamps prunkvoll-barocke Erzählgedichte über submarine Welten, die offenkundig an die früheren Untergrundexpeditionen Grünbeins anschließen, oder Katrin Askans pittoreske Entführungen in die Gefilde des Märchens flankieren als grelle Extrempositionen den generellen Ansatz, die poetisch versachlichte Diktion wieder an eine halluzinatorische Kraft der Bildprägung zu binden. Seit dem deutschen Postmodernedebakel, das sich heute wie eine verfehlte Konsensbildung über die Reästhetisierung der poetischen Idiome ausnimmt, ging aber die Formenerkundung in der Lyrik einher mit einer Versachlichung, die zunächst aus der naturwissenschaftlichen Nomenklatur ihre Sprachmuster bezog, dann aber erst in den späten Neunzigern vermehrt auch aus der antiken Dichtung ihre Lektürreize bezog.13 Anders als die ambitiösen Versuche längst etablierter Autoren, der zeitgenössischen Lyrik eine epistemologische, dezidiert antisentimentale Basis zu verschaffen und sie an Theoriediskurse anzuschließen oder sie in reflexionsgesättigte Poetiken einzubetten – bei den schon genannten Autoren Durs Grünbein und Raoul Schrott ebenso wie bei Gerhard Falkner, Thomas Kling, Brigitte Oleschinski oder Peter Waterhouse –, signalisiert die „Neue Schlichtheit“ der jüngsten Dichtung in ihrer Abkehr vom enzyklopädistischen Expansionsbestreben ein deutlich erkennbares Bedürfnis nach hypnotisch-einprägsamer Wirkung des Gedichts. Damit einher geht das Aufspüren von Grundbeständen der Gedichtsprache, die noch einen quasi-metaphysischen Nachhalleffekt haben. Dieser Ansatz spricht aus bizarren Parolen, die die Möglichkeit einer phantasievollen Selbsttranszendierung erwägen:
Stell dir vor: Dein Ohr ist nicht da!
(S. 50).
Es gilt, sich wieder der Veränderlichkeit von Regen, Gewitter oder Licht auszusetzen:
lass uns Wetterlagen erfinden
(S. 202).
Das gestische Sprechen, ein Denken im Konjunktiv und ein vorsichtiges Erwägen, das allseits Künstlich-Komplexe wieder am Einfachsten zu messen, ist denjenigen Autoren eigen, die sich wie etwa Daniela Seel, Monika Rinck, Steffen Popp deutlich erkennbar von den großen, enzyklopädisch aufgerüsteten Lyrikformen der späten neunziger Jahre abkehren. Die Versuche, einen moderaten Neuansatz zu finden, schöpfen aus dem Arsenal der poetischen Grundvokabeln. Das Meer, der Schnee, die Farbe Blau sind immer wieder aufblitzende Motivadern, die sich durch die Anthologie ziehen. Sie als Transzendenzmetaphern zu lesen, wäre irrig. Sie führen gerade nicht aus dem Diesseits einer menschlich erzeugten Kunstwelt heraus. Für Marcel Beyer zum Beispiel verspricht das Studium der „Logbücher“ sehr viel mehr als die Hoffnung auf ein Naturblau; im Ambiente von „Farbhalle“ und „Maschinensaal“ erfährt man ohnehin nur einen schwachen Abglanz in einem „Marinehimmel“ an der Decke (S. 310). Auch andernorts wird das Himmelsazur als Entgrenzungsbild ironisch destruiert. Wie bei Beyer handelt z.B. ein Text zum Thema „Sonntag“ davon, wie sich dem Auge die nicht so feinen Unterschiede zwischen dem Weltgewölbe und einer Zimmerdecke in „fernsehbildblau“ auflösen (S. 243). Ob ein „Engelrevier“ nicht eher synthetischen als himmlischen Ursprungs ist, wird Annette Brüggemann, die sich auf den Spuren Thomas Klings der Stadt Wien nähert, zur Gretchenfrage, die schließlich mit dem Hinweis auf bekannte illustrierte Zeitschriften als „Blaue […] Versatzstücke“ (S. 251) quittiert wird. In den Blau-Zonen der Stadt tritt die Farbe überhaupt nicht mehr als rätselhaftes „Sphinxblau“ (Gottfried Benn) in Erscheinung, sondern ist, ihrer metaphysischen Aura und mediterranen Umgebung vollends beraubt, bloß noch Pigment, Placke, Plastik (S. 138, 225, 236, 310, 336). Ein synthetisch herstellbarer „Rausch aus Blau“ (S. 196). Kunst-Stoff des Gedichts eben. Auch der Wutausbruch angesichts eines Passantenstroms und damit die Möglichkeit, frei nach Brinkmann, in ein befreiendes, unalltägliches „anderes Blau“ zu treten, wird letztlich negiert und bleibt in Ingo Jacobs’ kleinem „Film in Worten“ eine Szene der Imagination, d.h. der Abmischbarkeit von Zitaten aus den authentizitätsversessenen siebziger Jahren (S. 336).
Selbst das assoziationsgesättigte Bild von der See kristallisiert in ungewöhlich verdrehten Formen aus. Die Existenzbedingungen in der DDR, ein anderes Böhmen am Meer, werden von Ron Winkler mit Witz im Bild von Soldaten der Nationalen Volksarmee wachgerufen, die als „Matrosen, im eigenen Land auf schwankendem Boden“ (S. 303) auftreten. In der nautischen Metaphorik der „Neuen Leute“ – so der werbende Name für eine Gruppenlesung, die dazu diente, einzelne Autoren in Berlin vorzustellen (Falkner, S. 12) – ist das poetische Subjekt unentwegt mit „gestrandeten dörfern“ (S. 115), „planken“ (S. 295), „Häfen ohne Schiff“ (S. 353), den Fliegen als „müden matrosen“ (S. 37) konfrontiert. Das barock-romantische Motiv erscheint gebrochen in komisch-bizarren Bildern von einer „unendlichen Fahrt“ (M. Frank), die allerdings nie begonnen hat. Es ist in ihrer Gebrochenheit eine originär moderne, körperbezogene Auffassung, die Franz Kafka am eindrücklichsten in die paradoxe Wendung von der „Seekrankheit zu Lande“ faßte; sie läßt sich zwar umstandslos in das Sprachregister der jüngeren Autoren eintragen, erscheint aber befreit von der existentiellen Gravitas, die Kafkas Prosa durchdringt.
5. Sehnsucht nach Unmittelbarkeit: Zur Konstruktion des kalten Auges in Wahrnehmungsnotaten und im Liebesgedicht
Eine der mittlerweile geläufigsten Vorstellungen von der primären Aufgabe der lyrischen Textur ist die seit der epistemologischen Ausrichtung der achtziger Jahre vorherrschende Idee vom Gedicht als Wahrnehmungsinstrument, das als solches dem Erbe der romantischen Gemütserregung und Sentimentalität zu entgehen scheint. „Und was wäre das Gedicht anderes als eindrückliche wie, verständlicherweise, hochsublimierte Wahrnehmung?“ (Kling, S. 131). Wozu aber soll die Textur dienen, wenn sie als Werkzeug und vermeintlich präzise Apparatur der Beobachtung ausgewiesen ist? Im wesentlichen sind derartige Wahrnehmungsgedichte an Fernsehbildern und Landschaften ausgerichtet, oft aus dem Fenster eines Fahrzeugs ins Visier genommen. In lyrischen Notaten Nico Bleutges, Marcel Beyers oder Crauss’ sind es eine „handvoll gelber jacken“ (S. 258), „grelle Rapsfelder“ (S. 313) oder „ein Mohnfeld“ (S. 215), die temporäre Rauschzustände auslösen, dem Tanz nahe, also jenseits der sinnstiftenden Rede. Lustvoll wird gerade in den einer Apperzeptionsästhetik verpflichteten Texten immer wieder ein Kameraauge an Sehfelder herangeführt, in denen nur noch minimale Bewegungen oder Signalfarben zu verzeichnen sind. Es handelt sich im Sinne Jonathan Crarys um eine „purified subjective vision“ (S. 95). Das Sehfeld scheint für das Sehen allererst hergerichtet. Die semiotisierte Umwelt der Großstadt, die besonders an bunten Werbeplakaten (S. 118), den Nachtbetrieb (S. 51, 171) oder Ampeln (S. 278, 280) exemplarisch hervortritt, korrespondiert mit einem rein mechanisch reagierenden Auge, das auch andere Bereiche nur nach ihrem Signalwert bemißt. Auch Bewegungen sind in den starren Blickfeldern vornehmlich Bildstörungen: was überhaupt noch als Bewegtes wahrgenommen wird, ruft Verstörung hervor, sei es „die hellgrüne unterseite der blätter im augenblick / der erschreckten aufmerksamkeit“ (S. 329) oder unscheinbare Vögel, die ein Weiterverfolgen über den Bildrand hinaus stimulieren (S. 21, 299). Die extremste Position in Lyrik von Jetzt ist die abrupte Klärung des Feldes, um wieder die hypnagogisch hergestellte nature morte zu etablieren, etwa durch den Blick auf eine „rehbraune Schießscheibe“ (S. 314) am Waldesrand. Ein Vogel erscheint wie eine Bildstörung innerhalb eines winterlichkalten Stillebens, worin der Betrachter ihn als Wärmequelle identifizieren kann (S. 299). Dem Kunsthistoriker Jonathan Crary zufolge trugen in der Evolution von modernen Wahrnehmungsgewohnheiten nicht nur die Naturwissenschaften, insbesondere die Helmholtz-Schule, zu der Konstruktion eines Beobachters als „neutral conduit“ bei.14 Vielmehr floß das Ideal eines kalten Auges, wie man es in diesem Zusammenhang bezeichnen müßte, auch in das Selbstverständnis der modernen Kunstproduktion im späten 19. Jahrhundert ein, nämlich als gesuchte Befreiung von „the weight of historical codes“, insbesondere „language, historical memory, and sexuality“ (S. 96), um damit die „reine Wahrnehmung“ (S. 136), d.h. die Illusion einer Trennbarkeit von Wahrnehmung und Signifikation (S. 96) zu sichern. Martin Jay präzisiert die Bestimmung des Blicks aus historiographischer Perspektive, indem er die Illusion eines unschuldigen Auges, wie sie im Jahrhundert der Aufklärung auf das Kind projiziert wurde, am Maßstab ihrer diskursiven Erzeugung mißt, denn die reine Wahrnehmung ist „an epistemic field, constructed as much linguistically as visually“ (S. 393).15 Es gehört zu den Grundeinsichten einer philosophischen Kritik am okularzentrischen Weltzugang schon seit den sechziger Jahren (S. 327, 377), daß Äquivalenzen als naturhaft gegebene vorausgesetzt und qua analogisches Denken verabsolutiert werden (S. 33, 508), wie an Aristoteles’ Metapherndefinition der Skopophilie der Aufklärung bis hin zu Merleau Ponty in einer Vielzahl diskurstheoretischer Studien nachgewiesen wurde.
In der in Lyrik von Jetzt anvisierten fragilen Welt, die von bloßen Anzeichen, Vorboten bestimmt ist – sei es den Schwalben, Möwen, oder den Neuschnee – vollzieht sich eine momentane Stillegung der urbanen Bewegungsabläufe. Aber, das gilt es hier herauszustellen, es geht es nicht mehr darum, die kulturelle Physiognomie der Stadt zu umreißen. Vielmehr sollen in der Fremdheit einer verlangsamten Stadt die Situationen höchster Flüchtigkeit haltbar gemacht werden. Wie schon in den poetischen Texturen der Prenzlauer Berg-Dichter überwiegt die Stimmung des Abwartens (S. 73). Und im Gegensatz zur Alltagsästhetik, an deren Bildersuche die aktuellen Gedichte von ,Jetzt‘ nur im Zitat anklingen steht nicht die Situationskizze im Vordergrund, sondern die authentizitätskritische Metaphorisierung eines inneren Bildes. Wichtig ist demgemäß für Lyriker wie Thilo Schmid oder Renatus Deckert der Ansatz, historisch ins Abseits geratene Landschaften in Erinnerung zu rufen (S. 145, 211). Zu dieser Ästhetik der überpersönlichen Anamnese gehört es, kurzzeitige Glückserlebnisse aufzuspüren, um eine Basis für Haltbarkeit zu schaffen. Elegisch wird das alltägliche, saisonale, epochale Verstreichen der Zeit evoziert (S. 15, 164), wofür ein Doppelbefund gilt: einerseits heißt es „Alles strahlt für den Moment“ (S. 93), andererseits gilt „das leuchten der letzten dinge trat ein“ (S. 153). Im Klartext heißt das: die Hoffnung auf Endzeit resultiert aus der Beschleunigung der Zeit, doch die Schaffung von Jetztzeit gelingt nur durch die Besinnung auf den Wandel des Lichts.
Die durchaus konkreten Ursachen für dieses akute Bewußtsein von Vergänglichkeit sind insbesondere in Gedichten erschließbar, die indirekt auf die Katerstimmung nach dem Metropolenfieber der neunziger verweisen. Die „Feuerwerke sind verstummt“ (S. 184). Die mentalen Gründe dürften im erhöhten Metaphysikbedarf liegen, der sich als Gegenstück zu der mit gründerzeitlichem Pathos institutionalisierten Medien-, System- und Technikphilosophien ausweist. Als Überbrückung dient das Körpergedicht, das visuelle oder haptische Begegnungen als dramatische Entflammung inszeniert. Von den Passanten und Flaneuren der postmodernen Großstadtinszenierung wendet sich der Blick nämlich den einsamen Beobachtern und den Paaren zu. Selten sind die Lösungen allerdings so einfach wie in der Schlagerzeile „ich lieb dich“ (S. 348). Mit Nico Bleutges Wendung „die haut fängt feuer“ (S. 259) ist eine der ergiebigsten und häufig eingesetzten Grundsituationen des Liebesgedichts in dieser Gedichtsammlung gekennzeichnet. Ebenso setzt Tom Schulz die Faszination am pyromanischen Motiv in die Parole von „Verbrennung und Stillstand“ (S. 350) um. In einer erstaunlich homogenen Bildsprache wird das Kennenlernen und Zusammenkommen der Körper in der Anthologie grundsätzlich mit einer kurzlebigen Zündung zwischen den Geschlechtern in Verbindung gebracht (S. 31), womit zum einen das Bedürfnis nach haltbarer Flüchtigkeit wie überhaupt eine extrem sensitive Zeitempfindlichkeit jüngerer Autoren zum Ausdruck kommt. Was für das einsam reflektierende Subjekt die Hoffnung auf ein morgendliches „sekundenglück“ (S. 271) oder die im Mundraum sich vollziehende „implosion des kleinen glücks“ (S. 344) ist, findet seine Entsprechung unter Liebenden, die den „Glücksknoten“ des Herzens beschwören, weil wenigstens das unentwirrbare Knäuel der Gefühle in ungewissen Zeiten Bestand verspricht, „und das ist alles, woran ich festhalte“ (S. 316). Helwig Brunners „Schlaf im Feuerbett“ artikuliert den in dieser Anthologie vielfach anzutreffenden Gefühlsbrand in einprägsamer Form:
verlass
den Körper durch sein Porenkleid
[…]
Morgens
wars dann der Tau, der uns löschte
(S. 300).
Wenn sich dieser Brand auch durchweg als dramatisiertes Ereignis darstellt, so sind einzelne Gedichte nicht frei von unfreiwilliger Komik, etwa wenn davon die Rede ist, daß „zwei Körper die lautstark / sacken“ wie „Chinakracher“ explodieren; für existenzgefährdete Liebende „brennen die Jahre ab“ wie „zersprühende Wunderkerzen“ (S. 31). Sein Schreckbild findet die Vorstellung von rauschhaft gesteigerter Intensität des Lebens in der poetischen Nachstellung des fürchterlichen „brandopfers“ von Jimi Hendrix (S. 269). Angesichts eines gesteigerten Vanitas-Bewußtseins, das unter Lyrikern wie Daniela Seel oder Tom Schulz gleichermaßen einprägsam, aber höchst unterschiedlich motiviert von Langeweile (S. 351) und bis zur Suche nach einem „Leuchten“ reicht (S. 152), wird die Begegnung mit dem andern Geschlecht zu einer Erfahrung, an der sich die Geister und das Fleisch scheiden.
Natürlich existiert ein buntes Spektrum von Positionen zum Verhältnis von Körper und Zeit. Da gibt es die melancholisch verschattete Version: „während wir am überhitzten kühler lehnen / und rauchen dreht sich der tag in richtung des regens“ (S. 24); die lustvoll aufgedrehte Version, nämlich eine „barocke lust überzuschwappen“ (S. 32) oder die zynisch abgeklärte Version, „Sex heilt alle Wunden / oder warum pflastern wir / die Tage damit zu“ (S. 42). Dieses obsessive Herauskehren des Aufflackerns von Begegnungen, das unablässige Fixieren von überhitzten Körpern, deutet wiederum auf das Auseinanderklaffen von beschleunigter Weltzeit und retardierter Lebenszeit. Mit großer Sensibilität für den durch Speichermedien bestimmten Alltagssprachgebrauch greifen insbesondere die Debüt-Autoren des Bandes gerade diejenigen kurrenten Redefiguren auf, die am deutlichsten auf die Entritualisierung von Partnersuche und Trennung in nachindustriellen Gesellschaften verweisen. Man kann das alltagssprachlich als ,Anmache‘ beschreiben. Doch jeder sogenannte Alltag hat seinen diskursiven Hintergrund.
Die das Entflammen evozierenden Gedichte zelebrieren nämlich keineswegs das punktuelle Zünden von Ich und Welt, sondern beschwören oder inszenieren doppeldeutig das riskante Reiben und Entflammen: sind es nur Streichhölzer, die nach dem Angebot einer Zigarette aufflammen? Oder sind es doch Körper, die sich in der flüchtigen Begegnung wechselseitig anstecken und löschen, ohne je wie Pech und Schwefel zusammenzufinden? Was unablässig gebrannt und gelöscht wird, sind indessen nicht nur Leiber. Zum Hintergrund der Begegnungen gehört eine immer poröser werdende Erinnerung an das begehrte Gegenüber. Namen, Adressen oder Songs brennen sich ein oder werden gelöscht nach Strategien, die einst Sigmund Freud stilistisch brilliant in seiner Psychopathologie des Alltags benannte. Aktueller noch: Was erinnernswert ist und sein soll, wird Geräten anvertraut, die es ebenso schnell speichern oder tilgen. In der Verschränkung von archaischen und aktuellen Konnotationen, im Sprung von Heraklit zur CD fließen ,Brennen‘ und ,Löschen‘ zusammen; somit entpuppt sich das zeitgenössische ,Liebesgedicht‘ als Demonstration des Vergehens der Sinne, das seinen genuin technischen Hintergrund in der Frage nach der Haltbarkeit des Flüchtigen hat. Also auch hier die Frage nach den Grundstoffen der Welt und des Gedichts: Feuer oder Wasser, Erinnern oder Vergessen, Bewahren oder Tilgen? Unablässig umspielen Gedichte von Brunner, Bleutge, Poschmann u.a. die Phantasie von freier Triebentfaltung und Raub des freien Willens, beide spiegeln sich auf der sprachlichen Ebene ein Akt der Piraterie ist, denn die Tete nehmen Reizvokabeln als Beutestück der Mediensprache in Besitz. Die Sprache der technischen Medien vermittelt archaische Metaphysik mit der immer wieder modernen Mode. Hinter der magischen Formel des Brands, die unter den Lyrikern zirkuliert, verbirgt sich das zentrale Phantasma einer körperlichen Unmittelbarkeit, die unerreichbar bleibt. Durch die lustvoll besetzte Vision einer dialogfreien, grenzauflösenden Verschmelzung16 lokalisiert sich das sprechende Subjekt außerhalb einer Warenwelt. Diese aber hat in ihrer Durchdringung von Sexus und Marketing das Begehren selbst dem doppeldeutigen Gebot der (Un)Verfügbarkeit alles Käuflichen unterstellt.17 Der tückische Begriff Werbung beleuchtet eben beides: das Umwerben und das Erwerben des Begehrten. Deshalb erscheint der „poetische Augenblick“ im Sinne Lacans getrennt in das reine Auge und den sozial formierenden, kollektiven Blick:
When in love, I solicit a look, what is profoundly unsatisfying and always missing is that – You never look at me from the place from which I see you. Conversely, what I look at is never what I wish to see (zit. n. Jay, S. 366; 353–78).
Die beschworene Unmittelbarkeit in der Zentralmetapher des entzündenden Sexus spiegelt das konstitutive Phantasma einer lustvoll erfahrbaren Entlastung von Konventionen. Das eben macht die erotische Lyrik so konventionell: sie muß noch den Tabubruch als Idee beschwören und indem sie das nackte Dasein anruft, wirft sie, dem Troubadourgesang gleich, eine Toga über die Haut, um mit Kaja Silverman zu sprechen (S. 78). Befreit vom Dialog gerinnen Physiognomien gerade deshalb in den „Wahrnehmungsgedichten“ so häufig zu undurchdringlichen Masken: ein Gesicht im „aggregatzustand“ (S. 283), ein Lächeln wie ein „fels aus granit“ (S. 89), „Mienen versteinert“ (S. 72), ein „Mann mit Sperberaugen“ (S. 99). Eines der heroischen Leitbilder der neunziger Jahre war und ist noch heute das kalte Auge des Entdeckers, der sich der „Peilung“, der „lage / bestimmung“ (S. 256, 260) verschreibt.
Der vielfach umspielte Topos einer vermeintlich neutralen Musterung der Außenwelt zieht in dieses Wahrnehmungsideal als „invisible vision“ ein, die „epistemological mastery“ verspricht:
The spectator constituted through such an alignment seemingly looks from a vantage point outside spectacle (Silverman, S. 126).
Anders gesagt, je mehr poetologische Absicherungsstrategien auf das Gedicht als vermeintlich präzises Wahrnehmungsinstrument zielen, desto mehr konstituiert sich in ihnen eine lustvolle Entlastung vom sozial formierenden Blick. Den Gedichten selbst muß dieser konstitutive Erleichterungswunsch zur Rätselfigur werden, um die unendliche Verkettung von Alltagssätzen und Metaphern in Gang zu halten. Beide Phantasmen der Unmittelbarkeit, die unablässig umworbene neutrale Wahrnehmung und das ekstatische Aufeinandertreffen der Körper, speisen die Besichtigung der Umwelt und die kleinen Epiphanien des Alltags. Es ist eine Kunstwelt im doppelten Wortsinn, die in Lyrik von Jetzt anvisiert wird, eine Welt der synthetisierbaren Stoffe und eine Welt, die durch die hohe Kunst der Rede, das heißt durch Manipulation von Themen und Formen, aber auch Performativität, veränderbar scheint.
6. Fazit: Konturen der Neuen Schlichheit in der Gegenswartslyrik
Die Stoßrichtung der vorliegenden Recherche zielte in erster Linie auf die Erstellung von Beschreibungskategorien, mit deren Hilfe ein Geflecht von Motiven zu bestimmen war, das in seiner Gesamtheit auf bestimmte subkutane Denkfiguren und Phantasmen verweist. Durch die Auswertung des reichen Materialfundus von Lyrik von Jetzt ließ sich der Befund erhärten, daß in aktuellen Gedichten ein Außenbereich angesteuert wird, der die alte Dichotomie von Naturpoesie und Großstadttextur aufsprengt. Denn Gegenwartslyrik sieht sich nicht vor die Aufgabe einer wesenhaften Ergründung der Landschaftsaspekte gestellt; vielmehr gilt ihre Suchbewegung der Berührung mit einer Außenwelt, die sich in liminalen Räumen (Küste, Ufer, Garten, Park) darstellt. Hier findet das poetische Subjekt einen der urbanen Akzeleration entzogenen Ort, wo sich Gegensätze durchdringen und dem Wachstum Grenzen gesetzt sind. Erst an den Rändern und Einbrüchen von Landschaften stechen elementare Kontraste ins Auge, was auch auf sprachlicher Ebene der generellen Tendenz zur Sicherung von Grundbeständen und zur Vergewisserung von Grenzen entspricht. Die Umwelt tritt in den Ruhezonen der Stadt oder den Randstreifen von Sehfeldern als ein Sinnbezirk hervor, der den Beobachterfiguren der Gedichte vornehmlich durch Signalsprachen und minimale Bewegungsspuren zugänglich ist, wobei das Auge als neutrales, unmittelbar wahrnehmendes Aufnahmeorgan imaginiert wird. Dieses Phantasma des neutralen Auges findet schließlich sein Pendant in der Innenweltdarstellung des Liebesgedichts, wo sich in der dialoglos inszenierten Entfesselung von Begierde die lustvoll erfahrene Vorstellung von Unmittelbarkeit wiederholt. Die drastische Bildlichkeit, die an der Ambiguität eines plötzlich „zündenden“ Blickerlebens illustriert wurde, überhöht die sprachlos verlaufende Begegnung und macht sie als lustvoll imaginierte Entlastung von Konventionen kenntlich. Auch im Liebesgedicht, das die Zusammenkunft von Körpern inszeniert, vollzieht sich die Beobachtung des Anderen durch ein Registrieren der Signalsprache, die urbane Existenzen an die Warn- und Lockzeichen in der ,Natur‘ zu erinnern vermag.
Drei produktive Ansatzpunkte für eine weiterführende Diskussion und den kritischen Vergleich gilt es hervorzuheben. Die Neue Schlichtheit bedient sich erstens einer „ultrarealistischen“ Bildlichkeit:18 Sie wendet sich nämlich von der Worttrophäe zur Satzmetapher und erodiert dadurch den verbreiteten enzyklopädistischen Ansatz, der mit der epistemologischen Wende der achtziger Jahre einherging.19 Zweitens geht mit der Bildsuche ein eigensinniges Umwerben eines Neuanfangs einher; das politische Versprechen einer Neuen Mitte wird dabei demaskiert und durch eine Orientierung an Peripherien auf die Sicherung von unveräußerbaren Grundbeständen verwiesen. Ob es sich um das Bedürfnis nach Tradierung, um lustvollen Trotz oder um die inszenierte Rebellion handelt, entscheidend ist ein gestisches Sprechen, das ernsthaft-spielerisch (z.B. bei Seel, Rinck) auf „Losungen“ und „Drehungen“ hinarbeitet, den Erinnerungsrätseln ein solides Formbett verschafft (Wagner), „Handlungsanweisungen“ demontiert (Falb). Drittens schafft die Poetik der Schlichtheit eine affektorientierte Atmosphäre, die sich vom eher unterkühlten Mikroklima der seit den Mittachtzigern heranreifenden, dezidiert anti-sentimentalen Lyrikidiome abhebt. Als Grundtendenz ist die Suche nach Einprägsamkeit durch Beschränkung auf ein metaphysik-freundliches Basisvokabular zu erkennen: eine neue Schlichtheit des Gedichts.
Erk Grimm, in Karen Leeder (Hrsg.): Schaltstelle. Neue deutsche Lyrik im Dialog, Editions Rodopi, 2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Peter Geist: „halber Aufenthalt / wie auf fotokopiertem Schnee“
lyrikkritik.de
Michael Braun: Ich habe Poesie gekauft. Eine Wiederbegegnung mit der Lyrik von Jetzt. Anmerkungen zum Stand der allerjüngsten Gegenwartslyrik
der Freitag, 10.3.2006
Daniel Sich: Lyrik von Jetzt
Deutsche Bücher, Heft 4, 2003
Thomas Wild: Jan Wagner, Lyrik von Jetzt
Arbitrium, Heft 1, 2004
Fakten und Vermutungen zu Björn Kuhligk + Instagram 1 & 2 + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Galerie Foto Gezett + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Björn Kuhligk liest sein Gedicht „Die Liebe in den Zeiten der EU“.
Fakten und Vermutungen zu Jan Wagner + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.


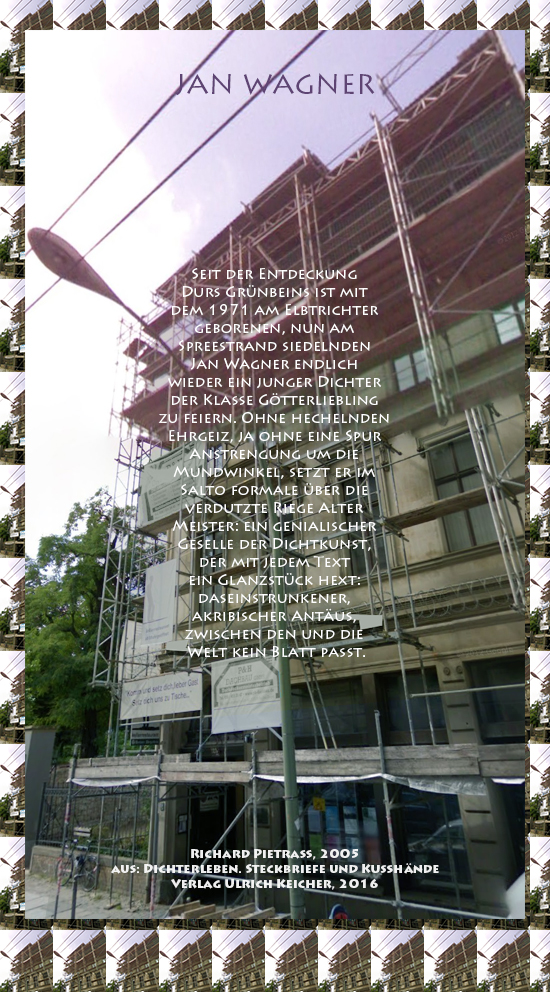












Schreibe einen Kommentar