Christian Lehnert: Auf Moränen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLeuna, 25.9.88
Das Gesetz hieß Warten, Tage
zu warten, das Brot aus den Büchsen
zu kauen, lange und faul und ohne zu schlucken,
und auszuspucken
das Brot und die Tageszahl, und mit den Augen
den Betonplatten am Himmel zu folgen,
Arbeiter unter roten Kabeln durchschreiten
chemische Prozesse, in denen sie anfangen zu leuchten
wie Algen im Meer, sie nehmen Wunden an,
Störungen im Erbmaterial, ein Finger fehlt,
ein Unterarm, ein Stahlseil schießt durch die Luft und reißt
einen Nasenflügel ab, die Stockung
ist kaum zu spüren unter dem Kran,
zwei Notärzte tragen den Bewußtlosen fort,
die Platten liegen wie Blätter im Gelände.
Inhalt
„Wie ein Buchstabe, / aufgerissenes Auge, nicht von dem Buch wissen kann, / das ihn enthält, / kann ich nicht lesen, wo ich bin.“
Sie stellen sich den Fragen nach der eigenen Existenz: der Bausoldat, der sich in der monotonen Plackerei auf Rügen zwischen „Gleichschritt“ und „Normzeit“ abhanden zu kommen droht; der Anpassungsvirtuose Erich Mielke, für den das Wort Ich ein „bloßes Stochern im Dunkel“ ist; oder Apostel Paulus, der auf das Kommende vertraut und das Hier und Jetzt als Zwischenzustand begreift.
Auf Moränen erklingen diese Stimmen, unter ihnen ein Berg von Erlebnissen und Geschichte, Gedankengeröll, das sich übereinanderschiebt. Christian Lehnert spürt in seinen Gedichtzyklen tastend, drängend den Identitätsfragen nach, wie sie vom Urchristentum bis in die Gegenwart reflektiert werden, und entfaltet „ein Wortgewebe voll dunklem Glanz“ (Gerhard Kaiser).
Seelsorge für Mielke?
− Christian Lehnert arbeitet sich mit neuen Gedichten an Minister und Apostel ab. −
Man stelle sich vor, 18 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches hätte, sagen wir, der studierte Theologe und Lyriker Stefan Andres (1906-1970) einen Gedichtzyklus über Heinrich Himmler, Chef der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), geschrieben. Unvorstellbar. Wie sich die Zeiten geändert haben! Heute, 18 Jahre nach dem Ende der DDR, verwundert es keinen mehr, wenn der studierte Theologe und Lyriker Christian Lehnert, 1969 in Dresden geboren, einen 23teiligen Zyklus über Erich Mielke, Chef der Staatssicherheit (Stasi), schreibt.
Lehnerts neues Buch beginnt mit einer persönlichen Reminiszenz an den Dienst ohne Waffe als Bausoldat 1987/88. Über die Stationen Prora, Leuna und Straußberg verweisen unter tagebuchähnlicher Datierung pathetisch überhöhte Metaphern auf Schikanen und verlorene Lebensmonate: „Vereinfache dein Leben zu einem Symbol… Der Spaten.“ Es folgt Mielke. Die Strophen spielen mit der Hypothese einer Bewusstseinsspaltung. „Das ist nicht Mielke“, erinnert zwangsläufig an Rimbauds „Ich ist ein Anderer.“ Sonst eher sparsam im Umgang mit Fußnoten, fügt Lehnert diesem Teil des Buches auffallend viele Erläuterungen an. Ist es Rechtfertigung oder Absicherung, wenn darauf verwiesen wird, daß zahlreiche Zitate aus Reden Mielkes stammen. Wer aber will das Gestammel eines debilen Psychopaten, das zumeist aus diversen Publikationen bekannt ist, noch einmal in Strophenform lesen? Sind es seelsorgerischen Gründe, die den Müglitztalpfarrer Lehnert dazu verleiten, dem ebenso gefürchteten wie verlachten Ex-DDR-Minister ein poetisches Denkmal zu setzen?
Das ist die Wahrheit, Genossen.
Es folgen 24 Vigilien. Die Vigil – Gottesdienst am Vortag hoher katholischer Feste. Anders als bei Mielke wird hier nichts erklärt, aber ebenso viel zitiert, nicht aus Stasiprotokollen, sondern aus den Paulusbriefen, denn um den Pharisäer und Apostel sowie um die Frage „was bedeutet Glaube?“ kreisen diese Verse.
Heute habe ich laut deinen Namen gesagt:
Paulus,
und damit war es plötzlich genug.
Wie wahr! Das Schlusskapitel schließlich bringt 11 Gedichte, die zeigen, daß Christian Lehnert als Vater, Partner, Freund und Kollege durchaus von dieser Welt sein kann. Problematisch ist auch die typographische Gestaltung des Buches. Der Leser muß rätseln, wer jeweils spricht. Weder Kursivschrift noch Anführungszeichen klären eindeutig, was Zitat ist, was Gespräch oder Hervorhebung sein soll.
Vor die Kapitel hat Lehnert mottogleich einen Vierzeiler gestellt, der als Liebeserklärung gelesen werden kann.
Ich bin dein Echo, du bist meine Stimme.
Ich höre mich, wenn ich in dir verschwimme.
Du bist der Raum, in dem ich widerhalle
und endlos falle.
Vier Zeilen, die mehr sagen als jeder messianische Selbstversuch.
Michael Wüstefeld, poetenladen.de, 2.2.2009
Ostdeutsches Requiem
− Kryptomessianische Poesie von Christian Lehnert. −
Richtig gute Lyriker gibt es höchstens eine Handvoll. Christian Lehnert gehört auf jeden Fall dazu. In seinem neuesten Gedichtband Auf Moränen mustert er den Sprachschutt, der nach dem Abschmelzen des Ostblock-Gletschers übrig geblieben ist. Das meiste ist gewöhnlicher Dreck, aber vereinzelt finden sich schöngemusterte Kiesel darin. Es stellt sich die Frage: Liegt irgendwo in der Sprache noch ein Rest jener Verheißung, die es doch einmal gab, ziele sie nun auf eine bessere Welt oder auf die Erlösung überhaupt?
Im ersten der vier Teile, der mit „Zungenreden“ überschrieben ist, beschwört Lehnert traumatische Bilder aus seiner Zeit als Bausoldat in Prora auf Rügen herauf, um darin nach Spuren der Nächstenliebe zu suchen. Aber in den DDR-Kasernen herrschte kein Verständnis, auch im Rückblick nicht, da war steinernes Schweigen und betonharte Einsamkeit, „nur die Möwen erkannten ihren Nächsten in ihm“. Die Möwenschreie werden zum Bild der Opposition gegen den Dämon der DDR-Sprache. Wie zerrissene Wolken wirbeln Bruchstücke der christlichen Apokalyptik in den Prora-Gedichten herum. Blitzartig öffnet sich der Himmel zu einem „Amen, Herr, komme bald!“, das sogleich wieder verschwindet.
Den zweiten Teil kann man vereinfacht „Mielke-Gedichte“ betiteln, nach Erich Mielke, dem einstigen Minister für Staatssicherheit, dem die Lüge zur zweiten Haut geworden war. Mielke glaubte stets an das jeweils Verordnete. Auch die eigene Biographie frisierte er je nach der politischen Lage um.
Es ist so,
dass wir nur dann der Wahrheit dienen,
wenn wir immer neu festlegen, was wir glauben,
und was gewesen ist.
Das Lügengespinst hat allen Glauben, alles Erinnern und jedweden Wahrheitsdiskurs auf unbestimmte Zeit verdorben.
„Vigilien“, also Nachtwachen, ist der dritte Teil überschrieben. Das Wachen und Warten gilt dem Messias. Wann kommt er? Christian Lehnert gibt nicht die alten, verbrauchten und missbrauchten Antworten. Nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt wird er kommen, sondern außerhalb der Zeit ist er und wird er sein: „Die Zeit vermag keine Wunde zu heilen. / Nein, solange die Zeit ist, keine Heilung.“ Man muss heraus nicht nur aus der Zeit, sondern sogar aus dem Glauben. Man muss glauben, als glaubte man nicht.
Die Gedichte der vierten Gruppe, unter denen viele bedeutende sind (zum Beispiel das im Brentano-Ton geschriebene Sonett „Herbstzeitlose“), vertiefen das mystische Paradox. Lehnert schwärmt von den ersten sechs Lebensmonaten, in denen das Kind noch nichts von Zeit oder Worten weiß. Auch Christi Geburt beschreibt er, in einer schockierend antiidyllischen Sprache, beginnend mit der Zeile „Unerwartet der Schwall Blut und das schwarze, kaum erträgliche Köpfchen.“
Im Moränengeröll findet man auch das Wort „Gott“, aber es ist zu nichts mehr zu verwenden außer: es leer zu halten, leer zu halten sogar „um den Preis des Verstehens“. Denn Gott fällt nicht unter unsere Begriffe. Es gibt immer noch vieles, sagt Lehnert im Gedicht, worauf man sich blind verlassen müsse, „dass die Erde auftaut im April“, und „dass die schweren Wurzeln des Nussbaums nicht in meine Seele übergreifen“, und „dass Gedächtnis und Begehren nicht von innen den Körper aufbohren“.
Hermann Kurzke, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.5.2008
Christian Lehnert: Auf Moränen
Bei Christian Lehnert viertem Gedichtband Auf Moränen ist Paulus eine schwergeprüfte Gestalt, der an seiner Unfähigkeit, die Vollkommenheit des Glaubens in sich zu finden, leidet. Und er meint, die von höchster Stelle ihm anvertraute Mission, nicht erfüllen zu können. Einmal heißt es: „Was ich auch tue, es führt in den Tod. / Was ich auch lasse, es ist mein Versagen. / Wenn ich erwache / falle ich zu einem Punkt zusammen.“ Das Verfahren, mit dem Lehnert Paulus konstruiert, ist hier interessant.
Paulus Briefe sind ja – wie weithin bekannt – Zeugnisse glühenden Glaubens. Jedoch sind die Bruchstellen innerhalb der Glaubensdarlegung mit ihrem immer wieder zum Ausdruck hervorbrechenden Ängsten vor dem Tod und den Unterlegenheitsgefühlen gegenüber leiblichen Bedürfnissen immer schon Futter für die Hermeneutiker gewesen. Für Lehnert sind diese Bruchstellen dialektischer Ausgangspunkt seiner 24 Vigilien (Stundengebete), die Paulus Mission thematisiert. Das ist einerseits schlüssig und schön, weil er sich einer historischen Note bedient – was durchaus typisch für eine DDR-Lyriksozialisation ist (Lehnert wurde 1969 in Dresden geboren), die von Heiner Müller bis Durs Grünbein reicht. Andererseits wirken die Vigilien aber auch wie ein Sandalenfilm in Versen.
Trotzdem ist die sprachliche Verve, mit der Lehnert die Lücken im Glaubenssystem Paulus’ ausleuchtet, nicht unbeeindruckend:
Paulus hörst du?
Ich spreche deinen Namen nach
bis er mir nichts mehr sagt.
Das hat dann Methode, denn später sagt er:
Ich bin, doch nicht in mir.
Oder er konstatiert:
Nicht ich lebe, der Kommende lebt in mir.
Lehnerts Gedichte haben also einen theologischen Einschlag, der allerdings im Dienste einer Spekulation steht. Der Dichter dreht an Paulus’ apodiktischem System von Glauben und Wahrheit kritisch herum. Eine ähnliche biographisch grundierte Methode wendet er in dem zweiten Abschnitt des knapp 130 Seiten langen Bandes an. Da stehen die verschiedenen Identitäten im Werdegang Erich Mielkes im Mittelpunkt, die ebenso fragmentarisch behandelt und dialektisch aufgelöst werden. „Das ist die Liebe“, heißt es einmal, „sich selbst / zu vergessen. Enteignung und Entblößung. Wer ist wer? / Fritz Leistner, Paul Bach? Erich Mielke? / Dass ich das nicht bestimmen kann / ist meine ganze Würde.“
Als Fritz Leistner kämpfte Mielke im spanischen Bürgerkrieg, der später mit anderen zusammen aus der Idee eines aufgeklärten sozialistischen Staates ein Gefängnis für 17 Millionen Menschen machte. Das heißt für Lehnert im Rückblick: Wann entsteht der Augenblick, wo aus einem System mit überzeugender Kohärenz eine geschlossene Anstalt wird?
Der ist manchmal etwas sperrig zu lesen, aber intellektuell interessant. Der ganze Post-DDR-Ernst kommt allerdings in dem Abschnitt, in dem sich Lehnert mit seiner Zeit als junger NVA-Bausoldat auseinandersetzt, besser zur Geltung. Diese Beschreibungen der schweren, körperlichen Arbeit mit ihren Knochen- und Muskelpathos überzeugen. Auch (oder gerade) weil Lehnert beeindruckende Bilder findet. In einem Gedicht beispielsweise werden verkrüppelte Krähen beschrieben – ein selbst sprechendes Bild für die flugunfähige DDR-Individualität.
Die schönste Lyrik des Bandes sind dann die aus feinfühligen Beobachtungen bestehenden Gedichte über die ersten Monate seiner Tochter. Und auch hier findet er schöne Bilder. Er begegnet der Befindlichkeit des Säuglings mit einer ozeanischen Metaphorik. Da tummeln sich die Delphine und Quallen; und das kindliche Prä-Bewusstsein schwimmt blind und vertraut in derselben Strömung. „Sie weiß von keinem Feuer, / keinen Rauchgaben, keiner Sintflut.“ Vielleicht mögen das einige überladen finden, man kann sich dem nicht anschließen.
Denn selbst nach mehrmaligen Lesen verlieren Lehnerts Gedichte nichts von ihrem warmen Ton, verbunden mit der weit ausgreifenden Bildkraft. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis der von ihm ausgesuchten Themenschwerpunkte. Vielleicht wird man bei diesen Gedichten so empfänglich, weil in ihnen immer wieder ein Kerngedanke klassischer Theologie aufleuchtet: Nämlich die Frage, warum es im metaphysisch erfahrbaren System der Natur eine so universell unpersönliche Kraft gibt, die ausgerechnet den Menschen liebt. Und man wird das Gefühl nie los, dass Christian Lehnert einen alten emotionalen Umriss noch einmal neu fasst.
Manuel Karasek, karasek02.blogspot.com, 5.3.2009
Auf Moränen
Der 1969 in Dresden geborene, in der sächsischen Provinz als Pfarrer tätige Christian Lehnert hat sich mit drei Lyrikbänden einen Namen als „religiös hochmusikalischer“ Dichter gemacht, der im Spannungsfeld von Religionswissenschaft, Orientalistik und Theologie virtuose und wahrnehmungsgenaue lyrische Texte schreibt.
Der neue Lyrikband Auf Moränen geht noch freier mit religiös-spirituellen Wissenstraditionen um. Vier Zyklen erkunden die Ablagerungen der Vergangenheit in Form von Rollen- und Monologgedichten: der manchmal betenden Bausoldaten der NVA in Prora auf Rügen kurz vor dem Ende der DDR; des Ministers für Staatssicherheit, Mielke, der humanistische Appelle in ideologische Phrasen umschmiedet und damit Folter und Verfolgung Andersdenkender zu rechtfertigen sucht; des mit seiner Mission ringenden Völkerapostels Paulus, „Sklave / des Messias Jesu“; schließlich des dichterischen Ichs selbst, das über die Wunder des Lebens und die Probleme des Verstehens reflektiert. – Beredte, nicht immer leicht zu verstehende, aber leserzugewandte Gedichte mit starkem religiösem Bezug.
Dr. Michael Braun, medienprofile.de
Reproduktion der Schuld
Orte sind nicht selten mit Schuld beladen. Wer den Sehnsuchtsaspekt an ihnen überbetont – das Ferne einerseits, die Heimat andererseits – der begegnet im neuen Gedichtband Christian Lehnerts einem mystisch aufgeladenen Bilderspektakel, das im Umkehrschluss nur allzu offensichtlich macht, in welchem Ausmaß der Unsinn geographischer Lobhudelei zu einem öffentlichen Selbstläufer anschwellen kann, so geschehen im vergangenen Jahrzehnt hinsichtlich des plötzlich von den Sendestationen entdeckten ostdeutschen Raums. Wo aber, im medialen Blitzlichtgewitter, nach den Allgemeinheiten des Lebens diesseits von Stacheldraht und Beton geschielt wird, dort widmet sich Lehnerts Gedicht-Ich seinem ganz persönlichen, man ist versucht zu sagen: mystischen Bezug zu dieser Geschichte, die immer wieder in einer seltsamen, aber spannenden Schwebe zwischen Ironie und Pathos kommentiert wird:
Hier werde ich gegangen sein,
werde ich gegangen sein,
werde ich gegangen sein…
Das Anschwellen des öffentlichen Interesses am untergegangenen Staat vollzog sich mit Verzögerung, schließlich aber rapide, und das, obwohl viele öffentliche Versuche der Schatzrettung und Geschichtenbergung im Sinne der Klischeevernichtung angedacht waren, nicht aber zugunsten der Potenzierung vermeintlicher Eindeutigkeit. So aber ist es gekommen, eindeutig, ganz medial und auf großer Bühne – und das Label, das man schließlich wie ein schon benutztes Kondom darüberzog, hieß „Ostalgie“.
In Auf Moränen leistet die Lehnertsche Poetik dieser Ostalgie gegenüber einiges an Aufarbeitung und Rückbesinnung: auf das vermeintlich Untröstliche, tatsächlich zu historischer Aufmerksamkeit Einladende:
Das Schweigen,
als ich vibrierte am Preßluftschlauch, als der Schnee
gegen den Sperrzaun wehte, ein Reh sich überschlug
als die Maschinengewehre in die Etagen zielten, als ich das Wort
Stille hörte, das Wort stehen, auf dem Appellplatz,
das Wort Ausgang hörte
und es war draußen nichts.
Solch welker Sprache, in der das Echo der DDR-Blütezeit aber immer noch nachhallt, kann kaum mit den herkömmlichen Inszenierungsgebärden medialer Cluster begegnet werden. Eher schon mit einer harten Fuge aus Beschreibungen einer durch Uranbergbau zerstörten Landschaft, „deren immer noch plätschernden Flüssen und Seen“. Nur wie es unter der glitzernden Oberfläche eines Bergsees aussehen mag, bleibt der Phantasie überlassen, meistens jedenfalls. Vielleicht ist auch die transzendentale Herangehensweise an ohnehin Erschütterndes die viel geeignetere Waffe, um den Schrecken der Rodung und Lebensraumvernichtung etwas an Kritikwürdigkeit anzuheften:
Ich bin dein Echo, du bist meine Stimme.
Ich höre mich, wenn ich in dir verschwimme.
Du bist der Raum, in dem ich widerhalle
und endlos falle.
Hoffnung auf himmelhochjauchzende Zustände gewähren diese Gedichte jedenfalls an keiner Stelle, Düsternis im Geschichtskreis stellt sich ein, festgemacht an gebrochenen Biographien:
Ein Körper in der unteren Bettenlage,
blaß und reglos zwischen blauen Karos:
Atmet er noch?
Doch stellt sich mit der letzten und keineswegs rhetorischen Frage auch etwas wie Fürsorge angesichts all der Ungewissheit über Künftiges ein. Selbst wenn kein Licht zu sehen ist, so scheint es doch auch keine Wand, die am Ende des Tunnels der Geschichte steht. Diese Offenheit ist bei Lehnert keine, die je beliebig werden könnte, sondern feine Sprachkalibrierung unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten, die Geschichte zu bewerten.
Teils ließe sich der Hang dieser Gedichte kritisieren, Situationen zu stilisieren, tatsächlich unschöne, ätzende Erfahrungen zu ästhetisieren, was Lehnert den Ruf eines religiösen Dichters eingebrockt hat. Diese künstliche Aufladung ist nie zu übersehen, allerdings auch nichts, was die Texte hauptsächlich kennzeichnen würde. Zwei Prinzipien scheinen einander permanent zu widersprechen. Einerseits bauen die Texte auf so etwas Vagem auf wie subjektiver Vernunft und historischer Ratio, andererseits kommen sie nicht ohne eben jene Ästhetisierung, ohne theologische Andeutung aus. Die historische Ratio, von ganzen Philosophengenerationen als Wunschtraum und Hirngespinst bekämpft, wird bei Lehnert von Grund auf wieder ästhetisiert, mystifiziert. Vielleicht bloß, um zu zeigen, dass sie selbst nie mehr als ein Mythos war. Hierin lässt sich allerdings auch ein Kampf des Autors um die angemessenste Perspektivierung herauslesen.
Neben der Aufarbeitung klassisch ostdeutscher Zeitgeschichte fnden sich in Auf Moränen auch grundsätzlich einige aufschlussreiche Passagen über Zeit als Phänomen an sich. Was diese Texte zudem leisten, ist, dass Geschichte selbst anhand von Gedichten nicht nur erfahrbar wird, sondern in all ihrer Plastizität auch Stoff für kritische Auseinandersetzung mit fragwürdigen Interpretationen bietet, wie sie von Talkmastern nicht weniger als von alten Stasi-Kadern durch die öffentliche Diskussion geschleudert werden. Dafür ist Christian Lehnert nicht genug zu danken.
Marius Hulpe, am-erker.de, Dezember 2009
Ich ist ein lallender Körper
− Eine Moderne der Heillosigkeit: Christian Lehnerts Gedichtband Auf Moränen. −
Manchmal entsteht ein Werk fast im Verborgenen. Christian Lehnert, 1969 in Dresden geboren, hat bisher eine handvoll Gedichtbände veröffentlicht, auch das Libretto zu Heinz Werner Henzes Phaedra stammt aus seiner Feder. Seine aktuellen Gedichte, gesammelt unter dem Titel Auf Moränen, kommen jetzt erstmals im veritablen Hardcover daher. Dennoch war Lehnerts Dichtung bisher eher verhaltene Aufmerksamkeit beschieden. Trotz Großverlag und trotz vermeintlicher Lyrik-Hausse.
Hauptberuflich als Pastor tätig, firmiert Lehnert unweigerlich unter dem Label „religiöser Dichter“. Nun mag die Religion heute durchaus wieder zeitgemäß sein; die Hochzeit zwischen Kunst und Kult mutet hingegen weiterhin reichlich unmodern an. Lehnerts Gedichte sind jedoch keine versifizierten Sonntagspredigten, keine lyrischen Wege zu Gott. Eher Umwege, Abwege. Noch dann, wenn das lyrische Ich dem Heiligen begegnet, etwa im Erlebnis der archaischen Stätten oder der religionsstiftenden Schriften; noch dann bleibt das Kunstgebilde Gedicht, bei aller religiösen Verwurzelung, merkwürdig heillos.
Bis die Lippen bluten
So zeigt sich auch im neuen Gedichtband zwar ein Ich „des Glaubens, / versunken in IHM“; ein Ich gewiss, „daß sich die Kraft in der Schwäche erfüllt“ – wie es in einer Meditation über die Paulus-Briefe heißt. Doch zu jenem Ich, das im Hallraum der paulinischen Sprach- und Gedankentiefe seinen Grund findet, gesellt sich ein anderer. „Ein anderer“ in dem Sinn, den Arthur Rimbaud einst fasste, als er die Störungen, Spaltungen, Kränkungen der modernen Subjektivität auf die Formel „Ich ist ein anderer“ brachte.
Nicht die unio mystica, sondern der Schrecken erweist sich als dichterische Urszene dieser Lyrik:
Bleibst du stumm, wenn dein Gesicht,
gleißender Fleck, auf dich zukommt und brennt?
Beim Blick in den Brunnen („mein gespiegelter / Kopf zerfällt, Bildsplitter“), beim Blick in die Pfütze („als mein Körper mir entgegenstürzte“) wiederholt sich die Begegnung mit dem eigenen „anderen“, wird eindringlicher, drängender. Was zunächst als Ausweg erscheint, das Gebet, läuft irr, mündet im Zungenreden, im „Krampfen, / bis die Lippen bluten, aufgebissen, die Laute // hervorbluten, das Wort / tanzt unverständlich (…)?“ Wieder ist dort nur der andere: der lallende Körper.
Lehnerts Dichtung, mitunter einer Art pietistischem Expressionismus gleichend, ist so religiös, wie man es von einem Pastor erwartet. Einerseits. Andererseits ist das Ich dieser Verse so verloren, dass von irdischen Vergnügen in Gott kaum eine Spur bleibt. Dabei kommt dem Lobpreis der herrlichen Schöpfung noch etwas anderes in die Quere: Diesseits der religiösen Entrückung waltet die Historie, das Menschenschlachthaus. Schon Lehnerts Zyklus „passio“ von 2004 zerfurchte den Leidensweg Jesu mit Versen aus Thomas Klings Großgedicht „Der Erste Weltkrieg“. Ein Frevel. Zugleich ein Exerzitium in der Theodizee.
Verstrickt in die Schrecken der Geschichte ist auch das Ich des aktuellen Bandes. Es ist dabei auch ganz buchstäblich ein anderer: Vielfach arbeitet Lehnert mit figuraler Rede, Rollendichtung, die er in ein düsteres Stimmengewirr verwickelt. Ein „unruhige(s) Gewebe“ entsteht, „Echos, / überlagert von Echos“. Zwei ausufernde Zyklen lassen auf diese Weise einen unbekannten DDR-Bausoldaten und, im konzeptionellen Gegenschnitt, einen bekannten DDR-Staatsterroristen, Erich Mielke, zu Wort kommen. So wird das Ich als historisches fasslich, als unterdrücktes ebenso wie als unterdrückendes.
Überzeugen können vor allem die tagebuchartigen Terzinen des Bausoldaten, der sich auf den surreal gezeichneten Großbaustellen des real existierenden Sozialismus um Leib und Seele schaufelt:
Ich finde keinen Ausweg
aus der Wiederholung, am Rand des Schlafes, dankbar
für jeden Befehl, der den Zusammenhang
zwischen Arm und Hacke belegt
In der biographischen Skizze über den Stasi-Chef gelingt es Lehnert hingegen nicht immer, für dessen Ego-Prosa einen dichterischen Kontext zu erfinden, der die lyrische Form zu begründen vermag. Doch auch wenn Lehnert im Ringen mit dem glitschigen Mielke formal mitunter strauchelt; wie ein Ich sich wieder und wieder als ein anderer entwirft – gerade an Mielkes Techniken der Identitätskonstruktion und -destruktion wird es ersichtlich.
Mit Auf Moränen zeigt Lehnert abermals, dass er mehr zu bieten hat als geistliche Lyrik von erstaunlichem Format, heillos modern und doch mit unbedingtem Gespür für die poetische Kraft des religiösen Idioms. Zeigt, dass er auch auf dem Feld der historischen Geröllkunde zu den versiertesten Buddlern seiner Generation gehört.
Peer Trilcke, Frankfurter Rundschau, 17.4.2008
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Frank Milauzki: Daß die Erde auftaut im April und auf was man sonst so vertrauen kann
fixpoetry.com, 29.6.2009
Georg Langenhorst: Die Silbe Gott leer halten um den Preis des Verstehens – Christian Lehnert
theologie-und-literatur.de
Jessica Brautzsch im Interview mit Christian Lehnert: „Ich sehe ihren Glanz“
Otto Friedrich im Gespräch mit Christian Lehnert: „Hineinsprechen in das Ungesagte“
Richard Kämmerlings: „Schreiben gehört zu den vorletzten Dingen“
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 5.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 1 von 4: „Die weggeworfene Leiter. Erste Gedanken eines Dichters zu einer religiösen Sprachlehre“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 26.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 2 von 4: „Das Kreuz. Vom Verlöschen der Sprache im Herzen des Christentums“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 10.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 3 von 4: „Fröhliche Urständ. Gedanken zur Sprache als Schöpfungsgestalt“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 24.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 4 von 4: „Atem“.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG
Porträtgalerie: IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Dichter im Porträt: Christian Lehnert.


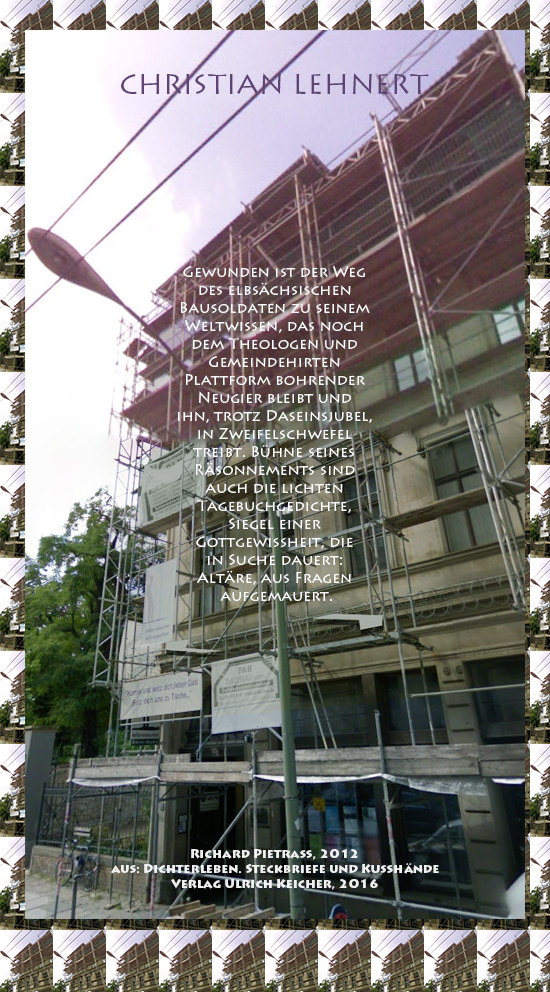












Schreibe einen Kommentar