Christian Lehnert: Ich werde sehen, schweigen und hören
WARTEN ALLER AUGEN
(Begegnungen)
(Neunzigjährige Witwe)
Ich bin in eine lange Dunkelheit gezogen.
Blüten der Birnen im Frühjahr,
die vollen Blätter,
das dürre Geäst −
so kehren die Toten wieder.
Alles im Raum fehlt unverändert wie es war.
Nur das farblose Gesicht meines Mannes,
wie er vergraben in einem Erdloch lag für Monate
im Eis, im Norden
bewegt sich manchmal, kaum merklich,
wenn es draußen taut.
Ich bin in eine lange Dunkelheit im Norden gezogen.
Blind bin ich aufgebrochen,
taub und schwer,
daß er mich vielleicht doch noch wiedererkennen kann.
Ich füttere das Mondlicht.
Ich werde nachts um Eins gedreht
zum Fenster mit dem Birnenbaum.
Christian Lehnert ist ein Dichter,
der sich Zeit läßt, einer, für den Zeit offenbar in einem ganz anderen Rhythmus verläuft. Das mag damit zusammenhängen, daß die Orte seiner Gedichte mit dem hiesigen Alltag zunächst wenig zu tun zu haben scheinen: Es sind Orte der geschichtlichen Überlieferung, der Bibel, Orte in Palästina, im Nahen Osten, in Spanien – Stationen seines Lebenswegs, der den noch nicht 35jährigen von Sachsen aus in die Ferne führte und wieder zurück in einen kleinen Ort bei Dresden, wo Christian Lehnert heute als Pfarrer arbeitet. Lehnert hört „auf die Sätze, die aus der Stille heraufsickern“, er gibt dem Schläfer poetische Stimme, dem Soldaten, dem Physiker oder dem taubstummen Tänzer, besingt den Vulkan, die Autobahn, die Brache in einer Sprache äußerster Verdichtung, die nie auf Effekte aus ist.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2004
Die Piste ragt ins All
Plötzlich, Mitte der neunziger Jahre, als ein für seine Skepsis bekannter Autor vom Blatt aufsieht, steht ein Engel im Zimmer:
Ein ganz gemeiner Engel, vermutlich unterste Charge.
Er erscheint in Enzensbergers Gedicht „Die Visite“ und belehrt uns, daß der Mensch nicht weiß, wie entbehrlich er ist. Der Dichter, unvorbereitet auf den überraschenden Besuch, scheint unfähig zu reagieren:
Ich rührte mich nicht. Ich wartete,
bis er verschwunden war, schweigend.
Er gehört einer Generation an, die sich an Gottfried Benns Satz hielt, wonach Gott ein „schlechtes Stilprinzip“ sei.
Solche thematischen Vorbehalte gelten für die jungen Autoren nicht mehr. Religiöse Motive erscheinen manchem von ihnen wieder interessant, ja dringlich. So dem Lyriker Christian Lehnert, Jahrgang 1969. Er hat Religionswissenschaft, Orientalistik und Theologie studiert und lebt heute als Pfarrer in einem kleinen Ort bei Dresden.
Die drei Gedichtbände, die er bisher vorgelegt hat, bezeichnen eine entschiedene Bewegung seiner Themen. Der gefesselte Sänger (1997) handelt von den Altlasten der deutsch-deutschen Geschichte, den historischen „Bruchzonen“ zwischen Auschwitz und Dresden. Der Augen Aufgang (2000) befragt im Bild der Wüste die Möglichkeit eines neuen Glaubens. Finisterre (2002) versteht sich im Sinne des alten Jakobswegs als Beginn einer Pilgerschaft.
Das neue Gedichtbuch schlägt in seinem Titel das Motiv der Verheißung an: Ich werde sehen, schweigen und hören. Doch der emphatische Ton dieses Satzes relativiert sich, wenn man den gleichnamigen Zyklus nachliest. Er steht im vierten und letzten Teil des Buches und bringt Gedichte aus einem Garten. Wir lesen Verse über Tomatenpflanzen, über Salbei, Giersch und einen kranken Pfirsichbaum, über Sonnenblumen, Knoblauch, die Zaunwinde und den Nußbaum.
Ist das ein Pfarrersgarten? Ist da wer tätig, munterer als Mörike? Angesichts der Tomatenpflanzen übt das lyrische Ich sich in Beschwörung:
Der Klang deiner Stimme düngt sie.
Immerhin hat es zuvor die Pflanzen an Pfähle gebunden und das Unkraut um sie herum weggehackt. Der Dichter ist ein Sorgender. Er kümmert sich um den kranken Pfirsichbaum:
Ich lege meine Hand
in die Wunde am Stamm.
Diese Geste läßt an die des ungläubigen Thomas denken, ohne daß der Autor diesen Bezug weiter ausdeutet. Lehnert sieht in der Natur die Zeichen des Leidens. Doch er spielt die sich anbietende Symbolik nicht aus und begnügt sich mit dem Vergleich. Die massigen Äste des Nußbaums erscheinen ihm wie „die Balken eines Kreuzes“.
Die naturfromme Gartenidylle ist ein Ruhepunkt in Lehnerts Band. Ihr gehen Gedichte voraus, die das religiöse Motiv existentieller fassen. Sie beschwören „Nacht eines Gottes der nie war“ und sehen das Licht als „Schrift- und Hinrichtungszug“ Richtung Golgatha. Dennoch scheint in Lehnerts neuen Gedichten die religiöse Problematik weniger zugespitzt als in seinen früheren Gedichten. Dafür gewinnen sie an Welthaltigkeit.
Der Zyklus „Warten aller Augen“ schildert Gestalten in ihren persönlichen Problemen: den Soldaten oder den „Physiker in der Chipfabrik“, aber auch den Autor, der gehetzt schreibt, und den Pfarrer, der nicht mehr weiß, was wird. Das anrührendste Gedicht ist „Patientin im Mehrbettzimmer eines Pflegeheims“. Es endet mit den Zeilen:
Wieder versuche ich,
weil es sich so gehört,
eine der schneeweißen Kartoffeln zu essen.
Im Dingsymbol der „weißen Kartoffeln“ ist alles an Verzweiflung und Todesnähe enthalten.
Bleibt noch, das Schönste und Merkwürdigste dieses Bandes zu erwähnen. Christian Lehnert hat vier Paraphrasen auf protestantische Kirchenlieder geschrieben. Das sind nicht etwa freie thematische Variationen, sondern Kontrafakturen, die dem strophischen Maß der Choräle und also auch den Melodien folgen. Eines beginnt:
Die Landschaft kippt, wird grauer,
ein nasser Wind, ein Schauer,
die Piste ragt ins All.
Verschüttet sind die Stollen,
die Erde treibt in Schollen:
du bist ihr warmer Widerhall.
Wir lesen hier die skeptisch-tröstliche Variante von Paul Gerhardts Abendlied „Nun ruhen alle Wälder“. Sage also niemand, Gott sei ein schlechtes Stilprinzip. Der Pfarrerssohn Benn war übrigens ein Liebhaber Paul Gerhardts. Pfarrer Lehnert erneuert ihn.
Harald Hartung, als: In der Nacht eines Gottes, der nie war, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.2004
Poesie der Genauigkeit
Christian Lehnert, hat Religionswissenschaften und Orientalistik studiert, ist Pfarrer mit einer halben Stelle, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden. Nach seiner persönlichen Aussage schreibt er Gedichte, weil das zu seinem Leben gehört. Nach den in den letzten Jahren publizierten Gedichten, Der gefesselte Sänger und der Augen Aufgang, ist jetzt der letzte Gedichtband Ich werde schweigen, sehen und hören, erschienen.
Der Dichter und der Pfarrer, eigentlich sind das zwei Lebenswelten, die sich ganz wenig überschneiden. Und doch findet man in diesen Gedichten eine Poesie der Genauigkeit, will sagen, die Dinge die Lehnert benennt, beschreibt, sind in der Beobachtung von einer unglaublichen Präzision. Das gelingt anderen Schriftstellern, die einen solchen Beruf nicht im Hintergrund haben, nur sehr selten.
In seinen bisherigen Gedichten bestach die sozialkritische Betrachtungsweise, besonders die Tatsache wie Christian Lehnert nicht einfach lyrisch über die Dinge hinwegfährt, sondern präzise ohne Effekthascherei auf die Dinge zugeht.
Die jetzt publizierten Gartengedichte sind einfach wunderschön, sie untersteichen die poetische Begabung und belegen die Tatsache, dass das Pfarrhaus oft als die Wiege der deutschen Literatur bezeichnet wurde und wird. Viele deutsche Geistesgrößen kommen aus Pfarrhäusern.
Es sind Prosagedichte, die von der Luthersprache und den Choralsprachen geprägt, eine ganz klare und einfache Sprache haben. Die dingliche Präzision besticht. Es wird nicht metaphorisiert. Da der Dichter auf dem Land lebt, hat er möglicherweise eine größere Nähe zu dem „Einfachen“. Die Abstraktion ist ihm fremd. Ein „Triebwerk“, ist bei Lehnert eben ein Unkraut, das sich überall breit machen kann, kein Flugzeugantrieb.
Ich habe die Gedichte mit einer anhaltenden Faszination gelesen und kann die Lektüre nur mit Nachdruck empfehlen.
Carl-Heinrich Bock, amazon.de, 14.2.2005
Christian Lehnert: Ich werde sehen, schweigen und hören
Kugelalgen, Fäden, Epithele begegnen in zeitgenössischer Lyrik eher selten, der Woyzeck-Ausruf, die Flechten und Moose lesen zu wollen, schien nach all den Pappeln, Lurchen und Anemonen der Nachkriegslyrik bedenklich ausgereizt und nach den medienvernarrten 1990ern gar völlig obsolet, da gehörte der naturlyrische Ton eher Discovery Channel denn der Dichterlesung an. Flechten, Atemwolken, Wellen und Kieseln nun begegnet man in der Lyrik Christian Lehnerts auf Schritt und Tritt, was, ebenso wie die Entstehungsgeschichte der Gedichte, die teilweise während einer Pilgerreise entlang des Jakobsweges notiert wurden, also durchaus etwas Besonderes ist. Warum aber Flechten und Moose, warum „Nomadenpflanzen“?
aaaaaaaaaaIhre Schrift aber bleibt ewig.
Ihre grünen Kursive widersagen dem eigenen Zerfall
und blühen. Ihre Körper wiederholen sich wurzelnd
in ihren Körpern, lösen Felsbrocken, haften
über Jahrhunderte fest am kargen Arkanum ihrer selbst:
Geflecht, das sich auf sein Geheimnis konzentriert,
indem es wahllos in die Breite wuchert.
Fraktale Geometrie des Mooses und Brechungen des Lichts betrachtete auch Theophrastus Bombastus von Hohenheim gen. Paracelsus bei seiner Reise im sächsisch-böhmischen Erzgebirge mit Interesse, ein direkter Gottesbeweis erwartet den Leser bei Lehnerts Beobachtungen jedoch nicht, er ist kein Missionar. Aber er kann das Fehlende, die Abwesenheit versuchsweise zum Zeugen machen:
Am Ende sähest du nur die Hohlform einer Hand,
die Spur von Millionen Wanderern an einer Säule:
Fehlendes, das ein Gewölbe trägt…
Zurück im Sächsischen beschäftigt auch lokale Zeitgeschichte den Dichter, so etwa die Elbflut 2002 als „schlammige Jetztzeit“ in Weesenstein, bevor wiederum Reisebilder die Gedichte inspirieren. Das verliert dann gelegentlich die Bodenhaftung, etwa wenn der Nachtflug Dresden-Arecife zur Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“ gerade noch rechtzeitig abbricht, bevor es unfreiwillig komisch wird. Zum Mitsummen:
Sei still und schlafe, warte
und träume nichts und walte,
zu hoffen ist kein Grund.
Hinweggerollt sind Meere,
Kulissen, schwarze Leere,
in der sich öffnet Gottes Mund.
Im ersten Gedicht des Abschnitts „passio“ sind die heiligen Texte dann zugleich diskursleitend und -vereitelnd. „Die Schrift bricht herein wie ein Beil“ heißt es da, und, Kafkas Bild des gefrorenen Meeres in uns mit theologischer Schriftgelehrtheit verschränkend:
Die Schrift ist das Auge,
mit dem das, was er sieht, erst entziffert werden muss,
trübes Glas
Diese Passion Christi ist literaturgeschichtlich informiert, sie weiß um die Macht der Schrift, weiß um die Strafkolonie, weiß auch um „festen Buchstab und gute Deutung“:
Nur durch die Sprache
wird die Sprache überwunden, das Tageslicht
arbeitet sich wie ein Schrift-, ein Hinrichtungszug
bis hierher vor,
in die Mittagshitze: Golgatha.
lntertextualität, Variation und Anverwandlung sind Lehnerts Sache, gern aus dem „Naturvorrat“, aber gern auch intermedial. Eine Federzeichnung Hieronymus Boschs aus dem Kupferstichkabinett Berlin inspiriert den Beschluss des titelgebenden Abschnitts des Bandes Ich werde sehen, schweigen und hören mit Gedichten aus einem Garten. Neben Tomaten, Knoblauch und Salbei spielt hierin auch ein Nussbaum eine Rolle, dessen massige Äste den Garten wie ein Kreuz beschatten. Darin hockten Vögel, die auf die Segnung des Öls warten. Das Bild der natura loquitur endet mit den folgenden Versen, in denen auch ein Nachhall Peter Huchels vernehmlich wird:
Im späten Glanz der Karwoche,
nach dem Feuer an der Lichtschwelle, dem Feuer
das sich nie verzehrt, sahst du die ersten Nüsse keimen
Dass Natur auch anders erfahrbar ist, darauf deutet dann das Bosch-Gedicht, das sich wie eine poetologische Überlegung lesen lässt. Selten werden Bild und Betrachter, Text und Leser genauer beschrieben:
Du bist fremd […]
Du horchst in dich hinein:
Warum stehst du hier in dem Wald?
Du weißt nichts von dir. […]
Längst haben dich Eulenblicke erspäht:
das Bild, das du siehst, ist dir auf der Spur
Christian Schlösser, Deutsche Bücher, Heft 2, 2006
Beeindruckende Gedichte
Ich lese nicht sehr häufig Gedichte. Doch die Gedichte von Christian Lehnert im Gedichte-Band Ich werde sehen, schweigen und hören sind wirklich lesenswert. Ich habe diese Gedichte nun schon das zweite mal gelesen. Dabei ist es interessant zu sehen, wie sich durch das mehrmalige Lesen eines Gedichtes plötzlich ein Bild ergibt und man in die Tiefe des Gedichtes eindringt. Speziell sind auch die Gedichte, welche sich mit biblischen Themen beschäftigen, vor allem der Text „passio“ hat mich stark beeindruckt.
Erich Spicher, amazon.de, 16.7.2006
Christian Lehnert
– Einführung zur Veranstaltung Die Gedichtbände des Jahres 2004 im Literaturhaus Berlin am 17. Dezember 2004. –
Auf den ersten Blick scheint es Landschaft zu sein, und diese Landschaft wird gestützt durch Orte, belegt durch Namen, beleuchtet von Witterungen, gepanzert mit Details und festgenagelt mit einer unerbittlichen Liebe zur naturwissenschaftlichen Genauigkeit und schlußendlich versehen mit dem Stempel des Augenblicks.
Aber je konkreter die Landschaft fixiert wird durch Kugelalgen, die weißen Vakuolen des Quarz, Eintragungen von Reiseetappen, je weniger austauschbar sie zu werden scheint und droht durch den keltischen Altar oder die Kirche zu Burkhardsweide, desto mehr befreien sich diese Orte von den Fesseln ihrer Unentrückbarkeit, desto mehr entrücken sich diese Orte in Sprache selbst.
Und in dem Wort, das es nannte, so schreibt Christian Lehnert, verschwindet das Festland.
Das Festland, die Landschaft, das Gesehene entrückt in ein Gebiet der Sprache, in dessen hundertfacher Schräge die Sonne sich spiegelt. Was hier am Werk ist, man merkt es schnell, ist Transzendenz und Verzückung. Aufhebung der Einzelheit und der Individualität in der Totale. „Schätze, die sich verzehren im Erfinden eines Namens, der sie verbirgt.“, heißt es an anderer Stelle.
Immer und immer wieder das Verschwinden von Welt hinter dem Begriff.
Damit liefert Lehnert einen Beleg, dass die Welt weiter nichts als die Gesamtheit all dessen ist, was Sprache zu finden/erfinden vermochte und der Dichter als größter Erfinder von Sprache ein Weltenschöpfer und damit im Umkehrschluß auch Gott der Dichter der Dichter.
Damit haben wir schon Vieles, was in diesen Gedichten eine wesentliche Rolle spielt, reale und poetische Religiosität, mystische Entrücktheit, auch Verzückung, transzendentale Aufhebung des konkreten Raums, „das Heimkehren des menschlichen Blicks in die Schrift der Kristalle“, das Leben ein Traum, und Christian Lehnert fragt sogar wörtlich:
Auf der Erde sein, wer hatte zuerst diesen Traum.
Ikonographisch sind die Gedichte christlich, das Kreuz, das Lamm, die Glocke, auch wenn Christian Lehnert über die christlich-mystische Zuordnung nicht immer glücklich ist, sagt er doch selbst: Gott ist nirgends, überall sind die Spuren seines Fehlens, aber die Nähe zum immer wieder in seinem Zusammenhang erwähnten Meister Eckhard und zu Silesius und anderen Mystikern ist nicht von der Hand zu weisen, eine mystisch religiöse Schöpfungsumarmung und ein auf Rilke verweisendes, glaubenstiefes Eindringen in die Dinge mittels Vision und Illumination.
Was allerdings das Entscheidende ist, keine Spur von Verstaubtheit findet sich an irgendeiner Stelle dieser Gedichte, sie sind klar, frisch, äußerst suggestiv und bildmächtig, altes Material, aber in neuer Bearbeitung.
Und seine Warnung an sich selbst, nur nicht Futter werden.
Gerhard Falkner, Park, Heft 63, Juni 2009
Gespräch mit Christian Lehnert
– Das Gespräch fand am 3. November 2005 in Burkhardswalde statt. –
Jörg Bernig: In deinem ersten Gedichtband Der gefesselte Sänger heißt es in der Kurzvita, dass die „Brüche in der eigenen Biographie, die letzten DDR-Jahre als Wehrdienstverweigerer und die neue Orientierung in einer veränderten Wirklichkeit“ dich als Autor auf den Weg gebracht hätten. Stimmt das so?
Christian Lehnert: Ja, mit Klappentexten ist das so eine Sache! Grundsätzlich stimmt das schon, also, die Erfahrungen als Bausoldat in den letzten Jahren der DDR haben mich schon auf den Weg gebracht, es war einfach ein – wie soll man sagen – ein Kampf um die eigene Stimme, ein Kampf um den eigenen Erinnerungsraum, um die eigene Identität in einer Maschinerie, die auf Dissoziation von allem ausgelegt war, wo man Teilchen eines Getriebes war und darum ringen musste, überhaupt eine haltbare oder verlässliche Sprache zu finden. Das war für mich eine Ausgangssituation des Schreibens. Die Texte, die ich damals oft nur skizziert und schnell hingeschrieben habe, abends auf dem Bett, Karo rauchend, diese Notizen habe ich später aufgearbeitet. Die Erfahrungen aus Prora und Merseburg gären in mir bis heute, es sind Dinge, die mir nachgehen. Jetzt erst wieder habe ich einen langen Gedichtzyklus über meine Bausoldatenzeit geschrieben.
Bernig: Du sprichst von Texten wie „eid“, „norm“, „prora“ oder „objekt h“…
Lehnert: Ja, genau. Ich war damals, als ich eingezogen wurde, 18 Jahre. Ich bin aus einer doch behüteten Kindheit von einem Tag zum anderen in eine Welt gekommen, von der ich intellektuell wusste, die ich mir aber nicht vorstellen konnte. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Die Kaserne war für mich DDR pur. Das war für mich das System ohne jede Maske. Und das hat natürlich auch, unabhängig von der reinen Auseinandersetzung mit dem Armeealltag, meine Sprache sehr verändert. Ich bin in eine gewisse Sprachlosigkeit gefallen. Die gängigen Erklärungsmuster – das klingt jetzt vielleicht albern – aber die gängigen Erklärungsmuster für Wirklichkeit funktionierten in diesem Sinne nicht mehr. Ich musste meine Welt ganz neu buchstabieren. Und es hat danach Jahre gedauert, bis ich wieder in einem normalen psychischen, gedanklichen Kontext war.
Bernig: Ich finde überhaupt nicht, dass das albern klingt! Dieser Sprachverlust, das war ja eine von vielen geteilte Erfahrung.
Lehnert: Wenn ich die Texte von damals lese, empfinde ich sehr stark, wie sich meine Sprache verändert hat. Ich habe damals den grammatikalischen Satz verlassen, ich verwendete nur noch Bruchstücke von Sätzen, die ich nebeneinander baute, so dass Mehrdeutigkeiten oder Risse entstanden. Ich habe die Grammatik verlassen, die Groß- und Kleinschreibung, es gab kein Komma und keinen Punkt mehr. Die Texte sind im Grund genommen Lückentexte. Und das war – so erkläre ich mir das im Nachhinein – ein Reflex auf eine Sprache, die zerfallen war. Das, was ich sagen wollte, tauchte im Grunde genommen nur in den Lücken zwischen Sprachsplittern und Sprachfetzen auf.
Bernig: Ist das zunächst eine Selbstverständigung gewesen oder hast du beim Schreiben dieser Texte auch das Gefühl der Verständigung nach außen gehabt?
Lehnert: Ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Jede Suche nach Sprache ist auch ein Versuch einer Selbstfindung. Es spricht ja jemand. Ich suchte eine Sprache um das, was ich dort erlebte, auch was in mir passierte, zu verstehen und auszudrücken. Es war für mich eine entscheidende Auseinandersetzung mit der DDR und meiner tiefen Verunsicherung, ja Angst, und darüber wollte ich Auskunft geben. Es war damals auch nicht absehbar, dass dieses System so schnell kippen würde. Man war ja in der Kaserne von fast jeder Information von außen abgeschnitten. Ich wurde im Frühjahr 1989 entlassen.
Bernig: Habe ich das richtig verstanden – dein Schreiben wurde durch das traumatische Erlebnis des Militärdienstes in Gang gesetzt?
Lehnert: Dieses traumatische Erleben, die Erfahrung der Armee als Bausoldat hat mein Schreiben zum Schreiben gemacht. Vorher war es im Grunde genommen eine Art Kunsthandwerk. Ab dann sind auch die ersten gültigen Texte, die zum Teil in Der gefesselte Sänger enthalten sind, entstanden. Das Schreiben hatte von da an einen spürbaren existentiellen Sog für mich.
Bernig: Hat es dir geholfen?
Lehnert: Schreiben als Therapie?
Bernig: Nicht als Therapie. Als Trost?
Lehnert: Nein, als Trost überhaupt nicht. Es ist so schwer vorstellbar. Einmal z.B. wurden wir um 6 Uhr früh in die Leunawerke befohlen, um im Vollschutzanzug mit Gasmaske und mit einem Presslufthammer in einen leergepumpten Chemie-Waggon zu klettern und erstarrten Schwefel von den Wänden zu hacken, mehrere Stunden lang. Danach gibt es kein funktionierendes Denken mehr. Also während ich bei der Armee war, gab es in diesem Sinn keinen Trost. Im Nachhinein ist natürlich jede Reflexion hilfreich, und jedes Nachdenken und sprachliche Formulieren ordnet die Welt neu und gibt einem ein Gerüst für eine begrenzte Zeit, und einen Ausblick, eine Perspektive.
Bernig: Das leitet mich zur nächsten Frage. Du hast Anfang der 90er Jahre begonnen, evangelische Theologie zu studieren. Hat das für dich – nach dieser „primären“ Hinwendung aufgrund der Militärerfahrung – eine neue Hinwendung zum Wort zur Folge gehabt? Du schreibst in deinem letzten Gedichtband im Gedicht „passio“: „Nur durch die Sprache / wird die Sprache überwunden.“ Aber dein Studium der evangelischen Theologie hat mich auf den Gedanken gebracht, dass das Wort damit in doppelter Hinsicht in den Vordergrund gerückt wird. Zum einen als dichterisches Wort und zum anderen als Wort Gottes, als göttliches Wort. Schreiben und Theologie…
Lehnert: Das sind jetzt zwei Fragen, die sehr komplex sind. Zur ersten Frage: Das Theologie-Studium an sich war biographisch erst einmal eine Notlösung, muss ich ganz offen sagen. Mein Traum war immer, Medizin zu studieren; nur weil ich den Waffendienst in der NVA verweigert hatte, blieb mir dann nichts anderes übrig, und erst nach zwei-drei Jahren des Studiums entstand eine wirkliche innere Beteiligung und eine wirkliche Bejahung dessen. Hier spielt auch die Zeit in Israel eine Rolle. Am Anfang war für mich das Studium der alten Sprachen wunderbar, das hat mich verändert, Das klingt merkwürdig, aber das Studium der hebräischen Sprache, einer Sprache, die so gänzlich anders aufgebaut ist als die deutsche, hat meinen Sinn unheimlich dafür geschärft, wie stark meine Wirklichkeit, wie ich sie erlebe, durch die Sprache, die ich spreche, vorgeprägt ist. Das hat bei mir eine ganz neue Sensibilität für die eigenen Ausdrucksformen hervorgebracht. Im Hebräischen gibt es zum Beispiel keine so klaren Zeitformen wie im Lateinischen oder im Deutschen. Im Hebräischen ist alles sehr fließend, meist kann man nur aus dem Kontext erkennen, was Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist. Der Hebräer lebte in einer ganz anderen Gedächtniskonstruktion, als wir das kennen, in einer ganz anderen Zeitgestalt. Er war durchdrungen von der Vergangenheit und von der Zukunft in einer uns kaum verständlichen Weise. Dann gibt es im Hebräischen z.B. ganz wenig Abstrakta, selbst solche Worte wie „Denken“ werden in Tätigkeitsformen ausgedrückt, als „Sprechen im Herzen“ etwa, so wird die Sprache sehr sinnlich. Der alte Hebräer muss wohl in einer viel bewegteren, viel sinnlicheren Welt gelebt haben als wir. Das hat mich sensibel gemacht für die eigene Sprache.
Der zweite Punkt – das Wort – ist komplizierter zu beantworten, Ich habe von meiner Armee-Erfahrung erzählt. Der Ausgangspunkt meines Schreibens war im Grunde genommen ein Zerstörungsprozess. Ich habe angefangen, auf Trümmern zu schreiben, auf sprachlichen Trümmern. Für meine Lyrik war während der ersten Zeit eine massive Sprachskepsis prägend. Die Auseinandersetzung mit der Theologie – oder vielleicht genauer gesagt mein Glaube – hat ein anderes Vertrauen zur Sprache angeregt. Es ist etwas, was nun schon über Jahre anhält, ein Prozess, den ich jetzt erst in meinem Schreiben deutlicher erkenne, wie das Vertrauen zum einfachen Satz, zum Wort wächst, weil ich die Sprache wieder viel stärker als eine Schöpfungskraft, als eine wirklichkeitsgestaltende Kraft wahrnehme.
Bernig: Du beschreibst das in dem bereits angesprochenen Gedicht „passio“ folgendermaßen: „[…] das Amen ein Nachhall, / aus dem die Dinge ihre Sagbarkeit saugen.“
Lehnert: Ja. Das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht. Ich weiß, dass das mit Erfahrungen zu tun hat, die nicht jeder teilt. Ich empfinde da eine starke Dissonanz, dass einmal die Sprache vorgeprägt, einengend, kontaminiert ist, dass ich mich von der Sprache durch die Sprache freischreiben muss, aber gleichzeitig steckt in der Sprache eine Urkraft, die eine tiefe, schöpferische Verbindung mit dem hat, was ist.
Bernig: Diese Erkenntnis findet sich auch in dem Gedicht „Prora auf Rügen, ein Palimpsest“: „Ich lernte das Sprechen ohne Mythen.“ Ist das Schreiben, ist das Gedicht für dich Ausdruck einer Mythensehnsucht? Ist es die Suche nach einer Sprache, die mythenloses Sprechen transzendiert und die ins Metaphysische zielt?
Lehnert: Man kann Mythen ja nicht erzeugen. Wer das versucht hat, es gibt ja viele Beispiele bis heute, gerät meist in die völlige Introversion. Mythen kann man nicht machen, sie sind da. Das Gedicht… Mythensehnsucht würde ich deshalb nicht sagen, sondern das Gedicht ist für mich vor allem eine Formensehnsucht, oder vielleicht eine Sehnsucht nach Sinn.
Bernig: Einige deiner Gedichte haben mich an die Gedichte des walisischen Dichters R.S. Thomas erinnert…
Lehnert: Er ist doch anglikanischer Priester…
Bernig: Er ist vor einigen Jahren gestorben. Auch in seinen Texten gibt es diese Sinnsuche, die Sehnsucht nach Sinn, „Sinn“ in seinen Gedichten oftmals mit Schrägstrich zu „Gott“ gesetzt. Das habe ich auch in deinen Gedichten gefunden. Doch wo bei ihm, bei R.S. Thomas, die Wissenschaft als Teil der Sinnkonstituierung ins Gedicht kommt, ist es bei dir die Sprache.
Lehnert: Damit das nicht allzu naiv klingt: Die Sprachskepsis bleibt natürlich. Sie ist da im Gefühl, dass ein Gedicht entsteht, wenn die Worte versagen. Ein Gedicht entsteht meist dann, wenn mir die Sprache fehlt, ich aber auch nicht einfach schweigen kann. Dass die Sprache an dem versagt, was sie sagen will, dass Sprechen eine Bewegung ist, die letztlich eine gewisse Vergeblichkeit in sich trägt, das empfinde ich stark, aber daneben ist es eben diese Doppelgestalt der Sprache. Du sprachst vorhin von der Doppelgestalt des Wortes. Das nur noch einmal zur Richtigstellung… Doch mir fällt gerade ein Wort ein, das es vielleicht präziser sagt: Es ist die Haltung der Bejahung, aus der ich in den letzten Jahren zunehmend schreibe. Damals war es ein Schreiben auf Trümmern, ein Schreiben, das sich aus einem Trümmerfeld freischaufelte. Heute ist es eine viel stärkere Haltung der Bejahung, aus der ich schreibe. Es ist meistens das Staunen über etwas, das ist, und nicht die Verzweiflung über das, was fehlt.
Bernig: Dieser Prozess lässt sich in deinen drei Gedichtbänden nachvollziehen. Zunächst ist da – im ersten Band – das Schreiben auf Trümmern als ein Schutz, als Abwehr und als Selbsterhaltung. Das wandelt sich derart, dass du im letzten Gedichtband völlig bejahend einen Zyklus schreiben kannst, in dem das lyrische Ich in einem Garten steht. Hat das mit deinem Theologiestudium zu tun, oder liegt es vielmehr schlicht daran, dass man älter wird?
Lehnert: Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Ich bin ein gläubiger Mensch, doch mit dem Theologiestudium hat das erst einmal gar nicht so viel zu tun. Glaube ist übrigens ja auch keine Haltung, die eine Weltbejahung zwangsläufig in sich trägt. Glaube ist auch nichts, was einem das Leben erleichtert, gar nicht. Er stellt mehr Fragen als er beantwortet, er ist manchmal eher eine Erschwerung des Lebens. Von daher weiß ich nicht, ob diese Verbindung nicht zu kurz gezogen ist.
Bernig: In deinem letzten Gedichtband finden sich Choralbearbeitungen. Siehst du dich in einer Nachfolgeschaft zu Paul Gerhardt, Paul Fleming, Angelus Silesius, oder waren es einfach nur die wunderbaren Melodien ihrer Choräle, die dich angesprochen haben?
Lehnert: An denen habe ich inzwischen weitergearbeitet! Ich lese das oft, „Nachfahre der Mystik“. Da ist sicher etwas dran. Obwohl in dem Begriff des Nachfahren ja schon die Behauptung steckt, etwas sei vergangen. Aber ich empfinde das auch als sehr einengend. Natürlich, das Denken der christlichen Mystiker prägt mich. Juan de la Cruz zum Beispiel oder Meister Eckhart sind für mich ganz wichtige Denker, auch Augustinus. Aber mich in eine Nachfolgerschaft zu stellen, das kann ich gar nicht tun. Das ist etwas, was nicht in der eigenen Hand liegt. Die Choralmelodien faszinierten mich einfach. Ich erlebe im gottesdienstlichen Singen, wie zeitfremd die Texte zu diesen alten Melodien oft sind. Zeitfremd meine ich gar nicht negativ, sie erweisen sich ja auch als zeitresistent, wirken auch noch heute sehr schön, aber sie sind oft nur noch verständlich mit einem Fußnotenapparat. Es sind so viele Anspielungen darin, die heute niemand mehr versteht. Ich habe Kontrafakturen dazu geschrieben.
Bernig: Ich habe das auch so verstanden. Du verbindest die alten Formen und Melodien mit einer gegenwärtigen Bildwelt. Nun ruhen alle Wälder ist wunderschön, aber tatsächlich sind heute viele Strophen nur noch mit Erklärungen verständlich. Du hast eine heutige Bildwelt eingebracht.
Lehnert: Genau. Meine Texte sind ja keine religiösen Choräle im engeren Sinne. Sie könnten in keinem Gesangbuch stehen. Es ist keine christliche Gebrauchslyrik. Es sind einfach Gedichte mit dem Klang einer Musik im Hintergrund. Ich will diese alten Choräle auch nicht ersetzen. Ich habe einmal für die Glockenweihe der Frauenkirche Texte geschrieben, die in ein Gesangbuch passen könnten. Hier ist es einfach die Faszination der Melodien.
Bernig: In deiner Dankesrede zum Lessing-Förderpreis 2003 beklagtest du, dass es im deutschen Sprachraum – anders als im angelsächsischen – „so gut wie keine Tradition religiöser Lyrik in der Moderne“ gebe. Ist nach den brachialen Säkularisierungen im 20. Jahrhundert eine Revitalisierung religiösen Sprechens in der Lyrik möglich?
Lehnert: Es wird ja immer wieder über die Wiederkehr der Religion geredet. Wenn man sich die Phänomene genauer anschaut, auf die sich diese These bezieht, kann ich das nicht teilen. Das Papstbegräbnis z.B. oder der Weltjugendtag. Die Krise der Religionen in Mitteleuropa, ich sage das bewusst im Plural, ist so tief, dass sich da im Laufe von 100 Jahren sicher nichts wirklich verändern wird. Es ist ein Entfremdungsprozess, der tief in die Mentalität eingreift – er ist nicht so leicht zu revidieren. Die Krise der Religion spiegelt sich auch darin, dass in Deutschland fast die gesamte sprachlich kreative Intelligenz aus der Kirche ausgewandert ist. Ich kann auch keine Rückkehr von religiösen Themen in der Literatur beobachten. Es gab hier und da immer Texte, die eine religiöse Dimension besitzen, das liegt meines Erachtens in der Natur der Dichtung und beschreibt eine heimliche Sehnsucht, aber dass das jetzt eine Revitalisierung wäre, kann ich nicht sagen. Im englischsprachigen Raum gibt es eine durchgängige Tradition religiöser Lyrik, im deutschsprachigen Raum nicht. Sie ist spätestens im 20. Jahrhundert abgebrochen. Es gibt religiöse Gebrauchsdichter und hier und da vielleicht einen Einzelnen, der darüber hinausragt, aber von einer Tradition kann man nicht sprechen.
Bernig: Es ist schwierig, einen Anknüpfungspunkt zu finden… Mir fällt spontan Heine ein, der jedoch auch kein unproblematisches Verhältnis zur Religion pflegte…
Lehnert: Rilke, der späte Benn, Konrad Weiss – ein großer Dichter, der leider fast vergessen ist – aber es sind Einzelne…
Bernig: Ein wesentliches Moment für dein Schreiben scheint mir die Angst vor Vereinzelung, vor Sprachverlust zu sein. Als Indizien möchte ich zwei Gedichte anführen. In „Der Pfarrer“ heißt es: „Ich begegne niemandem. / Ich begegne niemandem“, wohingegen im Gedicht „Autor“ hastig gesprochen wird: „Ich spreche Wörter nach, schnell, um nicht zu verstummen. / Nur nicht schweigen, / nur nicht Futter werden.“ Sind damit die Umkehrpunkte des Pendels markiert?
Lehnert: Ja, das sind zwei Extrempunkte. Im Grunde sind es zwei Reaktionen auf dieselbe Erfahrung. Ich bin kein Vielschreiber, ich schreibe relativ wenig, ich schreibe dann, wenn ich verunsichert über etwas bin, seien es Stimmungen. Schreiben ist für mich in der Regel ein Wiederzusammensetzen von Wirklichkeit, vielleicht auch eine Ordnungssuche, deshalb spielen Formen für mich eine so große Rolle. Ich schreibe nicht mit einem Programm, fast nie mit Ideen im Hintergrund, sondern fast immer ausgehend von Klängen. Am Anfang steht ein Ahnungsraum, ein Klangraum, der noch nicht Wort geworden ist.
Bernig: Es finden sich bei dir immer wieder Zyklen. Wenn sie keiner Programmatik geschuldet sind, dann entstehen sie, weil ein Raum mit einem Gedicht noch nicht ausgefüllt ist?
Lehnert: Ich nehme mir fast nie Zyklen vor, und es werden immer Zyklen. Ja, es ist ein Raum. Das eine Gedicht ist fertig, es steht da, ich denke es ist okay, aber es ist noch nicht alles Gestalt geworden. Das Gedicht erscheint plötzlich wie ein erster Markierungspunkt einer Fläche. Es hat etwas eröffnet, was es selbst nicht bannen kann. Ein zweites Gedicht tritt hinzu, und dann setzt sich das in Gang. Manchmal entstehen fast so etwas wie Erzählstränge, ein andermal sind es ähnliche Stimmungslagen, die in verschiedenen Nuancen auftauchen.
Bernig: Ich greife das Stichwort „Erzählstrang“ auf, das mir gerade beim Lesen deines Zyklus „Warten aller Augen (Begegnungen)“ durch den Kopf gegangen ist. Andere schreiben mit einem solchen Ansatz und mit Konstellationen wie in diesem Zyklus einen Roman…
Lehnert: Ich habe in diesem Zyklus von Porträtskizzen zwei Motive umkreist: das Schweigen und die Leere. Sie gehen mir nach, Du findest sie in meinen Texten immer wieder. Die Leere ist eine Dauererfahrung für mich: sowohl in unseren Kirchen, in der Religion, in der Kultur als auch in meiner Lebenswirklichkeit, eine Entleerung von den wichtigsten Dingen, die der Mensch braucht. Gleichzeitig erlebe ich Leere als eine sehr produktive Kraft, weil die Leere, das Schweigen, der Ursprung dessen ist, was wird. Nur in der Leere kann sich etwas ereignen. Das ist ihre Ambivalenz. Deshalb ist für mich das Schweigen sehr wichtig. Aus dem Schweigen entsteht die Sprache. Zum anderen: dieses gehetzte Ansprechen gegen das Gefühl, dass mir alles aus den Händen gleitet, dass ich nichts mehr überschaue, dass ich nichts mehr einordnen kann, dass so viel auf mich einstürzt, dass ich es nicht bewältigen kann. Das ist die andere Reaktion, Ruhe und Gehetztheit, Leere und Reizsucht.
Bernig: So habe ich es beim Lesen empfunden. Etwas sprachlich fassbar zu machen, fassbar im Sinne von festhalten. Das gelingt natürlich nicht immer. Wir haben ja auch Angst davor, dieses kleine, kleine Mittel, das man da hat, schließlich auch noch zu verlieren.
Lehnert: Das ist ja auch die Angst des Lyrikers, die ein Prosaautor vielleicht nicht so deutlich kennt: die Angst vor dem leeren Blatt. Das leere Blatt ist die vergegenständlichte Leere, das vergegenständlichte Nichts. Das, woraus alles werden kann. Vor dem stehen wir immer wieder. Der Prosaautor ist von einem Fluss erfasst. Er muss natürlich genauso immer wieder kreativ werden und hat es nicht in der Hand und weiß nicht, wo die Stränge hinlaufen. Aber dass der Schaffensprozess etwas mit der Angst vor dem Nichts zu tun hat, ist im Gedicht doch stärker und dauernd präsent.
Bernig: Ich glaube, das Gedicht an sich braucht diesen Hintergrund. Das Nichts, vor dem erst sich das Gedicht als etwas aufbauen kann… In deinen Texten überlagern sich oftmals verschiedene Zeiten und historisch überformte Landschaften zu Landschaftsgebilden mit einer weit ausgreifenden Weltbetrachtung. Die poetischen Zeitschichten, die du entwickelst, erinnern mich an die Studien von Jan und Aleida Assmann oder von Reinhart Koselleck und seine im historischen Kontext verankerten Zeitschichtenmodelle. Einerseits findet sich in deinen Gedichten das Hiesige, das Jetzig-Vergehende, andererseits das Ferne oder Vergangen-Gegenwärtige. Einerseits finden sich in deinen Gedichten Orte in Dresden – „marienbrücke“, „heidefriedhof“, „13. februar, 91“ u.a. – bzw. das Müglitztal, andererseits Spanien oder der Sinai. Sind Regionalität und Identität im oben erwähnten Kontext für dich Sedimentationen mit poetischen Folgen? Sedimentiert sich das für dich in deinen Gedichten?
Lehnert: Ich verstehe worauf du hinaus willst. Der Ort, an dem ich lebe, hat ja eine andere Ferne und Nähe zu anderen Orten als die Weltkarte uns das vorgibt. Zum Beispiel ist Jerusalem als eine sehr ferne Stadt ein Teil des Gedächtnisnes, an dem ich lebe. Santiago de Compostela gehört da ebenso hinein – der Jakobsweg zieht sich ja übrigens auch mitten durch Sachsen. Und auch der Sinai gehört dazu. Von daher ist der Sprung in die Ferne gar nicht so groß wie er auf den ersten Blick erscheint. Meine Gedichte sind in aller Regel verortet, es sind Texte, die sich in einem bestimmten, meist benannten Raum bewegen und in diesem Raum treten Tiefenschichten zutage. Sagen wir besser „Grabung“. Meine Gedichte sind oft Grabungen an einem bestimmten Ort, Grabungen, die Straßen öffnen, die weder räumlich noch zeitlich eindeutig sind.
Bernig: Deswegen erwähnte ich die Zeitschichten. Wobei diese Zeitschichten – ganz wie geologische Schichtungen – Verwerfungen unterzogen sein können, es liegt ja nicht immer alles schön chronologisch geordnet eins auf dem anderen. Mit diesen Gedanken habe ich deine Gedichte gelesen und mich gefragt, ob du über Dresden oder das Müglitztal nur aus dieser Perspektive schreiben kannst.
Lehnert: Mich interessiert die Schichtung eines Ortes und die Art, wie sich Geschichte, Landschaft und Mythos vermischen. Selbst bei einem Gedicht wie dem zum Hochwasser interessiert mich am meistens das, was das Hochwasser herausspült. Zumal alles andere ja von den Medien sofort besetzt, ausgeschlachtet und zerredet wurde. Meine Texte sind fast immer verortet, und ich bin – glaube ich – dennoch kein regionaler Dichter. Regionalität hat für mich nur in der Form Wert, wenn sie in aller Konzentration einen weiten Horizont hat. Für mich haben die verschiedenen Orte an denen ich gelebt habe, nie eine solche Bindung entwickelt, das sie mich völlig gefangen genommen haben. Wenn ich woanders wohnen würde, würden sich meine Texte an einem anderen Ort bewegen, wenngleich sich die Texte dann vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden würden, weil es ja auf ihre Blickrichtung ankommt.
Bernig: In dem Zyklus „Ich werde sehen, schweigen, hören“ im gleichnamigen Gedichtband finden sich „Gedichte aus einem Garten“. Für mich evoziert dieser Zyklus das Gefühl von Einkehr aber auch Heimkehr. Ist das eine logische Fortschreibung der Zeile: „Wir denken über das Gewöhnliche nach“ aus dem Band Der Augen Aufgang? Kehrt da ein poetologischer Ansatz von dir wieder und wird auf den Galten übertragen?
Lehnert: Sicherlich. Vielleicht gibt es da eine Linie. Das können andere sicher besser erkennen als ich selbst. Diese Gedichte sind entstanden, als ich aus Spanien zurückgekommen bin, wo ich fast zwei Jahre gelebt habe. Es war schon ein Buchstabieren, eine neue Ortfindung, das Buchstabieren eines Raumes, in dem ich jetzt zu Hause bin, in einem kleinen Dorf. Ansonsten sind diese Gedichte – du sagst „Einkehr“ –, es sind Gedichte, die einen doppelten Blickwinkel haben. Sie spiegeln ein Sehen in die Nähe, ein Sehen nach außen, und gleichzeitig ein Sehen nach innen. Es ist im Grunde genommen eine wechselseitige Spiegelung. Das lateinische Wort dafür ist „contemplatio“, und das hat vielleicht mit Einkehr gar nicht so viel zu tun, sondern viel mehr mit Öffnung, mit Öffnung für das, was ist.
Bernig: Der Garten als ein Ur-Mythos und die Möglichkeit, sich zu öffnen?
Lehnert: Dadurch dass diese Gedichte einen Garten begehen, haben sie an der Oberfläche vielleicht etwas Ländlich-Idyllisches, fast Insuläres, wo doch etwa rund um den Galten eine Autobahn gebaut wird. Ich hätte das theoretisch auch über ganz andere Dinge schreiben können. Wenn ich in der Stadt gelebt hätte, hätte ich vielleicht ganz ähnliche Gedichte über die Papierkörbe und die Pflastersteine geschrieben. Das sind einfach Nahaufnahmen einer Umgebung, die vor allem darauf blicken, wie ich sie aufnehme, wie ich sie sehe, wie ich sie wahrnehme. In diesen Gedichten finden sich ja auch ganz viele mythische Motive, die das Sehen vorstrukturieren…
Aus Deutsche Bücher, Heft 2, 2006
Michael Braun: Im Klanggewölbe der Mystik. Die Gedichte des Christian Lehnert
Jessica Brautzsch im Interview mit Christian Lehnert: „Ich sehe ihren Glanz“
Otto Friedrich im Gespräch mit Christian Lehnert: „Hineinsprechen in das Ungesagte“
Richard Kämmerlings: „Schreiben gehört zu den vorletzten Dingen“
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 5.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 1 von 4: „Die weggeworfene Leiter. Erste Gedanken eines Dichters zu einer religiösen Sprachlehre“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 26.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 2 von 4: „Das Kreuz. Vom Verlöschen der Sprache im Herzen des Christentums“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 10.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 3 von 4: „Fröhliche Urständ. Gedanken zur Sprache als Schöpfungsgestalt“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 24.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 4 von 4: „Atem“.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG
Porträtgalerie: IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Dichter im Porträt: Christian Lehnert.


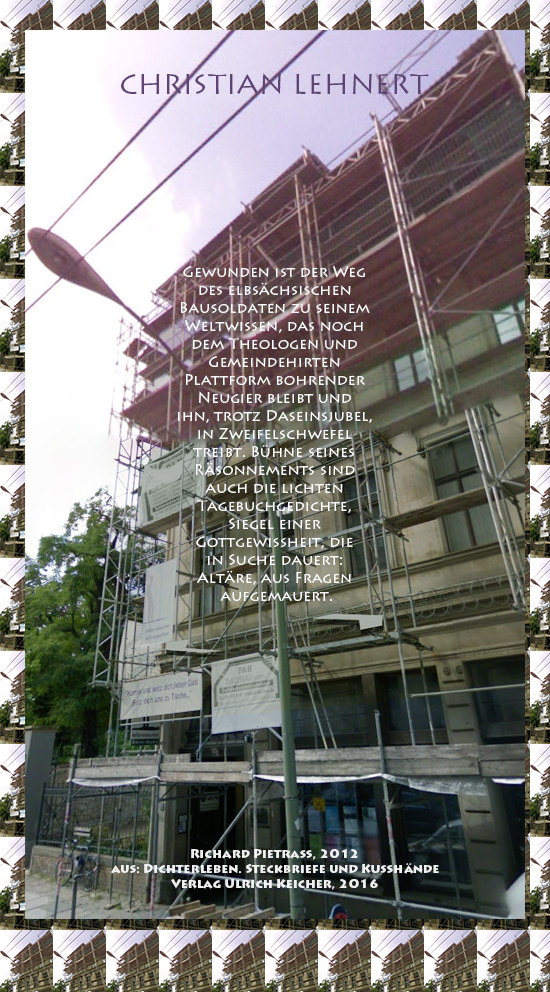












Schreibe einen Kommentar