Christian Lehnert: Windzüge
IM TURMZIMMER
Hatte es nicht geheißen: Seide und Blei?
Nämlich das Schwere zu fühlen und die genaue
Richtung zur Mitte? Hier ist kein Schatten
zum Körper, genau senkrecht fällt das Licht
auf einen Ort, der nach keinem Betrachter verlangt.
Auge, sagte man, Kammer: Wohin denn ich?
Nicht das ich sehe, ist das Geheimnis,
sondern daß sich mir zeigt, was will,
der stockende Fluß und die Schwäne. Aber
wollen sie? Oder stehen sie gegen das Licht?
Worauf lohnte zu warten? Stille. Dabei hatte ich doch
längst aufgegeben, ein Ganzes zu suchen,
aber Einklang war immer, und ich hörte allerorten
Resonanz, gar im Dielenknarren,
als ich ging, und Gehen, dieser halbbewußte
Zustand ist zwar endgültig, aber kein Ende.
In der kompakten Form
acht- und zwölfzeiliger Gedichte hatte Christian Lehnert seine „Pneumatologie“ einer spirituellen Naturerfahrung zuletzt verdichtet (Aufkommender Atem, 2011), und mit derselben Form setzt er in seinem neuen, sechsten Gedichtband wieder an. Konsequent aber wächst die Form diesmal gegen die minimalistische Verdichtung auf, über Sonette hin zu dynamischen Zeilen und Strophen voll hexametrischer Rhythmen. Die Weitung der Form bedeutet zugleich eine Annäherung an größere Formationen der Wirklichkeit. Das Gedicht bewegt sich über die Erfahrung von Landschaft und Kulturnatur zielstrebig hinaus, arbeitet sich auf Schotter und Gleisen voran, passiert Transportmittel, Maschinenparks, Depots und Halden, durchquert Brachen und steuert durch Kanäle und Schleusen in Richtung eines vorerst imaginär bleibenden Stadtkerns. Wie die Mitte selbst aber erreichen? In einer Coda reißt Lehnert diese Frage mit drei Langgedichten zu drei Worten Martin Luthers als Sprachproblem auf: Dichtung als ein unablässiges Ringen um solche Worte und damit um den Zugang zur Mitte – ein unabschließbarer Versuch, doch ermutigt durch den festgegründeten Satz:
Solange ich Atem hole, ist Zeit.
Flugbahn ohne Gewissheit
– Der Theologe Christian Lehnert hat sich vorgenommen, die Tradition der geistlichen Dichtung zu erneuern – sein neuer Band Windzüge zeigt, wie schwierig es ist, Gott anzurufen. –
Die geistliche Dichtung befindet sich in keinem guten Zustand, wer bestritte es? Nimmt man ein Gesangbuch der beiden großen Kirchen zur Hand, stellt man fest, dass die Kirchenlieder aus dem 18. Jahrhundert schwächer sind als die aus dem 17., die aus dem 19. schwächer als die aus dem 18., die aus dem 20. schwächer als die aus dem 19. (Das 21. Jahrhundert scheint es völlig aufgegeben zu haben.). Jene Gattung, die es als ihre edelste Aufgabe betrachtet, Gott die Ehre zu geben, scheint je länger desto weniger noch ernsthafte Autoren anzuziehen. Die Theologie predigt vielleicht noch, aber sie dichtet nicht mehr.
Außer in Gestalt von Christian Lehnert, der 1969 in Dresden geboren wurde und bis heute in Sachsen verwurzelt ist. Der Klappentext stellt ihn vor als Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts an der Universität Leipzig und, außer als Lyriker, Verfasser eines bei Suhrkamp verlegten Essays über den Apostel Paulus mit dem Titel „Korinthische Brocken“.
Ob das klappt? Der Leser steigt in den Band Windzüge durchaus nicht unvoreingenommen ein, sondern hin- und hergerissen von dem Vorurteil, das müsse doch unbedingt schief gehen, und dem Wunsch, es möge noch einmal gelingen. Denn insgeheim sehnen sich viele, selbst unter ihren Verächtern, nach einem neuen starken Auftritt der christlichen Religion, die sich im Mund ihrer Verkündiger heute oft ausnimmt wie eine deutlich unter Wert gehandelte Aktie.
Lehnert weiß es, welch übermächtiger Tradition, die seit dreihundert Jahren nicht mehr wirklich fruchtbar geworden ist, er sich überantwortet, und er schreckt vor diesem Zeitenabgrund nicht zurück.
Der Gott, den es nicht gibt, ist mir ein dunkler Riß,
ist meiner Seele nah, sooft ich ihn vermiß.
Ist das wirklich Lehnert im Jahr 2015? Es klingt vollkommen wie der barocke evangelische Mystiker Angelus Silesius.
Gott, der einst so große und präsente, entzieht sich heute seiner Anrufung. Sicher, der deus absconditus, der verborgene Gott ist in der modernen Theologie zum Gemeinplatz geworden, und man kann es sich sogar bequem damit machen, wie wenn der Chef des Hauses auf Dienstreise ist. Aber ein solcher Gott hat jedenfalls nichts mehr zu verheißen.
Mit einem Satz hockt bei den Pfählen
ein Gott, der hungert. Lächelt er?
Verunsichert? Kann nicht erzählen,
was gestern war, die Kurzzeit: leer?
Ein Gott, der hungert, bietet höchstens noch den Trost des Schicksalsgenossen. Und selbst wer daran erinnert, dass Gott immerhin in einem Stall zur Welt kam, stolpert doch über dieses ganz und gar menschlich-zeitgenössische „verunsichert“. Gott darf arm und ohnmächtig sein – aber verunsichert wie ein frustrierter Normalbürger, der auf therapeutischem Weg wieder zum Funktionieren gebracht werden soll? Das wohl eher nicht.
Der sich entziehende Gott wirft für den Dichter nicht zuletzt ein Formproblem auf. Wie von dem reden, was nicht da ist, ja nicht einmal recht vorstellbar – einem Phantomschmerz? Lehnert greift hier zur Reaktivierung altbewährter Muster, des Reims, des Sonetts und anderer Formen. Aber er fühlt, dass sie heute in ihrer klassischen Reinheit nicht mehr zu gebrauchen sind, und baut kleine Rauheiten oder Sprünge ein; er spielt sie „dirty“ wie einen Blues. Dann reimt sich „Körper“ auf „Gestöber“, oder vielmehr, es reimt sich eben nicht, sondern liegt um den ausdrucksvollen Viertelton daneben.
Und doch, dieser Eindruck bleibt der vorherrschende, geht hier allzu vieles allzu glatt von der Hand. Bibelstellen haben ihren erwartbaren Auftritt, die Naturlyrik ist machtvoll mit Bibernellen und Schwarzpappeln zur Stelle, Rilke in seinen verschiedenen Werksphasen übt erheblichen Einfluss aus; und von ihm ebenso wie von den christlichen Mystikern schreibt sich die Konvention des eigentlich Unsagbaren her, die Lehnert zuweilen zu etwas verleitet, was ein Lyriker niemals tun sollte: seine Strophen und Gedichte mit drei Pünktchen zu beenden…
Eines der längsten Stücke trägt den Titel „Die Mücken“.
Sinkende Sonne, die Schwärme tanzen wirr und beharrlich,
reine Gedanken, zufällig wie eine ,beste der Welten‘,
immer bedürftig nach fremdem Blut. Das Hiesige fasst sie
niemals, sie schwinden und steigen,
Flugbahnen ohne Gewissheit.
Das scheint doch sehr übertrieben. Nicht nur wird hier überschätzt, was so ’ne Mücke maximal hinkriegt, speziell im Spirituellen; sondern auch der von den olympischen Göttern erborgte Hexameter donnergrollt gewaltig fehl am Platze. Ohne Zweifel, der Lyriker Lehnert kann was; aber er findet nicht die Objekte, die seinem Können den nötigen Widerstand des Neuen entgegensetzen. Und so bleibt ihm nichts übrig, als aus einer Mücke teils einen Elefanten, teils einen Engel zu machen.
Burkhard Müller, Süddeutsche Zeitung, 7.7.2015
Meditation als literarisches Heilmittel
– Der sächsische Lyriker Christian Lehnert legt siebten Gedichtband vor. –
„Ich mache keine Worte mehr. / Es gibt genug“, heißt es in einer von Christian Lehnerts neuen Strophen. Dieses Kokettieren des gebürtigen Dresdners mit dem Verstummen wiederholt sich bei modernen Lyrikern gebetsmühlenartig. Dahinter verbirgt sich Ohnmacht angesichts der durch Reizüberflutung kaum noch greifbaren Realität.
Gegen die Orientierungslosigkeit des heutigen Menschen führt Lehnert die Meditation als literarisches Heilmittel ins Feld. Der ehemalige Pfarrer, der inzwischen das Liturgiewissenschaftliche Institut der Universität Leipzig leitet, bringt dabei ganz legitim christliche Aspekte ins Spiel:
Wie mich hüllt in stiller Scheu
Gottes Aug, eh ich gedacht,
fasst es mich, in klarer Nacht,
lang dem Blindgebornen treu.
Doch Lehnert meidet die Rolle des Missionars. Verblüffend ist, dass er den holländischen Philosophen Baruch de Spinoza zitiert, der als Verfechter der These „Gott = Natur“ gilt. Ins Auge sticht darüber hinaus, dass seine Strophen spröder anmuten als früher. Obwohl er die Form des Sonetts bemüht, vermag er die harmonische Kraft dieses strukturierten Typs von Poesie nicht auszuschöpfen.
Mit Widmungen geht Lehnert sparsam um. Einige Verse eignet er dem Komponisten Hans Werner Henze zu, andere dem ehemaligen Sinn und Form-Chefredakteur Sebastian Kleinschmidt. Auch dem Kollegen Wulf Kirsten erweist er die Ehre. Wie nahe er sich diesem Rhapsoden mitteldeutscher Gefilde fühlt, bezeugt die Wahl seiner Metaphern. Plastisch beschwört er das Bild herbstlicher Äcker herauf:
Die Felder aufgepflügt, die Landschaft flockt
wie dunkler Weinstein aus.
Dann wieder schwärmt er von Pappelblättern, die „leuchten wie ein Schrei, / gewendet in die Klarheit, immer höher / ins Blau, den Nachtgrund, immer höher / ins Silbergrau bis nichts mehr sichtbar sei // als Streuungen.“ Doch Lehnert ist kein weltfremder Ästhetizist, er wohnt gedanklich im Hier und Jetzt:
Schon der erste Schritt auf Rolltreppengrund, wenn die dichten
Stahlrippen passgenau sich heben, gemächlich zur Schräge,
lässt die eigenen Glieder, im Einklang mit der Maschine,
laufen und schlafen.
Trotz hohen sprachlichen Niveaus erscheint Lehnerts siebter Gedichtband als Spiegelung einer Schaffenskrise. Der Autor irrlichtert darin zwischen verschiedenen Inhalten und Formen umher, er wirkt zuweilen unsicher, hadert mit sich selbst. Womöglich muss er sich hart von bisherigen künstlerischen Konzepten verabschieden. Eine Morgenröte in dieser Richtung deutet sich im Zyklus „Aus dem Bergwerk“ an, der die Sammlung beschließt. Darin beschäftigt sich Lehnert ganz unorthodox mit dem Schicksal Martin Luthers, vor allem in dem Intermezzo über Thomas Müntzer:
Was für ein Licht, die eisige Sonne und tief darin
der Nieselregen!
Licht, das die Birkenstämme gleißen lässt
und wie ein süßer Nachgeschmack die Zunge überwältigt,
zinkweiß!
Hier entfaltet sich ein Stil, der an Friedrich Nietzsches Dithyramben heranreicht.
Ulf Heise, Freie Presse, 19.8.2015
Beglaubigung des Landes
– Kann man heute noch christliche Lyrik schreiben? Christian Lehnert feiert die Schöpfung und begegnet Engeln auf der Autobahn. –
Noch immer gibt es Dichter, die sich dem Mystischen zuwenden – der auslaufenden Moderne mit ihrer konkreten Zeichenhaftigkeit zum Trotz. Auch der Allesschlucker Postmoderne lässt sie kalt, erst recht die experimentelle Multimedia-Poesie. Ein „Cursor zwischen Zeichen“ („Strandgang“) will Christian Lehnert nicht sein. Er meditiert über das Geheimnis allen Seins. Er hält inne im schnellen Wechsel von Phänomenen der äußeren Welt, die – kaum dass sie entstanden sind – schon wieder vergessen werden. Lehnerts Verse sind dem Dunklen und Rätselhaften gewidmet, das sich rationaler Deutung entzieht. Damit ist er nicht allein. Die lyrische Pilgerschar auf dem Weg zum Geheimnis wird angeführt von Les Murray, einem Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Der Australier hisst die poetologische Flagge mit seiner Behauptung:
Religionen sind Gedichte. Sie bringen
unseren Tages- und Traumgeist in Einklang,
unsere Gefühle, Instinkte,
den Atem…
Von Atem, Hauch und Wind ist in Gedichten Christian Lehnerts häufig die Rede. Dabei hat der Pneumatiker sowohl die konkreten Naturerscheinungen als auch die tradierten Metaphern, vor allem aber den Heiligen Geist der christlichen Glaubenslehre im Sinn. „Eines ist, in die Nacht zu rasen – ein anderes schauen, was die Nacht bewegt“ heißt es in seinem Gedicht „Angelus“. Atemlos durch die Nacht rennt hier niemand, denn: „Atemnot leert das Bewusstsein“, weiß Lehnerts Gedicht „Seefahrt“.
Christian Lehnert ist ein gläubiger Denker. Er kennt sich aus in christlicher, jüdischer und muslimischer Religion. Der 1969 in Dresden geborene Dichter und evangelische Theologe hat unter anderem an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert und seit 1997 große zyklische Gedichte und Sonette veröffentlicht, zuletzt „Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus“. In Windzüge kommt er als Nachfahre des Angelus Silesius daher, jenes christlichen Poeten des 17. Jahrhunderts, dessen Epigramme aus dem „Cherubinischen Wandersmann“ heute fast in Vergessenheit geraten sind. Christian Lehnert frischt unser kulturelles Gedächtnis auf – nicht im verstaubten stillen Kämmerlein, sondern unterwegs, auf der Autobahn, wo ihm Angelus, der Engel, im Aufprall erscheint.
Auch im siebten Gedichtband von Christian Lehnert grundieren die Worte Gott, Seele, Gnade und Glaube die Verse. Gesten des Gebets und der Anrufung stellen die Verbindung zwischen der Alltagsexistenz des lyrischen Ich und imaginiertem Schöpfer her. Das Ich spricht von Auferstehung und die Stimme der Natur lobpreist:
Dem Gott sei Ehre für die dunklen Schwingen
Für Unzählbarkeit und das Misslingen
Nun ja, so reimen die Perlmuttfalter im gleichnamigen Gedicht. Der Natur wird hier allerhand zugemutet. Aus der Sicht des Theologen ist das legitim und verdient Respekt. Aber poetische Substanz zeigt sich immer dort, wo sich Lehnerts Gedankenlyrik aus dem puren Dienst der Verkündigung befreit und zu überraschend suggestiven Sprachbildern findet, etwa wenn er metaphorisch „das Schiffchen Wirklichkeit“ auf „Brachen“ schaukeln lässt oder Fundstücke auf der „blanken Plane der Erinnerung“ sondiert. Wo er Widersprüche in Sentenzen zusammenzurrt, ist er ein Meister: „Ganz sind nur die vielen Scherben“ oder: „Was ich entbehre, hüllt mich ein“.
Einst wanderte er zu den heiligen Orten des Christentums, des Judentums und der Muslime. Emphatisch entwarf er Urszenen, beschwor Visionen des animalisch Ursprünglichen und planetarische Urkräfte der Natur. In seinem neuen Lyrikband klingt seine Stimme gedämpfter, entspannter, manchmal sogar lapidar. Frei nach Goethe heißt es sogar: „Nichts zu suchen steht mir im Sinn“ („Der Holzweg“). In nahen Landschaften widerfahren ihm Epiphanien als Wärme, Verlässlichkeit, Glanz und als Glück des „Ganz-bei-sich-Seins“. Das ist Dichtung, die aus dem Bewusstsein eines tiefen Eingebundenseins aller Natur in göttliche Schöpfung kommt – ein Sonderfall in der zeitgenössischen Lyrik. Bemerkenswert auch die Musikalität der Verse und die Formenvielfalt – vom prägnanten Zweizeiler bis zum szenisch und dialogisch angelegten Zyklus, vom freien Vers bis zum Sonett. Reime und Hexameter aller Orten. Permanente Fragegesten sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit des Lesers in den fließenden Harmonien erhalten bleibt. Wäre da nicht manchmal eine Inflation von Wie-Vergleichen, läse man die Gedichte mit reinem Vergnügen.
Wie man Widersprüchliches in metaphorisch geschlossenen und zugleich deutungsoffenen Sprachbildern festhält, hat Lehnert zweifellos bei Peter Huchel und Johannes Bobrowski gelernt, jenen großen christlich motivierten Naturdichtern und Sprachmagiern, die dem im Osten Deutschlands aufgewachsenen Lehnert Lektüreerlebnis waren. Auf Bobrowskis sinnliche Rede zwischen „Windgesträuch“ und „Wasserwind“ antworten Lehnerts Windzüge. Wie Bobrowski baut Lehnert ein beunruhigendes Spannungsfeld aus faszinierend schönen Landschafts- und Naturbildern einerseits und zerstörerischen Spuren des Menschen andererseits auf – eine in sich stimmige Verbindung aus arkadischem Schimmer und Zerstörung. Auch die Ödnis der zerklüfteten Landschaft des Braunkohlentagebaus in der Lausitz ist ihm ein Gedicht wert: „Neuseenland“ – eine nicht durch Hass, sondern durch Ausbeutung verheerte Welt. Lehnert ist ein Moralist, Schuld Ingredienz seiner Verse.
Das ist vor allem in Gedichten mit geschichtlicher Thematik spürbar, die Verse thematisieren Kampf, Terror und Mord. In „Jetzt lasst mich reden: Unser Heil“ lässt Lehnert einen entfesselten und pervertierten, terroristischen Mob sprechen: „Wir bieten Judenasche feil, / wir verbrennen Kirchenschätze“ – eine Tatsache, die den Beobachter der Verbrechen so ratlos zurücklässt, dass ihm der „erträgliche Satzbau“ zerbricht. Gott antwortet dem Verzweifelten nicht. Unheilvolle Geschichte bringt Lehnert in „Bei der Seherin“ zur Sprache, einem Gedicht, das ins Szenische gleitet. Es erinnert an menschliche Schicksale während der Naziherrschaft, in Krieg und Nachkrieg. Wörtliche Rede macht den Text authentisch:
Vater kam heim, nur Knochen, in einem blaugrauen Anzug.
umerzogen in Buchenwald
Eine Rede aus „Schmerzen und Narben“, die von Bombenkratern und „brennender Strömung“, dem Dresdner Feuersturm weiß. Sie klingt überzeugend dokumentarisch.
Zu den interessantesten Gedichten gehört „Deutschland liegt am Meer“, das auf Ingeborg Bachmanns „Böhmen liegt am Meer“ anspielt. Wie Bachmann zieht Lehnert eine (vorläufige) Lebensbilanz, die zugleich eine politische ist. Darin ist von Glauben und Hoffen die Rede. „Das Land, wer glaubt es noch? Wer hofft noch, ist an Land?“ fragt der Autor und hört „den Wind in Böen bellen“ – eine martialische Akustik. „Kein Land, kein Grund, wo Deutschland sei“ heißt der resignative Schluss. Die Negation aber enthält eine Utopie. Lehnerts Utopia ist nicht nur ein Utopia der Sprache; es bewahrt humanes Vermächtnis.
Obwohl Christian Lehnert die reine Naturbetrachtung liebt und die Schönheit und Vollkommenheit von Flora und Fauna besingt, geht er in seinen Versen letztlich durch eine Welt der Leere, des Hungers und des fehlenden Maßes. Er nennt es „Graufraß“ in „Nur die Maschinen sind noch wach“ und „Zahlwesen“ in „Stille“. Die melodiöse Innerlichkeit und die an Rilke erinnernden Visionen der „erhabenen Welt“ mit Engeln und pfingstlichem Atem gehen mit dem Benennen von Zeiterscheinungen eine Verbindung ein, die es sonst in der Lyrik der Gegenwart nicht gibt.
Dorothea von Törne, Die Welt, 14.3.2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Elke Engelhardt: Zweifel als Trost
fixpoetry.com, 10.3.2015
Ilka Scheidgen: Christian Lehnerts neuer Gedichtband Windzüge
theologie-und-literatur.de, 12.2.2015
Jessica Brautzsch im Interview mit Christian Lehnert: „Ich sehe ihren Glanz“
Otto Friedrich im Gespräch mit Christian Lehnert: „Hineinsprechen in das Ungesagte“
Richard Kämmerlings: „Schreiben gehört zu den vorletzten Dingen“
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 5.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 1 von 4: „Die weggeworfene Leiter. Erste Gedanken eines Dichters zu einer religiösen Sprachlehre“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 26.4.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 2 von 4: „Das Kreuz. Vom Verlöschen der Sprache im Herzen des Christentums“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 10.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 3 von 4: „Fröhliche Urständ. Gedanken zur Sprache als Schöpfungsgestalt“.
Poetikvorlesung von Christian Lehnert am 24.5.2022 an der Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. Auf der Schwelle. Von Religion und Poesie Teil 4 von 4: „Atem“.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG
Porträtgalerie: IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Dichter im Porträt: Christian Lehnert.


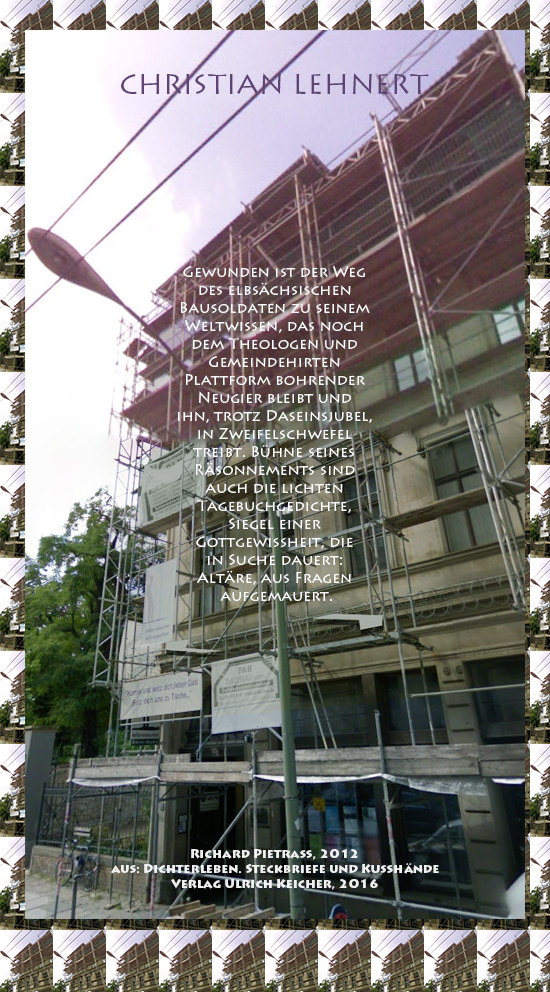












Schreibe einen Kommentar