Durs Grünbein: Den Teuren Toten
An einer unbekannten Krankheit, durch Verhexung
Starb in den Dschungeln Neu-Guineas der Gelehrte
aaaaaG.,
Ein Ethnologe alter Schule. Immer selbst vor Ort,
Verbrachte er die besten Jahre unter Eingeborenen
Am Golf von Papua. Sein Lebenswerk
War eine Studie zur Funktion von Sprache und
aaaaaMagie.
„Er wußte, daß er todgeweiht war…“, sagten Freunde,
Die seinen Mut bewunderten. Bei einer Stammesfehde
Vergeblich als Vermittler zwischen den Rivalen,
Geriet er bald in einen Hinterhalt.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAls weiße Geisel
In einem Erdloch eingesperrt, bespuckt von Kindern,
Schrieb er die bösen Flüche mit, die man ihm zuschrie
Im Ritual des Schadenzaubers, sieben Stunden lang.
In seinem Blick, im Fieber später, auf dem Sterbebett
Lag diese Urgeduld der Leguane und der Echsen.
Sein letztes Wort war „Langgasutap… langgasutap…“.
Inhalt
„Bleib stehen, Wanderer, und lies!“, riefen vor zweitausend Jahren die Grabsteine den Vorübergehenden zu. Inschriften sprachen von den Vergnügungen des Gestorbenen, von Beruf und Verdienst, Charakter und Familie. Die Persönlichkeit lebte weiter in gebundener Rede.
Heute schweigen die Eiligen allenfalls ein paar Ziffern an, über denen ein Name im Leeren verharrt, beziehungslos, entlassen aus jedem Zusammenhang. Kein Zwiegespräch mehr von Diesseits und Jenseits, keine Totengeister, die es zu beschwichtigen gilt. Das wenige, das geblieben ist, gibt sich routiniert in vergeßliche Formeln gefaßt.
Es ist lange her, daß in diesen Breiten die Toten zu sprechen aufgehört haben. Die Kulturgeschichte kennt Zeiten beredten und Zeiten stummen Gedenkens, sie kennt auch die Sprachlosigkeit und das leere Schweigen. In Kulturen, denen der Tod zum Tabu geworden ist, weil sie ihre eigene Sterblichkeit hysterisch hinter „Jetztzeit“ verbergen, ist nur mehr indirekt die Rede vom Ende. Wie der Witz nach Sigmund Freud seine Beziehung zum Unbewußten, so offenbart das Geschwätz um den Tod eine anthropologische Enttäuschung. Alles im Griff zu haben, nur „das“ nicht, muß kränkend sein für das einzige Lebewesen, das sich mit seiner Lage nicht abfinden kann. Der Effekt kann nur ein komischer sein, wo Bedauern an die Stelle von Trauer tritt. Durs Grünbein, in den letzten Jahren bekannt geworden mit seinen Gedichtbüchern Grauzone morgens (1988), Schädelbasislektion (1991) sowie Falten und Fallen (1994), zieht sich diesmal ins Halbdunkel ungewisser Autorschaft zurück. Von dort tritt er vielstimmig hervor als Philologe, Herausgeber, Nachdichter und Kompilator seiner Notizbücher.
Die 33 Epitaphe Den Teuren Toten singen das Lob der Entfremdung. Eine neue Lektion deutet sich an: Lächerlich macht sich das Leben in seiner vergeblichen Wiederkehr, sieht man es als den Reinfall des Endes. Wo gestorben wird, ohne daß man den Toten Gehör schenkt, hat Schwarzer Humor seinen Augenblick.
O Tod, wie trivial bist du
Lyrik zählt an der literarischen Börse nicht. H.M. Enzensberger hat plusminus 1354 Leser pro Lyrikband errechnet, wobei kurioserweise diese Zahl ebenso für riesige wie für winzige Länder gelten soll. Dennoch ist momentan im deutschen Literaturbetrieb ein Junglyriker everybody’s darling: Durs Grünbein lautet sein wundersamer Name. Die FAZ hat ihn zum „Götterliebling“ ausgerufen und fühlte sich durch ihn an das erste furiose Auftreten des jungen Hugo vonHofmannsthal erinnert. Preise und Stipendien ließen naturgemäß ebensowenig auf sich warten wie Einladungen zu den diversen Foren der Auffälligkeit.
Die Gunst der Stunde nutzend, schiebt der Suhrkamp Verlag, der erst in diesem Frühjahr Durs Grünbeins Gedichtband Falten und Fallen vorlegte, nur sechs Monate später ein neues Grünbein-Opus nach, das allerdings bei niemand Hofmannsthal-Assoziationen auslösen dürfte. Eher schon konnte jemand dazu Hofmannswaldau einfallen, also jener für seine poetischen Grabschriften ebenso berühmte wie berüchtigte Breslauer Barockdichter, der seine geistreich frivole und parodistische Begabung gern darauf verwandte, die Toten zu verhöhnen.
Den Teuren Toten ist Grünbeins jüngster Lyrikband betitelt. Er enthält 35 Epitaphe, in denen der junge Dresdner Dichter seinem schlesischen Ahnherrn mit kalter Spottlust nacheifert. Über diese Epitaphe dürfte keiner der in ihnen Angesprochenen Freude empfinden. Aber auch die Freude des Lesers wird sich vermutlich in Grenzen halten, zu groß ist nämlich die Diskrepanz zwischen der hohen Erwartung, die Durs Grünbein mit seinen letzten Publikationen geweckt hat, und dem niedrigen Anspruch, mit dem er sich diesmal begnügt.
Von Toten bevölkert waren Durs Grünbeins Gedichte von Anfang an, und auffällig war immer schon Grünbeins Affinität zu allem Ruinösen, Katastrophischen und Finalen. Der im verwüsteten Dresden Geborene und neben dem großen Müllplatz der Stadt Aufgewachsene empfand sich früh als Bewohner eines modernen Pompeji, „mit den Toten auf du und du“ (wie es in seinem großen Gedicht „Trigeminus“ heißt). Zustimmend zitiert er Ungaretti: „Leben ist nur Verwesung, die sich mit Illusionen schmückt.“ Totale Illusionslosigkeit ist das Programm dieses jungen Dichters, der selbst hinter der „Wärme der Haut“ noch das „Indiz für versteckte Leichen“ wittert und „dem Sterben der Ideen“ ähnlich ungerührt zuzusehen versucht wie dem Sterben der Menschen. „Was heißt schon Leben? Für alles gibt’s Ersatz“, so tönte es aus seinem in dem Band Schädelbasislektion enthaltenen Gedichtzyklus „Porträt des Künstlers als junger Grenzhund“, in dem Durs Grünbein den Menschen, gut nietzscheanisch, auf „das alphabetisierte Tier“ reduzierte und sich selbst die Jugend absprach: „Alt siehst du aus, young dog. Atomzeitalt.“
Leben, dieses „Nullsummenspiel“, schien lediglich für Zynismus gut – „nur eine Leiche nimmt das Leben schließlich leichter“ – oder für Sarkasmus. Als „Sarkast“ definierte sich Durs Grünbein dann in seinem letzten Buch Falten und Fallen selbst:
Fröstelnd unter den Masken des Wissens,
Von Unerhörtem verstört,
Traumlos am Tag unter zynischen Uhren,
Fahrplänen, Skalen, beraten
Von fröhlichen Mördern, –
So wird man Sarkast.
Das Wort Sarkast führte Grünbein auf sarkázein zurück, was sich übersetzen ließe mit „das Fleisch abschaben“ oder „die Knochen bloßlegen“ oder auch „zerfleischen“. Entsprechend negierte Grünbeins Poesie jede seelische Gestimmtheit, gesellschaftliche Bedingtheit oder metaphysische Bedürftigkeit des Menschen und packte ihn an seiner biologischen Blöße und seinem genetischen Code.
Durs Grünbeins gelegentlich von Kritikern monierte Vorliebe für medizinisches, gynäkologisches oder biologisches Vokabular, das er – ein neuer Gottfried Bennscher „Hirnhund“ (freilich nicht „schwer mit Gott behangen“, sondern aller Götter ledig) – virtuos poesiefähig zu machen verstand, entspricht konsequent der poetologischen Kursbestimmung dieses Dichters:
Zwischen Nekrophilie und Neurologie führt ihn der Weg im Zickzack durch die urbanen Gefahrenzonen…
Wer Durs Grünbeins neuen Gedichtband Den Teuren Toten zur Hand nimmt, tut gut daran, all diese Präliminarien zu vergessen, denn die Gefahrenzonen, in die sich der Dichter diesmal begibt, sind bestens bekannt aus der Rubrik „Vermischtes“ unserer Zeitungen, und Grünbein steuert auch keinen kühnen Zickzackkurs, sondern geht ganz gradlinig vor. Seine Epitaphe – auch „Berichte vom Untergang unbedeutender Menschen“ genannt – gehorchen alle demselben Gesetz, das lautet: Trivialisierung des Todes um jeden Preis. Der Sarkast zeigt sich hier weniger aufs Radikale als aufs Ridiküle fixiert und liefert den Beweis, daß zu seinen vielen Kunstfertigkeiten auch die des (mehr oder weniger gehobenen) Kalauers gehört, wie ein paar Beispiele es belegen mögen.
In Florenz erliegt ein älterer Japaner statt dem befürchteten Hitzschlag einem Kulturschock. Ein Mann, dessen Frau in der Badewanne den Heißluftstrom benutzte und dadurch umkam, erklärt der Polizei: „Die dreizehn Ehejahre waren hin wie nichts“. In Amsterdam stirbt eine Schülerin, die gerade den Titten-Test eines Nachtclubs gewann, am Genuß von viel zu kaltem Schampus. Fünf Bergarbeiter hinterm Ural betrinken sich am 1. Mai mit einigen Flaschen Methanol und stoßen, bevor sie krepieren, zunächst auf Stalin und dann auf den Zaren an. Einem deutschen Winzer, den Schulden in den Selbstmord trieben, läßt seine Frau im regionalen Fernsehen die Botschaft zukommen:
Mein lieber Mann, komm bald nach Hause, auf Dich wartet Dein Leibgericht, die Rebenernte und Dein Weib.
Man tritt dem Autor mit der Versicherung, Ähnliches am Feierabend auch selber fabrizieren zu können, hoffentlich nicht zu nahe. Der Witz dieser Epitaphe wird ja auch dadurch nicht weniger mäßig, daß Durs Grünbein in einem arg angestrengten Nachwort die Autorschaft an diesen Grabschriften einem „Pseudonymus N. 13“ unterschiebt, dessen Nachlaß er auf einem Dresdner Dachboden entdeckt haben will. Und so sicher diese Epitaphe eher grauem als schwarzem Humor entsprangen, sind sie auch keine Demonstration jener „Idiotie als Haltung“, die Durs Grünbein in einem blitzgescheiten Essay zum Thema Widerstand als die unter realsozialistischen Bedingungen bei weitem wirksamste Widerstandsform beschrieben hat. Die Idiotie dieser Verse hält sich in den Grenzen von Geisterbahn und Grand Guignol.
Nun bedürften diese etwas brav und billig geratenen beileidlosen Bagatellen eines ansonsten Hochbegabten sicherlich keines kritischen Aufhebens, eignete ihnen nicht etwas Symptomatisches. Wobei weniger Grünbeins – oder Suhrkamps Marktbewußtsein gemeint ist als vielmehr das beschädigte Bewußtsein vom Tode, das sich in ihnen ausplaudert. Die Moderne hat zwar, wie Peter Sloterdijk kürzlich feststellte, „einen ihrer großen Triumphe darin gefeiert, daß sie den Tod trivialisiert hat“, aber es ist ihr schlecht bekommen, nicht nur weil damit die Bedenkenlosigkeit zum Töten befördert, sondern auch weil damit das Leben selbst entsakralisiert und trivialisiert wurde. Selbst die Sexualität, das letzte metaphysische Reservoir des Menschen, muß ja ohne Todesbewußtsein – und das heißt ohne tragisches Bewußtsein zum bloßen Sportbetrieb entarten. „Befreite Sexualität“ ist jedenfalls etwas ähnlich Illusionäres wie die „Entspanntheit zum Tode“, die sich heute überall im westlichen Kulturkreis zu Wort meldet und auch in Durs Grünbeins Gedichten niederschlägt.
Tatsächlich ist die Trivialisierung des Todes nichts anderes als eine andere Form der Tabuisierung des Todes, ein Versuch der Verdrängung, der verständlich anmutet angesichts einer Welt, die nicht weniger verheert ist und von Toten und Getöteten bevölkert wird als jene zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in der Hofmannswaldau und viele seinesgleichen ihre Todesfurcht hinter der Maske des Sarkasmus und der Grimasse des Zynismus verbargen.
„Wo immer euer Leben endet, da ist es ganz vollendet.“ Montaignes Überzeugung muß einem jungen Dichter heute ähnlich verrückt vorkommen wie Rilkes frommer Wunsch: „O Herr, gib jedem seinen eignen Tod“, werden ihm schließlich täglich die aktuellen Zahlen der Hunger- und Bürgerkriegstoten ins Haus geliefert. Wo in solchem Maße kollektiv oder anonym gestorben wird, ist ein unzynisches Verhältnis zum Tod wohl ebenso schwer zu finden wie ein unzynisches Verhältnis zu Politik und Gesellschaft.
Übrigens bildet den Auftakt des neuen Grünbein Bandes ein Gedicht, das sich von den übrigen vorteilhaft abhebt, weil in ihm der Urgrund des Sarkasmus und des Zynismus sichtbar wird, nämlich Trauer, unbezwingbare Trauer. Es ist das Gedicht von dem Toten aus Berlin, der dreizehn Wochen vor dem laufenden Fernseher saß – bevor man ihn fand, verwest fand. Ein Gedicht zur deutschen Wende wie zur Jahrhundertwende (Leider hat es den Makel, daß es – neben einigen anderen der Epitaphe – bereits 1991 in Durs Grünbeins Buch Schädelbasislektion abgedruckt war ) Es sei hier – zum „fraglos schönen Ende“ – in seiner Vollständigkeit und Vollkommenheit zitiert!
Berlin. Ein Toter saß an dreizehn Wochen
Aufrecht vorm Fernseher, der lief, den Blick
Gebrochen. Im Fernsehn gab ein Fernsehkoch
Den guten Rat zum Kochen.
aaaaaaaaaVerwesung und Gestank im Zimmer,
Hinter Gardinen blaues Flimmern, später
Die blanken Knochen.
aaaaaaaaaaaaaaaNichts
Sagten Nachbarn, die ihn scheu beäugten, denn
Sie alle dachten längst dasselbe: „Ich hab’s
Gerochen.“
aaaaaaaaaEin Toter saß an dreizehn Wochen…
Es war ein fraglos schönes Ende.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJahrhundertwende.
Peter Hamm, Die Zeit, 7.10.1994
Vom Herzversagen der Poesie
Durs Grünbeins Band Den Teuren Toten bietet in 33 Epitaphen eine Mischung aus schwarzem Humor und Zivilisationskritik. Ein Beispiel:
Wer, Mann am Steuer verblutet, bist du gewesen bevor
Dieser schreckliche Unfall geschah? Mit Tempo 200
Trug dein Mercedes dich aus der Kurve, Bei glatter Straße
Wurde ein Baum dir zum Schicksal, ein steiniger Graben.
Schneidbrenner brauchte es, dich zu befrein. Groß
War der Blechschaden, unermeßlich der Schrecken,
Als dein Körper zum Vorschein kam, einzeln die Glieder
Und ganz zuletzt erst dein Kopf mit dem verdutzten Gesicht.
Der Blick mag herzlos sein, vielleicht ist er erkenntnisfördernd. Ist das Verdutztsein angesichts des Todes die einzige Überraschung eines Lebens, das sonst keine Überraschung kannte? Erhalten wir eine Lehre, die über diesen Fall, diesen Unfall hinausreicht? Die Frage „Wer bist du gewesen?“ gilt als Memento mori demjenigen, der vor der Grabinschrift verweilt: dem Leser. Aber mir scheint, damit rücken wir eine edle moralische Zielstellung zu sehr in den Vordergrund und versuchen das befremdliche Vergnügen herunterzuspielen, auf das diese Anthologie seltsamer Todesarten nicht zuletzt spekuliert. Der variantenreiche Tod anstelle der Monotonie des Lebens – wäre dies Gegenstand und Botschaft der neueren Poesie? Nun will ich nicht die souveräne Verskunst des Autors leugnen, mit denen Polizei- und Zeitungsberichte poetisch aufgearbeitet werden (denn das sind sie eher als Epitaphe im strengen Sinn), auch die philosophische Dimension der Texte nicht bestreiten (ist vom Tod die Rede, hängt schließlich immer Philosophie dran), will aber auch den Eindruck nicht verschweigen, daß die Texte den Vorlagen – Zeitungsmeldungen in Rubriken wie „Kuriose Welt“ oder „Was sonst noch passierte“ – allzusehr verhaftet bleiben. Mir drängt sich der Vergleich auf mit dem nordamerikanischen Dichter Edgar Lee Masters. Sein Hauptwerk Die Toten von Spoon River ist eine umfassende Anthologie von – fiktiven – Grabinschriften, in denen die Friedhofsbewohner einer kleinen Stadt im amerikanischen Mittelwesten quasi in der Rücksicht auf ihr Leben, aber ohne alle Rücksicht die Geheimnisse ihres Daseins preisgeben. Die Todesarten verweisen hier auf die Lebensarten und -unarten, die Epitaphe bilden eine Enzyklopädie des Lebens mit seinen Hoffnungen und vor allem enttäuschten Hoffnungen. Man hat dabei keineswegs den Eindruck, daß sich die Gedichte dem ausgesprochenen Willen zur Rühmung oder gar Harmonisierung des Lebens verdanken, einem Willen, der oft recht schnell zum Kitsch führen kann. Kurzum, der Tod als Wechselfall des Lebens, wie es einmal eine Versicherungsanzeige so eindrucksvoll wie unfreiwillig komisch formulierte, ist wohl ein Gegenstand der Poesie (Gegen-Stand sogar in der wortwörtlichen Bedeutung), seinen poetischen Abwechslungsreichtum als brutaler Fakt kann man dennoch nicht überschätzen.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 503, September/Oktober 1995
Schonungslos – aufwühlende Gedichte
voller Sozialkritik und Denkanstöße
Im Gedichtband Den Teuren Toten widmet Grünbein als „Pseudonymus No. 13“ 33 sog. Epitaphe (das ist die Bezeichnung für antike Grabesinschriften) kürzlich auf unterschiedliche und meist grausame Weise ums Leben gekommenen und oftmals namenlosen Toten. Schonungslos und ohne Rücksicht auf Tabus und guten Geschmack kreiert Grünbein aufwühlende Todesszenarien, etwa von einem 9-jährigen Jungen, der seinen 3-jährigen Bruder beim Spiel erschießt, einem verschwundenen Mädchen, das in einem Gully wieder gefunden wird oder einem Gefangenem, der seine geglückte Flucht mit dem Leben bezahlen muss. Oftmals wird den teilweise krassen und heftigen Todesschilderungen noch ein beissender, fast höhnischer Spott beigefügt, etwa bei dem 80-jährigen Mann, der seinen größten Wunsch, einen Fallschirmsprung, mit dem Leben bezahlt oder bei dem Jäger, der von seinem Hund (!) erschossen wird.
Doch Grünbeins Band Den Teuren Toten verkommt nie zu einer bloßen Aneinanderreihung grausamer Todesszenarien voller blutrünstiger Details. Vielmehr rütteln die 33 Epitaphe den Leser wach und bringen ihn dazu, sich selbst Gedanken über den Tod und dessen eigentlichen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft zu machen. Einen weiteren roten Faden durch die Epitaphe bilden die vielen sozialkritischen Töne auf die heutige Gesellschaft und deren Verlogenheit und Schwächen. Wenn beispielsweise ein vor dem Fernseher Verstorbener erst nach 13 (!) Wochen aufgrund des bestialischen Gestanks gefunden wird oder ein im Krieg Verschollener nach 40 Jahren durch Beschluß für tot erklärt wird, dann kann man nur fassungslos den Kopf schütteln.
Knallhart führt Grünbein uns vor Augen, dass der Tod allgegenwärtig ist und dass es sinnlos ist, die Augen vor ihm zu verschließen. Eine Lektüre, die dem Leser etliches abverlangt und schwer im Magen liegt, aber nichtsdestotrotz sehr lohnenswert ist und lange nachwirkt.
Tobias Zeitler, amazon.de, 10.7.2006
2.4 Bulletins in metrischer Sprache. Den Teuren Toten.
33 Epitaphe zwischen klassischem Versmaß und Pin-up-Stil
Die 33 Epitaphe1, die in Den Teuren Toten versammelt sind, „singen das Lob der Entfremdung“, weiß der Klappentext vom Inhalt des Gedichtbands zu berichten. Und:
Lächerlich macht sich das Leben in seiner vergeblichen Wiederkehr, sieht man den Reinfall des Endes.2
Schon fast selbst Poesie, filtert der editorische Vorspann die folgenden Texte vorab zu einem munter ironischen (singenden) und zugleich höchst sensiblen Derivat. Der Tod – immer schon größte Metapher für das Leben –, angereichert um die Entfremdung, Anämie der Moderne, ist ein gewichtiges Thema. Epitaphe, die sich der Problematik des Mortalen annehmen, müssen demnach a priori philosophische Gebilde sein, Diagnoseversuche in der Spezialform ,literarisches Letogramm‘3.
Es geht, so die informelle Hinführung andernorts zwischen den Zeilen, um nichts weniger als den Verlust des Individuums und um den Verlust, diesen ernsthaft als solchen zu empfinden oder monumental ins Leben hinein zu statuieren („Kein Zwiegespräch mehr von Diesseits und Jenseits…“). Der Einzelne als sein letztes Eigentum verschwinde heute, flugs eingeäschert, hinter Ziffern, marginalisierter Inschrift. Die Lebendigkeit der Gegenwart setze vor den Tod kein Memento mehr, sondern Tabu oder das Trivial nervöser Nachbehandlung. Das Sterben sei aus dem Bewusstseinsgetriebe der Gegenwart ausgeklinkt, weil man „die eigene Sterblichkeit hysterisch“ zu verbergen sucht. Sich vom Sterben als variante Konstante nicht lösen zu können, bedinge die Ohnmacht, mit der wir leben, so der Prolog des Buches und die Epiloge der Rezensenten.
Durs Grünbein habe die Texte zum annoncierten Schweigen erzeugt, 33 Epitaphe geschrieben, welche die absurden Varianten des Todes als beredte Ingredienz führen. Die Epitaphisierung trivialen Sterbens, welche den Akt des Todes entblößt bis auf die endgültigen Knochen, wäre im Weiterdenken der editorischen Handreichung eine große Farce auf Komplexe dem Tod gegenüber.
Doch ganz so ,meta‘ ist der Text zum Kontext nicht, auch wenn es zutrifft, dass die bedauernde Inszenierung der Vergängnis die konsensuale Trauer mit schwarzem Humor überzieht. Das Groteske ist allerdings fast die einzige Botschaft der Texte; reflexiv ist sie kaum: Mit erweiterter intellektuell-philosophischer Durchdringung sollte man das sarkastische Arrangement nicht verwechseln.
Drei zwischen die übrigen Epitaphe gestellte Texte lassen in Allianz mit ihnen die Diktion erahnen. Mit sinnlicher Wehmut, einsamen Bedauern eröffnet folgendes Gedicht die epitaphe Serie:
Unklar weshalb, es ist so,
Wer weiß warum.
Sie alle
Machen sich aus dem Staub
Irgendwann.
Kommen an
Mit geschwollenen Adern
Gewollt oder ungewollt
Sind sie da,
bleiben
Nicht selten unfruchtbar,
Lärmen und suchen.
Sätze
Gegen die Stille schleudernd,
Mäkeln sie boshaft, so geht es,
So geht es nicht.
Bis eine weitere Urne voll ist,
Unter den leeren Himmeln
Ein Nachruf spricht.4
Hier wird zunächst der Zustand der Gegenwart archiviert,5 der Bezugsrahmen festgelegt, um dann mit den folgenden Epitaphen die leicht tragisch klingenden Zwischenstücke kontrapunktisch zu unterminieren – und das angelegte Misstrauen zu bestätigen. Im Zentrum des ersten Gedichts droht ein unfruchtbar, prangt ergo erneut die Vergeblichkeit als Urspule des lyrischen Fadens, den Grünbein fortlaufend spinnt.6
Die im Vorab fingierte Anteilnahme – „Sie nimmt mich mit, die Traurigkeit der Körper.“7 – ist ein Scheingefühl, welches den Boden bildet für die Ernüchterungen des Autors. Die anschließenden Verse präzisieren das ,Mitgefühl‘ umgehend:
Ekstasen, Schleim, die leeren Hülsen Haut.
Was da ins All abgeht, verrenkt, zerpulvert,
Lief einmal aufrecht, lächelnd, leichtgebaut.
Was dir bevorsteht, siehst du
früh bei andern.
Erschreckend klar… Zukunft, durch Nichts ersetzt.
Leben ist ein Nullsummenspiel. Zuletzt
Bleibt im Gedächtnis nicht einmal der eigene Tod.8
Die Projektion jenes Nullsummenspiels ist ein grundlegendes Motiv des Buches. Den Teuren Toten heißt auch: Den Lebenden, jenen noch aktivierten Toten in Warteschleife. Entsprechend setzt die Erinnerungsarbeit der Epitaphe dort ein, wo die Lebenden in den Tod ,überführt‘ werden. Am Leben in seiner letzten Probe übt der Autor die zynische Wende.
In einer Stimmung zwischen Desinteresse, Unbehagen und Faszination hält das memento mori der dreiunddreißig moritaten Kapitel das Leben im Sterben fest. Die Absurdität privater Tragik ist der Kern jener Identität, die den Einzelfall über das Individuelle hinaus interessant macht.
Die Epitaphe sind poetische Stilisierungen von wirklichen Todesfällen, tradiert durch bestimmte Rubriken bestimmter Medien. In Randspalten kolumniert, in Boulevardformaten abgelichtet, wird der Tod, wenn er nur spektakulär genug war, zum flüchtigen Ereignis, zum medialen Quicky „unseres klatschsüchtigen Zeitalters 9. Die Botschaft ist relativ zweifelhaft; tendenziell dient das ,Fazit‘ des Nullsummenspiels den (zumindest stellenweisen) Nullmedien als Tapete. Dem Singulären gibt Grünbein einen lyrischen Anstrich:
Fahrlässiges Betreiben eines Heißluftföns
Führte im Fall Frau Helga M.’s zu einem Unfall
Mit Todesfolge. Aus noch nicht geklärtem Grund
Hatte die Frau ihr Bad entgegen der Gewohnheit
Zum Haarabtrocknen nicht verlassen. Schlimmer noch,
Die Wanne halbvoll und bei schwachem Deckenlicht
Benutzte sie, die noch im Wasser lag, in aller Eile
Und ungeachtet der Gefahr den Fön im Netzanschluß.
Dabei geschah’s.
Sie war schon tot, als sie ihr Gatte fand.
Der Polizei erklärte er, noch unter Schock:
„Die dreizehn Ehejahre waren hin wie nichts“.[footnote]Grünbein: Den Teuren Toten. S. 15. [willkürlich gewählt].-Prototypen der Auseinandersetzung Grünbeins mit außergewöhnlichen Toden finden sich als Bildbeigaben zu der Nullserie Pina und Via Lewandowskys. Die Texte jener Death Row sind noch näher am Original der Meldung oder unverändert, wie ein Beispiel zeigen soll: „7. März 1994 / Berlin. Parteisekretärin zerstückelt. Im Bezirk / Friedrichshain fanden Nachbarn die Leiche / von Helga F. (65). Ihr Mörder hatte sie zer- / stückelt und in die Badewanne gelegt. Vor der / Wende war die alleinstehende Frau SED-Parteisekretärin ihres Wohnbezirks, Kader- / instrukteurin bei Narva (Glühlampen).“ (Durs Grünbein: „Death Row“. In: Lewandowski, Pina und Via: Alles Gute! Danke! – Good Luck! Thanks! Leipzig, 1995, S. 34).[/footnote]
Im Nachwort zu Den Teuren Toten, einer Herausgeberfiktion, lässt Durs Grünbein einen Pseudonymus No. 13 sagen:
Was einst zum Lob des Verstorbenen sprach, gemeißelt als Inschrift auf Tafeln und Grabplatten, in steinernen Monumenten und an den Wänden von Sarkophagen, verbirgt sich heute als sachliches Fazit, verkürzt zur Notiz, in der Tageszeitung. In der Neuzeit ist nur die christliche Schwundform geblieben […].10
Diese überzeichnet Grünbein und zeichnet sie nach.11 Der Epitaph verschriftlicht das Flüchtige, dient wie ein Denkmal als „Rinnstein für Erinnerungen, / Die niemand auffängt sonst.“12 Den Instant-Stoff des Todes – vom Zufall spekulationsträchtig koloriert –, den die Medien aufgreifen, adaptiert der Dichter und bringt ihn in metrische Form. Daraus folgt zwangsläufig, dass die lyrischen Aufbereitungen sich nicht von den Vorlagen lösen können. Die Imitation differenziert sich kaum von jenen Pressemeldungen, „die das semper idem als Sensation interessant zu machen suchen“13.
Der Voyeurismus ist nicht außer kraft gesetzt, er ist nur durch den Kontext des Lyrischen verschleiert. Auch die Grünbeinschen Texte sind von Gleichgültigkeit regiert. Clemens Umbricht urteilt luzid, dass die Gedichte ins Leere fallen.
Was in jedem dieser Epitaphe als Bild effektvoll aufblitzt, endet auch als Bild – und verglimmt ebenso echolos rasch. […] Da verselbständigt sich aus ihnen nur selten ein Gedanke zu einer erhöhten Transparenz seines Gegenstands. Im Gegenteil: Es bleibt nur der große Fächer, der geräuschvoll übers neu zum Leben erweckte Tabu wedelt – und die Spuren verwischt: Aller angestrengten Ironie […] zum Trotz.14
Ähnlich operiert Burkhard Lindner:
Es irritiert […], dass er die Partikelwelt der Informationsmedien nicht selbst in der Form der Gedichte thematisiert, […] dass er die Polyphonik der Innenstimmen und die Reflexion zerfallener Subjektivität preisgibt. Das lyrische Ich befindet sich in Quarantäne, vermummt im Faltenwurf des Epigrammatikers.15
Die Fiktion, vom Autor aus der Wirklichkeit extrahiert, ist Mimesis ohne Durchdringung der Mechanismen.16 Mit jedem weiteren Epitaph wird die Nekroskopie exotischer, aber kaum aufschlussreicher. Auch eine vielstimmige Systematik bleibt Systematik; im vorliegenden Fall erhält die Grundaussage bloß kontinuierlich neues Make-up. Was über das showing hinaus interessant erscheint, assimiliert der Kommentar des vermeintlichen Herausgebers.
Den Teuren Toten sei, heißt es dort, eine Kompilation von Fundstücken emes Anthropologen, „,Berichte vom Untergang unbedeutender Menschen‘“17 in der Form kleiner carmina funebra festhaltend.
Auffällig schmucklos, betont dürftig in der Öde ihrer faktischen Details, sind es vor allem Armutszeugnisse, trist wie die Pappschilder an den Füßen mancher Leichen im Schauhaus, selten Gedichte. Aus ihnen spricht weder Lebensweisheit noch Jenseitsglaube. Ihr Reich sind die Zettelkästen, nicht die Annalen der Kondolenz.18
Die Epitaphe versuchen also, so der Gedankengang, sich dem morbus civilisationis mittels einer eigenartigen Faktografie zu nähern. Das äußerst Bizarre lasse gleichsam das äußerst Banale erkennen – was es ja auch tut. Epitaph für Epitaph werden Einzelfälle zu einer Pragmatik des Alltags installiert. Im Recorder des Gedichts findet sich jene Semantische Tristesse19 wieder, die zu spiegeln Durs Grünbein für sich reklamiert. Infolgedessen bieten die Epitaphe, Ulrike Draesner hält es fest, neben dem Tod in seiner Varianz „ein kleines Panoptikum heutiger Lebensformen“ 20, dargestellt im authentischen Ton gängiger Praxis. Mehr oder weniger spektakulär spricht Grünbeins Œuvre wiederkehrend von den Lebens- und Ablebensformen, offen oder allegorisch geschichtet tauchen sie auf, die Todesarten der Idioten21.
Ron Winkler, in Ron Winkler: Dichtung zwischen Großstadt und Großhirn. Annäherungen an das lyrische Werk Durs Grünbeins, Verlag Dr. Kovač, 2000
Das Lyrische Kabinett vom 25.6.2014 diskutiert ab ca. 1:47 zu Durs Grünbein: Den Teuren Toten
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinrich Detering: Hin wie nichts
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.10.1994
Iso Camartin: Der hohe Stil und das makabre Spiel oder: Warum schreibt Durs Grünbein Epitaphe?
Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, 1996
Burkhardt Lindner: Lyrische Schwundstufe
Frankfurter Rundschau, 5.10.1994
Ulrike Draesner: Reden vom Sterben und vom Grab
Süddeutsche Zeitung, 19./20.11.1994
Achim Nuber: Durs Grünbein Den Teuren Toten
Passauer Pegasus, Heft 24, 1994
Dorothea von Törne: Pornographie des Sterbens
Der Tagesspiegel, 31.12.1994
Clemens Umbricht: Nachrufe unter leeren Himmeln
Schweizer Monatshefte, Heft 3, 1995
D.M.G.: Dreiunddreißig lyrische Leichen
Basler Zeitung, 3.3.1995
Thomas Irmer: Sarkasmus im Unterrock
Theater der Zeit, Heft 10, 2000, Heft 10
(Zu: Berichte vom Untergang unbedeutender Menschen. Uraufführung der Dramatisierung von: Den Teuren Toten)
Mi-Hyun Ahn: Die (post-)moderne Thanatologie in Den Teuren Toten von Durs Grünbein
Dieter Koch: Auf der Suche nach dem Sinn des Todes
ev-kirche-riedenberg.de, 20.11.2008
DURS GRÜNBEIN
„Ich sags gerne noch x-mal…“
aaaaaHeulend latsche ich durch
aaaaaaaaaaden Tann. Sehe all die Deformation.
Die verseuchten Eich
aaaaaaaaaaHörner, zähle to-
aaaaaaaaaaaaaaate
Hasenschwänze unverhüllt-
aaaaabare Keilerzähne. Und da
aaaaaaaaaaergreifst mich denn doch. Oh ja
und ich lamentiere
aaaaaHalt! Los. Feen großer Wälder (am Wipfel
aaaaaaaaaavornüber in der Brise
aaaaaaaaaaaaaaaschwirren wie Gummi
reifen.
Horden von Hirschpenissen, die
aaaaagebührenfrei
aaaaaaaaaaabspritzen
spermaschwarze Chemikalien, an
aaaaaaaaaagewittert
aaaaaaaaaaaaaaatränt mein Pulver
Pillen gegen
aaaaadas Haßgase.
„Lieber Gott. Allermeister Durs du mir ich bin mein Hochgift.“
aaaaaaaaaaTrotze wie Schwarzsender
aaaaaaaaaaaaaaaauf zwei harmlose Pilzsammler, die
nicht
aaaaasehen, was ich mir von der Welt
so
zusammen
horroraune.
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


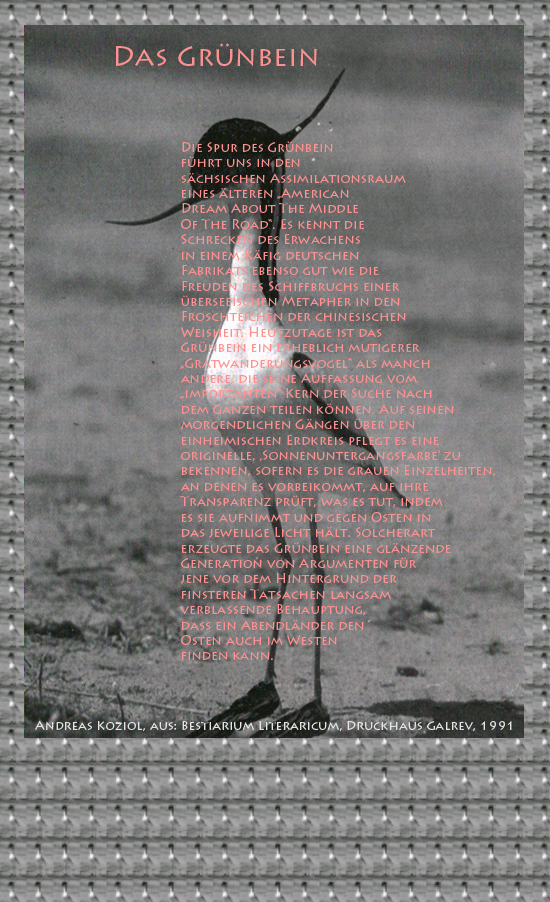
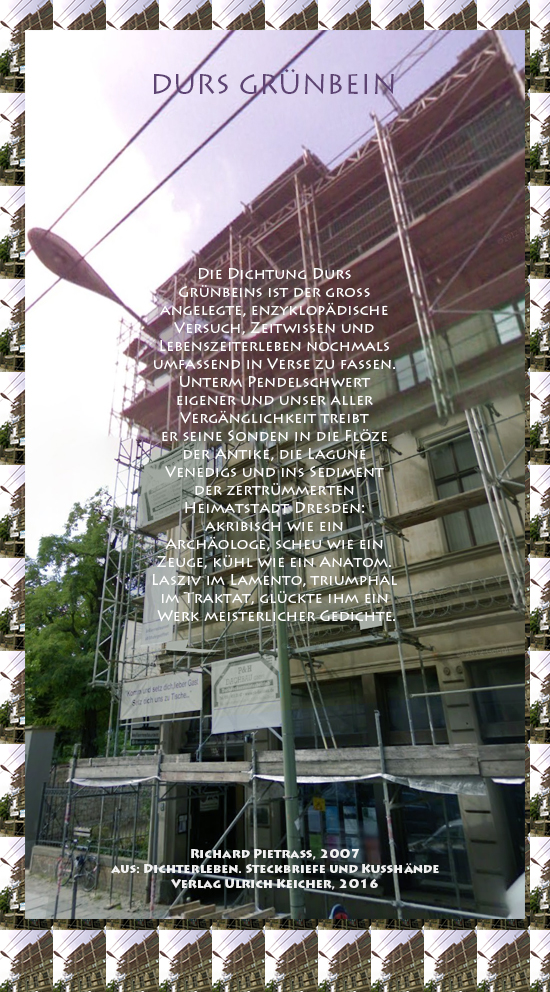












Schreibe einen Kommentar