Durs Grünbein: Der Misanthrop auf Capri
IN EIGENER SACHE
Luxus verdirbt den Stil, sagt Seneca.
Er mußte es wissen.
Ach, mein lieber Lucilius,
Sie verdrehen die Worte. Sie sprechen
in Rätseln und prahlen
Mit gesuchten Metaphern.
Stark muß die Rede sein. Der Gedanke
Hängt wirr in der Luft.
Mancher pflegt seine Fehler,
Die ihm Beifall verschafften im Volk.
Das Ordinäre gefällt,
Weil es Arm und Reich aussöhnt.
Machen ist – das tyrannische Verbum,
Das Modewort dieser Zeit.
Der größte Unsinn macht Sinn.
Alles ist sagbar geworden in Rom.
Der Mensch spricht, wie er lebt −
Weiß ein griechisches Sprichwort.
Kein Wunder, bei soviel Verschwendung
Sehnt das Ohr sich nach Süßigkeiten,
Wird die Sprache lasziv.
„Risse, die durch die Zeiten führen“
Zu Durs Grünbeins Historien
… Und was da bleibt,
Sind nur die Steine, glückverheißend…
(Durs Grünbein)
So also kehren sie wieder, die Toten.
(W.G. Sebald)
I
In der jüdischen Tradition pflegt man Steine auf die Gräber der Toten zu legen als Zeichen dafür, daß ihre Namen nicht aus dem Buche der Menschheit und des Lebens gelöscht sind, daß sie auf eine, hier nicht näher zu bestimmende Weise in Ewigkeit existiert haben werden. Das Ineinander von Leben und Tod, Geschichte und Einzelschicksal, Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerung und Erwartung, Trauer und Leichtigkeit wird im jeweiligen Jetzt dieser symbolischen Geste sinnfällig: Im auf den Grabstein gelegten Stein verdichtet sich das Dasein mindestens zweier Menschen des Lebenden und des Toten – auf den Raum einer handgreiflichen, punktuellen Präsenz, innerhalb deren ein Gespräch eröffnet bzw. fortgeführt wird zwischen jetzt und damals, Erinnerndem und Erinnertem.
Wohl kein Zufall also, daß der 1913 erschienene Gedichtband des russisch-jüdischen Dichters Ossip Mandelstam (1891–1938), dessen Leben und Werk zweifellos einen der wichtigsten Bezugspunkte für Durs Grünbeins Poetik darstellen und dessen „Russen-Sound“ letzterer, laut Selbstauskunft im Gedicht „Russophilie“, „erlegen“ ist, Kamen’ – Stein – heißt. Gedächtniswort und dichterische Replik (auf Fjodor Iwanowitsch Tjutschews Gedicht „vom Berg gerollt, kam ein Stein im Tal zum Liegen“, aus dem Jahre 1833) einerseits, „Stimme der Materie“ und konzentrierte Verkörperung alles Zeitlichen, Irdischen, Existentiellen andererseits: Mandelstams Stein führt Sprache und Historie, Poesie und Leben exemplarisch eng.
Seit Paul Celans intensiver Beschäftigung mit Mandelstams Poetik in den späten fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts gehört dessen Steinmetapher zum Inventar der deutschsprachigen Lyrik. Und obwohl Mandelstam weder der erste noch der einzige moderne Dichter war, der sich im Zusammenhang mit der Frage nach der Dichtung der mannigfaltigen Bedeutsamkeit des Steins bediente – man denke nur an die poetischen „Edelsteine“ Stéphane Mallarmés, an die sich im „Chor der Steine“ äußernden Klagen der Opfer des Holocaust in Nelly Sachs’ In den Wohnungen des Todes (1947) oder an folgende, Rilkes „Herbsttag“ zitierende und in Grünbeins Gedicht „Epigramm“ widerhallende Verszeile aus Celans frühem Liebesgedicht „Corona“: „Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt“ −, ist es doch Mandelstams Steinmetapher im besonderen, die in Grünbeins Bestimmung der Verskunst in dem Gedicht „Erklärte Nacht“ (aus dem gleichnamigen Gedichtband aus dem Jahre 2002) widerhallt:
Der Vers ist ein Taucher, er zieht in die Tiefe, sucht nach Schätzen
Am Meeresgrund, draußen im Hirn. Er konspiriert mit den Sternen.
Metaphern sind diese flachen Steine, die man aufs offene Meer
Schleudert vom Ufer aus. Die trippelnd die Wasseroberfläche berühren,
Drei, vier, fünf, sechs Mal im Glücksfall, bevor sie bleischwer
Den Spiegel durchbrechen als Lot. Risse, die durch die Zeiten führen.
Philosophie in Metren, Musik der Freudensprünge von Wort zu Ding.
Geschenkt sagt der eine, der andre: vom Scharfsinn gemacht.
Was bleibt, sind Gedichte. Lieder, wie sie die Sterblichkeit singt.
Ein Reiseführer, der beste, beim Exodus aus der menschlichen Nacht.
Dank ihres Gewichts und ihrer Schwere – „Billionen Erinnerungen“, „Ein Ranzen voll gelebten Lebens“ nennt sie Nelly Sachs – vermögen es die Metaphern-Steine der Dichtung, die dünne Wasseroberfläche der Zeit zu durchbrechen und eine direkte Verbindung herzustellen zwischen der „Tiefe“ der Vergangenheit und der Gegenwart: Die Schätze, die der „Vers“ entlang der von den Metaphern-Steinen gemachten „Risse, die durch die Zeiten führen“, von deren „Meeresgrund“ ans Tageslicht befördert und in der Dichtung verewigt („Was bleibt, sind Gedichte“), sind ebenjene Sehenswürdigkeiten aus der Schatztruhe der Geschichte, die der „Reiseführer“ vor den Augen der im Omnibus der Dichtung zusammengepferchten und ihre Nasen an die Fenster drückenden Touristen in all ihrer Lebendigkeit und Vielfalt auferstehen und durch die Glasscheibe des Gedichts selbst zu uns Heutigen sprechen zu lassen vermag – wie zum Beispiel jenen Menschenhasser, von dessen angeblich sadistischer Disposition und Hang zur Gewalttätigkeit schon Sueton berichtet und der uns in Grünbeins Titelgedicht „Der Misanthrop auf Capri“ angst machen soll.
In diesem sich an Suetons Kaiserleben orientierenden Text aus dem „Historien“-Zyklus des Bandes Nach den Satiren (1999) spricht, ohne daß sein Name fiele, ein stilisierter Tiberius zu uns. Laut Sueton soll sich Kaiser Tiberius (42 v. Chr. – 37 n. Chr.), nachdem er sich auf die Ermordung seines Sohnes Drusus im Jahre 23 n. Chr. von allen Staatsgeschäften aus Rom auf die Mittelmeerinsel Capri zurückgezogen hatte, all jenen Lastern hingegeben haben, die „er lange Zeit kaum zu verbergen vermocht hatte“: Dazu gehörten unter anderem angeblich auch fragwürdige sexuelle Praktiken mit Kindern „zarten Alters“ sowie die skrupellose Beseitigung von dem Kaiser nicht genehmen Personen.
Bei genauerem Hinsehen jedoch können wir nicht umhin, auch eine gänzlich „unhistorische“ Dimension in diesem Gedicht zu erkennen – die Dimension des Poetologischen: Macht uns doch nicht wirklich der tote Kaiser angst, sondern, wenn schon, dann derjenige, der mit seinen bloßen Fingern (ohne „Schlagring“) einen „Apfel durchbohren“ und „blutige Striemen“ – sprich: Gedichtzeilen, mit Leben getränkt – hinterlassen kann. Und das dürfte doch vor allem derjenige sein, der es kraft seiner bloßen Hände vermag, jemanden wie den Misanthtopen auf Capri überhaupt erst vor unseren Augen lebendig werden zu lassen – der Dichter selbst, dessen poetische Gestalt wir hinter der Maske des vermeintlichen Tiberius erkennen: der „Zeitreisende mit dem absoluten Gehör“, wie Grünbein ihn beschreibt, der eingestandenermaßen „schon vor Jahrhunderten mit Odysseus durchs Mittelmeer unterwegs gewesen“ war, der in Wort und Schrift das Zeitalter der gegenwärtigen sogenannten Pax Americana mit dem Rom der Pax Augusta engführt und dessen unverkennbare, ironisch-sarkastische Sprechhaltung sich in der süßlich-falschen, sadistischen Stimme des angeblich vom „Schlachten“ angewiderten Tiberius abzeichnet. So wird die Reise des Dichters ins Rom der frühen Kaiserzeit gleichzeitig zur Reise des „wiederbelebten“ Kaisers in die Gegenwart: Das Bild des freiwillig im Exil lebenden Misanthropen erweist sich sowohl als historische Vignette als auch als Allegorie auf den „neuen Künstler“, der, laut Grünbein, „nirgends zu Hause und nie angekommen“ ist und dessen sich an Ovid, Catull und andere anlehnender Rekurs auf den klassischen Topos der Dichtung als Waffe ihn in der Tat gleichsam als zeitgenössischen Misanthropen ausweist.
Motiviert wird das Changieren zwischen historischen Zeiten, Existenzen und Identitäten – „durch die Zeit… hindurch“, um mit Celan zu sprechen – von dem, was Grünbein den „prinzipiellen Anachronismus“, „die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ nennt. Die sprachliche Figur wiederum, die dieser Simultanität des historisch Disparaten gerecht wird, ist ebenjene Metapher (sprich: Dichtung), die als Stein „Risse… durch die Zeiten“ zu machen vermag. Indem Grünbein die semantische Figur der Metapher, deren Wirkung sich traditionsgemäß der ungewohnten bzw. widersprüchlichen Sinn- und Bedeutungsprädikation verdankt, dem Wortsinn von „Metapher“ („Übertragung“, „Transport“, „Transfer“) gemäß als eine Figur des Zeitlichen bzw. Historischen uminterpretiert, die einen Zeitraum eröffnet, in dem sich, wie W.G. Sebald schreibt, die „Wiederkunft der Vergangenheit… nach einer höheren Stereometrie“ vollzieht und „die Lebendigen und die Toten, je nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen“ und miteinander kommunizieren können, setzt er nicht nur (wie schon der Historiker Hayden White und andere vor ihm) dem, was „eigentlich gewesen“ sei, einen poetischen Begriff von Geschichte entgegen, sondern konzipiert auch die Dichtung selbst, die schon Aristoteles von der „Begabung… Metaphern zu finden“ abhängig machte, gleichsam als Historie.
In dem programmatischen Gedicht „Metapher“, das in Anlehnung an Lukians Dialog „Charon“ von dem „Ausflug“ des mythologischen, die Verstorbenen über den Styx in den Hades geleitenden Fährmanns ins Reich der Lebenden handelt, wird die „höhere Stereometrie“ des Verkehrs zwischen Lebenden und Toten, Vergangenheit und Gegenwart thematisch auf den Punkt gebracht. Die in diesem Gedicht in Szene gesetzte Metapher umfaßt sowohl den beiderseitigen Verkehr auf der mehrspurigen Spiralbahn zwischen dem Reich der Toten und dem der Lebenden als auch die jeweilige Lebensreise eines jeden von uns, die wir als „zeitlebens Beschwerte/Von Schwerkraft“ den „bleischweren“ Metaphern-Steinen aus Erklärte Nacht gleichsam reales Dasein verleihen. Als Hauptmetapher entpuppt sich dabei das dem Tod geweihte Leben selbst – die menschliche Existenz. Ihr setzt das Gedicht Gedenkstein und Chronik bzw. Historie zugleich – ein, um nochmals mit Celan zu sprechen, „für die Gegenwart des Menschlichen“ zeugendes Denkmal.
II
Die „Brücke zur Antike“, bemerkt Grünbein, sei ihm „ebenso wichtig wie der Einklang mit den Erscheinungen der Gegenwart“; „Dichter wie Horaz oder Juvenal“, der „um das Jahr 100 unserer Zeitrechnung ein Rom“ beschreibt, das ihm „sehr ähnlich vorkommt wie die Situation heute in New York, auch ein wenig wie in Berlin“, seien ihm nicht einfach „irgendwelche lateinischen Klassiker“, sondern hätten ihm „direkt etwas zu sagen“; ihre Werke werden dem „solcherart Angesprochenen zum Interpretationsmittel der eigenen Existenz“.
Die in diesem Band versammelten Gedichte, deren Großteil den mit „Historien“ und „Neue Historien“ überschriebenen Zyklen aus den Gedichtsammlungen Nach den Satiren (1999) und Erklärte Nacht (2002) entstammt und die sich alle mehr oder weniger explizit der Antike zuwenden, tragen Grünbeins Brückenbauprojekt exemplarisch Rechnung.
Sei es in der dichterischen Vignette auf historische Begebenheiten „Hadrian hat einen Dichter kritisiert“, im autobiographisch verbrämten Rollengedicht („Klage eines Legionärs aus dem Feldzug des Germanicus an die Elbe“, in dem wohl auch des Dichters eigene Klage über den Militärdienst in der Nationalen Volksarmee mitschwingt) oder schließlich in dem sich an einer bekannten literarischen Vorlage abarbeitenden Monolog [in „Aporie Augustinus (Über die Zeit)“, etwa oder in „In Ägypten“]: In Grünbeins historischen Metaphern oder metaphorischen Historien hat sich der Stein der Dichtung – jener Tjutschewsche, Mandelstamsche und Celansche Stein, der, den Gedichten „Fanum Fortuna“ und „,Siv me amas‘“ zufolge, nach „Psyches“ Weggang „glückverheißend… blieb“ – „zu blühen bequemt“. So also kehren sie wieder, die Toten, in Grünbeins Versen: Als Blumen des Mundes (wie schon Hölderlin die Sprache – mithin die Sprache der Dichtung – metaphorisch definierte), als Blüten – poetisch „gefälscht“ und doch wahr – wahr auf die einzige Art und Weise, auf die Historie für den aufmerksamen Nietzsche-Leser Grünbein überhaupt nur wahr und von Nutzen sein kann: als Metapher. Denn die Wahrheit sei nichts anderes, heißt es einmal bei Nietzsche, den Grünbein für einen der „folgenreichsten Denker aller Zeiten“ hält, als ein „bewegliches Heer von Metaphern…“
Auf den ersten Blick mag es paradox erscheinen, daß gerade der Dichter, der von sich sagt: „die Historie war mir von Nachteil“ (in dem autobiographischen Gedicht „Vita brevis“ aus Nach den Satiren), sich dem ausgiebigen Verfassen von „Historien“ widmet. Eher würde man erwarten, daß Grünbein, seinem Vorgänger in Sachen „Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ (so der Titel von Friedrich Nietzsches zweiter Unzeitgemäßer Betrachtung von 1874) folgend, dem, was Nietzsche das „Unhistorische und das Überhistorische“ nennt – dem „Vergessen-können“ bzw. „Ewigen und Gleichbedeutenden“ −, das Wort redete. Hat doch ein zu stark ausgeprägter Sinn für das Historische, laut Nietzsche, die bedauernswerte Folge, daß „das Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt zu Grunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Cultur“.
Daß Grünbein seiner Faszination für das Historische dichterisch freien Lauf läßt, mutet um so erstaunlicher an, als er ja damit gerade jenem vermeintlichen „Übel“ Vorschub leistet, das er auf der Folie von Juvenals scharfzüngigen Beschreibungen des Großstadtlebens in Rom als „Berufskrankheit“ der Dichter im besonderen, als „Krankheit der Moderne“ im allgemeinen diagnostiziert und das bereits Nietzsche als das Hauptsymptom des „historischen Fiebers“, an dem „wir Alle… leiden“, zu erkennen glaubte: dem Übel der „Schlaflosigkeit“. „Was im Vordergrund als bloße Ruhestörung erscheint draußen vorm Fenster, Gewühl und Verkehrslärm der Großstadt“, schreibt Grünbein mit Mandelstam im Ohr, „ist im Grunde das Rauschen der Zeit.“ Um den Schlaf wird der Dichter nicht so sehr vom Straßenlärm gebracht als von dem hinter dem Treiben der Menschen sich artikulierenden Generalbaß der Zeit, der Geschichtlichkeit selbst – dem, was Grünbein das „Getöse der Vergänglichkeit“ nennt. „Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden wollte“, schrieb bereits Nietzsche, „wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde…“ Was heißt aber schon „durch und durch historisch empfinden“? Oder anders gefragt: Können wir vergänglichen Menschen, deren inneres Zeitbewußtsein Grünbeins Augustinus prägnant aus „Augenschein erst, bald schon Erinnern, genährt von Erwartung“ zusammengesetzt bestimmt, überhaupt je anders als „durch und durch historisch empfinden“? Wäre die Fähigkeit zu einer sich dem Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen verdankenden Schlaflosigkeit gerade das dem Menschen zutiefst Eigene? Wären die Dichter gerade diejenigen unter den Menschen, die mit einer ausgezeichneten Begabung für diese allzu menschliche „Krankheit“ ausgestattet sind?
Nietzsches Zeitdiagnose im Namen der Dichtung in einem homöopathischen Umkehrschluß gleichsam auf den Kopf stellend, interpretiert Grünbein die als Schlaflosigkeit symptomatisch werdende „historische Krankheit“ gerade als Heilmittel um: Similia similibus curantur – Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Manifestiert sich doch die Schlaflosigkeit nur dann als ein „Übel“, wenn der moderne Patient vor allem auf Schlaf und „Vergessen-können“ aus ist; wird dagegen die äußerste Aufmerksamkeit dem Rauschen der Zeit gegenüber erstrebt, dann entpuppt sich die Schlaflosigkeit nicht nur als keine zu bewältigende „Krankheit“, sondern gerade als die Bedingung der Möglichkeit solcher Aufmerksamkeit, als „das irdische Exil der Poeten, der Zeitreisenden mit dem absoluten Gehör“. Wann sonst als nachts, wenn die Wogen von Straßenlärm und menschlichem Treiben „draußen vorm Fenster“ sich glätten, vermag sich der Wachliegende so ganz und gar der Brandung der Zeit hinzugeben, aufmerksam in das „Stimmengewirr vieler Zeiten“ zu lauschen, dessen unzählige Frequenzen zu entwirren und ein ruhiges Gespräch anzufangen mit diesem oder jenem der uns aus der Tiefe Ansprechenden?
Schon Nietzsche räumte ja ein, daß nicht jeder von der Historie „Befallene“ ihrem „Bazillus“ auch erliegen müsse: Für diejenige „Natur“ nämlich, die die „plastische Kraft“ besäße, „aus sich heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und Fremdes umzubilden und einzuverleiben“, gäbe es „gar keine Grenze des historischen Sinnes…, an der er überwuchernd und schädlich zu wirken vermöchte; alles Vergangene, eigenes und fremdestes, würde sie an sich heran, in sich hineinziehen und gleichsam zu Blut umschaffen“. Eine derartige „Natur“ müßte weder einen „unhistorischen“ noch einen „überhistorischen“ Standpunkt einnehmen. In dem Historiendichter Grünbein hätte Nietzsche zweifellos eine derartige die von ihm beschworene „plastische Kraft“ besitzende „Natur“ erblicken können.
III
Am Gedicht „Julia Livilla“, in dem ein an Schlaflosigkeit Leidender aus der Tiefe der Zeiten zu uns spricht, soll, ohne daß hier auf alle Details dieses Textes im einzelnen eingegangen werden könnte, die Plastizität von Grünbeins Dialog mit der Antike beispielhaft skizziert werden.
In diesem Gedicht – einer Mischform aus dramatischem Monolog und fiktivem Brief nach der Art der Ovidschen Heroiden – richtet sich ein auf Korsika verbannter Philosoph an seinen „einzig treue[n] Freund“ in der Ferne. Aus der Sehnsucht des Sprechers nach Rom läßt sich schließen, daß er vormals in der Hauptstadt gelebt hatte. Der Freund, der wahrscheinlich in Rom zurückgeblieben ist, hatte mit der Möglichkeit einer Verbannungsstrafe gerechnet und dem Sprecher „vor Jahren schon“ geraten, umsichtiger zu sein. Den Rat des Freundes hat der Sprecher offensichtlich nicht befolgt. Das Exil des Sprechers ist Folge einer gefährlichen Liebschaft: „Eine Frau, / So schön, so ungewöhnlich, muß Verderben bringen“. Die Verbannung eines Philosophen auf Korsika aufgrund einer Liebesaffäre weist den Sprecher des Gedichts eindeutig als den Stoiker Seneca aus, der in der Tat acht Jahre (41–49 n. Chr.) im korsischen Exil verbringen mußte als Strafe dafür, daß er angeblich mit Julia Livilla, der Nichte des Kaisers Claudius, in einem (bis heute nicht nachgewiesenen) ehebrecherischen Verhältnis gestanden haben soll. Erst nach dem Tode Messalinas, der ersten Gattin des Claudius, auf deren Betreiben das Verbannungsurteil verhängt worden war, durfte der Philosoph, von Agrippina, Claudius’ zweiter Gattin, als Erzieher ihres Sohnes, des zukünftigen Kaisers Nero, nach Rom berufen, aus dem Exil zurückkehren. Bei der Ausarbeitung und Gestaltung des Gedichts bedient sich Grünbein der überlieferten Schriften Senecas. Nicht nur bildet die Apostrophe des stilisierten Philosophen die Anredestruktur der Briefe des historischen Seneca (an Lucilius und andere) nach, sondern auch Wortlaut, Bildmaterial sowie Gehalt des Gedichts vom anfangs erwähnten „Felsenrand“ und den „kargen Inseln“ über die Behandlung der stoischen Themen des Schicksalswollens und des Exils als „[d]es Philosophen Ziel“ bis hin zum Husten und dem darauffolgenden Schmerz gegen Ende des Gedichts – sind zum Teil direkt dem Werk Senecas entnommen: Beschreibungen der „rauhen“, „felsigen“ und „kargen“ Insel Korsika, gepaart mit Überlegungen zum Exil als conditio humana, finden sich zum Beispiel in Senecas aus der Verbannung geschriebenem Brief an seine Mutter Helvia; sein Atemleiden wiederum, an dem er seit seiner Kindheit litt und dessentwegen er viele Jahre „In Ägypten“ verbrachte, beschreibt der Philosoph detailliert in seiner Korrespondenz mit Lucilius. Indem Grünbein seinen Seneca im Sprach- und Gedankengewand des historischen Seneca auftreten läßt, gelingt es ihm, dem stilisierten Sprecher (und damit dem Gedicht als ganzem) den Nimbus der Authentizität zu verleihen – als rede der Philosoph per impossibile selbst zu uns.
Kaum hat sich der Leser in dem Glauben eingerichtet, hier spreche ihn auf wundersame Weise aus der Tiefe der Zeiten Seneca selbst an, muß er sich jedoch eingestehen, daß der Stoiker ganz so wohl nicht gesprochen haben würde: Steht doch sein von Grünbein inszeniertes Bekenntnis zur Macht der Leidenschaft und der Liebe (auch der außerehelichen), die alles „übersteigt, was… du an Argumenten hast“ und derentwegen er gegen den Rat des Freundes „zu manchem Risiko“ bereit war, radikal Senecas tatsächlicher Verurteilung aller Leidenschaft – auch der körperlichen (außer zum Zwecke der Fortpflanzung und der Beförderung von Gesundheit und Wohlbefinden) – als „niedrig, sklavisch… und vergänglich“ im Namen eines von Begierden und Leidenschaften freien, ruhigen, auf Vernunft und Umsicht gegründeten Lebens entgegen. Deutlich wird eine zweite, gänzlich unstoische Stimme im Gedicht hörbar.
Wer spricht so im Gedicht? Auf subtile, doch unmißverständliche Weise verrät uns Grünbein, wem diese zweite Stimme gehört: Der so spricht, ist einer, dem „ein Blutgerinnsel! [seine] Sterblichkeit beweist“ und der „von der üblen Seite / Aufs Leben“ schaut. Und das ist niemand anderer als der Dichter selbst, der in manchem Gedicht „[d]iese Scheiß Sterblichkeit“ besingt und 1991 in einem Interview folgendes zu sagen hatte: „Einmal fragte mich ein Amerikaner, als ich ihm sagte, ich käme aus Berlin: ,Free side or bad side?‘ Seither weiß ich, daß alles, was ich bisher getrieben habe, Poetry from the bad side ist.“ Von der üblen Seite – so auch der Titel eines frühen Sammelbandes Grünbeins. Indem Grünbein metaphorisch Senecas Verbannungsort mit der DDR gleichsetzt (beides Satelliten zweier Imperien: Rom bzw. Sowjetunion), verwischt er die Bedeutungsgrenze zwischen dem insularen Exil-Gefängnis des Philosophen und seinem eigenen ehemaligen „Gefängnis“ „im Schatten der… Mauer“ und folglich auch die personale Grenze zwischen Seneca und sich selbst tout court. Der Sprecher des Gedichts entpuppt sich als ein doppelter: Der „einzig treu[e] Freund“ wird sowohl vom stilisierten Seneca als auch vom stilisierten Grünbein apostrophiert, wobei seine Rolle, je nachdem, ob wir Seneca oder Grünbein als Sprecher des Gedichts auffassen, von dem einen oder dem anderen der beiden Protagonisten eingenommen wird.
Die Identifikation des Dichters mit dem Philosophen kulminiert, beinahe unmerklich, im finalen Rekurs auf Senecas Atemleiden, das ihn nachts nicht schlafen läßt: Verbirgt sich doch hinter dem schmerzvollen, ihm den Schlaf raubenden Husten des Philosophen Grünbein selbst, der die Sprache – mithin das poetische Sprechen – in einem seiner frühen Texte programmatisch als „Rache des Fleischs // Durch den Kehlkopf“, somit als eine Art „Husten“, bestimmt. Im dichterischen „Husten“ Grünbeins wird der antike Philosoph leibhaftig gegenwärtig; umgekehrt ermöglicht es die Metapher des Hustens dem Dichter, vom „Lärm“ seines Sprechens gleichsam geweckt, sich ganz körperlich in die Vergangenheit zu versetzen. Dank des in „Julia Livilla“ beschworenen Bildes des schlaflosen Philosophen oder philosophierenden Dichters wird die von Grünbein postulierte „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, die sich im „Stimmengewirr vieler Zeiten“ artikuliert, exemplarisch manifest. In der unhintergehbaren, konkreten Körperlichkeit des hustenden Sprechers wird jeglicher Versuch, eine Trennlinie zwischen Dichter und Philosoph, mithin zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zu ziehen, ad absurdum geführt: Seneca avanciert zum ehemaligen DDR-Bürger und zeitgenössischen Dichter, der sich „exilgerecht“ als „nirgends zu Hause und nie angekommen“ beschreibt; Grünbein nimmt die Gestalt des tatsächlich exilierten Philosophen an. Als „Vexierbild physiologischen Ursprungs“ hat Grünbein einmal das Gedicht metaphorisch bestimmt: In „Julia Livilla“ findet diese Metapher ihre beispielhafte dichterische Umsetzung.
IV
Grünbeins Umgang mit der Geschichte läßt die gängige Rückwendung zum Vergangenen als Spiegel, Meßlatte oder Korrektiv für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft weit hinter sich. Mag auch die Antike – insbesondere die römische Antike – zunächst Eingang gefunden haben in seinen poetischen Kosmos als „Widerpart und Kraftreservoir für Zeitdiagnose“ (wie ein Kritiker bemerkt): Im Laufe ihrer Rezeption durch Grünbein, von deren Ausmaß vorliegender Band Zeugnis ablegt, hat auch sie sich im Lichte der Lebenswelt und Gegenwart des Dichters neu sehen gelernt. Die Vergangenheit als eine ein für allemal feststehende Größe – das führen uns Grünbeins Historien immer wieder vor Augen – kann es nicht geben, insofern sie immer schon das Produkt von Erzählungen ist und somit sprachliches Konstrukt. Was es lediglich geben kann, sind Metaphern der Vergangenheit (und Gegenwart), die als solche schon aus Gründen der Rhetorik niemals mit dem, was „eigentlich gewesen“ sei, zur Deckung kommen können und deren – wie der von Grünbein geschätzte Dichter Joseph Brodsky sagen würde – „höchste Existenzform“ gleichsam sich in den hier versammelten Texten artikuliert. Insofern sie die philosophische Kritik der Postmoderne am Historismus jedweder Couleur im Namen der konstitutiven – wenn auch nicht kompletten – Fiktionalität und Narrativität des Geschichtlichen poetisch in Szene setzten, können Grünbeins Historien in der Tat als Bausteine für eine „Philosophie in Metren“ gelesen werden, als die Grünbein die Dichtung charakterisiert.
Dies soll keineswegs bedeuten, daß Grünbeins Texte dem, was geschah, die Bedeutung absprächen oder es gar zu leugnen suchten. Ganz im Gegenteil: Kann der Dichter doch nicht oft genug betonen, wie wichtig sie ihm sind – all jene „Kleinigkeiten“, die sich irgendwann zugetragen haben mögen. Daß sich in der Historiographie Grünbeins jedoch, in der Nachfolge von Tacitus und Herodot vor allem, das Gespür für alles Historische – für Zeitgeschichte im besonderen – mit einem ausgeprägten Sinn für das „Wunderbare“ und Imaginäre verbindet, ist nicht zu übersehen. Sei es als imaginärer Legionär unter Germanicus, als sich über Eigennutz und Selbstsucht seiner Untertanen beklagender Kaiser Titus, als krummfingriger Misanthrop oder als der vom Ort seiner Verbannung auf Korsika aus sich einem fernen Freund über seine Liebe zur Kaisernichte Julia Livilla mitteilende Seneca – was Grünbein über letzteren, einen seiner Lieblingsautoren, schreibt, kann ebenso als ästhetisches Grundprinzip seiner eigenen Poetik gelten:
Er tauschte die Masken und die Metaphern. Er schlüpfte in die unterschiedlichsten Rollen und wechselte die Standorte wie die Sandalen.
„Der Vers ist ein Taucher, er zieht in die Tiefe“, heißt es in Erklärte Nacht: Von den „Meeresfrüchtchen“, die er in dem Gedicht „Calamaretti“ „aus der Tiefe“ hervorholt und deren warmer Geruch uns aus einem in der bunten Schüssel der Grünbeinschen Historiendichtung gebauten „Nest aus Spaghetti, Fusilli und Linguine“ entgegenduftet, würden wir ohne ihn kaum etwas wissen. Dank der Metaphern – des feinsten Maschengeflechts des Netzwerks der Sprache – werden sie real, Teil unserer Wirklichkeit. Dank ihrer auch werden sie Teil unseres Gedächtnisses. Wohl nur die „plastische Kraft“ der Dichtung, von der Hand mit Tinte geschrieben, vermag es, „Unter den Tintenfischen“ sogar „die allerfeinsten und kleinsten“ nicht nur „ins Tageslicht“ zu rücken und uns so ihre unerhörte Bedeutsamkeit sehen und erfahren zu lassen, sondern ihnen auch im Gedenkstein der Sprache das Zertifikat des „Echt Absolut Reellen“ auszustellen.
Michael Eskin, Nachwort, März 2005
Inhalt
Der Misanthrop auf Capri (eine Anspielung auf Kaiser Tiberius) versammelt Durs Grünbeins verstreut und in den eigenen Gedichtbänden publizierten „Historien“ – Gedichte hauptsächlich zur römischen Antike. Dichter wie Horaz oder Juvenal, der um das Jahr 100 unserer Zeitrechnung ein Rom beschreibt, das Grünbein „sehr ähnlich vorkommt wie die Situation heute in New York, auch ein wenig wie in Berlin“, sind ihm nicht einfach irgendwelche lateinischen Klassiker, sondern haben ihm „direkt etwas zu sagen“: Ihre Werke werden zu Interpretationsmitteln der eigenen Existenz.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Zu Fuß durch die Antike
Zu Fuß durch die antike Welt führt uns Durs Grünbein in dem Gedichtband Der Misanthrop auf Capri. Das Buch versammelt bereits veröffentliche Gedichte sowie einige wenige Erstpublikationen, die meisten Gedichte sind den Zyklen Nach den Satiren (1999) und Erklärte Nacht (2002) entnommen. Durs Grünbein lebt in Berlin, er ist Mitglied der Akademie der Künste und auch in den Bereichen Essay, Übersetzung und Kritik umtriebig. Den neu veröffentlichten Gedichten, die hauptsächlich unter dem Themenbereich der Antike zusammengestellt sind, ist ein wunderbares Nachwort von Michael Eskin beigefügt.
Wind der Welt
Die Poesie-Reihe der Bibliothek Suhrkamp, in der Der Misanthrop auf Capri erschienen ist, nennt sich „Wind der Welt“. Bereits im Juli wurden bei einem Sommerfest die zehn Bände des Programms im Münchner Lyrik Kabinett vorgestellt. Neben Durs Grünbein weht der Weltwind auch Samuel Beckett, Ko Un und Paul Celan heran, dessen Gedicht „Zauberspruch“ der Suhrkamp-Reihe den klangvollen Titel schenkte: „Wind der Welt im Sternenkleid, / Bring der Dunkelheit Bescheid“ heißt es hier. Celan also und auch den russisch-jüdischen Dichter Ossip Mandelstam nennt Michael Eskin in seinem Nachwort zu Grünbeins Gedichtsammlung als wichtige Einflüsse für dessen Poetik und führt den Leser an für die Dichtung Grünbeins wichtigen Schlüsselbegriffe wie die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ heran.
Eskin selbst ist Direktor des „Deutschen Haus“ an der Columbia Universität, das als eine Art Schnittstelle zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Geistesleben fungiert.
Der Titel des Buches, Der Misanthrop auf Capri, verweist auf Kaiser Tiberius, der sich von Rom nach Capri zurückzog und dort angeblich seinen vielen Lastern frönte. Eskin schreibt: „Das Bild des freiwillig im Exil lebenden Misanthropen erweist sich sowohl als historische Vignette als auch als Allegorie auf den ‚neuen Künstler‘, der, laut Grünbein, ‚nirgends zu Hause und nie angekommen‘ ist und dessen sich an Ovid, Catull und andere anlehnender Rekurs auf den klassischen Topos der Dichtung als Waffe ihn in der Tat gleichsam als zeitgenössischen Misanthropen ausweist.“
So wie das individuelle Gedächtnis eine beständige Neuformung des Vergangenen unternimmt – durch Erzählen, durch neues Erleben, durch konstruierte Erinnerung, so folgt Grünbeins Dichtung dieser Spur im großen Gedächtnis, das wir Geschichte nennen. Der Mensch, sein Handeln, Denken und Fühlen bilden den Kern, um den herum Geschichte entsteht. Auch individuelle Geschichten entstehen aus ihm, und diesen Kern berührt die Zeit nur an der Oberfläche. Die, oftmals auch aus einem überlegenen Blickwinkel, aufgebaute Distanz, die man sich in unserer heutigen Gesellschaft oftmals zur Vergangenheit aufbaut, entlarvt er in seinen Gedichten als Schimäre, Trugschluss. So wird ein Konzept von Dichtung selbst als Historie sichtbar.
Wanderer durch die Zeit
Grünbeins Gedichte verbinden Zeiten von der römischen Antike bis in die Gegenwart. Für verklärte Heldenbeweihräucherung ist in seinem Gedichtkosmos kein Platz. Beim Lesen findet man sich ebenso in den Schuhen eines Legionärs auf dem Rückweg einer Schlacht wieder wie in der Gedankenwelt eines grausamen politischen Führers. Wenig später torkelt und hurt man mit den Betrunkenen im nächtlichen Rom, um hiernach Kinder sowie Gladiatoren sterben zu sehen. Zuletzt finden wir uns „im Berlin der Jahrtausendwende“ und stehen vor Vitrinen, in denen sich die Überreste der antiken Kultur befinden.
Es zeigt sich: Durs Grünbein ist nicht nur jüngster Büchner-Preisträger, sondern auch wie ein Kwai Chang Caine der Dichtkunst: wandernd, im Notfall kampfbereit, die Welt um ihn herum philosophisch betrachtend und dichterisch deutend: „Natur, war sie nicht selber Stoa? Tiere reißen, Tiere grasen. Der Pflanzen Gleichmut und die Ignoranz des Wetters sind wie der Fels, an dem der Schmetterling zerschellt mit Namen Psyche…“
Dorothea Kallfass, Die Berliner Literaturkritik, 6.10.2005
Der Menschenfeind als Dichterfreund
Irgendwo dort wo die Novelle zur Schaubühne wird, wo das sich Zeigen zum Parademarsch wird, genau dort ist Durs Grünbeins Gedankengebäude zu Hause. Die Insel der Feindseligen wird zur Heimat des beseelten Dichters. Finde die Felsspalten und die einsamen Buchten, finde das Wort das den Sonnenuntergang beschreibt, den unglaublichen Nachthimmel mit seinen Atributen universeller Reflexion. Selbst die Platitüde des Erdtrabanten wird so zu einer Anschauung die sich als etwas nie vorher Gesehenes darstellt, als etwas nie zuvor Gelesenes, dass sich wie ein Begleiterin für eine gewisse Stunde anbietet. Ich rate jedem Interessierten, nimm das Angebot an. Folge den Pfaden der Grünbein’schen Sprache, sei getragen vom Vorher und Nachher einer reichen Poesie, die sich am Ende eines jeden Gedichtes so herrlich und wunderbar entfaltet. So wird der Misanthrop zum Philanthrop.
Hanno Hartwig, amazon.de, 29.3.2011
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


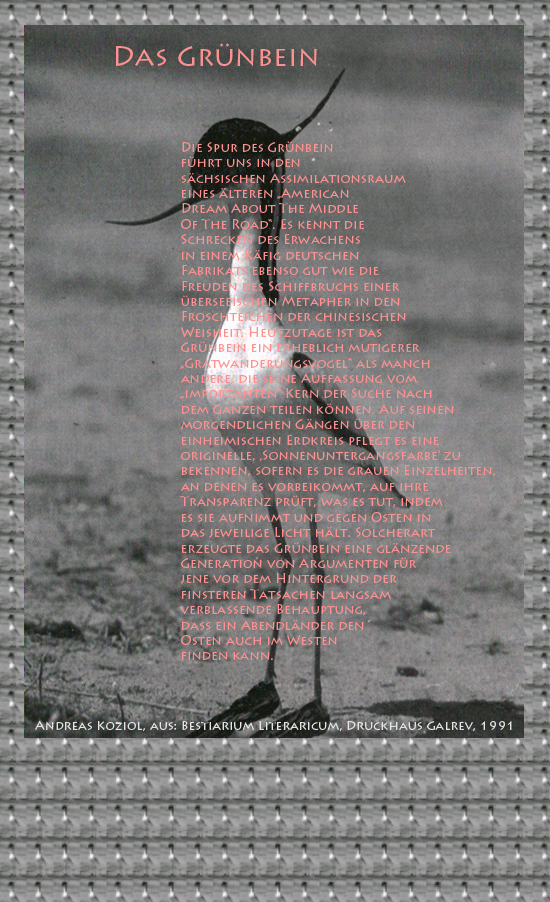
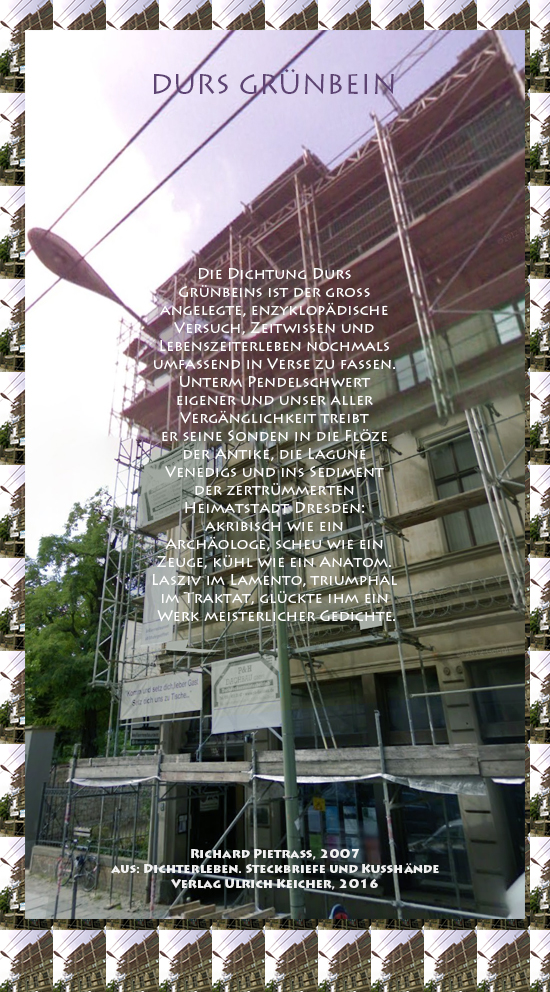












Schreibe einen Kommentar