Durs Grünbein: Liebesgedichte
APRÈS L’AMOUR
Gleich nach dem Vögeln ist Liebe der bessere Stil.
Die Tierhaut entspannt sich, das Herz fängt sich ein.
Flacher Atem bläst Schweiß aus den
aaaaaSchlüsselbeinmulden.
Auf der Zunge zergangen, löschen Spermien den
aaaaaDurst
Auf den Nachwuchs. Die Achselhöhlen, den müden
aaaaaBauch,
Alles holt sich der Schlaf. Wie nach zuviel Theologie
Kehren die Laken sich um. Altes Dunkel am Rand,
Neue Ränder im Dunkel. Die Kniekehlen zwitschern
Zweistimmig stimmlos ihr Post-Coital, ein Rondeau.
Eben noch naß, richten die Härchen wie Fühler sich auf.
Betäubt, summa summarum gestillt, hört dieser Schmerz
Des Lebendigsein bis zur Erschöpfung auf weh zu tun.
Zurück in der Zeit, sind die Körper an keinem Ziel.
Gleich nach der Liebe ist Vögeln der bessere Stil
Nachwort
Jede Sprache hat einen Bereich, in dem sie dem Schwierigsten, Herrlichsten und Gefährlichsten begegnet. Dabei schöpft sie ihre Möglichkeiten so verschwenderisch aus wie nirgendwo sonst, und dennoch erfährt sie gerade hier besonders schmerzhaft die eigenen Grenzen. Es ist der Bereich der Liebe, und der kulturelle Rang einer Sprache bemißt sich auch danach, wieweit sie über die Jahrhunderte hin fähig war, eine Sprache der Liebe auszubilden.
Genau gesagt: eine vollständige Sprache der Liebe. Nicht nur das eigene Entzücken soll laut werden, nicht nur die Schönheit des geliebten Gegenübers, nicht nur die Sehnsucht, ihre Erfüllung oder ihr hoffnungsloses Sich-Verzehren, nicht nur das Scheitern aneinander, die Kälte, der Bruch, der Verrat, nicht nur der Wandel vom ekstatischen Glück in die wohlige Gewöhnung, nicht nur das Augenfunkeln und der Kuß, sondern auch das, worüber man nicht spricht oder nur andeutungsweise, das Körpergetümmel, das wilde Greifen und Fassen und gänzliche Zusammenfinden auf dem geduldigen Bett.
Aber selbst wenn es einmal gelingt, in die Nähe solcher Vollständigkeit zu gelangen, wie dies bei Goethe geschah, von seinen frühsten bis zu seinen letzten Versen, ist das Ziel doch nur auf befristete Zeit erreicht. Denn es ändern sich die Gebräuche der Liebe von Epoche zu Epoche, es ändert sich das Selbstverständnis der Geschlechter, es ändern sich deren Rollen und wechselseitige Deutungen. Soziale Tabus lösen sich auf und neue entstehen. Beides schlägt durch auf die Sprache der Liebe. Diese ist also ebensosehr Epochensprache wie ein Element der gesamten Überlieferung. Was Goethe geschaffen hat, bleibt, und doch steht es dem heutigen lyrischen Reden längst nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung, wie es für Mörike und Heine, selbst für Hofmannsthal noch zur Verfügung gestanden hat. Wer das alte Lied in unseren Tagen anstimmt, muß es, trotz der tausend Klänge im Ohr, auf neue Weise tun.
Durs Grünbein leistet dies für unsere Zeit in erstaunlicher Weise. Gewiß trägt jeder, der auch nur ein einziges gültiges Liebesgedicht schreibt, zu dem großen Projekt bei. Grünbein aber schlägt einen Fächer auf, so breit, so vielfältig blitzend, so überraschend von Bild zu Bild, von Szene zu Szene, daß wir vor einem Panorama der Liebe stehen, der Liebe in unserer Gegenwart. Insofern ist die Zusammenstellung, die er für diesen Band vorgenommen hat, ein Kunstwerk besonderer Art. Es zeigt auf kleinem Raum seine ganze Ars amandi und alle Raffinessen seiner Ars scribendi. Die Kunst der Liebe und die Kunst des Schreibens treten in ein geheimnisvolles Widerspiel. Um der Liebe und der geliebten Frau willen führt der Poet alles vor, was er kann, und um seiner Poesie willen freut sich der Liebende doppelt an jeder Nuance der zärtlichen Gefechte.
Man darf Durs Grünbein einen furchtlosen Dichter nennen. Jede Zeit stellt auch literarische Verbote auf, Listen alles dessen, was, wie man zu sagen pflegt, „heute nicht mehr geht“. In Grünbein haben wir einen, den solche Weisungen nichts kümmern. Er schreibt über Venedig, weil es ihm gefällt, über Venedig zu schreiben, auch wenn ihm hundert Kritiker sagen würden, das sei endgültig vorbei. New York geht, Bangkok geht, Schanghai würde sogar sehr gut gehen, aber Venedig nun wirklich nicht mehr. Ist denn diese Stadt nach Goethe, Platen, Meyer, Rilke und dem moribunden Gustav von Aschenbach nicht literarisch ausgereizt? Für viele wäre das ein ernstes Argument; Grünbein schert sich den Teufel darum. Und siehe, es gelingen ihm ein paar Venedig-Gedichte, die neben den Strophen der berühmten Vorgänger glanzvoll bestehen.
Die Venedig-Gedichte sind nicht zuletzt deswegen so bezwingend, weil sie zugleich Liebesgedichte sind, Verse von einem bettfreudigen Paar, das sich der Wechselwirkung zwischen der ungeheuren Kunst dieser Stadt und seiner eigenen Liebeslust stellt. Schönheit, äußerste, hier wie dort. Hier wie dort Erfahrungen, die sich nicht mehr steigern lassen:
Was gibt es Schöneres, als sich auf Laken auszubreiten?
Mann oder Frau, denkt nach (und scharf), was übertrifft
Die Seligkeit, es unverschämt zu treiben?
Diese Zeilen sind zwar keinem Venedig-Gedicht entnommen, sie enthalten aber am genauesten die eigentümliche Schönheitslehre der Liebe, die bei Grünbein in einem Spiegelverhältnis steht zur Schönheitslehre der Kunst.
Auch von den Malern alter Zeiten zu reden in einem heutigen Gedicht ist anrüchig. „Bildungsbürgerlich“ nennen das die Tabuverwalter. Sie ziehen dieses Wort so rasch wie der Sheriff den Colt. Den furchtlosen Dichter läßt das kalt. Mit dem Ausruf „Ach, Vermeer“ schließt er das Preisgedicht auf die geliebte Frau, das er zeichenhaft ans Ende der Sammlung gestellt hat – eines der hinreißendsten Stücke und ein Liebessignal über alle Literatur hinaus. Eine uralte, längst museal gewordene Praxis des barocken Liebesgedichts, der Blason, erlebt hier ihr modernes Revival. Im Blason zählten die Sänger einst alle Schönheiten der Angebeteten der Reihe nach auf – deine Augen sind wie … deine Wangen sind wie … dein Mund ist wie … dein Haar ist wie … Bei Grünbein erscheinen die Teile des geliebten Gesichts im Spiegel des Bades, aufglänzend über allerlei kosmetischem Krimskrams. Und er reiht sie wahrhaftig aneinander. Doch der optische Taumel, in dem das geschieht, liegt weitab von der ehrwürdigen Pedanterie jener Vorgänger. Ganz nah indessen rückt deren Zeitalter wieder in der Beschwörung Vermeers. Dieser hat das gesammelte Bei-sich-Sein der Frauen in Bildern dargestellt wie kein anderer. Das „Ach, Vermeer“ ist der Dank des Dichters an den Maler, der ihm die Augen geöffnet hat für die magische Aura der Geliebten, wenn sie selbstversunken vor dem Spiegel steht.
Ihre Zeit hat die Liebe, und sie hat ihren Raum. Beides schafft sie sich und erschafft sich darin selbst. Grünbein führt es vor, in immer neuen Variationen, und nicht zuletzt hier erweisen sich seine Gedichte auch als konkrete Philosophie. Daß die Liebe in einem prekären Verhältnis steht zur Zeit, ist eine alte Wahrheit. Sie hat sich in tausend Gemeinplätzen niedergeschlagen. Bald sind sie zynisch, bald resigniert. Sie reden meistens einem Fatalismus das Wort, der an der Liebe nichts anderes gelten lassen will als den Übergang von der Illusion zur Langeweile. Das ist aber eine faule Weisheit, und Grünbein tritt dagegen an. Nicht indem er die Langeweile leugnet. Er kennt diese Schlange im Paradies. Das zeigt sich am raffiniertesten in dem famosen Katzengedicht „Yoni“, welches keineswegs nur von einer Katze handelt. Aber die Langeweile ist nur eine der vielen Gestalten, zu welchen die erlebte Zeit, Bergsons temps vécu, in der Liebe findet. Schon in „Après l’amour“, einem der Gedichte, die Grünbein früh berühmt gemacht haben, fällt die Wendung: „Zurück in der Zeit…“ Die Zeit kann also aussetzen für die Liebenden, kann zum Augenblick ohne Ende werden, durchaus verwandt den ekstatischen Zeiterfahrungen der Mystiker. Das Stichwort „Theologie“ in der sechsten Zeile dieses Gedichts deutet in diese Richtung: die Verzückung ist auch Erkenntnis des Absoluten.
Dem steht die Frage der Dauer gegenüber. Nicht die geringste Leistung des Bandes ist die vielfache Abwandlung dieses heikelsten aller Liebesthemen. Kann das Glück bestehen? Und wie? Wird es nicht naturnotwendig zum Opfer der reißenden, alles zerstörenden Zeit? Grünbein zeigt die Verachtung der Liebenden gegenüber dieser Drohung, in „Camera degli sposi“ zum Beispiel. Er führt den Trotz vor, mit dem das Paar die kommenden Jahre ins Auge faßt, deren lange Reihe es will und bejaht, so im vierten der „Grüße von unterm Vulkan“. Und er fürchtet sich nicht einmal vor dem Begriff der Treue, den doch die Säure der modernen Psychologie längst zersetzt zu haben scheint. Gewiß, er tut es nicht ohne Ironie – „Nibelungentreue“ heißt das Gedicht −, aber sie flimmert vor einem grimmigen Ernst. Und schön entwickelt sich aus dem Bekenntnis zur Dauer auch, was so sehr zu ihr gehört, die Alchemie der Erinnerung. „Denn nichts verliert sich wirklich…“. heißt es einmal. Wenn der eine Tag in Rom, von dem in „Mimosen“ die Rede ist, damals zum Augenblick zusammenschrumpfte, zum Jetzt der Liebe, so gewinnt er dennoch Bestand in der Erinnerung, und sein aufzuckendes Glück lebt jahrelang. Diesem Paradox ist Grünbein inständig auf der Spur.
Zum Nachdenken über Liebe und Zeit gehört schließlich auch das Kind. Verblüffend selbstverständlich fügt sich sein Erscheinen in diese Reflexionen. Im Kind, das so sehr Gegenwart ist, reine, sich selbst begründende Gegenwart, leuchtet eine weitere Dimension des Widerstands der Liebe gegen die Vergänglichkeit auf. Nahezu singulär in der deutschen Literatur ist das Gedicht von der Geburt, dessen Titel, „L’origine du monde“, sich auf Courbets Skandalbild im Musee d’Orsay bezieht. Es will aber den einstigen Skandal nicht weiterführen, sondern verwandelt ihn in einen Akt der Ehrfurcht vor dem gebärenden Leib und seiner winzigen Frucht. Diese tritt ein in das Leben des Paars, ist Zukunft und Erinnerung zugleich. Geheimnisvoll spricht darüber auch „Vorzeitiges Wiedersehen“ – ein Anklang an Hebels „Unverhofftes Wiedersehen“? Denn um ein solches geht es tatsächlich, wenn der Mann in den Augen seiner neugeborenen Tochter die Augen der eigenen Mutter erkennt, plötzlich, nach Jahrzehnten. Und wieder packt ihn die Erfahrung von Dauer und Verschwinden: „Die Zeit tat Sprünge…“
Was von der Zeit gilt, gilt auch vom Raum, gilt von den Räumen der Liebe. Schlafzimmer, Bad und Bett bei Grünbein wären eine eigene Untersuchung wert. So von der Unschuld des Intimsten zu reden haben noch wenige gewagt. Eine Spielart der Furchtlosigkeit auch dies. Dazu tritt das geographische Setting: Berlin, Italien, die Inseln … Die Stunden der Liebe haben ihre Orte. Sie nicht zuletzt fachen die Alchemie der Erinnerung an, aus der sich die Zuneigung erneuert und ihre Dauer genießt.
Die Energie des Nachdenkens, die in diesen Gedichten steckt, wird sichtbar in der Form. Die Verse suchen immer die letzte Verdichtung, eine antike Gedrängtheit. Daher macht sich der Autor auch ein Vergnügen aus dem Nachdichten römischer Texte, geht bei diesen in die Schule und operiert gelegentlich mit Motiven der antiken Liebespoesie. In dem prächtigen Spatzengedicht läßt er die geflügelten Begleiter der Aphrodite in die heutige Großstadt ausschwärmen. Die klassischen Anklänge weisen stets auf den Willen zu Bau und Fügung, ebenso die Annäherung vieler Texte an das Sonett. Erst in der erreichten Form ist ein Gedanke zu Ende gedacht. Goethe hat das einmal die Ballung genannt. Wenn ein Dichter ins Wasser greife, balle es sich in seiner Hand. Allen andern zerfließt es, vertropft und verrinnt wie die Stunden des Lebens. Ihm aber wird es zur festen Gestalt. Sie besteht in der Zeit und läßt die Leser daran teilhaben.
Peter von Matt; Nachwort
Kein anderer Dichter
hat in den letzten Jahren mit so meisterhaften Großpoemen und formenreichen Zyklen beeindruckt wie Durs Grünbein. Auch die Liebe hat in seinen Gedichten ihren Auftritt, als Spiel- und Echoraum von Erotik und Psyche. Seine Liebesgedichte sind wortgewaltig und musikalisch, sinnlich und klar und zeugen von größter Empfindsamkeit.
Der vorliegende Band präsentiert 60 Liebesgedichte Durs Grünbeins; 20 davon, darunter drei Catull-Übersetzungen, werden hier erstmals veröffentlicht. Ein Nachwort von Peter von Matt begleitet die Auswahl des Autors.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2008
Buchkritik
Autor: Durs Grünbein ist einer der wichtigsten jungen deutschen Lyriker. Jetzt ist ein Band mit Liebesgedichten erschienen: rund 40 Gedichte und Zyklen aus zwei Jahrzehnten, die im engeren oder weiteren Sinn von „Liebe“ handeln; auch einige bislang unveröffentlichte Texte sind dabei.
Zitator: Pünktlich immer um dieselbe Zeit
nach Mitternacht hörst du im Bett
ein Stöckelschuhpaar draußen
vor dem Fenster im Alleingang
klappern tak-tak-tak-tatak
nach jedem vierten Schritt ein
Auftakt langsam näher kommend
irgend so ein Stelzfuß (weiblich) mit
geschärften Krallen … während du
dich in den Laken duckst wie
vor dem Sprung erregt von diesem
aufgespreizten rhythmisierten
Klang. Doch sie (die Vogelfrau?
der Vamp?… die große Ralle?)
zieht gelassen weiter ihren Strich
mit der erotischen Mechanik einer
trägen Nähmaschine, die dich an
Normaluhrzifferblätter denken läßt:
„Als er noch einmal hinsah
war es 5 Minuten später.“
Autor: Das ist der „frühe“ Grünbein – wenn man bei einem erst 46jährigen schon von Werk-Phasen reden kann. Das Gedicht stammt aus dem Debüt Grauzone morgens, von 1988. Ein junger Wilder war da am Werk, der in harten, fragmentierten Texten von Einsamkeit sprach, und von seiner Stadt, dem großen, dreckigen Dresden. Er denke „von den Wundrändern her“ sagte er damals. Danach entwickelte sich der Autor zu einer Art lyrischer „Nachhut“ der Antike und Klassik. Seine Texte wurden strenger, ihr Ton, trotz Melancholie, manchmal regelrecht feierlich. Grünbein setzte Bildung und Form gegen postmodernes Durcheinander. Immer wieder spiegelte er diese in Werken und dem lyrischen Gestus der „Alten“. Es gibt kaum einen jungen Autor, der so belesen ist, so viele, gar schwierigste Formen meistert. Nur: Leider fehlt vor lauter Artistik und Bildung manchmal die Sinnlichkeit. So ist es auch in den Liebesgedichten. Er unterfüttert die Erfahrungen des lyrischen Ichs mit Verweisen auf Antike und Mythologie; dazu kommen Anspielungen auf die Literatur-, Kunst- und Geistesgeschichte. Sieht er die Liebste selbstvergessen im Spiegel, denkt er an Vermeer. „Zwei Körper, umschlungen“ sind ihm ein „Verspaar, das hinkt“.Das ist originell, doch da sieht, hört, liebt einer sozusagen „bildungsbürgerlich“. Das ist nicht negativ gemeint; aber ist wirklich Nähe, auch Innigkeit zwischen dem, der spricht, und der, um die es geht – abgesehn vom Intellekt? Und wenn wir schon beim Mäkeln sind: daß einem Autor wie Grünbein Klischees wie „Venedigs Labyrinth“ oder „brütende Hitze“ unterlaufen, verblüfft. Schön dagegen jene Texte, in denen er einfach, klar von der Liebe zu seiner Frau und der Freude über das gemeinsame Kind spricht. Endlich eine, durchaus robust geschilderte, Welt ohne Hades und Hexameter:
Zitator: Es war im dreißigsten der Sommer, zählt man deine,
daß wir zum letzten Mal allein verreisten, nur wir zwei.
Statt deines Kugelbauchs ich sah nur schlanke Beine.
Wir dachten nicht an Embryos, nur an die süße Vögelei
beim Baden nachts im schwarzen Regenteich.
Wie herrlich war das, egoistisch sein. In Serpentinen
lag vor dem Lenkrad ausgestreckt ein grünes Königreich.
Und in den Ohren fing sich Blütenstaub. „Ihr Bienen,
vergeßt den Mohn. Nehmt uns, macht keinen Quatsch!“
Gefährlich lebten wir. Der kleine Fiat war, in voller Fahrt,
mit seiner Windschutzscheibe eine Fliegenklatsche.
„Du bist der einzige, dem ich verzeihen könnte“, sagte sie,
„wenn er mich totfährt.“ Und es klang sehr ernst, sehr zart.
Wenn das nicht Liebe war, dann gabs uns beide nie.
Autor: Wieder folgt Grünbein dem Sonett, der Gedicht-Form schlechthin. Aber er sieht es nicht so eng, gibt das klassische Strophen- und Reimschema teilweise auf. Überhaupt nutzt er viele „unreine“, also ungenaue Reime, bricht den hohen Ton mit Prosaischem. So entstehen „klassische Verse mit neuer Tonalität“, wie er einmal sagte. Wobei diese, von Rhythmuswechseln abgesehn, hoch musikalisch sind – und Grünbein immer wieder schöne Bilder für, auch körperliche, Liebe findet. „Deine Finger südwärts gleiten“, heißt es einmal: was die Bewegung auf dem Körper des Liebsten meint, zugleich Sonne, Wärme, Méditerranée evoziert.
Matthias Kußmann, Südwestrundfunk, 22.6.2009
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Frank Milautzcki: Beredsame Zeugen einer anderen Sprache
fixpoetry.com, 26.6.2009
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


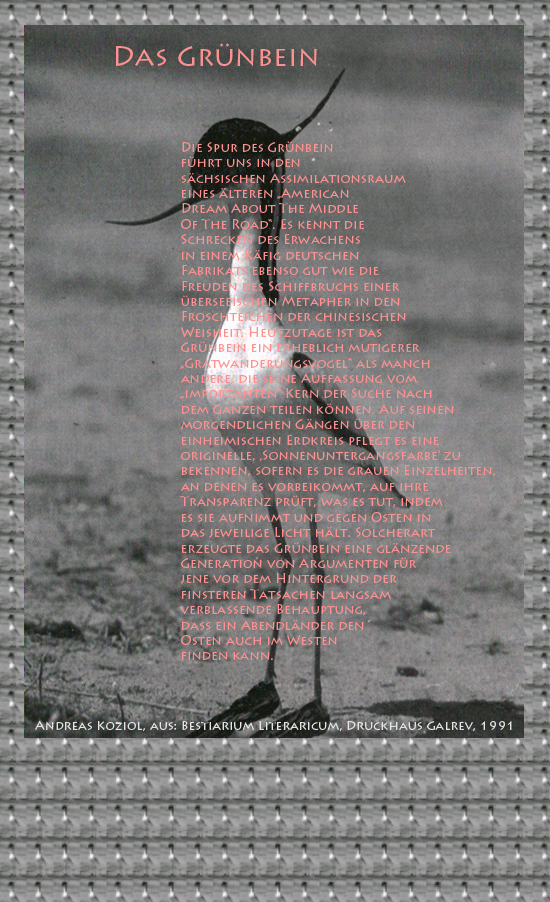
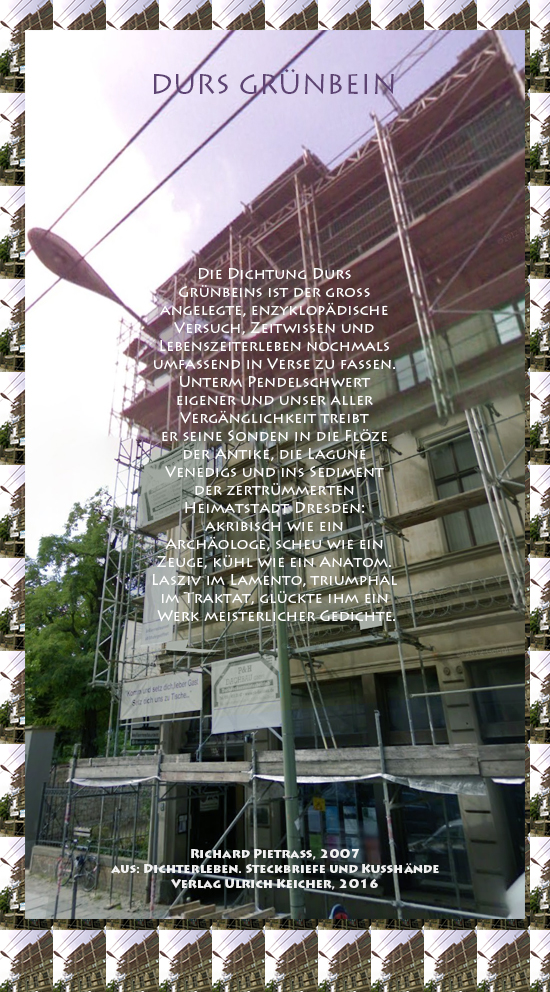












Schreibe einen Kommentar