Durs Grünbein: Lob des Taifuns
Pingpong im Hausflur.
Oder sind das die Schritte
Der Frau mit dem Tee?
(25. Oktober 1999
Tokyo / Chuo University
Vor der Lesung Versammlung im Professorenzimmer)
Siebzehn Silben des Augenblicks
1
Einmal bin ich von einem Japankenner gefragt worden, ob ich denn etwas von der Landessprache verstünde. Mir war nicht klar, ob die Anfrage scherzhaft gemeint war oder in vollem Ernst, der Forschende hinter der Briefadresse verzog keine Miene. Also gab ich ihm nach Kinderart einigermaßen aufrichtig Auskunft und schrieb: Nein, ich bin des Japanischen leider nicht mächtig. Aber wer, außer den Einheimischen, wäre das schon? Ich weiß um die jahrelangen Bemühungen einiger mir nahestehenden hartnäckigen Deutschen und ihre unfaßbaren Erfolge auf diesem Gebiet, die ich nur bewundern kann. Auch meine Kenntnis der japanischen Literatur beschränkt sich auf die üblichen Klassiker unter den Versdichtern. So bedauere ich beispielsweise, einen gewissen Mokichi Saitô, einen Dichter und Arzt, dessen Interessen und Lebenslauf in manchem dem Gottfried Benns ähneln, allenfalls in Prosa-Ausschnitten lesen zu können, nur weil dieser wie die meisten modernen japanischen Klassiker zwar in Fachzeitschriften beachtet, aber mit seinen Hauptwerken nie ins Deutsche übersetzt wurde. Von den Erzählern haben mich besonders Ryûnosuke Akutagawa und Yasunari Kawabata mit ihren wie hingehauchten Geschichten bezaubert. Yasushi Inoue war der letzte, der diese Gabe besaß, ich rede nicht von den heute gängigen, international viel erfolgreicheren Namen. Wahrscheinlich ist es um das kostbare Flackern der Andersheit nun insgesamt etwas schlechter bestellt als in den Zeiten vor der weltweiten Vernetzung und Übersetzung von Literatur. Aus japanischer Sicht hat der verschwindend geringe Romantikanteil in der deutschen Gegenwartslyrik sicher auch etwas Enttäuschendes…
Ein bestimmter Roman von Kôbô Abe führte in jungen Jahren dazu, daß ich eine Zeitlang nachts schweißgebadet aufwachte, weil ich geträumt hatte, ich sei in ein unterirdisches Sandgefängnis in einer namenlosen Wüste eingesperrt und dort vergessen worden. Das erste, was ich kennenlernte und mit größter Aufmerksamkeit zu studieren begann, waren tatsächlich Haikus. Sie wurden mir auch von anderer Seite nahegebracht, gehörten sie doch neben allerlei buddhistischem Religionstalmi zum neuen Einmaleins der Beatniks, die hier an Ezra Pound anknüpften, den wohl wichtigsten Import-Export-Händler für Weltpoesie im Zwanzigsten Jahrhundert. Auch aus einigen Musikstücken und Schriften des Komponisten John Cage glaubte ich damals ein gesteigertes Interesse an dieser poetischen Kurz- und Kürzestform herauszuhören. Später kaufte ich mir, in den schmucken Ausgaben von Dieterich, eine ganze Handbibliothek japanischer Dichtung zusammen, also die bekannten Namen Bashô, Buson, Issa, auch die klassischen Anthologien, ergänzt das Ganze um englischsprachige Ausgaben, die in der Mehrzahl entdeckungsfreudiger waren. Dies ist nicht der Ort, von Forschungsreisenden und Pioniergeistern wie Engelbert Kaempfer oder Franz von Siebold zu reden, die als Taxonomen japanischer Natur und Kultur die folgenreichen ersten Schritte setzten. Noch Goethe hatte von den Schätzen dieser Kultur nur eine ganz ungefähre Vorstellung. Beim Blick über den West-östlichen Divan hinaus sah er allenfalls schemenhaft in der Ferne Buddhastatuen und schweigsame Zedern. Es gab dann den Österreicher August Pfizmaier (der 1847 erstmals ein japanisches literarisches Werk ins Deutsche und damit auch erstmals in eine europäische Sprache übersetzte) und den Deutschen Karl Florenz sowie einige andere Europäer. Eine größere Öffentlichkeit aber erreichte die Japanologie erst am Ende des 19. Jahrhunderts, dem umtriebigen Propagator Lafcadio Hearn sei Dank, der um 1900 als Dozent für englische Literatur an der Kaiserlichen Universität von Tokyo gewirkt hatte. Mit dem Finderglück des Ausländers war dieser irische Journalist in eine einzigartige Position geraten. Das neu erwachte Interesse an Fernost machte seine Prosasammlungen im Westen eine Zeitlang geradezu populär. Vor allem die Geistergeschichte, eine japanische Spezialität über viele Jahrhunderte hinweg, rückte durch ihn in den Mittelpunkt einer Aufmerksamkeit, die sich an den grotesken und arabesken Erzählungen des E.A. Poe geschult hatte. Die zweite Entdeckung verdanke ich Ezra Pound, seiner ruh- und rastlosen Vermittlung der Schriften aus dem Nachlaß des Japanologen und Kunsthistorikers Earnest Fenollosa. Nach der Lektüre dieser Studien zum klassischen Nô-Theater, seiner bahnbrechenden Überlegungen zum Charakter der chinesischen Schriftzeichen (die im Japanischen kanji heißen) und ihrer Funktion in der Dichtung sah ich vieles mit neuen Augen; von hier nahm die eigene Recherche ihren Ausgang.
Dann schenkte mir ein befreundeter Architekt eines Tages Tanizakis Lob des Schattens. Das war nun eins von den Büchern, die man unwillkürlich wie ein Brevier zu lesen beginnt. „Tatsächlich gründet die Schönheit eines japanischen Raumes rein in der Abstufung der Schatten“, heißt es da. Mit Sätzen wie diesem näherte man sich den allesverändernden Kriterien, die eine neue Schule der Wahrnehmung begründen konnten: Es ging um Schatten, Unwägbarkeiten, um das Dazwischen mit all seinen Valeurs, eine Ästhetik des Luftigen und Flüchtigen, um ein aus feinsten Gradationen erwachsendes Wohlgefühl – für das es in der japanischen Kunst, Literatur und Architektur überhaupt zum ersten Mal Muster und Beispiele gab. Es waren da wimpernfeine Unterscheidungen am Werk, die sich, wie ich bald herausfand, schon früh in der japanischen Literatur gezeigt hatten. An ihnen ließ sich ein für das Selbstbewußtsein der Japaner noch heute entscheidender Schritt ablesen: die Ablösung von der überstarken, inspirierenden Tradition Chinas. So fand sich etwa bereits um das Jahr 1000 im berühmten Kopfkissenbuch der Dame Sei Shônagon ein ästhetisches Raffinement, das den eigenen Weg deutlich markierte. Es war der Jahreszeitenwechsel tief im Inneren des Subjekts, der hier zum allesdurchwirkenden Thema wurde. Ein nie gekannter Facettenreichtum in allen Dingen, Farben, Gesten und Stimmungen verschaffte der japanischen Poesie ihren zeitüberdauernden Sublimationsvorsprung. Hier wurden seit Jahrhunderten mentale Effekte erzeugt, lyrische Minimalsensationen, wie es sie bei uns erst im europäischen Symbolismus, bei Mallarmé und den Seinen, und nachher in der Experimentalliteratur der Moderne gab.
Begeistert war ich von der bambusartigen Biegsamkeit ihrer Kategorien, von der befreienden Eleganz eines Materialismus, dem alles Schwergewichtige fremd war, der die besten Eigenschaften des Holzes gleichsam auf das Denken und die menschlichen Verhaltensweisen übertrug. Es erging mir damit wie so manchem europäischen Künstler des Fin de siècle, der sich von dieser unendlich abstufungsreichen, flexiblen, bei aller Finesse jedoch immer konkreten Naturästhetik aus dem alleröstlichsten Asien so angesprochen fühlte, daß Japanismus ihm gleichbedeutend wurde mit Avantgarde. Ich konnte es einem Whistler, Toulouse-Lautrec, Marcel Proust nachfühlen, daß sie sich hatten bezaubern und anregen lassen. Einmal sensibilisiert, suchte ich selbst immer weiter in dieser Richtung.
2
Mehr als alles andere hat mich damals die Gedichtsammlung eines gewissen Issa gefesselt, seine für japanische Verhältnisse höchst unorthodoxe Sterbechronik in Haikus: Die letzten Tage meines Vaters. Mit ihm, dem Goethe-Zeitgenossen (1763–1827), beginnt eine neue Epoche der Haiku-Dichtung. Es zeigte sich, daß sie, in ihrer anthropologischen Konzentration auf das Wesentliche, das zugleich die Alltäglichkeit jeder gottfernen Existenz ist – Familie, Tagesablauf, Sterblichkeit −, auch für den Europäer sofort eingängig war. Nicht daß europäisches Denken Maßstab aller Menschlichkeit wäre, befreiend war aber doch die konfirmative Freude, mit der ein Leser von Lessing und Goethe, Moritz und Hölderlin dieselbe Spezies wiedererkannte, wenn auch im andern Gewand. Denn ob Geheimratsgehrock oder Mönchskutte des Wanderdichters (dem Habit des Heiligen Franziskus nicht unähnlich), letzten Endes blieben das Äußerlichkeiten vor der Tatsache unbewußter Verbundenheit im geräumigen Inneren des poetischen Menschen.
Man hat Issa zügellose Subjektivität nachgesagt, extreme Verstöße gegen die ausgewogen milde Prosa-Pinselei des klassischen haibun-Stils. Das alles erledigt sich schnell, macht man sich erst einmal klar, welches Wagnis hier eingegangen wurde. Ich las in den Aufzeichnungen eines Erdenbürgers, der keinen Moment die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des eigenen Lebens vergaß, und daß alle Dinge auf der Welt nur von kurzer Dauer sind und schneller als Blitze verzucken. Anders gesagt: ich war, was mir in der heimischen Literatur immer nur ausnahmsweise widerfährt, spontan ergriffen. Ein Blitz, ein Zufallssplitter fernöstlicher Poesie hatte einen seiner nie vorgesehenen Adressaten getroffen. Zum Beispiel dieser hier:
Wunderschön ist sie
durch das Loch der Schiebetür gesehen:
Die Milchstraße!
Dazu muß man wissen: das Buch handelt von den quälenden letzten Wochen im Leben des geliebten Vaters, von den Ohnmachtsgefühlen des Sohnes. Dem Gedicht gegenübergestellt ist die schockhafte Einsicht in den hoffnungslosen Zustand des Kranken, nachdem die Ärzte ihn aufgegeben haben. Wie fortgeblasen war auf einmal der Unterschied zwischen ihrer und unserer Wahrnehmung. In der Konzentration auf den intensiv erlebten Augenblick schmolz alle Fremdheit dahin. Man war einander doch im Grunde verwandt, nur einer der vielen Mitversterbenden (symparanekromenoi), wie Kierkegaard irgendwo sagt. Bestätigt fand ich, was mir seit langem das Entscheidende ist bei jeder Lektüre: Wir Planetarier sind ein Gehirn.
Über alle Sprachbarrieren und jeden Exotismus hinweg gab es etwas, das uns gemeinsam war. Ob Tanka, Distichon, Ghasele oder Terzine, es ging noch jedesmal um Aussagen wie diese: „Keiner, der lebendigen Leibes in diese Welt hineingeboren wird, entrinnt den Beschwerden von Krankheit und der Grausamkeit des Todes.“ Eine der drei für den Buddhismus grundlegenden Einsichten (in Sanskrit trividyâ – man vermeint, daß von da unser Ausdruck Trivialität rühren muß) lautet in Kürze: Erstens ist alles unbeständig, zweitens Leiden und Tod unterworfen und drittens vollkommen ichlos. Mit anderen Worten, das Sein kümmert sich zwar um vieles, aber nicht um uns im speziellen. Von daher also wehte der Wind. Es war der Ostwind, der mir nur allzu Vertrautes herüberbrachte. Man ging den japanischen Gedichtsensationen auf den Leim, wie man in unseren Breiten den Offenbarungen aller spirituell Hochdisziplinierten folgen konnte, denen der Vorsokratiker und des Meister Eckhart ebenso wie denen Goethes oder der Emily Dickinson.
3
Befragt nach dem Zustandekommen dieser Haiku-Sammlung, kann ich nur beteuern: Es waren Tagebuchaufzeichnungen, mehr anfangs nicht. Daß ich sie überhaupt hergezeigt habe, hat mit einer liebenswürdigen Eigenschaft der Japaner zu tun – einem nur schwer unterdrückbaren Narzißmus in allen Belangen der eigenen Kultur. Nachdem sich die Sache bei meinen Gastgebern herumgesprochen hatte, sind sie einfach neugierig geworden auf die Versuche des europäischen Amateurs. Ein befreundeter Professor hatte als erster davon Wind bekommen, und nun war, bei der Zusammenstellung einer japanischen Ausgabe meiner Gedichte, von größtem Interesse, was ich bis dahin nur als ein Privatvergnügen erachtet hatte. Man hat sie mir regelrecht abgehandelt, diese Reisenotizen in Stenogrammform. Mir, der ich nie photographiere, schien das Haiku die günstigste Alternative zum Polaroid – einer Technik, die nun ihrerseits obsolet ist. Es ging mir darum, die einzelnen inneren Aufnahmen sofort begutachten zu können – auf einer weißen Notizbuchseite. So absurd es erscheint, ich bin, unterwegs im Heimatland der Digitalkamera, nicht eine Sekunde lang auf die Idee gekommen, den Stift beiseite zu legen und es einmal mit einem anderen Verfahren zu versuchen. Was man mir über die altjapanischen Holzschnitte und ihre Technik des ukiyoe gesagt hatte, galt auch für meine eigenen flüchtigen Hervorbringungen. Es waren Bilder der auf der Oberfläche schwimmenden Welt. Nur daß in diesem Fall ein paar Worte genügten (um genau zu sein: siebzehn Silben), um den jeweiligen Schnappschuß festzuhalten.
Das allerdings war die stillschweigende Abmachung: alles mußte sogleich notiert werden. Kein Zögern, kein langes Umkreisen des Motivs, das Inbild sollte im nächsten Augenblick Schrift werden. Darin aber unterschied es sich bereits von einer gewöhnlichen, gut ausgeleuchteten Impression. Die Ökonomie des Ausdrucks erzwang so etwas wie eine mentale Sofortreaktion. Hierin eben lag ja das Versprechen der Haiku-Poetik: etwas festhalten zu können, das im Moment seines Erscheinens einen packenden Eindruck gemacht hatte und doch nur flüchtig aufscheinen konnte, bevor es verging – eine Geste, eine Straßenszene, ein Gedanke, die Erscheinung eines wildfremden Menschen, irgendein nichtiges existentielles Etwas. Unschätzbar war sie, diese Methode, die es einem erlaubte, Vergänglichstes einzufangen in Form von mikrosemantischen Intervallen. Selten hat ein so geringes Quantum Sprache eine so enorme Wirkung gehabt wie im japanischen Gedicht, und selten war auch die Einprägekraft, der mnemotechnische Koeffizient, größer als dort. Ein Zuruf genügt, und die Trance des ersten Augenblicks ist abermals da. So sehe ich wieder den Mönch vor mir, in eine Art Schildkrötenstarre verfallen, inmitten des Besucherstroms meditierend, und hinter ihm den Tempel mit der hochgelegenen Holzterrasse, die Allee aus Rot-Kiefern und jenen Nachmittag in Kyoto (der so niemals wiederkehrt). „Und nichts geht über ein Wort, das der Mensch zu hören bekommt, solange er lebt“, sagt Issa.
4
Die meiste Zeit bin ich allein unterwegs gewesen, und das aus gutem Grund. In jeder Begleitung liegt eine Einschränkung der Wahrnehmungsfreiheit. Von einem Stadtführer mag man manches zu hören bekommen, was einem sonst entgangen wäre, aber die Augen blenden doch leichter ab, während er redet und redet. Am Ende muß man den ganzen Weg noch einmal gehen, weil man die ganze Zeit zu sehr an diesem schwatzenden Gängelband ging. Im Museum lasse ich den braven Kunsthistoriker gern stehen und wandere lieber ohne Kommentar durch die ausgestorbenen Nebensäle. Nur einmal habe ich mich überreden lassen und bin einer charmanten Japanerin durch das Labyrinth der Stadt Tokyo gefolgt. Und was glauben Sie, was geschah? Der Ariadnefaden ist mir schon auf den ersten Metern aus den Händen geglitten, ich verlor vollkommen die Orientierung. Eine U-Bahn-Fahrt auf eigene Faust mag eine gewisse Herausforderung sein, im Schlepptau einer Einheimischen verfällt man sofort in die Unachtsamkeit des Kindergartenkindes, das hinterher nicht mehr sagen kann, wohin der Ausflug noch einmal geführt hat. Die junge Dame war übrigens jene Klavierspielerin, die geklagt hatte, ihre Hände seien zu kurz geraten und sie selbst daher leider unbegabt für eine perfekte Darbietung von Brahms. So war ich denn hin- und hergerissen zwischen ihrer melancholischen Erscheinung und den verschiedenen lokalen Höhepunkten, die mir nunmehr als Programm von sightseeing entgegentraten. Das war nicht besonders schlimm, aber es hat den Assoziationsspielraum des Flaneurs doch stark eingeschränkt. Mehr als einmal habe ich das Hotel durch einen Seitenausgang verlassen, um ungestört in den Alltagsstrom einer japanischen Metropole zu entkommen und darin unterzutauchen, auch auf die Gefahr hin, in einer hundertprozentig unbekannten Gegend zu landen. Wie heißt es bei Issa?
Meine Heimat – bah!
Bis zur allerletzten Fliege
setzt jeder jedem zu!
Ich habe keine Ahnung, wie das Haiku im Original klingt, aber das bah in der ersten Zeile scheint mir doch ein weltweit verstandener Code.
5
Viermal bin ich innerhalb der letzten zehn Jahre nach Japan gereist, und jedesmal wuchs das Verlangen nach diesem wahrhaft fernen, fernöstlichen Land. Wenn ich ergründen sollte, was mich so heftig anzog, fallen mir nicht zuerst die kunstvollen Lanschaften ein mit ihren gedämpften, wie von blauem Dunst verschleierten Perspektiven, nicht die Tempel, aus Kiefernhainen hervorleuchtend, oder die anheimelnden Formen des Regens (der hier immer etwas Tröstliches, die Seele Stärkendes hat), auch nicht die vielphotographierten Megacities, diese Ansammlungen von Abertausenden elektronischer Bienenstöcke (allein im Großraum Tokyo leben rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung), ich denke dann vielmehr zuallererst an diesen erstaunlichen Menschenschlag. Es hat lange gebraucht, bis ich bei einem Philosophen auf die Zauberformel stieß, die mir meine eigene unklare Faszination begreifen half. In einem Gespräch über Hegel und das Ende der Geschichte aus dem Jahre 1968 empfiehlt Alexandre Kojève die japanische Kultur als Alternative zum American way of life und kommt mit folgender überraschender Beobachtung: „Was uns Japan lehrt, ist daß man den Snobismus demokratisieren kann. Japan, das sind 24 Millionen Snobs. Neben dem japanischen Volk ist die englische High Society ein Sammelsurium von betrunkenen Seeleuten.“
Daran mag manches überzogen sein, zutreffend ist jedoch der Hinweis auf die Seeleute der einstigen westlichen Imperien, denn es waren Seemächte, die Portugiesen und Spanier, die in Japan die Reaktion einer Muschel auslösten und es mit ihrer Zudringlichkeit dahin brachten, daß sich das Land lange Zeit vor der Geschichte verschloß, während es allerdings einen kontrollierten Handelsverkehr mit Holland aufrechterhielt. Mehr als in der Tradition der alten Samuraigeschlechter, die von selber verblaßte und ohnehin nur die oberen Klassen betraf, liegt im Boykott der Verwestlichung, in einer allenfalls argwöhnisch kontrollierten Öffnung gegenüber fremden Kulturen die Wurzel des erwähnten volkstümlichen Snobismus. Es ist dies aber keine Haltung, die in reiner Blasiertheit erstarrt wäre. Auch hält sie sich nicht lange mit der Idee ihrer eigenen Überlegenheit auf, sieht man vom berechtigten Stolz auf die heimische Rohfischküche, gewisse Mikro-Technologien und die komplexe Sprache mit den diversen Kognitionsvorteilen, die man ihr nachrühmt, einmal ab. Das Überraschende am Snobismus der Japaner ist, daß man ihn in allen Gesellschaftsschichten und Generationen antrifft und daß er besonders gut in den Helligkeitszonen der Populärkultur überlebt. Er ist nicht nur, was er lange Zeit in Europa war, das Vorrecht einiger Bohemiens. Man sieht ihn an der wohlfrisierten Hausfrau, die ihre Bonsai-Bäumchen selbstversunken mit der Nagelschere stutzt, ebenso wie an dem pubertären pickeligen Otaku, der in enger Wohnzelle monomanisch seiner abstrusen Sammelleidenschaft nachgeht (Knöpfe alter Schuluniformen oder Modellflugzeuge in der Nußschale) und darüber die Außenwelt längst vergessen hat. All diese gleichzeitig kollektivierten wie atomisierten Existenzen pflegen eine Extravaganz im stillen, von der sich im Westen allenfalls der Künstler noch einen Begriff macht.
Dafür soll hier gleich am Eingang des Buches das Bild des kleinen Kabuki-Spielers stehen. Er ist der inoffizielle Vertreter einer ebenso rätselvollen wie eigensinnigen Nation, ein kleiner Theaterprinz. Verloren steht er auf seinen Strohsandalen und signalisiert doch mit trotzigem Gesichtsausdruck: Paßt nur auf, ich werde dereinst berühmter als alle meine Vorgänger sein.
Durs Grünbein, Nachwort
„Wasser und Wolken ziehen wie immer dahin.“
Das Sonett, diese strenge Gedichtform, ist in Japan nicht nur durch Übersetzungen sehr bekannt geworden, sondern wurde unter dem Einfluß der europäischen Literatur von japanischen Dichtern auch adaptiert. Erfüllen aber derartige Übersetzungen und eigene Dichtungen in dieser Form noch den Begriff des „Sonetts“? Während die sonettypische Konstruktion von vierzehn Zeilen in vier Teilen beibehalten werden konnte, mußte auf regelgerechte Endreime weitgehend verzichtet werden. Haben also Sonette auf japanisch keinen Wert, sind sie nur mißlungene Merkwürdigkeiten? Auf keinen Fall. Sonette bildeten einen wichtigen Teil sowohl in der 1905 erschienenen, von Bin Ueda übersetzten Anthologie von Gedichten aus Europa als auch in der Sammlung französischer, von Daigaku Horiguchi ins Japanische übertragener Gedichte aus dem Jahr 1925. Ohne diese recht einflußreichen Bücher hätte sich die japanische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmt ganz anders entwickelt. Darüber hinaus bilden die japanischen Sonette von Chûya Nakahara und Michizô Tachihara aus den 1920er und 30er Jahren eines der schönsten Kapitel in der Geschichte der modernen japanischen Lyrik. Im Versuch, die eigene literarische Sprache an eine fremde Form, soweit es geht, anzupassen, eröffnen sich neue, noch unbekannte Möglichkeiten. Die durch eine solche Aneignungsleistung belastete Sprache wird reicher und ausdrucksstärker, wie belastete Muskeln kräftiger und leistungsfähiger werden. Dafür bietet die Sonett-Rezeption in Japan ein schönes Beispiel.
Eine ähnliche Rolle wie das Sonett für die japanische Literatur spielte in Europa vielleicht das Haiku. Im frühen 20. Jahrhundert wurden Haikus nicht nur in verschiedene europäische Sprachen übersetzt, sondern sie wurden in diesen Sprachen auch geschrieben. Das Sonett in Japan und das Haiku in Europa: Der rege Verkehr zwischen Europa und Japan, der in den 1850er Jahren einsetzte, brachte einige Jahrzehnte später literarische Früchte in beiden Kulturen hervor. Frankreich war das Zentrum der Haiku-Rezeption in Europa. Dort hatte die Rezeption der japanischen Kunst die der japanischen Literatur vorbereitet, und es gab sogar die sogenannte Haikai-Gruppe, einen Kreis französischer Haiku-Lyriker. Auch der späte Rilke nahm die Haiku-Rezeption in Frankreich wahr. Er beschäftigte sich mit dieser Form in seinen letzten Lebensjahren und verfaßte selber einige Haikus, bald auf französisch, bald auf deutsch. Auch seine berühmte Grabschrift aus dem Jahr 1925 („Rose, o reiner Widerspruch, Lust, / Niemandes Schlaf zu sein unter soviel / Lidern“) wurde von ihm wahrscheinlich als Haiku gedacht.) „Un bref étonnement“, so heißt die von Rilke zitierte Definition des Haikus durch eine der zentralen Figuren der Haikai-Gruppe, Paul-Louis Couchoud. Unter den Eigenschaften des Haikus fiel Couchoud und Rilke vor allem die pointierte Kürze auf – und dabei ist es tendenziell geblieben in der weiteren Haiku-Rezeption durch europäische Lyriker. Knappheit und Dichte waren die Herausforderung, der sie sich in ihrer eigenen Sprache stellten, um diese zu stärken. Formelle Regeln für Haikus wurden dabei sehr oft vergessen – was zwar Fachleute befremdete, aber eine eigene durchaus vielfältige Haiku-Sprache hervorbrachte.
Von deutschsprachigen Schriftstellern wurden Haikus nur in begrenztem Umfang geschrieben. Die verstreuten deutschen Haikus Rilkes und seiner Zeitgenossen nehmen sich fast wie Nebeneffekte der Haiku-Rezeption in Frankreich aus. Daß Klabund in seinem Roman Spuk (1922), der „Chinesisches und Japanisches sorglos durcheinander“ mischt, ein „Haiku“ in Phantasieform als chinesisches Gedicht bezeichnete, illustriert den Stand des deutschsprachigen Haiku-Dichtens vor dem Zweiten Weltkrieg. 1953 gelang es Karl Kleinschmidt zum ersten Mal, einen deutschsprachigen Haiku-Band zu publizieren. Imma von Bodmershofs ab 1962 veröffentlichte Haiku-Bände trugen viel dazu bei, die Gattung des deutschen Haikus zu etablieren. Diese aufs Haiku spezialisierten Lyriker haben jedoch Schwierigkeiten, einen festen Platz in der Geschichte der deutschen Literatur zu finden. Einige Kurzgedichte Brechts und Eichs ähneln Haikus, werden jedoch nicht als solche bezeichnet. Auch Thomas Kling sei hier genannt, der sich in seinem Gedichtband brennstabm mit dieser japanischen Gattung beschäftigt hat; doch bilden Haikus nur einen kleinen Teil seines Buches. Mit diesem Band der Insel-Bücherei stellt Durs Grünbein alle vier in Haikus verfaßten Tagebücher seiner Japan-Reisen zusammen: ein großer Schritt in der Geschichte der deutschsprachigen Haiku-Dichtung.
Im Zentrum der japanischsprachigen Literatur standen jahrhundertelang die vom Tennô, dem japanischen Kaiser, herausgegebenen Sammlungen von Waka (japanischen Gesängen), als deren Gipfel die erste (Kokinwakashû) aus dem frühen 10. und die achte (Shinkokinwakashû) aus dem frühen 13. Jahrhundert herausragen. Die meisten Waka waren dabei Tanka, Kurzgedichte aus fünf Teilen, in der Regel in jeweils 5 / 7 / 5 / 7 / 7 Moren und 31 Moren insgesamt. Nach der achten Sammlung brach eine Blütezeit der Kettenlyrik (renga) an. Dabei handelt es sich um das gemeinsame Verfassen einer Reihe von Tankas durch verschiedene Personen; die humoristische Kettenlyrik (haikai no renga, „haikai“ bedeutet Humor) wurde in der weiteren Entwicklung der Form dominant; Hokku, der erste Teil der Kettenlyrik, der aus 5 / 7 / 5 Moren besteht, wurde eigenständig. Schon bei Bashô (1644-94), dem größten Meister der Haiku-Geschichte und deren Erneuerer, war der humoristische Charakter von sowohl haikai no renga als auch von Hokku nicht mehr explizit. Dies ist, in Kürze, die Entstehungsgeschichte der lyrischen Form aus insgesamt 17 Moren, die heute meistens Haiku, aber auch Haikai oder Hokku genannt wird.
Das Haiku war lange Zeit nicht autonom. Es war ursprünglich der erste Teil einer Kettenlyrik, der sich auf die Gelegenheit des Zusammensitzens und -dichtens beziehen sollte und zum Beispiel ein Gruß des Gastdichters sein konnte. Das Haiku gehörte also zu einer gesellschaftlichen Gelegenheit. Auch als ein von der Kettenlyrik abgekoppeltes Gedicht wurde das Haiku gern in einen Kontext integriert. Das Reisetagebuch war dafür eine wichtige Form, insbesondere bei Bashô. Außerdem wurden Haikus gern räumlich installiert – zum Beispiel in ein Bild kalligraphisch eingeschrieben und aufgehängt. Alle drei Haiku-Meister, die Grünbein in seinen Tagebüchern nennt, Bashô, Buson (1716–83) und Issa (1763–1827), waren Dichter, Kalligraphen und Maler zugleich. Wird also ein Haiku, das ein Dichter-Kalligraph-Maler auf einem Faltfächer mit einem Bild gekoppelt geschrieben hat, aus diesem Kontext herausgenommen und in eine Taschenbuch-Anthologie aufgenommen (was heutzutage überall auf der Welt geschieht), liest der Leser ein Fragment.
Grünbein ist in seiner Haiku-Dichtung zunächst Traditionalist. Mag er sich auch in jungen Jahren an haikuähnlichen Kurzgedichten geübt haben, so bediente er sich, sobald er Haikus für die Öffentlichkeit schrieb, immer entweder der Form der Kettenlyrik oder des Reisetagebuchs. Als er 1999 zum ersten Mal Japan besuchte und anfing, sich mit dem Haiku ernsthaft auseinanderzusetzen, schrieb er schon beides: Zum einen war er neben Uli Becker als Gast aus Deutschland an einem deutsch-japanischen Kettengedichtprojekt beteiligt, bei dem auf der Gastgeberseite hervorragende japanische Lyriker (Makoto Ôoka, Junko Takahashi und Shuntarô Tanikawa) standen. Die Beteiligten, die deutschen und die japanischen Dichter wie auch die deutsch-japanischen Übersetzer, befreiten sich zwar von der Pflicht, in einer bestimmten Silben- bzw. Morenanzahl zu schreiben. Das Projekt war jedoch als eine bewußte Weiterentwicklung der traditionellen japanischen Kettenlyrik gedacht. Zum zweiten begann Grünbein damals, das Tagebuch seiner Japan-Reisen in Haikus und zum kleineren Teil in Tankas zu schreiben. Außerdem ließ Grünbein seine Haikus installieren – nicht auf einem Faltfächer, aber in einem ähnlichen Kontext. Die Buchkünstlerin Veronika Schäpers gestaltete nämlich mit einer Auswahl der Haikus aus den Tagebüchern seiner ersten drei Japan-Reisen ein komplex gebautes, mit Kalligraphien geschmücktes Leporello.
Grünbeins erster Zyklus enthält auch eine Reflexion über die literarische Gattung des Reisetagebuchs oder über das Phänomen, reisend zu dichten. Ein Eintrag lautet:
Wiederaufgebaut hat
Das Teehaus des unbehausten
Der behauste Dichter.
[„…“ Besuch im Gedenkhaus für den Dichter Buson, der in seinem Obergarten einen kleinen Teepavillon errichten ließ. Dort wurden, in Erinnerung an den Aufenthalt des berühmten Bashô am selben Ort hundert Jahre zuvor, Lesungen abgehalten. „…“]
Hier zitiert er versteckt das wichtigste unter den japanischen Haiku-Reisetagebüchern: Bashôs Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland, das mit einem Li Po-Zitat beginnt:
„Sonne und Mond, Tage und Monate verweilen nur kurz als Gäste ewiger Zeiten“, und so ist es mit den Jahren auch: sie gehen und kommen, sind stets auf Reisen. Nicht anders ergeht es den Menschen, die ihr ganzes Leben auf Booten dahinschaukeln lassen, oder jenen, die mit ihren am Zügel geführten Pferden dem Alter entgegenziehen: tagtäglich unterwegs, machen sie das Reisen zu ihrem ständigen Aufenthalt. Viele Dichter, die vor uns lebten, starben bereits auf der Wanderschaft. Meine Gedanken hören dennoch nicht auf, wohl angeregt durch den Wind, der die Wolkenfetzen jagt, um das stete Getriebenwerden zu schweifen – ich weiß schon gar nicht mehr, von welchem Jahr an.
Diese Passage steht auch im Hintergrund des nächsten Haikus in Grünbeins Zyklus:
Wasser und Wolken
Ziehen wie immer dahin.
Selten noch Dichter.
Aus der Ferne, aus Deutschland kommend, gewinnt er die fast verlorengegangene japanische Tradition des reisenden Dichters stolz zurück. Man nehme Bashôs Reisetagebücher als Grundtexte für Grünbeins Reisetagebücher: Grünbeins Shinkansen ist die Neugeburt von Bashôs Wander-Strohsandalen, seine Hotels sind Reinkarnationen des Graskopfkissens, das Bashô als Metapher des Übernachtens auf Reisen verwandte.
Grünbein, der zwar kein Japanologe ist, studiert die japanische Literatur jedoch gern auf seine eigene Art und Weise und thematisiert in seinen Haikus diese als literarisches Genre. Diese Reflexion auf das Haiku durch das Haiku gilt nicht nur den Überlegungen über das Dichten auf der Reise, sondern auch denjenigen über Humor als Ursprung und Kern des Haikus. Die Distanz des Haikus zu der hohen japanischsprachigen Literatur Waka ist nämlich nie gänzlich aufgehoben worden; Haiku konnte und kann sich in diesem Sinne von seinem scherzhaften Charakter nicht völlig lösen:
Ein Scherz das Ganze!
Selbst wenn er fliegt, der Vers,
Er bleibt, was er ist.
[„…“ Haikai bedeutet Scherz, scherzhaft.]
Stellt dieses Gedicht eine Reflexion über das Scherzhafte des Haikus dar, kommt das nächste selbst als Scherz daher:
Ganz fremd ist (und bleibt)
Solcherlei Verskunst dem Mann
Aus dem bergigen Holland.
Eine Distanzierung vom Autoritären und dessen Verwandlung in Humor sind eine Geste, die der 1962 in Dresden geborene und dort aufgewachsene Dichter in Japan gern vorführt:
Um die Lippen spielt
Ein ironisches Lächeln.
Erinnert er sich?
[Zu Besuch beim Großen Buddha von Kamakura]
Der Shôgun-Palast −
Ein Ensemble von Scheunen,
Gesehn von Versailles
Während Grünbein an der Kürze des japanischen Haikus und möglichst auch an dessen Silbenanzahl 17 festhält, befreit er sich von einer anderen bedeutenden Regel dieser Gattung: daß ein Haiku prinzipiell immer ein Wort enthalten müsse, das eine Jahreszeit bezeichnet. Sogenannte Jahreszeitenwörter und welches Jahreszeitenwort für welche Jahreszeit steht, ist in der Tradition festgelegt.
Die vom Tennô herausgegebenen bereits erwähnten acht Waka-Sammlungen bildeten den Kodex dafür aus, wie die Welt in der japanischsprachigen Lyrik aussehen und ausgedrückt werden sollte: welche Pflanzen und Tiere zu welchen Jahreszeiten gehören, welche Orte als besingenswert gelten, wie eine Liebesbeziehung beginnt und endet, mit welchen Worten all das gesagt werden soll – ein jedes war kanonisch definiert. Im langen Schatten dieser kanonischen Waka-Sammlungen steht das Haiku, von der Entstehungsgeschichte her gesehen ein verfallenes Waka, immer noch. Der Kern der Jahreszeitenwörter des Haikus gehört zum Wortschatz des Kanons, die Nuancen solcher Wörter sind in hohem Maße von klassischen Wakas bestimmt. Diese Wörter beziehen sich oft nicht so sehr auf die wirkliche Natur als vielmehr auf den Kanon, so daß solch ein Haiku zu Meta-Literatur wird. Ein Jahreszeitenwort kann etwa als Codewort fungieren: Der Dichter verwendet in einem Haiku ein Jahreszeitenwort, das der Leser entschlüsseln, d.h. in dem er die klassische Literatur dahinter mitlesen soll. Dies ist eine Strategie, in der Kürze von 17 Moren vieles auszudrücken und zu lesen. Grünbein will in seinen Haiku-Zyklen jedoch kein Absender verschlüsselter Texte unter Anwendung des Codierungssystems der alten Wakas sein und dieser vorgegebenen Regel nicht blind gehorchen. Und dies ist durchaus selbst in Japan erlaubt: Das Haiku ohne Jahreszeitenwort, muki no ku, ist auch dort schon längst ein Begriff.
Grünbeins erster Haiku-Zyklus trägt den Titel „Zerrüttungen nach einer Tasse Tee oder Reisetage mit Issa“. Dahinter steckt ein Wortspiel: Der Name Issa besteht aus dem Schriftzeichen für „eins“ und dem Schriftzeichen für „Tee“. Grünbein nahm bei dieser Japan-Reise Issas Tagebuch mit, das auch auf deutsch vorliegt. Issas hier und da mit Haikus versehenes Werk beschreibt die letzten Tage seines Vaters im Jahre 1801. Grausam und fast unerträglich zu lesen ist Issas Klage über den Streit mit seiner Stiefmutter und seinem Stiefbruder, auch über das Erbe. Der Issa-Forscher Katsuyuki Yaba bemerkt zu Recht: Während zeitgenössische Hokku-Dichter das Schöne besangen, beschrieb allein Issa das Häßliche in diesem Tagebuch; damit nahm Issa den Naturalismus vorweg, der in Japan unter dem Einfluß vor allem des französischen Naturalismus erst um 1900 wirklich Fuß faßte.
Stiefsohn in einer Familie in der Provinz im vormodernen Japan zu sein, in dieser unterdrückenden Situation als Individuum über seine Gefühle zu schreiben, diese Sprache überhaupt zu finden, war bestimmt keine leichte Sache. Genau hier knüpft Grünbein an Issa an: Grünbein hat in der DDR zu schreiben begonnen, aus einer das Individuum ähnlich unterdrückenden Situation heraus. Kritik am japanischen Kollektivismus, der aus seiner Sicht auch heute noch gegeben ist, bildet ein wichtiges Thema seiner Kurzgedichte.
Zuckend die Lider
Plaudern den Preis aus, den Preis
Lebenslanger Geduld.
[„…“ Größer als anderswo scheint in Japan die Selbstdisziplin der Leute. Früh schon lernt man sich hier in Geduld und Zurückhaltung zu üben. Manchmal jedoch verrät ein Tic, ein nervöses Blinzeln, wieviel Kraft das kollektiv eingeübte Ansichhalten kostet „…“]
Der Militarismus als Form des zugespitzten Kollektivismus und die Nationalflagge als sein Symbol werden natürlich nicht geschont:
Das Auge dämmert
Im „Land der Zwischenfarben“.
Bei Rot schreckt es auf.
Wo immer der Kreis sich zeigt,
Schlägt die Pupille Alarm.
Furchtbar der Anblick
Der rohen Sonne. Im Krieg
Brannte halb China.
Es ist verständlich, daß der Dichter aus Ostdeutschland sich auch nicht in das Kollektivsystem der Jahreszeitenworte einordnen wollte, hinter dem die Autorität der alten Tennôs immer noch waltet.
Wegen der Jahreszeitenwort-Regel wird das Haiku heute in der internationalen Haiku-Szene, auch im deutschsprachigen Raum, oft als eine Form der Naturlyrik betrachtet. Grünbein wollte in Japan mit seinen Haikus aber nicht so sehr Naturlyrik schreiben. Was ihn beschäftigte, waren vielmehr kulturelle und gesellschaftliche Erscheinungen und insbesondere die Großstadt Tokyo. Julien Vocance, ein Dichter der französischen Haikai-Gruppe, empfing 1936 den berühmten japanischen Haiku-Lyriker Kyoshi Takahama bei sich zu Hause und bemerkte ihm gegenüber, daß die Regeln der Jahreszeitenwörter für französische Haikus sinnlos seien. Eine ebensolche Ablehnung dieser Regel drückt Grünbein gerade durch ein Haiku aus, das inmitten des bekannten Elektronikviertels Akihabara in Tokyo entstanden ist:
Welche Jahreszeit?
Was weiß ich, wo es ringsum
Auf Bildschirmen schneit.
Wie schon erwähnt, war Frankreich das Zentrum der Haiku-Rezeption in Europa. Dies hing nicht nur mit dem in Frankreich besonders regen Japonismus zusammen, sondern auch mit der Metropole Paris und dem Ersten Weltkrieg. Die moderne Großstadt mit ihrer Fülle von wechselnden Impressionen und der Kampf von Millionenheeren unter Einsatz hochzerstörerischer technischer Waffen stellten Schriftsteller vor die Frage, wie sie mit allzu vielen und extremen Eindrücken und Geschehnissen umgehen und diese zum Ausdruck bringen könnten. Eine Möglichkeit bot das Haiku – im Sinne einer Strategie, nicht durch Expansion, sondern durch Reduktion das Übermaß zu fassen. Vocance machte nichts anderes in der vielgelobten Sammlung seiner Haikus von der Front des Ersten Weltkriegs, Cent visions de guerre (1916). Und Ezra Pound, ebenfalls begeistert vom Haiku, verdichtete sein Paris-Erlebnis von 1911 in dem berühmten, epochemachenden „hokku-like sentence“:
Three years ago in Paris I got out of a „metro“ train at La Concorde, and saw suddenly a beautiful face, and then another and another, and then a beautiful child’s face, and then another beautiful wo man, and I tried all that day to find words for what this had meant to me, and I could not find any words that seemed to me worrhy, or as lovely as that sudden emotion. […] I found it [„one image poem“] useful in getting out of the impasse in which I had been left by my metro emotion. I wrote a thirtyline poem, and destroyed it because it was what we call work „of second intensity“. Six months later I made a poem half that length; a year later I made the following hokku-like sentence: −
„The apparition of these faces in the crowd:
Petals, on a wet, black bough.“
Drei Jahre zuvor stieg ich in Paris bei der Station La Concorde aus der Metro und sah plötzlich ein wunderschönes Gesicht, dann ein zweites und noch eins, dann das Gesicht eines wunderschönen Kindes und sodann noch eine wunderschöne Frau, und versuchte nun den ganzen Tag über, Worte zu finden für das, was dies für mich bedeutet hatte, und ich konnte keine Worte finden, die mir als so wertvoll oder so schön erschienen wie diese plötzliche Gemütsbewegung. […] Ich fand es [das Ein-Bild-Gedicht] zweckdienlich, um mich aus dieser Sackgasse zu befreien, in der mich meine Gemütsbewegung in der Metro zurückgelassen hatte. Ich schrieb ein Gedicht von dreißig Zeilen und vernichtete es wieder, weil es das war, was wir ein Werk von „verblaßter Intensität“ nennen. Sechs Monate später schrieb ich ein Gedicht, das nur halb so lang war; ein Jahr später machte ich den folgenden hokku-ähnlichen Satz:
„Die Erscheinung dieser Gesichter in der Menge:
Blütenblätter an einem nassen, schwarzen Zweig.“
Diese beiden Zeilen markieren nicht nur die Wende in der Dichtung Pounds, sie waren zugleich einer der Ursprünge der europäischen Haiku-Sprache. In dieser Sprache und im Bewußtsein dieser Tradition schreibt auch der Pound-Leser Grünbein.
Das antike Rom, das heutige Berlin – Großstädte sind eines der für Grünbein wichtigsten Themen. Er betrat und verließ Japan immer über den Flughafen Narita bei Tokyo, hielt sich aufgrund verschiedener Veranstaltungen öfters in der japanischen Hauptstadt auf und „verdichtete“ dabei das Tokyoter Gesellschaftsleben „im Epigramm zu einer Folge präziser Schnappschüsse“, um es mit Grünbeins Worten über den Dichter des antiken Roms, Martial, zu sagen, wobei Epigramm hier in Haiku zu übersetzen wäre. Die scharfe Visualität der Grünbeinschen Dichtung gewinnt in der Hauptstadt Japans und durch die Form des Kurzgedichts eine besondere Prägnanz. Eine seiner Momentaufnahmen lautet:
Müll glänzt am Wegrand
Des gepflegten Viertels am Sonntag.
Die Krähe beäugt ihr Revier.
Als feiner Filter, durch welchen aus dem metropolitanen bilder- und geräuschvollen Chaos siebzehn Silben sich herauskristallisieren, sind nicht nur Grünbeins Augen, sondern auch seine Ohren am Werk. Geräuschempfindlich nennt Grünbein Juvenal, der in der lauten damaligen „Welthauptstadt Rom“ viele fein klingende Verse seiner Satiren schrieb. Und so findet sich auch Grünbein selbst in Tokyo als einer Stadt wieder, die, vom Wechsel der Jahreszeiten unbeeindruckt, Geräusche erzeugt. Draußen das laute Tokyo, während sich drinnen im Hotel Verse einstellen, die von sensiblen Ohren geprüft und dann niedergeschrieben werden – so entstand nicht nur das folgende Haiku:
Drohend das Brausen
Vorm Hotelfenster draußen −
Kernkraftwerk Tokyo.
Atemberaubend die Gleichsetzung von Baudelaires Paris und Grünbeins Tokyo:
Hier laß uns beten
Im größten der Warentempel,
Mon frère Baudelaire.
[„…“ Tokyo / Ginza / Kurz vor Ladenschluß nachts]
Statt mit Jahreszeitenworten auf klassische Wakas und somit auf die Literaturgeschichte Japans Bezug zu nehmen, schreibt Grünbein hier im Kontext der metropolitanen Kulturgeschichte der Welt. Auch im folgenden Haiku geht es um die Großstadt Tokyo und, wie es zur Zeit Bashôs hieß, um Edo:
Wieviel er doch schluckt,
Der Fluß: Schildkröten, Karpfen −
Ein Fahrrad sogar.
[„…“ Tokyo / Am Kanda-Fluß, unterhalb des Ryûge-an
Hier setzte Bashô den ersten Schritt ins Dichterleben. „…“]
Wie Juvenals Rom war auch Bashôs Edo kanalisiert. Oder genauer: Bashô war selbst in leitender Funktion an der Wartung der Kanalisation beteiligt, um die Population der schon damals großen Stadt mit Trinkwasser zu versorgen. Er wohnte dabei, bevor er reisender Eremit wurde, möglicherweise in der Nähe, wo heute Ryûge-an, eine Bashô-Gedenkstätte, steht. Grotesk ist der Gegensatz zwischen dem Oberwasserkanal von damals und dem daraus entstandenen grausamen Fluß von heute. Bashô wird hier, fern dem Bild eines repräsentativen japanischen Naturlyrikers, in die Geschichte der Großstadt Tokyo integriert dargestellt.
Einunddreißig Schriftzeichen, misohitomoji, ist ein anderer Name für Tanka. Das japanische Schriftsystem besteht im Grunde aus drei Schriften: zwei Lautschriften hiragana und katakana sowie kanji (chinesische Schrift). Wenn ein Tanka in hiragana geschrieben wird, wie es früher typisch war, ergeben sich 31 Schriftzeichen, wobei ein Schriftzeichen einer Mora entspricht. Japanische Kurzgedichte, Tanka sowie Haiku, werden viel stärker als Schrift empfunden als deutsche Gedichte. Dementsprechend legte man früher großen Wert darauf, sie mit der Hand kalligraphisch darzustellen. Als der Dichter Makoro Ôoka, der Initiator des Kettengedichtprojekts, an dem auch Grünbein teilnahm, das ganze Werk, darunter Grünbeins Beiträge, mit japanischer Feder aufzeichnete, folgte er dieser alten Tradition.
Ein japanischer Leser wird deshalb fast überrascht, wenn Grünbein hier und da die akustische Seite der japanischen Kurzgedichte in den Vordergrund stellt. Nicht so sehr ein japanischer Haiku-Lyriker, als vielmehr erst der deutsche Dichter kann ein Hokku wie das folgende schreiben:
Siebzehn Kehlkopfklicks −
Ein Gedicht auf japanisch.
Vorbei, kaum gehört.
Sprache als Schrift und Sprache als Laut: dieser Gegensatz hat Grünbein während seiner Reisen in Japan immer wieder beschäftigt.
Was hat er gemeint?
In die Handfläche malt er
Den plötzlichen Sinn.
[„…“] [Immer wieder kann man beobachten, wie ein Japaner sich dem andern erst dann verständlich macht, wenn er ihm das gemeinte Zeichen vor Augen führt. Erst damit gilt das gesprochene Wort.]
Als Grünbein im buddhistischen Tempel Daian-ji eine Lesung hielt, wurde darüber in verschiedenen japanischen Zeitungen mit großer Hochachtung berichtet. Die Lesung als besondere Form des Literaturgenießens ist in Japan, wo Literatur in erster Linie als geschriebenes Wort gilt, zumindest heutzutage selten. In einem Tempel in der alten Kaiserstadt, in dem vielleicht, wie es in einem buddhistischen Tempel in Japan oft der Fall ist, unlesbare indische Schriftzeichen hier und da ihre Aura ausstrahlten, erklang die deutsche Sprache: ein Abend an der Spitze der Avantgarde.
Durchs Hinterland in die Ferne, gen Osten wollte auch Goethe. Nachdem er in Italien gewesen war und in seinen Römische Elegien eine Versform der europäischen Antike benutzt hatte, reiste er – nicht mehr tatsächlich, sondern nunmehr in der Vorstellung – weiter in den sogenannten Orient, um dort einen von persischen Dichtern inspirierten Gedichtband zu verfassen. Danach setzte er seine imaginäre Reise nach China fort: Von der übersetzten chinesischen Literatur angeregt, entstand daraus der schöne Zyklus „Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten“, in dem Goethe sich in die Rolle eines Mandarins in China versetzte. Hier aber fand seine Reise in fremde Kulturen und Literaturen auch ihr Ende; er erreichte Japan nicht. Weder schrieb er Kettenlyrik mit Eckermann, noch verfaßte er ein Tagebuch in Haikus. Dies hätte er wohl gemacht, wenn im damaligen Europa die Japanologie der Sinologie nicht nachgestanden hätte und die japanische Lyrik früher bekannt geworden wäre. Vielleicht kann man so weit gehen zu sagen, daß Grünbein mit seinen vier Haiku-Zyklen Goethes westöstliche Fackel übernommen hat. Denn es hat bislang noch keinen deutschsprachigen Schriftsteller von Format gegeben, der diese literarische Gattung so ernst genommen und sich ihrer in diesem Ausmaß gewidmet hätte.
Dort, wo seine Reise endete, im imaginären China, schrieb Goethe fremde Schriftzeichen. Im den Zyklus eröffnenden Gedicht heißt es: „geistig schreiben, […] Zug in Zügen“. Damit meinte Goethe chinesische Schriftzeichen in ihrer komplexen Gestalt. Er interessierte sich dafür und kannte sie. Er lieh sogar eine Menge Druckstöcke mit solchen Zeichen in der Weimarer Bibliothek aus. Die chinesische Schrift, die zum japanischen Schriftsystem gehört, beschäftigt Grünbein nicht minder. Auch in diesem Sinne schließt er sich an Goethes China-Zyklus an und führt ihn fort. Eines seiner Haikus thematisiert das chinesische Schriftzeichen für Tor, das sich vom Abbild eines wirklichen Tors herleitet:
Das hölzerne Tor
In der Bucht von Miyajima −
Ein rotes kanji im Meer.
Wenn daher die Leserinnen und Leser dieses Buches der Insel-Bücherei unlesbare Schriftzeichen vor sich sehen, darunter viele chinesische, erleben sie das gleiche, was auch Grünbein erlebt und in seinen Haikus thematisiert hat. Diese Erfahrung schadet bei der Lektüre nicht, ist hoffentlich vielmehr hilfreich. Auch so kann die Zweisprachigkeit des vorliegenden Büchleins verstanden werden.
Ein Wort zur Übersetzung: Die hier vorliegenden japanischen Übersetzungen sind nicht in Haiku- oder Tanka-Form geschrieben. Der Übersetzer hat sich bemüht, originalgetreu zu übersetzen, ohne daß die Gedichte dabei ihren lyrischen Charakter verlieren. Die so entstandene japanische Version eines Grünbeinschen Haikus ergibt viel mehr Moren als 17, die eines Tankas viel mehr Moren als 31. Hätte der Übersetzer daraus ein japanischsprachiges Haiku oder Tanka machen wollen, hätte er vieles von dem, was im Original ausgedrückt ist, entweder weglassen oder verändern müssen. Das aber wollte der Übersetzer nicht. Das Ideal, das er vor Augen hatte, waren nicht so sehr klassische japanische Haikus und Tankas, als vielmehr Daigaku Horiguchis Übersetzungen französischer Gedichte in seiner berühmten, bereits erwähnten Anthologie aus dem Jahr 1925. Darin hat die lyrische Sprache des Japanischen eine neue Dimension gewonnen. Die in Europa eigens entwickelte Haiku-Sprache seit Pound sowie der französischen Haikai-Gruppe und die Sprache japanischer moderner Lyrik – beide sind sie gleichzeitig in einem europäisch-japanischen Kulturaustausch entstanden und passen deshalb gut zusammen.
In der altostasiatischen Tradition der Nachwort-Kultur konnte das Haiku-Reisetagebuch eines Dichters mit dem Nachwort eines anderen Autors geschlossen werden; so geschah es z.B. bei einer wichtigen Fassung von Bashôs Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland. Der Übersetzer freut sich, daß er hier genauso verfahren darf.
Yûji Nawata, Nachwort
Inhalt
Viermal, einer eigenen langen Werkspur und Wahlverwandtschaft mit dem Osten nachgehend, hat Durs Grünbein Japan besucht. Während aller vier Reisen hat er sein Tagebuch in Form von Kurzgedichten geführt. „Mir, der ich nie photographiere, schien das Haiku das probate Gegenstück zum Polaroid. Es sind Bilder der auf der Oberfläche schwimmenden Welt. Nur daß sie in diesem Fall aus nichts als aus Worten gemacht sind. Die Impression wird im nächsten Augenblick Schrift.“
Grünbeins Haikus sind ihrem Genre treu und eigenmächtig zugleich. Obwohl der Dichter von der japanischen Norm in Vers und Strophe ausgeht, verwandelt er sich die fremde Form an, stört dabei die traditionellen Elemente ihrer Bildlichkeit und die sie kennzeichnende Harmonie, durchaus auch drastisch. So entsteht in der fremden Form zwar etwas Privates, ursprünglich nicht für die Publikation Gedachtes, zugleich aber eine Art interkulturelles Gespräch in und mit der Fremde. Das dialogische Prinzip wird in dieser Gesamtausgabe von Grünbeins Haikus durch eine parallele Übersetzung und Verschriftlichung ins Japanische und ein Nachwort seines japanischen Übersetzers verstärkt.
Die Nudel im Rinnstein
− Alternative zum Polaroid: Durs Grünbeins Haikus. −
Man könnte sich ziemlich verheddern, wollte man sich angesichts des hübschen Gedichtbands von Durs Grünbein fragen, was denn deutsche Haikus sind und sein können. Andererseits ist es so selten nicht, dass eine lyrische Gattung in andere Kulturen wandert, man denke nur an das italienische Sonett, das im Englischen und in vielen anderen Sprachen heimisch wurde. Weshalb also nicht auch das japanische Haiku?
„Das kostbare Flackern der Andersheit“ habe ihn an den Klassikern der japanischen Moderne besonders angezogen, bekennt Grünbein im Nachwort. Haikus seien das Erste, was er kennenlernte und mit größter Aufmerksamkeit zu studieren begann. Kein Wunder, denn das Haiku ist das bedeutendste Exportgut der Kultur Japans. Viermal hat der deutsche Dichter zwischen 1999 und 2005 Japan bereist und seine Eindrücke in Stenogrammform notiert. Haiku als „die günstigste Alternative zum Polaroid“ – eine Technik, wie er gleich hinzufügt, die nun ihrerseits obsolet sei. „Bilder der auf der Oberfläche schwimmenden Welt“ nennt er sie auch, spontan, ohne Zögern eingefangene Impressionen. Selten erziele, so Grünbein, ein so geringes Quantum Sprache eine so große Wirkung wie im japanischen Gedicht. Und was macht er daraus?
Wir sehen, hören, schmecken die japanische Umgebung mit Grünbein, etwa im Großstadtgewühl:
Tausende Blicke
Beim Durchqueren des Fischschwarms.
Doch keiner galt dir.
Fotografische Aufnahmen wie:
Im Rinnstein schwimmt, schau:
Eine einzelne Nudel.
Der Regen kocht Suppe.
Oder
Frisiert die Büsche,
Streng in Reihen gescheitelt.
So reift Grüner Tee.
Solch vordergründige, aber scharf gezeichnete Bilder finden sich eher selten. Die Stimmungen sind heiter bis melancholisch:
Dieses Leben, Mensch,
Wirst du nicht überleben.
Murmelt der Regen.
Doch Grünbein wäre nicht Grünbein, wenn er seine Skizzen nicht auch als Dialog zwischen literarischen Traditionen angelegt hätte, mit vielstimmigen Verweisen auf europäische und japanische Vorgänger, auf Texte und Mythen. Dabei greift er bisweilen den ursprünglich scherzhaften Ton des Haiku auf, etwa wenn er „Nach dem Lesen von Tanizakis Lob des Schattens“ notiert:
Manch Haiku entstand
An dem stillsten der Örtchen
Im Zedernholz-Klo.
Dass er dann doch über das Haiku in Haiku-Form reflektiert, scheint seiner Maxime der „mentalen Sofortreaktion“ zu widersprechen. Die Haiku-Regel, die ein Jahreszeitenwort verlangt, wird bestätigt und abgelehnt zugleich in dem im Elektronik-Viertel Akihabara entstandenen Vers:
Welche Jahreszeit?
Was weiß ich, wo es ringsum
Auf Bildschirmen schneit.
Zweifellos sind Grünbeins Haikus intellektueller, als es japanische sind. Doch so steht ihm die Form für ein breites Spektrum an Ausdrucksabsichten zu Gebote, seien es blitzhaft aufscheinende Kindheitserinnerungen, metropolitane Grotesken oder eine ins Apokalyptische sinkende, dabei ganz beiläufig-leichte Vision:
Der Wecker nimmt dir
Den falschen Albtraum – im Tausch
Gegen den echten.
Apropos Form: Es überrascht, dass Grünbein sich tatsächlich der klassischen Haiku-Gestalt mit fünf-sieben-fünf Moren bedient, denn ein solcher Rhythmus lässt sich im Deutschen, das ja, im Gegensatz zum Japanischen, seine Metrik aus dem Wechsel von betonten und unbetonten Silben bezieht, nicht wirklich wahrnehmen. Doch es scheint den Sprachvirtuosen Grünbein gereizt zu haben, sich dennoch dieser Regel zu unterwerfen, die im Übrigen auch im Japanischen nicht zwingend durchgehalten wird. Die Kürze ist natürlich relativ, denn es lässt sich in den siebzehn Moren eines Haiku im Englischen oder Deutschen deutlich mehr sprachliche Information unterbringen als im Japanischen. Man könnte daraus die Konsequenz ziehen, das deutsche Haiku habe sich, um der Knappheit der Originalform wirklich zu entsprechen, noch weiter zu verkürzen, vielleicht auf drei-fünf-drei Moren.
Immerhin kommt es einem da gelegen, dass dieser Band auch eine Umkehrprobe anbietet, denn Grünbeins deutsche Originale werden allesamt von (notgedrungen wesentlich längeren) japanischen Übertragungen begleitet, was natürlich schon in optischer Hinsicht eine Besonderheit dieser Ausgabe ausmacht. Der japanische Germanist Yûji Nawata hat die Haikus kongenial transponiert, im Stil der frühmodernen, von Übersetzungen aus dem Französischen inspirierten japanischen Lyrik, und beim Stereolesen geht es einem wie mit allen (guten) Übersetzungen: Man entdeckt verborgene Facetten und literarischen Eigensinn des Textes in der fremden Sprache.
Der japanische Übersetzer hat im Übrigen auch ein kenntnisreiches Nachwort verfasst, das uns auf kulturelle Unterschiede im Umgang mit Haikus aufmerksam macht und manche der Grünbeinschen Anspielungen hilfreich aufschlüsselt. Denn welcher nicht japanologisch vorgebildete Leser ahnte schon, dass sich hinter dem Titel „Zerrüttungen nach einer Tasse Tee oder Reisetage mit Issa“ ein Wortspiel versteckt: Der Name des japanischen Dichters Issa besteht aus den Schriftzeichen für „eins“ und „Tee“. Ähnlich wie die Dichter – oder die Kommentatoren – im Japanischen versieht Grünbein seine lyrischen Miniaturen mit erläuternden Hinweisen, in jedem Fall mit Datum und Ort, bis hin zu kleinen Exkursen. Auch japanische Haikus sind in ihrer elliptischen Kürze ja nur bedingt verstehbar. Nicht alles ist kulturelle Anspielung; der Kontext muss oft mitgeliefert werden. Bisweilen beobachten wir Grünbein in seinen Kommentaren beim Nachdenken über die Tücken der Beschäftigung mit Japanischem, etwa wenn er im Anschluss an ein Gedicht – diesmal nicht Haiku, sondern das etwas längere Tanka – selbstkritisch bemerkt: „Wie es aussieht, ist der Autor hier einer Fehlinformation aufgesessen.“
Falls nun der Eindruck entstanden sein sollte, wir hätten es mit einem kopflastigen Buch zu tun, das zudem nur Japan-Interessierte zu fesseln vermöchte, sei kräftig widersprochen. Lob des Taifuns ist, jawohl, auch ein Reisebuch von der schönsten Sorte, bis hin zu den ernüchternden Szenarien der Heimkehr –
Der Birke gleich am Rollfeld, auf verlornem Posten
Stehst du vorm Passbeamten stumm, endlich zuhaus.
Ein in allen Teilen gelungener interkultureller Dialog. Und ein Experiment mit originellem Ergebnis – pointierte, einfallsreiche, in aller Kürze kunstvolle Gedichte, die an einer globalen Poetik des Haiku feilen.
Irmela Hijiya-Kirschnereit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.2.2009
Lob des Taifuns
Wer den scheinbar leicht hingeschnippten Dreizeilern aus Fernost bislang misstraute, kann in Grünbeins Reisetagebüchern in Haikus wahre Kleinodien entdecken. Die pointierten Kurzgedichte in 17 Silben folgen einer Ästhetik des Luftigen und Flüchtigen und fächern Nuancen von Licht und Schatten filigran auf. Grünbein folgt der Tradition des Reisetagebuchs in Haikus, wie sie der Japaner Bashô (1644–1694) kultivierte. Das Buch versammelt den lyrischen Ertrag von vier Japan-Reisen, die Grünbein zwischen 1999 und 2005 unternahm. Nicht nur im ersten thematisiert Grünbein – gleich Haiku-Meister Issa (1763–1827) – die Hinfälligkeit menschlichen Lebens und die Vergänglichkeit des Augenblicks. Neben bildhaften Szenen, Situationen und Bewegungen stehen – anders als in der japanischen Tradition – Geräusche im Vordergrund. Von „siebzehn Kehlkopfklicks“ ist die Rede und von Echoloten, die das Meer nach letzten Fischen durchpflügen. Die biegsame Eleganz der Form schließt zivilisationskritische Beobachtungen ein. Abweichend vom klassischen Tennô-Kodex, der „Jahreszeitenwörter“ zur Pflicht erklärte, entwirft Grünbein einen zeitgemäßen Code, der den Lärm der Großstädte in die gelassen-heiteren Naturbetrachtungen einbezieht. Das als bedrohlich empfundene Brausen des „Kernkraftwerks Tokyo“ ist im Kapitel „Regentropfen auf einem Brillenglas“ unüberhörbar. Die Megastadt erwacht nicht als liebliche Kirschblüte, sondern als Godzilla. Ein Dialog mit der „Table-dance-Lady“ aus Kiew beleuchtet trübe Nischen der Globalisierung. Um ironische und makabre Varianten bereichert der Dichter die scherzhafte Grundierung des Haikus. Die Unterschiede zwischen europäischem und japanischem Verhältnis zu Religion, Esskultur und Sprache bringt er exzellent auf den Punkt. Trotz des Vergnügens am Haiku genügt dem Dichter die knappe Form offensichtlich nicht. Er ergänzt und relativiert sie mit Kommentaren über Entstehungssituationen, Anlässe oder weiterführende Gedanken. So werden sowohl poetische Gewinne als auch Verluste der lyrischen Minimalform transparent.
Dorothea von Törne, Die Welt, 25.10.2008
Neuronotizen und Wortmoleküle
− Durs Grünbeins japanische Reisetagebücher Lob des Taifuns. −
Mehrmals schon hat Durs Grünbein Japan besucht. Bei jeder seiner Reisen hat der Lyriker seine Eindrücke in Reisetagebüchern aufnotiert: Gewählt hat er dafür die Form des Haikus, jenes, an eine lange japanische Tradition anknüpfende Kurzgedicht von zumeist siebzehn Silben. Es erscheint ihm geeignet, „etwas festhalten zu können, das im Moment seines Erscheinens einen packenden Eindruck gemacht hatte und doch nur flüchtig aufscheinen konnte“, so formuliert es Grünbein selbst im Nachwort dieses Bandes, in dem seine japanischen Reisetagebücher nun gesammelt vorliegen. Man ist dankbar, dass den meisten Haikus ein Kommentar folgt, manche wären ansonsten für Nichtjapankenner schwer nachvollziehbar. Hat man allerdings von Europa aus eine solche Reise schon einmal unternommen, gibt es einige Aha-Erlebnisse für diejenigen, die Ähnliches schon beobachtet haben.
Die hier vorgelegten Haikus nehmen im Werk Grünbeins eine Sonderstellung ein: Sie erscheinen doch weit entfernt von den filigranen Gedankengebilden des übrigen Werkes, betreffen sie nun die Gedichte oder auch die klugen Essays. Sie unterscheiden sich zudem nicht nur dadurch, dass sie in ihrer Kürze einen anderen formalen Eindruck vermitteln, sondern vor allem darin, dass sie sich gar nicht scheuen, Banales mitzuteilen und auch im dazugehörigen oder mitunter auch fehlenden Kommentar diese einfachen Aperçus nicht tiefer begründen:
Taxis im Regen.
Die Fahrer schlafen. Dann schreckt
Ein Kunde sie auf.
Grünbeins Haikus wären aber nicht die Grünbeins, wenn sich in ihnen nicht auch etliche Geistesblitze fänden. So sind sie zu lesen als „Gefühlssouvenirs“, „Neuronotizen“ oder auch als „Wortmoleküle“, wie Grünbein selbst anlässlich einer Lesung seiner Haikus im Tokyoter Goetheinstitut im November 2008 anmerkte. In ihnen scheint eine Spannung auf, die diese Haikus gerade in ihrer Kürze kaum auszuhalten vermögen: eine Spannung zwischen Tradition und Moderne, zwischen Formstrenge und Freiheit von der Form, zwischen kunstvollem Wortspiel und vitaler Lebensbejahung. Yûji Nawata hat die Gedichte ins Japanische übersetzt. Es macht den Reiz dieser zweisprachigen Ausgabe aus, dass sie immer nach den deutschen Haikus abgedruckt sind. Sie sorgen so für eine nicht unerhebliche Fremdheitserfahrung der Lesenden.
In seinem überaus lesenswerten Nachwort verdeutlicht Nawata, dass er Durs Grünbein trotz aller modernen Anklänge eher als Traditionalist sieht und ihn entsprechend übersetzt hat. So kommen in seiner Übersetzung Worte vor, die das heutige Japanisch nicht mehr kennt, die aber auf älteste japanische Gedichttraditionen zurückgehen. Ob das den mitunter recht derb formulierenden Gedichten Grünbeins gerecht wird, vermögen nur Japanologen zu entscheiden. Deutlich wird aber, dass Nawata die Haikus möglichst wortgetreu übersetzen wollte und sie deshalb auch nicht in das klassische Haikukorsett der 5 / 5 / 7 Silben zwängt, zumal sich auch Grünbein selbst an dieses Schema nicht hält.
Was den Lesenden hier letztlich begegnet, sind Momentaufnahmen eines Flaneurs, dem man seinen vertrauten europäischen Kontext entzogen hat und in Japans Großstädten mit einer erhöhten Aufmerksamkeit umhergeht. Dort bleibt er ein Flaneur im Sinne Charles Baudelaires, aber die Eindrücke, die er schildert, sind so schnell wechselnd wie die, die man in einer Megacity wie Tokyo gewinnt, wenn man sich dort bewegt. Auffällig an ihnen ist der selbstreflexive Gestus und an ihm wiederum die selbstironische Note. Grünbein beobachtet sich selbst beim Beobachten, darin gleicht er vielleicht sogar Franz Kafka in seinen Tagebüchern. Was er dabei beobachtet, ist für ihn nicht immer schmeichelhaft:
Wohin willst du denn Kopf?
He, was treibt ihr da Füße?
Wir baden, du Arsch.
Die Haikus gewinnen ihren Reiz auch aus ihrer Synästhesie, sie evozieren zumeist gleichzeitig Reize für Auge und Ohr. Nicht zuletzt fällt auf, dass sie oft in drei Versen notiert sind, was in Japan nicht vorkommt. Grünbein hat sich aber bewusst die Freiheit genommen, deutsche Haikus zu schreiben, die die japanische Tradition zwar berühren, sich aber zugleich von ihr auch kräftig abstoßen. Was so entsteht, sind poetische Spielereien, von denen viele geglückt sind, manche womöglich auch schnell wieder vergessen werden können, eines aber deutlich zeigen: die durch nichts festzuhaltende Augenblickshaftigkeit des Beobachteten, sein Gemahnen an die Vergänglichkeit des vorbeihastenden Lebens.
Iris Hermann: Neuronotizen und Wortmoleküle
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Frank Milauzki: Aus der wirklichen Welt gezoomt
satt.org, 8.11.2008
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


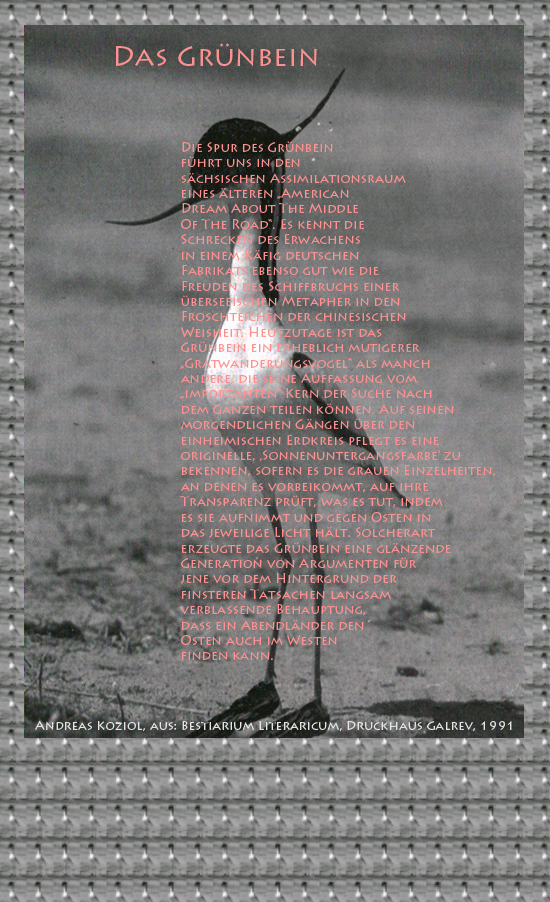
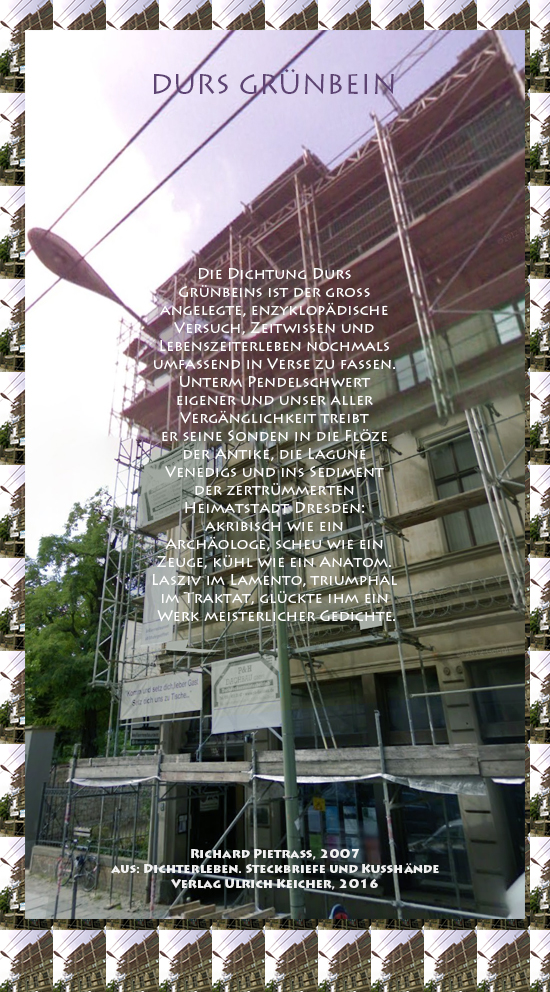












Schreibe einen Kommentar