Durs Grünbein: Nach den Satiren
HEINER MÜLLER, AUF DANN…
DREI BLÄTTER
I
Die Meldung kam wie auf Krähenflügeln
Durch die kahlen Bäume, das städtische Gitterwerk.
Der Rundfunk wie immer, das Fernsehn wie immer
Strahlten Musik aus und Bilder und Worte zum
aaaaaSamstag.
In den Theatern nachmittags schob man Kulissen
Für die Komödien am Abend, den örtlichen Shakespeare.
Scheinwerfer wärmten die Bretter vor leerem Saal.
Die Grippe ging um in Berlin, ein Virus aus Moskau.
Silvester warf ein hysterisches Flackern voraus.
Die Meldung kam wie von leerer Bühne.
Den meisten war es eine Nachricht nur.
Nah am Gefrierpunkt
Hielten die Pfützen noch Ausschau nach Landschaft
Inmitten der Häuser. Die Straße blieb eisfrei,
Solange die Autos fuhren. An diesem Tag
Gab die Tragödie den Geist auf – seinen zum Beispiel.
Der so lange gewartet hatte, geduldigen Blicks,
Jetzt erwartet ihn nichts mehr. Jetzt hat sein Schmerz
Mit Spritzen betäubt, aufgehört wie das spröde Gelächter.
Der so lange Verbindung hielt mit den Toten, zu langsam
Sterbend, jetzt ist er tot. Der Fabel- und Fallensteller
Im Selbstgespräch mit den deutschen Gespenstern,
Der Meister ist tot.
Bevor er hinausspähen konnte ins nächste Jahrtausend,
Hat ihn sein Körper verraten. Der Feind
Hat ihn ausgeliefert an die Atteste, die ärztlichen Messer,
An denen die Sätze zuschanden werden und heimatlos.
Der Terror, von dem er schrieb, kam aus Deutschland.
Der Terror, an dem er starb, kam aus den Zellen.
Berlin im Dezember ohne ihn, das Gefühl
Von Verwaistsein.
II
Schneeloser Winter wie seit Jahren war
Die letzte Jahreszeit, die er erlebte
Auf einer Erde, die nicht mehr erbebte
Vor frischen Massengräbern, jedes Jahr
Zehn neuen Kriegen. Selbst die Bilder,
Ein toter Stadtkern, Krüppel in den Betten,
Verblaßten schnell vor immer milder
Geröstetem Kaffee und Zigaretten,
Die kaum noch giftig waren. Nikotin −
Ein Fremdwort wie Ozon und Holocaust.
Man sah die einen schießen, andre fliehn
Wie Herdentiere. Die geballte Faust
War aus der Mode wie seit Jahren schon
Die weiße Weihnacht und gewisse Slogans.
Er starb am Tor zur Intensivstation,
Gedichte lesend unter leichten Drogen.
Die Ziele gingen, doch die Waffen blieben.
In diesem Winter, der sein letzter war,
Sah man ihn still sich in den Tod verlieben,
Tartarisch lächelnd hinterm Rauch der Bar.
III
Nach Hadrian
aaaaaaaaaaaaaaaaaDu schweifendes schmeichelndes Seelchen
aaaaaaaaaaaaaaaaaGast meines Körpers, Begleiter
aaaaaaaaaaaaaaaaaIn welche Fernen zieht es dich jetzt
aaaaaaaaaaaaaaaaaSo nackt und so blaß und schon steif
aaaaaaaaaaaaaaaaaUnd die fröhliche Zeit ist vorbei.
Die erste Nacht kalt auf dem Friedhof,
Umgeben von Lemuren, Toter,
Wie fühlt man sich im Erdreich und allein
Im engen Sarg nachdem die Trauergäste
Zurückgekehrt sind in ihr Leben,
Wie fühlt man sich so jung im Tod.
Video Durs Grünbein: Selbstporträt in der Provinz. Gedicht aus Nach den Satiren.
Inhalt
Durs Grünbein hat sich Zeit gelassen mit einem neuen Gedichtband. Fünf Jahre nach Falten und Fallen zieht der Autor eine Bilanz seiner dichterischen Arbeit vor dem magischen Jahr 2000. Die enzyklopädische Neugier, die Grünbeins Texte seit jeher prägte, kennzeichnet auch diese Gedichte, in denen er sich neues poetisches Terrain erschließt. Weit gespannt ist dabei der Bogen: von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart, von der Heimatstadt Dresden über die Kontinente bis hin zu Saturn und Venus, die „entgleist ihre Runden drehn. / Wenn im Teilchenzoo Ordnung herrscht und ihr kennt jedes Gen“ von der Mikro- bis zur Makrowelt und zurück. Grünbein ist gelegentlich „Kälte“ bescheinigt worden, doch jederzeit nachvollziehbare „Präzision“ beschreibt die Art seiner Wahrnehmung besser.
„Und hinter allem steckt eine Liebe zum Lebendigen, Vergänglichen, die den Körper und alle Phänomene rings um ihn her noch einmal – metaphysisch – umfängt.“
Nicht der Blütenstaub, fein verteilt, nicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadieser Schmerz
An den Haarwurzeln, mit jedem Frühling
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaerneuert,
Nicht das Erwachen ist grausam. Was
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber dann?
Asche zum Frühstück
− In vielen Lektüren nicht auszuschöpfen: Durs Grünbeins Gedichte Nach den Satiren. −
Gesänge aus der Frühzeit des Menschengeschlechts, Totenlieder auf das Kind, das man einmal war: zwischen Säugling und Mumie, „Schamhaar und Ewigkeit“ schreitet Durs Grünbeins ausserordentlicher Gedichtband die Koordinaten von Körper und Kosmos aus. Die Stadt, der Müll und der Tod sind seine Sujets. Der globale Flaneur ist sein heimliches Auge, Mnemosyne sein Leitstern, Chronos der Held.
Was ist die Zeit? „Aus jedem Satz springt uns ein Wort an, das uns älter zurücklässt, irgendein Bald, ein Nichtmehr, ein Von alters her“. Doch nichts, was sich messen lässt, ist die Zeit.
Weder der Staub
Im Tiegel der Goldwaage noch der gestiegene Kaufpreis für Fische.
Auch nicht der wandernde Schatten am Gnonom
oder die Zahl der Regierungen in einem Leben, der Kriege
Da ist dieses Noch, dieses Schon, dieses Einst, da ist die Stimme der Toten und in den Schläfen das Klopfen des Bluts – doch nichts, was man hört, ist die Zeit und nichts, was man fassen kann: „weder die Greisenstirn noch die rosa Fingerbeeren des Kindes“. Nichts, was man sieht, ist die Zeit. Aber alles ist da, in diesem Gedichtband, für eine poetische Weile, die keine Zeit misst: der Feueratem des Krieges und „der metallene Schorf des Geldes“, das Dosengewicht der Tiere und der Tiefkühlschock im Sonnengeflecht, das Gellen der Städte und die Provinz des Menschen. Was aber ist die Zeit?
„Aporie Augustinus“ ist das Gedicht überschrieben, aus dem diese Zeilen stammen; Nach den Satiren heisst Durs Grünbeins jüngster, fünfter Gedichtband. Nach den Satiren – das meint, in Anlehnung an Juvenal, den „Gesang der Satten“, vorgetragen im alten Rom während des üppigen Mahls. Nach den Satiren, heisst es im Anhang, „das war der Moment, wenn alles gesagt und durchgekaut war, die Zeit der Gedankenspiele und der Verdauung. Während der Magen arbeitete, kehrten die mit vollem Munde verspotteten Dämonen langsam zurück.“ Nach den Satiren, das meint aber auch: Verse nach dem Vorbild des Juvenal, dessen Warnung vorm Preis der Städte dem titelgebenden Zyklus das Motto spendet: „In der Stadt zu schlafen, kostet zu viel Geld, daher die Übel.“
Robinson in den Städten
Der „urbane Wiedergänger des Juvenalis“ entwirft eine Vorhölle aus Asphalt und Reflexen, „Zerstreuung und wirrem Gebet“. Stets wird dabei die Gegenwart auf die Vergangenheit durchsichtig und – umgekehrt – das Einst auf das Jetzt. Aus jeder Schaufensterscheibe grinst uns der eigene Totenschädel entgegen und mit ihm die lange Reihe der Vorgänger; und bereits auf dem Schild des Achill – im 18. Gesang der Ilias – ist das Schicksal der Kommenden eingraviert. Ob wir in diesen Gedichten das gärende Strassenleben im Rom des späten 1. Jahrhunderts betreten oder das aufgewühlte Berlin der neunziger Jahre: das Grauen der Horrormovies ist nichts als ein fernes Echo der Gladiatorenkämpfe, und aus der Tiefe der Zeit spricht schon der letzte Mensch. Vita brevis – was ist die Krone der Schöpfung? Ein wenig Eiweiss, viel Wasser und jede Sekunde Zersetzung. „Und nichts davon ist die Zeit.“
Ja, gross und gewichtig ist der Themenkreis, den der 37 Jahre junge Dichter zur „Halbzeit“ des Lebens geschultert hat, „zwischen Schamhaar und Ewigkeit“ kreist – einmal mehr – sein jüngster Band, dessen Gedichte in den letzten fünf Jahren entstanden sind. Die Stadt, der Müll und der Tod sind seine Sujets; die Spanne zwischen Körper und Kosmos seine Koordinaten. „Dass es Tod nicht gibt, nur Tote“ ist die Lektion dieser langen lyrischen Stücke – und die „teuren Toten“ begegnen uns gleich in den ersten Bildern: Tierkadaver in den verschiedenen Stadien ihres Verfalls. Und Auferstehung ist nur „in den Larven / Der Fliegen, die morgen schlüpfen werden“.
„Historien“ ist der erste Teil überschrieben; dass diese auf die Geschichte hin durchscheinend sind, signalisiert nicht zuletzt das Ortsschild über dem ersten Gedicht: Normandie – wo „quer im Gebiss / Kreideweiss numerierter Schwellen“ ein Hundekadaver am Bahndamm liegt.
Je länger du hinsiehst, je mehr
Zieht sein Fell in den Staub ein, den Schotter
Zwischen den Inseln aus frischem Gras.
Dann ist auch dieses Leben, ein Fleck,
Gründlich getilgt.
Auch dieses Leben – kreideweiss numeriert, dem Tod auf den Gleisen erlegen; auch dieses Leben bereits beim Zuschaun begraben unter dem sprichwörtlich drüber gewachsenen Gras. Doch es gibt nicht den Tod, es gibt nur den einzelnen Toten, auch dort, wo die Alliierten einst landeten, um dem grossen Morden ein Ende zu machen. Gründlich registriert, gründlich getilgt: so viele Leben. Und nichts davon ist die Zeit. Was aber ist sie?
Vielleicht dies: der stetige Herzschlag, „der sich in Sicherheit wiegt: / Dass jemand lacht und nichts weiss vom Treppensturz morgen“. Oder das Rieseln, „wenn durch ein ganz kleines Loch die üppige Ernte“ verschwindet. Vielleicht auch das Kauern der Dinge „in den Geschäften, die Schauhäusern gleichen, / mit Leichenteilen in jeder Tiefkühltruhe.“ Oder die eigene Hand, diese „fettigen Schwielen“ des letzten Affen, dem alles erreichbar geworden ist. Oder der Totenschädel des Wehrmachtssoldaten, der im Bauboom Berlins aus dem Brachfeld gebaggert wird. Durch all das geht die Zeit, der rhythmische Herzschlag der Sprache, die sich nirgends „in Sicherheit wiegt“. Und das ist bei Grünbein so neu.
Die eisige Kunstfertigkeit, seine terminologisch abgefederte Poesie ist dem viel und früh Gerühmten immer mit einer Mischung aus hausväterlicher Besorgnis und heimlichem Schauder unter die Nase gerieben worden; es war freilich nicht nur der pädagogische Eifer bedenklich wiegender Köpfe, die in der szientistisch bewaffneten Abgeklärtheit das humanitäre Herzblut vermissten. In der Tat hat der „Künstler als junger Grenzhund“ seine „Schädelbasislektion“ in der Ex-DDR gründlich gelernt und ist der Gefahr der ausgekühlten Manier mitunter erlegen. Mit dem gleichnamigen Gedichtband wurde der Dichter anno 91 als ostdeutscher Götterliebling gefeiert; fortan hat Grünbein sein „Babylonisches Hirn“ auf Versfüssen um den Globus geführt und dabei eine Weltläufigkeit an den Tag gelegt, die nicht nur seine einstigen Landsleute in Erstaunen versetzte. Seine lyrischen Zeitreisen führen nun stracks in die christliche Frühzeit.
Mittlerweile ist das naturwissenschaftliche Imponiergehabe und der prunkende Einsatz von Bildungsgut im Gedicht leider in Mode gekommen. Es sind denn auch in diesem starken Band nicht die stärksten Stücke, die der Dichter unterm Faltenwurf der Gelehrsamkeit vorträgt: die bärtige Rollenprosa aus dem Mund des Polemonius oder des Kaisers Julianus, der lüsterne Chor der Mörder des Heliogobal gemahnen in ihrer deftigen Mischung aus Tyrannenmord, Gladiatorenkämpfen und Hurenhintern „wie Spanferkelrücken“ ein wenig an eine Melange aus Lateinunterricht und Bänkelgesang.
Das späte Rom als Prototyp der Dekadenz und des Lotterlebens – es bedarf solch renovierter Fresken aus der Antike nicht, um die ewige Wiederkehr von Verkommenheit und Bestechlichkeit zu illustrieren. Es braucht nicht den kostümierten Hohn auf den Dichter, den „Mann ohne Eier“, und nicht „die Gaumenlust / Unseres schläfrigen Kaisers“, um dieses zu sagen: „Das Schlachten widert mich an.“ Das Schlachten, das uns durch die Zeiten begleitet: Durs Grünbein hat es in seinen Gedichten in eine ästhetische Wahrnehmungsform gebracht, die – sei es der Terror aus bewaffneten Himmeln, sei es die Arbeit im Kühlhaus für den Verzehr – in der deutschsprachigen Lyrik dieses Jahrzehnts ihresgleichen sucht. Ja, „Dauer ist bloss ein Feilschen der Zeit mit sich selbst“ in der falschesten aller Welten. Und was ist das, was die Zeit sich vorbehält?
Chronos und Mnemosyne
Drei Teile hat der Gedichtband – „Historien“, „Nach den Satiren“ und „Physiognomischer Rest“ überschrieben –, von denen jeder mehrere Zyklen unterschiedlicher Länge, Gangart und Temperatur enthält. Unsere Hybris und unsre Herkunft aus zoologischen Zeiten, das Schnelle Wohnen und schnellere Sterben, die tägliche „Asche zum Frühstück“ und „der Tag nach dem Happy End“ – das sind die Themen der über hundert Gedichte. Der globale Flaneur ist ihr heimliches Auge, Mnemosyne ihr Leitstern und Chronos ihr Held. Ob Dresden im Jahr 44, in einer Nacht „aus der urbanen Zeit in die Aschenzeit“ katapultiert, ob Berlin, wo wir uns mit Planierraupe und Zementbrei ins Vergessen einüben, oder Venedig im stinkenden Pomp seiner feuchten Gemäuer: Überall ist Pompeji und der künftige Untergang ist schon in die Lava der Zeit eingeprägt. Das apokalyptische Menetekel, seine unermüdlich vorgetragene Vanitas vanitatum, überhaupt die düstere Feier im Metrum der Todesarten, mag manchem etwas bombastisch erscheinen. Es gehört aber zu den Vorzügen dieser Verse, dass ihr glühender Kern noch nicht zum ehernen Memento mori erstarrt, sondern beweglich, fürs individuelle Sensorium empfindlich geblieben ist.
Gleichwohl ist ihr Ton mitunter etwas zu innig im Bunde mit der Vergeblichkeit, zu schnell manchmal auch mit dem Hohn auf Tand, Mordgier und Käuflichkeit. Ob Zirkusspiel, Raufereien und das letale Zucken der Leiber im alten Rom oder asiatischer Schund, Sarkasmus und eine „schwindelnd durchwachte Nacht unter Models“ am Broadway – man vermisst hier mitunter jenes Quentchen schwarzen Humors, das der selbsternannte „Clown und Chorknabe“ zu seiner Stärke erklärt. Besonders dort, wo der Postkartengruss „aus der Hauptstadt des Vergessens“ eintrifft, zeigt sein Absender miesepetrige Züge. Wer Robinson in amerikanische Städte und „Aristoteles’ Tier“ in die künstlichen Paradiese schickt, hat für das Quengeln wohlfeil gesorgt. „Dass ein Tag dem andern gleicht, besorgt das Fernsehn“ und „Fitness ist das Zauberwort“ der „Frauen an Metallgeräten“ – das ist lyrische Fingergymnastik von einem, „der auszog, das Fürchten zu lernen“, und dafür Hochglanzgazetten studiert. Dabei hat er das Fürchten im Blut.
Denn wer den „neuralgischen Kehrreim / In den Rückenwirbeln“ wie Grünbein in körpernahe Dichtung umsetzt, muss das Zucken des Herzmuskelfleischs und die grossen Worte nicht scheuen. Es macht ja gerade die Stärke des Bandes aus, dass der „Physiognomische Rest“ nicht nur in der genetischen Umlaufbahn zirkuliert, dass der Dichter das Tier, das plant, nicht bloss im Teilchenzoo ausstellt. Wenn sein „komfortables Gehirn“ unsern Eiweissgehalt bestimmt, vergisst es doch nie „die Ferne von Ich zu Gesicht“.
Ja, was ist die Zeit, und
wie fängt das an das Erinnern? Dass da jemand liegt,
Schon schläfrig und noch wach, und denkt zurück an einen,
Dem in derselben Rückenlage, Jahre früher, unbesiegt.
Erinnerung mit Käferfühlern hochkroch an den Beinen?
Das ist schön, und besonders dort, wo das lyrische Ich durchlässig wird, für die Verlorenheit, die aus der Kindheit kommt „wie zweite Masern“, hat es seine grossen Momente. So versammelt dieser Band neben melancholischen Gesängen aus der Frühzeit des Menschengeschlechts auch untröstliche Totenlieder auf das Kind, das man einmal war. Denn was ist die Zeit andres als das gelöste Rätsel der Sphinx?
Drei Arten Gegenwart sind in dir aufgespart.
Die eine heisst Gestern, die andere Heute und Morgen die dritte.
Sie alle sind rege in dir, nur in dir, nirgendwo sonst.
„Nachbilder, Sonette“ ist ein elfteiliger Zyklus auf den Uomo finito überschrieben, und „Netzhautskizzen, die man lesen lernt, / Die Augen schließend“ sind auch diese Visionen in Versen. Ja, Grünbeins Gedichte sind vor allem dies: nachzitternde Bilder, ein optischer Reigen, der Raum und Zeit überwölbt. Mag man sich auch gegen die düstren Prognosen für das Menschengeschlecht „nach den Satiren“ wehren: solche Gebilde von hoher ästhetischer Einbildungskraft und enormer Sprachphantasie sind ein Trost für die sprechende Gattung, ein poetischer Einspruch gegen den „Terror der Poren“ und den Sieg der Kehrmaschinen am Morgen – bevor die mit vollem Munde verspotteten Dämonen uns vollends eingeholt haben.
Andrea Köhler, Neue Zürcher Zeitung
Anstrengend und angestrengt
− Durs Grünbein läßt die Lyrik hinter sich. −
Viele Autoren der letzten Jahre haben ein neues Verhältnis zur gebundenen Rede gewonnen, und wenn nicht zu Reim und Metrum, so doch zu anderen Ordnungsprinzipien. Mit dabei ist Durs Grünbein mit seinem neuesten Band.
„Nach den Satiren“ heißt einer der Zyklen, aus denen dieser Band besteht, vier lange Gedichte, die sich teilweise wie ein Frontbericht aus dem zeitgenössischen Straßenkrieg lesen. Ein „urbaner Wiedergänger“ des Juvenal berichtet von Gewalt und Laster, an seinen „Schläfen / Fängt sich ein Luftstrom aus alten Städten“, die vor 2.000 Jahren dasselbe Bild geboten haben mögen. Graffiti, oder soll man sagen: Menetekel, fragen nach dem Bösen, „Leben kommt und geht im Affekt“, aktuell wie eine Tageszeitung berichtet ein Poem von „ungeheuren Verbrechen“: „Wer riskiert jetzt zu helfen, wenn ein Verletzter halbtot / Nach einem Überfall sich durch Glasscherben schleppt.“
Das zweite lange Gedicht des Zyklus ist als ein Selbstgespräch konzipiert, ein noch junges Leben zieht vor dem geistigen Auge vorüber, Kleinkinderszenen steigen herauf, Gerangel der Körper im jugendlichen Spiel, die Zeit in der NVA („beschlagnahmt zum Nichtstun“), doch am Ende wird, im letzten Wort, der eigentliche Adressat der Rede sichtbar, Orest, und die biographische Lesart erweist sich als ungenügend. Wie eine Kippfigur schlägt der Text um, wie ein doppelt belichteter Film muß das gesamte Szenarium erneut entrollt und interpretiert werden, verschiedene Zeitstufen und ihre Überlagerungen werden in einem Bild konzentriert sichtbar.
In der Literaturkritik werden die neuen Texte Durs Grünbeins als Lyrik wahrgenommen. Der Band Nach den Satiren, der ohne Untertitel auskommt, gibt jedoch Anlaß, die Gattungsfrage zu stellen. Denn Lyrik ist per definitionem charakterisiert durch „Kürze“, „Nicht-Narrativität“, „strukturell einfache Versrede“, „Sangbarkeit“, „Absolutheit des lyrischen Ichs“, „Abwesenheit agierender Figuren“ usw. Hier jedoch haben wir es mit teils großräumigen Texten zu tun, die sich zu Zyklen und weiter in (Teil-)Bücher gruppieren. Die Zyklen heißen etwa „Von den Todesarten der Idioten“ (fast schon penetrant Grünbeins Spießer-Kritik), „Kleinigkeiten nach Christus und Juvenalis“, „Novembertage“, „Heiner Müller, auf dann… Drei Blätter“ usw. Es sind große, angestrengte und anstrengende Textkorpora, deren Einzeltexte ein Verbundsystem bilden, sich ergänzen und wechselseitig interpretieren. Auch zwischen den Zyklen verlaufen Verbindungsstränge, die eine zusätzliche Verdichtung des Textgewebes bewirken: die Zeitmetaphorik, die Städte- und Landschaftsbilder (Atlantis, Berlin, Hollywood, Palästina, Rom, Troja), die kosmologischen Entwürfe, die Metaphorik der Naturwissenschaften, die Nekrologe, die Vanitasbilder, die Serien der zur Schau gestellten Prunkzitate, die von den Klassikern der Antike bis zu den Weltbildentwürfen der Frühen Moderne (Freud, Darwin) reichen.
Es scheint so, als habe der Lyriker Durs Grünbein die Lyrik hinter sich gelassen, um den autonomen lyrischen Einzeltext in einen syntagmatischen Kontext einzubetten, der auch Narrativität zuläßt, Geschichtserzählung, eine Totalität der dargestellten Welt, das Sittengemälde der Gegenwart vor dem Hintergrund römisch-antiker Dekadenzbilder. Für das immense kulturelle Wissen, das Grünbein hier einfließen läßt, ist jedenfalls eher die Prosa eingerichtet, der Prosa auch kommt traditionell die Darstellung des Häßlichen zu, wie sie in Grünbeins Band geradezu schwelgerisch gepflegt wird: Die Übelkeit nach der Völlerei, die grausame Ermordung der Rosa Luxemburg, die Schändung der Leiche des Heliogabal (eines der eindrucksvolleren Stücke), die Christenverfolgungen, Laster und Perversionen, Korruption, der Schmutz der Städte, die lange Reihe der Zynismen und Endzeitvisionen. Spricht er von Schönheit, dann „von der Schönheit der Hämatome“.
Durs Grünbein mutet sich und seinen Lesern viel zu. Sein Band zeigt die Begabungen, aber auch die Grenzen des Lyrikers. Bemerkenswert viele verschiedene Formen poetischer Rede werden hier ausprobiert, manche mit mehr, manche mit weniger Erfolg. Leicht und gelöst wirken die dialogischen Texte, die im Zwiegespräch die unterschiedliche Wahrnehmung der Welt thematisieren. Das Ich dissoziiert sich in „Er und Ich“, zwei Perspektiven, die sich ein Leben lang begleiten, sich fremd und vertraut sind, hell der eine, zuversichtlich und geschwätzig wie in Horazens berühmter Satire, düster der andere, skeptisch, schweigsam, die Stimme des Gewissens, die Stimme des Dämons. Über weite Strecken gelungen ist auch das Briefgedicht von Julianus, im Winterlager am Rhein an den Freund in Rom geschrieben. So will es jedenfalls die Fiktion.
Formal kommt Grünbein rasch an seine Grenzen, vieles wirkt überfrachtet, schwerfällig, seine Manierismen gehen auf Kosten syntaktischer Klarheit, wie der nachstehende Text über Rosa Luxemburg belegt:
Vulgäre Mäuler rissen sich um die Legende –
Jeanne d’Arc die Jüdin, die den Aufstand singt…
Ein böses Omen, eine Frau stirbt vor dem Ende
Der Dummheit, die ein schwerer Hunger bringt.
War ihre Art zu lieben der Skandal?
Syntaktisch heikel auch das folgende Bild:
Die letzte Jahreszeit, die er [scil. Heiner Müller] erlebte
Auf einer Erde, die nicht mehr erbebte
Vor frischen Massengräbern, jedes Jahr
Zehn neuen Kriegen.
Oder:
Mit offnem Mund am Straßenrand ein Offizier
Stand wie verrenkt, weil kein Befehl mehr lenkte,
Das Machtwort ausblieb wie seit Jahren nie.
Das ist, rundheraus gesagt, nicht schön. Zu streng gebaut, zu ehrgeizig wohl auch, es fehlt der Mut zur Inkonsequenz, die Mechanik des Versbaus geschickt zu unterlaufen. Beim Reim ist Grünbein deutlich freier: Er reimt, wo es sich anbietet, wo es sich ergibt, durchaus auch mit Erfolg, denn Reime tragen Witz, Lebendigkeit und einen Anflug von Behendigkeit hinein, die Schlußpointierung der Texte wirkt weniger störend. Neben dem reinen Reim werden klangliche Annäherungen gesucht, „Sündenfall“ / „Skandal“, „Zaun“ / „Traum“, der Eindruck von Gelöstheit aber dann durch manches textgrammatische Ungeschick wieder unwirksam. Der Versuch zur großen Form ist bemüht zwar und respektabel, aber doch voller Mängel und häufig steif und bieder.
Lutz Hagestedt, hagestedt.de
Durs Grünbein
war schon immer ein Skeptiker der Gesellschaft, der mit satirischer Lust die gänzlich unsatirische Alltagsmonotonie scharfzüngig konterkarierte. Ihm ging es immer schon darum, sarkastisch die vor allem urbane Paralyse spätmoderner Zivilisation darzustellen oder die Seele als Ammenmärchen zu entlarven.
Dass sich das bittere Hohnlachen, getrieben von eigenen Schockerfahrungen, erhalten hat, zeigt sich in Grünbeins jüngstem Gedichtband, Nach den Satiren. Der entgrenzte, aber mit-traumatisierte Dichter seziert eine ihm mittelmäßige Welt, ob nun in kleinen, das Morbide nur andeutenden Stills oder in ausgedehnten Reflexionsübungen.
Nach den Satiren ist der Versuch, zeitkritische Spannung über den Umweg des Abtauchens in halb verschollene Geschichte zu erzeugen. Durs Grünbein ist der conditio humana auf der Spur, den virulenten, zeitlosen Traditionen der zivilisatorischen Entwicklung.
Ausgangspunkt der literarischen Ermittlungen ist zunächst die Antike in der Form Römisches Reich. Grünbein gestaltet Szenen aus der Saturiertheit des alten Roms, spiegelt den Alltag eingeübter Hierarchien mit all seinen Chauvinismen und dem routinierten Masochismus im trostlosen Ganzen. Die Historien, die der Autor verfasst, stellen weitgehend hysteriefreie Schilderungen von der Kontinuität der Intrigen und der unerträglichen Trivialität des Seins dar.
Das Ich, das sich aus den Randbereichen einer früheren Diktatur meldet, ist mal bedenklicher Gast, mal stoischer Philosoph, imaginiert sowohl das Opfer als auch den Täter. Mittels rapidem „Identitäts-Hopping“ übt sich das Grünbeinsche Ich in Kontemplation oder fängt Smalltalk ein, werden Spielarten der vox populi vom anonymen Straßengänger bis hin zum Despoten realisiert.
Übergangslos führt der Autor Geschichte in akute Gegenwart. Das Ich schaltet um von Antike auf Konsumgesellschaft, zappt vom Panorama Rom in die zeitgenössische Avenue of the Americas, und führt die fernen Historien als ungleich plastischere Diagnosen der Gegenwart fort.
Grünbein widmet sich gern und fast exegetisch neben dem Bedeutungslosen der Vergänglichkeit. Der Mensch findet sich immer mal wieder zurückradiert auf den corpus passatus, einen vergehenden Körper. Was von ihm bleibt, Ich-frei zuletzt, ist nicht mehr als ein Fundstück für eine spätere Archäologie.
Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,
Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,
Unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,
Wird es schon morgen abstrakt sein, ein weißer Bügel,
Rein wie ein Notenschlüssel aus Draht.
Im Fundus Grünbeinscher Lyrik findet sich aber nicht nur die düstere Erfahrung der Kontingenz der menschlichen Natur in einer Art bitterer Nekrolog. Grünbein ist mehr als zynischer Nihilisierer hochgradig Sarkast, den das Design der Postmoderne nicht täuschen kann. Ihm geht es um die Beobachtung des konditionierten Menschen in den Routinen einer Potemkinschen Welt.
Obwohl hin und wieder dozierender Intellektualismus die Szene betritt, obwohl manches in Gedankenhektik zerflattert, manches in überbordender Sprache träge fließt und vieles wie eine nur neu ausgemalte Karte zu einem schon bekannten Atlas erscheint, muss man Nach den Satiren zugestehen: Stellenweise ist keine bessere Lyrik möglich.
Ron Winkler, carpe.com
Die Oberfläche des Spiegels
Doch nur einer verstellt sich vorm Spiegel,
allein mit sich selbst.
Er spinnt, von der Gattung beschattet, Intrigen.
Durs Grünbein
Vor acht Jahren hieß es in Schädelbasislektion vom „cartesianischen Hund“: „Müde der leeren Himmel, die Kehle blank / Gehorcht er dem Ersten das kommt und ihn denkt.“ Descartes als Denker des Cogito war immer Grünbeins Antipode, doch die Sehnsucht nach dem unmöglich Gewordenen, der Einheit des Subjekts, blieb. Jetzt scheint es Durs Grünbein zu sein, der von etwas gefunden und gedacht wurde.
Vom ersten Band Grauzone morgens an ringt Grünbein um Form, um Ordnung. Auf der Suche nach etwas, das der eigenen Fragmentierung in Stimmen, in fremde, selbsteingeflüsterte Gedanken, entgegengesetzt werden kann. Ordnung, ohne einem unreflektierten Klassizismus zu erliegen. Das Mitstenographieren der Welt geschieht seit damals in zunehmend strengeren Formen.
Die Manie der Schädel und Nerven, der Versuch, den Menschen auf das vermeintlich Nichtmetaphysische des Körpers zu reduzieren, tritt in den Hintergrund. Auch die Sehnsucht danach, nicht mehr Subjekt sein zu müssen. Beides verlagert sich in die Form der Gedichte: Die Stilleben In der Provinz, die Rollengedichte der Historien.
Die Lust an der Pointe, die manchmal zur Zote wird, entfaltet sich dort in erfundener Vergangenheit. Das Schreiben entzündet sich daran, die Überfarbigkeit der Bilder in kühler Sprache aufzufangen. Sie gewinnen ein halluzinatorisches Eigenleben, wie etwa im Bericht von der Ermordung des Heliogabal. Davon wird die Sprache der Gedichte getrieben. Die Form wird Begrenzung und Durchlaß zugleich: ein Gefäß, durch das die Worte rinnen können.
Die Stationen in Nach den Satiren: das Rom der Antike, Venedig, Hollywood, Dresden, Berlin. Venedig ist Zeichen des Verfalls, der Unterhöhlung, aber auch des touristischen Handels damit, also Unterhöhlung des Verfalls. Dresden und Berlin: die Heimat überrollt, die Jugend vorbei, eine Welt zusammengebrochen; die Wahlheimat im Umbruch, eine Stadt voller Versprechen und Selbstbetrug. Grünbeins Rom ist häufig nichts als Berlin oder New York mit Toga.
Hollywood ist der „Mythos“ („einer von den neuen“), den man aufsucht, um sich von ihm zu befreien. Doch die Faszination bleibt. Hollywood ist der Ort, an dem die Inszenierung ihren Höhepunkt erreicht, die Oberfläche gefeiert wird, wo man am deutlichsten Illusion und Realität ineinanderschlagen sieht. Daher die Ambivalenz, mit der Grünbein mit Oberfläche, den Fundstücken der Worte und Bilder umgeht. Es ist schwer zu unterscheiden, was Zeichen ist und was nur ein Stock.
(Normandie)
Eingefallen am Bahndamm,
liegt ein Hundekadaver, quer im Gebiß
Kreiseweiß numerierte Schwellen, erstarrt.
Je länger du hinsiehst, je mehr
Zieht sein Fell in den Staub ein, den Schotter
Zwischen den Inseln aus frischem Gras.
Dann ist auch dieses Leben, ein Fleck,
Gründlich getilgt.
Der Beginn also In der Provinz. Kein Stimmengewirr bricht ein. Der Blick fällt ungestört auf den Kadaver eines Hundes. Was in dieser biotopen Stille erscheint, ist alles andere als idyllisch: natura morte im Wortsinn, die Gleichgültigkeit der Natur. Die Geschichte ein Versickern im Boden, das keine Spuren hinterläßt.
Die Vergangenheit, in der man sein Selbstverständnis daraus beziehen konnte, weder zum einen Land noch zum anderen zu gehören, ist verloren. „Glücklich war ich in einem Niemansland aus Sand / War ich ein Hund, in Grenzen wunschlos, stumm“, heißt es im „Portrait des Dichters als junger Grenzhund“ in Schädelbasislektion. Die Geschichte schreibt diese Geschichten fort. Die einzelne ist ihr Spielball, aber sie ist nichts als das Leben der einzelnen.
Der Grenzhund, als der Grünbein in Schädelbasislektion auftaucht, der Dichter zwischen den Fronten, aus Funktionen und Gemeinschaften ausgeschlossen, keiner Zeit wirklich zugehörig, der Körper fremd, keine Stimme die eigene, er liegt im ersten Gedicht von Nach den Satiren tot, irgendwo in der Normandie.
Fantasiestücke, halb durchgeführte Terzinen, Liedstrophen inmitten langzeiliger Gedichte, Sonette in ungewohntem Druckbild, mal fünf-, mal sechshebig, schnoddrige Hexameter. Grünbein reagiert auf den Verlust der Vergangenheit mit klassischer Formstrenge oder genauer: mit ihrer Erfindung.
In Falten und Fallen hatte er noch Pseudo-Sonette geschrieben. Sonette, die zwar das Metrum einhielten, sich aber nur auf den letzten beiden Zeilen reimten. Das war nicht ungenau: Die Form war als Zitat erkennbar, der historische Abstand kenntlich gemacht. In Nach den Satiren gibt es mit den „Nachbildern“ jetzt durchgereimte Sonette. Hin und wieder ist unklar, wie weit Grünbein den historischen Abstand, die Differenz von Gestus, Inhalt und Form noch mitreflektiert wissen will. Langsam wächst die Maske an.
Viele Gedichte wirken nach wie vor durch das Ineinander von prosaischer Sprache und strenger Form. Hin und wieder entgleitet diese Methode zum bloßen Nebeneinander oder zum reinen Erzählton. Ein Ton, der keine Brüche mehr kennt, keine Gegenstimmen, die ihn korrigieren könnten.
Wer den Kopf verliert,
dem sind die nächsten Schritte ungewiß. So sucht er Stützen,
In dem was war. Nur auf Verlassenheit ist dann Verlaß.
Und der Körper altert. Das Vergehen der Hülle, die in früheren Gedichten eine Metaphysik des Physischen etablierte, einen nicht weiter reduzierbaren physiognomischen Rest, sprengt für kurze Momente die Distanz zum Wahrgenommenen, zu sich selbst. „Was sind Gedichte / Gegen die Folter im Hirn, das Ächzen im kranken Leib?“ Der Dichter erschrickt, morgens den eigenen Körper zu sehen, der ihn im Stich läßt.
Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,
Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,
unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,
wird es schon morgen abstrakt sein, ein weißer Bügel,
rein wie ein Notenschlüssel aus Draht.
In einem Spiegel zeigt uns Grünbein, welche Utopie noch bleibt: klare, menschenlose, kühle Präzision des Unorganischen, des Knochens, in die Funktionalität eines Instruments gehoben – eines vollendeten Instruments, weil es keinen Aufgabenbereich mehr hat.
Grünbein scheint in einer Art selbsterfundener Klassik einen Weg gefunden zu haben, die Sprache ins Rollen zu bringen. Sie bleibt oft seitenlang in Bewegung. Bei großer Virtuosität ist die Suada nicht weit. In den „Veneziana“ etwa oder im „Denkmal für einen Fuß“ bricht eine Kluft zwischen Ton und Gegenstand auf. Der Manierismus ist dort keine bewußt eingenommene Pose, kein Aneinanderreiben der Gegensätze mehr, sondern Beliebigkeit. Mit seiner Sprachmaschinerie könnte Grünbein dann eigentlich alles bedichten.
Vielleicht steckt wirklich eine Sehnsucht nach Handwerk hinter diesen Gedichten: eine Sprache zu haben, die einem im Mund liegt wie dem Fotografen die Kamera in der Hand.
Alexander Gumz, luise-berlin.de, 1999
Das Ende der Saturiertheit
Bei dem Lyriker Durs Grünbein, der 1962 in Dresden geboren wurde, läuft die Frage nach seiner Herkunft aus Ost oder West ins Leere, denn Grünbein hatte sich früh angewöhnt, die Gegenwart und die Zukunft mit demselben distanzierten Blick zu betrachten wie das Römische Reich: einem Blick, unter dem schon „der Morgenhimmel pompejanisch rot“ aufglänzt. Diesen Kunstgriff und Bewußtseinsakt führt der Autor ausdrücklich auf den Kirchenvater Augustinus zurück, dem es in seinen berühmten Meditationen über die Zeit darum ging, „das noch Künftige in die Vergangenheit (hinüberzuschaffen), so daß um die Minderung der Zukunft die Vergangenheit wächst, bis schließlich durch Aufbrauch des Künftigen das Ganze vollends vergangen ist“.
Nach den Satiren heißt Grünbeins neuester Gedichtband, was erstens das Ende einer Saturierten-Poesie verkündet, in der noch die bissigste Kritik Selbstgenuß und Einverstandensein bedeutet. Einer Poesie aber auch, die von klaren moralischen Kategorien („Noch stand an keiner der Mauern Was ist das Böse?“) ausgehen konnte. Zum dritten beschwört der Titel den Geist seines allgegenwärtigen Mentors Heiner Müller, des „Fabel- und Fallenstellers / Im Selbstgespräch mit den deutschen Gespenstern“, der seinen Verbleib in der DDR damit begründet hatte, daß sich im Osten noch Tragödien ereigneten, im Westen nur die weniger interessanten Komödien. Grünbein, der Dialektiker, hält sich bei solchen Alternativen nicht mehr auf, sondern seziert das alternativlos gewordene Komödiantenstadl mit sicherer Hand, um festzustellen, daß auch „das Gewölbe aus Übermut, / Auf dem man so sicher ging, lautlos zusammenstürzt“ und „die Kälte hereinweht, der Haß“.
Autoren wie Botho Strauß haben daraus die Rückkehr der Tragödien gefolgert. Für Grünbein sind die kollektiv erinnerten Vergangenheiten oder Utopien, aus denen sie sich speisen, nur noch „ein Rest von Lüge familiär geteilt – als Proviant“. Bereits in seinem Gedichtband Schädelbasislektion (1991) hatte er den „Großen Gesängen“ über die wieder in Gang gekommene Geschichte mit einem Hinweis auf die unterschiedliche Wahrnehmung der Zeit eine Absage erteilt: „…langsam kommen die Uhren auf Touren / jede geht anders“.
Nach den Satiren ist auch der zentrale, aus vier Langgedichten bestehende Zyklus dieses Bandes betitelt, der mit einem programmatischen Satz des römischen Dichters Juvenal eingeleitet wird: „In der Stadt zu schlafen kostet viel Geld, / Davon rühren alle Übel her“. Der erste Teil, „Historien“, handelt von geschichtlichen Figuren und Begebenheiten, vornehmlich aus dem Römischen Kaiserreich. Der dritte Zyklus, „Physiognomischer Rest“, ist eine lockere Sammlung von Reise- und Stadtgedichten. Der Weltenbummler sinniert darin über den Genius loci populärer Orte in der Alten und Neuen Welt, stellt sich dem Chaos der Simulationen, der medialen Bilder und globalen Vernetzungen, um sich eine geistige Biographie zu erarbeiten, die zumindest als Fragment, als „Physiognomischer Rest“ eben, lesbar ist. Seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in begreifbare Bilder zu fassen und klassisches Bildungsgut zu aktualisieren, ist beeindruckend.
In „Aporie Augustinus (Über die Zeit)“ nimmt er Bezug auf die „Bekenntnisse“ des Kirchenvaters. Er spitzt dessen Erfahrung innerer Zerrissenheit – „ich aber splittere in Zeit und Zeit“ – dramatisch zu, denn eine Anrufung Gottes als letzte, unangefochtene Instanz des Trans-zendentalen, in deren Zeichen Augustinus hoffte, „ein ungeteiltes Eines“ zu werden, kommt für den Spätgeborenen selbstredend nicht mehr in Betracht:
Zeit ist das Seil das ein Esel frißt und herausscheißt, verknotet.
Und der Esel gehört einem Mann der die Knoten löst
Und dem Tier von neuem das Seil hinhält, mangels Futter:
Und der Esel macht statt zu rülpsen den Laut
Den nur der Esel beherrscht, vollendet.
Im Gedicht „Griechischer Abschied. Eine Stele“ greift der Trauernde auf dem Relief hilfesuchend nach der Hand des Toten. Doch ist der Verstorbene gerade wegen seines Erkenntnisvorsprungs, den ihm die Entrückung aus dem Reich der Lebenden verschafft hat, nicht in der Lage zu helfen. „Er weiß, / Daß vor ihm nichts mehr kommt“, und selbst die Vergangenheit („Sein Grab wird leer sein“) beginnt ihm abhanden zu kommen. Zwischen seiner Erfahrung des Nichts und der Welt der „Täuschungen“ (deren letzte die Grabinschrift ist), in die die Lebenden unentrinnbar eingesperrt sind, gibt es keine kommunikative Brücke. Er hat Mitleid mit dem Trauernden und schämt sich für dessen erwartungsvolle Unbedarftheit. Als einzig erreichbares Echte im Leben kann er ihm die intensive physiologische Wahrnehmung empfehlen: „Es ist nichts, / Was sich vergleichen ließe mit den Thymianwiesen, / Den Schatten unter Pinien…“ Zwei der Identifikationsmöglichkeiten, die sich dem Leser anbieten, seien genannt: Zum einen die mit dem Trauernden auf der Stele, und zweitens die mit dem vom Dichter implizierten Betrachter. Im ersten Fall muß er erkennen, daß die Toten durch ihren erzwungenen Verzicht auf Täuschungen und Selbsttäuschungen paradoxerweise „vitaler“ sind als die Lebenden (eine Variation des Satzes „Die schatten atmen kräftiger“ in Stefan Georges „Porta Nigra“), im zweiten Fall akzeptieren, daß ihm die antike Kunst (anders als noch in Rilkes „Archaischer Torso Apollos“) keine Wegweisung mehr gibt.
Der Rekurs auf eine höhere, sinnstiftende Instanz verbietet sich Grünbein schon wegen des Ideologieverdachts. Die Sehnsucht nach Transzendenz und der Wille, die Essenz geschichtlicher Erfahrungen zu ergründen, bleiben indessen wirksam: „Es gab so vieles, / Wo alles anfing, hier, am kapitalen Ende“, schreibt Grünbein in einem seiner zehn Venedig-Gedichte. Sie äußern sich bei ihm in einer extremen physiologischen Sensibilität oder, wie er selber sagt, „Reizbarkeit“:
Der erste Blick und der letzte
Kreuzen einander, in einer Drehung…
Im Schwarz der Pupille ertrinken
Landschaften, Menschen und Städte
In diesem Vorgang gelingt ihm eine Großstadtpoesie von atemberaubender Evidenz:
Autos gleiten vorüber, friedlich schillernde Hechte
Im verregneten Schilf
oder:
Dresden, die Restestadt… ein Hinterhalt
Für Engel, die der Krieg hier internierte
Vorm Rückflug.
Durch Bildung, Sprachgewalt und Intellekt ist Durs Grünbein konkurrenzlos unter den Schriftstellern seiner Generation – und darüber ein wenig hochmütig geworden. Wie sonst sind die vielen störenden Nachlässigkeiten bei einem so stilsicheren Lyriker, der klassische und moderne Versformen aus dem Handgelenk schüttelt, zu erklären? Seine Bemerkung über die ermordete Rosa Luxemburg: „Ein böses Omen, eine Frau stirbt vor dem Ende“, entspricht nur dem monographischen Standard. Seine Verse über die amerikanische Westküste: „Alles trägt hier den Namen absurder Glückseligkeit“, reichen alte Klischees weiter. Aber vielleicht gehören auch noch solche Stilbrüche zu einem Buch, das repräsentativ für die geistige Situation seiner Zeit sein will – und diesen Anspruch tatsächlich erfüllt!
Doris Neujahr, Junge Freiheit, 10.3.2000
Lyrik im Zeitalter des Postsozialismus
− Alles geht weiter, vor allem der Krieg. Neue Gedichte von Volker Braun und Durs Grünbein. −
Volker Braun und Durs Grünbein stammen beide aus Dresden, arbeiteten als Schriftsteller in der DDR und leben heute in Berlin. Dennoch trennt sie mehr als bloß ihr Altersunterschied. Der heute 60-jährige Volker Braun hat mit seinem Schaffen die Entwicklung der DDR in kritischer Loyalität begleitet und eckte mehrfach bei der herrschenden Nomenklatura an, die ihn observieren ließ, obwohl er dem Staat, in dem er lebte, trotz aller Kritik im Festhalten an der Utopie einer sozialistischen Gesellschaft stets verbunden blieb. Bereits vor 1989 und erst recht danach wurde die Klage über den Verlust dieser Hoffnung und die unerbittliche Selbsterforschung über die eigene Verstrickung in diese Epochenillusion zum dominanten Thema seiner Texte. Ganz anders bei dem um eine ganze Generation jüngeren Durs Grünbein. Sein Werk hält seit dem ersten Gedichtband Grauzone morgens (1988) Distanz zu den Ideologien und utopischen Erwartungen des 20. Jahrhunderts und zum Leitdiskurs der DDR-Literatur. Daher ist die Desillusionierung über den Zerfall der projektierten Zukunftsgesellschaft für ihn nicht wie bei Volker Braun das Resultat eines längeren Prozesses der Enttäuschung über das einst Geglaubte, sondern bildet das unhintergehbare Fundament seines Schreibens, auf dem alles Folgende aufbaut. In seinem Werk betreibt er, auch wenn das von der Kritik gern übersehen wird, mehr als nur die Auseinandersetzung mit der untergegangenen DDR, nämlich eine grundsätzliche und schonungslose Analyse der modernen Zivilisation. (…)
Während Volker Braun trotz aller Skepsis grundsätzlich auf den Utopiediskurs fixiert bleibt und mit dem Mut des Verzweifelten darüber nachsinnt, ob die Geschichte ihr Rad nicht doch noch irgendwann wieder in die andere Richtung lenken wird, ist der Gedichtband von Durs Grünbein von vorneherein jenseits der Debatte über die großen philosophischen Metaerzählungen situiert. Ganz ohne Selbstmitleid und Schmerz verzichtet der Autor auf alle Utopien und universalistischen Sinnkonstruktionen, stellt er sich illusionslos dem Blick auf eine Geschichte, die vom Altertum bis in die Gegenwart eine Geschichte der Schlachten und Zerstörungen gewesen ist: „Alles geht weiter, nicht erst seit heute, vor allem der Krieg“, heißt es in dem zentralen Gedicht „Memorandum“, das die Krise der Poesie angesichts ihrer drohenden Marginalisierung durch die Massenmedien reflektiert. Und auch der Blick auf die außermenschliche Natur, aus dem die Kälte und affektive Distanz eines unbeteiligten Naturforschers spricht, bietet angesichts solcher Ausweglosigkeit weder Tröstung noch Heil. „Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen.“
Das Sinnversprechen, das in den überkommenen Denksystemen einmal aufbewahrt schien, hat sich für Grünbein heute weit zurückgezogen und überlebt, wenn überhaupt, nur noch im Reservat der Poesie selbst:
[…] Aber wenn alles zuwächst,
Der Traum undurchdringlich wird in der Menge,
Ist es der Vers, der ins Freie zeigt. Der geblendete Stieglitz
Singt schöner, heißt es, zu keinem Flug mehr verführt.
Das ist ein deutlicher Gegenentwurf zu der Position, wie sie zum Beispiel von Volker Braun eingenommen wird, der den geschichtsphilosophischen Utopien um keinen Preis abschwören möchte. Mit dem Beharren auf einer Epiphanie des Schönen inmitten einer häßlich gewordenen, von der technischen Zivilisation verschandelten Realität versichert sich Grünbein einer literarischen Tradition, die vor allem auf Rilke und Hofmannsthal zurückweist. Aber auch andere Dichter der Moderne – wie Baudelaire und Lautréamont, Friedrich Hölderlin, die Expressionisten, Brecht und Benn, Bachmann und Brinkmann – haben in dieser Lyrik, die durch eine erstaunliche Gelehrsamkeit und einen schier unerschöpflichen Reichtum an Ausdrucksmitteln frappiert, ihre Spuren hinterlassen. Gelegentlich wirkt das souveräne Verfügen über das gesamte historische Inventar lyrischer Formensprache, von antiken Odenstrophen bis zum expressionistischen Reihungsstil oder zur Prosazeile des modernen Gelegenheitsgedichts, etwas verspielt und manieriert. Doch vertraut sich der junge Autor mit seinen Variationen überkommener Muster nicht einfach naiv einer großen Tradition an. Anders als vielen seiner Vorgänger bliebt ihm stets bewußt, daß auch die Poesie angesichts der postmodernen Sinndestruktion an Bleibenden „nichts mehr stiften“ kann. Und seine Inhalte sind, selbst wenn er in das antike Gewand von Juvenalis schlüpft oder Baudelaires „Tableaux parisiens“ nacheifert, immer die von heute.
Politische Gedichte, die unmittelbar auf geschichtliche Vorgänge Bezug nehmen, findet man bei Durs Grünbein kaum. Zu den Ausnahmen zählen die eindrucksvollen Strophen, die dem verstorbenen Mentor Heiner Müller gewidmet sind, oder der Zyklus „Novembertage“, der von der Maueröffnung im November 1989 einen historischen Bogen schlägt zum Mord an Rosa Luxemburg und zum Hitlerputsch im November 1923 und so wie im Zeitraffer die für die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert zentralen Ideologien Revue passieren läßt. Auch für Grünbein endet der Tanz der aus ihrer „Geiselnahme“ entlassenen DDR-Bevölkerung auf den Berliner Boulevards übrigens im Katzenjammer, weil die Konsumgesellschaft ihren Freiheitstraum im Keim erstickt:
[…] sie lagen eingerollt
Vorm Kaufhaus selig unter den
Vitrinen,
Auf teurem Pflaster träumend
freien Grund.
Andere Gedichte wie etwa „Sunset Boulevard“, aus Anlaß eines längeren Aufenthalts in den Vereinigten Staaten entstanden, nehmen in ihrer Kritik am Kapitalismus amerikanischer Prägung das Erbe von Brechts polemischen „Hollywood-Elegien“ wieder auf, wobei dem Lyriker ebenso minutiöse wie bitterböse Momentaufnahmen der postmodernen Erlebnisgesellschaft mit ihren Film- und Fitness-Studios gelingen. Hier läßt sich jemand auf unsere heutige Wirklichkeit mit offenen Sinnen ein, vertraut seiner eigenen individuellen Wahrnehmung und fängt in einer Phänomenologie aktueller Lebensformen ebenso differenziert wie subtil die Deformationen und Irritationen unserer Alltagsrealität ein. Dasselbe gilt für die zahlreichen Großstadtgedichte, die eine historische Topographie von Städten wie Berlin, Dresden und Venedig entwerfen, oder für die Reisegedichte aus der Karibik, in der die ein paradiesisches Leben verheißenden Slogans der Werbeprospekte und die schnöde Banalität der Ferienclubs mit einer satirischen Schärfe aufeinanderprallen, wie sie in der Lyrik der letzten Jahre nur selten anzutreffen gewesen ist. Immer wieder öffnen sich die Gedichte dabei mit einer Vielzahl intertextueller Bezüge und historischer Assoziationen für die geschichtliche Dimension, die in der Gegenwart verschlossen liegt, für die Spuren des faschistischen und stalinistischen Terrors oder der kolonialen Eroberungszüge, und entziffern so die Urgeschichte der modernen Zivilisation seit dem frühen Altertum als erschreckendes Kontinuum von Krieg und blanker Gewalt.
Grünbein betreibt mit seiner Lyrik aber nicht nur eine historische Archäologie der menschlichen Zivilisation, sondern darüber hinaus so etwas wie eine unerbittliche Analyse der menschlichen Existenz. Seine Skepsis gegenüber allen Dogmen und Sinnsystemen speist sich daher nicht allein aus dem Unbehagen an den bestehenden sozialen Verhältnissen, sie speist sich vielmehr noch aus ganz anderen Quellen. An ihrem Grund stehen die Ängste und Zweifel eines Einzelnen angesichts der Kontingenz der menschlichen Natur, steht die konstitutive Erfahrung der Endlichkeit des Daseins, der Krankheit, des Todes. Es sind dies Voraussetzungen, die, wie die naturwissenschaftlichen Exkursionen in den Bereich der modernen Biologie und Medizin deutlich machen, grundsätzlich allen Lebewesen gemeinsam sind, die aber nur der Mensch kraft seines Verstandes zu reflektieren vermag. Doch er flüchtet sich vor dieser die Souveränität seines Selbstbewußtseins erschütternden Kontingenzerfahrung lieber in Selbsttäuschungen und Sinnprojektionen aller Art, und daher hat die Poesie für Grünbein die Aufgabe, ihn aus seiner Alltagsroutine aufzuschrecken und ihm diese Verdrängung immer wieder aufs Neue in Erinnerung zu rufen.
Nach den Satiren wirft ein Licht auf die kleinen und großen, die schmerzlichen und aberwitzigen Tragödien der Existenz, aber auch auf die gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontexte, in denen sie sich ereignen. Kein Zweifel, Durs Grünbein ist mit diesem Gedichtband, der zwischen illusionsloser Existenzanalyse und kulturkritischen Diagnosen, zwischen Längstvergangenem und jüngster Gegenwart eine Brücke schlägt, eine ebenso eindringliche wie beeindruckende Bilanz unserer Gegenwart gelungen.
Heinrich Kaulen, der Freitag, 26.3.1999
Der strahlende Eisblock
− Nach den Satiren – das reichste und bedenklichste Buch des Dichters Durs Grünbein. −
Am Anfang blickt man ins Schweigen einer Landschaft. Oben, eingeklammert, ein Ortshinweis wie auf manchen Gemälden von Anselm Kiefer: Normandie. Dann: „Gefallen am Bahndamm, / Liegt ein Hundekadaver quer im Gebiß / Kreideweiß numerierter Schwellen, erstarrt.“ Alles, was Sprache vermag, steckt in diesem Beißverhau aus Wörtern; wie ein Blitz schießt zusammen, was ist, was war, was wird.
Was wird, liegt beschlossen im „Gebiß“ der Schwellen und in den Kreidemarken: das weiße Skelett, der grinsende Tod, nachdem das Fleisch des Hundes von Klein- und Kleinstfressern abgeräumt, sein Fell zu Staub geworden ist. Was war, ist der Krieg, ist die Landung der Alliierten in der Normandie, sind Güterzüge mit Nachschub an Mensch und Gerät, sind die Gefallenen – und es bedarf keiner Kenntnis der speziellen Hunde-Metaphorik des Dichters, um in der toten Kreatur den armen Hund per se zu sehen, den gemeinen, den unbekannten Soldaten. Was war, ist schließlich auch jene berüchtigte Rampe fern im Osten, an die man unwillkürlich denkt, wenn sich das Bild von Gleiskörpern mit denen von Kadavern und Nummern verfräst, die Rampe von Auschwitz. Und dann (oder sieht man alles zugleich, übereinander, wie im Palimpsest?) ist da wieder nichts als ein totes Tier, erlegt vielleicht von einem Schnellzug, eingerammt zwischen die Schwellen. Ein Bild der Gewalt, ganz gleich, ob man sie auf Krieg, Verkehr oder Naturvorgänge zurückführen will. Und, dies nicht minder: ein Bild, das alles andere ist als nur eine jener poetischen Metaphern, denen erst der vielfache Schriftsinn ein bißchen Leben einhaucht: (Normandie) Gefallen am Bahndamm, Liegt ein Hundekadaver quer im Gebiß Kreideweiß numerierter Schwellen, erstarrt.
Je länger du hinsiehst, je mehr
Zieht sein Fell in den Staub ein, den Schotter
Zwischen den Inseln aus frischem Gras.
Dann ist auch dieses Leben, ein Fleck,
Gründlich getilgt.
Dieses Gedicht, das „transhistorisch“, wie es in dem poetologischen Essay „Mein babylonisches Hirn“ von 1995 einmal heißt, an den Weg allen Fleisches gemahnt und aus dem zugleich die Schrecken des Jahrhunderts uns anspringen, eröffnet den fünften und bislang umfangreichsten Lyrikband von Durs Grünbein. Es bildet das erste von fünf Stilleben, die unter der Überschrift In der Provinz zu einer der vielen Gruppen und Kleinstzyklen des Buchs zusammengefaßt sind: Vanitas-Bilder könnte man sie nennen, mit Kadavern vor abendländischen Landschaften.
Aber vielleicht ist es besser, von Epitaphen auf tote Tiere zu sprechen, weil sich immer auch eine Erschütterung mitteilt, ein Leiden mit Hund, Hase, Maulwurf, Frosch, Amsel und dem alten Adam, der durch sie alle hindurchlichtert, wenn auch nur als Gattungswesen, Art unter Arten und angelegt auf Reflexe. Und wenn er einmal als er selbst auftritt, dann gleich als Zerstörer:
Ob Daker und Hunnen, Mongolenpferde und Motorräder – […]
Damals im Staub grober Quader, heute auf nassem Asphalt.
Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen.
Dieses statische Menschenbild, das transparent allenfalls nach rückwärts ist, hin auf den haarigen Affen, „humpelnd auf Fäusten“, scheint Grünbeins Dichten unvermindert zu beflügeln. Im Blickwinkel seiner szientistisch hochgerüsteten Darwin- und Pawlow-Religion, seines Bio-Nihilismus, der die Kritik mit Recht an Gottfried Benn erinnert hat, marginalisieren sich nicht nur historische Abstände, sondern auch solche zwischen höherem und niederem Leben. Da mag er noch so sehr Poeta doctus sein, noch so vernarrt in Hochkunst und Formenstrenge, ja selbst, wie in diesem reichsten und bedenklichsten seiner Bücher sich zeigt, in die schönen Faltenwürfe des Verfalls: nichts ist seinem Existenzgefühl so fern wie die Vorstellung, daß „Ich“ mehr sein könnte als eine bloße Funktion von Hirnströmen; nichts ihm exotischer als die bürgerliche Verbesserung des Individuums, als eine Kultur des Maßes, als helle Humanität…
Dieses reichste und bedenklichste Buch: „Man reibt die Augen, sieht das Vielzuviele“, weit über hundert Gedichte nämlich aus fünf Jahren, zusammengefaßt zu zwei großen Gruppen, überschrieben Historien und Physiognomischer Rest, zwischen denen als Herz- und Gelenkstück der titelgebende Zyklus eingefügt ist: Nach den Satiren, vier große, freirhythmisch schwingende Erzählbilder, in denen ein „Wiedergänger“ des galligen und verfallsbesessenen römischen Satirikers Juvenal das heutige Berlin bei Nacht und Tag durchstreift, ein Geisterseher, dessen Röntgenauge, ob es will oder nicht, die Physiognomie des Alltags durchdringt und nichts als Spuk dahinter sieht.
Auf diesen Spuk ist der Titel gemünzt: „Die Satire“, liest man dazu in den gelehrten Anmerkungen am Ende des Bandes, „war sozusagen der Gesang der satten Leute. Wohl deswegen trugen sie ihn so gern bei den Mahlzeiten vor. Nach den Satiren, das war, wenn alles gesagt und durchgekaut war, der Heimweg, der Katzenjammer […]. Während der Magen arbeitete, kehrten die mit vollem Munde verspotteten Dämonen langsam zurück.“
Das freilich tun sie auch ohne solchen Kommentar, und es wäre schlimm, wenn man klassisch gebildet sein müßte, um ihre Anwesenheit zu bemerken, wenn einem nur aufblitzte, was man bereits weiß, wenn die plötzliche Wahrheit einer Wortfügung, einer poetischen Vision nicht gelegentlich umfassender wäre als die persönlichen Wahrheiten des Dichters, als Neurophysiologie und Abstammung der Arten. Es gibt bei Grünbein eine atemberaubende, unmittelbar zwingende Evokationskraft und Bildphantasie, die tatsächlich ans Visionäre grenzen und elaborierte Vermittlung nicht nötig haben:
Wie im Bürgerkrieg sind die Rolläden dicht, hinter Gittern
Die Geschäfte den Schauhäusern gleich, glasiert in der Frühe
Mit Leichenteilen in jeder Tiefkühltruhe, geäderblau
Strahlend aus jedem Eisblock, vor den glänzenden Kacheln
In Dosen das Fleisch toter Tiere. Kein Gesicht einer Frau
Tröstet das Weinen der Dinge, den scharfen Grabsteinglanz
aus den Regalen.
Da haben wir es, in einem Bild, das ganze sterile und gekachelte City-Deutschland bei Nacht, „Autos gleiten vorüber, friedliche schillernde Hechte / Im verregneten Schilf“, und zugleich, in den Vorstädten, wo „zischend / Ein Streichholz die Szene aufreißt, den magischen Kreis / Aus Gewalt und Reflex“, sortieren Passagen „die kommenden Opfern nach Alter und Schwäche. Selten nach Wohlstand.“
Die vier Langgedichte „Nach den Satiren“ sind ein deutsches Pandämonium, errichtet von einem, der Gewalt, Verfall und Sterben wie im magischen Kristall erblickt, dem überall im Dickicht Berlins die „Schatten“ des kollektiv Verdrängten begegnen und dem die toten Dinge Menetekel werden, so, als wäre er in einem bösverspielten Trickfilm:
War da ein Fußweg, sah ich Kreidestriche für die Körper,
Die bald dort liegen sollten, eingezeichnet, den Seziertisch
Große Gesänge, die auch ein paar Klischees verkraften („In tausend Hinterzimmern trösten Leute, die mit Lottozahlen / Ihr täglich Glück verfehlen sich beim Sport“). Welche Wucht hätten sie erst in einem halb so umfangreichen Band, unmittelbar in Spannung gesetzt zur Sprödigkeit der Provinz-Stilleben oder zu den klaglosen Abrechnungen (Vita brevis, Brief an den toten Dichter, Novembertage I) mit einem Staatssozialismus, als dessen „Geisel“ sich der 1962 in Dresden Geborene bis zum 9. November 1989 empfunden hat:
… sah man Die kommunistischen Auguren zögernd lächeln
Wie Spieler, die verlieren, und jetzt wissen sie,
Was sie, gewiegt in Sicherheit, vergessen hatten.
Mit einer letzten Drohung, einer Atempause, Erklärten Greise meine
Geiselnahme für beendet.
Doch ja, sie haben sich auffallend vermehrt, jene Gedichte, in denen Grünbein seine Erschütterbarkeit nicht mehr in ruppig expressionistischer Reihung und surrealen Bildketten, nicht mehr durch Technifizierung – l’homme machine – vor sich selbst und aller Welt verklausuliert. Vor fünf Jahren, in Falten und Fallen, hat er den „Panzer aus Sprache“ noch einmal drohend-programmatisch auffahren lassen, aber schon damals war die jugendlich forcierte Kälte aus Schädelbasislektion (1991) nicht mehr ganz wahr, konnte man Zoo-Gedichte lesen – ein wunderbarer Nachzügler, gewidmet „Einer Gepardin im Moskauer Zoo“, findet sich im vorliegenden Band −, in denen Kunst ein Mitempfinden bis in jede Körperfaser der Tiere ermöglichen will und nicht ihren Stolz dareinsetzt, jede Regung zu vereisen.
Die Gepardin gehört also auch hinein in die verschlankte Wunsch-Ausgabe. Hinein gehört ein „Veneziana“-Zyklus, in dessen verschwenderischer Bilderfülle das Glück beim Schauen noch nachzittert: Eine Verzückung, beinah kampflos einverstanden mit sich selbst – so etwas ist neu bei Grünbein. Zum erstenmal, so scheint es, tritt ihm in Venedig, dem „umgekehrten Vineta“, Dauer nicht als sterile Schauseite und Ewigkeitsanmaßung entgegen, wie da, wo allmorgendlich die „Kehrmaschine das letzte Wort hat“, sondern mit der Würde des Einverständnisses:
Wasser nimmt
Den Jahreszehnt, die Summen, die dem Fiskus nie gebührten,
Was Zeit sich vorbehält. Und siehe da, die Stadt,
Bedroht vom Wellenschlag, noch lebt sie munter, schwimmt.
Dagegen: Dresden, das auch eine Serenissima gewesen ist, unteutonisch wie nur eine, dann, in der Nacht auf den 14. Februar 1944, „aus der urbanen in die Aschenzeit“ befördert. Sieben, acht der elf Dresden-Gedichte („Europa nach dem letzten Regen“) scheinen eine volle Reifezeit entfernt von der posierten Kaltsinnigkeit des „Gedichts auf Dresden“ in Schädelbasislektion – und sind ein Muß für den imaginären schmalen Band. – An dieser Stelle, statt Elogen auf Grünbeins Liebesraunen von seiner Stadt, statt Paraphrasen der Bilder von Trauer und Schrecken, nur ein Ausriß aus einem Gedicht, das er seiner Großmutter, Zeugin des Infernos von 1944, gewidmet hat:
Vom Glutwind warm
War draußen Winter, und die Nacht war Tag.
Gespenster, die im weißen Nachthemd spuken,
Rannten sie barfuß an die Elbewiesen.
[…] – Panik, ein Luftstrom aus den Feuerluken,
Bevor aus allen Wolken die Posauen bliesen.
Und als der zweite Angriff kam, verschwand
Die Stadt im Stummfilm, und kein Schatten fiel
Als sie verbrannte durch die Flammenwand,
Den einen Falle und den andern Ziel.
Aus einer Nacht im zwanzigsten Jahrhundert
Flogen Maschinen eine zweite Steinzeit an
Dieses reichste und bedenklichste Buch! Denn bedenklich ist es auch. In dem Maße, wie sich Grünbein seiner Fähigkeiten sicher geworden ist, scheint bei ihm ein Hang zu glamouröser Rhetorik, zu verbaler Filmmusik erwacht zu sein, der Mißtrauische dazu verführen könnte, auch seine Herbheit für angelernt zu halten und, nur zum Beispiel, das preziös überinstrumentierte Kriegs- und Rußlandepos „Transpolonaise“ gegen Verdichtungen des Schreckens wie in den Provinz-Bildern auszuspielen. Wer, wie er, alles kann, soll nicht nachgiebig gegen sich sein, erst recht, wenn Nachfrage und Bewunderung zunehmen.
Immer wieder zeigt sich effektvolle Unverbindlichkeit, etwa in einer Reihe von antikisierenden Erzählgedichten, die das Geistes-, Straßen- und Liebesleben im Rom des 1. und 2. Jahrhunderts betreffen, kulminierend in einer blutrünstigen Phantasie über die Hinschlachtung des Schlächters Heliogabal:
Und dieses Sterben, ich schwörs euch, war seine erste Arbeit
Und seine letzte. In ihm steckte ein zweiter Vulkan.
Nie zuvor hat er so schuften müssen und niemals
So erbärmlich geschwitzt.
Das ist, wenn man so will, groß gesehen, und in der Tat kann man sie beinah wie im Rausch lesen, diese Historien, lüsternen Plaudereien und Greisengespräche über Stoa und frühes Christentum aus einem Rom, das „blühte und stank“. Aber es ist Kino. Hier, bei solchen bildungserzeugten Visionen, als Sittenspiegel viel zu vage, überschreitet eine Vorstellungskraft, die auf die Wiederkehr des Immergleichen fixiert ist, schnell die Grenze zum kulturhistorischen Gemeinplatz. Ähnliches gilt für die lyrischen Grüße aus der Hauptstadt des Vergessens, gemeint ist Hollywood, oder für ein Gedicht wie Westindische Insel, das den Tagesablauf reicher Touristen glossiert, gestern noch Kolonisatoren, heute schmerbäuchige Aktionäre, die der „Sonnenbrand / Von leichter Arbeit befreit hat“, und allezeit „Ritter / Der magischen Habgier“ (nur im beiseite Gesprochenen blitzt und züngelt Poesie:
… am Horizont
Der eine Linie ist, zitternd von Kartographenhand
Gezogen am spanischen Hof,
die Palmen rotieren lautlos, riesige Ventilatoren…).
Hier hat einer bloß gesehen, was er sehen wollte, nämlich, daß die Kultur des Kapitalismus ihrer eigenen brave new world in die Arme treibt, die forciert geschichtslos ist, untragisch und immergrün. Hat brillant, pointenreich und ohne Anstrengung seinen Gebrochenheitsdünkel gegen das Amerika der Reichenreservate, Fitneßstudios und Traumfabriken ausgespielt, gegen Amerika, wo es am einfachsten ist. Das kitzelt angenehm so manches Vorurteil, ist risikolos und klingt bereits verfestigt – künftig wird es blicklos funktionieren.
Zwingend aber, so sei hier behauptet, ist Grünbeins Könnerschaft nur, wenn hinzukommt, weswegen wir jemanden – und ganz gewiß auch ihn – einen Dichter nennen: daß er zu sehen vermag wie noch keiner zuvor, daß in seiner Sprache das vermeintlich Vertrauteste neu entsteht und das Unbekannteste wie altvertraut erscheint. Daß er Neuland betritt, wo Millionen schon waren.
Andreas Nentwich, Die Zeit, Heft 15, 1999
Knochensatt knirscht die Erde
− Nach den Satiren: Durs Grünbein besingt unsere Rückkehr in die Geschichte. −
Sieht Durs Grünbein eine Maurerkelle Mörtel glätten, fällt ihm gleich der Pinsel ein, mit der ein Archäologe dereinst das Werk der Kelle vom Staub befreien wird. Das neue Berlin, das aus den Baugruben emporwächst und stolz die Planen herunterläßt, hat in dem Dichter einen Historiker gefunden, der bereits die Asche von morgen besingt. Die Gegenwart empfindet Grünbein als extrem porös, offen für das Morgen und Gestern: „War da ein Fußweg, sah ich Kreidestriche für die Körper, die bald dort liegen sollten.“ Kein Ast, zu dem Grünbein nicht die Schlinge einfällt, die von ihm baumeln könnte, kein Birkenwäldchen zwischen Berlin und Moskau, in dem er nicht die Schüsse der Wehrmachtsoldaten hört. Durch Venedig navigiert er sein Gedicht, bis von Vergangenheit und Zukunft „alle Gassen gurgeln“, bis das Wasser um den Ohrensessel schwappt, „uns Octopusse beim Fesselspiel helfen“ und am Ende alles unter Wasser steht. Was dann noch blinkt, „ist nicht Geld, es sind Schuppen, lose Steinchen aus Mosaiken, unmöglich zu fassen“.
Durs Grünbeins neuer Gedichtband gibt jener Geschichtsversessenheit poetischen Raum, die nach dem Ende des Sozialismus die Welt erfaßt hat. Damals „rutschten Staaten wie Sandburgen“, und mit ihnen versank das Gefühl, die Zeit gleite wie auf Schienen in stabiler Gemessenheit dahin, berechenbar dank der verläßlichen Angstbalance zwischen Ost und West. Rückblickend stellte die Gegenwart auch die Geschichte ruhig, ließ sie erstarren in abgesicherten Betrachtungsmethoden, die ähnlich übersichtlich geordnet waren, wie die Truppen von Warschauer Pakt und Nato.
1989 hat die Geschichte aufgehört, uns zu langweilen. Je ungewisser die Zukunft wird, um so beunruhigender wird auch die Vergangenheit. Deshalb beherrscht beim derzeit wohl für allgemeine Stimmungslagen empfindsamsten deutschen Lyriker die Geschichte fast jeden Vers: Das Wort wird zum „Altersfleck, lange im voraus“. Ob im Wortspiel („der Ewigmorgige, auf den ich gestern stieß“), ob im philosophischen Kontext (den Engel der Geschichte als „Alzheimer Engel“ pathologisierend), ob im Geräusch („knochensatt knirscht die Erde“) aus allen Gedichten Grünbeins sickert die Zeit, aufgehalten von Erinnerung, überholt von Vergessen, gespreizt durch den poetischen Überraschungseffekt. Dann hält der Leser den Atem an, die Sekunden dehnen sich wie in der Einzelbildschaltung des Videorecorders, und der Film bleibt schließlich wie gebannt stehen, als könnte ein Gedicht der fortschreitenden Uhr Lebenszeit abtrotzen: „Was ein Leben zusammenhält, ist das Loch im Kalender.“
Grünbein hat den Band kunstvoll komponiert, man sollte nicht der Versuchung nachgeben, mal hier, mal dort zu lesen. Es beginnt mit fünf Gedichten über Tierkadaver, einem Hund zwischen Eisenbahnschwellen, einer Hasenpfote im Gebüsch, schließlich einer zerfetzten Amsel auf dem Asphalt der einstigen Römerstraße, wie vom Reisewagen eines fliehenden Siedlers gestreift. „Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen“, heißt es, und schon gilt das nächste Gedicht der „Klage eines Legionärs auf dem Feldzug des Germanicus an die Elbe“, perfekt gesetzt in klassischem Versmaß. Die Zeiten, da man Grünbein vorwerfen konnte, seine Gedichte seien lediglich mittels Zeilenumbruch in Lyrik verwandelte Prosa, sind vorbei. Virtuos demonstriert er ein breites Repertoire historisch überlieferter Versformen; fast unvermeidlich ist es, das Durchschlüpfen des Formenkanons postmodern zu nennen, findet man doch von Juvenal bis Tucholsky vieles, was der Großstadt lyrisch gegenübergetreten ist.
Der Titel Nach den Satiren bezieht sich auf die Satiren des römischen Dichters Juvenal, des bissigen Großstadtschilderers. Grünbein weist in den Anmerkungen darauf hin, daß sich im Begriff der Satire Völle und Sattheit verbergen: „Nach den Satiren, das war, wenn alles gesagt und durchgekaut war, der Heimweg, der Katzenjammer, die Zeit der Gedankenspiele und der Verdauung.“ Nach den Satiren, das ist auch die Zeit nach dem saturierten Stillstand der Systeme, der Weg heraus aus „dem öden Schlamassel, der allem droht, was sich verkennt“, wie Grünbein das öffentliche Leben in der DDR beschreibt. Also auf nach Westen! Doch dort, wo „eine ganze Himmelsrichtung abbricht“, an der Westküste der USA, stößt Grünbein wiederum nur auf eine „Hauptstadt des Vergessens“, auf die Zelluloidmetropole Los Angeles. Er widmet sich ihr mit pimpfigem Trotz, als wäre er im Trabi über den Sunset Boulevard gestottert.
„Im dichterischen Wort in den verschiedenen Rhythmen, den verdichteten Bildern wird die Vorstellung des einzelnen synchronisiert mit der Weltwahrnehmung aller“, schrieb Grünbein in einem Essay zum „Babylonischen Hirn“. Dieses Verhältnis zwischen Zeitgeist und Individuum wird in der Begegnung mit Los Angeles für einen unangenehmen Moment aus der Balance gebracht. Der Kulturschock unter kalifornischer Sonne verführt ihn zur direkten Anrufung des Kollektivs, Heimweh-Postkarten an die Daheimgebliebenen schreibend: Mit der beleidigten Lakonie eines Erich Kästner, Einverständnis erheischend, nimmt er sich Modepuppen, Fitneß-Studios und Vegetarier vor, um den Prenzlauer Berg als Lebensform zu verteidigen.
Dann doch lieber zurück ins antike Rom, die heimliche Partnerstadt Berlins. Kaiser Julianus warnt vor dem erstarkenden Christentum mit dem Kosmonauten Gagarin im Seherblick:
Wenn erst ein Gott allein das Sagen hat genügt ein Schwächeanfall,
Bis jemand kommt, dem es im Weltraum kalt ist,
so kalt, daß er daraus den Schluß zieht, Gott ist tot.
Das ist großartig durch die Epochen gezappt, wie überhaupt Grünbeins Lyrik ohne Fernbedienung ebenso undenkbar wäre wie ohne Leihbibliothek. „Mäntel umschwärmen den Kartentisch“ eine solche Zeile zur Lagebesprechung mit Generälen ist kaum denkbar ohne die Jahrzehnte, die den Krieg zum Kriegsfilm gemacht haben.
So läßt Grünbein das Wort an langer Leine durch kollektive Erinnerungsräume stromern; je strenger die Form Gestalt behält, um so weiter läßt er die Aufmerksamkeit schweifen. Kehrt sie in Form eines Verses zurück, riecht die ganze Seite nach Zeitgeist und Erfahrung, nach allem, was Dichter und Publikum verbindet, Unfälle inbegriffen: „Stecken Zähne im Asphalt, sind sie von Fahrradboten“ besser kann man nicht ausdrücken, wie unsere Zeit sich anfühlt. Die Asphaltliteratur ist zurückgekehrt.
Harald Jähner, Berliner Zeitung, 23.3.1999
Zeitdiagnose am Widerpart Rom
– Zu Grünbeins Gedichtband Nach den Satiren. –
1
Grünbeins umfänglicher neuer Gedichtband Nach den Satiren läßt sich als „bunte Schüssel“ beschreiben, als satura lanx, wie die Römer sagten. Hiervon soll die Satire, die einzige genuin römische, nicht von den Griechen entlehnte Literaturgattung ihren Ausgang genommen haben: von einer Sammlung vermischter Gedichte in wechselnden Versmaßen. Die spezifisch ,satirische‘ Sichtweise, die übertreibende, durch Lächerlichmachen geübte Kritik an Personen und Zuständen, kam erst später hinzu: Der Ritter Lucilius, der Freund des illustren Scipio, wurde durch seine ,satirischen‘ Angriffe auf unliebsame Zeitgenossen der Begründer der Gattung, das Vorbild des Horaz, des Persius, des Juvenal.
Von dieser Tradition wünscht Grünbein offenbar ferngehalten zu werden, so ,römisch‘ er sich sonst in dieser Sammlung gibt – oder deutet das ,Nach‘ des Titels nicht auf zeitliche Distanz, sondern auf Maßgeblichkeit? Wie dem auch sei, der Befund einer „bunten Schüssel“ liegt vor: Grünbein kehrt – vielleicht ungewollt – zum Urstadium der Gattung zurück; der Band zeigt größte Mannigfaltigkeit nach Inhalten und Formen.
Der Autor hat immerhin Sorge getragen, daß der Leser nicht sogleich in der Fülle ertrinkt: Die drei Hauptteile – mit den Überschriften „Historien“, „Nach den Satiren“, „Physiognomischer Rest“ – verschaffen ihm eine erste Orientierung. Der Mittelabschnitt wiederholt den Titel des Ganzen: Dort, in den vier langen Gedichten, die er enthält, steckt das Gravitationszentrum der Sammlung, und dieses Zentrum wiederum ist bei Juvenal, Roms letztem Satiriker, verankert, wie ein Zitat aus dessen dritter Satire sofort zu erkennen gibt. In den flankierenden Abschnitten mit ihren Klein-Zyklen und Einzelstücken herrschen einerseits geschichtliche Szenen und Figuren vor, des öfteren in der Form von Rollengedichten, und andererseits erlebte und bereiste Topographie, heimatliche wie fremde. Merkwürdig, daß Grünbeins Triade hinlänglich genau mit dem Aufbau der Sammlung eines anderen Römers, der Catulls, übereinstimmt, wo ebenfalls die anspruchsvollen langen Stücke die Mitte einnehmen, während je ein Reigen kürzerer Gedichte vorausgeht und folgt. Bei Grünbein sollte man dergleichen nicht zu rasch für Zufall halten.
2
Der Widerpart Rom macht sich vor allem im ersten und im mittleren Abschnitt geltend; der Schlußteil mit seinen Städte- und Landschaftsimpressionen beschränkt sich im wesentlichen auf das 20. Jahrhundert.
Der „Historien“-Abschnitt beginnt mit fünf Nature-morte-Skizzen im Wortsinne: mit fünf Tierkadavern vor europäischen Landschaften. Das letzte Stück, einer toten Amsel gewidmet, enthält die kryptische Ortsangabe „Bei Aquincum“ – der Autor hat zur Antike, zu den Römern gefunden. Gemeint ist aber nicht Aquinum, das italienische Landstädtchen auf halbem Wege zwischen Rom und Neapel, der Geburtsort Juvenals, sondern eine entlegene Grenzgarnison an der Stelle des heutigen Budapest. Diese Wahl hat ihren guten Grund: Die tote Amsel liegt auf einer Römerstraße, als wäre sie vom Reisewagen eines fliehenden Siedlers gestreift – der Autor deutet an und spricht schließlich auch aus, daß er sich das Zeitalter der Völkerwanderung als Kulisse denkt.
Während die Introduktion mit Aquincum für die meisten Leser schwerlich anders als durch die Benutzung eines guten Lexikons vollauf verständlich wird, deutet sich das nächste Stück, die „Klage eines Legionärs aus dem Feldzug des Germanicus an die Elbe“, aus sich selbst und ohne daß die Kenntnis der taciteischen Annalen erforderlich wäre – an diesem Rollengedicht in Brechtscher Manier könnte nur ein Pedant rügen wollen, daß nicht Germanicus, sondern der Vater Drusus sowie dessen Bruder Tiberius, der nachmalige Kaiser, bis an die Elbe vordrangen; er selbst hat auf seinen Zügen zum Feld der Varus-Schlacht zwischen Weser und Elbe Halt gemacht.
Der folgende Zyklus – „Kleinigkeiten nach Christus und Juvenalis“ – verweilt noch beim niederen Volk, in der Sphäre des Alltags; er bringt realistische Genrebilder, die meist im frühkaiserzeitlichen, zum Teil im bereits christlichen Rom angesiedelt sind. Zwei Stücke, die den bestialischen Vergnügungen der Römer gelten, konfrontieren den Leser mit kulturhistorischen Spezialitäten: Ein Secutor, „Nachsetzer“, war ein Gladiator, der bei seinen Kämpfen über Helm, Schild und Schwert verfügte; die Autorin Elephantis wiederum, die in der Beschreibung eines Nashorns nicht ohne obszönen Nebensinn erwähnt wird, hatte den Markt mit illustrierter Pornographie versorgt. Nicht bloß gelehrt, sondern zugleich von lyrischer Zartheit sind die Zeilen des Stücks ,,Am Flußhafen von Aquile(i)a“, das den Tod eines jungen Mädchens zum Gegenstand hat:
Jetzt hat sie sich aufgemacht Richtung Westen, begleitet
Von Tritons Delphinen, den ersten in ihrem Leben.
Im ,Westen‘, irgendwo im Ozean, lagen nach verbreiteter Vorstellung die Inseln der Seligen, wohin Verstorbene – wie auf antiken Sarkophagen zu sehen – vom Meergott Triton und von Delphinen geleitet wurden.
Die übrigen Rom-Stücke des ersten Teils entheben sich dem Treiben gewöhnlicher Sterblicher und haben meist Kaiser zu Hauptfiguren. Nicht als ob es deswegen sogleich vornehmer zuginge. Im Gegenteil: „Der Misanthrop auf Capri“, der alte Tiberius, erhält ein Porträt, das seine Farben der gehässigen Biographie Suetons entlehnt hat. Und der lange „Bericht von der Ermordung des Heliogabal durch seine Leibgarde„ wartet mit den grellen Effekten auf, wie sie die Historia Augusta, die durch mancherlei Fiktionen angereicherte Kaisergalerie der Spätantike, schätzt.
Doch mit Julian werden die Themen anspruchsvoller, ohne an kraftvoller Bildhaftigkeit zu verlieren. Der Apostat prophezeit angesichts des sich ausbreitenden Christentums eine Entwicklung, an deren Ende die Parole „Gott ist tot“ stehen werde, und Grünbeins Augustin paraphrasiert, was der historische Augustin im 11. Buch seiner Confessiones gelehrt hatte: daß die Zeit nichts als ein Phänomen des menschlichen Bewußtseins sei, mit den drei Dimensionen der Erinnerung, der Anschauung und der Erwartung.
Der folgende „Von den Todesarten der Idioten“ betitelte Zyklus, in darstellerischer Hinsicht besonders virtuos, mutet lukianisch an: Ein kynischer Bettelphilosoph und Todesprophet wird aus dreifacher Sicht geschildert. Schließlich ein Gedichtpaar, das um den Mode-Autor Favorinus kreist: Dieser fiel bei Kaiser Hadrian in Ungnade und wurde von seinem Konkurrenten Polemon mit boshaften Attacken bedacht, was beides auf genau bestimmbaren antiken Quellen beruht.
Hiermit sind alle wichtigen Rom-Reminiszenzen des ersten Teils genannt – nur daß einem der Nachrufe auf Heiner Müller die Übersetzung der berühmten Hadrian-Verse Animula vagula blandula vorangeht:
Du schweifendes schmeichelndes Seelchen
Gast meines Körpers, Begleiter
In welche Fernen zieht es dich jetzt
So nackt und so blaß und schon steif
Und die fröhliche Zeit ist vorbei.
3
Die zuletzt zitierten Verse bedürfen keines Kommentars. Auch leuchtet sofort ein, daß sie sich gut in Grünbeins Lyrik fügen, zu deren Hauptthemen der Tod gehört, die sich geradezu als Praeparatio mortis, im stoischen oder existentialistischen Sinne, auffassen läßt. Desto irritierender könnte das sperrige Rom-Gepäck manches anderen Gedichtes auf den heutigen Leser wirken, der nicht in der Lage ist, mehr oder minder dunkle Andeutungen durch die Konsultation von Fachlexika oder von Quellen wie der Historia Augusta zu dechiffrieren – und wie die bisherige Kritik zeigt, haben gerade die historischen Stücke des nach ihnen benannten Abschnitts mitunter so gewirkt. „Bei solchen bildungserzeugten Visionen, als Sittenspiegel viel zu vage“, ließ eine Stimme sich vernehmen, „überschreitet eine Vorstellungskraft, die auf die Wiederkehr des Immergleichen fixiert ist, schnell die Grenze zum kulturhistorischen Gemeinplatz.“
Gewiß, die Hauptintention der „Historien“ kommt nicht immer gleichermaßen deutlich zum Vorschein: das späte Rom als Modell der Dekadenz, als Menetekel eines ausweglosen Endes. Doch schon das erste Rom-Stück, das erwähnte Gedicht von der toten Amsel, zeigt diese Intention mit hinlänglicher Schärfe, und an ihm läßt sich auch demonstrieren, auf welche Weise der Autor die von ihm angestrebte Transparenz des antiken Motivs zur Gegenwart hin bewerkstelligt hat:
Wie vom Reisewagen gestreift eines fliehenden Siedlers
Lag auf der Römerstraße die tote Amsel, zerfetzt.
Einer, der immer dabei war, den nie was anging, der Wind
Hatte aus Flügelfedern ein schwarzes Segel gesetzt.
Daran erkanntest du sie, von fern, die beiseitegefegte,
Beim Einfall der Horde an die Erde geschmiegte Schwester.
Ob Daker und Hunnen, Mongolenpferde und Motorräder –
Schimpfend hatte sie abgelenkt von der Nähe der Nester.
Mehr war nicht drin. Sieht aus, als sei sie gleich hin gewesen.
Der miserablen Sängerin blieb nur sich querzulegen.
Damals im Staub grober Quader, heute auf nassem Asphalt.
Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen.
Das Gleichnis, mit dem das Gedicht beginnt, zielt präzis auf einen bestimmten historischen Sachverhalt. Als im 5. Jahrhundert die Barbaren die westliche Hälfte des römischen Reiches überfluteten, trat in den Kernländern, in Italien und Gallien, in Spanien und Nordafrika, kein völliges Ende ein; die Ansässigen suchten sich mit den Eindringlingen irgendwie zu arrangieren. Anders erging es den exponierten Alpen- und Donauprovinzen; dort fand – wie etwa die Lebensbeschreibung des heiligen Severin bezeugt – ein totaler Untergang der Kulturwelt statt, und die römischen Siedler verließen fluchtartig die Region oder wurden planmäßig umgesiedelt.
Trotz des auf den Zusammenbruch des Limes verweisenden Gleichnisses, trotz der Römerstraße scheinen wir uns bei den drei ersten Strophen in unserer Gegenwart zu befinden. Zwar hebt der Wind – als Repräsentant der Natur – die Zeitlosigkeit des Immergleichen hervor; andererseits wendet sich der Autor an den Leser, als handele es sich um etwas unlängst Geschehenes: „Daran erkanntest du sie.“ Dann aber folgen, exakt in der Mitte des Gedichtes, zwei wichtige Signale: „Einfall der Horde“ und „Schwester“.
Die einfallende Horde korrespondiert offensichtlich mit dem fliehenden Siedler; die Zeitebene des Gleichnisses ist also zur Zeitebene des ganzen Gedichtes, des Nekrologs auf die Amsel, geworden. Die folgende Zeile scheint dies zunächst zu bestätigen: Daker, Hunnen und Mongolen pflegten in der Tat über die Pußta ins Römerreich einzubrechen. Doch schon zerstören die Motorräder, durch Alliteration an die Mongolenpferde angeschlossen, die Konzinnität, so daß sich der Begriff ,Horde‘ nunmehr als die Klammer erweist, welche die Nomaden von einst mit denen von heute verbindet.
Die Schlußzeilen ähneln einem Epimythion am Ende einer Tierfabel, oder richtiger, sie sind ein Tierfabel-Epimythion: Die ,Schwester‘ der Gedichtmitte hatte ja bereits darauf hingewiesen, daß die Amsel als Bild für den Menschen dient. Und noch einmal spielt der Autor mit der Identität und Nicht-Identität der Epochen. Im Äußerlichen, Unwesentlichen unterscheiden sie sich; staubige Quader kontrastieren mit nassem Asphalt. Im Kern aber sind die Zeiten einander gleich, und das ,Immer‘, das zunächst den Wind, die Natur charakterisiert hatte, ergreift nun auch die menschheitliche Dimension, die Geschichte.
Das Gedicht, dessen rein lyrische Elemente hier ausgespart blieben, bemüht die Altertums-Reminiszenzen nicht um ihrer selbst willen. Sein Gehalt erschöpft sich auch nicht darin, daß zwei Epochen parallelisiert werden. Die eine Zeitebene ist um der anderen willen da; Rom in der Völkerwanderungszeit ist Bild für eine bestimmte Deutung der Gegenwart. Dieses Verhältnis von Einst und Jetzt verleiht dem Gedicht den Charakter einer Allegorie. Rom dient so als Widerpart und Kraftreservoir für Zeitdiagnose.
4
Von Juvenal sind fünfzehn Satiren vollständig sowie der Anfang einer sechzehnten an die Nachwelt gelangt; die insgesamt etwa 3.800 Hexameter ergeben eine durchschnittliche Länge von 240 für das Stück. So betrachtet, entspricht das erste Gedicht der Abteilung „Nach den Satiren“ mit seinen 231 Zeilen recht genau den juvenalschen Maßen. Übrigens: der Autor bringt, wie zu anderen Gedichten, so auch zum Großformat des Stücks „Nach den Satiren I“ einige Anmerkungen, die er auf bestimmte, von ihm bezifferte Zeilen bezogen wissen will – die Benutzung würde erleichtert, wenn am Textrand bei jeder fünften Zeile die zugehörige Zahl erschiene.
Die moderne Juvenal-Reprise läßt, wenn auch nicht so augenfällig wie das Vorbild, eine Struktur erkennen. Die ersten sechzehn Zeilen geben die Exposition. „Kehrst du nach Hause früh“, „Brei dieser Städte“, „Ein neues Jahr hat begonnen“ bestimmen den Ort, die Zeit und die Situation: Der Autor wandert nächtlicherweile durch eine moderne Großstadt. Ein Zitat, ein Gleichnis kündigt das Thema an (Zeile 17–19):
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMach ein Register
All der Dinge, die dir jetzt wichtig sind. Wie sieht er aus,
Dein Schild des Achill, dieser Fahrplan aus Nichtigkeiten.
Der Zweck des Gleichnisses erklärt sich von selbst: Hier wie dort, in dem modernen Gedicht ebenso wie in der Schildbeschreibung des 18. Gesanges der Ilias, geht es um Tableaus von Städten. Gleichwohl könnte der Hinweis wegen seiner Bekanntheit und Abgenutztheit überraschen – bis man erkennt, daß der locus classicus lediglich als Kontrastfolie dient: „dieser Fahrplan aus Nichtigkeiten“.
Die Erwartung des auf einen negativen Katalog vorbereiteten Lesers wird durchaus bestätigt: In einem ersten Abschnitt (Zeile 20–53) kommt inmitten eines chaotischen Allerleis von Vorgängen und Gegenständen menschliche Bosheit als Regelfall, als Normalität der Großstadt zum Vorschein; „Verbrechen“, „Raub“, „Verletzter“, „erschlagen“, „vergewaltigt“ lauten die einschlägigen Stichworte. Die eng anschließende folgende Partie (Zeile 54–74) wiederholt das Zitat aus der dritten Satire Juvenals, das dem Ganzen als Motto vorangestellt ist (Vers 235/236):
In der Stadt zu schlafen, kostet viel Geld. Daher die Übel.
Der Autor wendet sich zurück zur „Zeit der Satiren“ und fühlt sich vom Hauch des antiken Rom getroffen – auch damals gab es das Böse, jedoch unreflektiert“ im Stadium der Unschuld.
Ein doppeltes „Grausam“ begleitet die Rückkehr des Autors in die Gegenwart, in eine abermalige Sequenz von Gewaltszenen (Zeile 74–114), und diese münden schließlich in düstere Visionen bis hin zu mancherlei Bildern des Todes (Zeile 115-144) – die Abgeschiedenen lassen „Gesänge“, „die schönsten Arien„ hören, „unter der Erde in ihrem ewigen Rom“.
„Dort also gingst du, morgens noch schlaflos“: Jetzt erhält das sprechende, sich mit „Du“ anredende Subjekt des Gedichts einen langen Part (Zeile 145–183): Wahrnehmungsfetzen und Reflexionsfragmente lösen einander ab – Thema ist die gesellschaftliche Randposition des Sprechers, seine auch in materieller Hinsicht prekäre Existenz (Zeile 164/165):
aaaaaaaaaaaaaaaaaaSein komfortables Gehirn
War das einzige, das ihm hier half…
Mit einer bravourösen Schilderung der eiskalten City-Konsumwelt vor ihrem morgendlichen Erwachen schließt das Gedicht (Zeile 183–231). Den vom langen Gestern erschöpften Stadtwanderer drängt es jetzt nach Hause – er ist nur noch ein stummer Zeuge isolierter äußerer Vorgänge, bis sich der Tag bemerkbar macht, „über die Dächer kriechend im ersten Licht“.
Das Poem läßt sich als Kontrafaktur zur dritten Satire Juvenals deuten, ja, es will offenbar so gedeutet sein. Zwar spricht dort in der Hauptsache nicht der Dichter selbst, sondern dessen Freund, ein unbegüterter kleiner Mann namens Umbricius. Doch die Inhalte ähneln sich: Hier wie dort geht es um die äußeren Gefahren, die in der Großstadt lauern, und um die Schwierigkeit, dortselbst ein redliches Auskommen zu finden. Ferner fordern der Duktus der Darstellung, das Andeuten mit wenigen Strichen, die Fülle der sich rasch ablösenden Details zu Vergleichen auf, zumal sich auch Juvenal die Effekte eines unruhigen Notturno nicht hat entgehen lassen (Vers 268 ff, in der Übersetzung von Joachim Adamietz“):
Richte den Blick jetzt auf weitere unterschiedliche Gefahren der Nacht: welche Höhe die aufragenden Häuser haben, von denen aus eine Scherbe das Hirn trifft, wie oft lecke und zerbrochene Gefäße aus den Fenstern fallen, mit welcher Wucht sie auf das Pflaster schlagen, es zeichnen und beschädigen…
Einer, der betrunken ist und aggressiv und zufällig niemanden verprügelt hat,
fühlt sich gestraft, durchleidet eine Nacht wie der den Freund betrauernde
Pelide…
Die Gemeinsamkeiten lassen den kardinalen Unterschied desto deutlicher hervortreten. Umbricius trägt seine Rom-Schelte nicht nur vor, um seinem Herzen Luft zu machen: Er hat die Konsequenzen gezogen und steht im Begriff, den Schrecknissen und der moralischen Verkommenheit der Hauptstadt auf immer den Rücken zu kehren; er wandert aus nach Cumae, in ein griechisches Städtchen am Golf von Neapel. Dem Autor der Gegenwart, dem „urbanen Widergänger“ (Zeile 60) Juvenals steht diese Zuflucht nicht mehr offen; die moderne Großstadt, die moderne Zivilisation sind unentrinnbar.
An geeigneter Stelle bestätigt Grünbein diese naheliegende Deutung mit einem verschmitzten Hinweis. Der Sprecher des Gedichts läßt sich zu seiner pekuniären Situation wie folgt vernehmen (Zeile 158–160):
Einer, dem nur der Pass in der Tasche gehörte und das Notizbuch,
Im Laufen gefüllt, sonst nichts; keine Eidechse, nach Juvenalis,
Ein Glück, das alles bedeutet, wie in der Enge der eigene Platz…
Mit der rätselhaften Eidechse beruft Grünbein sich auf eine Partie die dem Motto-Zitat vom teuren Schlaf in der Stadt unmittelbar vorausgeht (Vers 230/231 ):
Es bedeutet etwas, an welchem Platz und in welchem entlegenen Winkel auch immer
sich zum Besitzer einer einzigen Eidechse gemacht zu haben.
Dies erklärt bei Juvenal der aus Rom ausziehende Umbricius; der Sprecher des modernen Gedichts hingegen kann nicht einmal eine bescheidene Eidechsen-Idylle sein Eigen nennen.
Rom – so könnte man wohl die Art der Juvenal-Reprise im ersten Stück „Nach den Satiren“ resümieren – dient teils als Analogon, teils als Kontrast zur heutigen Stadtkultur: als Analogon für die Gefahren der Zivilisation und die Verkommenheit der Menschen, und als Kontrast, weil Verstädterung einst die Ausnahme war und jetzt die Regel ist. Allerdings lassen sich keineswegs alle Rom-Bezüge des Gedichts auf diese Ambivalenz zurückführen: Bei der Unschuld von einst, „als der Jude verreckte am Kreuz“ (Zeile 74), bei den Arien aus dem unterirdischen ewigen Rom (Zeile 142–144) sowie bei dem „Brennenden Rom“ im Kino (Zeile 203) schwingen wohl noch andere, hier nicht zu erörternde zeitkritische Vorstellungen mit.
5
„Wir leben in der Spätantike“, sagte Alfred Andersch vor nunmehr zwanzig Jahren, um seinem Zeiterleben durch eine der Geschichte entnommene Metapher Ausdruck zu verleihen. Die Kategorie, die er hierbei verwendete, ist ziemlich jungen Datums: Sie wurde – nach einem Vortrab bei Jacob Burckhardt – erst um das Jahr 1900 von dem Wiener Kunsthistoriker Alois Riegl als Bezeichnung einer besonderen Epoche, des halben Jahrtausends von etwa 250 bis 750, aufgebracht und durchgesetzt. Klassizismus und Romantik hatten dieses Zeitalter des Wandels gewissermaßen eliminiert. Die klassizistisch gesinnte Altphilologie pflegte die Epoche des ,Verfalls‘ jenseits der klassischen Autoren zu ignorieren, und die Neueren Philologien, allen voran die Germanistik, beschränkten sich auf die national-sprachlichen Wurzeln ihrer Literaturen und mieden die lateinischen Bindeglieder. Erst Ernst Robert Curtius füllte die Lücke: durch sein mit Recht berühmtes Buch Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.
Die Spätantike, die Zeit der Kirchenväter, der Völkerwanderung und des untergehenden Westreiches, hat nicht zum Kanon des Bildungsbürgertums gehört. Schon deshalb urteilt man nicht richtig, wenn man Grünbeins einschlägige Gedichte zu Produkten bildungsstolzen Virtuosentums erklärt: Mit Anleihen bei der Historia Augusta und selbst bei Julian und Augustin begibt sich der Autor eher in den Bereich der hermetischen Poesie. Die Bevorzugung einer bestimmten Leserschicht durch die Evokation von ,Bildungsgut‘ mag jetzt anfechtbar sein; die Suche nach unverbrauchten Stoffen verdient wohl auch dann Respekt, wenn sie den Autor einsamer und sein Werk schwieriger macht.
Außerdem halten sich in Grünbeins ,postsatirischem‘ Gedichtband die frühere Kaiserzeit, die Zeit des Prinzipats, und die Spätantike in der genauen Bedeutung des Wortes ungefähr die Waage; auch Juvenal (etwa 60 bis 135 n. Chr.), der wichtigste Anreger, ist ja als etwas jüngerer Zeitgenosse des Tacitus durchaus noch ein klassischer, kein spätantiker Autor. Die Unterscheidung hat indes in diesem Falle wenig Belang: Es kam Grünbein offensichtlich auf das Gemeinsame der beiden Epochen an, nicht auf das Trennende: auf die überreife Zivilisation, die an schweren inneren Schäden leidet und schließlich auch von außen zu Fall gebracht wird.
Schließlich ist Rom nicht das einzige Objekt, durch das Grünbein seiner Zeitdiagnose und Zeitkritik Relief zu verleihen sucht; seine Technik des Übereinanderschiebens, des Verfugens und Verschmelzens von Vergangenheit und Gegenwart bemächtigt sich auch anderer Bereiche. Als eindrucksvolles Beispiel sei das dritte Stück „Nach den Satiren“, das große Berlin-Gedicht, genannt. Hier brauchten die Epochen nicht durch den räsonierenden Intellekt zusammengebracht zu werden: Sie waren bereits vereinigt, als Schichten im Boden, und ein Bagger genügte, die Verschränkung vor Einst und Jetzt – in diesem Falle: von Zweitem Weltkrieg und verdrängender Gegenwart – ans Licht zu bringen.
Ähnliches findet sich vor allem im dritten Teil, im „Physiognomischen Rest“, und zwar in den drei aufeinanderfolgenden Zyklen „Europa nach dem letzten Regen“ (über Dresden), „Transpolonaise“ und „Berliner Runde“. Die Gedichtfolge „Transpolonaise“ präsentiert als Motto die Worte: „Maikäfer, flieg.“ Daß hiermit nicht alles gesagt ist, daß man den Kinderreim zu Ende denken soll, wird sofort durch das erste Stück bestätigt. „Mondfern am Horizont kriecht ein Reisezug Richtung Osten“, beginnt die erste, ganz in der beschriebenen Gegenwart aufgehende Strophe. Desto grausiger nimmt sich die verdinglichte Assoziation aus, die den Reisenden in den Abgrund der Vergangenheit wirft:
Am Waldrand in Reih und Glied warten Birken auf ihre Erschießung.
Bahngleise, galgengeschmückt, lassen den Tod der Dampflok vergessen.
Ganze Dörfer haben jetzt neue Bewohner, und manche staubige Stadt
Führt nur im Friedhofsregister noch die Familien der Alteingeseßnen.
Nicht alles, was in dem großen Lyrikband Aufnahme gefunden hat, trägt so schwer an der Last der Geschichte. Zyklen wie „Grüße aus der Hauptstadt des Vergessens“ (aus Los Angeles) oder „Veneziana“ spiegeln offenbar Reiseeindrücke; sie verbinden die übliche Sprachbravour mit Oberflächlichkeit in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Man schelte den Autor nicht, daß er mitunter auf den Widerpart der Vergangenheit, auf Mehrschichtigkeit und Doppelbödigkeit verzichtet hat: Variatio delectat – dies bei Gedichtsammlungen seit jeher praktizierte Prinzip gilt auch für Grünbeins nachsatirische „bunte Schüssel“.
Manfred Fuhrmann, Sprache im technischen Zeitalter, Heft 151, Oktober 1999
Schock und klassisches Maß
– Durs Grünbein flaniert durch die antike Moderne. –
Auf seinem Kriegsschauplatz Hirn, erhellt von den Suchscheinwerfern der Meister, kämpfen eben erst sichtbar gewordene Phänomene mit den Wellen der Evolution, das ganz und gar Künstliche mit historischen Exponenten, Banales und Liebgewordenes mit Resten Archaik.
Lang ist’s her, daß ein Dresdner Dichter solcherart unterwegs war in Berlins Mitte, „unterwegs auf einer in vielerlei Sprachen verstummenden Erde“. Das Dichtergemüt sollte (wie in Benns epochemachender Marburger Vorlesung vierzig Jahre zuvor) ganz Membran werden, ganz Seismograph im Scherbenhaufen unserer okzidentalen Metropolen. Dichten hieß, die polymorphen Reize des zu Ende gehenden Abendlandes in zerklüfteten, vielstimmigen Tableaus aufeinanderprallen zu lassen: das „Unversöhnte, in schockhafter Montage gefügt“. Lang ist das her – nicht den Jahren, sondern den inneren Epochen des Dichters nach. Vielleicht wird diese multilinguale Härte, die Durs Grünbein berühmt machte, einmal sein „Frühwerk“ genannt werden.
Schon bald in den neunziger Jahren jedenfalls machte sich etwas bemerkbar in seinem Dichten, das der gewaltsamen Verschränkung entlegenster Wirklichkeiten und Geschichten, jener kunstvollen Willkür im Umgang mit dem Material, entgegenlief. Alexandriner, Hexameter und immer wieder Jamben, mal trimetrisch, mal pentametrisch, eroberten das Feld der Form, eine klassizistische Dämpfung glättete den Ton, milderte die Schocks. Das mochte man anfangs für eine weitere Spielform eines Lyrikers halten, für den der Dichter heute „nichts mehr besitzt, was wert wäre aufgehoben zu werden“, und der daher „aufs neue unmittelbar, wie Leonardo sagt, Schüler der Erfahrung“ sein darf und muß: „Ein Vers des Kallimachos aus Kyrene bringt ihm genauso viel Gegenwart wie der Zuruf des Postboten vor der Tür.“ Die Bilderflut ist geblieben, die Themen haben sich kaum gewandelt, doch in der Frage von Form und Metrik hat Grünbein seine eigenen Programme Lügen gestraft: Das klassische Maß ist für ihn ein apriorisches Formelement geworden. Die antikisierende Hülle der 33 Epitaphe (1994) war gefüllt mit Stoff aus den Nachrichtenmagazinen unseres klatschsüchtigen Zeitalters. Haarscharf an der Grenze zur postmodernen Setzkastenbastelei entlanggedichtet, wollte der Zyklus doch mehr sein als eine Übungsreihe im stile antico. Eher waren es Anstrengungen im Geiste Mandelstams, dem man „Phantastik der Bilder, immer freiere, kühnere und unerwartete Metaphernflüge in klassisch strengen, genauen, epigrammatischen Formeln“ bescheinigte.
Grünbein hat schon damals, wenn auch nur an eher versteckten Stellen seiner Essays, die Notwendigkeit des festen Metrums gelehrt. Des Dichters Stimme, die „das Wort aus dem lexikalischen Tiefschlaf“ befreie, tue dies „paradoxerweise, indem sie es mit dem Bann der Kadenz belegt“. So las man es seinerzeit und durfte rätseln, was gemeint war: Sollte der Versfuß das Mittel sein, um Distanz zum Stoff zu gewinnen, um also – frei nach Benn – „kalt“ zu bleiben angesichts des hereinstürzenden Materials? „Um dem bloßen Ablauf etwa zu entgegnen, um innezuhalten in den Wüsten der Information […], hilft der Erinnerung nichts als die Orientierung anhand der versprengten Zeile, mit den Mitteln metrischer Peilung.“
Das ist ein deutliches Stichwort: „Orientierung“. Orientierung hat Grünbein gefunden, in Juvenal zuallererst, dem bissigen Schilderer der Laster und Sitten unter Domitian. Das Rom des Juveal mit seinem Vielerlei an Religionen und Lebenslehren, mit seiner Korruption und seinen Intrigen, das erinnert ihn stark an unser Berlin oder New York, Nach den Satiren, vier lange und langzeilige Stücke, gearbeitet im Geiste juvenalisch freier Hexameter, liehen der neuesten Gedichtsammlung den Titel. Nach den Satiren – auch die Gemütslage nach den von Rezitationen begleiteten altrömischen Gelagen ist hier gemeint, wie eine Fußnote uns wissen läßt:
Nach den Satiren, das war, wenn alles gesagt und durchgekaut war, der Heimweg, der Katzenjammer, die Zeit der Gedankenspiele und der Verdauung. Während der Magen arbeitete, kehrten die mit vollem Munde verspotteten Dämonen langsam zurück.
(Mitgedacht ist überdies, wie wir dem ersten der Langgedichte entnehmen dürfen, eine projektierte Epoche nach der „Zeit der Satiren… / Als die Vorstadt zur Hölle wurde / Nicht nur für Christen […] Und das Jahrhundert starrte in ein Muränenmaul.“)
Die vier Zentralstücke setzen noch einmal eine Lieblingsvorstellung Grünbeins um, nach der der Dichter „durch die Szenen der Städte wie durch Gemäldegalerien“ gehe. Noch immer kann das hinreißend sein, auch im antikisierenden Gewand. Ein einziger weiter Atemzug kann ein polyphon verdichtetes Kaleidoskop urbaner Sinnzersplitterung aufs Papier zaubern:
Kommen die Zugvögel früher zurück, liegt in der Luft
Ein Ermuntern zu höherem Einsatz, brutaler Eroberung –
Schnelle Liebe auf den Autositzen, Yoga im nächsten Park,
Ein fernöstliches Lächeln, das über den Dächern schwebt,
In Tröpfchen sich niederläßt auf den Blaubeeren, Trauben
In Stiegen am Wegrand, auffährt mit vertraulichem Wind.
Zeit, aus den Löchern zu kriechen…
Das uralte ,Buch der Natur‘, Eichs Vorliebe für Zugvögel („Ich denke auch der Vogelzüge, / der flüchtigsten, der reinsten Spur“), die verblose Asyndetik und die hermetische Metaphorik der klassischen Moderne gehen mit dem schnoddrigen Vulgarismus eine aufregende Ehe auf Zeit ein. Nichts ist Fremdkörper, die Anverwandlung des Höchsten und der Niedrigsten ist vollkommen. Grünbeins Könnerschaft, sein Beherrschen des Materials ist in solchen Passagen schlichtweg betörend. Von „schockhafter Montage“ allerdings ist nur wenig übriggeblieben – dem krummen und holpernden Hexameter Juvenals sei Dank. („Oder Gedichte mit wechselndem Versfuß, zum Beispiel Horaz“.)
„… wie durch Gemäldegalerien“ – da ist der Weg zum Musealen, Kostümbildnerischen, zum Ausstattungsstreifen nicht weit. Und wenn Grünbein einen Leibgardisten Heliogabals vom Mord an seinem Herrn („Der so grausam war, lustvoll / wie sonst nur die Frauen“) erzählen läßt, dann ist er im Bühnenbild untergetaucht. Daß er der antiken Gattung Satire Genüge leisten will und seinem Hang zur umgangssprachlichen Sentenz frönt („Nur dem Caesar war alles egal“; „Ein Tourist auf dem Thron“; „Was vom Vögeln noch übrig blieb, der Rest von Gehirn“), tut ein Übriges, um die Kluft zu den Momenten glücklicher Synthese des Alten und Neuen zu vergrößern. Solcherart Rollengedichtetes findet sich reichlich im neuen Band. Als Fingerübung auf neuem Terrain darf es dort seinen Platz beanspruchen, doch nichts könnte seine zerstreute Müdigkeit besser demonstrieren als die Exempel der großen Begabung Grünbeins zur verdichtenden Zusammenschau, die ihm zur Seite stehen.
Wie einfach, plastisch und frisch können andererseits die verschiedensten Gemeinplätze unter den Händen Grünbeins werden. Der Topos von der Stadt als Text zum Beispiel:
du bist dieser vorwärtsrückende Strich
In beengten Straßen, das Komma, fehlplaziert
Wie schwer kam einst seine Metaphysik des Gedichtes daher, nach der sich Lyrik eine „Gegenwart jenseits des Todes und diesseits der historisch verhafteten Zeit“ erobere. Wie leicht, wie aus dem Handgelenk geschüttelt, kann Grünbein nun vom „Vers, der ins Freie zeigt“ sprechen:
Plötzlich unbrauchbar, und das Gerangel der Körper
Ging ohne dich weiter, und nichts war so schmerzhaft
wie Ignoranz, – beim Anblick der ziehenden Wolken
Die Gewißheit posthumen Glücks.
Oder so:
Und jedes Jahr
Brachte neue Verheißung, am Wegrand Zweige,
die nach dir schlugen, und hinterm Rücken ging
Das verlassene Leben fort.
Maßvoll ist Grünbein geworden, nicht nur in der Metrik. Der Motor des Lebens ist auch jetzt noch, wie in der Büchnerpreisrede, der pure, physisch regulierte „Affekt“. Doch beim Griff in die Wortarsenale der Anatomie ist Grünbein vorsichtig geworden. Wie gut er daran tut, sparsamer zu sein – man könnte auch sagen: ökonomischer – beim Anreichern seiner Gedichte mit allerlei humanistischem Bildungsgut, läßt sich an „Aporie Augustinus (Über die Zeit)“ studieren: Gemeint ist die jedem philosophischen Proseminaristen bekannte Stelle aus den „Confessiones“, das ist als Thema gefährlich. (Daß es dann noch kierkegaardisch heißt: „Zeit, eine Krankheit zum Tode“, macht es noch gefährlicher.) Grünbeins Sinn für die rhythmische und syntaktische Variation, die in der Langzeile möglich wird, macht die Fallgruben auf den ausgetretenen Pfaden der Schulbildung schnell vergessen, und sein motivischer Erfindungsreichtum ist bezaubernd. Nur, muß der Partner in diesem kleinen sokratischen Dialog in Versen unbedingt „Alypius“ heißen, muß es ein „Amphitheater“ sein, in dem wir uns bewegen, muß „Über uns der Sirius, im Rücken Ödipus“ stehen? Es ist ein eigenartiger Widerspruch zwischen dem virtuosen, das Erhabene nicht scheuenden Ernst im Umgang mit Metrik und Bild einerseits, der arglosen, mitunter läppischen Lust am Kostümieren andererseits.
Noch etwas ist neu am neuen Grünbein. Man ahnte es, als er vor einigen Jahren ins Schwärmen geriet angesichts der Kunst des Eugen Gottlieb Winkler, statt dekadenter Verfremdung „sinnlich bewußte Beschreibungskunst“ zu üben. Die Schulung durchs Malerauge, die Abkehr von der Erzählung zugunsten der Bildbeschreibung, die Grünbein bei Winkler und Hartlaub fand, die pflegt er nun (zeitweise) selbst. („Wie sieht er aus, / Dein Schild des Achill“? fragt nicht eben bescheiden ein Vers in diesem Sinne.) Gleich zu Anfang stehen Proben in der hohen Kunst der Nature morte, ein „Denkmal für einen Fuß“ spielt mit einer akademischen Zeichendisziplin, „Grauer Sebastian“ ist eine Etüde in der Kunst der Bildbeschreibung.
Ein bedeutendes Talent, das sich von Zeit zu Zeit verschwendet und hinter den eigenen Möglichkeiten zurückbleibt; eine große Begabung, die ab und an Opfer der Leichtigkeit wird, mit der sie über Formen und Motive verfügt – vielleicht ist das, auch diesmal, der Eindruck, den Grünbein hinterläßt. Daß Metaphern verunglücken („die geschäftige Zunge / Zwischen Schamhaar und Ewigkeit“; „in Bastionen des Luxus, todchic wie die Bunker der Normandie“) ist kein Einwand, bei Celan und Benn ist schließlich auch nicht alles gutgegangen.
Und vielleicht steckt in Grünbeins Laissez-faire im Umgang mit seinem Können auch ein eigenartiges Kalkül: Statt unentwegt die höchste Verdichtung zu suchen, ist der neue Band eine Art Tagebuch. Es läßt die Flüge des Geistes gelten, mögen sie an dem einen Tag hoch hinauf wollen, am andern belanglos werden. Das wäre die letzte Konsequenz einer Haltung, die das eigene Dichten durch keine vorab gesteckten Ziele einengen will. Welcher Ton es auch sei, der sich einstellt, er ist gut.
Sebastian Kiefer, neue deutsche literatur, Heft 526, Juli/August 1999
Das Hirn ist ein metamorphosiertes Rückenmark
– Durs Grünbein und das Ende der Geschichte. –
Um von vorn zu beginnen, – der Anfang
Liegt in den Tagen danach.
Georg Büchner: „Über Schädelnerven“
Danach ist in Grünbeins Fall die Zeit nach der Mauer, nach der DDR, nach dem Sozialismus als Staatsform; danach… Durs Grünbein wurde oft aufgrund seiner Herkunft und der dort herrschenden Umständen festgelegt: In der ehemaligen DDR aufgewachsen, ist er, wie Brecht es nennen würde, ein Nachgeborener. Im literarischen Kanon wird er als einer gehandelt, der die Wiedervereinigung und die Zeit danach, zum Thema seiner Gedichte gemacht hat. Was lange in der Lyrik vermißt wurde, der Rückbezug zum aktuellen Tagesgeschehen, fanden die beurteilenden Instanzen bei Grünbein. Kritische Alltagsrealitäten in Versen.
Ihm wird neben dem politischen, ein zerebraler, ein naturgeschichtlicher, ein körperlicher Blickwinkel bescheinigt. Zumindest versuchen Rezensenten und Kritiker ihm und seinen Gedichten mit diesen Zuschreibungen gerecht zu werden. Ungewöhnliche Metaphern sind sein Metier. Versierten Lesern entgeht dabei nicht, daß Grünbein sowohl Metrik als auch Rhythmik beherrscht. Alles in allem wird er seit seinem ersten Gedichtband Grauzone morgens (1988) als neues Genie einer neuen Lyrikergeneration gehandelt. Seit Oktober 1995 ist er jüngstes Mitglied der Mainzer Akademie der Wissenschaften und erhielt – das eine geht mit dem anderen einher – den Georg-Büchner-Preis. Seine Rede anläßlich des Preises war eine Laudatio auf Georg Büchner und im besonderen dessen erste Probevorlesung in Zürich „Über Schädelnerven“. Mit Absicht und Hinblick auf die Verwandtschaft der Themen und die Verwendung eines anatomischen Vokabulars, hat sich Grünbein diesen Text Büchners ausgesucht. Wer die Vorlesung kennt, weiß um den Abgrund, in dem die Körper verschwinden, weiß um das, was Büchner selbst den philosophischen Standpunkt nennt.
… und so wird für die philosophische Methode das ganze körperliche Dasein des Individuums nicht zu seiner eigenen Erhaltung aufgebracht, sondern es wird die Manifestation eines Urgesetzes, eines Gesetzes der Schönheit, das nach den einfachsten Rissen und Linien die höchsten und reinsten Formen hervorbringt.
Büchner denkt den Körper vom Nerv her, Physiomotorik schlägt sich sprachlich nieder. Ein Theater der Anatomie.
Liest man Gedichte Grünbeins, erscheint einer wie Büchner, wie ein naher Bruder im Geiste. An Zeitschwellen stehend, war für den einen wie für den anderen das gleiche von besonderer Wichtigkeit: Das Individuum hört auf, als Ganzes wahrnehmbar zu sein. Bei Büchner sind es die Naturwissenschaften, die gesellschaftlichen Umstände und nicht zuletzt die Politik, die aus einem teleologischen und theologischen ganzheitlichen Menschen eine in Einzelteile zerlegte Person machen.
Man arbeitet heut zu Tag Alles in Menschenfleisch. Das ist der Fluch unserer Zeit. Mein Leib wird jetzt auch verbraucht.
Büchner legt diese Worte Danton in den Mund – sie könnten, leicht modifiziert, auch in einem Gedicht Grünbeins stehen.
Sein Thema ist der Mensch „danach“. Er beschreibt im wahrsten Sinne des Wortes einen postmodernen Zustand des Seins. Die Menschen, die Dinge, die Welt an sich sind darin der Idee von sich selbst verlustig gegangen. Das eben Wahrgenommene ist fraktal. Schon längst in seinem Selbst zersplittert, ist der Mensch nur teilweise erfaßbar. Sich und seine Umwelt kennt er nur als Reflex. Ein Gedicht aus dem Band Falten und Fallen (1994), betitelt mit „Trigeminus“ (ein dreiästiger Gesichtsnerv), ist beispielsweise eine Erinnerungssequenz an die Kindheit und Jugend in der DDR. Es gehört in den Zyklus „Variation auf kein Thema“. Kein Thema, das ist der Alltag, sind die alltäglichen Verrichtungen und das Ich, das seine Umgebung nicht mehr als Heimat oder Heim, sondern nur als Fremde wahrnehmen kann.
Und morgens schießt aus der Dusche…
Wasser, was sonst? Rot und Blau
Steht auf den Hähnen für Heiß und Kalt
Ein radikaler Exotismus hat das Subjekt befallen. Ewig unverständlich sind Kulturen, Sitten, Gesichter, Sprachen. Einsamkeit und Vereinzelung gehören dazu.
Unwirklich das Zimmer, allein bewohnt
…
Lächelnd und kaum entsetzt
Suchst du in alphabetischen Gebeten Halt.
Auch die Liebe wird vom Persönlichen abgekoppelt. Sie ist „… ein raffinierter Schmerz, / Den nur Gymnastik stillt… /“ Und selbst die zur Liebe gehörende Intimität ist schon längst über das Stadium Sex hinaus und damit bar jeder Lust. Der Vergleich mit gymnastischen Übungen erläutert das Niveau und den Grad der Entfremdung. Liebe ist eine Art Freizeitgestaltung und rangiert unter Hobbys.
Am deutlichsten wird die Grundaussage von Grünbeins Lyrik in einem Gedicht mit dem Titel „Aus den Romantischen Kriegen“ wiedergegeben. Ich möchte es hier stellvertretend zitieren:
Vielleicht war ja ein Äderchen geplatzt
In meinen Augen, als an diesem Morgen grau
Die Luft sich trübte. Plötzlich war der Herzschlag
Nurmehr ein Echo alles Draußen, das mich trug.
Ein Nichts an Körper und ganz allgemeiner Atem,
Gehörte ich den andern eher als mir selbst,
Erwacht zu Alltagsseligkeit. In solcher Frühe
Ein unbekanntes Tier, vergaß ich meinen Weg.
Ein Mensch und zuallererst sein Körper verliert sich schrittweise im Draußen. Spekulativ und jenseits des Psychischen ist der Auslöser. Die graue Luft wird als Auswirkung eines Körperdefekts interpretiert. Das lyrische Ich nimmt sich nicht mehr als Ganzes wahr. Es ist reduziert auf seine anatomischen Bestandteile und ihre (Fehl-)Funktionen: Äderchen, Augen, Herzschlag, Atem. Diese redundante Reflexion des Selbst führt zu Persönlichkeitsverlust. Es veräußert sich. Es gibt kein Innen und kein Außen mehr. Der Herzschlag – höchstes Symbol für das Leben – verhallt und ist nur noch eine Schallwelle, ein Reflex des Draußen. Anstatt eines inneren Halts gibt es nur Veräußerung, die im Gegenzug zum lyrischen Ich in den anderen manifest wird. Die Folgen der Veräußerung des Geistes im Speziellen und des bereits fragmentierten Menschen im Allgemeinen führen zu einem evolutionären Rückschritt. Er wird zum Tier, das zudem seine Instinkte verloren hat. Warum sonst würde es seinen Weg vergessen? Ganz ent- und veräußert verliert sich dieses lyrische Ich in der Orientierungslosikgeit, die hier den Namen „Alltagsseligkeit“ trägt. „Aus den Romantischen Kriegen“ ist das letzte Gedicht in einem Zyklus, der mit „Mensch ohne Großhirn“ überschrieben ist. Ohne Großhirn ist der Mensch kein Mensch mehr, sondern auf das rein Vegetative beschränkt.
Grünbein stellt den Menschen in eine entmythologisierte Alltäglichkeit. Er steht am Ende der Geschichte, befangen in der Wiederholung des gleichen und ins Lyrische zersplittert. Er ist sich selbst Objekt ohne Selbst geworden. Das Danach, das in Grünbeins Gedichten beschrieben wird, ist ein Zustand der Künstlichkeit, in dem Emotion und Kommunikation nicht mehr bis zum anderen durchdringen, sondern das lyrische Ich selbstreferentiell umkreisen. Der Körper, einst Metapher für die Seele und später für den Sex, steht für gar nichts mehr. Der Mensch ist aus allem befreit und damit eine leere Hülle, eine Projektionsfläche. Ohne moralischen Anspruch schreibt Grünbein Zustandsbeschreibungen der Gesellschaft, wie er sie sieht. Sie sind Reflex einer Umwelt, die tatsächlich den Status der Moderne längst eingebüßt hat. Sie gehen über diese hinaus, sind in Sprache und Form jenseits dieser Ästhetik und vermelden nichts mehr und nichts weniger als den desolaten Zustand, in dem sich der einzelne und die Gesellschaft momentan befinden.
Grünbein erinnert mich ein wenig an den Narren King Lears, der mehr als die Wahrheit sah und sagte, dem der König jedoch keinen Glauben schenken wollte.
Anke Scholl, luise-berlin.de, 1999
Habemus poetam
− Zum Konnex von Poesie und Wissen in Durs Grünbeins Gedichtsammlung Nach den Satiren. −
Durs Grünbeins Lyrik setzt Leser voraus, die bereit sind, sich auf distanzierte, (selbst-)reflexive Weise in Gedichte zu vertiefen. Und weil es dem Autor nicht um Versifikationen von Statements und Eindrücken und auch nicht um Parlando und Betroffenheit geht, aktivieren seine Texte ein breit gefächertes Bezugsfeld aus Namen, Anspielungen und Wissenskomplexen. Dem poeta doctus der neunziger Jahre kommt ein Lesermilieu zu, das schwierige Sprach- und Textchiffrierungen als Prämisse aktueller Lyrik begreift und daher von vornherein Postulaten misstraut, die auf ein müheloses Verstehen und ein geheimes Einverständnis zwischen Dichter und Publikum rekurrieren. Dass ein Gedicht ein komplexes Sprachgebilde ist, darüber wurde unter Lyrikern der neunziger Jahre nicht mehr gestritten, so unterschiedlich ihre Positionen auch sonst sein mögen. Thomas Kling hat in seinem Itinerar den Konsens auf den Punkt gebracht: „Was darf das Gedicht dieser Jahre keinesfalls sein? Ich meine laut: Rezeptions- und Unterhaltungsindustrie.“ Im Umkehrschluss lässt sich der kleinste gemeinsame Nenner der Gedichtpoetik der neunziger Jahre formulieren: „Gedichte sind hochkomplexe (,vielzüngige‘, polylinguale) Sprachsysteme. Kommunikabel und inkommunikabel zugleich.“
Zur Vorgeschichte: Poesie und Wissen in Grünbeins Schädelbasislektion
Poetische „Sprachsysteme“ sind in einer sich als ,Wissensgesellschaft‘ gerierenden Gegenwart von der Sprache der Wissenschaften, der Technologie und Medienkommunikation durchsetzt. Grünbein hat als einer der Ersten und Entschiedensten unter deutschen Autoren die Revolutionierung neuester naturwissenschaftlicher Forschung zum literarischen Thema gemacht, und zwar lange bevor Menschenparks und Klon-Szenarien zum Feuilletonstoff wurden. Der erste Satz seiner Darmstädter Rede bei der Verleihung des Büchner-Preises im Jahre 1995 hält in der Form der Frage ein ganzes Programm bereit: „Was haben die Schädelnerven der Wirbeltiere mit Dichtung zu tun? (…) Welcher Weg führt von der Kiemenhöhle der Fische zur menschlichen Komödie, von rhythmisierter Prosa zur Ausstülpung des Gehirns in den Gesichtsnerv?“ Die Fragen zielen auf langwierige Arbeitsprozesse, nicht auf bündige Antworten. Seit der Schädelbasislektion, Grünbeins zweitem Gedichtbuch, gehören Rekurse auf komplexe Theoreme moderner Naturwissenschaft, Wissenschaftsgeschichte und Philosophie zur poetischen Praxis des Autors. Einen Dichter, der sich mir Nervenmembranen, Schädelröntgen, Hirnphysiologie und dem Funktionieren zerebraler Prozesse befasst und anatomische Zeichnungen als Material der Anschauung und Bewunderung gleich mitliefert, hatte es lange nicht gegeben; er erinnerte manchen Kritiker an Benn – und an die Aktualität der Hirnforschung, die nun auch eine kräftige Spur in der Gegenwartslyrik hinterlassen hat: „Ein Licht“ ging auf, „was es hieß // Daß da in jedem Großhirn 15 Milliarden / Grauer Zellen gemeinsam / Untergebracht sind“.
Wer die Verse genauer las, konnte in ihnen freilich auch einen neuen Schreib-Ansatz entdecken. Grünbeins Schädelbasislektion war eine verblüffende Lektion in Poetologie, keine illustrierte Neurobiologie. Wissenschaftssprache wurde in dem Maße zum Teil einer präzisen, semantisch ausgearbeiteten Gedichtsprache, wie sie Chiffren zur poetischen Konstruktion und Simulation von Wirklichkeitsmodellen bereithielt. „Kleinhirn, Stammhirn“, „Liquor“, „Schlüsselbeinmulden“, „Schleimrest“, „Würfelknochen“ nebst „Spuckefäden“, „Nervenbündel“ und „Neuronensplitt“: Grünbeins Reizworte riefen zu Beginn der neunziger Jahre hochaktuelle Erkenntnis- und Vorstellungskomplexe ins Gedächtnis, die wie kleine, in Verse eingeschmuggelte Sprengkörper wirkten. Beim Lesen der Zyklen wurde deutlich, dass hier keine bloße Benn-Imitation im Spiel war. Es ging nicht um einen antihistoristischen intellektuellen Gestus, sondern um ein ernst zu nehmendes Umkreisen von Modellen und Theoremen, die freilich nirgends den Autoritätsstatus wohlgeordneten Wissens erhielten. Grünbeins Texte destruierten Weltbilder, ohne sie durch eine biologistische Super-Theorie oder gar durch Wissenschaftsgläubigkeit auszutauschen. Als sie 1991 erschienen, durchkreuzten sie einen noch stark von Politik, deutscher Vereinigung und vom Ende des Kalten Kriegs bestimmten öffentlichen Diskurs. Von heute aus gesehen liest sich das Eingangsgedicht der Schädelbasislektion, das mit der Frage „Was du bist“ anhebt, wie eine kategorische Abgrenzung zur Ost-West-Dichotomie deutscher Lebensgeschichten:
Was du bist steht am Rand
Anatomischer Tafeln.
Dem Skelett an der Wand
Was von Seele zu schwafeln
Liegt gerad so verquer
Wie im Rachen der Zeit
(Kleinhirn hin, Stammhirn her)
Diese Scheiß Sterblichkeit.
Die Lektion, die Leser aus der Schädelbasislektion lernen konnten, war also nicht auf die Vermittlung gesicherter, im Gedicht mimetisch abgebildeter Wissenschaftskoordinaten zum Zwecke aktueller Weltorientierung gerichtet. Vielmehr löste sich gerade in Anspielungen auf jene Wissensfelder die sichere Verortung des Ichs wieder auf:
Dasein als Zellverkehr… in Einzelzellen?
Auch du, für diesen Zeitfilm chromosom-
Getreu kopiert, steckst tief in deiner Zelle.
Man hat nicht erst gefragt, ob du das willst.
Geboren bist du wie du sterben wirst
Einem Kernimpuls der Moderne folgend, wurde der Ich-lnstanz der Gedichte der feste Boden unter den Füßen gründlich entzogen. Im Gedicht „Inside out outside in“ hat Grünbein ein scharf belichtetes Epochen-Porträt dieses fragmentierten Ichs entworfen:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaRestlos vollgesoffen, ich hing
Hing herum in den Worten, den Sätzen, im Phlegma
Der Signifikanten, an Kantischen Kanten
Verletzt… Raum und Zeit.
Der trinaxische Marx-Mensch, vermarktet, der Schlehmil,
X-ist ohne Schicksal, die Beute Freuds,
Verliebt in The power of positive thinking, das Glück
Zu vergessen … von Illusionen halbblind.
In einer Schlafmohnkapsel lag ich und träumte
Um meine leere Mitte gerollt, das metaphysische Tier.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAnmaßende Stimme, Spion
Des Zerfalls ohne Hoffnung auf den Zerfall im Innern,
Wo das Erinnern wimmert, wo sich das Ich noch immer
Fassungslos sammelt vom elektronischen Schneesturm,
Euphorisches Häufchen Fleisch, wirst du langsam weich?
(…)
Der andeutende, elliptische Stil, ein Anspielungsmix aus unterschiedlichsten Wissenskontexten, fügt lakonische Chiffren zusammen, um die prekäre Situation des Ichs zu konturieren. Sprache, Psyche, Wahrnehmung, Weltdeutung, Individualität, Alltagspraxis, Hoffnung, Glücksempfinden und Begehren: Es gibt nichts, was dem Ich die Möglichkeit böte, seine eigene Topografie im ungesicherten Raum zu konstruieren. Von dieser Perspektive aus sind Selbstdefinitionen des Ichs auch und gerade dort, wo die klassische philosophische Frage nach der Natur und Bestimmung des Menschen aufgeworfen wird, dem Kern poetischer Rhetorik verpflichtet, der komplexen Bildlichkeit moderner Poesie, die alle Substitution und Fundierung von Wissen und Erfahrung im Unbestimmtheitsrest metaphorischer Rede auflöst, ohne sich auf die Positivität von Sinnversprechen einzulassen:
Zwischen Sprache und mir
Streunt, Alarm in den Blicken,
Ein geschlechtskrankes Tier.
Nichts wird ganz unterdrücken
Was mein Tier-Ich fixiert
Hält – den Gedankenstrich kahl
Gegen Zeit imprägniert:
Bruch der aufgeht im All.
In Schädelbasislektion sind Rekurse auf Wissensbestände von Philosophie und Wissenschaft Teil einer unabgeschlossenen Partitur, in der sie eine leitmotivische Rolle spielen. So wie die Gedichte zu Zyklen anwachsen, wuchern Anspielungen auf jene Bestände durch ganze Subsysteme des Gedichtbuchs. Die Texte werden zu einem Stimmen-Ensemble, komponiert aus Wahrnehmungsresten, Anspielungen, Reflexions-, Bild- und Erinnerungssequenzen, die einander überlagern und in Endlosschleifen wiederkehren. Und der beigefügte Anmerkungs-„Appendix“ mit einem Set Sachinformationen für den philologisch prüfenden Leser wird zum Signum des gelehrten Poeten der neunziger Jahre.
Stoische Pose und wissender Gestus
Auch in Grünbeins Nach den Satiren findet sich wie selbstverständlich ein Apparat „Anmerkungen“. Wer ihn mit dem der Schädelbasislektion vergleicht, stößt indes rasch auf einen entscheidenden Unterschied. Es dominiert der Rekurs auf historische Wissensfelder in einem bunten Mix aus römischer Kulturhistorie, Kunst-, Literatur- und Zeitgeschichte. Der Bogen reicht von Tiberius bis Stalin, von Horaz bis Heiner Müller. Der Anmerkungsapparat ist nur ein schwaches Echo auf jenen Wissensdiskurs, der Nach den Satiren vom ersten bis zum letzten Abschnitt bestimmt. Anspielungen auf historische Figuren und Ereignisse vor allem aus der römischantiken Welt sind derart zahlreich, dass der historische Wissensrekurs ein ausgeprägtes, das einzelne Gedicht übersteigendes Struktursegment wird und es wie ein Subtext durchzieht. „Historien“ ist der erste der drei Abschnitte überschrieben, fast die Hälfte des Gedichtbuchs füllend. Ein neues Konzept ist damit prägnant umrissen: Geschichte, Historie in ihren unterschiedlichsten Facetten, wird nicht nur zum beherrschenden thematischen Feld, sondern verleiht dem lyrischen Subjekt auch eine Sprecherrolle und einen Duktus, der bis ins Detail – bis hin zur Verskonstruktion, zum Metrum, rhetorischen Dekor und zur Pose – mit Geschichtlichem zu spielen weiß. Dagegen tritt der verstörende anthropologische Blick der Schädelbasislektion deutlich zurück.
Insofern stellt die Sammlung Nach den Satiren innerhalb des Werkprozesses ein Novum dar. Noch die 1996 veröffentlichte Essaysammlung Galilei vermißt Dantes Hölle zeigte in substanziellen Aufsätzen wie „Neun Variationen zur Fontanelle“ und „Von Neuen Menschen und anderen Irrtümern“ die Bedeutung, die Grünbein dem Fazit seiner wissenschaftlich fundamentierten Anthropologie zuerkennt – jenseits aller Historie: „Und wirklich, sieht man genau hin, ist nichts komischer als dieser einseitig akzelerierte, von Mikrozephalie gezeichnete Gegenwartsmensch, Darwins Schlußlicht am Ende des Stammbaums. Bei gleichbleibendem Kopfmaß ist nur der Körper von Jahrhundert zu Jahrhundert länger geworden. Anthropologie hat es nunmehr mit kleinköpfigen Riesen zu tun, in Horden zur Arbeit strömend, ins Fußballstadion oder zum nächsten Bürgerkrieg.“ Aus der Feder des Poeten markiert ein solcher Satz den Willen zur Einmischung in aktuelle, zunehmend naturwissenschaftlich grundierte Feuilletondebatten, zugleich aber auch den Versuch, die eigene Autorschaft als eine gerade im Wissensrekurs kompetente, unüberhörbar eigene Stimme zu positionieren.
Die in Nach den Satiren markante Werkzäsur zeigt sich nicht nur in der Dominantsetzung des Historischen gegenüber den früheren anthropologischen und biologischen Wissensparadigmen, sondern auch und vor allem in den veränderten Präsentationsmodi der Wissensrekurse. In Schädelbasislektion und noch in Falten und Fallen hatte der poetische Blick auf „Darwins Schlußlicht am Ende des Stammbaums“ insofern etwas Herausforderndes, als er einen im literarischen Gegenwartsdiskurs kaum beachteten, teils sogar provozierend wirkenden Themenkomplex zur Sprache brachte. Der Titel der beiden Gedichtbände umriss gleichsam das Programm. Mit dem Gedichtbandtitel Nach den Satiren wird ein deutlich anderer Akzent gesetzt. Der Titel nimmt die Überschrift des zweiten Gedichtbuchteils auf, der Nach den Satiren heißt und vier auf die ersten vier Satiren des Juvenal sich beziehende Texte umfasst. Als Konzept gelesen, erscheint Nach den Satiren als Buch, das seinen Antike-Bezug gleich im Titel aufruft und den auf Traditionen rekurrierenden Anspruch bekundet, ,nach den Satiren‘ des Juvenal und anderer römischer Dichter geschrieben zu sein.
Grünbeins „Historien“ sind ebenso wie der Juvenal-Zyklus im Mittelteil von antikisierendem Bildungswissen gesättigt, das auf allen Ebenen der Texte ausgebreitet wird: in Titel und Thema, in der Vers- und Strophenstruktur, in Anspielungen auf Namen, Ereignisse und klassische Kanonwerke. Wichtiger noch sind die Schreib- und Sprechhaltungen in vielen Gedichten. Grünbeins römische Tonlage korrespondiert mit einem Subjekt, dessen anspielungsreicher Sprachcode und wissender Gestus eine souveräne Sprecherstimme entstehen lässt: Hier spricht jemand, der alle Turbulenzen und Widersprüche der Gegenwart durchschaut und sie theoretisch brillant auf den Punkt bringen kann. Der Sprecher-Souverän hat seinen Platz in der Gegenwart, der sein Interesse gilt. Aber er ist ihr nicht ausgeliefert, denn er kann sie auf Grund seiner Weitsicht, Bildung und Sprachgewalt mühelos historisieren, relativieren und verfremden. Schon für Falten und Fallen hatte Franz Josef Czernin 1995 im Schreibheft ähnliche Konfigurationen des Ichs festgehalten. Auch für die Gedichtsammlung Nach den Satiren gelten seine bestechend klaren Beobachtungen zum lyrischen Ich bei Grünbein: „So sieht und hört man jemanden, dem offenbar viel daran gelegen ist, den mit Bildung prunkenden Weltläufigen vorzustellen genauso wie den über jede Menge letzter Schreie verfügenden subkulturell geeichten Großstadt-Jugendlichen; man sieht und hört auch den Dandy, den feinnervigen Eleganten, das antimetaphysische und postnietzscheanische Zünglein einer Nervenwaage, den Abgeklärten, den Desillusionierten, den kalten oder coolen, manchmal zynischen Vivisekteur (…).“ Vor diesem Horizont sind der Klassik- und Antike-Rekurs in Nach den Satiren kein Aufruf zu klassizistischer Restaurierung, sondern dokumentiertes Selbstbewusstsein und inszenierte literarische Autorschaft mit jener von Czernin umrissenen Programmierung. Sich ,nach den Satiren‘ römischer Klassiker zu richten, definiert einen hochzivilisierten, urbanen, an Lebens- und Welterfahrung herausragenden, literarisch routinierten, zu Spott und scharfsinnigem Urteil besonders befähigten Schriftstellertypus.
Noch ein weiterer Gegensatz zu früheren Gedichtbüchern ist auffällig. Auch er hängt offenbar mit dem scharf konturierten neuen Status des lyrischen Subjekts zusammen. An Juvenal, den „Pathetiker der satura“, erinnert die zuweilen hoch aufgeladene Sprache einzelner Gedichte mit ihren pathetischen Wendungen und Formeln, welche abrupt die rhetorische Brillanz der ,römischen‘ Diktion unterbrechen. Gleich der erste Zyklus, „In der Provinz“, zeigt eine Ich-Figur, die im befremdlichen Blick auf das Randständige und Abseitige eine für das gesamte Gedichtbuch charakteristische Distanz aufbaut, welche spüren lässt, dass der Sprecher in den Metropolen zu Hause ist und nun wie ein in die Fremde verbannter Römer auf manche „Hasenpfote im Gebüsch“, manchen „toten Maulwurf“ abseits am Wege und selbstverständlich auch auf „fliegende Händler (oder sind es Reporter)“ stößt, auf ausgedörrten Boden und anderen Ungemach. Der Zyklus zeigt exemplarisch, wie die Sprache und Form der Gedichte alltägliche Ereignisse, wie die plötzliche Wahrnehmung toter Tiere am Wegrand, immer mehr mit dem Pathos der Rede überziehen, bis zuletzt der rhetorische Gestus das factum brutum des Texts – „auf der Römerstraße die tote Amsel, zerfetzt“ – vergessen lässt.
Wer das Eingangs- und das Schlussgedicht des kleinen Zyklus „In der Provinz“ miteinander vergleicht, stößt auf unterschiedliche rhetorische Stile. Das erste Gedicht, „In der Provinz 1“, entfaltet sich aus genauester Beobachtung, der es die ihr angemessene unregelmäßige, rhythmisch sperrige, disharmonische Vers- und Strophenform zuordnet:
Eingefallen am Bahndamm,
Liegt ein Hundekadaver quer im Gebiß
Kreideweiß numerierter Schwellen, erstarrt.
Je länger du hinsiehst, je mehr
Zieht sein Fell in den Staub ein, den Schotter
Zwischen den Inseln aus frischem Gras.
Dann ist auch dieses Leben, ein Fleck,
Gründlich getilgt.
Grünbein hat den Prozess der Verwesung in einem einzigen Moment festgehalten und auf den Punkt der Beobachtung hin verdichtet. Noch die auf die Interpretation des Wahrgenommenen zielende Metapher „dieses Leben, ein Fleck“ verweist auf das exakt in den Blick genommene Detail, den Kadaver, zurück. Im letzten Gedicht, „In der Provinz 5“, schlägt Grünbein einen umgekehrten Weg ein. Statt der bestürzenden Präzision von Beobachtungen kommentiert er den Kern des Geschehens – „auf der Römerstraße die tote Amsel, zerfetzt“ – mit immer neuem Bildungsballast:
Daran erkennst du sie, von fern, die beiseitegefegte,
Beim Einfall der Horde an die Erde geschmiegte Schwester.
Ob Daker und Hunnen, Mongolenpferde und Motorräder −
Schimpfend hatte sie abgelenkt von der Nähe der Nester.
(…)
Damals im Staub grober Quader, heute auf nassem Asphalt.
Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen.
Auch das Gedicht „In der Provinz 3“ gibt sich nicht mehr mit der kunstlosen Registrierung eines Schreckmoments zufrieden, sondern sucht förmlich nach dem decorum des rhetorisch ausgefeilten Bildprogramms. Das Gedicht hebt mit der trügerischen „Stille um einen toten Maulwurf“ an, um sie dann mit entsprechendem rhetorischen Bildaufwand zur Allegorie einer von Gefahr und Kampf erfüllten Welt zu transformieren:
Unter ihm sammeln sich Käfer, bewaffnete Kräfte
In schwarzer Uniform. Über ihm kreist,
Bevor er abdreht, die Flügel zerzaust, ein Habicht.
Ameisen graben, Kommandos im Eilmarsch
Der Schluss des Gedichts freilich gibt die Aussicht frei auf eine Figur, die jenseits des hektischen Weltgetriebes en miniature steht: „Nur eine Grille, einen Sprung weit entfernt, / Liest in den Wolkenzügen und sonnt sicht Schweigend, ein stoischer Philosoph.“ Im heiteren allegorischen Bildrätsel des Gedichts verkörpert, alter literarischer Konvention folgend, die Grille die Position des den „Wolkenzügen“ nachsinnenden Dichters, der sich als „stoischer Philosoph“ ausgibt. Stoische Posen wie diese gehören zu den Leitmotiven der Gedichtsammlung Nach den Satiren und sind self-design. „Kein Wunder, daß uns Stoiker die Mehrheit flieht, / Wenn sie uns lästern hört“, heißt es in der Versepistel „Julianus an einen Freund“. Die stoische Haltung ist Teil eines Überlegenheitstopos, mit dem die Ich-Figur der Gedichte die eigene Souveränität behauptet.
Unter diesen Prämissen wird auch der veränderte Präsentationsmodus von Wissensrekursen nachvollziehbar. Sobald sich der historische Anspielungshorizont öffnet, ist sein Status durch eine Sprecherstimme vermittelt, die mit Autorität ausgestattet ist und das officium eines stoischen Kulturphilosophen versieht. In manchem Gedicht verselbständigt sich der wissende Gestus zum rhetorisch versierten Ich-Porträt. Dokumentiertes Wissen verflüchtigt sich zur bloßen Bildungsreminiszenz. Manche der „Historien“ Grünbeins leiden unter erzwungenem Aktualitätsbezug und geben kaum mehr wieder als ein geräuschvolles Blättern in den Annalen des Tacitus.
Die „Klage eines Legionärs aus dem Feldzug des Germanicus an die Elbe“ ist dafür ein Beispiel. Was ist dem historischen Stoff, den mit Triumphen in Rom bekrönten Germanien-Feldzügen des römischen Feldherrn Germanicus (14-16 n. Chr.), mehr abzugewinnen als die Klage eines zivilisierten Reisenden, der ein Statement über barbarisch-chaotische Fremde abgibt? „In den waldigen Tiefen / Verliert der Triumph sich, die lateinische Ordnung.“ Da ragt aus „Nebel“, „Dauerregen“, „Sumpf“, „Schlamm“ und „Morast“ eine bis ins Klischee ungemütliche „Germania Magna“ auf, die für einen Augenblick freilich auch eine fata morgana des Natürlichen sein kann:
Wo die Wälder noch dicht sind, kein Baum
Auf dem Ozean treibt als Galeerenbank
Oder als brennender Schiffsrumpf
Und weil die „Klage“ über ein ironisch nachempfundenes Räsonnieren nicht hinausreicht, hält wenigstens der Schluss eine Pointe bereit:
Und kommst du endlich, um Jahre gealtert, nach Haus,
Steht der Germane in deiner Tür, und es winkt dir
Das strohblonde Kind deiner Frau.
Der stoische Durchblick reicht tief, er kann im schnellen Schritt Epochen überwinden, Jeanne d’Arc mit Rosa Luxemburg vernetzen. In anderen Gedichten, wie in „Hadrian hat einen Dichter kritisiert“, „Physiognomik nach Polemonius“ und „Zwei Epigonen unter sich“, verkümmert der historisierende Wissenscode zum geschwätzigen Histörchen. Im Rollengedicht „Julianus an einen Freund“, geschrieben in Epistelform, vernetzt Julian, der letzte sich dem Christentum im 4. Jahrhundert entgegen stellende römische Kaiser, mühelos spätantikischen Skeptizismus und Stoizismus mit Nietzsche-Volten, wenn es heißt:
Wenn erst ein Gott allein das Sagen hat, der eine,
Der den Verrat belohnt und durch Vergebung
Komplizen macht, wenn alle Sterblichen
Vereinsamt sind, genügt ein Schwächeanfall,
Bis jemand kommt, dem es im Weltraum kalt ist,
So kalt, daß er daraus den Schluß zieht, – Gott ist tot.
Vielleicht nicht morgen, doch in tausend Jahren
Wird sich ein Wirrkopf finden, der die Formel spricht.
(…)
Der Wissende und die „Menge“
Die Art und Weise, wie die Ich-Figur in Nach den Satiren ihre Kenntnisse und ihren Wissensfundus ausbreitet, konstituiert ein souveränes lyrisches Subjekt mit dem „Anspruch, über den Dingen zu schweben“, ein Ich, das die Rolle einer unabhängigen, hochkompetenten, Gegenwart und Vergangenheit kritisch beobachtenden Sprecherinstanz ohne einen Anflug von Selbstzweifel zu beanspruchen weiß. Die stoische Pose und der wissende Gestus schaffen Distanz. So wie das Ich zu Kommentar und Urteil befähigt ist, bleibt dem Gegenpol, den unwissenden Kräften, Alltag und Welt verschlossen. Hundert Jahre nach der literarischen Inszenierung des Gegensatzes von Künstlertum und Bürgertum kehrt in Grünbeins Gedichtsammlung die Opposition zwischen einer gestaltlos-diffusen Menge und einer scharf umrissenen Ich-Figur wieder, teils als exzeptionelle poetologische Position, teils als in Gesten und Anspielungen verdeckte Reminiszenz.
Diese Opposition tritt in den vier Gedichten des Juvenal-Teils besonders zu Tage, Vor dem Auge des Ich-Beobachters, der ein Selbstgespräch in Permanenz führt, hat nichts Bestand, während alle anderen irgendwie in die großen und kleinen Katastrophen des Alltags verstrickt sind. Dem juvenalischen Pessimismus folgend, demonstriert gleich die erste Satire Egozentrik, Männlichkeitsrituale, Gleichgültigkeit, Mord und Totschlag in breit ausladenden Langversen mit unterschiedlicher Hebungszahl, variablem Metrum und elegant parlierenden Rhythmen. In den Blick geraten Konfigurationen des Alltags; sie bleiben namen- und schicksalslos, heißen „Jemand im Rollstuhl“, „ein Bettler“, „die Alte am Friedhofstor“, „die Muskeln / Vor geöffneter Kühlerhaube“ und, knapp und kurz, „die Meute“. Kein anderer als der neue juvenalische Sprecher ist zur panoramaartigen Vogelschau auf die Welt befähigt, deren Verhängnis er zu Verssentenzen verdichtet:
Jeder Tag kann ein Tag sein, der alles zerreißt
In einer Stunde wie jede, alles und nichts,
Was die Netzhaut behält.
Denn das Unheil ist stumpf
Im Moment des Erscheinens, vergessen,
Wo eine Kehrmaschine das letzte Wort hat, am Morgen,
Wie das Schuhpaar des Mörders der Bordstein glänzt.
Der Dichter (wer sonst?) kann das Treiben der Menschen kommentieren, scherzhaft und mit vollem Ernst, augenzwinkernd, humorvoll und hier und da auch mit tragisch-düsterer Bitterkeit – eben so, wie es Horaz und Juvenal entspricht, dessen erste vier Satiren Grünbein weder ins Deutsche überträgt noch nachdichtet, sondern mit kongenialem Blick fürs analoge Detail aktualisiert, indem er eine lasterhafte, lernunfähige, sich selbst zerfleischende Gesellschaft mit pastosem, wuchtigem Farbauftrag und wuchtigem Pathos ins Bild setzt.
Zur Opposition zwischen Grünbeins Sprecherfigur und der „Meute“ gehört der Gegensatz zwischen abgeklärtem Wissen und dumpfer Ignoranz. Auf dem Boden dieser Dichotomie erhält der leitmotivische Begriff der „Menge“ seine Konturen. Ein Beispiel dafür liefert die Elegie „Ein bedenklicher Gast an der Tafel bei Kaiser Nerva“. Der „bedenkliche Gast“ ist jenes zur Reflexion befähigte Ich, welches das blutige Treiben in den Arenen mit dem Satz quittieren kann:
Wer seinen Augen traut, (…) muß verrückt sein.
Die „Menge“ aber bleibt blind und unwissend:
Und was tut die Menge? Schaut gar nicht erst hin. Der blicklose Koloß,
Der neronische Travertin hallte wider von Jux und Hallo.
Grüße flogen und Tücher… Bis kein Mensch mehr war, was da lag
Am Grunde des Zyklopenaugs. Denkt euch, da hab ich geweint.
Von einer andern Seite zeigt sich das Ich in „Limelight“, im Zentrum New Yorks, als Dandy, Flaneur und Weltmann, als einer, der sich auskennt und seine Rolle „im Gefolge des toten Adonis“ so zu spielen weiß, wie sie verlangt wird:
Nach einer schwindelnd durchwachten Nacht, unter Models
Und Tänzern verbracht, im Gefolge des toten Adonis,
Sieht er den Broadway mit anderen Augen, gerändert
Von Sperma und Seifenschaum
Im Regen der Neuen Welt,
Die Inszenierung des Dichters als eines Heroen der Metropole wird in den Eingangsversen der vierten ,juvenalischen‘ Satire sogar zur unfreiwilligen Wild-West-Parodie:
Wir gingen lange schweigend durch den Morgen, er und ich,
Zwei Duellanten, die auf einen Blick die Straße messen,
Den Abstand zwischen jedem Baum und jedem Haus.
Und hinter dem Gespräch verschwand, was Stadt war,
Solange man hier Nahrung suchte, Nachtgesellschaft, Schlaf,
Entlang der Alptraumwege zu den Clubs und Bars.
Die exklusive Ich-Figur illustriert jene kritische Beschreibung, die Czernin schon nach dem Erscheinen von Falten und Fallen entwarf: „So gibt sich etwas zu erkennen, ein poetisches Ich, das die Attitüde hat bzw. sich in der Pose ergeht, all diese so verschiedenartigen Dinge von oben herab zu einer poetischen Gegenwart und auf eine Fläche zu bringen und gerade damit das Ganze absehbar zu machen; ein poetisches Ich, das über subkulturelle Jargons wie über wissenschaftliche Fachtermini verfügt, über morgen- oder abendländische Jahrhunderte, über philosophische Probleme wie über die Methoden der Wissenschaften, über poetische Traditionen und Verfahren (…) und über alles das und noch viel mehr genauso wie über das Leben, die Liebe und den Tod.“ Der Status des Ichs hebt sich in dem Maße empor, wie es sich von der „Meute“ und „Menge“ abhebt. Eine solche Dichotomie aktiviert nicht allein tradierte Dichterkonfigurationen, sondern auch zivilisations- und kulturkritische Volten, die längst dem historischen Fundus angehören. Ein Beispiel dafür ist Grünbeins „Bericht von der Ermordung des Heliogabal durch seine Leibgarde“, der auf Georges Dichtung verweist. Der Berichtende gehört zur wissenden Elite der Tyrannenmörder und vermag selbstdiszipliniert die Tat und den Moment des Morens zu einem komplexen Versgeständnis zu verarbeiten, während die „Menge“ nichts als Affekt und niederen Instinkt kennt:
Merkt euch, wir waren zu fünft. Der Tod des Tyrannen
Ist unser Verdienst. Bevor die Menge ihn stückweis
Verteilte in allen Gassen, standen wir lange
Erleichtert über dem Leichnam.
Und ich, Pittakus, pißte am längsten.
Im Gedicht „Avenue of the Americas“ trifft das Beobachter-Ich wiederum auf „die Menge“ und nutzt die lästige Begegnung zu einer kategorischen Abgrenzung. Wo die einen „Asiatischen Tand“ suchen, hängt das Ich im tiefen Selbstgespräch den „Bildern des Botticelli“ nach und sieht – Dante:
Dort an den Kistenholzständen, wo die Verkäufer
Mit hageren Händen Spielzeug und Elektronik,
Asiatischen Tand in die Menge hielten:
Erschien dir zum ersten Mal diesseits des Traums,
Gesenkt den Kopf, wie auf den Bildern des Botticelli,
Der schweigende Dante.
Der Selbstinszenierung der Ich-Figur entspricht ein poetologisches Programm, das, an Positionen der frühen Moderne erinnernd, der Lyrik den Rang bedeutenden Sprechens zuweist. Wiederum ist es eine Epistel, in der Grünbein sein Statement artikuliert, ein „Brief an den toten Dichter“, der zugleich ein Nachruf auf Heiner Müller ist: „Der Rest ist Lyrik, wie? Aber wenn alles zuwächst, / Der Traum undurchdringlich wird in der Menge, / Ist es der Vers, der ins Freie zeigt.“ Im Pathos einer solchen Wirkungsmacht kommt Traditionen eine besondere Rolle zu, und zwar nicht als Argumentationsfigur, sondern als konkrete Bezugsgröße. So widmen sich einige der Programmgedichte in Nach den Satiren bezeichnenderweise Charles Baudelaire, Grünbein akzentuiert in ihnen eine bis zu Karl Kraus mühelos zurück zu verfolgende Dichotomie, die Opposition zwischen Dichtung und Presse. Es ist freilich konsequent, dass „der Vers, der ins Freie zeigt“, seine Stimme gegen den Lärm der Medien und Höllendreck der Presse erhebt. Baudelaire jedenfalls verbürgt anekdotisch diese Auffassung:
Baudelaire, mit stumpfer Klinge zum Selbstmord bereit
Beim Erscheinen der ersten großformatigen Zeitung,
Glaubte das Ende der Dichtung nah, nicht zum ersten Mal.
Auch in seiner „Daguerreotypie Baudelaire“ konfiguriert Grünbein den Dichter als „Gazetten“-Feind:
Dort ging Baudelaire in grüner Perücke und jagte die Phrase,
Den Krankheitserreger, in Gazetten, auf rostige Haken gespießt.
Rhetorik des Wissens
Grünbeins Baudelaire-Gedichte lesen sich wie ein Selbstbild vom Autor, der sich als ein exzeptionelles, mit Wissen und Willen ausgestattetes Schreib-Subjekt begreift und dessen Stimme im Lärm der Welt deutlich herauszuhören ist. In Nach den Satiren geht es nicht mehr, wie noch im Gedichtband Schädelbasislektion, um Stimmen aus „Niemands Land“ und auch nicht mehr um „Die Leeren Zeichen“. Im Gegenteil: Gerade die Tendenz zum sprechen in Sentenzen läßt manche Verse wie Grundeinsichten erscheinen, welche die „Mehrheit“, „die Masse“ und „die schlichten / Gemüter“ nicht kennen.
Paradigmen dafür liefern die dreizehn als „Fantasiestücke“ bezeichneten Gedichte des Zyklus „Asche zum Frühstück“. Schon die einzelnen Titel wirken wie spruchhafte Kennmarken: „Von der Eins in der Menge“, „Von der inneren Unruh“, „Von den Tageszeitungen“. Grünbeins Denksprüche haben ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes Metrum. Ein Hexameter weiß:
Streng als Eins lebst du hin. Gewöhnt an die Ordnung der Zehn…
Ein anderer Vers verkündet: „Menschen ändern sich, Städte, doch nicht am Nabel der Leberfleck“. Einzelne Sentenzen sind Weisheiten vom Menschen:
War der Mensch nicht das Tier, das Kaugummi kaute,
Als es Eden verließ und zur Mondlandung aufbrach?
Mancher Spruch kann im Alltag sicher bestehen: „Nein, was nie liegen bleibt ist Geld, Blinkt auf der Straße, / Kopf oder Zahl, ein rundes Stück Metall, macht man den Diener.“ Auch praktische Lebensmaximen werden feilgeboten: „Blut stillt sich selbst“; „Was ein Leben zusammenhält, ist das Loch im Kalender“; „Wo ein Datum ist, hat der Körper das Nachsehn“. Die Höhe sentimentaler Moralität schließlich erreichen Sätze wie diese aus der dritten, Juvenal nachempfundenen Satire: „Wie viele Leben faßt ein Wiegenlied“, „Wieviel Schweigen geht / Verschüttet in den Ballungsräumen“.
Grünbein experimentiert in Nach den Satiren mit einem der juvenalisch-römischen Tradition angemessenen, getragenen Sprachstil, der allerdings so elastisch zu sein hat, dass er vom Zitat obszönen Alltagsjargons bis zum hohen Pathos-Ton reicht. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass gerade dann, wenn einfache Dinge und Zusammenhänge auf ironische, lässig-leichte, spontane Weise formuliert werden sollen, ein gekünstelter, umständlicher Ton zu hören ist, der umso mehr auffällt, als er von wuchtigen, vielhebigen Versen und vom adaptierten antiken Formenrepertoire echoartig verstärkt wird. Ein Exempel dafür ist die Kultur- und Zivilisationskritik des kleinbürgerlichen Muffs der Metropolen, die unversehens zu einer moralisierenden Einrede gerät:
In dieser Enge
Führt jeder Schrei von begrünten Balkons zum Gerücht
Unter Nachbarn, schließt eine Tür wie ein Verdacht
Mit dumpfem Ruck. Irgendwo ist ein Totschlag die Folge
Einer verkannten Bitte.
An solchen Stellen verformt sich der souveräne stoische Duktus unversehens zum diffusen Klageton, der nach Allgemeinplätzen sucht:
Wie Gasgeruch legt sich
Über Straßen im Zwielicht, Plätze, tags dunkel, ein Fluch,
Der Vergangenes aufstört, und schon brennt die Luft,
Die kritische Invektive aber bleibt trübe, trifft niemanden, ist daher, mit Czernin formuliert, „wohlfeile Gesellschafts- oder Bewußtseins- oder auch Medienkritik“. Juvenalische Präzision und Treffsicherheit verlieren sich in vagen Räsonnements, deren Verschwommenheit immer wieder von verschachtelter Syntax, manierierten Periphrasen und hochartifiziell konstruierter, der Sache nach aber recht belangloser Metaphorik verdeckt wird. Die wuchernden, aufeinander verweisenden und miteinander verknüpften Bilder geben in manchem Vers und mancher Strophe kaum mehr als Nachdenklichkeit und Unbehagen wieder, Stimmungen, die in kunstvoll angezogenen Terzinenstrophen wie Preziosen kunsthandwerklicher Lyrik glänzen:
Und warum, fragt man sich (und Warum ist die kindlichste Frage)
Bin ich ausgesetzt dem Parcours, diesem Lauf auf verkauftem Boden,
Wo die tote Taube zum Fußball wird, den der Schwächlichste kickt,
In die Nähe des Manierierten gerät Grünbein aber auch dort, wo die Dynamik des beweglichen Verses und der rhetorische Fluss seiner Sätze zu routinierten, geschliffenen Bildkompositionen erstarren. Beispiele dafür gibt es im „Veneziana“-Zyklus der in zehn Elegien die Anatomie des morbid-mondänen Stadtkörpers von Venedig als Erinnerungsort, Touristenspektakel und Imaginationsreiz durchmustert. Es macht die Stärke der Gedichte aus, dass die Beobachterperspektive seltsam gebrochen erscheint, weil in der poetischen Stadt-Redoute die Umrisse einer Liebesgeschichte („Wir suchten eine Fluchtburg, und… Venedig“,) durchschimmern und lyrische Töne den souveränen Beobachterduktus abschwächen. Umso mehr fallen gekünstelte Formeln auf, etwa wenn das Gewirr der Kanäle in einem gedrechselt wirkenden Vergleich wiedergegeben wird:
Was im Kreuzworträtsel die Worte, sind die vielen kleinen Kanäle
Hier oben: Relikte des Handels, der Reden, Verbindungen überallhin.
Die Produktion solcher im Kern trivialen Vergleiche und Metaphern wird im Text wie eine automatische, von der Ich-Figur losgelöste poiesis beschrieben: „Nur die Metapher findet von selbst hier zum nächsten, entferntesten Ziel.“
Einem solchen Prozess des „Von selbst“ verdanken sich offenbar Vergleiche wie der folgende:
Wie der Lido kein Ort zum Baden,
Ist Venedigs Manege kein Spielplatz für Löwen, gleich welcher Art.
(…) Was da überall scharrt
Mit verwundeten Füßen, sind Tauben, und deren Beute heißt Müll.
Grünbeins Technik, Vergleiche zu ziehen und immer wieder als poetisches Stilmittel einzusetzen, ist ein Beispiel für fragwürdige Lektionen in Versrhetorik, für überpointierte Analogien und zwanghaft gesuchte Parallelen: „Wie die Hand leicht abrutscht an Melonen, / Irrt der Touristenblick durch dieses Mekka für Banausen“; „Wie verloren / Führt aus feuchtkaltem Korridor direkt ins Wasser manche Tür“; „Wenn auf der Piazza plötzlich wie am Grund der Wundertruhen / Silberne Pfützen stehn“; „Sein Gezappel, das ist der Klatsch, das Zitieren und Schwätzen / Über alles von Dauer, alles Uralte wie Kinder, Rezepte, Wehwehs.“
Wie alle rhetorische Technik läßt auch bei Grünbein die Konstruktion der Vergleiche und Metaphern Rückschlüsse auf die Ich-Figur der Gedichte zu. Das Ich aber beherrscht das Repertoire der Bildlichkeit. Vergleich und Metapher stellen sich für einfache Vorgänge wie für hochkomplexe Menschheitsfragen wie von selbst ein. Wenn der poeta doctus spricht, expliziert er sein Wissen und seine Beschlagenheit, indem er die Rhetorik des Wissens wortreich ausbreitet und auf Effekte der Überraschung und Überredung setzt. So mutieren manche Verse zu erhabenen Wendungen und gediegenen Bildungsaphorismen, welche die Welt noch mit wissendem Blick und geistreichem Wort erklären und buchstäblich ins Bild setzen können:
Der Mensch ist nichts zuletzt als eine trübe Pfütze,
Die von Asphalt dampft, wenn sein Fleisch Geschichte ist.
(…)
Was ist ein Nackenwirbel gegen einen Eisenträger,
Der noch zerborsten aus den Fundamenten ragt,
Was ist ein ausgeschlagner Zahn, der in der Schachtel rasselt,
Gegen das Rumpeln der Zementmischtrommel nebenan.
Solche Rhetorik des Kothurn schraubt den Ton vieler Gedichte hoch, nährt den Manierismus-Verdacht und versteift deren Vergleichs- und Metaphernkonstruktionen zu rhetorischen Posen artifizieller Selbstdarstellung:
Wenn das letzte Streichholz vor blauschimmliger Mauer verpufft
Und wir selbst überrascht sind, wie gut uns das Paar in den Pfützen gefällt.
Dann wird der Heimweg zur Springprozession auf Planken und Stegen.
Zusammengefasst: Den Konnex von Poesie und Wissen verbürgt in Grünbeins Gedichtsammlung Nach den Satiren eine exzeptionelle, hochsensible, für alle Reize empfängliche Ich-Figur, die den Mut hat, in großangelegten, exklusiven, mit Traditionen spielenden Formdesigns über alle Facetten des Lebens, der Welt und der Historie eine Überschau zu wagen, eine Figur, die so beweglich ist, dass sie stoische Posen, römische Kostümierungen und mondäne Kritikerrollen mühelos auf sich vereinigen kann – bis zur Attitüde, bis zur Selbstparodie.
Hermann Korte, in: TEXT+KRITIK: Durs Grünbein – Heft 153, edition text + kritik, Januar 2002.
2.5 Nach den Satiren1
2.5.1 Engführung von Antike und Gegenwart: Grünbeins Historien, weitgehend hysteriefreie Schilderungen von der Kontinuität der Intrigen und dem Sterben am Rande
Wir sind jetzt in der Phase der Farce, nach der Tragödie, jetzt ist keine Tragödie im Gange. Da kommt auch keine mehr.2 Heiner Müller
Farce heißt bei Heiner Müller Bedeutungslosigkeit – Geschichte, die kaum interessiert, deren Ideen bereits in der Vergangenheit angelegt sind und sich mühelos in die Zukunft weiterdenken ließen. Die Problematik dieser Aussage soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden.3 Nur scheint sich die Parallele zwischen Müller und Grünbein anzudeuten, dass der auch produktive Schock der ostdeutschen Diktaturerfahrung nach seinem Ende ein Vakuum hinterlassen hat, das zunächst noch kaum aufgefüllt ist. Der Titel des Gedichtbandes markiert eindeutig eine Zäsur. Zunächst nur vager Befund, gilt es, eine Störung bewusst zu machen. „Der Schaden ist angerichtet“4, steht in einem der nachsatirischen Texte.
Insofern kann man Grünbeins Nach den Satiren als Metapher verstehen für den Zeitpunkt vor gültigen Gewissheiten, Antworten auf neuen Fragen.5 „Unter den Füßen ist der Boden schwankend geworden“, schreibt Grünbein 1991 in dem Essay „Transit Berlin“.
Wie aus fernen Fluchten, lang schon beschleunigt und mit jedem Nachkriegsjahrzehnt schneller, wächst eine neue Architektur samt Raumordnung auf den betäubten Beobachter zu.6
Die Historien gehen der ,Betäubung‘ entsprechend den Weg zurück – dem Exemplarischen auf der Spur, dem in der Gegenwart noch immanenten Gestrigen. Die Texte sind keine konzertiert allegorische Aktion, keine didaktischen Parabeln, sondern vielmehr versuchte Analogien.
Das Ziel ist die szenische Vorstellung, nicht die rhetorisch-inhaltliche Verhandlung. Die Historien haben mit gewissen Kontinuitäten zu tun, für die das Bewusstsein geschärft werden soll.
Es geht um Fehlleistungen, um das Intrigante und Kaltblütige, das die Menschheitsgeschichte begleitet. Einen Gedichttitel Grünbeins adaptierend, könnte man sagen, dass die Historie Kein gutes Omen7 erlaubt, die biologisch-zivilisatorische Entwicklung geprägt ist von virulenter Tradition. Heinrich Kaulen schreibt:
Ganz ohne Selbstmitleid und Schmerz verzichtet der Autor auf alle Utopien und universalistischen Sinnkonstruktionen, stellt er sich illusionslos dem Blick auf eine Geschichte, die vom Altertum bis zur Gegenwart eine Geschichte der Schlachten und Zerstörungen gewesen ist.8
Basis für Grünbeins literarische Ermittlungen ist die Antike in der Form Römisches Reich. Pars pro toto entsteht eine Topografie eines zynischen, im Alltag der Herrschaft blasierten Systems. In der Arena, jener Kernstelle römischen Lebens, „nichts Besondres: Der übliche Leichenberg – / Gliedmaßen aller Nationen, ein zuckendes Völkergemisch, Und daneben die Tierkadaver, die allerneusten Chimären, / Krokodile mit Löwenkopf und so weiter. Doch dann geschah’s. // […] Ein alter Secutor / Schlägt seinen Eisenhaken in die Brust eines jungen toten Gladiators / Und zieht ihn, ein Fischkoch, durchs Paniermehl aus heißem Sand. // Und was tut die Menge? Schaut gar nicht erst hin.“9 Grünbein aber schaut, blickt hin sowohl aus Richtung tradierten Wissens als auch imaginierend auf Rudimente alter Zyklopenaugen10, Blindstellen und Wegstrecken.
Die ersten Texte des Gedichtbandes – In der Provinz11 – sind allmähliche Annäherungen an das territoriale Gespinst einer alten Herrschaft. Lokalisiert in der Normandie, in Böhmen oder der Campania, verweisen die Gedichte auf die weitläufige Geografie des einstigen Römischen Weltreichs.
Im Kontext der weiteren Texte und durch die Verlagerung des Geschehens in römische Provinzen werden die Gedichte zu so etwas wie historischen Piktogrammen.
Grünbein greift indirekt eine der wesentlichen Hinterlassenschaften des expansiven Roms auf: Den Tod. Die Schilderung der Begegnung mit Tierkadavern – Sebastian Kiefer nennt sie „Proben einer hohen Kunst der Nature morte“12 – auf historischem Boden bringt eine subtile Konstellation hervor.
Was vom Gemetzel übrig blieb, hing in den Zweigen,
Die sich an nichts erinnern wie bestochne Zeugen.13
Das eigentlich kaum interessante Ableben unbedeutender Kleinlebewesen übersetzt Durs Grünbein in präzis formulierte, weiter gehende Assoziationen aber ermöglichende kleine Grotesken:
Wie vom Reisewagen gestreift eines fliehenden Siedlers
Lag auf der Römerstraße die tote Amsel, zerfetzt.
Einer der immer dabei war, den nie etwas anging, der Wind
Hatte aus Flügelfedern ein schwarzes Segel gesetzt.
Daran erkanntest du sie, von fern, die beiseite gefegte,
Beim Einfall der Horde an die Erde geschmiegte Schwester.
Ob Daker und Hunnen, Mongolenpferde und Motorräder –
Schimpfend hatte sie abgelenkt von der Nähe der Nester.
Mehr war nicht drin. Sieht aus, sieht aus, als sei sie gleich hin gewesen.
Der miserablen Sängerin blieb nur sich quer zu legen.
Damals im Staub grober Quader, heute auf nassem Asphalt.
Immer war Völkerwanderung, meistens Gefahr auf den Wegen.14
Von der Geschichte ist bloß assoziative Erinnerung geblieben. Sie ist wie „das Leben, ein Fleck, / Gründlich getilgt.“15 Auf historischem Boden breitet sich die hektische Geschäftigkeit der eingespielter Resteverweser:
Die Stille um einen toten Maulwurf
Am Rande eines Weizenfeldes, sie trügt.
Unter ihm sammeln sich Käfer, bewaffnete Kräfte
In schwarzer Uniform. Über ihm kreist,
Bevor er abdreht, die Flügel zerzaust, ein Habicht.
Ameisen graben, Kommandos im Eilmarsch,
Am Rückgrat entlang eine Rinne. Im Innern
Laufen die Drähte heiß, wimmeln nervöse Maden
An der Börse der Eingeweide. Vom Bauchfell
Tragen fliegende Händler (oder sind es Reporter)
Die Botschaft in alle vier Winde: Ein Aas, ein Aas!
Nur eine Grille, einen Sprung weit entfernt,
Liest in den Wolkenzügen und sonnt sich
Schweigend, ein stoischer Philosoph.16
Grünbein hält die Position der Grille, gibt sich in der Nähe fern, ist der gleichmütige Philosoph als „überlebender Zeuge“17.
Das historische Panorama selbst wird mit Kleinigkeiten18 begonnen, in denen der Autor (oder seine Ich-Fixierung) als bedenklicher Gast19 erscheint, der eine Stimme aus den Randbereichen einer früheren Diktatur repräsentiert. Einen ersten partikularen Schicksalsschlag schildert zuvor die Klage eines Legionärs aus dem Feldzug des Germanicus an die Elbe: Der Fußsoldat, der in den Sümpfen Mitteleuropas für sein Reich kämpfte, erhält den eigentlichen Todesstoß erst bei der Heimkehr aus den Schlachten:
Und kommst du endlich, um Jahre gealtert, nach Haus,
Steht der Germane in deiner Tür und es winkt dir
Das strohblonde Kind deiner Frau.20
Die Gedichte, zunehmend auch im Stil einer poème en prose, verraten eine (formale) Strategie, die Lutz Hagestedt folgendermaßen charakterisiert:
Es sind große, angestrengte und anstrengende Textkorpora, deren Einzeltexte ein Verbundsystem bilden, sich ergänzen und wechselseitig interpretieren. Auch zwischen den Zyklen verlaufen Verbindungsstränge, die eine zusätzliche Verdichtung des Textgewebes bewirken: Die Zeitmetaphorik, die Städte- und Landschaftsbilder (Atlantis, Berlin, Hollywood, Palästina, Rom, Troja), die kosmologischen Entwürfe, die Metaphorik der Naturwissenschaften, die Nekrologe, die Vanitasbilder, die Serien der zur Schau gestellten Prunkzitate. […] Es scheint so, als habe der Lyriker Grünbein die Lyrik hinter sich gelassen, um den autonomen lyrischen Einzeltext in einen syntagmatischen Kontext einzubetten, der auch Narrativität zulässt, Geschichtserzählung, eine Totalität der dargestellten Welt, das Sittengemälde der Gegenwart vor dem Hintergrund römischantiker Dekadenzbilder.21
Wir kommen darauf zurück.
Grünbein gestaltet Szenen aus der Saturiertheit des alten Roms, spiegelt den Alltag eingeübter Hierarchien mit all seinen Chauvinismen und paradigmatischen Beiläufigkeiten. Er zeichnet Porträts verschiedenster Charaktere, indem er die Identitäten wechselt. Insofern dient diese Lyrik als Gedächtnis des Strukturellen über den Umweg der Fixierung eines konstruierten Ichs. Die Porträts sind kleine Charakterstudien – physiologies –, in denen die Zeitlosigkeit der Conditio Humana erzählt wird.
Das Rollenspiel ist, wie auch Michael Braun feststellt, eine Reise „in die Zynismen, Immoralitäten, Misanthropien und Überdrussgefühle einer unserer Gegenwart geistesverwandten Epoche.“22 Das Ich der ,römischen Stücke‘ verkörpert Spielarten der vox populi vom anonymen Straßengänger bis hin zum Despoten, dessen vom Ennui des Alters angefressene Willkür immer noch wirksam ist,23 fängt Smalltalk ein oder gibt sich philosophischen Fragen hin.24
Dabei ist es so wenig festgelegt, dass der Wechsel von Zitat und unmarkierter Rede – der gelegentlich willkürlich erscheint – keinen Unterschied zwischen eigener Stimme und Anstimmung des Fremden macht. Aus der Methode resultiert ein steter Transfer von subjektiver Erfahrung in entpersonalisierte Subjektivität.
Das ,Identitäts-Hopping‘ ermöglicht unterschiedliche Perspektiven im schnellen Wechsel. Eben noch misanthropischer Tiberius – bereit, mit einem Wink der Hand die „römischen Flugzeugträger“25 in Marsch zu setzen – ist Grünbeins Geschichtszeuge im nächsten Moment junger Gardist einer kleinen Revolution. Der Bericht von der Ermordung des Heliogabal durch seine Leibgarde26 schildert expressiv-salopp das Attentat auf Mark Aurel. Ohne allzu politisierende Subtilien arrangiert Grünbein den Mord sichtbar als Akt der Selbstwehr gegen ätzende Tyrannei, der sich mittels Gewalt Luft verschafft.27 Es ist nach Michael Braun „der Verlust jeglicher Moralität“28, der hier festgehalten wird – weniger ein Versuch über den moribunden Zustand des Menschengeschlechts. Dazu ist der humoreske Anteil der Ironie zu groß.
Eine ähnliche Adresse an saturiert-selbstsüchtige Machtklienteln bietet auch Club of Rome29. Während sich das System an den Rändern auflöst, kämpft die Altherrenschaft der Regenten um den eigenen Leib.
Wie im Bordell die Matratzen,
War der Limes zerschlissen. Aus Waldböden schossen
Feinde wie Pilze.
[…]
Nur die alten Herren, bewundert, intrigierten mit Lust
Um verpachtete Güter. Ihr großes Spiel
War der Wechsel von Lachen und Weinen; ihr Credo-
„Nach uns die Schlammflut“.[footnote]„Club of Rome“. Grünbein: Nach den Satiren. S. 49[/footnote]
Eine der für das Ancien Regime Roms bedrohlichsten Katastrophen ist bereits in die Gänge geleitet. In Club of Rome wird deutlich:
Unterm Fuß Katakomben, in deren tropfenden Gängen
Fanatiker wohnten, Verdammung kochend30
Das Christentum schwelt an den Grundfesten der römischen Ordnung – und dem Römer des alten Weltgepräges bleibt nicht mehr als eine Stellvertreterbeklemmung:
die Angst vor Barbaren
Sein letzter Zauber.31
In Zusammenhang mit dem Text „Entrüstet am kommenden Tag“32 wird deutlich: Der Einbruch der neuen Religion ist nicht aufzuhalten („Man fragt sich, warum diese Leute / Kein Cicero widerlegt und kein neuer Quintillian“33), Skepsis ist die letzte Zuflucht vor der ,Übernahme‘, welche am Ende ohne größere Widerstände vonstatten gehen wird.
Es ist zu vermuten, dass darin ein Analogieversuch verborgen ist. Der sich anbahnende Systemwechsel vom Polytheismus zum Christentum ist eine frühere ,Wende‘, ein anderer Hierarchiezerfall. Im Fall des Eisernen Vorhangs zweitausend Jahre später zeigen sich ähnliche Symptome: Die Infiltration einer gravitätisch gewordenen Weltordnung, die Überlagerung der alten Schablonen mit den bisherigen Feindbildern, später folgend das schnelle Halsen der Segel.34
Übergangslos führt Durs Grünbein die (vermittelte) Geschichte in die (akute) Gegenwart. Das Ich schaltet um von Antike auf Konsumgesellschaft, zappt vom Panorama Rom in die zeitgenössische Avenue of the Americas35, und führt somit die fernen Historien als ungleich plastischere Historien der Gegenwart fort.
In der Moderne angekommen, sichtet der Autor noch immer die Rückansicht des gesellschaftlichen Systems, verweilt bei „Kistenholzständen, wo die Verkäufer / Mit hageren Händen Spielzeug und Elektronik, / Asiatischen Tand in die Menge hielten“36, sieht mit „Augen, gerändert / Von Sperma und Seifenschaum“37 den Broadway als gleichsam Verdichtung der Neuen Welt und blickt aus und in Limelight – ein erneutes Grau. Bleibt en passant geschlachtete Engel38 und „Namen absurder als Interimsfazit die traurige Erkenntnis:
Überall Tivoli, nirgendwo Rom.39
Grünbein setzt Wahrnehmungen, süffisant unterbreitet, konterkarierend ein, lässt die Erscheinungen das zugehörige System entlarven. Dass das Schöne oft etwas Verlogenes ist, beschreibt folgende Passage aus einer sarkastischen Ode:
Wie beruhigend das Zwitschern
Einer elektrischen Nachtigall, schaukelnd im ewigen Grün
Eines Gummibaums aus demselben Kunststoff Made in Taiwan.40
Der Dichter ,botanisiert‘ bedauernswerte Kulturformen, die auf eine kaum glücklich zu nennende allgemeine Entwicklung verweisen. Mit sprachlichen Formeln, die die Negativitäten des Seins beständig aufgreifen, widerlegt er den Anflug dauerhafterer Romantik.
Es manifestiert sich Lebensekel und Daseinsüberdruß, der – mal als Stoizismus, mal als Ennui – den Ton bestimmt.41 Der Text ist überwiegend dort, „Wo Leerzeit umsonst bei Bewußtsein hält“42.
Nach dem Ende des (literarischen) Flaneurs – in Daguerreotypie Baudelaire43 noch einmal erinnert – ist ein Schatten-Ich geblieben, ein reserviertes Beobachter-Subjekt. Wie die Gepardin, die Grünbein beschreibt, ist das Ich in einer Trostlosigkeit inhaftiert – beide sind sie „Gefangne des Zements“, immer „Millimeter / Vorm Grabenrand“44.
2.5.2 Asche zum Frühstück. Dreizehn Fantasiestücke45
Die dreizehn Gedichte, die Durs Grünbein unter Asche zum Frühstück versammelt, sind mehr oder weniger Beiträge über und gegen eine (nur leidlich tarnbare) Schizophrenie. In stetem Wechsel von monologischem und dialogischem Sprechen gelingen dem Autor profunde Beleidigungen des Ichs – dem eigenen und dem der anderen Vertreter gleicher Gattung.
Dein gebrauchtes Gesicht
Scharf rasiert, das dem Quengeln von Innen höhnt,
Gehört dem Empfangschef, der die Verhandlungen führt.
Hinterm Jochbein verschanzt, hinter funkelnder Brille –
Hat seine Leichenblässe dich nicht einmal gerührt?
Sicher, man kennt sich. Das heißt, ohne Promille
Tritt keiner dem andern zu nah (und auch das besser selten).
Denn vor der schmierigen Wand, konzentriert auf das Gelbe
Im Porzellan, ist man wieder der Andre, wieder derselbe,
Dem im Moment der Entleerung die Klassiker gelten.
,Alles fließt.‘
,Hör auf in den Eingeweiden zu wühlen.‘
,Lebe verborgen.‘ ,Erkenne dich selbst.‘
Doch bevor du hier fortgehst, vergiß nicht zu spülen.46
In den Texten liegt Ironie auf die omnipräsente sapientia hominis – der Mensch ist dem Autor im Kern immer noch Wesen des frühen Holozän. Grünbein holt ihn zurück in die Biologie.
Zeit, sich den Rücken zu kehren. Die Tür
Läßt den Affenkäfig vergessen, das Namensschild Darwins Coup
Den gespreizten Daumen zu deuten, den Pelz unterm Hemd. Und wofür
Sind Schuhe und Hausecken da, wenn nicht, um ihn abzuschütteln,
Den Wächter am Stammbaum
[…]
Unrast, der große Zerstörer,
Macht aus dem Läusesammeln die tausend Verrichtungen täglich.
Zwischen Imbiß und Beischlaf wie oft, fern der Oldoway-Schlucht,
Zeigt der haarige Kerl sich, humpelnd auf Fäusten, und scheitert kläglich47.
Es ist das eine Topik, die Grünbein verfolgte und die er beispielsweise bei Canetti fand, der mit Masse und Macht die „säugetierhaften Urformen“48 demaskierte.
Die Fantasiestücke rechnen ab mit Ambitionen, utopischen Trugbildern und falschen Gelassenheiten. Schonungslos dekonstruiert Grünbein die menschliche Erhabenheit als Kostüm unter dem Deckmantel der Zivilisation:
Streng als Eins lebst du hin. Gewöhnt an die Ordnung der Zehn…
Rechnend nur mit den zählbaren Dingen. Egal wie verschlungen
Laokoon war, – du bist dieser vorwärts rückende Strich
In beengten Straßen, das Komma, fehlplatziert, eines fleißigen Setzers,
Dem die Stadt in Gedrucktes zerfällt, in Tabellen und Spalten49
Vor der Logik zerplatzen die Träume, ist die Welt unnahbar oder verkatert, bleiben die Bücher stumm50.
Das Menschenbild dieser Lyrik zeigt nicht das freudsche Es-Tier, sondern die Summe aus in vielen Alltagen gewachsener Eigenschaften – bei Grünbein als Notlösungen bewertet. Latent sind die Gedichte weiter vom Konzept der Beobachtung des konditionierten Menschen geprägt. Konsequenterweise entsprechen die Texte dann auch Berichten von einer Entgrenzung:
ausgesetzt dem Parcours, diesem Lauf auf verkauftem Boden,
[…]
Beiseite geschafft nach dem Herzinfarkt, mit erkalteten Hoden
Einer, der weiß, wann ein Wort nicht mehr wirkt.51 Grünbein handhabt die Distanz zwischen Autor-Ich („Robinson in der Stadt“52) und Gesellschaft aber weiterhin nicht einseitig und moralinsauer. Es gibt keine Schuldzuweisungen, keine Ausflüchte. Als Doppelgänger der literarisch Sezierten ist das lyrische Subjekt genau so befangen wie diese. Es hat beobachtet, es hat erlebt – sich und das ,Außerhalb‘ gleichermaßen. Die Autopsie stellt im Ergebnis Bedeutungslosigkeit fest – oder Bedeutung, die sich in nichts hinterlässt:
Ich habe Asche gegessen zum Frühstück, den schwarzen
Staub, der aus Zeitungen fällt, aus den druckfrischen Spalten,
Wo ein Putsch keine Flecken macht und der Wirbelsturm steht.
Und es scheint mir, als schmatzten sie, die parlierenden Parzen.53
Die Ernüchterungen sind periodisch, im Allgemeinen wie in der Subroutine des 24-Stunden-Rhythmus’:
Überschaubar geworden, illustriert, fällt es leicht durch den Schlitz
Der entzündeten Lider: Dies protzige Jetzt, dies verstiegene Hier.
Was immer piano beginnt, wie auf Mäusepfötchen und als Etüde,
Dröhnt aus sämtlichen Boxen zuletzt.54
Die erlernten Reflexe legen sich wie eine Schwellung um den Ursprung. Vulgo: Vom Hier und Jetzt ist nichts Tröstendes zu berichten.
2.5.3 Positionsbestimmung in Bezug auf die Moderne:
Die Zyklen Nach den Satiren55 und Physiognomischer Rest56
Der Weg, durch den es das lyrische Ich treibt, ist ein blutiger Brei der Städte57 – in paradoxer Wirkung zugleich aufdringlich und unnahbar. Dem Ich, sich im Schleudergang durch die unerträgliche Trivialität des Seins befindend, bleibt nicht mehr, als ein Register58 zu ziehen, um der indoktrinativen Bilderflut zu begegnen. Die Tragiken, weiß es, gehören zum System. Die Beobachtung von Niederlagen, Opfern und Gesichtsverlusten führt zu keiner Pulsbeschleunigung (mehr) und nicht unbedingt und ganz zur melancholischen Widmung. Nach den Satiren ist hier nach der Schädelbasislektion.
Im Jetzt (der Städte) schlägt das „Herz der Gewalt“59, und posttraumatisch kühl wird die fundamentale Differenz zwischen Ich und Welt via dokumentarischer Detailarbeit immer neu formuliert.
Der zentrale Passus des Gedichtbandes erscheint wie der Anlauf zu einem enormous room. Er versucht, schreibt Michael Braun, „in vier Anläufen ein Pandämonium der Großstadt und der menschlichen Existenz“60. Durs Grünbein entwirft darin eine überzeugende emblematische Verdichtung von Erfahrung im großstädtischen Raum. Zwischen Klavierkonzert und Baustelle, Verkehr und Marktgeschrei trifft das lyrische Subjekt auf sich selbst und die Facetten der Metropole – oft vertraute Leerstellen. Das Humane ist in dieser Lebensunwirklichkeit abgestorben und bestenfalls hinter dem Lächeln des Dienstleistens versenkt. Urbanität übersetzt sich in den Langzeilen des Zyklusses als Kaltblütigkeit, Vergessen und natürlich Anonymität.
Im Handumdrehn ist die Stadt ein hysterischer Traum,
[…]
Durch laute Straßen
Ziehen bewaffnete Kinder zum Duell auf den Schulhof.
Halb verwelkt sind die Rosen, die der stumme Verkäufer
Anpreist wie ein gehetztes Tier. Vor dem bösen Blick
Aus dem Kinderwagen schreckt selbst die Mutter zurück.
An einer Ecke hackt ein Mädchen auf Kohlköpfe ein.
Vielleicht sind sie fremd hier, sie alle, wütend, zur Unzeit
Geboren zu sein, unterm fremden Sternbild.61
Die Texte erweisen sich als Chroniken einer zunehmend selbstverlorenen Gesellschaft. Es herrscht unausgesetzt Krieg, hatte Grünbein schon in Memorandum62 festgestellt. Krieg nicht in politischer Dimension, sondern als innerzivilisatorischer Konflikt, als Krieg des alltäglichen An- und Ausziehens, „der schmerzhaften Nähe / Der beiden Körperhälften, der Ferne von Ich zu Gesicht, / Zu entfliehen hilft nichts. Und getötet, gezeugt, / Wird hier nicht nur aus Armut, zum Zeitvertreib auch.“63
Ein Zwiegespräch zwischen Dichter und Mensch deklariert jenen zum verhinderten Orest, der bewegt wird, aber selbst nichts (sinnfällig) bewegen kann – der sich „selbst beim Ertrinken“ begegnet, „entsetzt vom eigenen Beileid“64. „Hast du gedacht, du entgehst dem“, fragt Grünbein rhetorisch den, der den Schocks der Gegenwart so umfassend ausgesetzt ist. Eine Antwort muss und wird der Fragende nicht geben.
Die Kritik der ,Nebenwirkungen‘ innerhalb der Moderne stellt sich unvergällt dar, ohne blinde Empörung. „Traumlos, mit registrierendem Schritt, – / Einer der Körper, verspannt in Gedanken, beraubt der Reflexe“, charakterisiert Grünbein den eigenen Zustand im Moment der Rezeption. Das beobachtende Ich in der modernen Großstadt ist „einer, der staunend am Rand stand, / Wo die Schatten durchquerter Leben sich sammeln/ In den Ruinen aus schnellem Geld.“65 Er reproduziert reality bites in ausgedehnten Reflexionen. Beinahe droht dabei das literarische Gemälde, sich in der Fülle der Wahrnehmungsreproduktionen selbst zu marginalisieren, an Drastik zu verlieren. Aber immer noch gelingt es, die Texte aus dem von Braun so apostrophierten lyrischen Breitwandformat66 heraus urplötzlich zu klug kalkulierten Präzisionen zu verdichten.
Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,
Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,
Unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,
Wird es schon morgen abstrakt sein, ein weißer Bügel,
Rein wie ein Notenschlüssel aus Draht.67
Die Zeilen, einem Gedicht entnommen, unter dessen Titel ein Drittel des Gedichtbandes subsumiert ist, veranschaulichen die bei Durs Grünbein weiterhin kategorische Verwendung des Themas Vergänglichkeit.
Der Mensch, das zivile Wesen, findet sich hin und wieder zurückradiert auf einen corpus passatus, den vergehenden Körper. Was von ihm bleibt, Ich-frei zuletzt, ist Fundstück für eine spätere Archäologie.
Wie der so nüchtern konzentrierte Text verkünden – mehr oder weniger explizit – viele Gedichte das Tremolo vom Skelett, das den Menschen mit all seinen Regungen überdauert. Was auch immer geschehen mag, am Ende der Geschichte droht anorganischer Rest, „Grinsen, in Kalzium gefasst“68.
Die Lyrik ist Grünbein Mittel für eine historische Archäologie der menschlichen Zivilisation – Ausdruck der Erfahrung der Kontingenz der menschlichen Natur, der Endlichkeit des Daseins.69 Grünbein wählt dafür, so Michael Braun, „die Weltaneignungsperspektive des melancholischen Flaneurs, der beim Blick auf die Polis der Jetztzeit von spätzeitlichen Stimmungen und einem dunklen Finalitätsbewusstsein erfasst wird.“70
Grünbeins anti-utopische Raumerkundungen sind keineswegs radikal – positive Besetzungen sind möglich, quasi als Arrangement mit dem Vorgefundenen. Die Perspektive des lyrischen Subjekts suggeriert die Existenz von Fluchtpunkten, einem nicht vollständig vom rauhen Wind der Wirklichkeit usurpierten Außerhalb.
Das Leben ist ein Ableben, das Ganze desolat, auf einen Hauch Pompeji verweist jede Zeile Grünbeins. Aber es gibt Momente, in denen den urbanen Widergänger „eine Schönheit anfällt zwischen zwei Häuserblöcken“71. Die Autonomie, diese ,Schönheit‘ zu werten, hat der Widergänger nicht. Der Kontext lässt vermuten, dass das Schöne mehr zweck- als idealschön ist.
Besonders die Veneziana72 zeigen, in welch struktureller Ambivalenz73 sich die Stadt einerseits und der Wahrnehmende andererseits befinden. „Gleich geblendet / Von Grazie und Gestank“74, ist der moderne Flaneur zur Zwiespältigkeit verurteilt. Die polare Verschiedenheit der Eindrücke zwingt ihn zu immer neuen, das Dilemma auch verdrängenden Determinationen der Umwelt.
Grünbein lässt, wenn er sie gefunden hat, die Aborte der Menschen nicht so schnell wieder los:
Zweimal am Tag steigt hier die Brühe. Dümpelnd treibt,
Was nach geplatztem Fallrohr aussieht und die Nase
Ein wenig höher heben läßt. Obstschalen, Plastikflaschen, Windeln
Erobern die Lagunen, wie ein Und sich in die Zeilen schreibt
Nach jedem Seufzer vor Fassaden. Dicht wie Efeu, strenge Gase
Um Mauern lassen Staunende vor Meisterwerken schwindeln.
Die schönsten Nebenarme stinken, wenn der Wind sich dreht,
Als seien Tizian, Veronese, Tintoretto Marken
Berühmter Körperdüfte, die von Pest und Sodomie erzählen.75
Auch hier wiederum formuliert Grünbein keinen konsequent moralischen Appell. Die Phänomenbeschreibungen markieren eine vage Erosion; der Verfall ist manifest und als Begleiter des zivilisatorischen Schnelllaufs akzeptiert. Die Stadt als Lebenszentrale ist nicht ,kaputt‘ oder ,hinfällig‘ – sie ist, diagnostiziert der Autor, ungesund“.76
Das Autor-Ich zumindest in den Veneziana ist nicht, wie es anderen Texten zu entnehmen ist, auf Abrechnung bedacht, sondern befindet sich auf versöhntem Ironiekurs. Kritische Schilderungen und humoreske Passagen durchdringen sich und entwerfen ein authentizistisches Panorama, in dem keine Verzauberung geleugnet wird. Die Seitenblicke auf Müll, Hektik oder Verfall sind Hommage an das unkontrolliert Urbane. Eine Janusköpfigkeit, nach der sich Schönes und Hässliches bedingen, wird hingenommen. Das Zivilisationshässliche erscheint mit Karl Rosenkranz als Negativschönes77.
Der Blick zurück gleicht oft der Lektüre eines Röntgenbilds. Der Kern scheint deutlich, die Schemen der Distinktion aber verblasst und vor allem unsauber. Nach den Satiren, das heißt auch, sich selbst im Epilog zu begegnen und sich ertragen zu müssen. Das Ich bleibt Dämon78, ausgetretener Kontinent und Neuland zugleich. Unbekümmertheit ist ein Lichtblick en passant:
Wir verschlungen zum Und.
Eine Nacht lang, dann Schweigen
Der verbliebenen Körper
Wie zuvor – moribund.79
Durs Grünbein ist die Fähigkeit zur scharfsichtigen, prononcierten Ironie nicht verloren gegangen.80 Seine Exkursionen führen aber vermehrt in ausgreifende Protokollierungen. Die ,Perikopierung‘ der Lyrik in Variationen, Impromptus, Grüße et cetera schafft ein ausführliches Diarium, in dem das Gedicht zugunsten eines Supratextes zurück tritt. Damit erliegen die Texte insgesamt dem Phänomen, das sie reflektieren: Die Fluktuation der Bilder ermüdet, wirkt im epischen Psalm der Langgedichte oder der zu Zyklen gruppierten Kurztextstaffeln kontraproduktiv. Der Dialogismus der Einstellungen ist wohl reichhaltig, doch wird kaum mehr als die Rhythmisierung ähnlicher Motive erreicht. Grüße aus der Hauptstadt des Vergessens81 reproduzieren die glitzernde Oberfläche, ohne sie mit poetischer Einbildungskraft aufzubrechen. Die lyrische Analyse stagniert, wo sie auf ähnliche Details angewandt wird. Viele Gedichte scheinen wie immer weitere Karten zu einem schon bekannten Atlas.
Ron Winkler, in Ron Winkler: Dichtung zwischen Großstadt und Großhirn. Annäherungen an das lyrische Werk Durs Grünbeins, Verlag Dr. Kovač, 2000
Am 17.3.1999 Studio LCB mit Durs Grünbein. Lesung: Durs Grünbein; Gesprächspartner: Helmut Lethen und Gustav Seibt; Moderation: Hubert Winkels.
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Helmut Böttiger: Das Ich und seine Verstärker. Nach den Satiren: Verschiedene Stimmen, verschiedenes Rauschen, aber ein Dichter
Frankfurter Rundschau, 24.3.1999
Michael Braun: Müde dieser alten Welt
die tageszeitung, 25.3.1999
Ron Winkler: Nomaden-Ich in verstiegener Welt. Zu Durs Grünbein: Nach den Satiren.
intendenzen, Nr. 5, 1999
Dieter Kief: Menetekel ohne Pathos. Durs Grünbeins fulminante poetische Verortung unserer Welt: Nach den Satiren
Der Standard, 30.4.1999
Ernst Osterkamp: Nach dem Glückskind. Durs Grünbeins neue Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.3.1999
Volker Sielaff: Nervenkunst aus Downtown-Babylon. Unterwegs mit fliegenden Fischen und rauchenden Engeln: Durs Grünbein bereist Alte und Neue Welt
Der Tagesspiegel, 25.4.1999
Dorothea von Törne: Der traurige Blick des Rhinozeros. Durs Grünbeins neuer Gedichtband Nach den Satiren
Die Welt. 19.6.1999
„manches Wort war ein Altersfleck“
– Durs Grünbein oder Die Verarbeitung dessen, allzu früh auf dem Olymp angelangt zu sein. –
Wer mit 33 Jahren den Büchnerpreis bekommen hat, der bekommt so schnell keine anderen Literaturpreise mehr. Überall sagen sie:
Der hat doch schon den Büchnerpreis.
Was da im Jahr 1995 passierte, kam trotz allem, was man über Durs Grünbein sagen kann, zu früh. Aber es schien dennoch unvermeidlich zu sein. Grünbeins Erschrecken damals war ein anderes als dasjenige, das man ein „freudiges“ nennt. Man merkte ihm an, daß er in etwas hineingeraten war, das er nicht mehr ganz überschauen konnte; die beiden Impulse der Genugtuung und des Rückzugs waren manchmal in einem einzigen Satz zu spüren. Und Grünbein spricht viele Sätze, er jongliert mit Sätzen virtuos – er zieht seinen Gesprächspartner unwillkürlich in den Gesprächsfaden mit hinein, und es wird unmöglich, Fragen wie von außen an ihn heranzutragen.
Anfang der neunziger Jahre begann etwas zu köcheln und zu sieden. Es braute sich etwas ganz Neues zusammen. Das neue Deutschland brauchte etwas, das unverbraucht war, unangetastet von den politischen Verwerfungen zuvor – am besten etwas Junges aus dem Osten, das westlich orientiert schien. Durs Grünbein, listig und beweglich, geriet in die deutschsprachige Literaturlandschaft wie weiland der junge Enzensberger. Er brachte sprachliche Virtuosität mit gesellschaftlicher Reflexion zusammen, war medienkompatibel und sprach und entzog sich immer im richtigen Moment. Grünbein konnte mühelos zum Symbol für eine neue deutsche Literatur aufgebaut werden. 1991 erhielt er den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis, 1992 den Marburger Literaturpreis, 1993 den Nicolas-Born-Preis. Sein dritter Gedichtband Falten und Fallen im Jahr 1994 fiel dann auf fruchtbaren Boden. Binnen kürzester Zeit wurde Grünbeins Stimme in den Orbit geschossen, in die sphärischen Dimensionen von Junggenie und Götterglück. In diesem Alter hatten außer ihm nur Enzensberger und Handke den Büchnerpreis bekommen.
Das konnte nur eine Wende bedeuten. Grünbein, der mit enormer Schnelligkeit auf der Klaviatur der Medien zu spielen gelernt hatte, zog sich nach dem Büchnerpreis 1995 spürbar zurück. Fünf Jahre ließ er sich Zeit mit seinem nächsten Gedichtband. Und dieser trägt einen durchaus mehrdeutigen Titel: Nach den Satiren. Das ist ein durchaus auch biographisches Augenzwinkern. Der Titel ist eingebettet zwischen mehrere Bedeutungsebenen, die Zeit der altrömischen Satiren ist der Ausgangspunkt. Der womöglich allzu juvenile Juvenal beschrieb damals Roms Hochzeit, die Völle, die Sattheit, das Rauschhafte, den Moment kurz vor dem Umkippen. Nach den Satiren, so schreibt Grünbein in den seinen Band lyrisch abschließenden „Anmerkungen“, da „kamen die üblen Schatten zurück, die Sarkasmen… Überall Knochen und Rülpser, und die schöne Zeit war vorbei.“
Was war die schöne Zeit?
1989 noch war Grünbein beim Darmstädter Literarischen März im Wettbewerb um den Leonce-und-Lena-Preis für junge Lyrik vertreten, und kaum einer nahm Notiz von ihm. Die drei Preise erhielten von den zwölf eingeladenen Lyrikern und Lyrikerinnen andere. Und 1991 war Grünbein zum Klagenfurter Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis gereist – er landete unter ferner liefen. Das Bild des „Panzers“, der zugleich Schutz und Gefängnis ist, zog sich durch seinen zwischen Essay und poetischer Prosa changierenden Text. Wie dieser dann fortlaufend neue Bilder entwickelte, war recht ungewohnt, und man hörte weg. In Erinnerung blieb nur die stoische Beharrlichkeit des Jurors Stefan Richter, der, obwohl Grünbein längst aussortiert worden war, bis zum Schluß, ohne taktisches Geplänkel, Grünbein als seinen ersten Preisträger nannte. Noch war die Aura um Grünbein nicht da.
In Berlin jedoch, in den Zerfallsprozessen der Hauptstadt der DDR, schien der Grünbein-Ton Ausdruck einer neuen Generationserfahrung zu sein: der letzten DDR-Generation, die noch nicht ganz in die DDR hineingewachsen war, sich aber durch das Gefühl der Geschichtslosigkeit in der Zeit nach 1989 doch von der DDR geprägt zeigte. Für die Vernetzungen am Prenzlauer Berg, für die Enge des literarischen Diskurses dort war er zu spät gekommen, nur als Randerscheinung taucht er zum Schluß in der inoffiziellen Zeitschriftenszene auf. Er schien keine Vergangenheit zu haben, nach 1989 konnte er deswegen ein Inbegriff des Neuen werden.
In Grauzone morgens, 1988 als Grünbeins Debüt erschienen, geht es um die Industrielandschaften um Dresden, um die Fabrikschlote und die endlosen Morgen, in denen keine Bewegung herrscht. Hineingeboren wurde er nicht mehr, wie es der Gedichtband Uwe Kolbes ein knappes Jahrzehnt vorher beschrieb, in ein vor allem durch gesellschaftliche und politische Fragen definiertes Lebensgefühl, sondern in eine Leere, die weitaus mehr umfaßte als fehlende gesellschaftliche Perspektiven. In Grünbeins Titelgedicht wird ein „Weg durch die Stadt“ beschrieben, „heimwärts / oder zur Arbeit (was macht das schon)“ und es endet:
Und es ist diese Zähigkeit (zäh:
WIE DAS DEUTSCHE SAGT), daß sie schräg
gegen den Kopfschmerz gehn und das
Rauschen der Filter-
anlagen in uns.
Das lyrische Ich ist hier bloß noch ein Zitat. Es geht um das Rauschen, es geht um den einen sich ständig unmerklich verändernden Grauton. In dieser Langsamkeit, in diesem Stillstand der Zeit sammelt sich aber etwas an. In einem Gedicht beschreibt Grünbein die Tage in der Dresdner Bibliothek, wo sich der Aufenthalt schon allein deswegen lohnte, weil man dann zu Hause nicht heizen mußte, und in dieser Dresdner Bibliothek verwandelte sich eine entfernte, synthetisierte Welt dem Körper an – ostasiatische Weisheiten, moderne Ingenieurwissenschaften, Dante. Abgekoppelt von der ständigen Frühjahrs- und Herbstproduktion aktueller Gegenwartsliteratur.
Die Bilder, die Grünbein der Dresdner Leere gegen Ende der DDR abgewann, waren bedrängend. Hier wurde nichts in ein bestehendes Gedankensystem eingebaut, wie man es in der DDR gewohnt war. Und am Ende eines Gedichts heißt es einmal:
,Viertel nach 2…‘, und ,Kein Traum in Aussicht…‘, nur
diese ziellose Müdigkeit. In New York
hättest du todsicher jetzt den
Fernseher angestellt, dich zurückgelehnt blinzelnd
vom Guten-Morgen-Flimmern belebt.
Die Sehnsucht nach New York, die hier in der späten DDR bei einem Mittzwanziger entsteht, ist von einer romantischen Sehnsucht ziemlich weit entfernt. Sie hat aber viele Verbindungen zu dem naturwissenschaftlich aufgeladenen, „kybernetischen“ Weltbild, das die DDR in ihrem ideologischen Überbau produzierte. New York weniger als Verheißung einer Freiheit als allumfassende Möglichkeit, sondern als Einlösung eines technisch-industriellen Versprechens – die Aufhebung des Gefühls, sich als Individuum nicht fassen zu können, auf einer zivilisatorisch und technologisch viel höheren Stufe.
Grünbeins Vater hat Flugzeugtechnik studiert und arbeitete in Dresden als Ingenieur für Bordelektronik, hat „mit deutschem Know-How die Elektronik der Russen verbessert“, wie der Sohn spöttelt. Und Grünbeins Kindheit und Jugend in Hellerau, am Stadtrand von Dresden, der „Gartenvorstadt“, war von einer ganz anderen Natur geprägt als von jener, die etwa durch Peter Huchel in der DDR lyrisch verdichtet wurde. „Mein Garten des Theophrast“, sagt Grünbein und spielt damit auf ein programmatisches Huchel-Gedicht an, „lag hinter unserem Haus“ – es war eine Landschaft aus Kiefern und Sand, mit dem „Plateau eines Müllberges“, das von der sowjetischen Besatzungsarmee als Manövergelände genutzt wurde: „ein riesiger Abenteuerspielplatz“. Grünbeins Kindheit fand in dieser „okkupierten Landschaft“ statt, die Wahrnehmung war auf die Kiefernlandschaft und die in ihr steckenden Patronenhülsen gleichermaßen gerichtet. Einmal, im Alter von etwa zehn Jahren, geriet Grünbein in ein scharfes Manöver der Russen, das Sichducken zwischen den Fronten – ein Kernerlebnis.
Während für Gleichaltrige im Westen das Jahr 1989 nicht viel mehr als ein Punkt in einem relativ gleichförmig dahinfließenden Kontinuum war, bedeutete es für die auf dem Territorium der DDR Ansässigen einen existenziellen Einschnitt.
Und daraus entstand auch ein unvergleichlicher literarischer Stoff. In Grünbeins zweitem Gedichtband Schädelbasislektion schlägt sich der Umzug vom stillstehenden Dresden in die aufbrechende Metropole Berlin nieder: Die flirrende Großstadt, das fluktuierende Bewußtsein treten in den Vordergrund. Das Ich entsteht, durchschossen von sich ständig verändernden Strukturen, immer wieder neu: keine Einheit mehr, die in technologisch determinierter Welt das auf sie Einstürmende noch bündeln könnte. Doch entgegen dem modischen Verhackstücken in linguistische Kleinsteinheiten, dem sprachmusikalischen Slapstick, wie es auf dem Prenzlauer Berg und bei anderweitigen selbstreferenziellen Performancelyrikern zum Mainstream junger Lyrik wird, gegen die Beliebigkeit setzt Grünbein ein Programm. „Was du bist steht am Rand / Anatomischer Tafeln“, heißt eine zentrale Fügung in Schädelbasislektion. Er entwickelt eine Poesie abseits des lyrischen Ichs, die manchmal aufregend flackernde, neue Bilderwelten hervorbringt. Grünbein schlägt Funken aus dem Zerfall der DDR, der festgefügten Ordnungen. Das Chaotische, das Auseinanderstieben der Subjektivität ist bei ihm von einer anarchischen Lust. Die Wahrnehmungen einer schon längst durchgetexteten Umwelt setzen sich neu zusammen. Ähnlich wie bei Gottfried Benn, nur mit einem gänzlich neuen Instrumentarium und dem Blick des Nachgeborenen, wird der Wissenschaftsduktus zu Poesie.
Ein Höhepunkt ist der Zyklus „Variation auf kein Thema“ im dritten Band Falten und Fallen. Er besteht aus einem kalten Blick auf den Alltag, aus der unmittelbaren Nahperspektive, wo die kleinsten Details in Großaufnahme erscheinen und übergeordnete Bezüge und Sinnzusammenhänge ausgeschaltet werden: der Mensch als ein zoologisches Wesen, verloren und hineingestellt in die Metropole, in die durchvisualisierte Welt, ein winziger Teil der allgegenwärtigen Verkehrsströme. Daß sich die Subjektivität auflöst und im literarischen Text neu zusammensetzt, ist bei Grünbein vor allem eine biographische Erfahrung. Er stellte einmal fest:
Ich bin sentimentaler. Die im Westen sind viel kälter.
Seine DDR-Sozialisation führte zu einer besonderen Dialektik von Kälte und Wärme, in der lyrischen Beschwörung taut Sibirien auf: „Die im Westen, die sind Kühlschrank – ich bin Filz, bin Fettkloß“, er sieht sich zu einem Künstler wie Joseph Beuys hingezogen, der von sich sagte, er sei ein Wiedergänger des Ostens in der Westkunst.
Die frühen Bilder vom Dresdner Stadtrand hinterließen bei Grünbein eine „Affinität zu den Russen“, eine „innere Raumvorstellung“, die vom Bewußtsein bestimmt war: „hier beginnt schon Sibirien!“ Von diesen Wurzeln her erklärt er die innere Verwandtschaft, die er zu Dichtern wie Ossip Mandelstam oder Joseph Brodsky fühlt: die Sehnsucht nach Kultiviertheit, nach westlicher Kultur, die sich nur philologisch konkretisieren läßt. Die DDR war in besonderem Maße eine Schnittfläche zwischen der Sowjetisierung und dem bürgerlichen Ich, eine spezifische „Mischung aus Manfred von Ardenne und Ulbricht“, wie Grünbein in seiner typischen improvisierenden Weise sagt. Und hier liegt auch der Grund für eine bei ihm maßgebende Art von „Notwehr im Osten“. die „Stabilisierung durch Wissenschaft“.
Eine früh prägende Lektüre war für Grünbein Victor Klemperers LTI, die detaillierte Analyse der Sprache des Dritten Reiches. In der DDR wurde dieses Buch unter der Hand als Analyse von totalitärer Sprache überhaupt, als heimliche Selbstentlarvung der DDR gelesen. Grünbeins „rationalistische Opposition“ hatte nichts mit Moral, mit einer Betonung von emotionaler Subjektivität zu tun, sondern er wollte „mit den Augen des Ingenieurs schauen: Warum funktioniert das System nicht?“ Dieser frühe Blick auf das Funktionieren, der Blick des Ingenieurs kann assoziativ durchaus mit dem „Sibirischen“ zusammengebracht werden, das Grünbein als prägende Heimatwahrnehmung darstellt. Das Sowjetische, bis hin zu Stalins Begriff des Dichters als „Ingenieur der Seele“, kannte nicht den Fixpunkt einer bürgerlichen Subjektivität. Was wir darunter verstehen, tauchte in den erkenntnistheoretischen Schriften höchstens als „Dialektik von Individuum und Gesellschaft“ auf. Das entspringt einer Theorie vom neuen Lebewesen, das tatsächlich auf die Funktionsbindung innerhalb der Gemeinschaft ausgerichtet ist, als Rädchen im Getriebe. Das Ich, die die Erfahrung ordnende Subjektivität kommt bei Grünbein allenfalls als ironisches Zitat vor: „wo du / nicht bist, da fegt dieser Wind / über die trockenen / Hochlandsteppen des Nordiran oder / transsibirisch / für ein unhaltbares Ich“ – so heißt es schon in Grauzone morgens. Und in den Drei Ostrakoi, die ironisch mit den Formen der griechischen Tonscherbenschriften spielen und parodierte Originaltexte mit Anmerkungen aus der Wissenschaftssprache kombinieren, taucht einmal ein „(Ich)“ auf, das so kommentiert wird:
Wahrscheinl. später eingefügt, hier unklar wegen der Vermischung anat. und psych. Anschauungen, vgl. Psychopathologie des Chirurgenwitzes.
Das Ich als Chirurgenwitz: Grünbein konfrontiert hier ironisch seine Herkunft aus sibirisch anmutenden Abenteuerspielplätzen und sowjetischen Ingenieursperspektiven mit den Rezeptionsmustern der spätbürgerlichen Moderne. Auch für ihn gilt, was er als wesentlichen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen definiert: Das „aktive, handelnde Ich“, das im Westen der Ursprung aller Dinge sei, komme im Osten nicht vor. Das „DDR- Jammer-Ich“, ein kläglicher Niederschlag davon, könne seine Herkunft aus den „Kommunalwohnungen“ nicht verleugnen, in der DDR sei der einzelne „als Gemeinschaftstier konditioniert“ worden. Daß hier kein „bürgerlich handelndes Ich ausgebildet“ werden konnte, erklärt für Grünbein die Schwierigkeiten des Zusammenwachsens von Ost und West, es erklärt aber auch, warum in seinen eigenen Texten andere Koordinatensysteme herrschen als die, die von einer vorausgesetzten Subjektivität entwickelt werden.
Im Osten habe es nicht „diese große Sirene der Psychologie“ gegeben, sagt Grünbein. Sein Modell ist ein anderes:
Wahrscheinlich hat jemand wie Pawlow, mit seiner Reflextheorie, für den gesamten Osten ein sehr viel besseres Beschreibungsmodell geliefert, als es Freud getan hätte. Denn Freud und seine ganze Introspektion gehört halt wirklich zum bürgerlich potenten Ich oder auch zum impotenten, wie auch immer.
Grünbein ist zwar einer, der „mit besonderem Sarkasmus auf die Konditionierungen der DDR-Bürger“ blickt – auf der Leipziger Buchmesse bekannte er 1993 vom Podium aus:
Ich kann keinen Ossi mehr jammern hören!
Mit Nostalgie hat er nichts zu tun, aber er erkennt dennoch einen „sentimentalen Punkt“, der mit ihm als DDR-Bürger zu tun hat:
Unter anderem ist es der, daß ich Heiner Müller interessant finde.
Müllers Rekurs auf die Frühmoderne ist derselbe Vorgang, den Grünbein als Ausweg aus seiner sozialistischen Genese gesehen hat, durch die er sich „mit den Kirgisen verwandter“ fühlt „als mit den Belgiern“.
Dieser Rekurs auf die Frühmoderne begann schon mit Grünbeins Arbeit mit den Autoperforationsartisten im Dresdner Untergrund, früh entdeckte er den russischen Konzeptualisten Ilja Kabakow für sich. Das Aufbrechen der Künste in der frühen Sowjetunion zitiert Grünbein durch seine Texte und setzt diese Entwürfe neu zusammen: Die subjektive Wahrnehmung ist nicht der Ausgangspunkt des lyrischen Prozesses, sondern sie stellt sich durch die Sprache erst her. Hinterrücks ergibt sich eine subjektive Grundierung, die dem lyrischen Programm eine eigentümliche Farbe verleiht. Das Sekundäre verschwindet und entläßt eine Sprache, die unverwechselbar ist und poetisch:
Überall gab es Tatorte, graue Regionen. Ein kalter Atlas
Wuchs mit der Kopfhaut über Nacken und Stirn,
Mit jedem Gesichtsnerv, vom Regen erregt,
Bis man das Rauschen von innen erkannte: den Osten,
Die bleiernen Flüsse, die Ebenen, diese Erde im Dauerfrost,
Alles, was groß war, verloren und weit bis nach Wladiwostok.
Im Zerfallsprozeß der DDR, in der Generation der sozialistischen Spätlinge, konnte dem unhaltbar gewordenen bürgerlichen Ich etwas anderes entgegengesetzt werden, etwas, das viel stärker ist als postmoderne Spielereien. Daß Grünbein als erster „gesamtdeutscher Dichter“ apostrophiert wurde und somit einen Paradigmenwechsel anzeigte, nach dem junge deutsche Autoren plötzlich wieder wichtig wurden im literarischen Diskurs – das hat damit zu tun. So einer wie er wurde fast händeringend gesucht. Man stürzte sich von staatstragender Seite auffallend schnell auf ihn, der in der Subkultur am Prenzlauer Berg Installationen und Performances gezeigt hatte und dem eigentlich ein Ruch von Subversion anhaften mußte. Aber er konnte gar nicht erst in den Verdacht geraten, etwas mit den 68ern zu tun zu haben.
Durs Grünbein zog in den Westen. Auf die typische Prenzlauer-Berg-Unterkunft folgte das Wohngemeinschaftszimmer in der Westberliner Kurfürstenstraße, und schließlich kam der Umzug aus einer zwar sanierten, aber trotzdem Neuköllner Wohnung in eine großbürgerliche im zentraleren Westen, mit dem fließenden Raumgefühl des Berliner Zimmers. Grünbein hat nichts von der DDR-Bodenhaftung, wie sie bei vielen Daheimgebliebenen anzutreffen ist: So früh wie möglich hat er die neuen Erfahrungen des Westens gesucht und sie genossen, eine Reise in die USA war das Wichtigste, was er zunächst unternahm, und er bewegt sich auf den einschlägigen Parketts und Partys so, wie wenn er schon immer dazugehört hätte. So einer mußte in den Orbit geschossen werden.
An dem Band Nach den Satiren mußte, nach der frühen Erhebung des Autors in den Olymp, aus betriebsspezifischen Gründen zwangsläufig herumgemäkelt werden. Grünbein ließ fünf Jahre verstreichen, um die frühe Kanonisierung zu verarbeiten. Der Band stellt verschiedene Reflexionsebenen, Verdichtungsgrade, Wahrnehmungsintensitäten nebeneinander – „… und manches Wort war ein Altersfleck.“ Der Kern liegt im Rekurs auf Juvenal, auf die Populärkultur aus der Antike. Die Zeit der Satiren bekommt wie von selbst eine schillernde gesellschaftliche Dimension, und es wird auch ein Spiel mit Erscheinungsformen der Gegenwart. Grünbein schlüpft an zentralen Stellen in die Sprache und die Metrik der antiken Texte. Auf scheinbar disparate Weise kommen hier subjektive und objektive Themen zusammen: Selbstvergewisserungen, die mit dem bloßen Körper, mit Zeiterfahrung, mit dem Herkunftsort Dresden und dem Aufenthaltsort Berlin sowie Exkursionen in diverse Texte zu tun haben. Den Impuls bilden weniger lyrische Momente oder Einzelbilder, sondern Gedankenspiele, poetische Theoreme, die langsam verdichtet werden; manchmal herrscht fast ein erzählerischer Gestus vor. Klassische Versmaße, antike Rhythmisierungen dienen dabei als Stütze. Doch Grünbeins Umgang mit der Tonlage von Altvorderen wird nie zum Selbstzweck. Fluchtpunkt ist immer die Gegenwart, zeitgenössische Wahrnehmung und tradierte Sprachmuster gehen unmittelbar ineinander über; es ist eine Leichtigkeit in diesem Spiel, bei dem das erfahrende Subjekt des Schreibens keine Leerstelle bleibt, sondern eine Möglichkeit gefunden hat, von sich selbst zu sprechen.
Im Zentrum des Bandes steht der vierteilige titelgebende Zyklus „Nach den Satiren“. In langzeiligen, rhythmisierten Passagen wird die poetische Grundsituation, der Zustand „nach den Satiren“ aus römischer Zeit, auf verschiedenen Ebenen der Gegenwart durchgespielt. Dabei spielt die reale Geschichte, die reale Erfahrung der Zeit eine ausschlaggebende Rolle:
Und man sah Mauern wachsen, untertunnelt, Mauern fallen,
Die Stadt, den Riesenspielplatz, unter den Vier Mächten
Zerstückelt und auf hellem Sand verhärten
Zu transsibirischem Beton.
Die strenge, rhythmisierte Form, der Suadenton, die klassischen Einfassungen ermöglichen es Grünbein, unmittelbar von Nahaufnahmen auf die Totale überzugehen, von der Sprache der aktuellen Tageszeitung in die Sprache antiker Autoren zu wechseln, das Alltagsparlando von heute mit dem überkommenen hohen Ton von gestern zu konfrontieren. Gegenüber dem manchmal hochfahrenden, die Metaphorik der Naturwissenschaften fast provokativ ausstellenden Ton der beiden zurückliegenden Gedichtbände Grünbeins hat Nach den Satiren einen nachgerade gelassenen, abgeklärten Duktus, eine Ironie auch dem eigenen lyrischen Gestus gegenüber. Einmal etwa ist die Rede von einem lyrischen Doppelgänger:
Er verkaufte mir, was er für Einsicht hielt:
Daß wir nur kennen, was ein Ich uns öffnet, diese Lichtung,
Auf der sich alles abspielt und Bedeutung wird, Girlande
und Grünbein spinnt den Faden, am Schluß des Bandes, in den „Anmerkungen“, weiter:
Apropos Ich. Eine Silbe, die hier wie überall auftaucht und immer wieder erklärungsbedürftig scheint. In seinen Studien über Poe sagt Baudelaire: „Seine erzählerische Methode ist denkbar einfach. Mit zynischer Einförmigkeit mißbraucht er das ich.“ Vielleicht hatte Freud ja recht, der vom Helden aller Tagträume sprach. Daran, daß es unverletzlich sei, würde man es mühelos wiedererkennen. Seine Majestät, das Ich. Was aber, wenn sich, wie oft im Gedicht, jedesmal ein Anderer dahinter verbirgt? Ein altes Ich, ein neuer Ton – was weiß die Stimme schon davon?
Wie hier derselbe Gedanke vom Gedicht hinüber in die Anmerkung springt, vom Poetischen zum Räsonierenden, ist typisch für Grünbeins Umgang mit der Sprache: Die Rhetorik, die These und das Zitat verschmelzen mit der lyrischen Suggestion, es entsteht ein einziger Assoziationsraum, der Bewußtsein und lyrisches Empfinden nicht mehr scheidet. Doch es ist einigermaßen bezeichnend, daß die sich so belesen gerierende Anmerkung in einen Paarreim flüchtet, der scheinbar Bennsche Ausmaße annimmt.
Ein altes Ich, ein neuer Ton – was weiß die Stimme schon davon?
Das klingt wie eine Parodie, eine augenzwinkernde Wiederaufnahme jenes sich cool und abgeklärt gebenden Spiels mit Sentiment und Abendland aus den fünfziger Jahren. Das Ich, das sich so in Frage stellt, will sich nicht aufgeben. Es ringt in einer Klasse für sich, in der Benn-Klasse, in der Schwergewichtsklasse des Ich. Bewunderung und ironische Distanz sind für Grünbein dasselbe.
„Herzmuskelfleisch ist das Wasser hier, fest im Griff alter Mauern, / Bewegt unter Krämpfen, aus weiter Ferne, unbeständig, nie diaphan“: so beginnt ein Abschnitt im Zyklus „Veneziana“. Naturwissenschaften, Antike, Dante. Die Zeiten und die Diskurse schießen ineinander. Wenn dieser Lyriker tradierte Formen übernimmt, wirkt das nicht angestrengt, nicht starr und bedeutsam, sondern elegant und voller Volten. Der Reim oder das Metrum sind hier nicht der Ausgangspunkt, keine klappernde Geißel, man merkt es manchmal kaum: Oft schleift Grünbein die Ränder, macht einen Break und betont die Blue notes. Einerseits rekurriert er auf subjektive Erfahrungen, andererseits spielt er behende damit, skelettiert, reduziert das Ganze auf den Knochenbau. Das setzt immer neue Langzeilen frei, immer neue Reimschemata und Hebungen und Senkungen. Grünbein hat sich viele Voraussetzungen dafür geschaffen, weiterzusprechen, auch „wenn die Mikroben drohen“. Gegen Ende seines Bandes spricht er sich zu, in der Hälfte des Lebens angelangt zu sein, eine Hölderlin-Linie passiert zu haben:
Es ist Halbzeit, mein Lieber.
Aber um die Ecke kommt schon wieder etwas Neues.
Die Antike, vielleicht angeregt, aber letztlich doch unabhängig von Heiner Müller, ist für Grünbein der Fluchtpunkt nach dem Büchnerpreis geworden. Dabei geht es zunächst um „Archäologie“, um „einen Vorstoß ins Unbekannte, Vergangene der Zukunft“, wie er es nennt. Den Antrieb bildet der Wunsch, „ein winziges Fenster in diese kurze Lebenszeit zu reißen“ – ein Fenster, das im Lauf der Zeit immer sichtbarer wird. Durs Grünbein wird so schnell keinen Literaturpreis mehr bekommen. Aber es hat sich etwas geöffnet.
Helmut Böttiger, aus Thomas Kraft (Hrsg.): aufgerissen. Zur Literatur der 90er, Piper Verlag, 2000
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


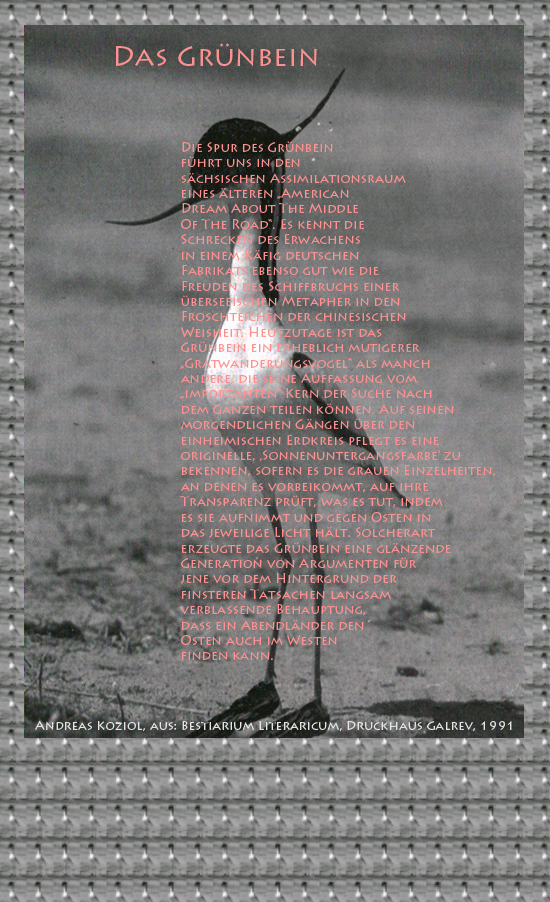
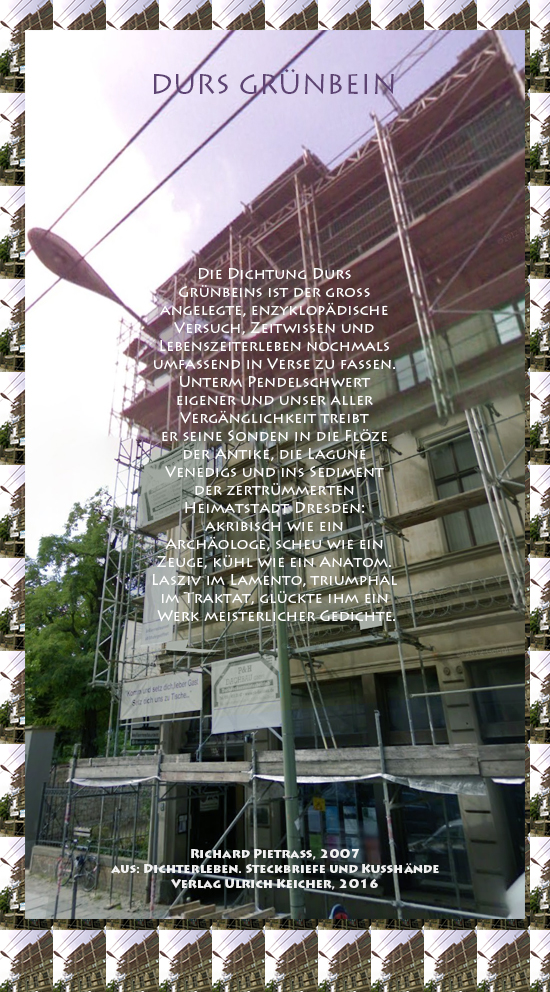












Schreibe einen Kommentar