Durs Grünbein: Schädelbasislektion
Alt siehst du aus, young dog. Atomzeitalt.
Neugierig morgens, schwer von Rest-Rationen
Bildsatter Träume streunst du in den Tag,
Gebremst vom Autostrom im Smog, den Sprachen
Gedruckt auf breitgewalztem Holz, dem Brei
An dem nicht zu ersticken es viel List braucht.
Denn was du sein sollst, gibt dein Phänotyp
Der Fetisch, jedem sichtbar, vor: ein Deutscher.
Weiß… männlich… mittelgroß… brünett.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa aDas reicht
Vielleicht für siebzig Jahre Kampf ums Dasein.
Wenn’s hochkommt, hält Geduld den Rotz zurück.
Doch droht mit Schlimmsten immerhin auch dir
Die Dummheit,
aaaaaaaaaa aadas Gesumm der Hirnmaschine
Von der es heißt, sie produziert sich selbst.
Inhalt
Mit seinem Gedichtband Grauzone morgens überraschte im Jahr 1988 Durs Grünbein aus Dresden – aus der damaligen DDR. Ein „Hineingeborener“, der von seinem Land sich nicht mehr poetische Aufbauhilfe abverlangen ließ, zog mit scharfgeschnittenen Moment-Aufnahmen aus dem „Ghetto einer verlorenen Generation“ in den Metropolen des Sozialismus seine erste Bilanz – mit nüchternem Blick „in Augenhöhe“.
Die Tagträume in den Rissen des Alltags von damals sind benennbar geworden. Illusionslos und radikal hat Durs Grünbein in Schädelbasislektion seine Gedichtsprache fortentwickelt.
Zeitgenossenschaft im Dialog mit der Tradition ist in den Gedichten von Durs Grünbein höchst gegenwärtig: Seine lyrischen Lektionen zur Jahrtausendwende haben die poetischen Gewißheiten an Ganglien und die Normen der Gereimten an Neuronen abgetreten. Die Gedichte in Schädelbasislektion reagieren auf den Zerfall der Sprache in die geschwätzige Phrase – „zu jeder Schandtat bereit“ −; auf den schmerzhaften Verlust des seiner nicht mehr selbst gewissen Ich; auf mörderische Großstadteinsamkeit und die Zerstörung der sozialistischen Ikonen. Die Gedichte von Durs Grünbein sezieren die Auflösung des modernen Ich.
Grünbeins armer Hund
Wohl wahr, hätte Eva nicht so kraftvoll zugebissen, wir säßen noch heute als glücklich grinsende Nackedeis im Garten der Lüste. So aber blieben nur die Götter nackt und ihre der Urmasse entkrochenen Erdenwürmer schwer mit Fluch beladen: Die Denkkappe wuchs zum Hirnerweichen und mit ihr die moderne Erkenntnis, daß Elysium im Eimer und Ich ein anderer ist. Seit den Diagnosen vom heillosen Sprung in der abendländischen Bewußtseinsschüssel freilich kommen Drogisten und Dichter immer besser ins Geschäft; denn „potente Gehirne“, so Doktor Benn ad usum proprium, „stärken sich nicht durch Milch, sondern durch Alkaloide“. Für den Prenzlauer Berg Poeten Durs Grünbein, Jahrgang 62, gehört die Kommunikation mit den literarischen Vorfahren zum täglichen Arbeitspensum. Mit ihnen teilt er nicht nur die Vorliebe für gewisse Stimulanzien („Ohne Drogen läuft nichts Hier im Irrgang der Zeichen“), sondern mehr noch jenes neuzeitliche Leiden, das „am Bewußtsein leiden“ heißt.
Schädelbasislektion ist Grünbeins zweiter Gedichtband. Als der Autor 1988 mit der Sammlung Grauzone morgens debütierte, zeigten sich seine Poeme noch „in Augenhöhe“ des sozialistischen Alltagsgeschehens. In glasscharfen Momentaufnahmen registrierten sie die Aporien einer Generation, die der SED Staat in die urbane Subkultur getrieben hatte. Aus und passe: „Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt. Wehleid des Wartens, Langweile in Hegels Schmalland Vorbei wie das stählerne Schweigen Heil Stalin“ („121189“) Doch wo das Alte endete, beginnt seither nichts Neues: „In den verödeten Kanälen treibt Nur die Erinnerung an Schlimmeres Durch das Gedicht „In Tunneln der U Bahn“ schwappt „die Gedächtniswelle aus 1000 verpaßten Gelegenheiten“, und zur akuten Lage der Stagnation bleibt nur die Meldung: „Vorm Fernseher die Toten“. Die Gegenwart führt in keine Zukunft, sie staut bloß die Vergangenheit. Grünbeins lyrische Lektionen, bald mit giftigexpressivem Pathos vorgetragen („Der kranken Väter Brut sind wir“), bald in düsteren Farben kunstvoll an die Wand gemalt, sind Mitteilungen eines Poeten auf der Flucht. Der Wirklichkeit und einer verluderten Sprache („zu jeder Schandtat bereit“) längst überdrüssig, drängt es ihn aus den ordinären Denk- und Wahrnehmungsrastern hinaus und tief hinab in atavistische Erlebniswelten, ins Reich der entregelten Sinne, wo „Fürst Unbewußt“ regiert und aus imaginären Sümpfen das Blubbern der Urbiologie steigt. Fremde Gegend, neue Lektionen: „dieses Ich. Besser Es läge noch immer vor seinem Schlag aus der Art Glücklich im Koma“.
Tut es aber nicht. Zurück vom Trip an den „Schlammgrund“ und bei Verstand ist es wieder das „metaphysische Tier“, eingepfercht „diesseits von Raum und Zeit“. Das lyrische Ich ist zerrissen: hier vom eigenen Bewußtsein bewacht, dort für kurze Momente dem Ich Zwinger entronnen — lange genug indes, um sich selbst zum Rätsel zu werden: „Was ich hier soll, ich weiß es nicht, bin“.
Waren Grünbeins Debüt Gedichte noch Spiegelungen einer äußeren Wirklichkeit, so ist aus dem Großstadtflaneur nun ein Grenzgänger im Niemandsland geworden, unterwegs zwischen Rausch und Realität, Mythos und Misere. Ein armer Hund auf dem „Hyänengang hungriger Poesie“.
Michael Kohtes, Die Zeit, 6.12.1991
War da irgendein Mythos?
− Porträt des Künstlers als junger Grenzhund: Durs Grünbeins Lyrik. −
Es ist nichts in den Schubladen. Keine in der Hoffnung auf bessere Zeiten geschriebenen Manuskripte, keine zurückgehaltenen Texte, keine versteckten Bücher sind bislang in der ehemaligen DDR gefunden worden. Schriftsteller, auch die weltfremdesten unter ihnen, wollen Öffentlichkeit. Daß einer von ihnen für eine ferne und vielleicht nie erreichbare Zukunft schreibt, ist eine fromme Lüge. Das Buch, das die Leidensgeschichte jener vierzig Jahre erzählt, ist in diesen vierzig Jahren nicht geschrieben worden.
Hier liegen Gedichte vor, die jetzt entstanden sind. Sie reagieren auf die Wende des Jahres 1989. Aber in ihnen kommt erstmals eine Vergangenheit zu Wort, die heute noch wie ein böses Geheimnis wirkt. Ihr Verfasser ist der 1962 in Dresden geborene Durs Grünbein. Er ist Angehöriger einer Generation, die nichts anderes als die ummauerte DDR kannte. Grünbein äußert sich in dem Augenblick, in dem das hermetisch geschlossene System zusammenbricht. Seine Gedichte artikulieren den Übergang, aber auf eine Weise, als blicke man aus ferner Zukunft wie auf ein archäologisches Fundstück auf ihn zurück. Erst so wird das ganz und gar Einzigartige, das historisch Einmalige dieser Biographie kenntlich. Wie lebte man inmitten einer eingesperrten Gesellschaft? Wie wuchs man auf an einem Ort, zu dem es, bei Todesandrohung, keine Alternative gab? Wie bildete sich ein Bewußtsein, das immer wieder an eine wirkliche Mauer stieß? „Schädelbasislektionen“, „Gehirn“, „Nervenbahnen“, „Hirnmaschine“, „Schädelnaht“ – immer wieder tauchen in diesen Gedichten zerebrale Motive auf. Das Denken bildet sich auf seinen organischen Ursprung zurück: von ihm bleibt am Ende nur Gehirn zurück und von den Gedanken das „Gesumm der Hirnmaschine“. Grünbeins Gedichte sind selber Ausdruck eines solchen Rückbildungsprozesses. Die Stimme in ihnen erzählt von einer umfassenden Desillusionierung. Nicht Ideen und Gedanken, sondern die Nutzlosigkeit des Denkens selber ist ihr Thema. Worüber sie reden, ist einfach: wie man es schaffte, in dem verriegelten Land nicht wahnsinnig zu werden. Weil Grünbein diesen Prozeß nicht als abstrakten Vorgang, sondern als Erfahrung seiner DDR-Existenz begreift, gewinnen seine Texte eine bestechende Intensität. Es ist, als spräche der Verfasser aus einer unvorstellbaren Enge heraus, in der er nur noch den Raum zwischen Gedanken und Schädeldecke auszuloten vermag:
Versprich mir, daß du dich versprichst
Im zerebralen Rülpsen, Sprache
Die sich an Knochen bricht wie Echolot.
Blind vor Kontrolle herrscht im Kopf,
Fraktur, die Rede gegen Wände.
Wo Nichts und Niemand spiegelbildlich
Wie durch ein Fernrohr sich beglotzten
War das „Ich denke“ nur ein Bluterguß.
Das ist die Beschreibung einer immer wieder scheiternden Grenzüberschreitung. Es ist aber zugleich auch, und darin liegt Grünbeins Kunst, die ganz realistische Darstellung eines Grenzbesuchs, wo hüben und drüben sich durchs Fernrohr betrachten. Immer wieder ist in diesen Gedichten von dem Nichts die Rede, das sich hinter den Wänden und Grenzen auftut, von den Spiegeln, die einen zurückwerfen, von der Trennung, die das Gehirn lahmlegt „wie nach dem Schnitt die Nervenbahnen“. Aber das alles ist nicht metaphorisch. Es ist, und das macht diese Gedichte so unheimlich, der realistische Ausdruck dessen, was war. „Ende der Pause, Amigo“, so heißt es in einem ,,26 / 12 / 89“ betitelten Gedicht. Grünbein redet von einem Leben, das sich in einer Pause abspielte und gegen Spiegel ankämpfte.
„Der Platz zwischen den Fronten ist der Platz der Verlierer. Mit einem Bein diesseits, mit dem anderen jenseits bleibt keiner im Gleichgewicht. Wer obendrein glaubt, in solcher Position lasse sich am ehesten die Wahrheit finden, der irrt sich sehr.“ Mit diesen Worten drohte Erich Honecker den Kulturschaffenden der DDR bei einem Treffen im Jahre 1979. Daß es im ganz diesseitigen Sinne kein „Jenseits” gab, daß die andere, die westliche Welt nur durch Simulation, durch das Fernsehen, erfahren werden konnte, muß prägend das Bewußtsein jener Generation bestimmt haben, der Durs Grünbein angehört. Grenze und Mauer waren für sie nicht mehr nur Material aus Beton und Stein, sondern Grenzen, über die nicht mehr hinweggedacht werden konnte. Daß in der gesamten DDR-Literatur kaum oder nicht von der zentralen Erfahrung ihrer Bewohner, von Grenze und Mauer, die Rede war, zeigt, wie gewaltig das Tabu gewirkt hat. Deshalb auch flüchtet Grünbein – darin symptomatisch für viele seiner Altersgenossen – in seinen schwächeren Gedichten in hochtheoretische Diskurse von Bild, Abbild und Kopie. Alles, so lautet die Botschaft dieser frühen Gedichte, ist Simulation, und er folgert: „Die beste Zuflucht – ein geschlossner Mund.“
Man muß die Phrase ernst nehmen, daß mit dem Bruch der Mauer das „Undenkbare“ geschah. So wie in bestimmten Religionen das höchste Wesen als undenkbares Nichts gedacht wird, so schien das „Jenseits“, von dem die Mauer trennte, ein weißer Fleck, eine tote Stelle des Gehirns. Wer schon als junger Pionier zum biblischen Respekt vor ihr erzogen wurde, dem erscheint die unerwartete Wendung wie die Ankunft des Jüngsten Tages. Ihn nennt Grünbein-„Tag X“:
Wohin die Morgen als ein Pioniergruß zart
Die Welt in zwei erstarrte Hälften teilte
Antagonistisch und entlang der Schädelnaht?
Als den Legenden noch die Drohung folgte
Es ginge eins im andern auf und sei bestimmt.
Von Husten bis zum Abschlußzeugnis,
von der Milch
In der noch Wahrheit schwamm bis zum verheilten
Selbst
Hing alles wie nach Plan zusammen.
Plötzlich ist die Pause vorbei. Die Zeit kehrt wieder zurück in die verschollene Welt. Grünbein beschreibt die Zeit vor, während und nach der Wende. Der Leser wird Zeuge dieser Bewußtseinsveränderung. Die „Nervenstränge“ wachsen buchstäblich im imaginären Gehirn dieses lyrischen Ichs zusammen. „Komm zu dir Gedicht“, so ruft er sich zu, „Berlins Mauer ist offen jetzt! Wehleid des Wartens, Langeweile in Hegels Schmalland / Vorbei wie das stählerne Schweigen… Heil Stalin“. Doch indem das Warten endet, erscheint das gelebte Leben plötzlich als Teil einer verlorengegangenen Biographie. Über sie geben die wichtigsten Gedichte dieses Bandes Rechenschaft. Grünbein beschreibt sich rückblickend: er zitiert jenen ominösen Ort, an dem er sich als Schriftsteller aufhielt, wo „die Stirn vermauert“ war und immer nur die „alten Zeichen“ entziffert werden konnten. „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“ nennt Grünbein diesen zentralen Zyklus des Buches. Er ist zugleich Kritik jener zerebralen Rückbildung, mit der er in der DDR dem Wahnsinn entging:
Glücklich in einem Niemandsland aus Sand
War ich ein Hund, in Grenzen wunschlos, stumm.
Von oben kam, was ich zum Glauben brauchte.
Gott war ein Flugzeug, wolkenweiß getarnt
Vom Feind, mich einzuschläfern, ferngesteuert.
Doch blieb ich stoisch, mein Revier im Blick.
Wenn ich auf allen vieren. Haltung annahm,
Zündstoff mein Fell, lud mich der Boden auf.
Im Westen, heißt es, geht der Hund dem Herrn
Voraus.
Im Osten folgt er ihm – mit Abstand.
Was mich betrifft, ich war mein eigner Hund,
Gleich fern von Ost und West, im Todesstreifen.
Nur hier gelang mir manchmal dieser Sprung
Tief aus dem Zwielicht zwischen Hund und Wolf.
Grünbeins Gedichte sind Versuche der Wiederaneignung dieses verlorenen Lebens, in dem noch nicht einmal der Blick nach den Wolken ein Blick ins Freie war. „Was heißt schon Leben? Für alles gibt’s Ersatz“, sagt er einmal. Denn indem der Zwang, die Bedrohung und die Grenze entfallen, entfallen auch wesentliche Elemente des mühsam aufgebauten Selbstverständnisses. Jetzt, wo ihn nicht mehr der Blick der Bewacher trifft, fällt müde und fast beiläufig der Satz „Ich bin frei“:
Wie gut nur, daß man meiner Stirn von außen
Den Film nicht ansieht, der im Innern läuft.
„Mein Leben rückwärts…“ oder wie ich blindlings
Im Sperrgebiet durch die verminten Zonen strich.
Selbst nur ein Strich in einer offnen Gleichung.
Nun ist sie nicht mehr offen, ich bin frei.
Wachtürme sind vergeßlich
Wie Augen, von den Höhlen abgelöst,
Die zwei, drei Namen für den Ort der Trennung
Sind schon verblaßt.
Natürlich sind Grünbeins Gedichte nicht bloße Illustrationen schmerzhafter DDR-Erfahrungen. Sie zielen darauf, daß die Wirklichkeit, in der er lebte, selber nur die rabiate Umsetzung von Gedanken war. Wie die Gedanken, so verflüchtigt sich die Gesellschaft, die sie schufen durch einen einzigen falschen Ton. Wie Grünbein diesen Einfall umsetzt, bezeugt Meisterschaft. Ihm gelingt es, in wenigen Zeilen jene sonderbare, von Volksfest, Einkaufsrummel und Gefahr durchdrungene Atmosphäre zu schildern, die den Monaten nach der Maueröffnung folgte:
Was für ein Trick Eins zwei drei…,
Schon war das Kollektiv verschwunden.
Eben noch Schweigemasse, schwerer Schlaf,
Appell ans Nichts in Reißbrettstädten,
Fata Morgana im Beton… genügt
Ein falscher Ton es zu zerstreuen.
Das Karussell von Putsch und Polka
Dreht sich im Leeren. weiter,
sonntagsruhig.
Grünbein verleumdet nicht, was er beschreibt. Die Auflösung der Kollektive, die sich zum Besuch in den nun zugänglichen Westen abmeldeten, den gespenstischen, gleichwohl aufgeräumten Leerlauf jener Tage im Winter 1989 – all dies ist in diesen Zeilen enthalten.
Gewiß, in diesem Band finden sich auch schwache und schlechte Verse. Die Liebe zur modernen Zeichentheorie und zu den französischen Simulationstheoretikern erzeugt zuweilen ein leeres Sprechen, das langweilt. Aber das sind geringe Einwände gegen die Stärke des Talents, das sich hier ankündigt. Die Schädelbasislektion dieses Dichters sind ein lyrischer Erziehungsroman, der Verhältnisse bewahrt, von denen schon jetzt undenkbar scheint, daß sie noch bis vor kurzem existierten. „War da irgendein Mythos“, so fragt er verwirrt und wie auf der Suche, „der all dem entspricht? War da irgendein Mythos / Irgendein Mythos der / Sprich“. Durs Grünbein hat dieser Suche die Stimme geliehen.
Frank Schirrmacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.3.1992
Die leeren Zeichen
Als Durs Grünbein vor drei Jahren mit dem Band Grauzone morgens debütierte, wußten die wenigsten, wer er ist. Das war für hiesige Verhältnisse, wo einmal jeder jeden im Umfeld ernstzunehmender Talente kannte, ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch, daß dem damals sechsundzwanzigjährigen Mann aus Dresden im Vorfeld der Publikation, die kein geringerer als der Frankfurter Suhrkamp Verlag übernahm, nicht einmal die Zeit geblieben war, eine Empfehlung hinter vorgehaltener Hand zu werden. Diese günstige Variante der Werbung hätte Durs Grünbein zweifellos ebenso verdient gehabt wie einige andere auch. So kam der Sachse, wie es ein mittlerweile nicht unüblicher Weg war, über den Westen nach Sachsen. Für mich, der ich gerade alles Nennenswerte zur jüngeren Lyrik für eine Anthologie zusammentrug, war es schon ein kleiner Skandal, erst im nachhinein die Gedichte von Durs Grünbein entdeckt zu haben und in meiner Sammlung die Lücke zu sehen. Dieses kleine Bändchen gefiel mir und traf in etwa die eigene Auffassung vom Gedicht. Vielleicht war mir hier und dort einiges zu rhetorisch, erschienen mir manchmal die metaphorischen Konstruktionen als überzeichnet, so war es doch der Ton, eine sich zwischen die Zustände und Erscheinungen bringende lyrische Frequenz, die den Satz, obgleich er noch immer Stoff überträgt, fast zum Stillstand zwingt, der mir nahe ging. Dieser Ton, der so unausgesprochen viel mit der Zeit hinter verschlossenen Türen zu tun gehabt hat, wie die DDR sie anbot. Drei sehr entscheidende Jahre sind seitdem vergangen, entscheidend auch für Durs Grünbein, der gerade mit diesem nun vorliegenden Band zu einem der wichtigsten Vertreter einer jüngeren Lyriker-Generation geworden ist.
Schwerpunkt dieser Sammlung sind die mit „Tag X“ und „Die Leeren Zeichen“ überschriebenen Kapitel, in denen die Novemberereignisse von 1989 in die Auseinandersetzung geraten und um Fragen erweitert sind, die einen allgemeinen Zustand des Denkens und Handelns markieren. In sieben mit Datum versehenen „Telegrammen“ und neunzehn achtversigen Textblöcken werden die lauten Vorgänge still registriert. Die reflektierende Figur bleibt illusionslos und fern aller Affekte und Emotionalitäten, und mitunter scheint es, als würde sie einen höheren Sinn eher darin entdecken, die Bilder und Inhalte auf das Maß einer ästhetischen Ordnung zu bringen, als sich deren eigentlicher Substanz zuzuwenden. Aus Furcht, der Flüchtigkeit des spektakulären Details zu erliegen, erfahren wir von einer Verhaftung des Autors nur wie nebenher:
Vor einer gelben Wand zehn Stunden lang
Stand ich Bestellt – nicht abgeholt, es war
Das Spielchen einer Ordnung mit sich selbst
Weil niemand mit ihr spielte. Rückensteif
Vom Gegendruck des unter kollektiven Druck
Gesetzten Körpers sah ich, weiß im Putz
Die feinen Risse auf dem Grund des Ichs,
Freiwillig eingesperrt in seine Formen.
Das Subjekt in den Versen interessiert sich nur am Rande für das äußere Geschehen, das lediglich stellvertretend für ein System von Zusammenhängen steht. Eher noch nimmt es sich zurück, ersetzt Protest durch Diskretion, Pathos durch Kalkül, denn es ist sich seiner eigenen Realität nicht sehr sicher. Auf der Suche nach einem Beweis für sein Vorhandensein bringt es sich selber in die Krise. Einen Realitätswert scheint es sich dort zuzusprechen, wo es sich im Imaginären spiegelt, auf der Ebene des Realen indes nimmt es sich selbst nicht mehr wahrnimmt.
Verhaftet, zugeführt und eingelocht
Fand ich mich wieder als ein anderer,
Verwandelt binnen Stunden zum Beweis,
Daß schon der Name die Erziehung macht.
In schneller Folge war ich Demonstrant,
Dann Wirrkopf, Rowdy, Element
Und also Unperson, mit einem Wort
Ein Unding oder schlicht, ein Nichts.
Was da „schlicht, ein Nichts“ ist, ist die eigentliche Katastrophe des Jahrhunderts, die sich spätestens mit Rimbauds „Ich, das ist ein anderer“ angekündigt hat: Die permanente Abwesenheit der Subjekte. Auf dem Hintergrund eines reduzierten oder abgeschafften Ich-Gefühls können die Aktionen, die die Individuen lediglich mechanisch vollführen, nur noch als depersonalisierte, uneigentliche Bewegungen wahrgenommen werden, können die Inhalte einer Revolution aus nichts anderem mehr bestehen als aus der negativen Summe ihrer Verfälschungen. Dabei werden die „aktivierten Körper“ zu einer Art Leihgabe eines ins Leere auslaufenden Vorgangs, der erst im Abbild, in der Reproduktion, kurz: in der Irrealität seinen Wert eingelöst findet. So hat das Kapitel IV denn auch den Titel „Die Leeren Zeichen“, wo es unter anderem heißt:
Schwachsinn, zu fragen wie es dazu kam.
Es war der falsche Ort, die falsche Zeit
Für einen Stummfilm mit dem Titel Volk.
Die Luft war günstig für Vergeblichkeit,
Das Land weit übers Datum des Verfalls.
,Alles was schiefgehn kann, wird schiefgehn‘
War noch der kleinste Nenner wie zum Trost
Das Echo, anonym ,Ich war dabei…‘
„Der falsche Ort“, „die falsch Zeit“, ein „Stummfilm“, ein „Titel“, ein „Echo, anonym“: dies alles sind Synonyme der Abwesenheit und Nichtteilnahme, wie wir sie über den ganzen Band verteilt finden.
Es war wie ein Film
Der Das Ende des Wartens hieß
…,
wie gut nur, daß man meiner Stirn von außen
Den Film nicht ansieht, der im Innern läuft.
usw. „Film“ ist ein Hauptwort, und er ist der Ort, an dem „der enteignete Alltag / Eines kleinen Mannes in Deutschland“ stattfindet. Das schließt bruchlos an die Indikationen jener schulemachenden Neuen Subjektivität an, die, nicht nur für Grünbein, zur poetischen Orientierung geworden ist. Mit Zeilen wie:
Auftauchen früh, in der Menge verschwinden, gesichtslos
Zurück in den Drehstrom, ans Netz, auf die Straßen.
(„Inside out outside in“)
wird mall wohl schon beabsichtigt auf das berühmte Gedicht von Nicolas Born „Das Erscheinen eines jeden in der Menge“ verwiesen. An anderer Stellt, fallen einem vor allem Rolf-Dieter Brinkmanns im Text figurenlos bleibende Stimmenzitate oder frei benutzte Vers- und Strophensprünge ein, wie sie Grünbein für sich gebraucht. Aber im Unterschied zu jener Lyrik der siebziger Jahre, die sich im Widerstand zum „enteigneten Leben“ befand und den Simulationstechnologien, die mit den Medien ihren Höhepunkt erreichen, eine gestische und sprachliche Ursprünglichkeit entgegenzusetzen versuchte, konstatiert der Autor fast zwei Jahrzehnte später:
„Die meisten hier, siehst du, sind süchtig
Nach einer Wirklichkeit wie
Aus 2ter Hand…“
Was einmal Entfremdung und Identitätsverlust hieß, ist zum Arrangement der Subjekte mit jener Leere geworden, die daraus hervorgeht. Das moderne Symptom der Spaltung, scheint damit zwar aufgehoben, aber zugleich ist das Ich auch in seinem realen Verhältnis zur Welt bleibend deformiert. Erkenntnisse kann es somit nur noch auf der Ebene der symbolischen Wiederholung gewinnen, auf der der Schnitt zwischen Wissen und Macht schon vollzogen ist. Das Bild von der Welt überholt folglich die Welt als Realität, wie jüngstens der Golfkrieg uns lehrte. Der Sieg der Kopie über die Wirklichkeit, des Doubles über das Original, der Beschreibung des Dinges über das Ding, das ist das Thema und Koordinatensystem zugleich auch der Dichtung Durs Grünbeins. Daß dem Autor die Nichtadäquanz von Zeichen und Bedeutung zum jähen Leidensgrund wird, darin trifft er sich schon mit Flaubert und anderen der französischen Moderne zur Mitte des vorigen Jahrhunderts:
Zwischen Sprache und mir
Streunt, Alarm in den Blicken,
Ein geschlechtskrankes Tier
…,
Das Übel liegt an der Wurzel der Sätze
…,
Was gemeint ist, heißt Name, was verschwiegen bleibt Ding
… Mehr noch aber ist aus dieser mangelnden Übereinkunft von Bezeichnendem und Bezeichnetem ein Überschuß an Signifikanten, die für nichts anderes als für sich selbst stehen, geworden. Dieser „Überschuß“ umreißt die Leere, die zu spüren ist im Augenblick scheinbarer Fülle und Anwesenheiten, die Leere, in die hinein die Subjekte sich auslöschen, wobei die Aktionen der Subjekte zugleich sich auslöschende Aktionen sind. Diese Leere mit Bedeutungen auszufüllen ist ebenso unmöglich, wie ein Leben nach dem Tode zu führen, denn sie entsteht ja gerade dadurch, daß die Bedeutung überschritten worden ist; sie ist wie eine Fortsetzungsgeschichte ohne Personen, ein signifikativer Mehrwert sozusagen. (Symptomatisch dazu verhält sich die Spielsucht, in die einer nur deshalb gerät, weil er von einem Überschuß an Zeichen umgeben ist und diese lediglich vertauschen, nicht aber in einen Wert umwandeln kann. Das hin und wieder zurückbekommene bzw. aus dem Automaten herausstürzende Geld ist nur eine symbolische Wertbehauptung, die über die „Leere der Zeichen“ und über das Ausbleiben des immer nur angekündigten Objekts hinwegtäuscht.) Dieses Vorhandensein eines Überschusses an Signifikanten wird auch zum entscheidenden Drehpunkt in den Gedichten. Im Unterschied zu früheren Arbeiten, in denen Grünbein mit einem gewissen Selbstverständnis davon ausgehen konnte, daß der Satz und die Bewegung des Satzes eine Sache und den Sinn dieser Sache übertragen (und bestimmt hatte das auch mit einer anderen Erfahrung zu tun, denn in einem totalitären, zentralistischen System ist das Verhältnis von Zeichen, Bedeutung und Überschuß genau spiegelbildlich zu sehen und eher auf einen „Bedeutungsvorschub“ ausgerichtet), gerät er jetzt ins Stocken und in die beständige Reflexion über das Reflektierte, findet der lange Fluß des Redens seine Unterbrechungen und Momente des Innehaltens. In den eloquenten Strom des Registrierens und Mitteilens ist gleichermaßen ein Lakonismus eingeschaltet, der die Satzgeschwindigkeit abbremst und sich gegen eine vorschnelle Verständigung sperrt. So können episch ausgebreitete, lange Gedichte wie „Unten am Schlammgrund“ oder „Im Tunnel der U-Bahn“ ihre Spannung immer wieder neu aufbauen und die Balance zwischen angehäufter Stofflichkeit und nötiger Selektion und Verdichtung halten – der Methode nach den lyrischen Texten von Jürgen Becker (z.B. „Das englische Fenster“) nicht unähnlich. Die zusätzlich eingebrachte Reflexion über die Beschaffenheit der Sprache verweist nun auf die Beschaffenheit des Denkens, das die Gegenläufigkeit zweier ideologischer Traditionen beschreibt: einer mechanisch-materiellen (szientistischen) und einer metaphysischen (religiösen). Einerseits wird der Mensch zum Objekt der Erkenntnis ernannt und mit den Mitteln der Analyse in seiner Erklärbarkeit und physischen Hinfälligkeit vorgeführt, andererseits erfährt er sich gerade dort wesenhaft, wo er mehr als die Summe seiner Teile darstellt und sich der Erkenntnis entzieht. Aufklärung und ptolemäisches Weltbild, Enzyklopädismus und Transzendenz, Gesetz und Irregularität, Struktur und Chaos, das sind die Grenzpunkte einer Ambivalenz, wie sie gerade das ausgehende 20. Jahrhundert offenlegt und wie der Dichter sie wahrnimmt. Da heißt es zum einen:
Was du bist steht am Rand
Anatomischer Tafeln.
Dem Skelett an der Wand
Was von Seele zu schwafeln
Liegt gerad so verquer
Wie im Rachen der Zeit
(Kleinhinn hin, Stammhirn her)
Diese Scheiß Sterblichkeit.
Oder:
Zu spät
Kommt alles erst ans Licht durch Autopsie?
Das klingt böse vertraut und kennt seine historischen Spuren. Hier ist die Analyse für das Leben, was die Verwesung für den Tod ist. Erst über die Zerlegung des Leibes ist das Wissen über das Leben zu vervollkommnen; der eigentliche Wert des Lebens ist der Tod. An der ihr zugrunde gelegten Materie kann sich die Idee nur noch entkräften. Da ist das „Hirn… / wie ein Motor, der absäuft“, oder es ist die Rede von „unscheinbare(n) Verbrennungsrückstände(n) der Liebe“ usw. Das Text-Ich erscheint sich somit bald selbst als ein „Pawlowscher Hund“, von manipulierten Reflexen getrieben, ein „Grenzhund“ gar, streunend und ohne Heimat. Dann schließlich leidet es darunter, von außen als bloßer Körper, als berechenbare Materie, als funktionalisierte Maschine behandelt zu werden, und es flieht in Rauschzustände, empfiehlt sich einem Atavismus, regressiert:
Ohne Drogen läuft nichts
Hier im Irrgang der Zeichen
Wo du umkommst gesichts-
Los in blinden Vergleichen.
Träumend… Rate für Rate
Von den Bildern beäugt.
Wer ist Herr der Opiate
Die das Hirn selbst erzeugt?
Nicht die Geschichte des Denkens, das Denken selbst wird problematisiert:
Die Krankheit Denken, schrecklich, heilt dir keine Kur.
Hier nun freilich kündigt der Rezensent dem Autor die Gefolgschaft, oder besser, er unterbricht sie. Das Denken in der gegenwärtigen Tendenz zur Anti-Aufklärung kann eines nämlich nicht: hinter dem Wissen, das durch die Aufklärung in der Welt ist, zurückbleiben. Es neu zu ordnen und in andere Hierarchien zu verteilen ist eine gewiß komplizierte Herausforderung, es neu ordnen und anders verteilen zu müssen aber nicht nur tragisches Resultat fehlentwickelter neurochemischer Prozesse des Gehirns. Und damit schließt sich der Kreis; das Thema, die Revolution ohne Revolutionäre oder: „Die Leere der Zeichen“, wiederholt sich.
Nach soviel Aufruhr up and down die Nacht,
Schiffsschaukeln in den Grachten des Gehirns,
Soviel gestauter Gegenwart, Ideenflucht, Entzug
Kam früh, die Wende.
Die Wände hochgekrochen kam und blieb
Die eigne Frage in Gestalt des Feindes –
Daß niemand es gewesen sein wird, hieß
Das Ganze war ein Zwischenfall, mehr nicht.
Am Ende bleibt einem nur noch die Bestätigung übrig:
Es macht dich müd, dem Sterben der Ideen
Zu folgen
„Sinnlos jung“, wie man sich gerade fühlt.
Kurt Drawert, neue deutsche literatur, Heft 474, Juni 1992
Im Hirn nachsehen
Wie man aus dem Titel schon schließen kann, ist Schädelbasislektion ein ziemlich morbides Textgebilde, das sich mit dem menschlichen Körper und der Psyche im weitesten Sinn auseinandersetzt. Die Gedichte und Textstücke sind sicher keine leichte Kost, aber wer sich Gedanken über die eigenen Vergänglichkeit und den kleinen Dingen, die daran hängen machen will, findet in Grünbeins Buch viel organischen Stoff zum nachdenken.
Ein Kunde, amazon.de, 9.7.1999
Placebos, Kwehrdeutsch, Vaterlandkanal
(…)
Durs Grünbein (Jahrgang 1962) ist der jüngste in unserer Reihe. Sein erster Band Grauzone morgens zeichnete die damalige DDR so:
In dieser
Grauzonenlandschaft am Morgen
ist vorerst alles ein
toter Wirrwar abgestandener Bilder, z.B.
etwas Rasierschaum im
Rinnstein, ein Halsband
oder im Weitergehn ein Verbotsschild.
Auch hier winkte Brinkmann herüber, ohne Grünbeins „Grautonskala“ wesentlich zu beleben. Grünbeins eben erschienener zweiter Band Schädelbasislektion zeigt einen beträchtlichen Fortschritt der Entwicklung, was Sprache und Form wie die Themen angeht. Das kurze Reimgedicht wie der quasi dramatische Monolog, die lyrische Anekdote wie der materialienreiche Flächentext stehen dem Autor gleichermaßen zur Verfügung. Auch Grünbein sollte man da aufsuchen, wo er suggestiv und präzis ist. Bei einer lyrischen Anekdote wie der vom Toten, der „dreizehn Wochen / Aufrecht vorm Fernseher“ saß. Bei einer Passage in einem längeren Gedicht, die das Sprachproblem dialogisch auseinanderlegt:
„Nein, ich erträume nichts mehr.“ „Bist du krank?“
„Es sind die Worte, hörst du?“ „Ruh dich aus…“
„Es ist das Feilschen, nicht der Klang.“ „Kann sein.“
„Wir hängen alle in der Sprache fest, im leeren Raum.“
Oder bei Texten, die Benns Thema von Verhirnung und Regression als Schädelbasislektion wieder aufnehmen.
In Grünbeins Band gibt es auch schon lyrische Reflexe auf die politischen Ereignisse der Wende. Diese „Sieben Telegramme“ haben originelle Passagen („Ich sah: Hitlers Ohr rosig im Bunker der Reichskanzlei“). Ihr appellatives Moment fällt dagegen, gelinde gesagt, ungeschickt aus:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt.
Wehleid des Wartens, Langweile in Hegels Schmalland
Vorbei wie das stählerne Schweigen… Heil Stalin.
Grünbein ist (zum Glück) kein lyrischer Reporter. Unübersehbar an seinen Gedichten ist jedoch, daß er sich (begünstigt durch seine Jugend) zunehmend von einer spezifischen und begrenzten DDR-Thematik löst.
Harald Hartung, Merkur, Heft 513, Dezember 1991
Durs Grünbeins urbanes Epos
Du, allein mit der Geschichte im
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaRücken, „Zukunft“ ist
schon zuviel gesagt, ein paar Wochen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaim voraus (es gibt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakeine Leere), dazwischen die
Augenblicke von Einssein mit dir
aaaaaaaaaaaund den andern, die
seltsame Komik von Emigranten-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaträumen in einer Zeit des
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa„alles ist erlaubt“.
Dieses Gedicht aus Durs Grünbeins erstem Gedichtband Grauzone morgens scheint mir sehr prägnant die geschichtliche Situation der stehengebliebenen, angehaltenen Zeit kurz vor dem Zusammenbruch der DDR ins Bild zu nehmen. Was für viele Autoren der älteren Generationen quälende Verlusterfahrung war – der Verlust von Geschichte als Bezugsrahmen von Handlung und Engagement – und für die Autoren des ,Prenzlauer Bergs‘ eine Erfahrung, die sie sich erst aneignen mußten, ist für Durs Grünbein bereits Voraussetzung des Schreibens. Das Bild „Geschichte im Rücken“ ist, nebenbei, auch eine Umkehrung des Benjaminschen Engels, der das „Antlitz der Vergangenheit zugewendet“ hat, um mit ihr in ein (produktives) Verhältnis zu kommen.
Das Zeitgefühl ,alles ist erlaubt‘ hat es wohl in dieser drastischen Form für keine vorherige Generation in der DDR gegeben. In den vorangegangenen Kapiteln wurden einige der Widersprüche und Spannungen dargestellt, die schließlich in den achtziger Jahren für einen Teil der jüngeren Künstler und Schriftsteller in der DDR zu einer Umorientierung der ästhetischen Konzepte führten. Grünbeins Satz stellt hierbei einen radikalen Endpunkt, aber auch einen Neuansatz dar. Man kann ihn auf den rapiden Autoritätsverlust der staatlichen Mächte wie auch auf den der immer wieder beschworenen utopischen Legitimationsdiskurse zurückführen. Der „Zerfall der großen Erzählungen“ war für einen Autor, der theoretisch und wissenschaftlich so beschlagen ist wie Grünbein, in den letzten Jahren der DDR eben nicht nur theoretisches, poststrukturalistisches Konstrukt, sondern auch alltägliche Erfahrung. Grünbein gehört zur ersten Generation von Dichtern, die sich von Anfang an durch nichts als sich selbst legitimiert sahen.
Vielleicht auch deshalb gibt Durs Grünbein, folgt man den einschlägigen Klappentexten, nicht gern Biographisches preis. Meist findet man nur das Geburtsjahr 1962 und die Wohnorte Dresden und Berlin. Bekannt ist weiterhin, daß er einen kurzen Versuch des Studiums der Theaterwissenschaften unternahm, bevor er als freiberuflicher Autor arbeitete.
Sein erster Gedichtband Grauzone morgens wies zweierlei charakteristische Tendenzen auf. Einerseits war noch reichlich jugendliche Blues-Stimmung zu hören:
[…] Amigo, was ist bloß schief
gegangen daß sie uns derart zu Kindern
machen mit ihrer Einsicht in die Not-
wendigkeit, ihrer Wachsenden Rolle des
Staates? […]
Das „Amigo“ des Anprechpartners war teilweise sehr gewollt intim, eine zu starke Brücke zum Leser. Zugleich aber war bereits in diesen Gedichten eine erstaunliche Breite der Wahrnehmung, eine Fülle an Realität, eine Weitläufigkeit des Poetischen zu bemerken. Von García Lorca und Rimbaud über William S. Burroughs zu Nietzsche und Ezra Pound schweifte der Blick. Die „eiskalte Reizworthölle“ der Großstadt zwischen AIDS, „Junkie-Rhythmus im Blut“ und Entropie faszinierte den Dichter, der seine frühen Gedichte später als „lauter kleine Anti-Elegien, detailreich und minimalistisch aneinandergereiht“ beschrieb.
Viele Gedichte hatten thematisch mit Dresden zu tun, mit dem Schmutz der Elbe und der Vorortbahnen, der Hölle des Berufsverkehrs, den speckigen Kneipen und dem Terror aus dem Äther. Aber nicht Lokalkolorit dominierte, sondern eine ganz konkrete Welterfahrung war ablesbar, wenn auch aus dem Blickwinkel einer verkommenen Provinz. Die Erfahrung einer bis aufs Mark desillusionierten Generation, deren Wahrnehmung nur noch polyphone Geräuschsplitter aufnahm. „Schreiben am Schnittpunkt sehr vieler Stimmen“, so beschrieb Grünbein selbst sein poetisches Verfahren. Dies deutet auf eine Art Paradigmenwechsel in der poetischen Bezugnahme, auch im Verhältnis zur vorigen Generation. Im Gegensatz zur Dichtung der nur wenige Jahre Älteren, deren poetische Arbeit Grünbein kühl das „Scheitern der konkreten Sprachkritik“ nennt, haben diese Gedichte eher einen schlendernden, prismatischen Blick. Die Ästhetik der Sprachkritik, der erkenntniskritischen Arbeit mit der Differenz zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem, weicht bei Grünbein einer radikalen Hingabe an eine heterogene Realität. In dieser hat sich das Ich der Gedichte zu behaupten. Das Gedicht „Dieser Tag gehört dir“ beschreibt einen solchen lyrischen Spaziergang durch einen brutalen Alltag „im Nonsense-Ping-Pong-Geschwätz“, „im Schein einer immerfort gestrigen Politik“. Selbst die Shakespeare-Proben im Schauspielhaus entfallen durch ihre feststehende Codierung („Wir Humanisten…“) als kulturelles Gegengewicht. Der schlendernde Beobachter, ganz ähnlich dem Baudelaireschen Flaneur, ist durch nichts zu vereinnahmen. Kühl konstatierend, aber mit impressionistischer Schärfe und angeregt durch Theoreme und Begrifflichkeiten der modernen Naturwissenschaften, begaben sich die Gedichte auf die Suche nach einer zersplitterten Erfahrung.
Der Band war klar komponiert. Die Schwelle des Morgens, das Augenaufschlagen und erste Wahrnehmen bildeten den thematischen wie auch konzeptionellen Schwerpunkt. Biographisch und poetologisch war damit ein neuer Ton angeschlagen.
1988 und 1989 setzte eine intensive Performance-Arbeit mit den ebenfalls aus Dresden kommenden Autoperforationsartisten (Micha Brendel, Else Gabriel, Rainer Görß, Via Lewandowsky) ein. „Ghettohochzeit“, „Verlesung der Befehle“, „Deutsche Gründlichkeit“ hießen einige der Performance-Lesungen mit Via Lewandowsky. „Die eigene Erfahrung von Geschichte als Mythos und Faktum zugleich treibt die Aktion in eine immer dichtere Sprachlosigkeit“, beschreibt Grünbein in einem Essay die „Protestantischen Rituale“ dieser Performances. Im Zusammenhang mit einer späteren Performance 1991 in Köln fällt beiläufig auch die Bemerkung über ein Romanprojekt Grünbeins mit dem Titel „3. K“ – eine Arbeit, die „gegen den Stillstand innerhalb des Bezeichnenden“ ankämpft, die „das Eingeschlossensein in den Sprachen beschreibt“. Dieser Roman ist bislang nicht erschienen, kürzere Prosastücke des Autors waren allerdings in einer Anthologie nachzulesen. Die dortigen Erzählungen spielen, mit deutlichen Bezügen zu Franz Kafka, in einer versteinerten, bürokratischen und totalitären Welt. Aber es ist nicht mehr nur Kafkas Welt der – ungewissen – Schuldsprüche, eine ungeheure Dimension des Abfalls und des körperlichen Verfalls tritt hinzu. Die Fiktion unterstreicht den Simulationscharakter der dargestellten Welt, die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt der Figuren verwischen, sie bleiben in diesen Texten unentscheidbar.
Der zweite Gedichtband Schädelbasislektion ist entschieden komplexer und vielschichtiger als Grauzone morgens. Im wesentlichen zeigt sich, daß Grünbein weiter an einer Poesie der großstädtischen Erfahrung arbeitet. „Stimmen“ in der Vielzahl des „urbanen Gemurmels“, und „Posthume Innenstimmen“ sind Untertitel von Abschnitten. Offene Gedichte, in lockerer Anordnung über die Seite verteilt, versuchen der Polyphonie der Stimmen und Wahrnehmungen Raum zu geben. Beschleunigung, Bewegung, die Fahrt mit der U-Bahn durch die Eingeweide der Stadt, „Unten im Schlammgrund“, prägten das Bild vom „Imago im Niemandsland“. Der Untergrund ist hier ein wörtlicher, die zu gewinnende Erfahrung erneut Einsamkeit. „[…] klein, in der Einstein-Welt, verbannt“ ist der Mensch, alle Visionen stellen sich als Tricks heraus und das Ich als Konzept von Konditionierungen. Das „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“ führt dies sarkastisch vor. Grünbeins Kommentar zu diesem Zyklus lautet: „Der Künstler im Osten als Grenzhund, entlang der politischen Territorien streunend. Ich fühlte mich damals entsetzlich verarscht und biographisch mißbraucht, als der Schwindel im Jahr ’89 aufflog. Unfreiwillig haben fast alle Künstler in dieser oder jener Weise den Grenzhund gespielt, die einen als Wachhund, die anderen als Rettungshund und indem sie beharrlich die Mauern beschnuppert haben auf der Suche nach einer Lücke. Überschreitung als solche hat kaum irgendwo stattgefunden. Der Pawlowsche Reflex war ein gemeinsamer Nenner.“
Vordergründiges Thema der Schädelbasislektion ist die Physiologie des Gehirns, die Arbeit des Wahrnehmens, Speicherns, Kombinierens, Sprechens – Ansätze einer „biologischen Poesie“, die verschiedenen medizinischen und wissenschaftlichen Spuren der Beschreibbarkeit des Ichs folgt. Da das Subjekt für Grünbein in einem System, „in dem die Reduktion des Lebens auf Reflexe durchaus Methode war“, in dem der Mensch auf „die Summe seiner Pawlowschen Reflexe“ reduziert wurde, unter prinzipiellen Ideologieverdacht geraten ist, sucht er nach neurophysiologischen Selbstvergewisserungen. Auch konkrete Erfahrungen des gesellschaftlichen Umbruchs von 1989 wie die der Verhaftung, des An-die-Wand-gestellt-Werdens oder die medialisierten Bilder von der Erschießung des rumänischen Diktators Ceauşescu in den „Telegrammen“ bestätigen direkt politisch die sonst eher theoretisch formulierte Erfahrung, in einer Welt zu leben, in der „Identität ein Vexierbild ist, […] in der das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst wird in ein Vielerlei von Reizen“. Die politischen Erfahrungen des Autors sind eben keineswegs ausgeblendet, sie sind Bestandteil seines Programms einer literarischen Modernität, die ihren Hintergrund in den Zersplitterungen großstädtischer Lebensweisen hat.
Diese zivilisationskritische Haltung prägte auch Grünbeins Bild von der DDR. Das „Gedicht über Dresden“ ist eines von mehreren ironischen Abschiedstexten des Autors vom Land der Aluminiumgabel. Es endet mit dem lakonischen Satz „Im Futur II wird alles still geworden sein“. In einer früheren Fassung von 1990 hatte er noch „wird alles schön gewesen sein“ geschrieben. Die politische Erfahrung DDR („ein Stummfilm mit dem Titel Volk“) wird, ohne sich an deren Utopien in irgendeiner Form zu beteiligen, als eine von Terror und Beschädigung beschrieben.
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die essayistischen Arbeiten Grünbeins, die durch analytische Wachheit und z.T. sarkastische Pointen auffallen. In „Nach dem Fest“ zum Beispiel, einem politischen Essay von 1990, diagnostiziert er den Zustand seiner Landsleute in der sogenannten Wende: „Emsige Sklaven, wühlen sie in den Innereien Gestürzter nach dem Geheimnis ihrer Unterwerfung.“ Mit dem Blick eines von den Utopien restlos Desillusionierten lautet sein Nekrolog auf die DDR:
Wie sein Geld und seine traurige Eßkultur […] blieb der Sozialismus in diesem preußischen Schmalhansland immer nur Rohstoff […] Die Leute bürokratisch in Schach zu halten, war wichtiger, als sie idealistisch zu gewinnen.
Grünbeins Konsequenz aus seiner Lebenserfahrung in der DDR („Mit einem Dachschaden steige ich grimmig aus dem Schützengraben“) lautet radikal: „Ich verrate die gewaltsame Landschaft der Theologie und gebe mich dem materiellen Gewimmel einer Welt hin, die nur den Tausch, aber keinen anderen Ausweg als in den Tod kennt. Von einer geschlossenen Welt der Ideen laufe ich über in eine Dingwelt, die scheinbar offen ist.“ Der Weg heißt radikaler Individualismus.
In einem Artikel zur Stasi-Debatte um Sascha Anderson favorisierte er demzufolge auch gegenüber dem zoon politikon die idiotes als die eigentlichen Quertreiber, Störenfriede, die poetischen Störfaktoren. Nur der vereinzelte Einzelne kann mit seinem Eigensinn, auf die Signale seines Körpers lauschend, sich der Barbarei der (ideologischen) Fiktionen entziehen.
In „völlig daneben“ hatte er bereits 1989 ein Konzept von Dichtung entwickelt, die ganz offen, frei von theoretischen Absichten, „mit Gesten eines tierhaften Charmes […] im nackten Ereignisstil ihre Virulenz unter Beweis stellt“:
Wenn Poesie wirklich wieder mit allem rechnete, anzüglich leicht mit einem Scharfsinn und Sarkasmus, wie er nur über den dreckigsten Wellenwirbeln der Geschichten und Religionen aufleuchtet und tanzt: Was für ein Ungeheuer könnte aus ihr werden! Was für ein übler kleiner Wechselbalg aus Defätismus, frecher Einsicht, Aphasie und Ketzerei. Dann erst wäre sie wieder eines der weniger gemütlichen Produkte ihrer Zeit, absolut ätzend und unzitierbar für die Kulturhüter und Rhetorikzwerge an allen Auf- und Abbaufronten.
In einem älteren Gedicht, das er jedoch nicht in seine Gedichtbände aufnahm, hatte Grünbein seine Auffassung vom Wort als seinem Gegenüber in eine eher zarte Formel gebracht: „Worte sind / Schmetterlinge / über der Tastatur / Anschlag der leisen Dinge / Generator d’amour.“
Grünbein hat sich mittlerweile von den leisen und verschwiegenen Dingen auch hin zu den lauten und drastischen, den Körperverletzungen und Zynismen, bewegt. Schädelbasislektion ist eine radikale Suche nach dem Ich, das sich vielleicht im Großhirn versteckt hält („Ode an das Dienzephalon“), eine Suche nach einem fixierbaren Punkt im Gewühl und Getriebe der Städte:
Vielleicht war diese Stille nichts
als die Halbwertzeit
einzelner Wörter
In mir
und wer war ich:
ein genehmigtes Ich,
Blinder Fleck oder bloßer Silbenrest… (-ich),
zersplittert und wiedervereinigt
im Universum
von Tag zu Tag,
Gehalten vom Bruchband der Stunden
zusammengeflickt,
Stückweise
und in Fragmenten
,feel so atomized‘
[…]
Stärker als noch bei den Dresden-Gedichten des ersten Buches sind es jetzt die Metropolen, vor allem New York und Berlin, und deren Lebenswelten, die Grünbeins Menschenbild und seine eigene Standortsuche als Dichter nach der ,Wende‘ beherrschen. In einem Aufsatz versuchte er, die „Situation des Künstlers jetzt, im Jahre 2 nach der Vereinigung“ zu bestimmen. „Der neue Künstler hat kein Programm mehr, sondern nur noch Nerven und einen feinen Spürsinn für Koordinaten.“ Der Ort des „Transit-Künstlers“ sei im „Transitorischen“, in den Medien beispielsweise, „die ihrerseits transitorische Orte, also Nicht-Orte sind“. Der Künstler sei „nur noch punktuell faßbar“, und nichts „wäre unsinniger als angesichts der temporären Installationen, unsichtbaren Feldstudien, kurzzeitig exponierten und sofort wieder in den Kreislauf eingebrachten Fundstücke noch von einem Werk zu sprechen“. Was der Künstler hervorbringt, sei „allenfalls noch Ausschnitt, Provisorium, kurze Pause im Sperrfeuer der Reproduktion oder flüchtiges Indiz, listig einer anonymen Semantik entrissen“. In den Labyrinthen einerseits der Metropolen und andererseits der neuronalen Netze der Wahrnehmungsverarbeitung ist Grünbeins Poetik „unterwegs durch den anthropologischen Alltag“.
Peter Böthig, aus: Peter Böthig: Grammatik einer Landschaft. Literatur aus der DDR in den 80er Jahren, Lukas Verlag, 1997
2.2 Körperwärts, vom Kopfskelett her. Zur Schädelbasislektion
2.2.1 Präludium: Bemerkungen aus observierender Distanz.
Schädelbasislektion als programmatischer Begriff
Der Titel von Durs Grünbeins zweitem Gedichtband, Schädelbasislektion, hinterlässt sich dynamisch. Er animiert zu verschiedenen Assoziationen. Folgende Sätze spielen, ohne bereits analytisch auf die Texte einzugehen, mit dem programmatischen Begriff:
Erstens: Der Schädel wird genannt – ergo scheint der point of view markiert und die Tonlage gleich mit bestimmt. Schädelbasislektion zu sagen heißt: Etwas auf eine Basis zurückzuführen. Eine Lektion wird erteilt, eine Anweisung aus souveräner Position gegeben, das Harsche wird nicht gemieden. Der Ort des Sprechens ist autark, eigene oder humanistische Interessen bleiben ausgeklammert.
Das Wort zeigt zugleich die Koordinaten von Absicht und Ausführung: Nicht vom Weichen soll hier die Rede sein, nicht vom Hirn.1
Als Artefakt, als physiologischer und physiognomischer Rest, wandert er durch viele meiner Zeilen. Zum einen gibt er das Ziel an, die Reduktion. Zum andern hat er mit einer Ästhetik des Sarkastischen zu tun, mit der Austreibung des Expressionismus, der so tief in den deutschen Knochen steckt. Das Wort kommt vom griechischen sarkazein, „das Fleisch von den Knochen trennen“.
Der Sarkast trennt „die Bedeutungen von den Gegenständen und diese von den Gefühlen. Denn der Knochen, das ist der Rest, was vom Körper übrig bleibt, nach Jahrhunderten ein Geschenk für den Paläontologen. Nichts vom Gewebe, den Eingeweiden, den Nerven bleibt wirklich erhalten. Dabei ist es aus unserer Sicht das Wichtigste, das Sichtbare des Körpers. Sentimentalisiert werden die Weichteile, die Schleimhäute, sie haben ihre Geschichte, ihren Kult, ihre Literatur. Dagegen glaube ich, dass Dichtung den Knochenbau skandiert, sie erkundet den Schädel von innen. […] Für Hegel war der Schädelknochen ,Wirklichkeit und Dasein des Menschen‘ […]“. (Ebenda. S. 500f.). Es geht um die Elemente, Substanzen und die Aggregation. Jede Folgeerscheinung wird bewusst auf das Primäre zurückgedämpft. Emotionen sind möglich, Emotionalistik nicht. Hier wirkt das lyrische Ich als Katasterbeamter.
Zweitens: Vom Mensch wird gesprochen als von einer Anatomie, von einem funktionablen Bausatz. Er kann reduziert werden zum biologischen Zustand.
,Schädelbasislektion‘. Die naturwissenschaftliche Erklärbarkeit wird zur Maxime. 22 Knochen stecken den Raum ab, in dem ein Ich ist. Die Lektion dabei: Hier irgendwo muss es sein, das Ich, die Summe der die Persönlichkeit von anderen abgrenzenden Merkmale. Im Klang des Wortes schwingt bereits das Damoklesfazit: Das Ich ist bloß neurobiotisch, ein Körpervorgang, biochemische Reagenz. Aber das Resümee lautet dann auch immer mal wieder, die Gedichte zeigen es: Anyway. Keineswegs findet sich in der lyrischen Sprache nur aseptische Kälte.
Drittens: Aus der Schädelbasislektion leuchtet dunkel die Schädelbasisfraktur. Sicher nicht zufällig. Die Ungewöhnlichkeit der Komposition von Schädelbasis und Lektion drängt das geläufigere Wort in den Vordergrund. Dass eine Lädierung der Schädelbasis den Tod bedeuten kann, ist mitgesagt. Die Schädelbasislektion und die Fraktur im Schatten des Wortes ergeben die verborgene Maxime Durs Grünbeins: Das Zerbrochene lesen, seine Spuren vermitteln.
2.2.2 Lektionen im Auftrag der Ernüchterung.
Prä- und Posthume Innenstimmen2
2.2.2.1 Erste Sektionen des Ichs
Die erste Basislektion in Sachen Bewusstseinsgewinn ist eine bittere.
Was du bist steht am Rand
Anatomischer Tafeln
Dem Skelett an der Wand
Was von Seele zu schwafeln
Liegt gerad so verquer
Wie im Rachen der Zeit
(Kleinhirn hin, Stammhirn her)
Diese Scheiß Sterblichkeit.3
Knapp und kaum zimperlich beginnt Grünbein die Schädelbasislektion mit einer Zurechtweisung, die – obwohl vom hohen Sockel der Poesie gesprochen – nur wenig arrogant klingt. Die Physiologie, steht hier, ist das Schicksal, der vergehende Körper die erste und letzte Instanz des menschlichen Seins.
Das fünfteilige Intro zum zweiten Gedichtband, zeigt bereits, wohin die Reise gehen wird: Immer auch in einen Dialog des Autors mit sich selbst. Neben die durch eigene Ernüchterung bedingte Lust am rigiden Ton gesellt sich ein sympathisches, melancholisches Sinnieren:
Dieser Traum vom Leichthin
Kennt doch niemals Erbarmen.4
Grünbeins Lyrik begibt sich ab hier in Ansätzen bereits in Zwiegespräche, die sich nicht immer auflösen lassen. Die Fortsetzung des eben zitierten Gedichtes bietet keine hochprozentige Verständlichkeit mehr:
Zwang? Ist zwecklos. Ein Dschinn
Hält sich selbst in den Armen
Reiner Luft (Griechisch: Pneuma).
Erst ein Blindflug macht frei.
Sich oft bücken gibt Rheuma.
Du verstehst… Samurai.5
Es muss, signalisiert diese Poetik, die ungefähre Antwort genügen, der Denkbereich, das Gefühl – garniert mit einer Prise Parlando. Dass nicht immer alles ausdeutbar ist und die Topikketten an der Oberfläche der Texte wie leichte Beute treiben, gehört zur Faszination an diesem schriftstellerischen Programm und Literatur überhaupt. Manchmal genügt der Klang und reicht es, dass Metaphern und Gedanken sind – selbst unter der Gefahr falscher Assoziation.
Zwischen Sprache und mir
Streunt, Alarm in den Blicken,
Ein geschlechtskrankes Tier.
Nichts wird ganz unterdrücken
Was mein Tier-Ich fixiert
Hält – den Gedankenstrich kahl
Gegen Zeit imprägniert:
Bruch der aufgeht im All.6
Dieses virulente Etwas, das Grünbein hier diagnostiziert, durchsetzt seine Lyrik mit Codes und Emulsionen von Sprachnovität.
Intellekt und Sprache (als neben dem Denken erster Ausdruck von Individualität) treffen in einer kontaminierten Zone aufeinander und führen zu Texten, die im Grenzbereich von Konzept und bewusster Formulierung einerseits, Spontaneität und genialischen Spritzern andererseits liegen. Die Lyrik unterliegt einer Art Ich-Es-Zapping, mit immer wieder wechselnden Gewinnchancen. Leichtigkeit und Ironie der Gedichte resultieren zum Teil aus dem Gespräch von ,Vernunft‘ und Emotion.
Mit Tom Peuckert kann man sagen:
Die ,Schädelbasislektionen‘ ergeben „eine Art mentales Selbstbildnis, […] gereinigt von jeglicher Emotion. Die Frage nach dem eigenen ,Ich‘, nach einem Ort, an dem Fühlen, Denken und auch Sprechen wirklich zu Hause sind, diese Frage treibt Grünbein in jenen Texten in eine ausweglose Kompliziertheit.7
Der Autor als Schöpfer von Text ist im Zwiegespräch mit sich selbst:
Ohne Drogen läuft nichts
Hier im Irrgang der Zeichen
Wo du umkommst gesichts-
Los in blinden Vergleichen.
Träumend… Rate für Rate
Von den Bildern beäugt.
Wer ist der Herr der Opiate
Die das Hirn selbst erzeugt?8
Das Gedicht verweist auf das Dilemma des Lyrikers, den schmalen Grat zu finden, an dem Sprachrausch und Signifikanz eine Synthese bilden, an dem sich ,entmaterialisierte‘ Zeichen irgendeiner ,Opiatstimmung‘ und Verifizierbares miteinander verbinden. Eine bemerkenswerte Innenansicht der Kämpfe eines Dichters mit den Bildern und ihren Namen.
Der Strom des Irrgangs der Zeichen als Grundsituation des Schreibenden, das Beeinflusst-Sein durch Außen- und Innenwelt findet sich im letzten Text der Posthumen Innenstimmen als Resultat benannt: Was gemeint ist heißt Name, was verschwiegen bleibt Ding.9
Zwischen den Fronten von Ästhetizismus und Realismus zu changieren (und nicht von den Einflüssen getrieben zu werden), ist die Sehnsucht und das Dogma des Autors:
„Ich hätte mich gerne wie ein Fisch in den Medien bewegt.“10
Doch der Traum von der Äquilibristik, der Traum vom Traum zerschellt an den Realien:
Unterm Nachtrand hervor
Tauch ich stumm mir entgegen.
In mir rauscht es. Mein Ohr
Geht spazieren im Regen.
Eine Stimme (nicht meine)
Bleibt zurück, monoton.
Dann ein Ruck, Knochen, Steine.
… Schädelbasislektion.
Michael Kohtes bemerkt treffend, dass „aus dem Großstadtflaneur ein Grenzgänger im Niemandsland geworden [ist], unterwegs zwischen Rausch und Realität, Mythos und Misere.“11 Zumeist ist die Misere die trockene Wahrheit, die übrig bleibt. Sie wird nur temporär von Anhaltspunkten für das sensiblere Ich unterbrochen. Im Gedicht konstituiert sich gewissermaßen eine Contradictio in adjecto: Eine ,mentale Schädelbasisfraktur‘.
2.2.2.2 Posthume Innenstimmen: Das Innen stimmt nicht mehr
In den fünf Texten der Posthumen Innenstimmen ist das umtriebige Dichtertier weiter demaskierend unterwegs.
Unverwandt streunend, der Traum eine Lichtung im Ich
Nimmst du die Sprache der Dinge mit unter die Haut.
[…]
Was sich hier zeigt bleibt versteckt, was sich erinnert
Vergeht an der Drehung des Strickes an dem du hängst.12
Die Albdruck-Situation übersetzt Grünbein in fraktale Sequenzen, flirrend wie der Traum, aus dem sie stammen oder der Rausch, auf den sie rekurrieren. Es ist ein Zustand Inframince: ,Im Hackfleisch‘.
Inframince, die böse Metapher für den Ort des Geistes, wird im ersten Innenstimmenhaltlos von einem weiteren Sarkasmus ergänzt: Das „Hirn, schwimmend im Liquor, ein grauer Schwamm.“13 Es kann die fluktuierenden Zeichen nicht bewältigen, und auch auf der anderen Seite (der philosophischen) wartet keine Hilfe, jede Emphase ist falsch:
Archimedes’ Punkt, unter uns gesagt, ist kein Ort
Das Übel liegt an der Wurzel der Sätze, am Grund
Der Idiome und Stile, […]
Über der Zeit das Vergessen spricht fließend Latein.14
Und das Vergehen gibt den (bedeutungslosen) Rhythmus an. Hier wird umgesetzt, was Grünbein zuletzt ins Gedicht bannte: Was dem Sein, dem ,Prä-Posthumen‘, folgt, ist kein Filter, sondern eine Chiffriermaschine. Und zwar eine der Sprache.15
Die letzte Messe ist bereits gesungen oder steht kurz bevor. Durs Grünbein stimmt einen Blues der auskühlenden Hoffnung an, immer wieder Grotesken fokussierend. Après l’amour schildert den Menschen als armes, von Selbstberuhigung zu Selbstberuhigung jettendes Individuum. „Gleich nach dem Vögeln ist Liebe der bessere Stil“16 weiß es zunächst und idealistisch, muss aber peu à peu feststellen, dass die Ideale vom Verlauf der Ereignisse bestimmt werden, und nicht umgekehrt.
[…]
Eben noch naß, richten die Härchen wie Fühler sich auf.
Betäubt, summa summarum gestillt, hört dieser Schmerz
Des Lebendigseins bis zur Erschöpfung auf weh zu tun.
Zurück in der Zeit, sind die Körper an keinem Ziel.
Gleich nach der Liebe ist Vögeln der bessere Stil.17
Der Schmerz des Lebendigseins bedingt Lebenslügen, die die tief verinnerlichten Resignationen kaschieren sollen. Man befindet sich in ,zyklischer Zerrüttung‘ und behilft sich mit Zwiedenken18. Gegen das Lebendigsein setzt man hektische Betriebsamkeit (die des Vögelns) und hofft so, die Vorzeichen ändern zu können. Ein widerlicher, widerstandsloser Pragmatismus, den Durs Grünbein hier metaphorisiert. Doch macht er auch aus dem eigenen „Zwischendrinsein kein Hehl“19, schreibt davon, wie Beliebigkeit und das Wissen darum gelegentlich zum Initial der Gedichte werden kann. Ein wenig Fischen im „Ablauf der Mythen und Fakten“20 genügte zwar eventuell, ruft aber bei Grünbein nur Desinteresse hervor: „Einsam auf weiter Flur steht ein gelangweiltes Und“21, schließt er den Text. Nichts ist sinnvoll zu verbinden – und nichts Sinnvolles.
Ein Grund dafür ist auch das Schwinden der Geheimnisse mit der rational plausibler werdenden Welt.
Einmal vermessen lässt uns der Raum wunschlos zurück.
Langeweile, codiert, macht den Tod zur Null im Perfekt.
Ein neuralgischer Punkt, zwischen X und X auf dem Sprung,
jagt sich das Ich nun, verstört, durch ein Fehlerprogramm.22
Der Grünbeinsche Zynismus ist wieder obenauf: Das Ich, ein Problembereich aus Nervengestrüpp, will sich auf die Spur kommen und hilft sich mit verifizierbaren Koordinatensystemen. Es ist vakant und konsistenzlos (zwischen X und X), ein neuralgischer Schmerz an sich selbst. Man schickt sich als Laborratte in die eigene Versuchsanordnung und hofft auf Licht auch noch im letzten Sektor.
Das akribische Raster der Naturwissenschaften wird bei Grünbein zum ,abstrakten Witz‘, der die ,astralen Roste‘ blank fegt23. René steht da im Text, und dahinter ist sowohl Magritte als auch Descartes zu vermuten. Magritte, nach dem Bilder keine reale Existenz vermitteln können, die Wahrheit kaum einfach zu haben ist,24 und Descartes, dessen Vernunftbegriff die Wahrheit im Sinne des Logischen verstand und dessen Mathematik der Welt einigen Mythos nahm. „Wo immer Spuk mehr war als Ultraschall oder Zoologie /“, subsumiert Grünbein den Ausfall der Fantasien, „Sind nun Skalare… Vektoren… Tensoren… am Ziel.“25
Ein schwieriger Text, subtil und so trügerisch, wie es im Titel prangert: trompe – l’œil, also Augentäuschung und Kulisse vor einem dem Autor selbst unbekannten Sinn, ein Dekor aus Geraune und unkender Freizeitphilosophie. Vielleicht einzig mit dem Tenor, dass zwischen Wissenschaftlichkeit und Meditation noch etwas passieren kann. Trotz der Fehlvorgaben, trotz falscher Bilder und Wegzeichen – es gibt Lücken im System:
Unter den Füßen, René, ist der Boden immer noch heiß.26
Immer wieder gibt es Momente, die wenn nicht von technologiekritischer Skepsis, so doch von Medienkritik gespeist werden. Tendenziell bereits in Grauzone morgens zu finden, kennzeichnet Grünbein die Informationswelt der Menschen gerade in Schädelbasislektion als Transformator der Leere.27 Der Eiserne Vorhang geht im elektronischen auf.
2.2.3 Drinnen spricht Draußen. Niemands Land Stimmen[footnote]Grünbein: Schädelbasislektion. S. 21–51[/footnote]
Den drohenden Sinnverlust als Ballast im Nacken, komponiert Grünbein in Niemands Land Stimmen Phantasmagorien, die seltsam zwischen Realität und Traumwelt schweben. Das lyrische Ich ist „Auf den Boden gesunken / Dieser aquarischen Nacht / […] / Schaukelnd zwischen Erinnerungsschlieren / […] / Diesseits von Raum und Zeit / (Der Verwandlung und des Pollenflugs, / Der Kontinentaldrift und der Erfindungen, / Der Hierarchiezerfälle und der Geburten) / […] / wieder einmal / mitten im Zwischendrin“28
(Der Text wird zur Impression des Bennschen Dualismus von „zersprengendem und sammelndem Ich“29. Eine Analyse Michael Brauns trifft ins Schwarze:
Halt- und ziellos treibt das diffus gewordene Ich dieser Gedichte zwischen den toten Kulissen gespenstischer Metropolen dahin, überwältigt von einer Flut kaum mehr zu verarbeitender Eindrücke. Es ist ein geheimnisloses, vom weißen Rauschen der Medien durchdrungenes Ich, das zur bloßen Psychofolie geworden ist für künstliche Erlebnisreize.30
Die Texte entsprechen Versuchen der Annäherung an das ,Innere des Äußeren‘, an das Eigentliche und Verwertbare dieser anonymen Reize. Durs Grünbein zitiert Platons Höhlengleichnis31:
Doch was spielte sich wirklich ab
Dort oben vor dieser künstlichen
Trennwand
mit leisem Terror
Unter gefälschtem Zentralgestirn,
mit den ,Bedeutungen‘,
den Monologen so vieler Stimmen,
Im Durcheinander von Zukunftsmärschen,
von Geometrien und Ökonomien,
[…]
In einer Landschaft, die immer zerrissener wird,
immer ähnlicher einem Triptychon,
dessen Mittelteil auslischt32
Hier finden sich, schreibt Michael Kohtes, „Mitteilungen eines Poeten auf der Flucht. Der Wirklichkeit und der verluderten Sprache […] längst überdrüssig, drängt es ihn […] tief hinab in atavistische Erlebniswelten.“33 Die Sprache der Welt, als Bilderflut eingedrungen (ungefragt), wird in der losen Sprache reflexiver Gedanken abgebremst. Das Niemandsland innerer Empfindung reproduziert das fragmentarisch Aufgelöste des äußeren Niemandslands, gleichwohl beide eng miteinander verbunden sind.34
Man wird, wie Tom Peuckert formuliert, in „eine Art von Assoziationstrunkenheit“35 hinein geführt, der „Alltag [erscheint] in einem seltsam mythischen Glanz“36. Der Zustand der Gesellschaft ist übersetzt in einen metaphorischen Befund:
Eine Dunkelheit, nur von kleinen
Fischen und Troglodyten durchirrt,
Zombies
Die hier im Scherbenglück
nisten, wo giftige Algen
mit Augäpfeln bespickt
An den Brandmauern treiben […]37.
Die Wirklichkeit ist ein Schlammgrund voller Irreführungen; ein trübes Gewässer vor trüber Erinnerung. Und Durs Grünbein lässt die Sprache darüber sperrig bleiben, macht keine poetische Luxusversion aus der Erfahrung.
Das Unten, aus dem die lyrische Innenstimme spricht (zu reden versucht), steht allegorisch für den Blick hinter das fälschende Licht des Designs. Platons Höhlenhölle wird eruierend verlassen, der Körper aber ist noch ganz real im Untergrund des Sinns, „müde in einer U-Bahn“38. Von dorther sendet der unzufriedene Geist (fliehend, wie festgestellt) ohnmächtige Schauer von Erkenntnis. Das Ich emanzipiert sich wie im Höhlengleichnis unter dem Risiko der Desorientierung. Bisher genehmigt gewesen – „eine träge Masse“39 – ist das Ich nun vor dem Schock der Realität atomized und nackt, aber dafür in astraler Leichtigkeit unterwegs.
Die Gedichte collagieren Trance-Sequenzen mit Passagen der total-kritischen Demontage des sozialen Körpers der Welt. Man könnte von forciertem Surrealismus sprechen. Die Verse wieder aufgebrochen wie in der Grauzone, erhält die Dissoziation mit dieser Lyrik ein Gesicht. Grünbein montiert Bilder kaskadisch zu einem Unwirklichkeitsstrom. Die Welt wird mittels manierierendem Thesaurus rückübersetzt in die zutiefst nackten Bruchstücke, als die sie das Innere empfindet. Die Lyrik lädt das System nach dem Absturz wieder auf, und kleidet die Leere mit Metaphern aus – fast entsteht eine Zwangsverwobenheit der Zeichen, gehalten nur von der Füllmasse der (sperrig formulierten) Eloquenz.
Am Schnittpunkt der ,Stimmen‘ herrschen „de-personalisierte, uneigentliche Bewegungen“, wie Kurt Drawert meint.
Die reflektierende Figur bleibt illusionslos und fern aller Affekte und Emotionalitäten, und mitunter scheint es, als würde sie einen höheren Sinn eher darin entdecken, die Bilder und Inhalte auf das Maß einer ästhetischen Ordnung zu bringen, als sich deren eigentlicher Substanz zuzuwenden.40
Matthias Politycki weiß um den Kontext und doziert die Bedeutung:
Immerhin entspricht die collagehafte Montage von vielerorts Vorgefundenem mit Fragmentarisch-Eigenem einem neuen Daseinsgefühl, einem vage empfundenen Verlust von übergreifenden Strukturen aller Art und dem Verwiesensein auf das Detail, das ungeordnet Einzelne. Und daraus, dass die postmoderne Lyrik ihre Ratlosigkeit inmitten einer mit Bildungsballast überfrachteten und bis zur Undechiffrierbarkeit codierten Welt im Rahmen des Gedichtes gewissermaßen maßstabsgetreu abbildet, gewinnt sie ihre Ernsthaftigkeit und Legitimation.41
Im semantischen Geflecht offenbart sich ein ganz bestimmtes Befinden: Das lyrische Ich, nichtiger Bote, weißer Würfelknochen42, trauert einem früheren Zustand („Wie lautlos das ging.“43) fast esoterisch hinterher. Der Text benutzt die Verstörung aber nur als Grundton einer ausgreifenden Zivilisationskritik. Der Mensch, „von Gesten des Nahkampfs entstellt / […] / Schwitzendes Fleisch in Kolonnen“44 befindet sich in letalem Zustand; es sitzen vorm Fernseher die Toten45 und es taucht im Schatten der Steine der geduldige Tausendfüßler46 der Grauzone morgens wieder auf.
Aus den Surrealien zur Gegenwart schlägt ein impulsiver Tonfall entgegen, der das Labyrinthische der Sprache illustriert. Grünbein kokettiert mit dem Versatzstückhaften seiner Lyrik:
Bin ich der Witzbold den das Sternenlicht kitzelt?
Kalt in der Badewanne nachts, der Neo-Nihilist
Mit diesen Bildern… Fluchten… Bildern… der Idiot?47
– Der Dichter hat die Last einer Erfahrungswelt („den Rausch / Billigen Hamlet-Haschischs“48) am Hals, die mit zunehmender Fülle fragmentarischer wird.
Die Niemands Land Stimmen gipfeln in einer opulenten, von Chiffren noch mehr als die anderen Texte durchdrungenen Phantasmagorie. Inside out outside in49 ist ein vorweggenommenes Finale furioso der im Zyklus umrissenen Komplexe zwischen Ich-Unsicherheit und der Skepsis gegenüber den Erscheinungen des Seins. Aller Zweifel, alle Distanz wird in dieser intensivierten Schädelbasislektion neu erzählt.50
Es gibt keine unverfälschten Momente in dieser Welt, deren Vernunftsystem Vakuum hinterlässt. Der Text ist eine Art mental overview im halluzinatorischen Stil expressionistischer Großstadtlyrik. Das Resultat sind sich entziehende Sätze, kontextlose Zitate und Szenen, die allein durch das empfundene Ungenügen und die Lust am konträren Arrangement zusammen finden.
Biografisches, selbständige sprachliche Volten und das Konzept einer Spiegelung übersubjektiver Wirklichkeit verbinden sich zu einem Generalpanorama dessen, was Grünbein bewegt. Ein „Wetterleuchten von Aphasie“51 wolle er erzeugen und scheinbare Klarheiten ins Stottern geraten lassen, sagte er 1991. Die Aphasie zwischen entleerter Vergangenheit und ,Niemandslandgegenwart‘ ist hinreichend formuliert: Ich „hing herum in den Worten, den Sätzen, im Phlegma / Der Signifikanten, an Kantischen Kanten / Verletzt… Raum und Zeit. / Der trinaxische Marx-Mensch, vermarktet, der Schlehmil, / X-ist ohne Schicksal, die Beute Freuds, / Verliebt in The power of positive thinking, das Glück / Zu vergessen… von Illusionen halbblind.“52
Die Intro- / Retrospektive ,passiert‘ von einem ungewöhnlichen Ort aus:
In einer Schlafmohnkapsel lag ich und träumte
Um meine leere Mitte gerollt, das metaphysische Tier.53 Jenes unternimmt seinen Erinnerungs- und Erkenntnisgang an den Nullpunkt des Grünbeinschen Ichs: In die unselige Landschaft der Kindheit des Autors. Dresden am Rande, outside.
In fließendem Übergang, angereichert mit Klandestinem, kehrt das Ich aber wieder ins gegenwärtige Innen zurück, nicht ohne eine Harmonie markiert und demontiert zu haben:
Labyrinth der Plazenta
Hieß mein warmes Heim
Wo ich schaukelnd fast ein Jahr
Über mir allein
Wie auf Meeren trieb
Das Diorama der Kindheit ist mit den Bunkern versunken.54
Das Diorama der eigenen Wahrnehmung wird immer transparenter, der Fragmentarismus vom Autor in „Begegnen… dem Tag“55 auf die Spitze getrieben. Am Ende bleibt nicht viel:
Miss- und Un- und Nicht- und Ent-.56
2.2.4 Durchhaltegestern und Folgezeit. Nachrichten vom Tag X57
Worauf es jetzt ankommt, poetisch meine ich, wäre, die ganze ostdeutsche Szenerie, soweit ich sie kenne, noch einmal in ihren typischen und absurden Momenten einzufangen, bevor sie vollends in die Brüche geht. Noch einmal, ein letztes Mal muss man dem neuen Kulissenschwindel zuvorkommen. Um so deutlicher erkennt man nachher den Verlauf der Schönheitsoperation, die jetzt ansetzt. Denn schon passiert, was ich […] befürchtet habe. Dass nämlich niemand mehr etwas wissen will von dieser leicht surrealen Wahnsinnskultur und ihrer erhabenen Dürftigkeit.58
Herbst 1989. DDR und Nicht-DDR. Die ,Wende‘. Tag X. Und die Gegenwart bricht auf ins Unerwartete, ins vielleicht Ersehnte. Raum für Utopien, Denkansätze, Visionen. – Idealiter.
Doch wie ist das Archiv der eigenen Bilder zu ordnen, welchen Wert behalten die Bezüge zum nun Überholten? Was ist mit den Erinnerungen, was mit den Erwartungen? Durs Grünbein stellt diese Fragen in Tag X, dem Eingangstext zum gleichnamigen Gedichtezyklus.
Wohin die Morgen als ein Pioniergruß zart
Die Welt in zwei erstarrte Hälften teilte
Antagonistisch und entlang der Schädelnaht?
Als den Legenden noch die Drohung folgte
Es ginge eins im andern auf und sei bestimmt
[…] Streng vertraut
War noch der Zwang, das Salz im Alltag, liebenswert.
Durch jedes Fenster flog ein Raumschiff aus Papier
An Bord den Neuen Menschen im Versuchslabor.
Und jeder Ist-Satz, vom Diktat der Einfachheit
Befriedigt gab sich selbst den Punkt. Wie beim Appell
Das helle „Seid bereit!“ für den Tag X.59
In der DDR gehörte es zu den verpflichtenden Gepflogenheiten, die gesellschaftlichen Defizite als erreichbare Nahziele auszugeben. Was an Gutem nicht ist, werde sein, versprachen die Ist-Sätze. „Der Kommunismus kommt bestimmt“, hieß es jahrelang, und auf dem Weg dahin seien notwendige Opfer zu leisten. Jene Diktate der Einfachheit malten das Bild einer Welt, in der die sozialistische Sache einst auch den Westen beglücken müsse und beglücken werde. Der propagierte Tag X reüssierte zu einer Art säkularem Armageddon.
Doch die 1989-er Ereignisse negierten das Versprechen. Der Tag X mutierte zur Niederlage einer Weltanschauung, die keine Alternativen andenken ließ. Und für die, welche in den sich entwickelnden Umständen nicht sofort das Paradies erkennen wollten, stellten sich existentielle Fragen: Wohin die abgebrochene Kontinuität, wohin die Morgen? Was bleibt, wieviel wird von der eigenen Geschichte noch gültig sein, und welche Teile des Lebens im falschen Leben waren (dann doch) richtig gewesen?
Die Befreiung von den kritiklosen Losungen, der Propaganda gesetzmäßigen Fortschritts, den Phrasen der Durchhalteparolen kann kaum nachhaltig zufrieden stellen. Das Ende der sozialistischen Heilserwartung ist eben auch das Ende der Vertrautheit; die Lügen der nächsten Chiliasmen sind noch ungewiss.
Grünbein schreibt die Texte in einer Zeit nach und vor Illusionen: Zerfall der DDR – Systembruch – offene Wunde. Die Gedichte sind, so Frank Schirrmacher, Versuche der Wiederaneignung eines verlorenen Lebens; die Zeit kehrt zurück in die verschollene Welt.60 Hinter der alten Maske der Psalme vom Fortschritt zeigt sich ein Greisengesicht. Und:
„Jetzt sind wir die Arschlöcher des Jahrhunderts“
(Stimme aus einer Geisterstadt hinterm Ural)61.
Mit Block und Komma entwirft Durs Grünbein eine paradoxe Sammlung von Fragmenten, die er aus dem letalen Leib der einst so großen Geschichte herauslöst. Zitat und erläuternder Nachsatz markieren in Blöcken Stationen vom frühen Sowjetismus bis zum Ende dieser Art Moderne.
„Jawoll! Kann passieren!“
(Deutscher Schaffner bei der Durchfahrt eines
Plombierten Zuges Berlin 1917)
„Alles in Ordnung? Ich habe , Schüsse gehört.“
(Lenin zu Trotzki Neujahrsfest 1920)
„In diesen Breiten sind wir unser eigner Herr.“
(Wache am Eingang zum Smolny)
Im Regen, im Regen, wir springen im Regen…
Seventy years under the communist umbrella.
Auf dieser Planke kamen wir durch Dick & Dünn
(Anonymer Familienspruch Zeit der Säuberungen)
Wenn das Gedächtnis wegbricht schweigt die Mitte
Im Massengrab die Masse ohne Stimme.
(Erinnerung als Phrase Verfasser unbekannt)
[…] STALIN…STAL…INSTA…LINS … TAL…INS…TAL
(Echo vom Berge)
„Mutanten! Ergebt euch oder geht unter!“
(Batman Die Rückkehr des dunklen Ritters)
„Wenn die Leitungen frei sind wissen wir mehr.“
(1 x Washington-Moskau via Satellit 90er Jahre62
Das Ultimatum Batmans, Hero einer neuen Welt, findet sich ähnlich in einem anderen Text.
„Mein Name Ozymandias, Zar der Zaren: Seht meine Werke, Mächtige, und dann verzweifelt!“63
Das Zitat stammt aus der Grünbeinschen Übersetzung eines Gedichts Percy Bysshe Shelleys.64 Shelley zeichnet darin das Bild von der Vergänglichkeit der Macht, die aber als Spur weit in die Zeit nach ihrem Fall reicht In einer Wüste befinden sich Reste eines mächtigen Herrscherdenkmals. Der Körper ist zerbrochen, aber das Gesicht zeigt immer noch:
[…] frown
And wrinkled lip and sneer of cold command65.
Grünbeins Transsibirischer Ozymandias, im gebrochenen Deutsch eines Nicht-Muttersprachlers gehalten, wird durch eine minimale Veränderung des Ursprungstextes zur Parabel. Das Ozymandias, king of kings modifiziert Durs Grünbein zu dem bereits zitierten Zar der Zaren. Das pharaonische Grinsen kalter Herrschaft findet eine Analogie in der näheren Vergangenheit. Die Grundmechanismen sind unversehrt: Die Macht schafft sich Monumente auf den Rücken ihrer Untertanen. Letztlich aber sind auch die nicht gefeit vor der Erosion durch die Zeit.
Gelegentlich kommt der Herrschaft das Volk abhanden – die für die Ewigkeit bestimmte Warnung des König-Zaren spiegelt sich ins Nichts:
[…] Um den Zerfall
Von kolossale Wrack, grenzenlos öd und leer,
Dehnt flache Sand sich einsam weit weithin.66
Macht vergisst sich leicht. Wie das Blut der Opfer, nur kurze Zeit noch im virtuellen Raum. Übrig bleiben nicht mehr kommunikative Relikte, bereit, Kulisse für einen neuen despotischen Anlauf zu sein. Geschichte ist an Fatalität gekettet. Grünbein betont:
Allzubald komm ich wieder, sagt die Gewalt, allzubald.67
Auch die Sieben Telegramme68, die Grünbein vom Ende des zweiten deutschen Staates schickt, lesen sich wie der Epilog zu einem zerfallenen System, das lange Zeit einziges Ordnungsprinzip war. Es ist ein weitgehend emotionsloser Abgesang auf die DDR:
Im Schock abgeblockt, in der Stunde der Aktentaschen
Schwieriger Nebensachen wie Koffer, Doktrinen und Knöpfe
Bleibt dieses Grab, von einer zur andern Mauer verlegt
Mit der Angst von Politbürokraten kreuzweise Reaktion.
Versunken im Schlamm, neu in Marsch gesetzt, dreckig
Dunkeln bei Licht die Ikonen eines anderen Todes
Den niemand mehr sterben will…
This Siberian thrill! Trauriger Kreml, – „Adios, tristes obispos bolcheviques!“69
Grünbein transponiert die Hektik des Systemwechsels, dieses Bienenschwarmdurcheinander von Bestrebungen mit salopper Zunge in die enge Weite des Gedichts. Die Sieben Telegramme sind Nachrichten von letzten Begegnungen vor einem neuen (unkonturierten) Zustand. Sie spiegeln, mit Heiner Müller gesagt, „Inseln der Unordnung 70. Die Umwelt findet sich im Skelett wieder. Und die Lyrik schafft keine Ordnungsprinzipien, sondern bietet nur Register.
Wieder ein Glaube erledigt, wieder ein listiges Credo
Quia absurdum mehr, das sich im Schleppnetz verfängt.
Abschied von Inzest und Turnsport. Wie Poren schließen
Die Einschußlöcher des letzten Krieges sich an der Luft.
Gesteinigt die Steiniger, war der Bannkreis gesprengt
Dieses Nirgends und Nie nur ein Vorspiel der Monotonie.
Hier wo der Mangel sein Lied sang Ihr Kinderlein kommt…
Das Plappern verwaltet die Stummheit. („Das ist der Dank.“)71
In die telegrammatischen Bestimmungsversuche mischen sich Geschichtssplitterer etwas fernerer Herkunft. Tenor: Die alte Zeit schwang in der Neuen Zeit mit. Die Notiz vom 1. November 1989 hält fest:
Dienstags, verfangen in einem der schlimmeren Träume
Sah ich ein riesiges Schweineohr, feuerrot, aufgeplatzt
Von Reportern mit Schuhcreme auf Hochglanz poliert.
Nürnberger Trichter, in dem es von Fleischmaden wimmelte.
Pornographisches Megaphon einer fleißigen Generation.
Sickerloch für den dünneren Abgang, den Müll, das Gebrüll
Öffentlich und von allen benutzt, eine Wunschkloake.
Ich sah: Hitlers Ohr rosig im Bunker der Reichskanzlei.72
Die Bruchstücke wirken wie ein Graubereich von apokalyptischen und visionären Erwartungen. Der Betäubung folgt der auch poetologische Imperativ:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt.
Wehleid des Wartens, Langeweile in Hegels Schmalland
Vorbei73
Kein Grund jedoch für den Autor, mit sarkastischem Hohn zu sparen:
Revolutionsschrott en masse, die Massen genasführt.
Im Trott von bankrotten Rotten, was bleibt ein Gebet:
Heiliger Kim Il Sung, Phönix Pjönjangs, bitt für uns.74
In den sonor gestimmten Fußnoten zum gebrochenen Antlitz des Sozialismus mischen sich historiografische Momente mit Dunkelstellen der Innerlichkeit. Tom Peuckert:
Mehr und mehr führen die Wege des Gedichts nach innen, in Hirnlandschaften mit extrem kurzer Halbwertzeit […]. Die Wahrnehmung oszilliert zwischen Innen und Außen, es ist alles andere als ein kontinuierlicher Strom von Erfahrung, was dann zum Gedicht gerinnt. Der Dichter sucht Ordnungsmuster, um das chaotisch andrängende Wirklichkeitsmaterial zu bändigen.75
Verschiedene Wirklichkeiten werfen ihre Bilder und Schatten auf die Rezeptionsflächen des lyrischen Ichs. Und alles wiederholt sich:
Bis zum Beginn der Neuzeit nichts als alte Zeichen.76
2.2.5 Real existierende Degression von Utopie. Die Leeren Zeichen77
Es sind zunächst dunkle Metaphern und absurd erscheinende Gedankenkonstrukte, die das lyrische Szenario der Leeren Zeichen eröffnen.
Verse gruppieren sich wie unaufgelöste Traumbilder. Fragen unterschiedlicher Provenienz stoßen aneinander („Wie denkt ein sauber abgetrennter Kopf? / Was sucht ein Irrtum auf der flachen Hand, / Ein roter Pfeil entlang der Wirbelsäule?“78). Hier artikuliert sich ein Schweigen79, das sich, die Texte zeigen es sukzessive, erst allmählich auflöst – ohne jedoch die das Sprechen auslösende Sprachlosigkeit durch Geschwätzigkeit aufzubrechen. Die Lyrik befindet sich auf eremitischem Rückzug, skeptisch auch dem eigenen Urteil gegenüber.
Es ist, schreibt Frank Schirrmacher über einen der Texte, „als spräche der Dichter aus einer unvorstellbaren Enge, in der er nur noch den Raum zwischen Gedanken und Schädeldecke auszuloten vermag.“80
Grünbein scheint vom Menschen auszugehen, der sich in einem ,Bedingungsgewitter‘, einem amorphen Kontext von Modalitäten befindet. Die Fragen kennzeichnen seine Existenz als ein Irren auf Irrwegen, immer determiniert.
Wen hintergeht Vergangenheit, ein slang
Aus Anekdoten, Interieurs… Die Körper?81
Die Erkenntnis ist folgende: Der Mensch ist Instrument, nicht Instrumentierender. Und: Absolute Wahrheiten lassen sich nicht erzeugen.
Die Leeren Zeichen erweisen sich als Appendix einer fatalen Begegnung mit dem wahren Gesicht der DDR. Es sind Zeichen einer Vergangenheit, die wie eine Wunde in die Gegenwart reicht. Es stellt sich heraus, dass die dunklen Passagen dieser Texte Merkmale posttraumatischer Sprachfindung sind. Das Gewesene erscheint quälend in fast übersteigerter Unwirklichkeit.
Wie Mosaiksteine fügen sich die neunzehn Texte des Zyklus zu einer Topografie des Terrors. Vom Ort einer Verhaftung82 wird der Staatssozialismus interpretiert, als und mit Zeichen der Selbstbeobachtung. Das Ich sieht sich, analysiert Peter Geist die Leeren Zeichen, „einer extremen Situation von Anonymisierung ausgesetzt, die die eigene Nichtigkeit in den Fängen einer längst sinn-implodierten Maschinerie bewusst macht.“83
Grünbeins geradeheraus gestellte Frage, wie ein sauber abgetrennter Kopf denkt, sucht nicht nur die Annäherung an den Problemkomplex der Seelenanatomie. Hier wird auch gefragt, ab welcher materiellen Reduzierung ein Mensch aufhört, Mensch zu sein. Im Wissen um den Kontext liest sich die Zeile auch als Gleichnis für eine an sich selbst wahrgenommene Exekution, eine (noch dazu zynische) Beschneidung von Möglichkeiten. Der sauber abgetrennte Kopf scheint Bild zu sein für das Kontrollzentrum Hirn, dem die Bewegung verweigert wurde und noch verweigert ist.
Die Texte, formal zwar streng gehalten, sind Träume über ein Trauma. Im Suchen liegt Selbstvergewisserung. Vor dem Kontrastbild von Schmerz und Deprivation findet ein Dialog mit Signaturen eines falschgesichtigen Sozialismus’ statt.
Dennoch ist die Lyrik weder von Unversöhnlichkeit mit der sozialistischen Idee noch von ostalgischen Anwandlungen verstellt. Zum Ende eines deutschen Weges schreibt Grünbein:
Schwachsinn, zu fragen wie es dazu kam.
Es war der falsche Ort, die falsche Zeit
Für einen Stummfilm mit dem Titel Volk.
Die Luft war günstig für Vergeblichkeit,
Das Land weit übers Datum des Verfalls.84
Von der Resignation allerdings ist sich nicht leicht trennen. Grünbeins „Gedichte schlagen einen Bogen von der Heimatlosigkeit dort und damals zu der hier und jetzt“85, findet Heinz F. Schafroth. Nach den leeren Zeichen des Gestern blieben auch die Utopien virtuell. Der alte Staat verblasste im Neuen, weil alternative Gesellschaftsmodelle kaum angedacht wurden.
Konsterniert bleibt das lyrische Ich bei sich selbst zurück, wo nichts ist außer Folgeschäden:
Seit damals ist ein Wort ein Wort,
Sonst nichts. Seit diesem einen Tag
Und dieser Nacht, die am Gehirn fraß.
Etwas brach ab und etwas neues
Kann nicht beginnen seither. Ebbe.86
Die Enttäuschung klingt wie in einem Hohlkörper nach, blechern und trocken.
Die Ablösung davon muss radikal sein:
Versprich mir, daß du dich versprichst
Im zerebralen Rülpsen, Sprache
Die sich an Knochen bricht wie Echolot.
Blind vor Kontrolle herrscht im Kopf
Fraktur, die Rede gegen Wände.87
Grünbein äußert hier die Hoffnung auf irgend etwas, das den Ist-Zustand. über den Status des Lähmend-Normalen erheben kann. Das Denken befindet sich, wird hier diagnostiziert, im routinierten Dauerlauf. Gerade die Sprache erscheint behindert. Sie ist im Gang des Erwartbaren quasi maschiniert und benötigt vielleicht Intuition, vielleicht Fremdwirkungen – einen Zufall jedenfalls –, um von bloßem Selbstklang, leerem Hall und unentwegtem Repetieren loszukommen.88
Vor dem Motiv der Antwortlosigkeit spulen sich (schockgenerierte) Erinnerungsfetzen ab; aus den Schemen visualisieren sich Bilder einer Diktatur, deren Wesen sich weltweit ausmachen ließe. Grünbein degradiert ein ganzes System in zwei Zeilen:
Schweigemasse, schwerer Schlaf,
Appell ans Nichts in Reißbrettstädten89.
Sein Wort zum politischen Aufbruch von 1989:
Das Karussell von Putsch und Polka
Dreht sich im Leeren weiter, sonntagsruhig.90
Das Detail-Erinnern, manchmal im Stil flüchtig aneinander gereihter Tagebuchnotizen, führt an den Ort der Untersuchungshaft, als der Dichter staatsfeindlicher Delinquent war. Die Reflexion zeigt sich mokant:
Vor einer gelben Wand zehn Stunden lang
Stand ich Bestellt – nicht abgeholt, es war
Das Spielchen einer Ordnung mit sich selbst
Weil niemand mit ihr spielte.91
Mit dem Körper unter kollektiven Druck gesetzt92 worden zu sein heißt, keinen Raum für ein wirklich mündiges Ich bekommen zu haben. In der DDR war das Wir die Norm und der Vorwand. Individualopposition war nicht erwünscht. Die Angst vor dem kollektiven Druck spiegelte die Umwelt leicht in Caligarische Kabinette:
Ein Raum im Traum, verzerrtes Kabinett
[…]
Big Brothers Blick, ein Auge, tränenlos,
Im Glanz von Bohnerwachs drang hier
Sogar in Winkel, die es gar nicht gab.93
Die geistige Leere des Systems tarnte sich mit dem Zynismus der Macht und zappelte an den Extremitäten der Exekutive noch, als der Kopf schon tot war.
Insofern ist die Haftanstalt als Ort der Gedichte gut ,gewählt‘, denn der Charakter einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit ihren Gegnern und Opfern. In den Leeren Zeichen blickt Durs Grünbein hinter die Kulissen des händeschüttelnden Sozialismus. Beispiel:
Ein Tote-Fakten-Raum, ein gelbes Loch,
Die Wände wie mit Gänsehaut bespannt,
wo alle Farben per Dekret entfärbt
Unter dem Anstrich mundtot schwelten. Den Ton gab dieses Gelb an,
gelber Hohn
Der sich durch jede Zelle fraß, Urin-
Delirien die das Denken lähmte …
„Wozu aufs Klo gehn? Pißt euch ein!“94
Die menschenverachtende Praxis war normativ:
[…] Nichts war undenkbar jetzt
Der Mord, ein Mittel der Verwaltung,
War strengste Logik, was vom Menschen blieb
Nur noch ein leeres Zeichen an der Wand.95
Der Sozialismus in der Erscheinungsform entarteter Marx war eine humanistische Ruine auf der Basis von Apparatismus. Die 89-er Wende ins Ungewisse, Schlussstein der zur Diktatur geronnenen Idee von der Freiheit des Menschen, ist von dunklen Schleiern getrübt. Sie gleicht in der Sicht Durs Grünbeins dem Auge, „in dem sich Gallert mit Vergessen mischt.“96 Bitteres Fazit der Ohnmacht: Die Vergangenheit wird (aktiv) aus den Augen verloren – „Daß niemand es gewesen sein wird, hieß / ,Das Ganze war ein Zwischenfall, mehr nicht.‘“97
Die Leeren Zeichen sind von eigenartiger Stimmung, weil sie den am eigenen Leib erfahrenen Hohn mit besonders lapidarer Distanz (also quasi ,ohne Leib‘) wiedergeben.98 Sie überzeugen, weil in ihnen das Wehklagen stumm bleibt. Das Besonnene dieser Gedichte, im Wechsel mit Bruchstücken und dunklen Metaphern, deren Ursache keinen anderen Ausdruck gefunden hat, macht sie zu einem Textstrom tragischen Ernstes, der die lyrische Sprache mit Authentizität verbindet. Im Urgrund und im Effekt dieser Texte bleibt eine träge Masse Skeptizismus zurück.
2.2.6 Die Krone der Schöpfung, der Mensch, der Hund.
Ein Woyzeck-Szenario: Porträt des Künstlers als junger Grenzhund99
Das Porträt des Künstlers als junger Grenzhund greift die konzeptuellen Stränge der beiden vorangegangenen Zyklen auf und verabsolutiert sie gewissermaßen in einem allegorischen Selbstbildnis. Der Hund ist Kern jener Bildverschiebung, die Grünbein erzeugt, um sowohl zu einem Gesellschaftsbegriff zu finden als auch zu einem Spiegelbild der nachsozialistischen Psyche, „biographisch mißbraucht“100.
Glücklich in einem Niemandsland aus Sand
War ich ein Hund, in Grenzen wunschlos, stumm.
Von oben kam, was ich zum Glauben brauchte.
Gott war ein Flugzeug, wolkenweiß getarnt
Vom Feind, mich einzuschläfern, ferngesteuert.
Doch blieb ich stoisch, mein Revier im Blick.
Wenn ich auf allen Vieren Haltung annahm,
Zündstoff mein Fell, lud mich der Boden auf.
Im Westen, heißt es, geht der Hund dem Herrn
Voraus.
Im Osten folgt er ihm – mit Abstand.
Was mich betrifft, ich war mein eigner Hund,
Gleich fern von Ost und West, im Todesstreifen.
Nur hier gelang mir manchmal dieser Sprung
Tief aus dem Zwielicht zwischen Hund und Wolf.101
Am Rand verloren, aber am Rand auch erst als freier Mensch möglich, das ist eine der Gedankenlinien in diesem Porträt. Es gibt noch andere.
Zwölf Gedichte gehören zu dieser Studie, die die Verlaufsformen des Individuellen im Überindividuellen nachzuzeichnen versucht, den Druck des Kollektiven auf den Entwurf des Einzelnen. Grünbein beschreibt die Erfahrung des ihn geprägt habenden Systems Ost aus Sicht des Hundes. Das Objekt jener Betrachtung befindet sich, so Nicolai Riedel, wie das Tier „im Faradayschen Käfig, kontrolliert und registriert, zum allgemeinen Beschnüffeln freigegeben.“102 Die Metapher des Hundseins – welche, das zeigt sich, auch auf den Kriechgang des Kindes verweist – dient dem Rundumblick auf Entwicklung, Existenz und Perspektive des Menschen, routiniert im Sich-Fügen. Grünbein konstruiert den Hund als Symbol, das sowohl von der beschnittenen Freiheit als auch von der Selbstbeschneidung103, von schützender Disziplin im Disziplinarsystem berichtet. Die Wirkung der Instruktionen ist hilflose Unrast, die Figur dazu ein armer Mann, ein Charakter des Entbehrens, der Inanspruchnahme.
Heiner Müller hatte ein ähnliches Bild entworfen, 1985. „Der Hund heißt Woyzeck“104, taucht in seiner Büchnerpreisrede auf, und das Schlagwort impliziert genau wie Grünbeins Porträt die Bestrebung, das vergangene Ich mit dem noch an der Vergangenheit laborierenden zusammenzuführen. Unterschiedlich ist der Faktor an Selbstoffenbarung – Grünbein schildert sich gelegentlich via lyrisches Ich selbst. Was sie verbindet, ist die Ubiquität und Zeitlosigkeit von Woyzeck- und Hundsein. Müller:
Noch geht er [Woyzeck] in Afrika seinen Kreuzweg in die Geschichte […], während die Tambourmajore der Welt den Planeten verwüsten.105
Grünbein:
zig Jahre Dienst mit Blick auf Stacheldraht
Landauf landab im Trott hält nur ein Hund aus
Der was ihn gängelt anstaunt, früh schon brav.106
Hier Woyzeck, die Figur des haltlosen Verstörten, dort der Hund, geduldiges Erziehungstier und blindlings treuer Beigänger seiner Herren. Beide sind sie poetischer Ausdruck kollabierter Zuversicht. Der Mensch wird präsentiert als Objekt von Manipulationsstrategien, als Fehler im eigenen System. „WOYZECK ist die offene Wunde“, sagt Müller, „Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt, der Hund heißt Woyzeck.“107
Die Schnittmenge zwischen Müller und Grünbein ist die Kreation eines Phänotyps, der vom Leiden durch Unterordnung erzählt. Deutlich bilden Grünbeins Gedichte Woyzecksche Merkmale ab:
Hundsein ist Müssen, wenn du nicht willst, Wollen
Wenn du nicht kannst und immer schaut jemand zu.
Hundsein?
Ist dieses Übelriechen aufs Wort.108
Erst Fremdbestimmung, dann Handlungslosigkeit, letztlich der Verlust von Ethos: Übelriechen. Der avisierte Zustand spannt sich bei Grünbein kritisch zurück zum Sprecher, eingereiht in das Rudel der Hunde – „ein Tier, tief in sich selbst verstrickt.“109
Parallel dazu erweisen sich die Gedichte als Schritte zu einer Charakteristik und Selbstdeutung des Autors, relativ unabhängig vom historischen Kontext. Bereits das erste Gedicht verrät:
Hundsein ist dies und das, Lernen aus Abfallhaufen,
Ein Knöchel als Mahlzeit, Orgasmen im Schlamm.
Hundsein ist was als nächstes geschieht, Zufall
Der einspringt für Langeweile und Nichtverstehen.110
Durs Grünbein bildet mit dem Hundsein ein durch Manipulation durchbrochenes Lebenskonzept ab. Die Zeit vor dem Umbruch, Wende genannt, als deprimierendes Schnüffeln an den Grenzen des Möglichen, die eng gesetzt waren. Wo der eigene Entwurf so weit reglementiert wurde, dass „nur ein Strich in einer offnen Gleichung“111 übrig blieb.
Es geht also neben der skizzierten Idee des Mitlaufens und der Entmündigung – spezifiziert durch die Erfahrung eines verschlossenen Systems, in dem die Hoffnung sich selbst überlassen war – ganz allgemein um Konditionierung, um einen weiteren Beitrag zur Einsicht, dass es kein richtiges Leben im falschen geben kann. Dafür steht das Bild des Pawlowschen Hundes in einer Versuchsanordnung,112 dafür steht auch die textinterne Häme und Süffisanz, die vor der Zeitlinie der Gegenwart nicht Halt macht.
Hier, wo das Politische nicht appellativ daherkommt, gelingt eine Vergegenwärtigung des Lebens in einer untergegangenen Welt, aber auch eine Reflexion der veränderten Verhältnisse, in denen der ehemalige Grenzhund zum Haustier wird.113
Bis zu einem gewissen Grad hat von Petersdorff damit recht, aber Haustier ist missverständlich, weil daraus Domestizierung spricht. Grünbein schaltet derartige Bedenken prophylaktisch aus:
Hört euch das an: Ich sei so sanft gewesen
Daß man mich nun als Haustier halten will,
Heißt es in einem Nachruf noch zu Lebzeit.
Mir wird ganz schlecht, wenn ich sie flöten höre
Von handzahm, kinderlieb und treu. Geschwätz![footnote]„Porträt des Künstlers als junger Grenzhund, 9“. Grünbein: Schädelbasislektion. S. 103[/footnote]
Grünbein sah sich selbst als „Grenzhund, entlang der politischen Territorien streunend“114, ist aber weiter misstrauisch in Bewegung.
Ron Winkler, in Ron Winkler: Dichtung zwischen Großstadt und Großhirn. Annäherungen an das lyrische Werk Durs Grünbeins, Verlag Dr. Kovač, 2000
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Marcel Beyer: „Sprache ist Rache des Fleisches / Durch den Kehlkopf’“
Basler Zeitung, 9.10.1991
Sieglinde Geisel: Im zwielichtigen Niemandsland. Konzepte poetischen Widerstands in der jüngeren DDR-Literatur
Neue Zürcher Zeitung, 7.2.1992
Michael Braun: Armer Hirnhund
Die Weltwoche, 10.10.1991
Michael Braun: Schädelbasislektionen
Freitag, 21.8.1992
Stefan Sprang: Fahrt durch die Grauzonen oder Der Dichter als Grenzhund
Rheinischer Merkur, 11.10.1991
Dirk von Petersdorff: Fin de Siècle
Neue Rundschau, Heft 3, 1993
Hans Jansen: Rückruf ins Leere
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 12.10.1991
Ernest Wichner: Halb Zombie, halb enfant perdu
Süddeutsche Zeitung, 9./10.11.1991
Thomas Irmer: Schädelbasiszone. Durs Grünbeins zweiter Gedichtband bei Suhrkamp
Chemnitzer Tagblatt, 18.10.1991
Nicolai Riedel: Durs Grünbein: Schädelbasislektion
Passauer Pegasus, Heft 18, 1991
Tom Peuckert: Metaphern für eine neue Wildnis. Im Dickicht des Nicht-Ich: Die Gedichte von Durs Grünbein
Der Tagesspiegel, 17.5.1992
Alexander von Bormann: Der jähe Zugriff aufs Innerste. Lyrik im Herbst
Der Tagesspiegel, 8.12.1991
Will Gmehling: „Gepfiffen durch den Opernsaal der Nacht“
die tageszeitung, 27.1.1992.
Michael Politycki: Im Irrgang der Zeichen
Stuttgarter Zeitung, 31.1.1992
Heinz F. Schafroth: Auf den cartesischen Hund gekommen
Frankfurter Rundschau, 8.4.1992
Michael Rutschky: Welcher Dichter ich gern wäre. Eine Wanderung durch neue Lyrik
Merkur, Heft 600, März 1999
Young-Ae Chong: Poetische Bewältigung der Wende
Die Krise des Subjekts
– Laudatio zum Förderpreis des Bremer Literaturpreises 1992, gehalten am 27.1.1992. –
[…] Grünbeins erste veröffentlichte Gedichte stammen aus dem Jahr 1985. Der Beginn seines Schreibens fällt in eine Zeit gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche. Er erlebt eine ungeheure Verdichtung und Beschleunigung der historischen Prozesse und den Zusammenbruch des politischen Systems, in dem er aufwuchs. Ein immenser Stoff drängt sich ihm auf. In dieser Situation entstehen nun aber Gedichte, die zuallererst Orientierungsversuche künstlerischer Art erkennen lassen. Er ordnet sein Material, indem er geschichtliche Ableitungen philosophischer und literarischer Art sucht. So kommt es zu der Turmbibliothek.
Zugleich sucht er nach Übersetzungsmöglichkeiten für den gewaltigen Rohstoff. Hier ist jemand am Werk, der mitten im Sturm festhält an einer Literatur, die sich den Sinn für die Form als ordnender Intelligenz der Poesie bewahrt hat. Das Spektrum der lyrischen Redeweisen in Schädelbasislektion reicht vom Strophengedicht mit offenem oder verdecktem Versmaß über zersprengte Oden, das Lied, Sehtexte, bis zum freien Vers und der reinen Prosa. Er arbeitet mit und ohne Reim, mit Halleffekten, dem Refrain, Leitmotiven, mit linearen und flächenhaften Kompositionsformen, mit der Schere des Montagekünstlers und dem Klebstoff des Zyklikers.
Kurzum, eine technische Reflexion beteiligt sich am Schreiben und verbindet sich mit der Neugier des Büchertürmers in der alexandrinischen Bibliothek. Aber diese Auseinandersetzung mit den Form- und Stofftraditionen der Literatur ist nicht einfach nur eine Flucht zu fremden Autoritäten, sondern ein Mittel der Selbstvergewisserung und eine Methode der Selbstdarstellung mitten in einer schweren geistig-politischen Orientierungskrise. Diese Krise ist sein Thema. Die Krise des Subjekts nach dem Zugriff des totalitären Staates, und beim Eintritt in die mediale Kommunikationsgesellschaft des Westens. Die Schädelbasis, die besichtigt wird, ist das nackte Hirn, rohes Fleisch. Grünbeins Lektion, hier, in den Kapiteln über den Sozialismus, handelt von der Natur des Geistes und der Biologie, ja der Zoologie der Gedanken. Das Bewußtsein das erinnernd ausfindig gemacht wird, ist ein „genehmigtes Ich“, „Passagier unter Tiermasken“, „Hund unter Hunden“, „Automat im Dienst der sozialistischen Ordnung“, ein „metaphysisches Tier“. Ich habe entlang jener Gedichte des Bandes zitiert, die von der Vernichtung des Selbstbewußtseins handeln und von der Umkehrung des Prozesses, aus dem es hervorgegangen ist: der Emanzipation des Vernunftwesens von seiner Natur. Der Körper ist von seinem menschlichen Bewohner getrennt worden und umgearbeitet zu einem gesellschaftlichen Nutztier, biomechanisches Material, eine Körpermaschine. Einerseits.
Andererseits ist diese Schädelbasis ein Spukloch. Andererseits handelt Grünbeins Lektion von einem Gespenst. Die westliche Kommunikationsgesellschaft erlebt er als Wirklichkeit aus zweiter Hand. Das Ich, das hier unterwegs ist, erscheint als geisterhafter Schneemensch in einer abstrakten Zeichenwelt, ein Yeti zwischen Monitoren, Diagrammen, Sinustönen. Ein hoffnungslos verspäteter „euklidischer Träumer“ gerät in die „Einstein-Welt“. Narkotisiert verfolgt er die rasende Verwandlung von Gegenwart in Vergangenheit. Ein Leben als „Idiot“ in einem mediengesteuerten Wachtraum. Den Begriff Idiot benutzt er in der doppelten Bedeutung von enteigneter Intelligenz und bürgerlicher Innerlichkeit. In diesem Sinn hat Aristoteles ihn dem zoon politikon, dem Bürger als Gesellschaftswesen, entgegengesetzt.
In beiden Rollen, als kapitalistischer Idiot und sozialistisches Staatstier, ist das Subjekt Objekt, dort im „elektrisch aufgeladenen Fell“ als Beutetier der Medien, hier im Griff der Politik. Die schönsten, die bittersten Gedichte Grünbeins tragen die Überschrift „Der Cartesische Hund“. „Hört euch das an“, sagt er:
Hört euch das an: Ich sei so sanft gewesen
Daß man mich nun als Haustier halten will,
Heißt es in einem Nachruf noch zu Lebzeit.
Mir wird ganz schlecht, wenn ich sie flöten höre
Von handzahm, kinderlieb und treu. Geschwätz!
Für alles Fremde findet sich ein Kennwort.
Sieht aus, als sei ich nun von Zeit ereilt
Und meine Stimme schwimmt im Eingeständnis:
„Halb war ich Zombie, halb enfant perdu…“
Vielleicht hat mich da draußen irgendwann
Der Raum verschluckt, wo sich der Sichtkreis schließt.
Von nun an soll mein Double für mich sorgen.
Mein Trotz wird ausgekotzt mitsamt der Frage:
Ob Haustierhirne schließlich leichter sind?
Sibylle Cramer, aus Wolfgang Emmerich (Hrsg.): „Bewundert viel und viel gescholten…“. Der Bremer Literaturpreis 1954–1998. Reden der Preisträger und andere Text, edition die horen, 1999
Reflex und Exegese
– Dankrede zum Förderpreis des Bremer Literaturpreises 1992, gehalten am 27.1.1992. –
Keine Frage, ich liebe Tautologien. So war der erste Einfall, als ich das hier schrieb: Immer die erste Regung zählt, der schnellste Reflex. Es ist wie mit der wendigsten Samenzelle, die zur Befruchtung flitzt und alle Rekorde bricht. Ihr Fluchtreflex heißt Überleben, die bloße Schnelligkeit, mit der sie ihren genetischen Auftrag ausführt, sichert ihr den Platz in der Zukunft. Immer dicht am Geschehen und manchmal vorauseilend, ist es der postwendende Einfall, der schließlich den Ausdruck macht. Der Rest ist Geschichte, Erzählung, eine endlose Steilküste voller Schwalbennester, das unermüdliche Zwitschern von Interpretation, Kritik, Theorie. Läßt sich so das Gedichteschreiben erklären? Den Liebhabern von Tautologien und Biologismen vielleicht, aber allen andem?
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was man mit Gedichten alles anstellen kann. Man kann in sie eingehen wie die chinesischen Maler in ihre Tuschebilder, wenn sie geräumig genug sind. Man kann sie als Klangkonserve oder compact disc gebrauchen, wenn eine oder gar mehrere Stimmen, fremde und eigene, sich darin wiederfinden. Man kann sie als Falle verwenden, als geheimen Aufenthaltsort für die neugierigen Geister, wie das vom Lichtstrahl getroffene Zelluloid, das die Körper an der Grenze vom Realen zum Imaginären bannt. Oder man kehrt zu ihnen zurück und umschleicht sie als Schauplatz, auf dem die Begierden, Logiken und Gedanken ihr flüchtiges Stellungsspiel trieben, in jedem Hirn anders und in jeder persönlichen Lage neu. Das seltsame ist, daß sie jedem zugänglich sind, der ein paar aneinandergereihte Buchstaben und Silben verstehen kann, vorausgesetzt sein inneres Ohr läßt ihn nicht im Stich. Bloßes Lesen genügt nicht, hat nie genügt. Entweder spricht der Körper, über die weißen Seiten gebeugt, mit oder das Gedicht geht spurlos an ihm vorbei direkt ins Leere… ohne Spannungsaufbau kein Magnetfeld. Das Gedicht, per Definition eine Kette semantischer Effekte und physiologischer Kurzschlüsse, hätte sein Ziel verfehlt, wäre es nur ein weiterer Text auf einem weiteren Blatt Papier. Wie die Stimme im Telephonhörer, den jemand ans Ohr preßt, als könnte er in die Welt des anderen hineinhorchen, dringt es real in den Körper ein und explodiert im Unbewußten mit seinen Klängen und Codes, im Idealfall gleich einem intensiven Traum. Noch bevor du begreifst, was geschieht, hat es sich als Engramm, als Erinnerungsspur festgesetzt und du bist fortan gezeichnet, stigmatisiert durch ein paar merkwürdig aufgeladene Worte. Im Bruchteil einer Sekunde (länger dauert es nicht) hat ein neuronales Gewitter, ein Synapsenblitz die ganze Gehirnlandschaft verändert.
Von nun an wird dieses besondere Licht, eine bestimmte Perspektive, der ganz spezielle synästhetische Fluß immer wiederkehren, sobald die zugehörigen Namen fallen. Ein Fünfzehnjähriger, der durch Empfehlung oder aus einem abnormen Appetitanfall Novalis’ „Hymnen an die Nacht“ zur Hand nimmt und sich darin festliest, ist hinterher ein anderer, ohne daß er es gleich bemerkt. Kehrt er, verlockt durch Verbote oder eingeschüchtert vom kollektiven Zwang zu Spiel, Spaß und Sport, wieder und wieder in sein endogenes Versteck zurück, wird es nicht lange dauern und er fängt selbst an zu schreiben. Jeder weiß, wie diese ersten Nachahmungen aussehen, aber ist auch bekannt, daß Nachahmen einer der stärksten Triebe bei höheren Säugetieren ist? Natürlich bleibt von Poe in den Schreibereien des Siebzehnjährigen nicht viel mehr als der nackte Grusel. Und selbstverständlich ist der Pubertätsbrief direkt an Melville, Dostojewski oder Conrad adressiert Wenn der Achtzehnjährige dann, weil er zufällig schräge Vögel zu Freunden hat, zuerst auf Baudelaire, später auf die Cantos des Ezra Pound stößt und nur noch Bahnhof versteht, liegt der gefährlichste Teil der Reise schon hinter ihm. Den Dämonen der Ignoranz und der Gruppendummheit entkommen, findet er sich vor einem privaten Bücherschrank wieder, in Museen und Lesesälen, jung und zitatengeil, für jede literarische Einflüsterung offen. So unmerklich wie der Übergang vom pin-up-girl zur ersten Freundin, vom „Disco-Mäuschen“ zur Motorradbraut, hat ihn das Studium überkommen, seine erste recherche. Sein geheimer Kontrakt mit der Zeit, durch frühe Lektüre geschlossen, ist mit einemmal rechtskräftig geworden. Er marschiert durch die Hintergründe, liest sich durch Fußnoten und Bibliographien und entdeckt den Zauber der Anspielung in einem Nebensatz. Was er jetzt von sich gibt, sich großspurig herausnimmt, nennt er selbst, verführt von neusachlicher coolness, Versuche. Der Euphemismus Gedichte bleibt lange Tabu. Was zählt, ist die erste Erregung, von ihr geht das Sprechen aus. Das Erlebnis wird zum Anstoß und sprengt Wort für Wort aus den gewohnten Zusammenhängen heraus in die Fangarme einer fixen Idee. Bald festigt das Aufschreiben sich zum Bedingten Reflex, auch wenn kein Hunger gestillt wird… ein Phantasma genügt. Und mit den Formen setzt die Entfremdung ein.
Was mir als erstes beim Schreiben auffiel, war die Rolle der Mißverständnisse in der Dichtung. Daß jeder in einer Eigenwelt umherspazierte, eingehüllt in seinen eigenen absurden Kokon aus Worten, und daß es so viele Eigenwelten wie Menschen gab, versetzte der psychischen Illusion von Realität einen schweren Schlag. Mit einemmal war die Aura eines jeden einzelnen das gewöhnliche Unerkanntsein. Witz, Temperament, Wortwahl, Gestik, alles was zum persönlichen Stil des Einzelnen gehört, wurde zum anthropologischen Rätsel, wahrgenommen als Gesamtheit der individuellen Reflexe. Vor jeder Grammatik mit ihrem Punkt, Punkt, Komma, Strich wucherte immer schon die ungeheuerlichste sensualistische Vegetation, von der nur ihr Urheber wußte. Also war Sprache nur diese allen gemeinsame Lichtung, auf die man hinaustrat, geschwätzig lauernd, immer am Rand eines Dickichts aus Gesten und Blicken.
Wie gerufen lief mir damals Fritz Mauthner mit seinem sprachkritischen Skeptizismus über den Weg. Besonders eine Bemerkung, faszinierend in ihrer Willkür, ließ mich aufhorchen. Die ganze Unschärfe unserer sprachlichen Situation, früh als Unbehagen erfahren, fand sich in der einen lapidaren Wendung wieder:
Wir haben keine Sprache des inneren Sinns.
Was sonst konnte das heißen, als daß die äußere Realbanalität, gestützt auf Formeln, ausgeschmückt mit ein wenig Symbolik, einigen hermetischen Innereien, der verdammte Stammplatz, die ideale Lichtung war, wo alles sich traf? Demnach mußte persönlicher Ausdruck von Anfang an die undankbarste Aufgabe sein, Unverständlichkeit ihre größte Verlockung, Autonomie ihr vergeblichstes Ziel. Das Viele an Vielzuvielem auf engstem Raum: dieser Horror der Eigenwelt, ließ sich immer nur an den Rändern erwischen nur in kleinsten Bruchstükken und mit dem Griff des genauen Worts. Doch was, wenn die natürliche, innengeleitete Wahrnehmung, auf der Mauthner als Pflanzenliebhaber bestand, immer schon reichhaltiger, dynamischer und differenzierter war, als die in Formeln und Abstraktionen gealterte Sprache? Das einzige, was Sprache dann aufzubieten hatte, waren ihre Bilder, die Vorstellungen, die in ihr arbeiteten. Ihr kultiviertes Gestrüpp waren die Anklänge und Laute, Zitate und Ausrufe, Reime und Störungen, in denen das Physische seine Schatten warf. An die Stelle des „inneren Sinns“, der als blinder Fleck zurückblieb, rückte eine Flora und Fauna aus Klang und Bild, gleichzeitig imaginär und real. Und schon war, ohne Zauberspruch, nur durch eine leichte Drehung innerhalb des Sprechens, ein phantastischer, zoologischer, vegetativer Raum eröffnet, in dem jeder allein war mit sich, der Zeit und den Zeichen. Es war derselbe Raum, in dem sich die Tiere bewegten und wahrscheinlich hatte er auch genügend Ähnlichkeit mit dem legendären cyberspace der Computerpioniere. Wie in den weiten Räumen dessen, was Mauthner den „inneren Sinn“ nannte, regelten hier die Reflexe den Verkehr zwischen den Dimensionen. Die Silbe, das Wort, die Periode, alles war von Reflexen belebt und gesteuert. Und so war es kein Wunder, daß alles was aus reflexhaften Akten bestand, unmittelbar einging in diesen Raum… von der leisesten Regung eines Sperlings im Laub bis zur brutalen Geschicklichkeit von Kinderbanden in den Angstlustsphären der Metropolen. Schreiben war immer dann am lebendigsten, wenn es sich an den bloßliegenden Nerven vorantastete, beweglich in jede Richtung, wachsam und sensitiv. Nur so konnte es sich inmitten einer Kultur der Risiko-Kulte und Todeskitzel, einer Biochemie der Endorphine und Adrenaline behaupten. Es war die Vision vom Dichter als elektronischem Dandy, der mit tierhaftem Charme und kühlem Kopf durch die Bildweiten streift. Und hier bin ich nun, weit entfernt von diesem verlockenden Ziel, einer von vielen Jägern und Sammlern, unterwegs durch den anthropologischen Alltag.
Noch weiß ich nicht, ob der Außenraum mit seinen Mustern aus Geographie und Geschichte, Architektur und urbanem Leben nicht vielleicht längst totcodiert, ausgeschritten und zuendegedacht ist. Erst die Simulation eines enormous room in der Dichtung wird den Beweis erbringen. Bis dahin steht einstweilen nur fest: zwischen Nekrophilie und Neurologie gibt es kein Zurück für die Körper. In Zukunft ist alle Beweglichkeit ein geschicktes Hakenschlagen, ab durch die Mitte im Zickzack voraus. Ob den Dichtern dabei der Atem ausgeht, wird sich erweisen.
Ich danke der Rudolf-AlexanderSchröder-Stiftung für den mir zugesprochenen Preis.
Durs Grünbein, aus Wolfgang Emmerich (Hrsg.): „Bewundert viel und viel gescholten…“. Der Bremer Literaturpreis 1954–1998. Reden der Preisträger und andere Text, edition die horen, 1999
Vorerst
oder Der Dichter als streunender Hund Lobrede auf Durs Grünbein
Nicolas Born, der der deutschen Gegenwartsliteratur schmerzlich fehlt, sah (in seiner Rede zur Verleihung des Bremer Literaturpreises 1977) die Menschheitsgeschichte in „ein unwiderrufliches Stadium“ der Vernichtung getreten: „Unsere Sinne und unser Bewußtsein sind schon weitgehend anästhesiert; die Sprache legt dafür Zeugnis ab: in Begriffen wie Lebensqualität und Umweltfreundlichkeit drückt sich die Verödung der Empfindungs- und Wahrnehmungsfähigkeit aus. Was wir noch erleben, unsere äußere Wirklichkeit besteht zu 80 Prozent aus Synthetics, der Rest ist reine Wolle. Einen winzigen Teil der Wasservorräte der Erde nennen wir ,Trinkwasser‘. Es ist nicht mehr schwierig sich vorzustellen, daß in nicht allzu ferner Zeit eine bestimmte Luftsorte als ,Atemluft‘ rationiert werden muß. Wörter wie ,Natur‘ und ,Landschaft‘ bezeichnen ein immer blasser werdendes Phantom der Erinnerung. Bald werden sich solche Reservate nicht einmal mehr zum Hinfahren eignen; sie werden zu klein für alle, da ist es rationeller, sie abzufilmen und zu senden.“
In den Gedichten Durs Grünbeins kommt Natur kaum mehr oder fast nur als verwüstete vor, und wo von Landschaften die Rede ist, handelt es sich um „Hirnlandschaften“ oder „Bewußtseinslandschaften“. Allgegenwärtig sind in diesen Gedichten aber die Synthetics, sie sind das schlechthin Beherrschende und haben die Wirklichkeit in eine „Wirklichkeit aus 2ter Hand“ verwandelt, in der alles Ersatz ist und alles ersetzt werden kann – sogar das Leben, so daß es bei Durs Grünbein zu der zynischen Gedichtzeile kommt: „Was heißt schon Leben? Für alles gibt’s Ersatz.“ Zynismus ist freilich nur eine Reaktionsweise des Dichters – und sein Zynismus ist eher ein freundlicher, denn auch Ersatz vermag ihm noch einiges zu bieten, auch eine „Wirklichkeit aus 2ter Hand“ übt Anziehungskraft aus, manchmal sogar hypnotische. Und dann gibt es da noch eine zweite Wirklichkeit, in der die erste und ursprüngliche Wirklichkeit aufbewahrt ist, die Wirklichkeit der Bücher, in der der junge Dichter das genießt, was er „die Gastfreundschaft der Toten“ nennt. Auf diese Gastfreundschaft der Toten waren die Dichter – und nicht nur sie – schon immer angewiesen, und immer schon erschienen diese Toten lebendiger als die Lebenden. Meister Bashô – der Meister des Haiku – ist einer dieser Toten, die Durs Grünbein Gastfreundschaft gewährten, und ihm, dem toten Dichter, gesteht er:
Ich habe es satt so ganz
gramgesättigt zu leben von einem
undurchdringlichen Augenblick an den
nächsten gespannt.
Das Gedicht, dem diese Zeilen entstammen, beginnt übrigens mit dem Wort „Staunen“ – keineswegs hat also dieser junge Dichter das Staunen verlernt −, und eben in diesem Gedicht taucht für einmal auch ein Stück Natur auf, ein Fluß, die Elbe, die zwar zunächst „als dieser / sich bleiern windende Fluß“ und als „Kloake“ präsentiert wird, dem gramgesättigten Dichter aber an diesem Morgen des Gedichts eine unerwartete Freude bereitet, nämlich die „Freude der Überschwemmung“. „Freude der Überschwemmung“, so steht es im Gedicht, und es bedeutet Freude an der Grenzüberschreitung, Freude an der Grenzverletzung.
Die Grenzen, die Durs Grünbein gesetzt waren und ihn von Grenzüberschreitung träumen ließen, waren keineswegs nur die politischen, die einmal zwischen dem östlichen Teil Deutschlands, in dem Durs Grünbein aufwuchs, und dem westlichen Teil Deutschlands gezogen waren. Die undurchdringlichste Grenze war und blieb für ihn die genetische, jene also, die ihm seine Natur setzte, jene, die es ihm verwehrt, sein eigenes Ich hinter sich zu lassen. „Ich ist ein anderer“, verkündete Rimbaud, der mit diesem Satz so etwas wie das Motto der literarischen Moderne verkündete. Doch wenn das Ich auch aus Millionen Facetten zusammengefügt oder in Millionen Facetten zersplittert sein mag, es bleibt doch dieses eine, millionenfach zusammengefügte oder zersplitterte Ich. Ihm zu entkommen ist noch nicht einmal möglich, indem man das Existieren beendet, es wäre nur möglich – Fernando Pessoa hat diesen Gedanken in seinem Buch der Unruhe formuliert −, wenn man es fertigbrächte, „niemals existiert zu haben, was aber ganz und gar unmöglich ist.“ Das ist die „Schädelbasislektion“, die uns aufgegeben und die so schwer zu akzeptieren ist. Schädelbasislektion, so hat Durs Grünbein seinen zweiten Gedichtband überschrieben, und darin findet sich die programmatische – Rimbaud replizierende – Gedichtzeile: „Ich ist kein anderer / Als dieser Grenzhund, der sich selbst bewacht.“
„Portrait of the Artist as a Young Dog“, so hat Dylan Thomas eine Erzählung betitelt, die ihn berühmt machte. Durs Grünbein hat diesen Titel aufgenommen: „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“ heißt ein Gedichtzyklus von ihm, dem innerhalb seines bisherigen poetischen Werks, wie ich glaube, eine Art Schlüsselfunktion zukommt. Die Metapher vom „Grenzhund“ ist doppeldeutig, ist vieldeutig; sie suggeriert gleichermaßen Macht wie Ohnmacht, sie spielt sowohl auf die Todesgrenze an, die einmal zwischen den beiden Deutschländern verlief, als auch auf jenen Gottfried Bennschen „Hirnhund, schwer mit Gott behangen“; wobei ein toter Gott doppelt schwer wiegt („Nicht wahr, Gott einmal abgeschafft / Ging alles leicht. Nichts war undenkbar. / Der Mord, ein Mittel der Verwaltung, / War strengste Logik“, so weiß es ein Grünbein-Gedicht aus dem Zyklus „Die Leeren Zeichen“, in dem der Dichter die Erfahrungen jener Nacht, die er in Ostberliner Polizeigewahrsam verbrachte, verarbeitet hat).
Es waren zwei Diktaturen, so könnte man (womöglich etwas zu salopp) sagen, die Durs Grünbein gleichermaßen heftig zugesetzt haben: die Diktatur des Proletariats, die in Wahrheit aber eine über das Proletariat war, und die Diktatur der Großhirnrinde, die zerebrale Diktatur. Beide bewiesen dem Grünbeinschen „Grenzhund“ immer wieder, daß der bloße Wille, ihnen nicht zu Diensten zu sein, wenig vermag – und daß nur beim Ersatz ein wenig Rettung zu finden ist, bei Ersatz der Vorstellung nämlich, der Einbildung, oder um bei der kynologischen Metaphorik zu bleiben – beim Streunen. „Immer neues unverwandtes Streunen“, das ist die Lehre des Grünbeinschen Grenzhunds. Daß auch solches Streunen strafbar sein kann oder jedenfalls Strafen nach sich zieht, das läßt sich denken – und das läßt sich den Gedichten Durs Grünbeins ablesen.
„Eines Dichters Leben“, so sagte es Kierkegaard, „beginnt in dem Streit mit dem ganzen Dasein.“ Das ist die übliche Dichtervoraussetzung, anders ausgedrückt: das Leben eines Dichters ist sozusagen prinzipiell beschädigt. Ich denke aber, daß es doch eine Beschädigung oder Strafe besonderer Art war, wenn man – wie Durs Grünbein – im Jahre 1962 in der DDR geboren wurde. Ein Jahr zuvor war die Mauer gebaut worden, und wer danach in der DDR das Licht der Welt erblickte, dessen Welt war von Anbeginn an eine eng geschlossene und verschlossene, eine zugemauerte Welt, in der – wie es in Durs Grünbeins Gedicht „Nachruf auf eine verbotene Stadt“ heißt – „alle entmündigt waren“ und – wie es im Zyklus „Die Leeren Zeichen“ nachzulesen ist – „die beste Zuflucht – ein geschlossener Mund“ war. Wenn man dann noch – wie Durs Grünbein – ausgerechnet im „Tal der Ahnungslosen“ aufwuchs – so nannte der DDR-Volksmund die Dresdner Gegend, in der Westfernsehen nicht zu empfangen war −, wenn man also selbst dieses Ventils oder dieser allabendlichen elektronischen DDR-Droge beraubt war, dann mußte man sich als junger Autor wohl vorsätzlich an jene „Ruinenwerte“ halten, von denen in Durs Grünbeins Dresden-Gedicht die Rede ist. Damit sind nicht nur die „Ruinenwerte“ dieser besonderen und besonders zerstörten Stadt gemeint, sondern damit ist schlechthin alles gemeint, was dem Aufbaupathos und der verordneten Positivität entgegenstand oder entzogen war und den Machtinhabern als wertlos oder negativ galt. Alle Werte, die sich hier noch als unzerstörte oder gar als unzerstörbare anpriesen und aufspielten, hatten jedenfalls gegenüber diesen „Ruinenwerten“ keine Chance. Anders ausgedrückt: nur das Ruinöse in allen seinen Ausformungen schien imstande, der Staatsgewalt Widerpart bieten – und sie womöglich ruinieren zu können.
Vielleicht erklärt das, warum die Gedichte Durs Grünbeins so erfreulich frei sind von jenem Widerstandspathos, das so manche Gedichte ordentlich oppositionell gesinnter Schriftsteller schwer erträglich macht, weil es sich nämlich vom Pathos der Parteisprache nur gesinnungsmäßig unterscheidet. Ganz in diesem Sinne hat Durs Grünbein in dem mit Abstand gescheitesten Aufsatz, den die um die einstigen DDR-Autoren so unentwegt besorgte FAZ zum Thema Stasi-Verstrickung veröffentlichte, „das verbale Maschinengewehrrattern Wolf Biermanns“ mit den „Dekreten der einstigen Stalinisten“ gleichgesetzt. Und zum Thema Widerstand hat er ebendort festgestellt, „daß es im sozialistischen Osten spätestens nach vollendetem Mauerbau die wirksamere Haltung auf Seiten der Idiotie gab.“ Das „Zeitalter Solschenizyns“, so Durs Grünbein, „war endgültig vorbei.“ Was heißt das? Und was heißt es für Durs Grünbeins Gedichte?
Es heißt, daß sie auf die Zumutungen der Politik und der Geschichte vorzugsweise mit Sarkasmus und jenem eher heiteren Zynismus antworten, von dem ich bereits gesprochen habe, und gelegentlich auch, nun ja, mit Idiotie, wobei diese gar nicht unähnlich einer Strategie ist, die Bazon Brock schon sehr früh als „Strategie der Affirmation“ ausgerufen hat und die im zitierten FAZ-Aufsatz Durs Grünbeins als „Subversion durch Affirmation“ wiederkehrt. In einem Gespräch mit Thomas Naumann im Oktober 1991 hat Durs Grünbein bedauert, daß es ihm zu DDR-Zeiten noch nicht wirklich gelungen sei, die verfügbaren ideologischen und historischen Zeichen so verwegen zu verwenden, wie das sowjetische Künstler der inoffiziellen Szene – etwa Dimitri Prigow oder Wladimir Sorokin – getan hätten, die – so Grünbein – „mit dem spezifischen totalitären Material so frei umgegangen (sind) wie jenseits des Atlantik die Pop-Art mit den Zeichen der Werbe- und Warenwelt.“
Nun, die Russen haben in der Subversion durch Affirmation und durch Idiotie eine große Tradition, die in den Zwanziger- und Dreißiger Jahren schon begründet wurde durch Autoren wie Aleksandr Vvedenskij und Daniil Charms, ebenjenen Charms, der 1937 in sein Tagebuch notierte: „Mich interessiert nur Quatsch, nur das, was keinerlei praktischen Sinn hat.“ Daß es freilich auch damals in der Sowjetunion ganz andere Gegengifte gegen das Gift des Offiziellen gab als bloßen Quatsch, das zeigen die Werke von Dichtern wie Ossip Mandelstam, Marina Zwetajewa oder Boris Pasternak, deren Pathos ganz sicher nicht lediglich die Umkehrform des offiziellen Pathos ist, sondern legitimiert wird durch die Abkehr von allen Formen des kollektiven Sprechens und durch den Rückzug auf die ganz ureigene Erfahrung (man könnte auch gleich sagen: die ureigene Tragödie), legitimiert wird aber auch durch das Beharren auf der Unzerstörbarkeit des Menschen, besser: des Menschenbilds. Boris Pasternak schreib damals: „Die Kunst interessiert sich nicht für den Menschen, sondern für das BILD vom Menschen; das BILD vom Menschen ist immer größer als der Mensch… In der Kunst schweigt der Mensch und das BILD spricht.“
Gennadij Ajgi hat einmal bekannt, in ihm sei der schöpferische Prozeß strikt „adialogisch“: „Ich beantworte im Gedicht keine Fragen, polemisiere nicht mit der vordergründigen Wirklichkeit, ich arbeite vielmehr im Gedicht fortwährend an meinem ,Rechenschaftsbericht‘ weiter.“ Auch Quatsch und Idiotie sind Formen der Polemik, haben ihre Funktion nur im Hinblick auf eine schlechte Praxis. Was aber ist, wenn die historischen Bedingungen, die Formen wie Quatsch und Idiotie provozierten, weggefallen sind? Muß das Gedicht nicht spätestens dann wieder andere Formen des Nonkonformismus finden, muß es nicht zu seiner eigenen Wirklichkeit zurückkehren, zum Monolog, zum „Rechenschaftsbericht“ vor sich selbst?
Sind das nun Fragen an Durs Grünbein? An mich selbst? Es sind jedenfalls Fragen, die einen Abstand voraussetzen. Abstand zu gewinnen zum vergangenen Terror, der unentwegt neuen Terror zeugt, ist aber, zugegeben, unendlich schwierig. Unter den kollektivistischen Bedingungen, unter denen man in der DDR und Sowjetunion so lange zu leben gezwungen war, war – wie Durs Grünbein betont – die Reduktion des Lebens auf Reflexe die schiere Selbstverständlichkeit: „trainiert wurde vom Kindergarten an aufwärts und zwar gründlich dieselbe Kollektion eingeschränkter Verhaltensmuster.“ Daß auch die so anderen Umstände, unter denen heute ein Durs Grünbein existiert, eingeschränkte Verhaltensmuster verlangen, das ist eine Erfahrung, die es ihm nicht gerade leicht machen dürfte, das Bild vom Menschen als dem „alphabetisierten Tier“, wie er es im Grenzhund-Zyklus gebrauchte, zu korrigieren und zu einem anderen Menschenbild zu finden.
Bis jetzt ist jedenfalls der Ort des Dichters, wenn wir seinen Gedichten glauben, zwischen allen Systemen und allen Stühlen;
so dämmerst du
wieder einmal
mitten im Zwischendrin:
In der Mitte von Nirgendwo,
heißt es in einem Gedicht mit dem bezeichnenden Titel „Unten am Schlammgrund“. Ein andermal sehen wir das lyrische Ich „schlingernd im Labyrinth / eines Echobeschleunigers“, und der Gedichtzyklus „Fünf falsche Töne“ endet desillusionistisch mit der Zeile: „Was von Visionen bleibt sind Tricks.“ Daß sich dieses lyrische Ich, das „Tag und / Nacht den Dauerströmen von // Informationen“ und den „unsichtbaren Bakterienstämmen der Worte“ ausgesetzt ist, gelegentlich auch wie auf den Grund der Tiefsee versenkt vorkommt, verraten einige dieser Gedichte. Einmal ist von einem Radio die Rede, das sich „pünktlich von selbst mit den / vertrauten Tiefseegeräuschen“ meldet, ein andermal erscheint „das Leben ein Unterwasserfilm“, einmal taucht in einem Gedicht die Frage auf: „Welche Jahreszeit oben?“, ein andermal wird „das belebende Sprudeln / der Luftblasen aus einer / Seele auf Tauchstation“ beschworen, womit doch wohl der dichterische Prozeß umschrieben werden soll.
Die Epitheta „vertraut“ und „belebend“ – „vertraute Tiefseegeräusche“, „belebendes Sprudeln der Luftblasen“ – hervorzuheben, scheint mir allerdings angebracht, sie zeigen eine Gelassenheit in der Verzweiflung an, die für unseren Autor charakteristisch ist. Und wenn es in einem anderen Gedicht (das Durs Grünbeins erstem Gedichtband den Titel eingab) heißt: „In dieser / Grauzonenlandschaft am Morgen / Ist vorerst alles ein / toter Wirrwarr abgestandener Bilder“, so vernehme ich da nicht lediglich die Klage über die Bilderflut, sondern ich vernehme auch das „vorerst“ und setze meine Hoffnung in dieses leise vorerst.
„Der Dichter“, so sagte derselbe Nicolas Born, der in seiner eingangs zitierten Bremer Rede ein so düsteres Bild des Weltzustands malte „muß sich in einen Zustand versetzen, daß er etwas sieht – wie zum ersten Mal – oder zum letzten Mal.“ Und René Char hat geschrieben, heute müsse der Dichter „gelegentlich souverän die Augen schließen, um überhaupt noch etwas zu sehen, was angesehen zu werden verdient“. – Als ich den ersten Anlauf zu dieser Lobrede auf Durs Grünbein nahm, da bemerkte ich, daß die ersten von mir niedergeschriebenen Sätze alle mit dem Wort „noch“ begannen: noch ist Durs Grünbein auf dem Desillusionierungstrip, noch ist er vom Durchschauen nicht zum Anschauen oder gar Wie-zum-erstenmal-Anschauen gelangt, noch beschreiben seine Gedichte vorwiegend Fluchtbewegungen und kommen nicht zur Ruhe. Dann entdeckte ich bald dieses Grünbeinsche „vorerst“ und damit den Umstand, daß Durs Grünbein selbst vom „noch“ ausgeht, das heißt sich nicht fest eingerichtet hat in der Reflexroutine des eminent gebildeten Kulturkritikers (der er freilich auch ist, die Zitate von Leonardo bis Carl Schmitt und Baudrillard gehen ihm geläufig über die Lippen, und Nils Bohr zitiert er gar auf Dänisch, was vielleicht ein bißchen übertrieben sein mag).
Die primär auffallende Qualität der Gedichte Durs Grünbeins ist sicher ihre Beweglichkeit und ihre wache Weltaneignungsgeschicklichkeit; sie schotten sich nicht ab, ziehen sich nicht von vornherein in einen Innenraum zurück, sondern versuchen eher Räume zu öffnen und horchen den Echos nach und den „Echos der Echos“ (wie es im Gedicht „Das Ohr der Uhr“ heißt). Das macht diese Gedichte so vielstimmig wie vieldeutig. Daß diese Echos nicht nur aus der Literatur kommen, sondern ebenso aus den naturwissenschaftlichen Labors und Lehrbüchern, das hat bei Durs Grünbein, wie ich glaube, nichts mit Sich-interessant-machen-wollen zu tun. Grünbein hat einmal die Frage gestellt, „ob wir nicht alle lieber Mediziner geworden wären“, und da er diese Frage selbst nicht mit dem Verzicht auf Poesie und einem Medizinstudium beantwortet hat, so signalisiert sie mir vor allem sein enormes Interesse an den Grenzen, an den Übergangslinien zwischen Körper und Sprache zumal. Durs Grünbeins Vorliebe für medizinisches Vokabular kündet nach seiner eigenen Aussage vom „Verlangen nach einer sprachlichen Nähe zum Körper, die gleichzeitig der größte rationale Abstand ist.“ Ich fürchte freilich, daß mit Durs Grünbeins Forderung, etwa „den Anteil des Kehlkopfs an der Verdichtung der Wortfolgen herauszufinden“, wenig für die Poesie getan wäre – wie mir überhaupt bei den meisten derartigen analytischen Gelüsten immer wieder Günter Eich einfällt, der gern das Bild vom Tausendfüßler gebrauchte, der in dem Moment, in dem er über seine vielen Füße nachzudenken begann, nicht mehr laufen konnte.
Durs Grünbein legt übrigens selbst den Gedanken nahe, daß es sich bei seiner Begeisterung für Neurologie, Quantenphysik und so weiter auch lediglich um den Versuch handeln könnte, aus „dem Schlamassel der Sprachverdrossenheit“ herauszukommen – sprich: zu einem noch nicht poetisierten Vokabular gelangen zu können. Und es fällt bei ihm auch der Begriff „spleen“, der ja auf Baudelaire weist. Tatsächlich war Baudelaire einer der Literaturgötter des jungen Durs Grünbein, an dem ihn die „frühe Bildalchemie, das Halluzinatorische des Großstadtdichters“ reizte. Auch als „urbanen Reflexkünstler allerersten Ranges“ hat Durs Grünbein den französischen Dichter gepriesen, der demonstriert habe, daß „die Selbstauflösung des MOl nicht mehr möglich ist und dennoch ersehnt wird.“ „Diese Spannung“, so Durs Grünbein, „erlaubt erst das Körperlichwerden der Worte.“ Selbst Baudelaires Dandy kehrt bei Grünbein wieder, wenn er in seiner Rede zur Verleihung des Bremer Literaturförderpreises 1992 die „Vision vom Dichter als elektronischem Dandy, der mit tierhaftem Charme durch die Bildweiten streift“, verkündete. Einerseits der elektronische Dandy, andererseits der streunende Grenzhund, das sind nun die Chiffren der Grünbeinsehen Beweglichkeit.
Daß das unerschöpflichste Reservoir für jeden Dichter die Kindheit – der Ort seiner Menschwerdung – bleibt, gilt auch für Durs Grünbein, der in Dresden zwischen dem größten Müllberg und dem größten militärischen Exerzierplatz der Stadt aufgewachsen ist. „Unser frühester Horizont war die Autobahn“, bekannte Durs Grünbein einmal, und einmal sah er im Traum sein Elternhaus, wie es wegfuhr auf dieser Autobahn, „losgerissen vom Fundament, Inbild des Abschieds“. Daß Grünbein mit sechzehn, als er gerade Novalis für sich entdeckt hatte, einen Gedichtzyklus „Die Ulmenkinder“ schrieb, der die Geschichte einer Gruppe von Waisenkindern behandelte, die aus dem Heim ausbrachen und über Land zogen, das paßt ebenfalls ins Bild und zeigt, aus welchen Ängsten sich Durs Grünbeins Beweglichkeit gebildet hat. Zum elektronischen Dandy und zum streunenden Grenzhund kommt jetzt also noch das Bild vom flüchtenden Waisenkind, das unsere Vorstellung vom Dichter Grünbein komplettieren könnte. Apropos Angst: es gibt in einem der Gedichte Durs Grünbeins eine Zeile, die mich gleich besonders anzog: „Plötzlich wird Pfeifen im Wald zur besten Methode.“ Vielleicht ist ja all unser Dichten, in wie vielfältigen Formen es auch geschieht, nicht viel mehr als so ein Pfeifen im Wald, das die Angst vertreiben soll, die Angst vor dem, was Nicolas Born in den eingangs zitierten Zeilen als unser Verhängnis benannt hat. Und auch wenn Gennadij Ajgi darauf insistiert, daß Poesie für ihn unverändert eine sakrale Handlung sei, so darf man daran erinnern, daß auch der sakrale Akt mindestens so sehr aus der Angst wie aus dankbarer Anbetung gespeist ist.
Es ist dieses Pfeifen bei Durs Grünbein übrigens keineswegs eines aus dem letzten Loch, es ist auch nicht jenes Pfeifen, das Franz Kafka in „Josephine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse“ beschrieben hat, also reiner Reflex, es ist eher ein freundliches, manchmal sogar übermütiges Pfeifen, auch und gerade wenn es „gramgesättigt“ ist.
Peter Hamm, Rede zur Verleihung des Nicolas-Born-Preises 1993 an Durs Grünbein, gehalten in Perugia
Erstdruck in: Manuskripte Zeitschrift für Literatur, Heft 122, 1993
„Poetry from the bad side“
– Gespräch mit Thomas Naumann Berlin/Oktober 1991. –
Thomas Naumann: Wo bist du aufgewachsen?
Durs Grünbein: Ich bin am Rande des größten Müllbergs von Dresden großgeworden. Meine Kindheit habe ich in den Vorgärten Sibiriens verbracht, zwischen sowjetischen Kasernen, Manöverfeldern und in den Gassen der Gartenstadt Hellerau am Stadtrand von Dresden. Es gab dort zwei ineinander übergehende Landschaften. Eine riesige Müllhalde und einen militärischen Großspielplatz, den nacheinander kaiserliche Truppen, Wehrmacht und Sowjetarmee zur Rekrutenausbildung genutzt hatten. Wir haben dort als Kinder immer Abenteuerspiele veranstaltet, vor allem auf dem Müllplatz, der war unser Erlebnisraum. Vielleicht ist dort etwas wie ein frühes Heimatgefühl aufgekommen. Um diesen Müllplatz kreisten die meisten der Spiele, Rattenjagden, Räuber-und-Gendarm, Verfolgungsfahrten mit Fahrrad und Moped. In der jugendlichen Hochrüstungsphase kam dann einiges andere hinzu, als wir uns Luftgewehre und Katapulte besorgten und uns gegenseitig lustvoll Verletzungen beibrachten. Wir bildeten kleine Banden und streiften umher auf der Suche nach allem möglichen brauchbaren Zeug, nach Fahrradersatzteilen, Schrott, irgendwelchen Fundstücken, die man zu Geld machen oder tauschen konnte. Unser frühester Horizont war die Autobahn, den haben wir nie, auch in den kühnsten Ausflügen nicht, überschritten. Zwei Kilometer vom Elternhaus entfernt begann die Tabugrenze. Später im Traum hab ich das Elternhaus dann einmal auf der Autobahn fahren gesehen, ein Wohnhaus das über Land fährt, losgerissen vom Fundament, Inbild des Abschieds. Jetzt bin ich seit Jahren nur noch unterwegs, kann sein, daß ich es einestages wiederfinde, am Brennerpaß oder auf einem Highway in Kanada.
Naumann: Wie war es mit dem Lesen damals, mit der Literatur? Was hast Du besonders gern gelesen? Hast Du überhaupt gelesen?
Grünbein: Zuerst das übliche, Indianergeschichten, J.F. Cooper, dann Jules Verne, E.A. Poe, später die großen Romane, Melville und Dostojewski. Mit 16 habe ich eine Zeitlang Novalis gelesen, das hat mich angeregt, eine lange Gedichtfolge zu schreiben, im Geist der Romantik. Ich nannte sie „Die Ulmenkinder“. Es war die Geschichte einer Gruppe von Waisenkindern, die aus dem Heim ausbrachen und über Land zogen, sie lösten sich sozusagen in Natur auf. Naja, es war eine dieser dunkel inspirierten Phasen, in denen man alles mögliche ausprobiert, Sonette und Oden. Ich schrieb zwar nicht gerade in Reimen, aber es gab lange Strophen und einen sehr strengen Bau. Es waren meine „Hymnen an die Nacht“.
Naumann: Wie wurde Dein Schreiben damals aufgenommen?
Grünbein: Zunächst wohlwollend. Es wurde als Bereicherung für diverse Geburtstage empfunden. Hin und wieder gab es die Bitte: „Schreib doch mal ein Gedicht für Tante Gisela“. Die Probleme tauchten erst später während der Oberschulzeit auf, als sie merkten, daß es tiefer sitzt und als ich mich für ein Studium entscheiden sollte. Ich war seit langem auch sehr an technischen Dingen interessiert. Ich habe mich mit Elektronik beschäftigt, einen Verstärker und ein Mischpult zusammengelötet, solche Sachen. Mein Vater ist Ingenieur, und er sah das natürlich nicht ungern, ich konnte in seiner Heimwerkstatt basteln. Aber als er merkte, daß dies nicht mein Lebensinhalt sein würde, spürte ich schon einen leisen Vorwurf. Meine Versenkung in die Bücher war aber unaufhaltsam. Ich habe dann meine Bewerbung für ein Ingenieursstudium Elektronischer Bauelemente im damaligen Karl-Marx-Stadt zurückgenommen und hing damit in der Luft. In diese Phase fiel die Militärzeit, die obligatorisch war, außer man saß im kirchlichen Asyl. Während dieser sehr unangenehmen Zeit habe ich mir in der Kasernenbibliothek sämtliche Werke Brechts ausgeliehen und Zeile für Zeile alles gelesen. Von da an war klar, was ich studieren wollte: Germanistik. Ich tat aber nur 18 Monate Dienst in der Nationalen Volksarmee und da ich mich geweigert hatte, an der Staatsgrenze der DDR zu patroullieren, kam für mich das begehrte Studienfach Germanistik nicht in Frage. Daraufhin beschloß ich Theaterwissenschaft zu studieren, dort waren die Aufnahmebedingungen etwas günstiger. Ich ging an die Humboldt-Universität nach Berlin und studierte dort 4 Semester. Schließlich wollte ich mir einen eigenen Studienplan machen, verschiedene Nebenfächer belegen, doch das war unmöglich. Nach einem erfolglosen Briefwechsel mit einem meiner Dozenten brach ich das Studium ab. Prinzipielle Kritik am Lehrplan fiel auf den Studenten zurück. Von da an war ich fertig mit der DDR und wollte raus, um in Westberlin weiterzustudieren. Mit dem Ausreiseantrag begann eine Zeit intensivster Zusammenarbeit mit Dresdner Künstlern, zuerst in Dresden, dann in Berlin. Ich fing an, regelmäßig zu schreiben, beteiligte mich an Performances und Ausstellungen, lernte in Berlin andere Autoren und Leute aus der Untergrundszene kennen, geriet ins Umfeld des Prenzlauer Bergs.
Naumann: Du bist 1986 zum Studieren nach Berlin gekommen und dann dort geblieben?
Grünbein: Mein Verhältnis zu Dresden war damals schon leicht gestört. Man sieht es an meinem ersten Gedichtband (Grauzone morgens), der gespickt ist mit dresdentypischen Impressionen, lauter kleine Anti-Elegien, detailreich und minimalistisch aneinandergereiht.
In dieser Zeit, 87/88, nach Abbruch des Studiums, ging ich wieder nach Dresden zurück. Früher hatte ich dort am Theater gearbeitet, jetzt hatte ich eine Hilfsarbeiterstelle im Museum, am Mathematisch-Physikalischen Salon im Zwinger. Betreuung alter Optikgeräte, astronomischer Fernrohre und Uhren, das hat mich wegen der ganzen Technikgeschichte interessiert. Ich hatte einen normalen Arbeitstag, mit morgens um halb sechs Uhr aufstehen und Straßenbahnfahren. Ungeheuer war der Alltagsstreß in dieser Stadt, die Morgennebel, der Smog, die dichtgedrängten Werktätigen (wie es im offiziellen Sprachgebrauch hieß). Als Motiv kommt das immer wieder in meinem ersten Buch vor, ein permanentes 6-Uhr-morgens-Ambiente.
Mit meinem Umzug nach Berlin brach es dann ab. Nun begann etwas anderes, ein mehr konzeptuelles Nachdenken über Sprache und Gedicht. Das kommt auch in der Zusammenarbeit mit Bildkünstlern zum Ausdruck. Manche Verbindungen stammten noch aus der Dresdner Zeit. Ich habe mich manchmal an der Hochschule für Bildende Kunst herumgetrieben, aus der einige der Freunde, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite, hervorgingen.
Naumann: Um noch einmal auf Dein erstes Buch zurückzukommen. Mir schien es z.B. sprachlich eher traditionell. Wenn man von der Prenzlauer-Berg-Literatur spricht, und dazu wirst Du ja gezählt, denkt man doch, das müßte in der Sprache und vom Thema her anders sein?
Grünbein: Der Fehler liegt in der Zuordnung. Ich war im selben Revier, aber fern der Programme. Sprache an sich hat mich damals nicht interessiert. Natürlich fiel mir sogleich in Berlin das Grundmuster auf, diese Arbeit im sprachspielerischen Sinn, die Vorliebe für Etymologisches, der ganze Wort-Konstruktivismus, z.B. was Papenfuß-Gorek machte, der mit den Etymen jonglierte, sehr faszinierend und einflußreich auf Kollegen. Was ich machte, war dagegen so eine Art friedlicher Impressionismus, verschlafen und provinziell, Gartenarbeit. Epikur war mir näher als Dada. Das Gedicht als Ding hat mich mehr beschäftigt als textuelle Netzeflickerei. Filmische Techniken spielten eine Rolle, Schnitte und Klebstellen, Bilder aus verschiedenen Bedeutungswelten wurden aneinandergefügt oder schroff gegenübergestellt, Motive minimalistisch eingekreist. Grauzone, das war auch der Landstrich, in dem Lyrik und Prosa ununterscheidbar verschmolzen im Schweben einer balancierenden Sprechstimme. Auch die typographische Arbeit machte mir Freude. Später fing ich dann an, ganze Serien zu entwerfen, oft nur mit Einzelheiten beginnend. Der jähe Wechsel verschiedener Stimmen ergab die Rhythmen, die Blöcke.
Die sprachexperimentellen Richtungen der 60er und 70er Jahre mögen zwar in unabhängigen Formen in den 80ern weitergewuchert haben, aber mich hat dies nicht mehr beschäftigt. Mir ist heute klar, daß es um Existenz und Konzept gleichermaßen geht, und alles Formelle weist darauf hin. Damals sah ich im reinen Sprachspiel nur den Sportplatz, auf dem die Verbalathleten sich tummelten. Einerseits verlockte mich die Verbindung zu Aktion und Performance mehr, andererseits suchte ich nach Brücken zu den Naturwissenschaften. Poesie als vielstimmiges Rollenspiel gefiel mir mehr als jede Chirurgie an der Sprache selbst.
Naumann: … also der Blick auf das Signifikat, weniger auf den Signifikanten?
Grünbein: Genau. In den letzten anderthalb Jahren gab es allerdings immer wieder Momente, wo das Problem als Problem aufblitzt. Im allgemeinen aber nehme ich die Welt als Tableau. Ich glaube, meine dilettantischen Exzerpte aus Quantenphysik und Neurologie helfen mir ganz gut aus dem Schlamassel der Sprachverdrossenheit. Es gibt immer wieder Erkenntnissätze, also Sprengsätze, die mich zum Weitermachen ermuntern.
Naumann: Mir ist in einigen Gedichten aufgefallen, daß es da einen Beobachter gibt, der dasteht und betrachtet, was passiert. Die Gedichte sind kleine Situationsbeschreibungen, wie spotlights.
Grünbein: Das war damals so, heute hat sich das etwas verschoben. Man könnte sagen, von einer betrachteten Realität (der Oberflächen) zur beobachtererzeugten Realität (der Denkbilder). Damals hatte ich die Vorstellung, daß alles, was ich wirklich sehe, eine Aneinanderreihung von Momenten ist, die ich glimpses nannte. Momente, in denen das Reale emblematisch erstarrt.
Naumann: Was sind glimpses?
Grünbein: Augenblicksimpressionen. Glimpses, dafür gibt es im Deutschen kein adäquates Wort, im Englischen bedeutet es flüchtiger Blick, flüchtiger Eindruck, Schimmer. Wenn sich das Lid über dem Auge schließt und du hast ein Motiv im Kasten, das aber, wenn du es prüfst, aus vielen Zufallselementen besteht, die sich zusammenfügen zu einer signifikanten Konstellation, einem natürlichen Gesamtzeichen. Und alles hängt allein von deiner Wahrnehmung ab, an diesem bestimmten Ort, zu dieser Zeit, in dieser Situation. Ich habe das damals versuchsweise systematisch studiert. Die Gedichte sind nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Mittlerweile ist diese Studienreihe abgeschlossen.
Naumann: Wie kam es zu deinem Buch? Andere haben jahrelang darauf warten müssen, in der DDR ein Buch verlegt zu bekommen und Du hattest inzwischen im Westen eins veröffentlicht?
Grünbein: Meine Gedichte sind damals vom Chef des Suhrkamp Verlages sozusagen vom Fleck weg engagiert worden. Siegfried Unseld war in Berlin mit Heiner Müller zusammengetroffen, anläßlich des 100. Geburtstages von Brecht. Müller kannte meine Arbeiten durch meine Freundin Suheer Saleh, eine Schauspielerin. Er hat sich auf seine dezente Weise immer irgendwie für den Nachwuchs interessiert. Müller wußte erstaunlich gut Bescheid über das Tun und Treiben der Jüngeren. Im Februar’ 88 meldete sich Unseld bei mir und machte mir sofort das Angebot für ein Buch in der edition suhrkamp. Für mich war das damals ein Glücksfall. Ich hätte mir beim besten Willen keine Publikation in der DDR vorstellen können. Außer 6 Gedichten in der Zeitschrift Sinn & Form ist von mir dort auch nichts erschienen. Ende der 80er Jahre gab es ja genügend Versuche zur Integration der Außenseiter und Partisanen der Gegenkultur, z.B. eine Reihe namens Außer der Reihe im Aufbau-Verlag, herausgegeben von Gerhard Wolf. Bei allem Respekt für ihn, fand ich diese preußische Idee des Außer-der-Reihe-Tanzens doch zu durchsichtig. Abgesehen davon hatte ich damals noch nicht die historische Distanz zu allem, was DDR hieß. Für mich war es noch immer eine Zwangsneurose. Erst kurz vor der Auflösung dämmerte mir, daß das ganze bei allem Terror auch ein phantastischer Ideologiespielplatz war, eine Tummelwiese für Soz-Artisten. Doch da war es schon zu spät, und der Massenexodus hatte begonnen, die stalinistische Götterdämmerung.
Naumann: Wie ist auf Dein erstes Buch reagiert worden?
Grünbein: Es gab wohl Verstimmungen. Sowieso konnte ich Manuskripte und Druckfahnen nur über Dritte, niemals direkt an den Verlag schicken. Aber es gab eine Art konspiratives Netz. Müller war äußerst hilfsbereit und immer mit guten Ratschlägen zur Hand. Das Büro für Urheberrechte verlangte eine Zwangsabgabe vom Honorar, und wider Erwarten ließ man mich sogar für 3 Tage zur Buchmesse nach Frankfurt ausreisen, obwohl ich offiziell einen Ausreiseantrag laufen hatte. Die Bürokratie überbot sich in surrealen Einfällen.
Neumann: Gab es, als Du nach Berlin kamst, dort eine besondere Atmosphäre?
Grünbein: Ich war immer ein bißchen für mich. In den literarischen Kreisen war ich nur Zaungast, erst später hatte ich öfter mit Egmont Hesses Zeitschrift Verwendung und mit Rainer Schedlinskis ariadnefabrik zu tun. In Dresden war es für mich sehr wichtig, viel allein durch die Gegend zu streifen. Meine Arbeiten entstanden nicht gerade im lebendigen Austausch mit Literaten. Ich war immer ein Dichter unter Bildkünstlern. In Berlin gab es dann auf einmal Abende, da saßen 10 Schriftsteller schwatzend in einem Raum, was im Grunde tödlich ist. Es kann produktiv sein, wenn es ein gemeinsames Projekt gibt, z.B. bei Übersetzungen, ansonsten sehe ich dazu keine Veranlassung. Für mich ist Dichtung ein großes Einzelgängerspiel. Die Geselligkeit der damals modischen Verbalakrobatik hat mich oft genervt. Meine Sprache verstand sich nicht missionarisch, sie war eher ein Schutz nach draußen, eine zweite Haut.
Naumann: … eher beschreibend, deskriptiv?
Grünbein: Die Literatur des Prenzlauer Bergs war zu der Zeit rein informell. Was da entstand, waren drip paintings, nur mit Silben und wild sich gebärdenden Präpositionen. Hin und wieder tauchte dann aber plötzlich ein Klarsatz auf, etwa: Mehr Sinnlichkeit, weniger Ratio! Ich fand das entlarvend, ich sah, daß hinter den Dadaismen missionarischer Eifer steckte, ein Denken in Oppositionen und Dualismen, Anarchie als Appell. Z.B. war Stirners Der Einzige und sein Eigentum sehr beliebt. Ich aber hatte bei den andern immer nach dem Hermetischen gesucht. Während es im italienischen hermetismo sowas wie eine rätselhafte Transparenz der Sprache gab, zeigte sich im Spiel mit den Etymen und Morphemen immer nur der offene Text. Beliebig erweiterbar, lebte er von seinen Querverbindungen und trickreichen Sprüngen, sonst nichts. Was mich begeisterte, war im Gegensatz dazu jene scheinbare Klarheit, die plötzlich in Stottern ausbricht, das Wetterleuchten der Aphasie. Nur im Wortwörtlichen oder Satzsätzlichen, wenn man so will, sah ich diesen Moment näherrücken. Wenn die Sätze konträr zueinanderstehen, dann auf einmal tut sich was, die Logik fängt an zu schielen. Was ist denn das sogenannte Gefährliche in der Sprache? Daß sie selbst in ihrer Fehlerhaftigkeit zur Falle wird, die über dem Sprecher zuschnappt.
Naumann: Wie siehst Du Dein Verhältnis zu anderen Literaturen, z.B. zur französischen?
Grünbein: Zur Zeit der Dresden-Gedichte habe ich eine Weile Rimbaud gelesen, später mehr Baudelaire. Was mich reizte, war diese frühe Bildalchemie, das Halluzinatorische der Großstadtdichter. Das war eine Versuchsanordnung des 19. Jahrhunderts, ausgehend vom Symbolismus, während es dann im Surrealismus einen unerträglichen Grad von Beliebigkeit erreichte und abdriftete in typisch katholischen Bilderkitsch. Ich halte Baudelaire für einen unheimlich präzisen Dichter, einen urbanen Reflexkünstler allerersten Ranges. Im Grunde kommt das, was er gemacht hat, aus einer transrationalistischen Tradition, die erst mit dem Tod der Romantik ihre ganze Bildschärfe entwickelte. Daß nämlich die Selbstauflösung des Moi nicht mehr möglich ist und dennoch ersehnt wird, diese Spannung erlaubt erst das Körperlichwerden der Worte. Eine andere Linie, die ich auf uns zulaufen sehe, stammt von den Elisabethanern, vor allem von Shakespeare. In diesem Jahrhundert hat mich vor allem Ezra Pound angezogen, auch Eliot, Olson, Lowell, Williams und Cummings. Bei Pound fand ich die Vielstimmigkeit, den Freien Vers als Polyphonie vieler gebundener Verse, hunderte Rhythmen und metrische Fragmente, die sich gegenseitig spiegeln. Langezeit war ich in seinen Cantos, dem vielleicht größten dichterischen Konzept des Jahrhunderts, unterwegs. Dagegen ist für mich alles Sprachkritische nur eine Fußnote. Mittlerweile befasse ich mich mehr und mehr auch mit Leuten, die gar keine Gedichte geschrieben haben und dennoch wichtig sind für die Poesie. Duchamp fällt mir ein, Peirce, Schrödinger, Wittgenstein oder Leonardo da Vinci. Sehr spannend finde ich die enorme Anschaulichkeit und dimensionale Tiefe in den Sprachbildern Ossip Mandelstams. Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts tut sich insgesamt ein riesiges Feld auf an Prozeduren und Stilen. Viele kämpfen an verschiedenen Fronten mit ähnlichen Formproblemen. Und wenn einer wirklich intensiv kämpft, ist es allemal interessant genug.
Naumann: Wie siehst Du Dein Verhältnis zur Zeit, zur Geschichte?
Grünbein: Ich bedaure ein wenig, daß ich dem sozialistischen Osten damals noch kein konzeptuelles Verhältnis abgewinnen konnte. Die ideologischen und historischen Zeichen waren ja alle verfügbar. Aber kaum einer hat sie so benutzt, wie man es jetzt bei sowjetischen Künstlern der inoffiziellen Szene findet. Leute wie Wladimir Sorokin oder Dmitri Prigow sind mit dem spezifischen totalitären Material so frei umgegangen wie jenseits des Atlantik die Pop-Art mit den Zeichen der Werbe- und Warenwelt. Das hätte ich mir gewünscht, es war aber vermutlich unmöglich, schon durch die Nähe zum Westen Deutschlands, diese unglückliche Geschwisterbeziehung. Es gab nicht diesen Abstand, dieses freie Operieren, die brikolage mit den Mythen und Zeichenwelten des Sozialismus und seinen totalitären Diskursen. Ganz zum Schluß drang das bei mir manchmal als Erkenntnis in theoretischen Aufsätzen durch, die Idee des Spielplatzes, wenn man sich die Freiheit nahm, es so zu sehen und sich nicht unmittelbar, auch körperlich, im Clinch mit dem System befand, denn dann war es mit der Freiheit meist vorbei, auch mit der inneren Freiheit. Es ist schade, der wirklich postutopische Standpunkt zeigte sich erst zu spät.
Ganz am Anfang habe ich mich natürlich noch ganz naiv für all die politischen Emanzipationsideen und Revolutionskonzepte des Jahrhunderts begeistert. Dann kam die kritische Phase, die ultralinke und anarchistische Phase, in dieser Reihenfolge, erst Trotzki, dann Bakunin, dann wieder zurück zu Rosa Luxemburg, bis ich noch einmal ganz genau die frühen Marxschriften las, das Lilienthal-Zeitalter marxistischer Flugkunst. Und weiter im Kurzdurchlauf mit den Propellerflugzeugen der Frankfurter Schule bis zu den Düsenjets der französischen Strukturalisten, ab durch die Schallmauer der Affirmation. Irgendwann hielt ich das ganze nämlich für theologische Streitigkeiten, recht mittelalterlich, Realisten und Nominalisten, kreuz und quer. Nach soundsoviel Konzilen war alles hoffnungslos zerspalten und in Sekten aufgeteilt. Und wo blieb Dichtung? Witzig fand ich erst wieder eine Vorstellung, die in den Kommunisten Außerirdische, aliens, sah. In diesem Zusammenhang habe ich dann so sarkastische Serien geschrieben wie „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“. Der Künstler im Osten als Grenzhund, entlang der politischen Territorien streunend. Ich fühlte mich damals entsetzlich verarscht und biographisch mißbraucht, als der Schwindel im Jahr ’89 aufflog. Unfreiwillig haben fast alle Künstler in dieser oder jener Weise den Grenzhund gespielt, die einen als Wachhund, die andern als Rettungshund und indem sie beharrlich die Mauern beschnuppert haben auf der Suche nach einer Lücke. Überschreitung als solche hat kaum irgendwo stattgefunden. Der Pawlowsche Reflex war ein gemeinsamer Nenner. Und davon handelt mein letztes Buch Schädelbasislektion, eine Art Testament oder happy necroloque auf die Ära der doppelten Logik. Einmal fragte mich ein Amerikaner, als ich ihm sagte, ich käme aus Berlin: „Free side or bad side“ Seither weiß ich, daß alles, was ich bisher getrieben habe, Poetry from the bad side ist.
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 124, Dezember 1992
Der junge Grünbein und die DDR
– Poetik eines Schreibens jenseits der Avantgarden. –
Im Oktober 1991 beantwortet Durs Grünbein Thomas Naumanns Frage, warum seine Gedichte so gänzlich anders seien als jene der Dichter vom Prenzlauer Berg, zu denen er ja gezählt werde:
Der Fehler liegt in der Zuordnung. Ich war im selben Revier, aber fern der Programme.115
Von der jüngsten Dichtergruppe der DDR, die sich in den 1980er-Jahren konstituierte, grenzt er sich also entschieden ab. Und auch sonst dürfte man sein Verhältnis zur DDR-Literatur eher als ein ödipales anzusehen haben.116 Jedenfalls hat er in seinen frühen Essays keinen Hehl daraus gemacht, was er über den dazugehörigen Staat und dessen sozialistischen Legitimationsdiskurs dachte. In dem 1990 erstmalig publizierten Aufsatz „Verspätete Züge“ (1990) schreibt er:
Ich verrate nun die gewaltsame Landschaft der Theologie und gebe mich dem materiellen Gewimmel einer Welt hin, die nur den Tausch, aber keinen anderen Ausweg als den Tod kennt. Von einer geschlossenen Welt der Ideen laufe ich über in eine Dingwelt, die scheinbar offen ist. Ich weiß nun, daß ich nichts zu sehen bekommen werde, als was vor meinen Augen liegt, selbst im Traum. Alle Logik haftet den Dingen an und ist Tautologie.117
Vergleichbare Statements durchziehen sein lyrisches und essayistisches Werk wie ein roter Faden. An anderer Stelle, in dem ebenfalls frühen Essay „Im Namen der Füchse“ (1993) heißt es, nun mit einem dezidierten Blick auf literarische Fragen:
Im Streit zwischen Wolf Biermann und Sascha Anderson verneige ich mich voller Respekt vor der göttlichen Nina Hagen.118
Biermann hatte Anderson im Herbst 1991 als Stasi-Spitzel enttarnt und damit eine breite Debatte um den jungen Künstler ausgelöst. Da Grünbein sich von beiden distanziert, möchte er sich offenbar aus den politischen Querelen um die DDR-Vergangenheit heraushalten. Anders gesagt: Wenn er sich mit der exzentrischen Punk-Ikone Nina Hagen solidarisiert, dann suggeriert er, dass die Problemfelder der DDR-Literatur für ihn keine fruchtbaren Felder sind. Dass Hagen Biermanns zeitweilige „Quasi-Stieftochter“ war (immerhin war er von 1965 bis 1972 der Lebensgefährte ihrer Mutter), wird Grünbein gewusst haben, was seiner Abgrenzung eine (selbst-)ironische Pointe verschafft.
Auch wenn Grünbein auf dem Territorium der DDR aufwuchs und hier sozialisiert wurde – was er nach dem Mauerfall gelegentlich mit dem sarkastischen Bild des auf simple Reiz-Reaktions-Muster reduzierten Pawlow’schen Hundes quittierte119 –, so sieht er sich doch offenbar nicht ihrer literarischen Tradition verpflichtet oder will diese gar fortführen.120 Und aus diesem Grunde muss es auch als fraglich erscheinen, ob sein Œuvre überhaupt dem Text-Korpus der DDR-Literatur zugeordnet werden kann. Schon Fabian Lampart schätzte ihn bündig als einen ,Nicht-Repräsentanten‘ ein und schrieb über seine Poetik:
Sein ästhetisches Programm ist kaum vereinbar mit einer Lyrik. der es um die Kommentierung des Zeitgeschehens oder gar um Engagement zu tun ist. […] Als Repräsentant für eine die Wende- und Nach-Wende-Zeit problematisierende ,DDR-Literatur der neunziger Jahre‘ taugt Grünbein nicht.121
Als eine Situierung „jenseits der Avantgarden“ hat Grünbein knapp zwei Jahrzehnte später, in der Frankfurter Poetikvorlesung Vom Stellenwert der Worte (2009/10),122 seine eigene poetologische Position beschrieben und damit seine ausgeprägte Abneigung gegen jegliche Form engagierten Schreibens noch einmal unmissverständlich herausgestellt.
Diese post- oder auch – mit einem Ausdruck des italienischen Kunsttheoretikers Achille Bonito Oliva – trans-avantgardistische Poetik123 soll im Folgenden rekonstruiert werden, und zwar mit besonderer Betonung des Frühwerks, wie es sich im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des Mauerfalls entfaltet. Daraus folgt, dass ich mich auf jene beiden Gedichtbände beschränken werde, die dieses zeitgeschichtliche Ereignis flankieren – Grauzone morgens (1988) und Schädelbasislektion (1991). Die dazugehörigen poetologischen Selbstvorgaben aus Grünbeins Essayistik sind ebenfalls vorzustellen. Abschließend werde ich einen knappen Ausblick auf das spätere Werk vornehmen.
Grauzone morgens (1988): Geschichtsverlust, Individualismus, Wahrnehmungspoesie
In seinem Buch La Transavanguardia Italiana (1980) vertritt Oliva die These, dass das Fortschrittspathos der Avantgarde seit den 1970er-Jahren in der Kunst nicht mehr gegeben sei. Anstatt dem Zwang zum Neuen zu folgen, emanzipieren sich laut Oliva die Künstler von kollektiven Semantiken. Der Einzelne folge keiner normativen Dogmatik mehr, sondern arbeite nach einem Ansatz, der jeglicher Dogmatik gerade entgegengesetzt sei: Er arbeite an dem „Bruch des gesellschaftlichen Bedürfnisses“. 124
Damit hat Oliva eine Beobachtung gemacht, die sich cum grano salis als eine wesentliche Tendenz auch des Grünbein’schen Œuvres festhalten lässt. Schon von seinem ersten Gedichtband Grauzone morgens an, der noch zu DDR-Zeiten erschien, sucht Grünbein den von Oliva proklamierten „Bruch des gesellschaftlichen Bedürfnisses“, der vor allem ein Bruch mit dem sozialistischen Bedürfnis nach allgemeiner Erziehung ist.125 Grünbein, der von sich selbst bekennt, dass die Dichtung für ihn „ein großes Einzelgängerspiel“126 sei, beschreibt seinen Debütband als „eine Art friedliche[n] Impressionismus, verschlafen und provinziell“127. Der Band, der in seinem titelgebenden Hauptzyklus eine Flanerie durch das frühmorgendliche Dresden der 1980er-Jahre mit lyrischen Mitteln inszeniert, sei „gespickt […] mit dresdentypischen Impressionen, lauter kleine Anti-Elegien, detailreich und minimalistisch aneinandergereiht“.128 Grauzone morgens ist ein Buch, das die „Agonie des Realen“ (Baudrillard) kurz vor dem Zusammenbruch der DDR dokumentiert;129 es zeigt eine Welt im Stillstand („,Nichts geht mehr‘ heißt ein Gefühl / von allen Seiten fotografiert“),130 behauptet aber auch gleichzeitig ein frühmorgendliches Orientierungsverlangen, den Augenaufschlag beim Erwachen. Ein Buch auf der Schwelle zu einer neuen Zeit, die noch nicht angebrochen ist.
Grünbeins Erstling fällt in eine Zeit des rapiden Autoritätszerfalls der staatlichen Mächte wie der utopischen Legitimationsdiskurse der DDR.131 Die Geschichte, an der sich noch die Autoren der ersten Generation – insbesondere sein Förderer Heiner Müller – abgearbeitet hatten, hat für die jungen Dichter wie Grünbein ihre bindende Kraft verloren. Grünbein artikuliert ein Zeitgefühl des „Du, allein mit der Geschichte im / Rücken“ und des „alles erlaubt“.132 Radikaler Individualismus und Bewusstsein des Posthistoire sind bei Grünbein keine schmerzlichen Verlusterfahrungen mehr, sondern Voraussetzungen eines Schreibens, das in ihnen Möglichkeiten zur Freiheit erkennt.133 Die Unbekümmertheit, ja die Kälte, mit der das Ende der Geschichte diagnostiziert wird, hebt ihn selbst unter den desillusionierten jungen Dichtern seiner Generation heraus,134 die dort auf ideologische Selbstwidersprüche aufmerksam zu machen suchten, wo Grünbein nur noch süffisant das „Nonsense-Ping-Pong- / Geschwätz“ „einer immerfort / gestrigen Politik“135 konstatiert und sich, achselzuckend wie ein Baudelaire’scher Flaneur, von ihm abwendet.
Da die Geschichte, der primäre Bezugsrahmen der DDR-Literatur, nicht mehr die Intentionen und Funktionen lyrischen Sprechens vorgibt, kann es für Grünbein auch kein Engagement geben, das sich in historischem Wissen rückversichert und aus ihm seine Energien wie Zukunftshoffnungen bezieht. Das funktionsspezifische Vakuum, das sich daraus ergibt, füllt Grünbein durch die „radikale[] Hingabe an eine heterogene Realität“, durch eine geradezu obsessiv betriebene „Suche nach einer zersplitterten Erfahrung“. 136 Nicht die ,Ideenwelt‘, die Grünbein – wie bereits im eingangs aufgeworfenen Zitat – gern mit dem Sozialismus assoziiert, steht im Vordergrund, sondern die ,Dingwelt‘, zu deren „Erkundung“137 der Dichter in dem wenig später entstandenen Essay „Ameisenhafte Größe“ (1989) aufgefordert wird. Und erkundet werden soll hier auf eine recht wenig sozialistische Art: nämlich ohne hochtrabendes ideologisches Rüstzeug, nur ausgestattet mit Wahrnehmung und Verstand habe sich der Dichter auf den Weg zu machen, so Grünbein sinngemäß im selben Aufsatz. Der „Stelzengang der Geschichte“,138 wie es in „MonoLogisches Gedicht No. 2“ heißt, wird ersetzt durch das ameisengleiche, sensible und detailversessene Vorantasten auf Tuchfühlung mit dem ins Auge springenden Realen, das in einer unsystematischen Folge lyrischer Notizblätter dargeboten wird. Nicht das, was Marx den ,Überbau‘ nannte, der schöne Traum der Utopie, interessiert Grünbein, sondern das einzelne, sprechende Detail: Unabhängig von sinnhaften Kontexten wird es als Gegenstand transitorischer Wahrnehmung, augenblicksweise und kühl, registriert. Schon Jahre bevor er dies im Essay thematisieren wird, tritt Grünbein als ein Dichter der „Anschauung“139 auf; und das Ding, das Objekt dieser lyrischen Anschauung, ist ein opakes Ding, d.h. eines, das sich eben nicht mehr auf eine höhere, geschichtliche Wahrheit öffnet, sondern idealiter reines „Konzentrat der Erscheinungswelt“140 ist – und daher auch kein Medium zur Verkündung von (gesellschaftlich funktionalen) Botschaften, keine symbolische Form zur Stimulierung von politischem Engagement mehr sein kann und will.
In Grünbeins Erstlingsband, der das Konzept einer phänomenologischen Wahrnehmungspoesie lyrisch umsetzt und damit einen wichtigen Aspekt der exogenen Poetik, wie sie sich mit „Ameisenhafte Größe“ zu entfalten beginnt, vorwegnimmt, tritt uns ein Autor entgegen, der sich genauso kaltschnäuzig wie unbeirrbar aus dem realexistierenden Sozialismus davonstiehlt – nicht wie Wolf Biermann auf dem Wege lautstarker Rebellion, sondern als ein Unterwanderer des (brüchig gewordenen) Ganzen im Namen des (ins Recht gesetzten) Singulären, dessen akribisch genaue Notation den Widerspruch gegen das SED-System und seinen totalitären Herrschaftsapparat anzeigt.141
Die bewusste Subversion der machtgestützten historischen Semantik darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gegenwartswahrnehmung doch von Zeit zu Zeit erinnerungsintensiv aufgebrochen wird, in einzelnen Reminiszenzen oder erleuchteten Augenblicken etwa, in denen etwas Historisches aufblitzt, das der öden Gegenwart eine komplexere zeitliche Tiefenstruktur unterschiebt. Nur werden in diesen Reminiszenzen keine DDR-typischen Autoritäten – wie etwa Maxim Gorki oder Anna Seghers – mehr sichtbar. Im Gegenteil: Grünbeins Anspielungsverhalten zeugt von einer Weltläufigkeit, die allein schon als staatsgefährdend hätte eingestuft werden können. Neben dem die „Gastfreundschaft der Toten“142 suchenden Höllenwanderer Dante („Kennen Sie Dante?“)143 und dem Archetypen aller lyrischen Flaneure. Charles Baudelaire („Grauzone morgens, mon frère“),144 die beide jenen diskontinuierlichen Wahrnehmungstyp verkörpern, auf den es ihm ankommt, sind außerdem der US-amerikanische Dinglyriker William Carlos Williams (vgl. den Zyklus „Glimpses & Glances“), der japanische Haiku-Dichter Matsuo Bashô, das spanische Bürgerkriegsopfer Federico García Lorca, T.S. Eliot und vor allem Ezra Pound die maßgeblichen Vorbilder, die hier erinnernd herbeizitiert werden und als Autoritäten für eine der Grauzonen-Landschaft angemessene Schreibweise fungieren.145 In der Erwähnung Ossip Mandelstams, des Opfers stalinistischen Terrors, wird darüber hinaus Grünbeins indirekter Einspruch gegen das sozialistische Schreiben besonders beispielhaft manifest. Ferner zeigt sie, dass die so nüchterne und emotionslose Poetik des jungen Grünbein durchaus eine ethische Seite hat, obgleich Ethik an sich – zunächst – keinen Programmpunkt in dieser Poetik darstellt.
Frühe Essayistik: Formierung einer postutopistischen und nachidealistischen Poetik
Der Abstand Grünbeins zu DDR-typischen engagierten Schreibverfahren kommt vielleicht nirgendwo so deutlich zum Ausdruck wie in seiner Bemerkung, dass „das Begreifen und Deuten“ ihm mehr abverlange als „jedes Meinen und Handeln“.146 Das (selbst-)bewusst gewählte Oppositionspaar dokumentiert die programmatische Stoßrichtung unmissverständlich. Wie ernst es Grünbein mit seiner selbstauferlegten Verpflichtung zum „Begreifen und Deuten“ ist, geht aus seinen Essays hervor, die ab 1989 zahlreich und in rascher Folge entstehen.147 Hier zeigt sich ein Autor, der seinen poetologischen Standpunkt zu bestimmen sucht, in einem offenen Prozess des Suchens und Fragens, aus dem sich die eigenen Positionen erst nach und nach herauskristallisieren. Sicher ist zuerst nichts; nur eines ist von vornherein klar: Ein engagierter Autor will Grünbein nicht sein.
Solches geht schon aus dem bereits erwähnten Essay „Ameisenhafte Größe“ hervor, der die „Verbindung von Poesie und Erkundung“148 behauptet und in dem Schulterschluss zwischen Dichtung und Naturwissenschaft einen „dritten Weg“149 jenseits von l‘art pour l‘art und littérature engagée erkennt, dem zu folgen Grünbein sich selbst beauftragt. Der Autor dieses Essays ist kein politischer Idealist, sondern ein Erfahrungshungriger:
Wissen will ich, schräg hineinsehen in Werdegänge, begreifen was los ist, was vor sich geht mit mir und den andern.150
Den alten, bis auf Platon zurückgehenden Topos des Dichters als Biene nach den Maßgaben postmoderner Selbstwahrnehmung aktualisierend, führt Grünbein den von ihm favorisierten Dichtertypus als eine Ameise ein, die gerade kein (idealistischer) „Honigsammler des Geistes“151 bzw. Welt-Geistes mehr ist, sondern ein empiristischer Sammler, der eine „ungeheure Terra incognita von Bildern und Prozeduren“152 vor sich ausgebreitet sieht und der sich als ein „poeta empiricus“153 durch die „Hydra der Empirie“ (Goethe) mühsam, aber neugierig voranarbeitet. Schon in seinem ersten Essay, also von Beginn seiner poetologischen Selbsterkundungen an, sucht Grünbein den Bodenkontakt; der Himmel der Utopie ist seine Sache nicht.
Zwei Jahre später bekundet sich diese Abneigung deutlich aggressiver. In dem im September 1991 verfassten „Brief über den Sarkasmus und das Gedicht als Konzept“, der aus einer Korrespondenz mit Marcel Beyer hervorging, entwickelt Grünbein anhand des Begriffs „Sarkasmus“ ein poetologisches Konzept, das auf ein dezidiert ideologiekritisches und antiutopisches Schreiben abzielt.154 Auf das altgriechische Verb sarkazein zurückgreifend, definiert er Sarkasmus als das Ablösen des Fleisches von den Knochen. Damit meint er die Abführung idealistischer und ideologischer Zuschreibungen zum Zwecke der Erkenntnis grundlegender Wahrheiten über den Menschen als biologisches Gattungswesen oder, wie er selbst sagt, zum Zwecke einer „Suche nach dem Arttypischen und Anonymen“.155 Um die „handelnden Ideen und Gebete bloßzustellen“,156 um den „Verblendungszusammenhang“ (Horkheimer /Adorno) der Ideologie als solchen zu entlarven, betreibt der Dichter ein „Spiel mit den Bruchstücken einer abduktiven Logik, die auf den Paradoxen tanzt“,157 damit wir die Zufälligkeit und machtbedingte Konstruierthet jeglicher Kontextualisierung erkennen.
Deutet sich hier bereits eine Ästhetik der Verflüchtigung an, so wird diese 1992, als Grünbein den Essay „Transit Berlin“ vorlegt, in einen typologischen und zeitdiagnostischen Rahmen gestellt. Der Frage nachgehend, welche Konsequenzen sich aus dem Übergang aus der festgefügten Welt des Kalten Kriegs in die offene Sphäre der nachsozialistischen Epoche insbesondere für die Künstler ergeben, entwickelt Grünbein sein Konzept vom „Transit-Künstler“,158 der als ein Gegentypus zum sozialistischen Künstlerideal einzuschätzen ist. Verfügte Letzterer – der offiziellen SED-Doktrin zufolge vor allem über eine durch ,Bewusstsein‘, ,Standpunkt‘ und ,Parteilichkeit‘ definierte Identität, gilt für Grünbeins Künstler die Identität nur noch als „Vexierbild“, als „Summe einzelner Illusionen, die insgesamt nur ein beliebtes Phantasma ergeben“.159 Anstelle eines Programms habe der Künstler „nur noch Nerven und einen feinen Spürsinn für Koordinaten“.160 Darüber hinaus ist er ortlos, zeitlos und führt das Dasein eines Nomaden, der „nirgends zu Hause und nie angekommen“161 ist, der sich durch „Nicht-Orte“ (Marc Augé) bewegt und dem das „Umschwärmen gerade der Übergänge und Schnittstellen“162 zum Prinzip geworden ist. Die Subjektvorstellung, die sich hier zeigt, ist nicht ausschließlich postmodern; vielmehr äußert sich in ihr eine Melange aus modernen und postmodernen Subjektvorstellungen:163 Grünbein denkt das Subjekt zwar als aufgelöst, hält aber dennoch an einer subjektartigen Instanz fest. Er bringt es zum Verschwinden, um seine Autonomie zu retten: „[L]istig einer anonymen Semantik entrissen“,164 sei der Künstler nunmehr auf freien Fuß gesetzt und „ganz allein zum Ansichsein verdammt“.165
Den bereits in Grauzone morgens lyrisch antizipierten und dann in „Ameisenhafte Größe“ auch in der exogenen Poetik eingeführten Typus des empiristischen Sammlers und dichtenden Forschers aufgreifend und diesen mit dem Ideal des ,Transit-Künstlers‘ und dessen Haltung des ,Immerfort unterwegs‘ verschmelzend, sucht sich Grünbein 1993 in dem Essay „Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen“ ein neues Vorbild, das bereits in Grauzone morgens beiläufig erwähnt wurde und durch das er seiner nachidealistischen, auf das Empirische und Wissenschaftliche kaprizierten Poetik auch eine historische Legitimation zu geben bemüht ist: Dante Alighieri. Zugleich wendet er sich dem Problem einer spezifisch dichterischen ,Anschauung‘ zu. Anhand einer, Einflüsse von Ossip Mandelstam und Edmund Husserl verarbeitenden, Lektüre von Dantes Divina Commedia entwickelt Grünbein eine Konzeption des dichterischen Bildes, die eine Einheit von „dichterische[r] Imagination und naturwissenschaftliche[r] Abstraktion“166 anstrebt, die die physiologisch-sinnliche Wahrnehmung von Welt mit ihrer intellektuell-visionären Durchdringung verbindet und dabei auf die Gewinnung anthropologischen Wissens fokussiert ist.167 Ein ganz wesentlicher Punkt ist: Dante setzt sich nicht über die phänomenale Vielfalt hinweg, ist – anders als der als Kontrastfolie eingesetzte, an abstrakten Gesetzmäßigkeiten interessierte Galilei – kein Forscher „mit dem bewaffneten Auge“ (das den Phänomenen, salopp gesprochen, den Garaus macht), sondern er wendet sich dieser inkommensurablen, phänomenalen Vielfalt gerade zu und hält eine „Zwiesprache“ mit den Dingen.168
Die bereits in früheren Essays, etwa in dem eingangs zitierten „Verspätete Züge“, erfolgte Markierung des Bruchs mit der sozialistischen Vergangenheit gewinnt in der im Oktober 1995 gehaltenen Büchnerpreis-Rede „Den Körper zerbrechen“ eine ethische Komponente, wenn Grünbein dem utopischen Denken pauschal unterstellt, im Moment seiner politischen Umsetzung als „Gesellschaftsentwurf“169 zur Keimzelle für menschenverachtende Gräuel zu werden:
Daß sie tief einschneiden ins Fleisch, daß sie die Leiber zermalmt am Wegrand zurücklassen, das ist es, was Geschichte und Revolution so weit von jeder Erlösung entfernt. Und deshalb ist jeder Gesellschaftsentwurf wertlos, wenn er nicht auch das Bewußtsein von der Zerbrechlichkeit dieser traurigen Körper einschließt. Mag sein, daß die Utopien mit der Seele gesucht werden, ausgetragen werden sie auf den Knochen zerschundener Körper, bezahlt mit den Biographien derer, die mitgeschleift werden ins jeweils nächste häßliche Paradies.170
Die Emphase dieser Textstelle verrät, dass Grünbein sich unter der Hand nun doch zu einem Dichter gemausert hat, dem man die frühere Abgrenzung gegen das engagierte Schreiben nicht mehr so uneingeschränkt wird abnehmen wollen. Anders gesagt: Der Sprecher dieser Sätze ist ein Engagierter – sicher nicht im politischen, aber dafür im ästhetischen Sinne. Als ein höchst engagierter Anwalt der „Körperwelt“171 auftretend, votiert Grünbein für eine Achsendrehung im Begriff der Geschichte: Angesichts der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts dürfe die Geschichte endlich einmal nicht mehr von den Träumen der Vernunft her gedacht werden, sondern mit Rücksicht auf die Realität der auf Schlachtfeldern oder in Folterkammern vernichteten Menschenleiber. Dem utopischen Denken (und Schreiben) stellt Grünbein in dieser Rede sein Konzept einer dichterischen Autopsie entgegen: Die „Obduktion“ der vom „solcherart präzisierten Körper her“172 gedachten Geschichte auf der Suche nach „etwas, das der ganzen kreatürlichen Existenz ihre Richtung“173 gibt.
Schädelbasislektion (1991): Beschleunigung, Polyphonie, Ichzerfall
Die in der Büchnerpreis-Rede geäußerte Leitvorstellung Grünbeins, in der Lyrik nicht mehr das Aussprachemedium einer gefühlvollen Subjektivität, sondern im Gegenteil „das geeignete Werkzeug für die vom Herzen amputierte Intelligenz“174 – also einer Intelligenz, die gerade nicht mehr von den ,warmen‘ Träumen utopischen Denkens beherrscht wird – vorlegen zu wollen, lässt sich als raison d‘être seines bereits vier Jahre früher publizierten, zweiten Gedichtbands, Schädelbasislektion, festmachen, der in unmittelbarer Folge der Wende entstand und veröffentlicht wurde. Dieser Band ist weit komplexer als der Erstling, und er reagiert auch auf eine wesentlich veränderte Situation: Nach dem Fall der Mauer findet sich Grünbein in einer offenen und beschleunigten Welt wieder, der Einheitssound der DDR-typischen Revolutionsrhetorik ist einer Stimmenvielfalt gewichen, die vom Subjekt nicht mehr bewältigt werden kann.
Aus diesem Grunde ist die Polyphonie ein wesentliches Leitmotiv dieses Bandes. Das Ich ist ein anderes als in Grauzone morgens: Kein stoischer Beobachter mehr, sondern nur noch eine anonyme Instanz „am Schnittpunkt sehr vieler Stimmen“175. Damit ist dieser Band eine einzige Kampfansage gegen die, dem Sozialismus entstammende, überkommene, „fatale Identität, die sich selbst nur in paranoischem Argwohn ertrug“.176
Die bereits in Grauzone morgens zu bemerkende Einbeziehung naturwissenschaftlicher Fachsprachen avanciert zum werkprägenden Merkmal. Sie ist sprachlicher Ausdruck der im Essay artikulierten Ambitionen, einem „Hunger nach Desillusionierung“177 bzw. „Verlangen nach anthropologischer Klarheit“178 nachgeben zu wollen. Die Haltung der Erkundung verschiebt sich ins Zerebrale und (Hirn-)Physiologische, die minutiöse Erkundung von Außenwahrnehmungen weicht einem schwindelerregenden Nachzeichnen hochkomplexer Wahrnehmungsprozesse, in denen sich die Grenzen zwischen Ich und Welt verwischen. Es ist, als ziehe sich Grünbein als Reaktion auf den plötzlich ins Unermessliche erweiterten Außenraum ins Schädelinnere – sein „endogenes Versteck“179 – zurück, als konzentriere er sich darauf, das urbane Leben als hirnphysiologisches Phänomen neu zu erschaffen. Das Ergebnis ist die verwirrende Topographie einer virtuellen Simultankonstruktion „[d]ieseits von Raum und Zeit“, geprägt von „Verwandlungen“ und „Hierarchiezerfälle[n]“.180
Das Transitorische, für Grünbein nunmehr zu einer alltäglichen Lebenserfahrung geworden, ist das bestimmende Stilprinzip. Es affiziert auch seinen Umgang mit den aus der Vor-Wende-Zeit überkommenen diskursiven Altlasten, die offenbar immer noch Bestandteil seines Hirns sind. Am markantesten zeigt sich dies in dem fünfteiligen Großzyklus „Niemands Land Stimmen“: In diversen Metaphoriken der Verflüchtigung bzw. Verflüssigung (vor allem im Motivbereich Wasser und Meer) werden zentrale Denkfiguren des sozialistischen Legitimationsdiskurses – etwa jene des geschichtlichen Fortschritts, der kollektiven Repräsentanz sowie auch und vor allem das substantialistische Identitätsdenken – zugunsten einer bewussten Veruneindeutigung und Virtualisierung raumzeitlicher wie personaler Koordinaten verabschiedet und auf diesem Wege die Künstlertypologie des Essays „Transit Berlin“ vorbereitet: Um die Hirnrinde, die den Alptraum Geschichte träumt, außer Kraft zu setzen, hat sich eine ,unrettbar‘ zerschlissene, auf die reine Wahrnehmungsfunktion reduzierte Ich-Instanz – oder besser: ein Nicht-Ich – ganz dem Andrang heterogenster Stimmen und Wahrnehmungen hingegeben und seine durch historisch-ideologische Narrative gestiftete Identität also ausgelöscht.181
Werden in „Niemands Land Stimmen“ Fragen, die Grünbeins Vergangenheit unter Hammer und Sichel berühren, noch ausschließlich auf der Ebene diskursiver Auseinandersetzungen verhandelt, so betrifft der Zyklus „Die leeren Zeichen“ Grünbeins Person ganz unmittelbar, und zwar in einer sehr direkten und schonungslosen Konfrontation mit dem Zwangscharakter des Systems DDR: Der Zyklus verarbeitet die leidvollen Erfahrungen des Autors in einem Ostberliner Polizeirevier vom Oktober 1989182 und thematisiert in verstörenden, sperrigen Bildern diese als eine die Integrität der Persönlichkeit bedrohende posttraumatische mémoire involontaire aus den Tiefen des Bewusstseins infolge einer körperlichen Gewalteinwirkung. Grünbeins Text, der Züge einer autopsieartigen Selbstschau trägt, führt die Regression eines kollektiven, durch die menschliche Vernunft erdachten schönen Traums in ein am eigenen Leib erfahrenes, sich leibhaftig konkretisierendes und dabei Körper und Geist des Individuums zerrüttendes Trauma plastisch vor Augen. Autobiographisches behandelt ebenfalls der Zyklus „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“, der aufgrund seiner zentralen Bedeutung für die vorliegende Fragestellung im Folgenden einer etwas genaueren Betrachtung unterzogen werden soll.183
Einflüsse aus der antiken Philosophie des Kynismus und der klassischen Moderne (u.a. James Joyce, Dylan Thomas, Franz Kafka) verarbeitend, stellt Grünbein sein vergangenes Ich in einem hochgradig sarkastischen und selbstironischen lyrischen Selbstporträt als einen ,Grenzhund‘ dar, der an der Zonengrenze der DDR entlangstreunt. Dieser Grenzhund – aufgrund der in sie einfließenden divergenten Semantiken eine überaus schillernde Metapher – ist zunächst und vor allem als Pawlow’scher Hund definiert: ein durch und durch konditioniertes Wesen, dessen leibseelischer Habitus vollständig in physiologischen Reiz-Reaktions-Mustern aufgeht.
Das Leben im Osten wird aus der Sicht eines Hundes geschildert, und damit bedient sich Grünbein eines Verfremdungseffekts, der die Funktion hat, das Offensichtliche und Vertraute so darzustellen, als sei es nicht mehr das Eigene, „als ginge es um irgendeine altgriechische Provinz“.184 In dieser „Parallelwelt“,185 in der die Zeit stillzustehen scheint, werden die Bürger mit „Illusionen“186 gefüttert, die wie Stickstoff eingeatmet werden und „als Gerücht längst reiner Traumstoff sind“,187 führen also ein fremdbestimmtes und der Wirklichkeit entrücktes Dasein par excellence:
Ein sattes Schmatzen zeigt: Auch Hunde träumen.
Was ihm den Maulkorb feucht macht, ist der Wahn
Daß Parallelen irgendwann sich schneiden188
Die sozialistische Utopie als das Wunschdenken des entsprechend konditionierten Hundes – mit dieser Vorstellung überträgt Grünbein implicite Herbert Marcuses Idee der repressiven Gesellschaft auf den Sozialismus und ironisiert auf diese Weise dessen Befreiungsrhetorik mit kaum zu überbietendem Hohn. Im Bild der sich im Unendlichen schneidenden Parallelen wird die sozialistische Erlösungsmetaphorik, die den Erlösungszustand in Gestalt des verwirklichten Kommunismus als Hoffnung an ein diesseitiges Ende projizierte, sarkastisch destruiert. Konsequenterweise erscheint in dieser Optik auch das marxistische dialektische Denken, das den DDR-Bürgern von früh auf antrainiert wurde, ausschließlich als „Hundetreue“, die lediglich vom „Sinn für die Stimmung in his master’s voice“ zeuge.189
So scheint die Situation der allgegenwärtigen Gängelung keinen Ausweg zu bieten – und doch zeigt Grünbein eine Möglichkeit auf, wie man dem fatalen ,Verblendungszusammenhang‘ entgehen kann bzw. konnte:
Doch blieb ich stoisch, mein Revier im Blick.190
Die Pawlow’schen Gemengeanteile in seiner Hund-Metapher zurückdrängend und dafür die traditionellen, d.h. die antiken und modernistischen hervorkehrend, stilisiert er sich zu einem intrakulturellen Widergänger,191 der sich nicht vereinnahmen lässt, sondern aus der Distanz beobachtet, was um ihn her geschieht. Anstatt sich durch die politische Theorie korrumpieren zu lassen, nimmt er sich den sophistisch-zweiflerischen Sokrates mit seiner festgefügte Welterklärungen zertrümmernden Denkweise zum Vorbild:
Denk an Sokrates.
Wenn der schwor ,Beim Hund!‘
Fiel eine Welt aus Meinungen in Scherben.192
Zum Schein mimt er den Angepassten, der im Himmel der Ideologie mitzuschweben vorgibt, in Wirklichkeit aber Bodenkontakt behält:
Wenn ich auf allen Vieren Haltung annahm,
Zündstoff mein Fell, lud mich der Boden auf.193
Das Bedürfnis, sich zu tarnen, nimmt er als Erblast der sozialistische Vergangenheit mit in die Gegenwart, denn in „Transit Berlin“ bestimmt er die „ironisch spielerische Tarnung oder Mimikry“194 als typischen Stil des postmodernen Künstlers.
Insbesondere aus der siebten Strophe geht deutlich hervor, dass Grünbein sich auch früher den politischen Kräfteverhältnissen zu entziehen suchte, um – wie schon die Vorbilder James Joyce und Dylan Thomas – eine Haltung des radikalen Individualismus zu pflegen:
Im Westen, heißt es, geht der Hund dem Herrn
Voraus.
Im Osten folgt er ihm – mit Abstand.
Was mich betrifft, ich war mein eigner Hund,
Gleich fern von Ost und West, im
Todesstreifen.195
Mit dem Mauerfall hat sich dieser Wille zur Autonomi nicht erledigt. Im Gegenteil: Die in ihm angelegte (modernistische) Tendenz zur Selbstmarginalisierung reichert sich um postmoderne Elemente an und radikalisiert sich zu einem Kurs der – bereits für „Niemands Land Stimmen“ und „Transit Berlin“ bemerkten – „Selbstverflüchtigung“:
Die Landschaft sinkt zurück, ein neuer Baugrund.
Seit ich hier raus bin, kennt mich niemand mehr.
Der Sand löscht aus.196
Mithin ist die neue Freiheit, die sich dem Hund erschließt, eine der Auslöschung. Er will vollkommen vergessen, wer er war und wo er herkam, seine Vergangenheit tilgen, sich vom antrainierten „Identitätszwang“ (Adorno) reinigen und diesen auf der „historischen Müllhalde“197 entsorgen. Denn was auf die (moderne) Ära historischen Stillstands folgt, ist die (postmoderne) unablässige Grenzüberschreitung in der „Flucht nach vorn“.198
Ausblick
In den folgenden Büchern, insbesondere in den Gedichtbänden seit 1999, wird diese ,Flucht nach vorn‘ sich allerdings als eine ,Flucht zurück‘, nämlich – zunächst – in die (spätrömische) Antike kundtun.199 Ganz generell kommt es zu einschneidenden Veränderungen in seinem lyrischen Werk. Die markanteste ist sicherlich die Schwerpunktverschiebung von der Naturwissenschaft zur Geschichte als maßgeblichem Fundus, aus dem sich Themen, Inhalte und vor allem die Form der Gedichte speisen.200 Grünbein avanciert immer mehr zum ,Klassizisten‘, der sich mit vollen Händen aus dem „Katalog sekundärer Formen“,201 wie er durch die Tradition bereitgestellt wird, bedient. Das hatte er zwar auch schon früher getan: Bereits in Grauzone morgens und in Den Teuren Toten (1994) spielte er mit Variationen der Dante’schen Terzine, im „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“ verwendet er die Stanze in (unreinen) Blankversen. Doch erst seit Nach den Satiren (1999) wird dieses so typisch für sein lyrisches Schaffen, dass man Grünbein mittlerweile geradezu mit einer postmodernen ars magna zu identifizieren geneigt ist. Seine Poetik arbeitet zusehends mit ihren eigenen Beständen, variiert und aktualisiert ihre programmatischen Kernbereiche und Motivfelder, nimmt Neues hinzu (wie beispielsweise Anbindungsversuche an die Philosophie, man denke an seine Auseinandersetzung mit Seneca und Descartes), gibt aber nichts vollständig auf. Nichtsdestotrotz ist unverkennbar, dass die frühe Poetik der sarkastischen Reduktion und des solipsistischen ,Einzelgängerspiels‘ ihre Dominanz verliert und dass statt ihrer ein dialogisches, ein ,metaphysisches‘ Poesie-Konzept an Boden gewinnt, das die Dichtung in ein Gespräch mit den großen Wahlverwandten der Tradition verwickelt sieht und sie solcherart vorrangig als ein Medium des Gedenkens und des Aufbereitens von Geschichtlichem begreift.202 Das 2003 veröffentlichte Descartes-Epos Vom Schnee spricht hierzu deutliche Worte.
Immer wieder finden sich in den späteren Büchern (Erinnerungs-)Gedichte, die die Wendezeit oder – weit häufiger – die eigene Vergangenheit unterm Sozialismus thematisieren: Denken wir etwa an „Trigeminus“ aus Falten und Fallen (1994), an „Novembertage“ oder „Vita brevis“ aus Nach den Satiren, an „Abschied vom Fünften Zeitalter“ aus Erklärte Nacht (2002) oder „Russischer Sektor“ aus Strophen für übermorgen (2007). So unterschiedlich diese Gedichte im Einzelnen sein mögen, gemeinsam ist ihnen eines: Der sarkastisch-mokante Ton, der sie nach wie vor prägt, verliert seine provokante Schärfe, wird abgeklärter und souveräner, etabliert sich als ein Muster, das routiniert fortgeschrieben wird. Während der junge Grünbein noch an der Subversion DDR-typischer, engagierter Schreibverfahren und -intentionen arbeitete, hat sich der ,zweite‘, der ,historische‘ Grünbein davon gelöst. Nun erhebt er seine Stimme als kritischer Kommentator, erprobt er Formen literarischer Einmischung, die im Zeichen einer „elitären“ Variante engagierten Anti-Engagements zu sehen sind. Der Sarkast aktualisiert sich, indem er sich neuere, zeitgemäßere Angriffsflächen sucht, etwa den Kapitalismus, die westliche Freizeitindustrie oder auch den islamischen Dschihad-Gedanken. Um in dem zuletzt in Koloß im Nebel (2012) ausgiebig bemühten Bildbereich, jenem des Meeres, zu bleiben: Sein Schiff hat die brüchigen Taue endgültig losgeworfen, die das Frühwerk noch mit der Literatur der DDR verbanden, und sei es nur in der „Geste des Abwinkens“.203 Die Geschichte ist für ihn nicht nur, wie Helmut Böttiger es einmal formulierte, der „Fluchtpunkt nach dem Büchnerpreis“204 geworden, sondern auch und vor allem ein Fluchtpunkt nach der Überwindung der Avantgarde.
Hinrich Ahrend, aus Mirjam Meuser, Janine Ludwig (Hrsg.): Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland Band II, fwpf, 2014
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


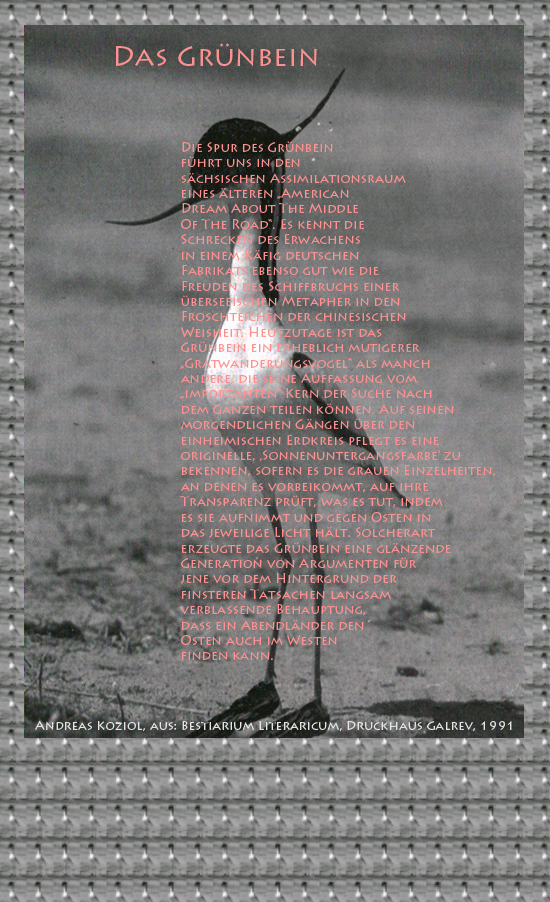
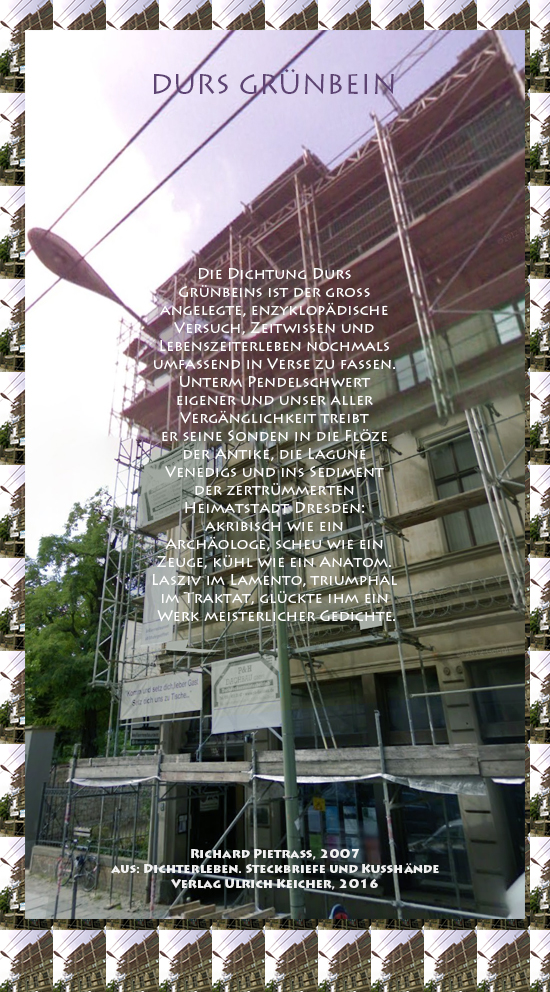












Schreibe einen Kommentar