Elisabeth Borchers: Zeit. Zeit
ZEIT. ZEIT
Ich muß endlich begreifen
daß ich Zeit habe.
Zeit für den Vogel auf der Brüstung
der mit mir redet, im Auftrag.
Zeit für den Lampenfuß
in dem sich das Erdenlicht spiegelt.
Zeit für die Katze auf blauem Samt
in kleinstem Format an der Wand
von Almut gemalt, als beide noch lebten.
Auch für das Schaf mit den schwarzen Ohren
den schielenden Augen, dem schiefen Maul und dem
durstigen Mund. Indianisch, ganz einfach, instruktiv.
Vermissen werde ich’s im kommenden Jahrhundert.
Ich habe noch nicht ein stillschweigendes Wort
mit der getrockneten Rose gewechselt, woher und wohin denn.
Und das Kalenderbuch in schwarzem Leder
mit der goldenen Jahreszahl
klafft elegant auseinander, um mich ein- und auszulassen.
Lernen, Zeit zu haben.
Lernen, daß es zu spät ist.
Zeit. Zeit
ist ein neuer Gedichtband von Elisabeth Borchers, ein Opus magnum, ein klares, schönes, leuchtendes, weises Buch. Der Band ist im Februar 2006 erschienen, anläßlich des 80. Geburtstags einer großen Autorin.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2006
Elisabeth Borchers: Zeit. Zeit
Elisabeth Borchers, dieses Jahr achtzig geworden, hat sich unauslöschlich ins anspruchsvolle Buch der modernen Lyrik eingeschrieben. Und ihre Leser sind dankbar für die Kraft des produktiven Weiterlebens – alle drei Jahre erscheint ein neuer Gedichtband, und immer aufs Neue gelingen zauberische Verse, von denen gilt, was sie dem Weihnachtsstern zuschreibt: dass sie ihren Glanz über uns werfen. Es ist ein eher klassisches Poesieprogramm, dem sie, die Betreuerin so vieler zeitgenössischer, gerade auch modernistischer Dichter, mit Leib und Seele anhängt. So ist die I. Abteilung des neuen Bandes einfach mit „Ergriffensein“ überschrieben, einem Reizwort für die Modernisten, die „das Material kalt“ wollen. Poesie dürfe nicht in die „Subjektfalle“ stolpern, was für Lyrik eine höchst befremdliche Warnung ist. Elisabeth Borchers scheut sich nicht, im klassischen Wie-Vergleich Wahrnehmungen und Erfahrungen aufzurufen, die ganz subjektiv und höchst allgemein und immer streng poetisch geformt sind. Zu einer Träne heißt es:
Durchscheinend wie Mondlicht, wie Sternenstaub
Leuchtend wie der Schmerz eines verlassenen Kindes.
Die Handlungen in der Welt und das sich empfindende Ich werden immer neu zusammengehalten:
Schritt um Schritt verweht
wie das Klopfen des Herzens.
Anders ist auch Entfremdung nicht denkbar geschweige denn einzuholen. So imaginieren ihre Gedichte immer wieder einen Ort, wo „alles Vergehen abgegolten ist“, meistens in Bildern der Tiefe, unterm Loreleyfelsen, oder im Blau, das „aus herzinnerster Erde“ kommt.
„Nicht zu tilgen“ heißt eine Abteilung, die sich an den von Elisabeth Borchers so geliebten Kinderversen orientiert, dem Urstoff aller Poesie, wo noch „alles ineinander“ verwoben ist und Versprechen glaubhaft sind, weil sie Erfüllungen bedeuten. Die Unglücke und die Freudentänze finden hier ihre zage Sprache, eine gestisch-rhythmische Andeutungsrede, die Borchers auch Sprünge „ins nicht Wiederholbare“ nennt. Doch „ob Glück oder Unglück / ob Kopf oder Bauch“, Borchers will den Menschen – „ohne Getöse, ohne die Schmerzen der Welt“ – als Bezugsort solcher Pole festgehalten wissen:
Beide wenden sich
der Herzgegend zu
beide dem Herzen.
Auch romantisches und surrealistisches Bildmaterial (der Baum ohne Schatten z.B.) ist willkommen, um die Erfahrung gelungenen und zersprungenen Daseins in Worte zu fassen. Welch eine schöne Exposition:
Du und ich
Seite an Seite.
Wir berechtigen
den Tag, die Nacht.
Der Hinfall des Wir, der Tod des geliebten Partners, zerreißt die Konturen des Ich, bildet sie neu. Borchers’ Verse sind der so anspruchsvolle wie subtile Versuch, der lyrischen Moderne und ihren märchenhaften Schönheiten ein Versprechen zu entlocken, eines das ihre Verse immer schon eingelöst haben: dass die preisgegebene (klassische) Kontur das Ich nicht ganz heimatlos macht, solange es sich in Natur und Dichtung spiegeln und als produktiv begreifen kann:
Die Wolken sind wieder blau
Der Baum ist wieder grün
Die Krone ist mein Versteck
Wie Böhmen nur in der Dichtung am Meer liegt (Shakespeare, Bachmann), so ist auch „der reinen Wolken unverhofftes Blau“ im Vers (Stefan Georges) zu Hause, einmal wieder und wieder neu bei Elisabeth Borchers.
Alexander von Bormann, Deutsche Bücher, Heft 4, 2006
Einfach großartig
Elisabeth Borchers gehört zu den wenigen Poetinnen (und Poeten) im Lande, die die Sprache mit virtuoser Schlichtheit handhaben können und dennoch bleibende Bilder schaffen. Schon das erste Gedicht ihres neuen Bandes Zeit. Zeit (vielleicht sollte man den Punkt im Titel mitlesen…) schafft es, aus der Schilderung einer Bahnreise eine Metapher für Leben, Werden und Vergehen zu entwerfen:
… Züge, die uns fortfahren auf
immer und ewig.
Oder:
Die harmlosen Tunnel rufen ins Schwarze.
Dem Gedicht ist ein „PS.“ angefügt, dass fast zum poetischen Credo wird: Sie sagt darin, sie habe Gedichte gelesen und „du liest und die Sternbilder werden sichtbar.“
Sichtbar werden, erkennbar werden bei Borchers Gedichten Einsichten in unsere Vergänglichkeit, in das, was bleibt – und eine vielleicht melancholische, immer aber in der Haltung großartige Hinnahme dessen, was unabänderlich ist.
Schade einzig, dass der Suhrkamp-Verlag zum achtzigsten Geburtstag der Dichterin diese hervorragenden Gedichte in seine billige broschierte Reihe verbannt hat; hier wäre gewiss ein gebundenes Buch angebracht gewesen.
Hans-Jürgen Singer, amazon.de, 15.3.2006
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + DAS&D + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Elisabeth Borchers: Park ✝ FAZ ✝ Welt


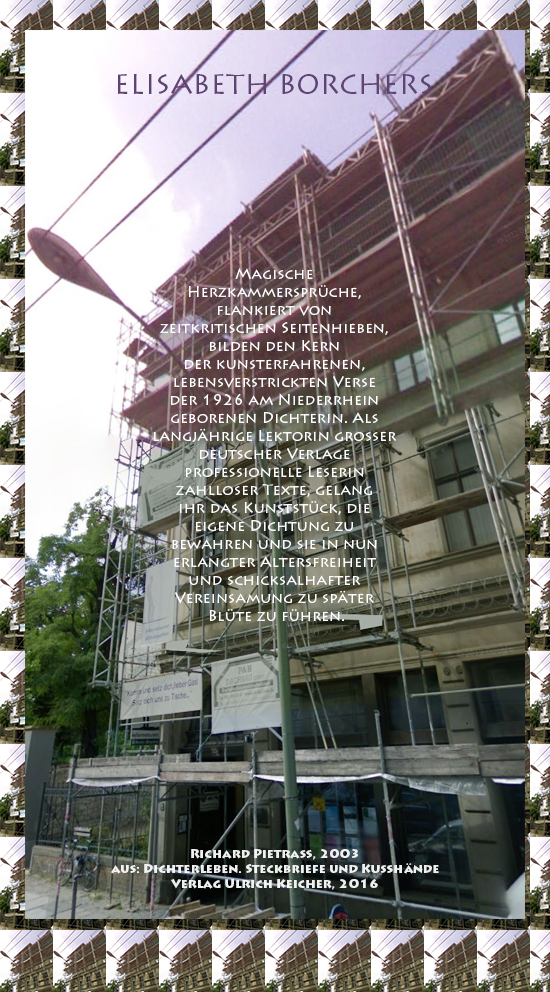












Schreibe einen Kommentar