Elke Erb: Kastanienallee
KASTANIENALLEE, BEWOHNT
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags
um halb fünf roch es flüchtig
nach toten, selbstvergessenen Mäusen.
1.1.1981
Das erste Gedicht des neuen Bandes? – Nein. Mit dem ersten Gedicht fängt man noch nicht an, den neuen Band zu schreiben.
aaaaa„Eins ist jedenfalls wieder fertig. Erstmal“, murmelt, dem Nest entstiegen, das Huhn und reibt sich die Hände.
aaaaa„Eins jedenfalls ist erstmal wieder fertig“, sagt die Bäuerin in der Vorratskammer und lachte sich ins Fäustchen.
aaaaaErstmal. Wieder. Jedenfalls.
Aber es ist nicht – einfach so – nur ein Gedicht,
aaaaasondern recht zwangsläufig unbestimmt,
aaaaanämlich fremdbestimmt, also nicht frei
aaaaairgendein Gedicht,
denn es ist das erste dennoch nach dem abgeschlossenen Band: …
Selbstauskunft
Was ich schreibe, das lebe ich auch.
Gregor Laschen: Wir haben in deinen Texten eine bestimmte anstrengende Sprache, die Sprache wird auf eine ganz bestimmte Höhe getrieben. Dann gibt es zweitens einen Text, vor allem in diesem neuen Band, der diese Gedichte, der diese Texte begleitet, kommentiert – wir werden über den Begriff des Kommentars noch reden −, der ebenfalls eine ganz bestimmte begriffliche Höhe hat, der die Sprache, das Denken anstrengt, und da sehe ich eine Parallelität zwischen Originaltext und dem Text über diesen Originaltext, also dem Sprechen über diesen Text. Muß das so sein? Inwieweit ist der erklärende Text, der analysierende Text überhaupt nur ein erklärender Text, ein analysierender Text? Muß er seinerseits nicht auch wieder dem Leser erklärt werden?
Elke Erb: Ich spreche von Kommentaren, keineswegs von Interpretationen, auch nicht von Erklärungen und von Lesehilfen und so weiter. Ich stelle mir die Kommentare vor nicht als einen Beistand für die Leser, sondern als einen Beistand zu den Texten. Sie wollen den Texten beistehen. Ich hatte das Gefühl, die Texte in dem Band Kastanienallee divergieren und sie sind heterogen. Ich meinte, ein Buch darf das nicht nur einfach so versammeln. In einem Buch muß etwas Ganzes, etwas Abgerundetes erscheinen. Und dann kam ich auf die Idee, die Entstehungssituation und ähnliches, ja, vielleicht so die Absegnung in Worten, die einem durch den Kopf kommen, wenn man einen Text niedergeschrieben hat, unten zu notieren und wollte sehen, ob sich daraus etwas Ganzes ergibt, so daß, was den heterogenen und divergierenden Eindruck ausmacht, sich irgendwie wieder zusammenschließen kann. Das war der Grund für die Kommentare.
Laschen: Die Kommentare gehen aus vom Text und sie sollen dem Text beistehen. In welchem Sinne beistehen? Man könnte auf die Idee kommen, daß der Text selber sozusagen nicht in der Lage ist, für sich zu stehen, sondern einen Kommentar, einen zweiten Text braucht, der ihm beisteht in seinem Für-sich-Stehen. Das weist du aber an einer bestimmten Stelle des Kommentars zurück.
Erb: Den Texten beistehen, nicht, weil sie nicht für sich stehen können, sondern weil sie, umgekehrt, etwas zu sehr für sich stehen. Sie sind mir als lebende Wesen, als etwas, das in einer Einzeit lebt, entlaufen. Wahrscheinlich, indem ich Grenzen aufmachen mußte. Da habe ich fremden Bedingungen meine Stimme gegeben.
Laschen: Die Schwierigkeit, die Texte zu kommentieren, wächst – das heißt also: auch der Kommentar war und ist in einem bestimmten prozeßhaften, prozessualen Stadium.
Erb: Das sowieso! Mit der Kommentierung habe ich sowieso einen ungeahnten Prozeß begonnen. Und gegen die Mitte zu wurde es richtiggehend gefährlich, ich hatte Angst, und ich weinte. Ich fürchtete mich vor dem Aufbereiten. Insgesamt habe ich dann gedacht: Sowieso sind die Texte so, wie Früchte oder Pflanzen, die auf dem Acker gewachsen sind, also schreibe ich jetzt den Acker.
Laschen: Du sagst an einer anderen Stelle: Was ich schreibe, lebe ich. Es gibt eine Stelle, wo du über den Kommentar und seine Funktionen sprichst und sogleich selbstreflektierend den Verdacht zurückweist, daß das Gedicht, daß der Text nicht für sich stehen könne, sondern den Kommentar brauche. Aber jetzt sagst du selber, daß er den Texten beistehen solle.
Erb: In dem Sinn, was das Interesse des Buches betrifft, und das spiegelt ja wider ein Interesse des lebendigen Autors – das weiß ich nicht genau. Mir fehlte da etwas, eine Art organische Abrundung in dem Buch. Dann muß ich mich doch fragen, ist die denn in mir selbst? Wo ist sie denn? Was war der Grund?
Laschen: Zu Beginn von Kastanienallee −
Erb: – wo ich also noch nicht wußte, was dann wird −
Laschen: – was aus den Kommentaren wird, sagst du selber: Ich weiß noch nicht, wie die Kommentare gehalten sein werden. Mir schwebt vor, den Denkprozeß zu erfassen, dessen Ausdruck das Reden und Schweigen der Texte ist. Und es heißt dann kurz darauf: Vielleicht ist für andere Augen die Kommentierung nicht nötig, weil für sie die Texte nicht divergieren, sondern, wie Lebendiges gesellig ist, zusammengehören. Und ein wenig später heißt es: Stört ein kleingedruckter Zusatz, frage ich so auch, die heile Stille, das stille Heil, die vom unschuldigen Weiß der Seite (vor-)getragene Konfliktfreiheit des Zugangs zum Text, Voraussetzung für seine persönliche Berührung und Einverleibung? Das ist genau der Punkt, den ich meine: das Verhältnis zwischen Text, Ersttext, Primärtext und Kommentar, von dem du sagst, er solle dem ersten Text beistehen. Steht er auf derselben Höhe, oder ist es ein sekundärer Text? Ist es, glaube ich, nicht, nicht ganz jedenfalls – also laß uns versuchen, diesen Begriff des Beistehens, das Verhältnis zwischen Primärtext und zweitem Text, Kommentartext genauer zu machen.
Erb: Irgendwo habe ich das gesagt, was Beistand ist, ob der Beistand des Kommentars einem selbständigen Gebilde, das der Text doch, wie auch immer, hoffentlich ist, die Selbständigkeit verdirbt. Ich meine, daß es von der Entstehung her eigentlich umgekehrt ist: die Texte waren mir zu selbständig. Sie sind ja, wenn ich sage divergierend und heterogen – sie sind zu selbständig geworden. Das heißt: Ich bekomme sie nicht in eine Art von Einheit. Diese Einheit verlangt aber ein Buch, das eine Abgerundetheit doch anbieten müßte, um einzuladen. Natürlich ist das meine Auffassung, mein Gefühl von diesem Buch. Andere Leute, andere Menschen können das viel entspannter oder mit einem anderen Maß von Einheit auffassen. Für die wäre das Problem gar nicht da. Aber für mich ist es da. Und jetzt habe ich gedacht: Dem Band, dem zum Buch die Vollendung (Abrundung / Einheit) fehlt, beizustehen, bei meinen Texten (den Sachen, die mir im Leben „aufgefallen“ sind) – das ist ein Zitat nach Peter Altenberg – zugegen zu bleiben, selbst gegenwärtig zu sein, eine schöne Idee! Geistesgegenwärtig zu sein. Das würde dann heißen: Nicht mehr der ausschließliche Text, allein auf weißer Wüste – und ich schimpfe dann etwas: sein autistisch behinderter Alleinvertretungsanspruch, umgeben von Unaussprechlichem – und schimpfe noch ein bißchen mehr: nicht mehr die vom Himmel herabgrüßende Zinnen- oder Zahnlücken-Reihe – da stelle ich mir das Buch vor, Seite für Seite, immer so kleine Textchen oben, ja? Also nicht mehr: Das Haus steht nicht im Himmel das Haus steht auf seinem Grund. Also meine ich eigentlich, einen Beistand des Grundes geben zu können. Wo kommt es her – das ist naturgemäß auch das erste, was einem einfallen kann. Ich suche jetzt, wo das herkommt, um dann vielleicht imstande zu sein, diesem Entkommen der Texte, das soweit geht, daß sie sich nicht mehr in einem Band schließen wollen, nachzukommen, wenn ich noch einmal in die Entstehungsbedingungen gehe, also wenn ich einfach sage: da und daher kommt es. Es ist auch so, daß mir Leser sagen: Weißt du, ich lese diesen Kommentar und erstmal komme ich schwer voran, ich verstehe nicht so richtig, was du da tust, und bei alldem, wie ich mich auch bemühe, und was du da auch selbst tust, verschwindet der Text. Ich frage mich, wieso verschwindet der Text? Der steht doch da. Ich brauche doch nur zurückzugehen, und da steht der Text. Und das ist tatsächlich so: Du kannst wahrscheinlich über sehr viele molekülartige Einheiten – auch im Leben – sehr weit gehen, um sie zu erfassen. Und wenn die erklärte Absicht ist, und es einen Sinn hat, ein gelebtes Ganzes zu erreichen mit den Kommentaren, dann brauche ich eben diese Gänge. Und dann werde ich diese Gänge natürlich gebrauchen.
Laschen: Braucht der Leser sie auch?
Erb: Das weiß ich nicht, aber was stört es ihn?
Laschen: Daß sozusagen eine neue Lesart nach Durchgang durch diesen Kommentar dasein könnte, das könnte bedeuten, daß ein Leser, der zum Beispiel das Eingangsgedicht dieses Bandes Kastanienallee, bewohnt, gelesen hat, ein sehr kurzes, dreizeiliges Gedicht, und der dann den Kommentar liest, nachdem er sich sozusagen über deine Rückerinnerung an Ausgangspunkte dieses Gedichtes, wieso und warum es dazu gekommen ist und so weiter, vergewissert hat – dann geht er zurück und beginnt die Lektüre dieses Dreizeilers von neuem.
Erb: Ja, dann aber, wenn er wirklich nach dem Dreizeiler angefangen hat, den Kommentar zu lesen, halte ich es für ausgeschlossen, daß er fragen kann, wieso das alles jetzt ein Kommentar ist zu diesen drei Zeilen.
Laschen: Bei diesem Kommentar wird ihm klar, daß er sich ja schon auf das ganze Buch als Projekt bezieht.
Erb: So war es doch auch. Ich wollte einfach wirklich hierzu ein – ich fange jetzt an bei der ersten Seite: Ich habe diesen kleinen Text vor mir und denke daran, was ich bei diesem gedacht habe, nämlich etwa: Ist es der erste Text des neuen Bandes? Dann fange ich an, darüber nachzudenken, und mir wird überhaupt erst bewußt, was das bedeutet, wenn man ein Buch gemacht hat und den ersten Text als ersten dieses neuen Bandes auffaßt welche Fremdbestimmung das bedeutet.
Laschen: Ist das in der Tat so gewesen, daß es chronologisch der erste Text war?
Erb: Das war in der Tat so. Ich wußte wirklich nicht, wie diese Kommentare sein werden. Es war ja ein erklärtes Experiment mit einer offenen Frage: Werde ich es erreichen, daß ich zugegen bin und daß, wenn ich zugegen bin, das bedeutet, daß es eine Ganzheit wird, die dem Buch, eben diesem konkreten Buch, eine Abrundung gibt?
Laschen: Was hat das Bedürfnis ausgelöst, dem Buch durch Kommentare eine Abrundung zu geben? Was hat ausgelöst, daß du eine Vorstellung vom Buch hattest, dem offensichtlich die vorangegangenen Bände nicht genügten, denn die haben den Kommentar nicht gehabt. Da brauchten die Texte diese Kommentare nicht, diese Durchkommentierung eines ganzen Buches.
Erb: Nein, diese früheren Bände waren für mich abgerundet. Und das Gefühl von diesen Bänden konnte ich hier nicht erreichen.
Laschen: Mit dem ersten Gedicht wußtest du das? Du sprichst davon, es sei ein Experiment gewesen oder du hättest so ein Experiment kommentiert.
Erb: Ich hatte ja doch die Idee, diese Kommentierung zu machen, bevor ich überhaupt ranging. Und dann bin ich an das Manuskript gegangen und habe den ersten Text genommen, und darum nehme ich das Thema Buch auf.
Laschen: Das heißt, der Kommentar in diesem Band Kastanienallee ist entstanden, als sehr viel mehr Gedichte als das erste da waren?
Erb: Es waren alle Gedichte da!
Laschen: Es waren alle Texte da?
Erb: Es war ein ganzes Manuskript fertig, und es ergab nicht das mir gewohnte Gefühl: das ist jetzt etwas abgerundetes. Das war einfach nicht da.
Laschen: Und daraus schlossest Du dann, daß es nicht, sagen wir mal, an der Komposition der Texte liegt oder daß noch Texte fehlen?
Erb: Nein, das war aussichtslos! Ich bin wirklich der Reihe nach gegangen. Bis zur Mitte etwa hätten sie, wären die Texte so weitergegangen, einen Band in der Art der früheren Bände abgeben können. Und dann beginnen Ausbrüche in verschiedenster Richtung. Die Richtung wußte ich auch nicht, auf jeden Fall hatte ich von den Texten der zweiten Hälfte wohl das Gefühl − das ist mir erst dabei klar geworden −, daß sie die Abrundung zerstören, daß sie einen zerstückelten Horizont aufmachen. Irgendwie so etwas. Oder als ob sie auf verschiedenen Horizontbahnen und konzentrisch sich um mich herum bewegen, der eine dort, der andere näher, der dritte da, und auch noch in den Richtungen verschieden – eben keine gerade Bahn mehr. Und ich nehme an, daß das mit dem Leben etwas zu tun hatte, mit den Korrekturen, die ich im Leben zu unternehmen hatte. Natürlich unternimmt man sie geistig, und dann sind die Folgen davon Texte. Weißt du, also immer im Kopf war der Text – ein Beispiel:
SCHNAPPSACK
Die Klappmasse klart auf ein Klack
Die klare böse Masse klappt
Diklipper diklapper wie Wasser
Verplappert von Pappe
Dieser bösen Masse, dem Wrack
Auf und ab steppt die Klappen der Fakt
Und im Treck schnappt die Tappen der Trakt
Und im Takt hackt die Treppen der Kasper
Laschen: Und der Kommentar?
Erb: Aus dem Kommentar lese ich zunächst vor, wie die Ausgangssituation ist: Jemand hatte, um Verhältnisse zu bezeichnen, ein Wort genannt, das sie lautlich abbildete. Es war ein Name oder Buchtitel mit mehreren konsonantisch verschlungenen A. Damit hatte er, obwohl ich das Wort vergaß, die Anregung gegeben, auf deren Grund ich die Sache, um seinetwillen und um ihrer selbst willen, mit dem Wort Klappmasse beginnend, aushandelte. Also, es ist ganz deutlich, das: um seinetwillen und um ihrer selbst willen. Der Text ist also die Sache um ihrer selbst willen; seinetwillen bedeutet: Der, der das gesagt hat, für den das ein solches Wort gewesen war, dieses mit den A. Ich aber bin nicht dabei. Wo bin ich dabei? Oder wo ist etwas, ein Anspruch oder auch nur ein Bedürfnis, mit einem Text wie diesem auf etwas Ganzes zu reagieren, so daß man von diesem Text aus weiterleben könne. Ich nehme an, es handelt sich um Texte, die – früher sagten wir, wie hieß das: operativer Art sind. Aber da haben wir immer gemeint: die in das gesellschaftliche Bewußtsein eingreifen oder so etwas. Sie haben ein Eirund verlassen von – wie nennt man das – organischer Begrenzung oder so, und fangen an, so als ob es kein Elternhaus mehr gäbe, oder was einen sonst noch empfängt, in der Außenwelt zu arbeiten.
Laschen: Das ist aber ein ganz anderes Niveau von Operativität.
Erb: Ja, aber jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Nach dem, wie ich früher diese Texte, diese Bände, diese drei Büchelchen, boekjes, wie der Holländer sagt, zusammenbringen konnte, hatte ich ein Maß, das das da gar nicht bewältigen, nicht aufnehmen konnte. Und nachher habe ich auch gesagt: Es ist irgendwie als ob ich die Glucke bin, der die Entenküken davonschwimmen. Ich war dann in der zweiten Hälfte sehr in Angst geraten und fragte mich, was ist eigentlich los, habe ich Berührungsangst, welche Vorstellungen habe ich eigentlich? Und ich bin dann darauf gekommen, daß ja: Die Bände früher hatten eine andere Gestalt, und von der bin ich ausgegangen, ganz naiv, jetzt diese neue Sammlung wieder zu seinem Buch zu binden. Aber da mußte ich mich strenger fragen, weil ich wirklich auch in Angst und Not war während der Kommentierung, und ich kam darauf, daß ich vielleicht so etwas bin wie die Glucke, der die Küken wegschwimmen. Und dann ging ich diesen Angstprozeß durch und hatte plötzlich als Hilfe das Bild eines russischen Soldaten unterm Zaren, der am Fluß sitzt und die Fußlappen wechselt, und dabei singt er Schwarzer Rabe, du kriegst mich nicht. Denn für mich hatte sich bei dem Kommentieren ein Bild im Erlebnis verselbständigt, als Bild für das Erlebnis dieses Tuns, dieses Kommentierens, das Wort Unglücksgeier. Und das half mir gar nicht, daß ich den Unglücksgeier noch verdeutlichen konnte damit, daß das offenbar also mein Mittelscheitel ist, ja? Rechts und links, wie die Haare runtergehen, sind die Flügel. Es half nicht, es half nicht. Auch die Frage half nicht, ob ich jetzt nach einem vorigen Maß, das ich mir als Spielraum eingeräumt hatte sowohl was den einzelnen Text der früheren Bände betrifft als auch was den ganzen Band, das Abgerundetheitsgefühl betraf, ob ich mir selbst Widerstände gebaut habe, die ich nun durchbrechen muß. Das war eine sehr gute Erkenntnis, die sich mit einer Beschuldigung nicht mehr erschöpfen läßt, die auf etwas sehr Produktives und sogar Ermunterndes zurückgeht. Wenn du nämlich so und so weit kommst in deiner Arbeit durch so und so viele Jahre, dann wirst du am Ende zu bestehen haben, was du dir selbst vorher als Spielraum eingeräumt hast. Es wird dein eigener Boden sein. Und ich glaube, daß dies zu denken mir sehr entgegen kam, weil ich ohnehin immer dachte, daß ich etwas, was Alter angeht, tue. Es war nie ein in diesem Sinn Subjektives, im Gegenteil: ich würde sagen, es ist ein Mangel an befolgter oder verfolgter Subjektivität dagewesen.
Laschen: Vielleicht sind doch die zwei Teile des Kommentars zu Schnappsack, die du ausgelassen hast, nicht unwichtig.
Erb: Ach ja! Also: Der Text ist ein Gleichnis. Er geht hypothetisch vor. Die Annahme baut sich auf aus der besonderen lautlichen Bedingung. (Der Aufbau war aufregend.) Sie erschließt (es ausschließend) ein Verhalten. Es nimmt Gestalt an. Dann kommt der Teil des Kommentars, den ich schon zitiert habe, und dann: Es ist ein Morgen. Der Tag tritt an die Klappmasse. Die Klappmasse tritt an den Tag. (Das Morgenlicht ist das Augenlicht.) Die klare böse Masse klappt – Sie hat offenbar den Tag okkupiert – Das ist die Annahme? Der Betrieb enthüllt sich. Perpetuum mobile, bis auf die Figur. Denn der Kasper – das bist nicht du. Also halte dich nicht damit auf, so zu denken. Das Schlußwort grüßt den Morgen. Es ist ja schon mit Der Aufbau war aufregend im Grunde typisiert gesagt, was diese Kommentare nicht Interpretationen sein läßt. Wenn ich sage Der Aufbau war aufregend – das ist keine Interpretation. Wenn ich sage Der Text ist ein Gleichnis, ist es eine Interpretation. Die Annahme baut sich auf aus der besonderen lautlichen Bedingung. Sie erschließt (es ausschließend) ein Verhalten. Es nimmt Gestalt an. Ich will jetzt im Ganzen sagen: Mir scheint das günstig zu sein mit dem Satz Der Aufbau war aufregend, daß ich, um das zu schaffen, was ich da will, um nach diesen Texten zu greifen und zugleich nach etwas, was sie waren, bevor sie Texte wurden, und was sie jetzt über das hinaus, daß sie Texte sind, erschließen können – um danach zu greifen, muß ich alle Mittel annehmen. Ich habe sowohl begriffliche Mittel, ich habe interpretatorische Mittel, ich habe immer wieder die Erinnerung: was war die Voraussetzung, woher kommt das überhaupt? Und ich habe sogar gedichtartige Abläufe darin, die ganz anderer Natur sind als die Texte, von denen der Kommentar immer wieder ausgeht.
Laschen: Mir ist nicht ganz klar, ob dieses Bild vom Beistand des Textes durch einen Kommentartext, ob das schon ganz deutlich geworden ist. Vielleicht kann man andersherum fragen: Kannst du dir vorstellen, daß dein nächstes Text-Buch ebenfalls so verfährt? Oder noch andersherum, noch spitzer, daß deine zukünftigen Bücher ständig sozusagen mit diesem Prinzip arbeiten werden? Ist das nötig?
Erb: Nein! Ich kann etwas ganz Einfaches sagen über das Wort Beistand. Das steht ja in dem Einleitungstext. Ich habe doch wirklich nur geglaubt, es handelt sich um einen kleinen gedruckten Zusatz unten auf der Seite. Das wäre schon wirklich: das steht da oben und das steht da unten dabei, im vollen, wie nennt man das, im Wortlaut, im Wortverständnis. Und das gehört zu meinen Arbeitsmitteln, dieses so aufzufassen. Ein Wort, ganz einfach, es steht dabei. Wobei es seine Beistandsfunktion ja auch im Vorlauf erklärt bekommen hat, wo ich auch sage: da ist ein Mensch, der das gemacht hat. Und es ist oft nicht so: das Gedicht scheint zu verheimlichen, wenn es da allein steht auf dem Blatt, daß ein Mensch dort redet, obwohl ein Mensch das gesagt hat. Es hat so eine Absolutheit, eine Tendenz zur Ver-Absolutierung.
Laschen: Hat es denn vielleicht auch etwas mit ästhetischen Vorstellungen zu tun? Ich stell’ mir vor, ein Küken schlüpft aus dem Ei und ist dann noch befleckt mit Schleim oder was weiß ich, und so stellst du dir auch das Gedicht vor. Es soll eben noch Spuren tragen?
Erb: Nein, dann müßte ich das in den Text mit einbringen. Wenn ich mir das so vorstelle, dann ja, dann müßte ich das im Gedicht selber austragen.
Laschen: Sollen Kommentare sozusagen auch etwas von dem Handwerk sehen lassen, wie so ein Text zustande kommt? Du sprichst davon, man soll eigentlich das Gefühl haben, daß es ein Mensch ist, der da geschrieben hat, auch bei Gedichten, die alleine auf einer Seite stehen oder alleine in Büchern stehen, für sich stehen. Du hast gesagt, sie sind natürlich auch von Menschen gemacht und man kann sie natürlich auch erkennen, nämlich irgendwie an ihrem Ton.
Erb: Man kann sie erkennen. Trotzdem ist er −
Laschen: − ich kann mir also vorstellen, daß die Kommentare, wo wir nicht deiner Interpretation oder deinem Hinweis folgen wollen, daß er tatsächlich so etwas wie eine Handwerklichkeit noch behalten soll. Es soll nicht ganz hermetisch sein, er soll nicht ganz abgeschlossen sein, ganz reingewaschen sozusagen, aber er soll von seiner Herkunft noch zeugen, er soll das sichtbar machen, woher er kommt, wenn du sagst, man soll sehen, daß das ein Mensch geschrieben hat.
Erb: Als die Texte geschrieben wurden, war kein Kommentar da, kein Gedanke an einen Kommentar. Ich fasse einen Text als etwas so Selbständiges auf, daß ich nicht hinterher sagen kann, er soll noch … Ich meine aber, wenn man so etwas dazu gibt, daß das diesen Text nicht stören kann. Ich würde mich dem aussetzen wollen, was ein Autor dazu sagt, ganz egal, wie er es sagt, selbst wenn er interpretiert, was ich eigentlich nicht sehr leiden kann. Ich würde das wissen wollen, genauso wie ich das wunderbar finde, wenn ein Autor persönlich vorliest. Wenn du dich erinnerst an das Gestotter von der Ingeborg Bachmann – welche Aussage das über den Text war! Und das hast du doch nicht, wenn du nur diese Texte auf einem Blatt liest! Da würde man sagen, das ist Natur, aber wieso ist ein gehemmtes Reden Natur? Wie kann man das ablehnen wollen, das verstehe ich nicht. Im Gegenteil, es ist ja doch ganz anders, es ist ja eher bescheidener. Du hast übrigens gesagt, die Kommentare seien doch auf einer Höhe mit den Texten, und da habe ich dir gesagt, der Begriff Höhe ist mir fremd.
Laschen: Das ist ein Bild!
Erb: Auch das Wort Anstrengung der Sprache ist mir fremd. Mir ist es so, als sei das Dickicht anstrengend, durch das ich mich hindurchbewegen muß. Und das bringt mich jetzt darauf: Die Normalsprache, oder was die normale Sprache tut und macht und wie sie einen ausschließt, was sie nicht leisten kann für dich, weswegen du ja anfängst zu sprechen – das ist das Dickicht. Weil du sagst, das sei ein Bild: Was machst du mit dem Bild statt mit dem Bild: Höhe? Das ist das eigentliche Dickicht.
Laschen: Du erinnerst dich vielleicht an die weit bekannt gewordene Formulierung von Ernst Meister – auf sich selbst und seine Arbeit bezogen −, daß Dichten ohne Denken keinen Grund hat, diese Anstrengung also, Dichten und Denken in eins zu bringen. Mir scheint, daß diese Selbstreflexion Meisters auch auf deine Arbeit zutrifft.
Erb: Schon als Jugendliche, wenn ich den Mund auftat: Wir verstehen dich nicht, und: Das ist uns zu hoch. Aber bitte, woher bin ich denn gekommen? Ich habe doch diesen Begriffsapparat nicht erfunden, ich habe den Überbau nicht erfunden, ich habe diese Schule mit Physik, Geographie, Chemie undsoweiter nicht erfunden. Ich meine eigentlich: Denken ist etwas nicht Überbauartiges, nicht etwas, das dich verrät. Wenn du es auffassen willst wie etwas, das dir gehört, oder wenn du überhaupt intuitiv dem nachfühlst, wie du gerade denkst, dann wirst du eher zu dem Bild kommen, daß es so etwas ist wie ein neugeborenes Kind, daß es Fühler ausstreckt, daß es etwas sogar kreatürliches ist. Es gibt ein sehr starkes Vorurteil dagegen gerade von Leuten, die Rationalisten sind, weil sie als erstes den Verödungskoeffizienten spüren, der überkommen ist aus dem ihnen angetragenen Denken, aus dem Wissen, dem Denken der Menschheit, das man in der Schule vermittelt hat. Und da unterscheiden sich diese Kommentare, indem sie nicht dozieren. Alles was da gedacht wird, ist wirklich gegangen, und ich habe dann oft keine andere Hilfe, als mich begrifflich, formelartig auszudrücken. Wenn eine wirkliche Anstrengung davor gewesen ist, wenn die zu bestehen war, ist es dann gerecht, von angestrengter Sprache zu sprechen? Oder Anstrengung der Sprache – das ist von unserem guten Hirsch Adorno, nicht? Anstrengung des Begriffs, ja!
Laschen: Darf ich dich jetzt fragen zum Kontext deiner Herkunft, deinem biographischen Ausgang, im Elternhaus, aber auch nach deiner ersten literarischen Orientierung, nach deiner ersten Berührung mit Literatur, vermittelt über die Schule oder über dein Elternhaus oder auch als eigenständige Erfahrung. Bist du von selbst auf Literatur gestoßen?
Erb: Wenn du vom Elternhaus anfängst, dann denke ich an das Elternhaus, in dem ich geboren wurde in der Eifel. Das ist die Voreifel, eine ziemlich einsame Gegend: drei Häuschen gegenüber und unseres. Unseres ohne den Vater, der im Krieg ist, mit der Mutter, die diese drei Morgen Land bewirtschaftet, um uns drei Kinder zu ernähren. Dann kam ich 1946 in die Schule, zwei Jahre zu spät. Ein Jahr, das erste Jahre, zurückgestellt, weil ich mit sechs Jahren nur 30 Pfund wog, das zweite Jahr, weil Kriegsende war. Und als ich dann lesen lernte, habe ich mich nur so gestürzt in das Lesenkönnen. Das erste, was ich selbständig las, war Der Schweinehirt von Andersen, noch in deutscher, in gotischer Schrift. Ich weiß nicht, warum mir das so in Erinnerung ist, aber da bin ich alleine durchgegangen, das habe ich wirklich selbständig gelesen. Und ich weiß noch, ich sehe mich noch: Ich glaube, sie schnipseln Bohnen in der Küche mit einer Apparatur, und ich sitze auf einem Schemel und lese Robinson Crusoe, völlig gebannt. Nie hat mich etwas so erglühen gemacht wie dieses Buch. Das ist die eine Erinnerung. Und die zweite: Abends im Bett, es gab keine Bücher, aber ich hatte immer nur Hunger nach Lesen, und ich las eine Broschüre über die Tsetse-Fliege. Merkwürdigerweise habe ich jetzt noch, wenn ich mich zurückfrage, die Erinnerung: Das war nun wirklich, was die da geschrieben haben – im Unterschied zu Crusoe.
Laschen: In der Eifel sitzen und ein Buch über die Tsetse- Fliege lesen!
Erb: In der Eifel, ja. Eine Broschüre mit irgendwelchen grauen Fotos und diesem Mistvieh von Tsetse-Fliege, das die Malaria überträgt. Und dann diese abmagernden Befallenen, die da liegen und immer mehr abmagern, weil sie gar nicht mehr erwachen- das muß das Kind natürlich beeindrucken.
Laschen: Aber das war selbständig gefunden oder gewählt?
Erb: Nein, das war schon Ersatz. Da war schon blindlings gegriffen, was nur irgendwie zu lesen geht.
Laschen: Und deine Mutter? Hat die Einfluß genommen?
Erb: Die hat Märchen vorgelesen, aber das war davor, alle diese Grimms Märchen.
Laschen: Und die ersten Berührungen wurden mit Literatur in der Schule, im Deutschunterricht vermittelt. Du hast einmal gesagt, daß du vielleicht Deutschlehrerin geworden wärst – also hat die Schule dir einen Zugang zur deutschen Literatur geöffnet?
Erb: Ich wollte das nicht sagen, aber ich möchte auch nicht so häßlich über die Schule reden. Weißt du, auch wenn du’s nicht aufnehmen kannst, Goethe, Egmont, oder was weiß ich – es wandert ja in dein Gedächtnis hinein, und irgendwie wird es in dir arbeiten. Ich glaube überhaupt nicht, daß man das vergißt, was man in sich aufnimmt. Man behält das, und es wirkt. Aber weißt du, an so richtige gute Erweckung kann ich mich, was die Schule betrifft, überhaupt nicht erinnern, auch nicht, was das Studium betrifft.
Laschen: Das Studium war dann schon hier in der DDR, du bist ja mit deiner Familie hierher gekommen. Vielleicht magst du etwas sagen zu diesem Übergang von einem Land in das andere?
Erb: Ich war 11 Jahre alt, als meine Mutter mit uns, den Kindern, zu meinem Vater nach Halle zog, wo er ein Hinterzimmerchen bewohnte, so daß wir Kinder erst in ein Heim kamen. Zwei Jahre haben wir in den Franckeschen Stiftungen gelebt. Was es bedeutete, in diese Stadt zu kommen und in diese Schule zu kommen, berührt in Kastanienallee der Kommentar zu dem Text Überlegung im D-Zug, Erinnerung (Schock). Das hat mich übrigens sehr aufgeregt, als ich das da verarbeitete. Ich habe es, als ich das bearbeitete, zum ersten Mal begriffen, als es auftauchte und ich es aufnahm, begriffen, einfach zusammengezogen, was in der Erinnerung war. Ich wollte eigentlich aus der Eifel fort. Ich habe da gedacht, als Kind, es muß jetzt was kommen, das geht nicht so weiter, daraus muß jetzt etwas erwachsen, aus diesem ländlichen Dasein, war also einverstanden damit, in die Stadt zu kommen. Und dann war in der Stadt natürlich kein Heimatboden mehr, sondern als Boden war nur angeboten dieser Schulunterricht und das, was dieser Staat war, also mit Friedenskampf und mit Wilhelm Pieck und mit Buntmetallsammeln und die Pionierorganisation und alle diese Unterrichtsfächer. Und ich habe das nachher Kopfboden genannt. Ich bin in den Überbau hineingegangen, als ob es mein Heimatboden sei, und es kam jetzt darauf an, in diesem Überbau, auf diesem Kopfboden zu leben. Und ich glaube, wenn man das so faßt, kann man vielleicht das Ganze anders auffassen, was ich da geschrieben habe, als wenn man das nur von außen sieht und dann so eine Kopflastigkeit feststellt. Es geht doch darum, das zu verarbeiten. Und das habe ich sogar mit Spiellust gemacht, obwohl meine armen Knochen da fast draufgingen dabei. Weißt du, da läufst du dann in Halle herum, dann guckst du auf die Häuser; da müssen doch Menschen drin sein, nix, nee, da lachen sie. Du bist ausgeschlossen, du bist irgendetwas, und dann tritt natürlich oft diese Isoliertheit ein, in die du gerätst während der Pubertät. Aber im Grunde hat mit diesem positiven Anfang, daß ich ja eigentlich in die Stadt wollte, das hatte schon ein großes Plus vorgegeben und ich habe mich dann nicht entmutigen lassen, trotz der Nervenkrisen nachher.
Laschen: Und wie kam es zu diesen Studienfächern Germanistik und Deutsche Literatur und Pädagogik?
Erb: Es war eigentlich phantasielos. Ich hatte eine andere Phantasie, ich wollte eigentlich Völkerkunde studieren, aber mein Vater wollte das nicht. Der hat gesagt: Dann endest du im Museum, was ist das für eine Existenz! Ich wollte, so wie er, Völkerkunde studieren – er hat dies nämlich auch gemacht und hat davon geredet. Ich wollte also im Grunde der Sache auf den Grund gehen, denn dazu hatte ich wirklich eine sinnliche Beziehung, zu so etwas Altem: das war schon, das ist jetzt so lange her, das war überhaupt.
Laschen: Würdest du dieses Studium als ein Scheitern betrachten? Du sagst, es sei eine echte Korrektur einer falschen Wahl, die du getroffen hast.
Erb: Völkerkunde habe ich ja nicht studiert.
Laschen: Nein, nein, aber Germanistik und Pädagogik.
Erb: Germanist – das war einfach so: zu Hause eine Riesenbibliothek und schon in der Eifel dieser Lesehunger und die Gewohnheit an die Bücher. Ich konnte in der gewohnten Art weiterleben – das war die Entscheidung, Germanistik zu studieren und nichts sonst. Kein Sinn im Leben, kein Fußfassen, sondern sich noch eine Weile aufheben, ja. Das Studium hat das auch nicht etwa unterbrochen.
Laschen: Aber du hast dein Studium aufgegeben?
Erb: Nein, das habe ich zu Ende geführt. Ich habe ein Jahr studiert, Geschichte und Germanistik. Das habe ich allerdings unterbrochen, weil weißt du: Ein halbes Jahr habe ich das gemacht, und ich sah, das ist nichts anderes als das, was vor dem Abitur gewesen ist, und ich bekam so eine Sehnsucht nach etwas anderem, und ich habe ein halbes Jahr lang immer vor mir gesehen: ein Dorf, rauch geschwärzte Katen- und da wollte ich hin. Ich bin dann in die Wische gegangen, habe dann ein Jahr gearbeitet, das hatte mit rauchgeschwärzten Katen allerdings nichts zu tun. Dann habe ich versucht, Anschluß zu finden an Psychologie-
Laschen: Mitte der 60er Jahre −
Erb: – nein, früher, Anfang der 60er Jahre. Dann bin ich zu einem Psychologen gegangen, dann habe ich bei den Medizinern vorgesprochen, dann habe ich gedacht: vielleicht Ökonomie. Ich wollte offenbar ausbrechen, aber es war noch nicht so weit.
Laschen: Hast du damals schon geschrieben?
Erb: Ja, da habe ich angefangen zu schreiben. Ich erinnere mich, daß ich zum Beispiel einen Traum aufschrieb und dachte: Hier weißt du ganz genau, wie das abgelaufen ist, das ist eine gute Schulung, wenn du Träume aufschreibst. Tatsächlich habe ich nachher viele Träume verwertet, immer wieder.
Laschen: Wie bist du als Lektorin in den Verlag gekommen? Du hast ja einige Zeit als Lektorin gearbeitet. Ging das ohne abgeschlossenes Studium?
Erb: Nein, das habe ich dann abgeschlossen – ein Vierjahreskursus war das für Mittelstufenlehrer, damals war das noch nicht polytechnische Oberschule, also für die Zehnjahresschule. Das erste Studium wäre für Diplomaten oder Oberstufenlehrer gewesen; das zweite war für Mittelstufenlehrer. Dieses Studium näherte sich dem Ende, und wir waren auch schon ein paar Mal in der Schule gewesen in verschiedenen Unterrichtsstunden, und ich sah nicht, daß das für mich eine mögliche Lebensweise ist. Ich dachte, ich müßte Schulrat werden, um das Unterrichtsprogramm zu ändern, daß es wenigstens logischer sei. Aber dann, wenn ich Schulrat würde, könnte ich ja nicht Lehrer sein, dann wäre ich wieder nicht mit den Kindern zusammen. Also es geht nicht. Das war das, was im Kopf ablief. Und sonst habe ich eigentlich nur gelitten und schreckliche Vorstellungen gehabt von dem Schulunterricht, zum Beispiel einen Traum, wo ich vorne stehe und sie haben lauter solche Schröpfköpfe oder sowas ähnliches in meinen Rücken gebohrt, und ich diene als Unterrichtsmaterial. Ich stehe vorne, ich diene als Unterrichtsmaterial, ich bin das pure Mittel. Dann war ein anderer Traum: Ich bin jetzt irgendwo auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt Lehrer geworden, und ich habe gedacht im Traum: Ich ziehe einfach schwarze Kleider an, dann wissen sie, warum ich weine. Ja, so war’s, Gregor. Und in so einer Verfassung hat mich mal die Deutsch-Methodikerin angetroffen vor der Straßenbahnhaltestelle und hat mich gefragt, was ich mir denn eigentlich vorstelle, und ich habe nur mit dem Fuß im Sand gescharrt, und da hat sie gesagt, das muß geändert werden. Und sie hat sich darum gekümmert, daß ich in den Mitteldeutschen Verlag kam als Lektor.
Laschen: In dieser zweijährigen Lektoratszeit, hast du da an einem Band ernsthaft geschrieben oder was ausprobiert oder wie ist das gegangen?
Erb: Geschrieben habe ich schon. Ich habe im Studium angefangen zu schreiben. Die ersten Veröffentlichungen waren 1968, glaube ich, in einer Almanachreihe Auswahl oder Auftakt oder so ähnlich. Ich glaube im Verlag von Bernd Jentzsch, in Neues Leben.
Laschen: Also nach deiner Entscheidung, Autorin zu werden, freischaffende Autorin?
Erb: Ja. Ich bin freischaffend geworden, ohne eine einzige Zeile gedruckt zu haben. Dann hat es auch noch ziemlich lange gedauert bis – ja, wann war ich denn …
Laschen: Erinnerst du dich an diese Situation, in der du entschieden hast, ich lebe jetzt als Autorin und ich werde das und das machen? Du hattest keinerlei Garantien, irgendwo gedruckt zu werden, du hattest auch nichts publiziert. Erinnerst du dich an diesen Beginn?
Erb: Ja, wie sollte ich mich nicht daran erinnern. Ich hab’ monatelang beschleunigtes Herzklopfen vor Angst gehabt, jetzt sozusagen auf die freie Wildbahn zu treten, monatelang hatte ich Angst.
Laschen: Hast du die Entscheidung ganz alleine getroffen?
Erb: Ja, gegen den Widerstand von allen. Es gab keinerlei Bestärkung. Das war einfach die Klarheit, daß es in dem geregelten Arbeitsablauf nicht geht mit mir. Und wenn das da für mich nicht geht, dann kann ich mich ja benutzen, um eine Art Überlauf zu machen, also irgendwie das Risiko darzustellen. Auf der einen Seite: das ist geregelt, auf der anderen Seite: das Risiko. Das Risiko müssen auch welche ausleben, so ungefähr. Ich bin nach Leipzig gegangen, habe eine Weile bei meiner Schwester gelebt, die dort studierte. Ich gehe in Leipzig herum, und ich sehe auf einmal ein Publikum und einen Redner vor einem Pult. Und der Redner hält einen Krug in der Hand, als ob das die Offenbarung ist. Ich habe wirklich keine nostalgischen Tendenzen. Es war aber so, es war so etwas Elementares. Aber wenn du das jetzt einmal zusammennimmst, in Robinson Crusoe die Insel und diesen Krug – darin sind irgendwie doch Symbole – nicht? Es sind doch Symbole, etwas Abgeschlossenes, in dem etwas zu schaffen ist. Aber ich nehme an, daß die von außen gekommen sind, daß ich von innen den Lebenskern aufbrechen und leben lassen wollte.
Laschen: Wie ist es zu diesen persönlichen, aber auch dann doch sehr ernsthaften literarischen Berührungen gekommen zwischen Sarah Kirsch und dir, mit Rainer Kirsch, Karl Mickel, Bernd Jentzsch, Adolf Endler, Heinz Czechowski – diese Gruppierung von Autoren einer Generation, die sich etwas zu sagen hatten? Das äußert sich in den vielen Porträt-Gedichten und Antwortgedichten auf diese Gedichte, aber auch eben darin, daß in der Öffentlichkeit das Bild von einer mittleren Generation oder wie Adolf Endler gesagt hat, der neuen Sächsischen Dichterschule, daß dieses Bild in der Öffentlichkeit entstand? Und wie ist es zu dieser Gruppierung, zu diesen Berührungen, Gemeinsamkeiten, Differenzierungen gekommen? Wie bist du dort hineingekommen?
Erb: Ich war noch Lektor. Da war eine Veranstaltung in Halle mit einer langen Reihe von Leuten, die Gedichte schrieben. Dem war vorausgegangen, daß Stephan Hermlin in Berlin junge Talente vorgestellt hatte. Dem war wiederum vorausgegangen diese Tauwetter-Lyrik in der Sowjetunion. Da hatte ich schon einen ziemlich wachen Kontakt zu allem. Wie ich da rein gekommen bin, das weiß ich nicht mehr, da fehlt mir irgendwie das Kettenglied jetzt, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich gehörte einfach zu ihnen. Sarah und Rainer Kirsch waren in Halle. Mit Czechowski habe ich zusammen im Mitteldeutschen Verlag gearbeitet. Von Czechowski habe ich gelernt. Ich hatte zum Beispiel die unverlangt eingesandten Manuskripte zu bearbeiten, wie das hieß, unverlangt eingesandte oder aber dilettantische andere. Czechowski reagierte mit einem Achselzucken und mit einer Handbewegung. Ich, durch die Schule und das Studium gelehrt, mußte es ergründen. Aber dieses Achselzucken und die Handbewegung waren für mich sehr gute Zeichen. Denn während des Studiums habe ich nicht gelernt, ein gutes Gedicht von einem anderen zu unterscheiden oder überhaupt zu erleben, was ein Gedicht ist. Das mußt du dir mal vorstellen, da bist du bald dreißig und weißt es nicht! Schillers moralische Schriften – ja. Aber wie ist das dann gegangen? Weißt du, sicher – ich habe ja während des Studiums angefangen zu schreiben. Das hat seinen Verlauf genommen, ich bin gerade dabei, den zu studieren. Deswegen wollen wir vielleicht nicht davon sprechen, weil das wieder sehr ausufern würde.
Laschen: Aber diese Gruppierung hat ja doch auch eine Beziehung zu der älteren Generation, zu Huchel, zu Bobrowski, zu Erich Arendt. Wie war das bei Dir? Brecht wäre natürlich auch zu nennen.
Erb: Von Brecht würde ich sagen, da gab’s eine wirkliche Schule. Bobrowski war ein Anreger, wie man etwas bewegen kann, wie man nach Brecht etwas bewegen kann. Huchel, glaube ich, war für mich wie eine Art Gewißheit für den Grund des Schreibens. Nicht, daß er auf das Schreiben direkt hätte wirken können, Arendt auch nicht. Aber Arendt habe ich Texte geschickt, und Arendt schreibt, toll wie er ist: Ich begrüße die neue Sonne am Horizont. Das ist unglaublich! Du hättest meine Texte lesen müssen! Wie war das möglich, daß er das erkennt! Aber er hat etwas erkannt. Ich bin ja noch da. Aber wenn du nach dieser Gruppe fragst und nach ihrer Beziehung zu Älteren – ich denke sofort nur an diese Gruppe und nicht an die Älteren, wie wir uns getroffen haben, wie wir uns unsere Texte vorgelesen haben, wie es immer gegenseitig hieß: das ist gut, daß ist nicht gut, das ist gut, und wie wir uns regelrecht durchgeschoben haben. Für Sarah beispielsweise war Alberti ganz wichtig. Für mich sind solche Sachen nicht wichtig gewesen. Es hat nicht gewirkt bei mir. Ich hatte einen anderen Text durchzuarbeiten, etwas anderes zu machen.
Laschen: Aber du hast auch zwei oder drei Texte für Erich Arendt geschrieben.
Erb: Ja, das ja. Das ging eigentlich mehr vom Leben aus.
Laschen: Kannst du das genauer machen, was du damit meinst?
Erb: Was er war als Person mit seinen Fragen, die er im Mittelmeerraum auf die Erde stellen konnte, mit dieser odysseeischen Weltfahrerweisheit, mit seinem unternehmenden Charakter, mit diesem Wesen, das sich erhitzt, das errötet, wenn die Frage auf Politik kommt, das sich so aufregt – es war um Arendt herum eine solche Klarheit, eine solche Reinheit, das habe ich zuerst nicht begriffen. Ich bin aber einfach hingegangen. Nachher dann, viel später, dachte ich: Das ist die beste Gesellschaft, die ich überhaupt haben kann. Das bedeutet aber doch eigentlich, wenn du’s so siehst, daß ich nach Gesellschaft nicht gefragt habe früher, denn wer war ich denn selbst, daß ich mich hätte dazugesellen können? Da war unsere Gruppe, und wie wir zusammenkamen, saßen und lachten, uns Krätzchen erzählten, und wie jemand reagiert hat, kulturpolitisch, schief, auf irgendeinen Text, und wir lachten darüber. Das Gelächter habe ich noch in Erinnerung. Dieses sich-Mut-machende Gelächter und dieses Sich-Finden im Lachen.
Laschen: Hast du Peter Huchel persönlich gekannt?
Erb: Einmal habe ich ihn gesehen, ja, beim Arendt. Arendt hatte, glaube ich, 65. Geburtstag und Huchel war mal aus seiner Höhle gekommen.
Laschen: Und die Texte von Huchel, hast du die schon früh wahrgenommen oder erst relativ spät?
Erb: Was heißt früh? In der Zeit, als ich im Verlag war und danach, in diesen ersten Jahren also, als ich dann auch bald mit Endler zusammenkam. Mir fällt jetzt übrigens ein, was Endler betrifft: Ich kam aus dem Mitteldeutschen Verlag und bin nach Berlin gegangen. Ich habe mir ein Dachbodenkämmerchen erkämpft am Rande von Berlin und ich hatte im Kopf: Du bist Germanist, es gibt lebende Dichter, die mußt du natürlich jetzt kennenlernen, was soll sonst – bitteschön – deine Germanistik. Und dann habe ich die nacheinander aufgesucht und dabei den Endler kennengelernt. So war das. Und die anderen natürlich auch, die hingen sowieso schon zusammen.
Laschen: Wir haben über das prozessuale Schreiben, über Prinzipien, Prozeduren undsoweiter gesprochen, aber wie fängt bei dir das Schreiben eigentlich an? Mit einem Bild? Mit einem Gedanken? Mit etwas, das du siehst, das etwas auslöst, etwas in Gang setzt? Wie kommt es zu einem Textanfang?
Erb: Wenn ich richtig antworten wollte, müßte ich jetzt alle diese Gedichte mir ansehen und die Kurzprosa – es ist ja sehr viel nur Kurzprosa, nicht Gedicht – und mich entsinnen und dann eine Statistik machen, und dann kann ich dir das −
Laschen: Vielleicht hast du ein Beispiel!
Erb: Im Prinzip würde ich sagen, ist es so, daß sich eine Lautfolge, eine Wortfolge schon abbildet, schon ergibt, sowie du etwas vor dich hinmurmelst. Und dann hast du Lust, das weiterzubauen oder es fordert sogar, daß du’s weiterbaust. Aber wenn du fragst: Hast du etwas gesehen – ich glaube, daß es jetzt so sein kann, daß ich etwas sehe und ich es schaffe, das zu sagen; früher war’s wohl nicht so, da brauchte ich schon irgendwie die Worte dazu, daß die anfingen, in mir zu reden.
Laschen: Empfindest du das als eine große oder als eine kleine wertende Distanz, etwas sehen, wahrnehmen und es auch in entsprechender Weise zu formulieren?
Erb: Ich glaube, die Distanz wird kleiner, etwas zu berühren, etwas aufzunehmen, ja, daß es leichter ist, das glaube ich schon. Mit der Zeit lerne ich.
Laschen: Ich denke, daß das eine Entwicklung ist, die man in deinen Texten auch beobachten kann, die aber auch zusammenhängt mit deiner Art von Konzentration, auch von Reduktion.
Erb: Da weiß ich jetzt nicht, was Reduktion ist. Das kommt eben schneller. Du erkennst auch die Verszeile schneller und du hast mehr Billigung ihr gegenüber. Dein Erfahrungsbereich ist weiter, du weißt, wie es tönt, und du kannst ihr leichter ihre Gesellschaft von den anderen Versen geben, die dann das Gedicht machen.
Laschen: Ist das die Sicherheit gegenüber dem eigenen Ton?
Erb: Weißt du, ich glaube, daß das ja nicht so aus dem Bauch kommt. Ich habe eine große Erfahrung im Nachdichten, wobei du sehr gefordert bist, wenn ein lebendiges Gebilde von Gedicht vor dir steht und das mußt du jetzt erreichen. Das ist eine phantastische Schulung, eine phantastische Schulung zum Lesen, und dann lernst du bestimmte Dinge. Da ist es dann unfaßlich, wie du das erreichen kannst: eine Winzigkeit verrückt, und schon stimmt es. Und das geht in eine – nur nicht benennbare – Erfahrung über. Ich würde sie nicht Routine nennen. Jetzt ist es sogar so, daß die Schmerzen dabei sich verloren haben, so daß, wenn ich jetzt nachdichte, das, was am Ende dasteht – und ich weiß nicht wie es gekommen ist, als ob es in der Luft zusammenfliegt. Vorher waren schreckliche – man muß aushalten, man muß warten, man sucht am Nordpol herum, wo nichts sein kann. Draußen ist vielleicht Mai und du sitzt da –
Laschen: − und im Zimmer ist November −
Erb: − und dann ist das Verrückte: Der Mai draußen, der lockt dich heraus, du willst hinaus, du schämst dich, alles grünt, blüht, du sitzt da – und weißt du, was dann passiert? Drei Tage später gehst du an der Stelle vorbei, wo du das Gedicht hast nachdichten müssen, und da strömt eine Intensität aus, da ist kein Mai was dagegen, ja? Es ist verrückt, das hab’ ich immer wieder erlebt, als ich Gedichte nachgedichtet habe − vom selber schreiben wirst du da zu sehr absorbiert −, aber wo ich nachgedichtet habe, ein Holzstoß auf dem Land in Wuischke: Brjussow, dieses Doppelbett hier: Ungaretti. Ich kannte verschiedene Orte, und es war dann immer noch so, daß du dann plötzlich da reintauchst: du gehst da hin und tauchst wieder rein. Obwohl es das tägliche Bett ist, scheint das da drüber zu leben. Übrigens, als du mich einmal über mein Verhältnis zu Franz Fühmann gefragt hast, da habe ich rekapituliert: Fühmann begann mit der Weißen Reihe, internationale Lyrik, mit dem ersten Band – im Umgang damit war für mich damals der starke Eindruck: Wir haben, was im Leben ist, was im Alltag zusammenlebte, verlassen, um eines Lebens willen, das schon tot ist. Diese Übersetzung, das kann man nicht Abstraktion nennen, aber natürlich ist es eine Art von Abstraktion, eine Wahl, doch, eine Wahl, aber du verlierst dabei – vielleicht erklärt das auch etwas für mich – die Scheu vor dem Verlassen des Realen, das dich umgibt, weil du einfach spürst: da lebt es.
Aus: Peter-Huchel-Preis Jahrbuch 1988. Elke Erb. Texte, Dokumente, Materialien; Elster Verlag, 1989.
Für das Buch Kastanienallee erhielt Elke Erb 1988 den Peter-Huchel-Preis.
„Nicht Fluch, nicht Flucht, kein Gegenzauber…“
Wer weibliches Schreiben nach wie vor mit der Vorstellung von Larmoyanz, Empirie und thematischer Einseitigkeit verbindet, erweist sich selbst als Ignorant. Für frühere Stadien war charakteristisch, daß sich alles um die Frauenfrage drehte, während heute die Literatur der Frauen vielleicht am wenigsten selbständig dort ist, wo sie Sonderinteressen einklagt. Nicht an der Themenwahl tut sich weibliches Schreiben kund; eher an der Vorliebe fürs Unfertige, für Mischungen und Fragmentarisches. Regeln lassen sich hier nicht ausmachen, denn das Werdende erkennt sich selbst im Prozeß seiner Entstehung. Und so will es auch verstanden sein.
Elke Erb hat sich immer für ein Verständnis des poetischen Textes verwendet, das im Staunen über die Unvereinbarkeiten bestehen soll, die in der täglichen Kommunikation irgendwie überwunden werden. Sie befaßt sich mit dem, was in diesem Irgendwie verschüttet wird, so daß die Worte nichts sagen über den Sprecher und den Empfängern wie Fremden begegnen: „So heranwachsend fragte ich (neu): Wo sind die Menschen?… Ich verstand die Sprachen nicht, in denen sie sich zu erkennen gaben“, lautet in Kastanienallee die Erklärung für die Entstehung eines ihrer Texte. In Sätzen, die sie auf einer ihrer konventionellen Bedeutung festlegen, haben die Worte nichts mit den lebendigen Empfindungen zu tun:
Solange ein Satz nicht sagt, was er sagt,
unvermeidlich
… sammelt sich Unkraut auf…
Solche „unsauberen“ Sätze nämlich stehen der Fähigkeit, Erfahrungen zu machen, im Wege. Um tatsächlich zu erleben, ist es unerläßlich, die sprachliche Ausstattung abzuwerfen. Ihre Normen sind restriktiv; sie beschneiden die Wahrnehmung und damit schließlich die Möglichkeiten des Subjektseins empfindlich. Dagegen entwickelt Elke Erb gegenläufige Prozeduren. Wenigstens ein Bedeutungsfeld wird ganz ausgeschritten, bis alles Stimme bekommt, was anklingt und mitschwingt. Im Prozeß des Aufsuchens stellt sich heraus, wo Bedeutungen und Erfahrungen ohne Zwang zusammenstimmen. Was dabei zutage tritt, ist das Unvorhergesehene, das bei der gewöhnlichen Benennung unterdrückt wird und im Bewußtsein nicht vorkommt, solange ihm keine Sprache gegeben wird. Elke Erb beschreibt dieses Verfahren, das sich durchaus auch sprachtheoretisch begründen läßt, als „nicht resultativ, sondern prozessual… ein Schreiben, das nicht bloß feststellte, sondern sich sofort selbst auf seine Folgen einließ…“ (Vexierbild). Der Text ist hier nicht das zur Kommunikation bestimmte Gebilde; er soll vielmehr sprachlich Gebildetes auflösen, den Anschein seines Gegebenseins und seiner Realität entkräften, damit sich die Schreiberin und ihre Leser im Wortwechsel als Subjekte gegenseitig erkunden können. Denn die Macht der Dinge, die sich mit einer Sprache der Zuordnungen wappnet, ist wiederum ein Vexierbild, in dem das gefährdete, weil unverstandene Subjektive aufgesucht werden muß. Der Gedichtband von 1983 bekam den sinnfälligen Titel Vexierbild.
Auf diesem Wege schreitet Elke Erb mit den Texten des neuen Bandes Kastanienallee getrost voran. Ihre Überzeugung ist gewachsen, daß die selektive und bezeichnende Sprache von innen her aufgelöst und mit persönlichem Sinn durchsetzt werden kann. Sachverhalte der Biographie, Äußerungsweisen in festgelegten Rollen und unwillkürliche Reaktion, Selbstbeobachtungen also werden zum Anlaß für eine zweite Aneignung des eigenen Lebens. Auch die poetische Produktion fällt unter jene Lebensäußerungen, die als Materialien der Selbstfindung genutzt werden.
Wichtig ist die Erinnerung an die jeweiligen Anstöße zu einem Text und an sein weiteres Wachstum. Die Genesis ihrer Texte nachvollziehend, arbeitet Elke Erb an der Rekonstruktion des Ich oder, was dasselbe ist, an ihrer Furchtlosigkeit vor den Dingen. Darum schreibt sie außer Texten, die jenem Ich zur Sprache verhelfen, auch noch „Textgeschichten“. Im Untertitel des Bandes werden sie als Kommentare angekündigt. Doch handelt es sich dabei nicht etwa um Erklärungen und selten um Interpretationen. Vielmehr wird eine zweite Ebene der Selbstverständigung eingerichtet. Auf dieser Ebene der Reflexion entfällt die Scheu vor Benennungen. Dadurch werden auch die Themen dieser Texte angekündigt. Eines von ihnen ist die Antinomie von Eignern und Eigentum. Das „erste Gedicht des neuen Bandes“, bestehend aus drei Zeilen und dem dazugesetzten Datum: „1.1.81“, artikuliert zuerst eine Beklemmung, deren Ursache unbestimmt ist. Der Text äußert nur diese Anmutung von etwas Trostlosem, Vergessenem. Sie ist sprachlich freilich überdeterminiert durch den Deutungsspielraum, der sich um die Wortgruppe „tote, selbstvergessene Mäuse“ bildet. Denn das Subjekt dieses Vergessens ist zugleich da und unterdrückt, so daß nach ihm gesucht werden muß. Der Kommentar fügt hier einen situativen Kontext hinzu. Der Anlaß im Ich geht von dem Zwange aus zu denken, daß jetzt ein solcher „neuer Band“ begonnen werden muß, weil der alte fertig ist, ebenso wie ein neues Jahr beginnt, nur weil die Tage des alten Jahres vom Kalender ausgezählt sind. Das letzte Gedicht beschreibt dann, wie ein Brief entsteht, indem die beängstigende Verpflichtung zu einem Brief durch Verwandlung der Form des Obligaten aufgehoben wird. Der Kommentar entwickelt hier den Vorgang, während der Text die Kundgabe der befreienden Entdeckung selbst ist. Alle Texte dazwischen machen eben solche Regeln, Normen und Vorschriften als Grund eines Leidens dingfest, das erfaßt und gleichsam wiederholt werden muß. Produktivität wird auch vom Eingeständnis der Schwäche und Schmerzen abhängig gemacht, vom Bekenntnis zu den eigenen Grenzen:
Grenzen leben heißt offen leben.
Offen leben heißt
selbst leben.
Im neuen Band herrscht, anders als früher, die Gewißheit vor, daß jene banalen Lebensmuster das Ich nicht unbedingt überrumpeln müssen. Diese Texte sind Aktionen gegen den Selbstverlust und probieren Haltungen aus, die der Verinnerlichung und Einübung vorgegebener Lebenspläne zuwiderlaufen. Sie versuchen, die Wahrnehmung sogar des äußerst Selbstverständlichen zu erreichen, das dann als Erfahrung mit Menschen, meist mit sich selbst, angenommen und verstanden werden kann. Ein derart emblematischer Text wie BIRKENWERDER-EIGENTUM stülpt die Ansicht von Dingen um, bis eine menschliche Hand sichtbar wird und sie etwas von der Sinnlichkeit wiederhergeben, die doch in ihnen geronnen sein muß. Wer denkt schon sonst über Entfremdung nach angesichts eines in Blüte stehenden Frühlingsbeetes, wer über die abwesende Besitzerin des Siedlungshauses, die ihren Schönheitssinn darin bewies?
Zuerst kann es scheinen, als seien alle diese Texte eine Art Aufzeichnung jener unmittelbaren Erkenntnis, jenes augenblicklichen Innewerdens, das der rationalen Begründung widersteht. Der Anschein trügt aber. Kastanienallee ist kein Journal der Seele. Vielmehr werden methodisch die Dimensionen der Alternative von Selber-Leben oder Gelebt-Werden zutage gefördert. Der marxistische Psychologe Lucien Sève und nach ihm Lothar Kühne haben untersucht, wie die Bildung zur Persönlichkeit und die Verfügung über die Lebenszeit einander bedingen. Der Zeitplan ist von ihnen als ein unsichtbares Gesetz beschrieben worden, das durch die gesellschaftlichen Verkehrsformen über die Individuen bestimmt, Macht in ihnen hat und ihre Absichten beherrscht. Ein Stundenplan kann womöglich der sichtbare Ausdruck des Vollzugs dieses auferlegten Gesetzes sein. In diesem Sinne organisiert der Text „Ein Stundenplan kommt selten allein“ eine doppelte Selbstbegegnung. Zuerst ist der alte Plan aus den Studienjahren zu einem Stück konkreter Poesie gemacht worden. Man sieht förmlich, wie die unersetzliche Zeit eingesperrt und zerstreuter Beschäftigung in diversen Kästchen zugeteilt ist. Eifrig, keine Stunde des Tages auslassend, hat die Schreiberin sich selbst verplant. Der Text stellt das als ein Paradoxon dar: „Ich in der Ohnmacht der Selbstbehauptung.“ Der Vorgang wird begleitet von der Bloßlegung seiner Anatomie. Nach den Gründen für diese Flucht vor dem Ich in das bereitstehende Schema eines Über-Ich ist gefragt. Um die Schuld gegen sich selbst abzutragen, die jener neunzehnjährigen, gutgläubigen Planerin unterlief, muß der „Stundenplan“ ernst genommen, das Verhaltensmuster verständig beschrieben werden. Erst durch die Vertiefung in seinen Mechanismus ist der Wiederholungszwang abzulösen.
Der Text benennt nichts, was nicht in der eigenen, unmittelbaren Erfahrung aufzufinden ist. Doch läßt sich das Phänomen der Selbstberaubung, der abgetretenen Zeit, in verschiedene Kontexte Stellen, aus denen es eine durchaus überpersönliche Bedeutung erhält. Einer davon ist der geschichtliche Kontext der fünfziger Jahre mit ihrem übermäßig auf Erziehung setzenden Menschenbild. Ein anderer die Disposition von Frauen zu Einverständnis und Verzicht auf sich selbst, auch sie Produkt von Erziehung, einer frühen, vorsprachlichen zumeist.
Auch in diesem Falle ist Erinnerung an jenes frühere Stadium der Selbstverleugnung, an die Motive dafür, ja selbst an die Lust, mit der die Planung vollzogen wurde, das Mittel der Aneignung und Durcharbeitung des Verhaltensmusters, das die Zeiteinteilung zustande brachte. Oder war es umgekehrt, brachte die Planung das zugehörige Verhalten hervor? Vom Kommentar erhält man hier Auskunft, daß der Text aus zwei widerstrebenden Reaktionen entstanden ist: Erschrecken über die Perfektion, mit der die eigene Unterwerfung betrieben worden war, ist die eine. Die andere äußert sich im spontanen Bedürfnis, ihr eine zweite Selbstverleugnung folgen zu lassen, das anstößige Zeugnis der Unmündigkeit zu vergessen. Der Kommentar bildet eine weitere Stufe der Verarbeitung, indem er die psychischen Energien, die Arbeit also, zu überdenken gibt, durch die das Widerstreben besiegt wird, ohne aus dem Text getilgt zu werden. Denn mundtot darf es nicht gemacht werden. Der Text, so sagt der Kommentar, ist ein Kampf gegen die bei den Versuchungen, glättend in den Vorgang der Selbsterkenntnis einzugreifen.
Auch Verdrängungen, weil sie Kraftvergeudung sind, werden „in den Stand eines Themas“ gehoben. Der Impuls zu einer Befreiung von einem mechanischen Zwang kommt aus dessen Analyse: „Von dem Klavierspiel erlöst allein das Klavierspiel.“ Wenigstens zwei Aktionen laufen dabei in jedem Text. Zuerst die Entdeckung, eine emotionale Betroffenheit, und, gleichzeitig oder folgend, die Verarbeitung derselben. Dem Komfort, einer Spielart des Eigentums, das den Eigensinn bedroht, sind gleich zwei Texte zugeeignet. Gegen die Verwicklung des Wortes mit den Sachen und beider Behauptung als Lebensumstände entwickelt „Komfort I“ lange Assoziationsketten, die das Wort abwerten, die Wortverbindung von Leben und Umstände aufbrechen und ein phantastisches Leben dagegensetzen. Der zweite Text greift weitaus tiefer in soziale Beziehungen hinein. Er stellt sich „der Fabel des Komforts in meinem Haushalt“, einem Thema, mit dem jede der schreibenden Frauen bei uns zurechtkommen mußte. Sie tun es in der Haltung zorniger Verachtung, in der Resignation am Unveränderlichen; man trifft aber auch die idyllische Sicht auf die häuslichen Verrichtungen an. Elke Erbs Text macht keinen Hehl aus der Furcht vor diesem Gehäuse einer Rolle, die Lebenszeit verschlingt, Wahrnehmungen strukturiert und sich auf diese Weise breitmacht im Bewußtsein der mit Haushalt Betrauten. Er wird durch sieben Tage und alle Gefühle hindurchgeführt, die ein so unbewegliches Gegenüber auslösen muß. Die endliche Lösung des Sonntags nimmt den Dingen die Magie: „– und jetzt, im Zorn… gelang die lückenlose und schonungslose Liste des Komforts… ohne Grauen“, sagt der Kommentar dazu.
Die Kombination von Texten und Kommentaren ist natürlich selbst ein Experiment. Selbstversuch und Kontrolle zugleich, haben die Kommentare Rechenschaft über den eigentlich unergründlichen Teil der Sprachwerdung von vorbewußten Impulsen abzulegen. Die Texte leben aus ihrer Empfänglichkeit selbst für Bruchteile von Impulsen, die dem Ich aus der Innen- oder Außenwelt zukommen. Die Kommentare beschreiben, wie man diese Empfänglichkeit bewahrt oder gewinnt, dem gewöhnlichen Leben zum Trotz, dessen Rationalität die Unempfindlichkeit fördert. Dabei entstehen oft Kompendien des ästhetischen Denkens und der Psychologie. Besonders sorgfältig werden die Artikulationen jener Seelenkräfte registriert, die in den Texten vorkommen, ohne daß sie zuvor im Bewußtsein der Schreiberin gewesen wären. Ihre Deutung ist Sache der Kommentare. Oft geschieht das durch die nachträgliche Kritik des Textes, die dann die notwendige Verständigung über ein unbekanntes Teil des Selbst einleitet. Wo etwa in einem Text nicht bis zum Ende gegangen wurde und daher Kurzschlüsse zwischen Wort und der gewollten Bedeutung auftreten, arbeitet der Kommentar, inspiriert durch die Fragerichtungen der Psychoanalyse, an der Bruchstelle weiter. Trotzdem ist er nicht etwa klüger als der Text; denn oft wird im Kommentar mit Überraschung konstatiert, wieviel Unerwartetes sich im Text herausstellt.
Unabhängig davon, was das Experiment für die Gestaltung der Texte einbringt, beeinflußt es natürlich auch das Verhältnis von Text und Leser. Die Kommentare lesen sich spannend und erhellen die vorausgestellten Texte auf vielfältige Weise. Aber sie behindern unter Umständen auch die spezielle Aufmerksamkeit, die die Texte brauchen, so daß diese selbst ins Hintertreffen geraten. Denn der argumentierende, weit ausholende Diskurs ist weitaus vertrauter als der Vorgang der Bedeutungserneuerung, der ein anderes, ganzheitliches Verstehen fordert.
Außerdem finden sich in den Kommentaren sehr strikte Ansichten darüber, wie man den Texten begegnen muß. Eine freie Bewegung bei der Bedeutungsfindung ist nicht vorgesehen. Die Kommentare bestehen auf der Einmaligkeit, einem unveränderlichen Texterlebnis. Von ihnen geht dadurch, ohne daß es gewollt wäre, auch eine einschüchternde Wirkung aus.
Elke Erb bringt viel Zuversicht auf, daß die Befreiung von allem gelingen kann, was uns starr macht und einer Dressur nach dem Regelwerk der toten Dinge unterwirft. Sie baut fest auf die Kraft einer eigenen Sprache, die ein Selbstvertrauen im Ich errichten soll, das sie schon formuliert:
Von nun an:
Wenn es nicht geht, paß auf, dann will es fliegen.
Oder mit anderen Worten:
Das ist von nun an erreicht.
Die Gestalt solcher Sätze ergibt sich nicht aus der Mitteilung über ein glücklich gelöstes poetologisches Problem. Sie bilden vielmehr ein Lebensgefühl ab, durch das die Gegenwart erfüllt ist mit Selbsttätigkeit. In der Hoffnung, daß sie Raum für eine Einheit von Sinn und Sein werden kann, schreibt sich die Idee eines vorankommenden Subjekts, ja fortschreitender Entdeckung ein. Diese Haltung sticht ausgesprochen von den Befunden ab, die sonst in der zeitgenössischen Lyrik zur weltanschaulichen Situation des Subjekts – besonders bei den Generationsgefährten Elke Erbs – vorgelegt werden. Welcher Lyriker wäre da nicht im Konflikt mit einem früheren Selbst und wen schauderte nicht angesichts unwiderruflich vergehender Zeit? – Veränderungen und Kürzungen von Gedichten, Selbstzitate und Kontrafakturen sind allerorts strukturelle Äquivalente für den aufgebrochenen Konflikt mit der Zeit. Auch die häufigen Gegenüberstellungen von Einst und Jetzt artikulieren Verlust von Gewißheiten. Elke Erb dagegen verfügt gerade jetzt über eine Zeit ihres Werdens. Frühere Zustände und ihre Zeugen, die Texte, werden mit der Gelassenheit angesehen, die nur dann möglich ist, wenn jeder Rückblick, selbst der auf weniger Gelungenes, den eingeschlagenen Weg bestätigt:
Sie waren ja weniger durchgearbeitete Auffassungen, d.h. – auf dem Wege – Entstellungen.
Dies ist ein ganz unsentimentalisches Verhältnis zur Zeit, Lebenszeit wie geschichtlicher Zeit; es lebt aus einer großen, fast gläubig zu nennenden Anstrengung des Wollens. Ob das ein Attribut weiblichen Schreibens ist, wage ich nicht zu entscheiden.
Ursula Heukenkamp, Neue Deutsche Literatur, Heft 433, Januar 1989
Weg nach innen
Was wäre, wenn das Meer mit jeder Welle in Schreie ausbräche? Das Geschrei ließe uns anders mit dem Meer umgehen. Elke Erb hört solches Geschrei, sie versucht es zu notieren. Weil sie meint, sie entferne sich dabei weit von der üblichen Art und Weise, das Meer oder braune Augen oder Otto und Anna zu sehen, überbrückt sie die Entfernung durch Kommentare zu ihren Texten, liefert also das Unterholz zum Holz. Elke Erb, Jahrgang 1938, einst von Deutschland-West nach Deutschland-Ost gezogen, um dort sinnvoll zu arbeiten und zu leben, weiß, daß die Zeit, in der Schreiben ein Akt der Selbstbehauptung war, vorbei ist. Die Kulturpolitiker erwarten nicht mehr, daß die Autoren, die Künstler des Landes einen direkt wirkenden Beitrag zum weiteren Aufbau des DDR-Sozialismus leisten – also muß man sich als Schreibende auch nicht mehr dagegen wehren. Was tun mit der neu gewonnenen Autonomie? Autoren wie Heiner Müller oder Volker Braun oder Rainer Kirsch oder Karl Mickel nutzen den neuen Status, um die Entwicklung ihres Landes kritisch zu begleiten, sie in Frage zu stellen. Elke Erb geht den Weg nach innen. Sie will die Poesie aus dem Leben befreien, sie will die Poesie als Leben erkennen. Sie knüpft an Denk- und Arbeitsweisen der europäischen Moderne an, die in der DDR lange Zeit als dekadent verpönt waren, und eröffnet so einer Gruppe von jüngeren DDR-Autoren Wege zur Neuen Poesie. Das ist verdienstvoll. Ob dieses Weg-Reisen fruchtbar sein kann? In ihrem Lehr-Buch Kastanienallee lesen wir vom Geruch toter, selbstvergessener Mäuse, wir betrachten senkrecht und waagerecht zu lesende Texte, wir erleben den Umschlag von Strukturen in eine Gestalt. Aus der Mitteilung: Mein Freund H., ein Pfarrer, sagte, (… ) daß er bei der HJ, wenn die Gleichaltrigen ihre Kommandos brüllten, immer kichern mußte im Glied werden unter Elke Erbs Händen neun Zeilen, und das Ergebnis nennt sie eine HITLERJUGEND-ANEKDOTE. Alle ihre Texte, von wilder Strenge beherrscht, verströmen die Angst der Autorin, mit dem Ungewohnten nicht verstanden zu werden – daher die umfangreichen Kommentare, die immer neuen Versuche, eine Theorie des offenen, halboffenen, geschlossenen Gedichts einleuchtend zu machen. Aber nicht alles, was einem Menschen einfällt, fällt so tief, wie man meint. Es ist gewiß wahr, daß Elke Erb eine neue Reifestufe der neuen Scheiberfahnungen erstiegen hat, ebenso wahr ist aber auch, daß sich andere Autoren, um im Bild zu bleiben, schon eine Treppe höher häuslich eingerichtet haben. Kastanienallee markiert einen subjektiven Fort-Schritt, objektiv aber eine Verspätung; Elke Erb versucht mit angestrengtem Ernst, die Virtuosität einiger ihrer Gedichte zu erklären, indem sie deren Genese beschreibt, den Weg, zur Sprache zu kommen, etwas zur Sprache zu bringen. Nur: das ist uns schon so oft erklärt worden und hat uns nie so recht überzeugen können. Weil Rezeption und rückwärts verfolgte Genese nicht identisch sind, weil erzähltes Kochen nicht Essen ist. So bleiben denn die Gedichte. Wohin mit dem Blick, wo lasse ich ihn grasen? fragt die Autorin. Die Kinderzeit, die Schulerfahrungen werden genutzt, früher Notiertes gerinnt zum Memorandum, zum Anlaß für Prüfungen und -Spiele mit Kombinationen. Es sind Gedichte, die herkömmliche Interpretation oft abweisen, man muß in ihnen sein oder draußen bleiben, man muß den Umschlag des Wortes weiß in das Wort wissen, des Verbs spazierengehen in das Substantiv Spaziergangster als aufschlußreich empfinden – erklärt werden kann dieses suchende Vertiefen, Erweitern, Erschöpfen nicht. Vor uns liegen Druck-Bilder, Wort-Kunstwerke mit blank polierten Oberflächen, in sich bergend Triviales und Überraschendes, entgegen der Behauptung der Autorin weitgehend irrational organisiert und letztlich unerschließbar. Es bleibt also: das Staunen. Elke Erb liest zwischen Staubwischen und Staubsaugen im Zupfgeigenhansl und macht daraus ein Sieben-Zeilen-Gedicht über deutsches, lächelndes, gewußtes Unglück, über den Tod, unabweisbar. Das macht ihr keiner nach.
Konrad Franke, Süddeutsche Zeitung, 10./11.12.1988
Die heile Stille
Kein Zweifel, die 1938 in der Eifel geborene und 1949 in die DDR übergesiedelte Elke Erb hat sich um die Literatur ihres Landes verdient gemacht. Nachdem die gemeinsam mit Sascha Anderson erstellte Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung in der DDR nicht erscheinen durfte, konnte sie den Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch 1985 zum Druck der Sammlung bewegen, die ein neues literarisches Selbstverständnis ostdeutscher Autoren im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren dokumentierte. Auch wenn sich die meisten von ihnen noch allzu unbekümmert an literarische Vorbilder aus dem Kreise sprachexperimenteller Poesie hielten und damit ungewollt das Vorurteil von dem verspäteten Bemühen um Anschluß an die europäische Moderne bestätigten, war der Einsatz nicht vergebens. Die Verlage der DDR sind mittlerweile aufmerksam geworden auf eine Lyrikergeneration, für die Dada und Pop wichtiger sind als der sozialistische Realismus, Jandl wichtiger als Becher, Breton bedeutender als Brecht. Auch Elke Erb profitiert von der langsamen Anerkennung avantgardistischer Literatur in ihrer Heimat. Mehr noch: sie begibt sich in immer kühnere Gefilde sprachlicher Abstraktionen, ja, sie scheint darin ihre Schützlinge noch Überbieten zu wollen – mit dem Resultat freilich, daß sie sich mittlerweile ganz gehörig verrannt hat. Aufgebrochen war sie 1975 mit der Sammlung Gutachten. Sarah Kirsch kapitulierte damals vor den noch vergleichsweise eingängigen Kindheitserinnerungen und Reisebeschreibungen, indem sie in ihrem Nachwort kurzerhand die Unmöglichkeit eines Nachworts zu einem schlichtweg überragenden Buch beschwor. In einem immerhin dreißig Seiten langen Gespräch mit Elke Erb als Lesehilfe zu dem Band Der Faden der Geduld (1978) gestand Christa Wolf: Ich glaube eine ganze Anzahl dieser Texte nicht zu verstehen. Auch viele Kritiker resignierten vor Elke Erbs Texten und raunten im Chor von der schieren Rätselhaftigkeit ihrer Arbeiten. Erich Fried vermutete gar eine Psychoneurose der Autorin, die uns indes lehre, auch die sogenannten Irren ernst zu nehmen. Der Versuch einer Rezension, schrieb er 1982 in seiner Rezension zu dem Buch Trost, sei eine Anmaßung. Elke Erb hat jetzt die Lehre aus der Ratlosigkeit im Umgang mit ihren Texten gezogen. Das für die Durchsetzung schwieriger Bücher in der DDR manchmal obligatorische Nachwort fehlt in Kastanienallee gänzlich. Die Autorin selbst hat jetzt die Kommentierung übernommen, und darin steckt dann auch der Kardinalfehler der Publikation. Elke Erb ist allen Ernstes darum bemüht, den autistisch behinderten Alleinvertretungsanspruuch von Texten, die allein auf – weißer Wüste ihr Dasein fristen, zu beheben. Die Kommentare – sie machen den weitaus größeren Teil des Buches aus – sollen den vorstehenden Texten als Beistand dienen, den Denkprozeß erfassen und noch so manches mehr, um dann die alles entscheidende Frage zu verneinen. Nehmen wir das Titelgedicht. Es lautet:
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags um halb fünf roch es flüchtig nach toten, selbstvergessenen Mäusen.
− Anstelle eines Exkurses in die Psychologie jenes selbstvergessenen Säugetiers – Humor ist der Autorin denkbar fremd – erwartet den Leser ein titanischer Kommentar zum Dreizeiler, der sage und schreibe sechs enggedruckte Seiten umfaßt. Da ist weidlich von den grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Wahl des ersten Gedichts für einen neuen Band die Rede, da wird in einem aufwendigen Beweisverfahren die grundsätzliche Unschuld eines jeden Textes ausgerufen und über das Leben schlechthin orakelt, (Das Leben ist eine Figur in der Zeit), bis der ohnehin schon tote Gegenstand des Gedichts vollends verschwunden ist und damit auch das Gedicht. Ob in Dreizeilern, graphisch ausgemessenen Flächengedichten oder Prosaminiaturen – überall zeigt sich Elke Erbs Ansinnen, kürzeste Sinneswahrnehmungen zu geheimnisvollen Beschwörungen aufzuplustern. Die können sich ergeben aus dem Anblick einer Blume im Herbstgarten oder der Auslagen in einer Drogerie, aus den Eselsohren im Stundenplan, einem Radfahrer im Regen, einer Kugellagerschiene zwischen den Fingern oder einem Satz wie Sie hat braune Augen, der folglich Anlaß zu einer ihrer selbstquälerischen Sprachreflexionen gibt. Soll man nicht besser sagen: Sie ist braunäugig oder Braune Augen hat sie? Ob auf dem Heuboden, in der Nähe zur Dusche oder zum Telephon – das Notizbuch liegt immer griffbereit. Doch das lyrische Material in Elke Erbs Gedichten ist austauschbar. Es dient ihr vornehmlich dazu, den formalen Bedingungen eines Textes auf die Spur zu kommen. Und dies versucht sie mit mathematischer Genauigkeit. Die Erstellung von Formeln und Gleichungen, Axiomen und Konstruktionsbeschreibungen liebt sie über alles. Natürlich will sie ihre Kommentare auch unabhängig von den Texten verstanden wissen. Das läßt sich kaum vermeiden, da sie chronisch aufgebläht werden mit Paraphrasen, Interpretationsvarianten und wüsten Assoziationsketten. Doch ändert dies gar nichts daran, daß sie überflüssig sind. Am Ende bleibt der Eindruck, als habe Elke Erb die Texte nur der Kommentare wegen geschrieben. Das ist gerade da um so schmerzhafter, wo das eine oder andere tatsächlich gelungene Gedicht vom post scriptum erschlagen wird. Abendspaziergang – der wohl beste Text des Bandes zeigt, daß die Autorin nicht nur sprachliche, sondern darüber hinaus auch soziale Erfahrungen in einer von Stacheldraht geteilten Stadt zu formulieren versteht. Aber wenn bald darauf Struktur 1981 folgt, ein vollkommen für sich sprechender Text, und sodann die Autorin zu ihren gefürchteten Kommentaren anhebt, wird dem Leser jede Poesie ausgetrieben. Der Kommentar zum Text: Innerhalb eines transzendenten (symbolkräftigen) Sinnganzen hält ein solches Exponat (…) zu einer Erweiterung der Grenzen an, als ein Besonderes also, das als unwiderleglicher Endpunkt Besinnung auf eine größere Allgemeinheit erheischt. – Wir dagegen können Elke Erb nur eine Besinnung auf ihre literarischen Grenzen wünschen.
Hajo Steinert, Frankfurter Allgemeine Zeitung 16.2.1988
Elke Erb: Kastanienallee
„Texte und Kommentare“ heißt das Buch der Peter Huchel Preisträgerin 1988 im Untertitel. Das erste Exempel gibt ein dreizeiliger Text nebst einem sich über sechs Seiten erstreckenden Kommentar. Der Text: „KASTANIENALLEE, bewohnt / Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags / um halb fünf roch es flüchtig / nach toten selbstvergessenen Mäusen. / 1.1.1981“. Der ausführliche Kommentar soll diesen Text offenbar assoziativ aufladen, er bietet Gedankensplitter an, halbdeutliche Bilder, Sentenzen, deren Sinn durchaus dunkel bleibt — vielleicht sollte man den Kommentar nochmals kommentieren, so ließe sich unter einem „Text“ ein ganzer Band füllen. Elke Erb vergräbt sich vor unseren Augen ins Chaos ihrer Gedankenströme; wenn wir hoffen, mit ihr daraus aufzutauchen, hoffen wir vergebens. Nun denn, mag der Gedankenfischer sich ermuntern, halt nur das Netz in den Schwarm, etwas wird schon darin hängenbleiben. Was bleibt, sind aber kleine Fische. Auf Seite 93 gibt Elke Erb ihre Methodik preis, in einer Notiz vom Winter 1980/81: „Ich nutzte in dieser Zeit die Vorteile meiner veränderten Schreibweise immer wieder,… Denkimpulsen sofort nachzugeben, die von ihnen signalisierten Zusammenhänge aufzudecken. Dank dieser Schreibweise wurde die sprachliche Wahrnehmung feiner, beweglicher, unternehmender, umfassender und gründlicher… Ich überwand auch jene bekannte Ausdrucksnot leichter, wo man etwas konzentriert (zum Greifen nahe) fühlt, aber nicht imstande ist, es zu sagen…“ Da ist Elke Erb nur zu gratulieren. Ob ihre Leser auch davon profitieren, bleibt allerdings fraglich. So sehr ist sie mit sich selbst beschäftigt, daß das, was sie nun so ganz ohne Not ausdrücken kann, es schwer hat, sich anderen mitzuteilen.
Martin Ahrends, Die Zeit, 3.3.1989
Verse, die das Gespräch (…)
(…) Kastanienallee, im Untertitel als Texte und Kommentare ausgewiesen, vereint Arbeiten, die nur selten länger als eine Seite sind, ohne je einseitig zu sein. Man kann sie keinem Genre wirklich zuordnen, was ihre sprichwörtliche Offenheit ebenso ausmacht wie die des ganzen Bandes. Es sind Momentaufnahmen, kaleidoskophaft verstreute Beobachtungen, die im Auge des Leser-Betrachters zum neuen Bild zusammenfinden. Den Texten stellt die Autorin (mit) Kommentare(n) nach; das Verhältnis beider zueinander ist im besten Sinne ein spannendes. Die Kommentare sind nicht Interpretation, die dem Leser übers Maul fahren, bevor der es auftut, sondern sie inszenieren gerade ein Gespräch mit ihm, das zu selten stattfindet. Sie geben in ein poetologisches Prinzip Einblick, das Freisetzung statt Entgegensetzung sucht, loses Spiel der Assoziationen statt deren Konfrontation, vergleichbar einem Mikado etwa, das, vom einzelnen verstreut, gemeinsam mit Spaß wie Bedacht eingesammelt wird. Die eigen-willigen Sinnaustreibungen Elke Erbs lassen zugleich fragen, wie sinnvoll eigentlich akademisch immer wieder einmal aufgelegte Vorstellungen von der Stummheit, der Sprachskepsis sowie des Experimentellen ihrer Dichtung sind. Die Texte der Autorin sind, wie auch bei einer Vielzahl jüngerer Dichter, Dokumente eines Lebensexperiments, das heißt eines erfahrenen wie sicher auch zerfahrenen, aber immer tätigen Seins. Und so heißt es folgerichtig in einem schon wieder jüngeren Text: Ich suchte das Leben, aber fragte nach dem Sinn.
Aus: Tilo Köhler, Neues Deutschland, 4./5.2.1989
Die Sprache als ein Schutzschild gebraucht
Werkstatt-Berichte sind häufig enttäuschend. Selten schaut ein Berichterstatter tatsächlich einem Schriftsteller auf die Finger oder in die Schubladen seines Schreibtisches. Nicht bereit, das eigene Licht unter den Scheffel stellen zu lassen, hat die Lyrikerin, Übersetzerin und Essayistin Elke Erb auch die Rolle der Berichterstatterin übernommen. Als die nahm sie die Gelegenheit wahr, ihre linguistischen Leidenschaften voll auszuspielen. Die von der Autorin so geschaffene autonome Situation schreckt den ab, der sie als autoritäre Bevormundung empfindet. Von Elke Erb wahrlich nicht gewollt, wird dieser Um-Schlag aber nicht immer zu verhindern sein.
Sicher ist, daß die „Texte und Kommentare“, die für den Band Kastanienallee ausgewählt wurden, die schweifende Phantasie drosseln. Die Schriftstellerin konzentriert und komprimiert ihre geistigen Ab- und Aus-Schweifungen derart, daß die Texte Minipillen gleichen, die am ehesten im aufnahmewilligen, empfänglichen intellektuellen Geist-Körper wirken werden.
Sind schon die Texte alles andere als flüchtige Zeichen, so haben erst recht die Kommentare nichts von zeichenhafter Flüchtigkeit. Mit einer seltenen sprachlichen Akkuratesse sanktioniert die Schriftstellerin ihr Sagen. Es ist zwecklos, eine inhaltliche Wiedergabe des Gesagten zu versuchen. Selbst die Neben-Sätze der Kommentare sind Haupt-Sätze. Sie weisen weit über literarisch-sprachliche Gestaltungsabsichten und -Varianten hinaus. Da Absichten und Varianten nicht um ihrer selbst willen existieren, auch nicht der literarisch-sprachlichen Existenz wegen, ist strikt darauf zu achten, wofür die Äußerungen stehen.
„Ich konnte bei einem Satz bleiben, der nichts bewegte und der blieb, was er war“, kommentiert die Lyrikerin eines ihrer Gedichte. „Konnte“, sagt sie und kann nicht verharren. Es wäre langweilig für sie, es bliebe, was war und wie es ist. Die Schriftstellerin schreibt, weil sie wissen will, was sein könnte. Jedes ihrer Worte ist Material aus dem Flöz des Bewußt-Sein-Stollens, in den sie vordringt. Elke Erb kann sich mit Blindheit schlagen, um so zu sehen und zu erkennen, was mit bloßem Auge nicht zu sehen und zu erkennen ist. Sie schaut ins Dunkel und sieht im Dunkel am besten. Erst das geistige Auge macht die Dunkelheit durchsichtig.
Elke Erb fertigt fortwährend sprachliche, gedankliche Entwürfe an, die ständig Signale geben. Auf jedes Signal reagieren, ohne das Gefühl, sich preiszugeben, heißt den geistigen Fortgang nicht verzögern oder durch Unterlassungen verraten.
Was der Schreiberin geschieht und wirklich gelingt, könnte auch dem achtsamen Leser von Kastanienallee widerfahren. Gemäß der Motivation: „Die gesamte Arbeit sagte mir: Man muß darauf zugehen (nicht fliehen).“
Die Selbst-Aufforderung der Schriftstellerin wird zur Forderung, vor den gedanken-stenographischen Kürzeln der Autorin nicht zu fliehen. Die ungewöhnliche Syntax Elke Erbs ist erlernbar, indem man ihre Sprache anders als üblich liest.
Daß die Schrift-Stücke selbst dem willigsten Neugierigen genug Schwierigkeiten bereiten, ist nicht zu verschweigen. Es ist immer einfacher, Elke Erb zu fliehen, als ihr zu folgen. Wem die Texte keine Brücke zu den Kommentaren schlagen, der kommt eventuell über die Kommentare zu den Texten. Es genügt, von einigen gedanklichen Metamorphosen der Autorin angesprochen zu sein, um zum Kern der literarischen Methode zu kommen. Es muß kein Versagen sein, wenn es einem nicht gelingt, die Tür zu den Texten und Kommentaren aufzuschließen. Selbst die Verfasserin beklagt: „DIE SCHWIERIGKEIT, die Texte zu kommentieren.“ Nie auf eine Wiederauflage der Texte mit verändertem Vokabular aus, ist jeder Kommentar auch ein Abstandnehmen oder Annähern, ein Umrunden oder Durchkreuzen, ein Bejahen, oder Verneinen, so daß immer wieder ein neuer, eigenständiger Text entsteht.
In ihrer rigorosen, nicht radikalen, aber konsequenten Denkungs-Art erinnert die Erb am ehesten an das russische Sprachgenie Welimir Chlebnikow. Wie er stellt sie allem Gedachten und Gesagten ihre Sprache als ein Schutzschild gegenüber, hinter dem sie ihre Selbstaussagen ungestört äußern kann. Das heißt, eine eigene Meinung zu haben, die schreibend Gestalt annimmt, also sich im Bewußtsein abzeichnet. Elke Erb ist eine selbstentschlossene Bewußtsein-Bildnerin. Die Bilder ihrer literarischen Texte sind allemal Gleichnisse, die sich geistiger Gleichförmigkeit und Deformation widersetzen. Die Aussagen der kommentierenden Literatur mehren und kräftigen die Gleichnisse. So bekommen alle Schrift-Stücke des Bandes einen starken Sinn-Symbolgehalt, ohne der Sinnlichkeit zu entbehren. Das ist wichtig, weil die Autorin ihre Äußerungen so „dem Schönen, Guten und Wahren“ bewahrt. Die Texte und Kommentare präsentieren sich in selbstentworfenen poetischen Strukturen. Sie verhindern, daß die Schriftstellerin die Rolle der germanistischen Analytikerin einnimmt. Wer aber, der Elke Erb kennt, hätte das auch von Elke Erb erwartet?
Bernd Heimberger, Neue Zeit 15.2.1988
Selbstvergessene Mäuse
KASTANIENALLEE, bewohnt
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags
um halb fünf roch es flüchtig
nach toten, selbstvergessenen Mäusen.
1.1.1981
(Elke Erb: Kastanienallee)
Er hörte seine Schritte auf den Granitplatten
des Gehwegs und verstand, wie seltsam es war
(angesichts dessen, was ihm gerade geschah),
die Vorstellung von einer richtigen Reihenfolge
aufrechtzuerhalten, weshalb er jetzt lächeln
musste. „Im Treppenhaus Kastanienallee 30
nachmittags / um halb fünf roch es flüchtig /
nach toten selbstvergessenen Mäusen.“ Carl
kannte den Geruch, tot und selbstvergessen –
so begann „Kastanienallee“; kein schlechter
Anfang für einen Gedichtband.
(Lutz Seiler: Stern 111)
Es roch nach Bier, nach Erbrochenem und nach
Pisse.
„Es riecht nach selbstvergessenen Mäusen“,
sagte Fabian eine Gedichtzeile, von wem,
konnte er sich nicht erinnern.
„Nach toten selbstvergessenen Mäusen“,
korrigierte Dmitri, ohne den Autor zu verraten,
und zeigte Fabian eine mittelgroße lebendige
Ratte.
(Olga Martynova: Der Engelherd)
Die von Elke Erb am 1.1.1981 ins Leben gerufenen toten Mäuse gehören heute zum Kanon der deutschen Dichtung. Nicht, dass ich Bestätigung dafür bräuchte, aber das war eine erfreuliche Überraschung, dass nicht nur ich, sondern auch Lutz Seiler auf die Idee gekommen war, „KASTANIENALLEE, bewohnt“ im eigenen Roman zu zitieren.
*
Elke Erb ist eine der ersten Freundschaften, die Oleg Jurjew und mich mit der deutschen Literatur verbunden haben.
Unsere Begegnung Anfang der 1990er löste eine gegenseitige Neugier aus. Elke wollte wissen, „was die Russen nun so machen“, und hat deshalb zugesagt, Olegs Prosa zu übersetzen.
Das Interesse für den / einen anderen macht aus dem / einem Objekt das / ein Subjekt.
Oleg und ich wollten keine passiven Objekte ihrer Übersetzung sein, sondern auch aktive, wahrnehmende Subjekte.
Diese Mäuse, die den Band Kastanienallee eröffnen, haben wir sofort ins Herz geschlossen. Wir hatten damals keine Ahnung, dass sie bereits berühmt und prominent waren. (Dass einige Gedichte von vielen, voneinander nichts wissenden Menschen ausgewählt werden, beweist übrigens auch, dass der Kanon nicht als Machtakt eines Fabelwesens namens „alter weißer Mann“ gebildet wird, sondern von der kollektiven Auswahl der Leser.)
*
Warum verliebt man sich gleich in diese Mäuse? Natürlich lesen wir Gedichte intuitiv, und je weniger wir versuchen, sie zu verstehen, desto besser verstehen wir sie. Das gilt auch fürs Schreiben der Gedichte: Je weniger wir verstehen, was wir schreiben, desto gescheiter kann der Text im Nachhinein werden. Und genauso, wie man beim Schreiben doch irgendwann den Kopf einschaltet, um das Geschriebene zu verantworten, wird man als Leser sich irgendwann fragen, was das Geheimnis eines Textes ist.
Was ist das Geheimnis dieser Mäuse? Zuerst, was die Autorin selbst über ihr Gedicht sagt:
Es ist ja wahr, es würde kein Mensch außer mir darauf kommen zu sagen, in der Kastanienallee roch es nachmittags um halb vier nach toten, selbstvergessenen Mäusen. Es wäre auch niemand darauf gekommen, diesen Satz als Gedicht hinzustellen. Damit behauptet man ja einen lebenden Zusammenhang, der eine Spannung enthält. Und das war auch die Parteikritik, die sagte, was die Erb schreibt, das ist doch alles so banal, was soll das? (Im Gespräch mit Annett Gröschner und Brigitte Struzyk)
Ich kann mir die Parteikritik in der DDR durchaus vorstellen. Auch in der Sowjetunion konnten in einem Gedicht Dinge, die keinen ideologischen Wert hatten, allein dadurch verdächtig werden. Und ja, sie wurden als „banal“ beschimpft. Das ist die Dreistigkeit der Propaganda, denn selbstverständlich sind „selbstvergessene Mäuse“ alles andere als banal. Aber wäre dieses Gedicht nur deshalb prominent geworden, weil es der DDR-Obrigkeit nicht gefiel, hätte es seinen Zauber heute längst verloren – was nicht geschehen ist.
Dem Dreizeiler folgen sechs Seiten Kommentar, auf denen Elke Erb dieses Verfahren, „Texte und Kommentare“, das zu ihrem Markenzeichen wird, begründet.
Für mich – und ich vermute, für jeden, der Gedichte schreibt – ist es sehr spannend, über einen bekannten Zustand zwischen den Gedichten zu lesen – ein Raum ist verlassen, ein anderer ist noch nicht aufgeschlossen:
Die Tür fällt ins Schloß, und DU stehst draußen
In diesem Zwischenraum denkt sich Elke Erb dieses Modell (Gedicht und Kommentar):
das Haus steht nicht im Himmel
das Haus steht auf seinem Grund.
Man kann sich in einem Haus durchaus wohlfühlen, auch ohne über den Grund, auf dem das Haus steht, nachzudenken. Somit ist das eine freie Wahl des Lesers, die Kommentare zu lesen oder nicht zu lesen.
Ich plädiere fürs Lesen, weil da vieles zu entdecken ist:
Das Leben ist eine Figur in der Zeit.
Um wie viel reicher wird die Welt, in der es diese Zeile gibt, die ich dem Kommentar entnommen habe: In der Tat, das ist das wenige, das man mit Gewissheit über das Leben sagen kann.
Hat aber der Zauber der toten, selbstvergessenen Mäuse mit dem Kommentar zu tun? Nein. Das ist eine zusätzliche Wohltat der Gedichte in diesem Band, dass sie die Kommentare hervorgerufen haben.
Das Verhältnis „Text – Kommentar“ wird von Elke Erb in verschiedenen Büchern unterschiedlich gelöst. In Kastanienallee sind Texte und Kommentare radikal voneinander abgetrennt. Die eigentlichen Texte (ohne Kommentare) in Kastanienallee ähneln den Gedichten aus ihrem späteren Band Sonanz, in dem sie „automatisches Schreiben“ ausprobiert hat. In Sonanz war das „automatische Schreiben“ die Befreiung von der Kontrolle. In Kastanienallee ist diese Befreiung das Versprechen, das Gedicht später zu kommentieren, ihm „beizustehen“.
Daher möglicherweise ist in den beiden Bänden diese fliegende Freiheit; das Gedicht verlässt jede sichere Zone und geht mit bedingungslosem Vertrauen in Zeit und Raum in die Welt.
*
Was verblüfft am meisten im Mäuse-Gedicht? Vielleicht ist es das Wort „selbstvergessen“, das kursiv gesetzt ist.
Das andere Wort, das erstaunt, ist „flüchtig“. „Mir schwebt vor, den Denkprozeß zu erfassen“, steht auf der vierten Kommentarseite zu diesem Gedicht. Das entspricht einer der stilbestimmenden Eigenschaften von Elke Erbs Schreiben. Sie bemerkt und formuliert die flüchtigsten Denk- und Fühlbewegungen.
Es roch „flüchtig“ – das bedeutet: In diesem einem Moment war der „Denkprozeß zu erfassen“, der flüchtige Augenblick war zum Stehen zu bringen. Eben nicht im Sinne „Verweile doch! du bist so schön!“, sondern: Halt, ich will sehen, was los ist, die „Figur in der Zeit“ betrachten und bezeichnen.
Der Zustand der „Selbstvergessenheit“ ist auch eine Befreiung von der Welt in einem buddhistischen Sinne. Gewöhnlich wird dieser Zustand aus der Perspektive eines Individuums erfasst. Und hier haben wir nicht einmal die Mäuse, sondern eine flüchtige Andeutung. Eine momentane Verbindung mit der Selbstvergessenheit der Welt. Aber natürlich bekommt das Wort im Kontext des Dreizeilers eine zusätzliche Bedeutung der Verwahrlosung jenes Treppenhauses, jener Zeit: Die Mäuse sind nicht nur selbstvergessen, sie sind tot.
Der Titel: „KASTANIENALLEE, bewohnt“. Bewohnt von wem? Von „uns“, die da wohnen? Von dem Geruch der toten, selbstvergessenen Mäuse? Elke Erb im bereits zitierten Gespräch:
Ich war nicht Flaneur! Wenn ich in die Kastanienallee ging, dann wollte ich jemanden besuchen.
Bewohnt, nicht „beflaniert“. Tote, selbstvergessene Mäuse sind etwas, was es nicht geben sollte in einem Treppenhaus. Einerseits. Andererseits sind sie das, was diesem Treppenhaus einen Sinn verleiht, für alle Zeiten, solange man noch Gedichte lesen wird. An einem Nachmittag geschah etwas im Treppenhaus Kastanienallee 30. Möglicherweise um halb fünf wurde der Zauber angedeutet. Als das Gedicht niedergeschrieben wurde, war der Zauber vollzogen:
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags
um halb fünf roch es flüchtig
nach toten, selbstvergessenen Mäusen.
*
Und noch eine für mich verblüffende Sache. In Oleg Jurjews Notizbüchern habe ich ein Gedichtfragment entdeckt:
Звуковой дорожкой парка
Не выпаренной после дожда
По зигзагу кожкой пахло
(An der nach dem Regen noch nicht gedämpften
Tonspur des Parks
Roch es im Zickzack nach Katze)
Vor zehn Minuten war ich mir ziemlich sicher, dass diese Katze eine Antwort auf jene Mäuse war, die Oleg so gemocht hat. Sicherheitshalber prüfte ich nach: Die Notiz ist vom Juni 1992. Und Kastanienallee las Oleg erst, als Elke Erb uns das Buch im November 1995 geschenkt hatte, was ich jetzt der Widmung entnahm. Also trafen sich diese Katze und diese Mäuse erst jetzt, in meinem Text: Wer Gedichte liest, wird die Geheimnisse der Welt also zwar nicht lösen, aber wenigstens spüren, dass es sie gibt.
Olga Martynova, aus Transistor, Ausgabe 4, Herbst 2020
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Ursula Wiecklein: Kastanienallee
Die Union, 25.10.1987
Cornelia Lampert: Klartext
Thüringer Landeszeitung, 12.12.1987
Hartmut Buchholz: Lyrik von der Wucht eines Sprengversuchs
Badische Zeitung, 7.4.1988
Oscar van Weerdenburg: Ein Satz sagt, was er sagt
Frankfurter Rundschau, 21.6.1988
Ernst Nef: Die lyrische Werkstatt der Elke Erb
Neue Zürcher Zeitung, 2.12.1988
Oswald Egger: Elke Erb: Kastanienallee
Der Standard, Wien, 13.1.1989
Martin Ahrends: Elke Erb: Kastanienallee
Die Zeit, 3 3.1989
Manfred Jäger: Der Büchermarkt. Aus dem literarischen Leben
Deutschlandfunk, 5.4.1988
Michael Braun: Elke Erb: Kastanienallee
Sender Freies Berlin, 13.3.1989
Gerhard Jaschke: Elke Erb: Kastanienallee
Österreichischer Rundfunk, 30.4.1989
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.1988
Elke Erb: Leben im Kommentar
Elke Erb: Vexierbild
„Zu beschreiben wäre ein steinerner Tisch…“ Ein Satz von Max Frisch aus Montauk, einer der vielen Anläufe, Gesehenes und Geschehenes auf ein Blatt Papier zu bringen, ein Satz aus einem Roman, in dem der Autor ein Resümee seines Lebens zieht, sich der Frauen, der Orte erinnert:
Zu beschreiben wäre ein steinerner Tisch… Das Haus in Berzona, das wir auf einer Durchreise besichtigen bei strömendem Regen: ein Bauernhaus, das Gemäuer ziemlich verlottert, das Gebälk zum Teil morsch. Wir kommen von Rom, VIA MARGUTTA, aus einer Untermiete; mein Leben lang bin ich Mieter oder Untermieter gewesen. Jetzt möchte ich ein Haus haben mit Dir.1
Das Ich oszilliert zwischen Privatperson, Dichter und Erzähler. Leben und Schreiben gerinnen in der Formel „Leben im Zitat“, wenn sich der Erzähler-Autor Frisch an vergangene Sätze erinnert, die das in der „dünnen Gegenwart“ Gelebte einholen.2 Auch in Elke Erbs Werk spielen die schillernde Figur des Ich und das Ineinander von Leben und Schreiben eine zentrale Rolle. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Eine Untersuchung, die sich der Poetik von Erbs frühen Texten3 widmet, wird eher an einer Differenz zu Frisch ansetzen.
„Zu beschreiben wäre“ – solche Kurvaturen sind Erbs Schreiben fremd. „Frei heraus!“ und „Nur frisch von der Leber“4 betitelt sie zwei kurze Texte aus dem Jahr 1978 und formuliert demonstrativ unprätentiös ein poetisches Programm, das sie auf den ersten Blick tatsächlich so einfach, so geradeheraus umsetzt. Da geht es nicht um Überlegungen, was zu schreiben wäre. Sie sind ja da, die alltäglichen Dinge und die alltäglichen Erfahrungen, denen sich die Dichterin unmittelbar zuwenden kann.
Berlinische Intimitäten sind diese Häuser, Hinterhäuser, so alt und mürbe, daß sie mit dieser Berlinischen Sand-Erde, auf die sie gestellt sind, fast schon wieder versöhnt scheinen, eins Sand und Haus. In einem von ihnen wohnte Greßmann, ein Poet. Sein Körper, hoch, dünn wie ein Brett, – ich konnte ihn kaum wahrnehmen –, in den Raum geschoben, senkrecht zwischen die verteilt anwesenden Möbel im Zimmer der Wirtin, als ich ihn besuchte.
So beginnt der Kurzprosatext „Erinnerung an Uwe“.5 In „Bewegung und Stillstand“, einem weiteren Text aus Vexierbild, fallen Einstieg und Schluss zusammen; das lakonische Protokoll einer Beobachtung umfasst nur einen einzigen Satz:
Kommt man mit der S-Bahn von Mahlsdorf über Kaulsdorf und Biesdorf nach Friedrichsfelde-Ost, sieht man zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost links immer diese Neubauten, aus deren hunderten Fenstern man die S-Bahn zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost immer vor sich sieht.6
Ton und Sehbewegung der Kurzprosa setzen sich fort in einem Gedicht aus dem nachfolgenden, vier Jahre später erschienenen Band Kastanienallee:
ABENDSPAZIERGANG
frische Luft zu schöpfen
Links, zurück rechts, zwei Meter hoher
Betonpfeilerzaun, ein Lager, Maschendraht,
die Pfeiler gekrümmt, Stacheldraht in den Nacken.
(…)7
„She depicts everyday details in an almost naturalist manner“ – „almost“, schreibt Birgit Dahlke.8 Genau darin, in der Artikulation des „Beinahe“, liegt das Spezifische der Dichtungen Erbs, die „Frei heraus!“ in den (Ab-) Grund alltäglicher Erfahrung führen. Es gilt also zu fragen, wie die kaum merkliche Unterwanderung der naturalistischen Darstellungsweise und damit das Offenhalten des Texts auf den eigentlichen Grund hin geschieht.
Fast mag es als ein Widerspruch erscheinen, dass Beharrlichkeit und Genauigkeit des Blicks eine erste entscheidende Voraussetzung dafür bilden, das vage „Beinahe“ zu artikulieren. Der oben zitierte, 1981 entstandene Text „Abendspaziergang“ führt in dem einem Kommentar nicht unähnlichen Untertitel „frische Luft zu schöpfen“ die Erwartung des Lesers zunächst weit weg von dem, was folgt. Überraschend setzt der erste Vers mit einem militärischen Befehlston ein: „Links, zurück rechts“. Erb verweist im Übergang zum nächsten Vers auf die Einschränkungen des Gangs am Abend und beendet den Satz im dritten Vers mit: „Stacheldraht in den Nacken.“ Während schon die Aussage „die Pfeiler gekrümmt“ die Vorstellung von ,Menschen, gekrümmt‘ hervorruft, bestätigt sich die unheilvolle Erwartung durch die Personifikation in „Stacheldraht in den Nacken“. Der elliptisch verkürzte Satz bildet eine von der friedlichen Eingangssituation des Abendspaziergangs her unerträgliche Pointe, ist ein Schlag auch in den Nacken des Lesers. In der lakonischen Reihung von Detailbeobachtungen beschreibt Erb „beinahe naturalistisch“ einen Abendspaziergang, spricht aber tatsächlich von der alltäglichen Präsenz des staatlichen Zugriffs, ohne im weiteren Verlauf des Gedichts (Selbst-)Kritik im Umgang mit der politischen Situation auszusparen, wodurch sie das im Wunsch, „frische Luft zu schöpfen“, zunächst harmlos Erscheinende kippt – „Spaziergangster“ und „Mitläufer noch des Stillstands“ heißt es in der dem Gedicht beigestellten „Paraphrase“.
Erb nennt ihren Band von 1983 Vexierbild. Der Reiz, aber auch das Quälende eines Vexierbilds (lt. vexare, plagen, quälen) beruhen auf dem Widerspruch, dass das in ihm Verborgene sichtbar und unsichtbar zugleich ist. Die eigentliche Schwierigkeit aber ist nach Franz Kafka, der in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert wird, dass ein Vexierbild nur „deutlich“ für den sei, „der gefunden hat, wonach zu schauen er aufgefordert war; unsichtbar für den, der gar nicht weiß, daß es da etwas zu suchen gilt“.9 Darin liegt seine Eignung zur politischen Kunst in Zeiten eingeschränkter Meinungsfreiheit begründet: Im Medium des Vexierbilds lassen sich verschlüsselte Botschaften vermitteln, um der Zensur zu entgehen. In Anbetracht dieser über die ästhetisch-spielerische Dimension des Rätsel- oder Suchbilds hinausgehenden politischen Bedeutung lässt sich der Titel als verborgener Hinweis auf die nur scheinbare Unverfänglichkeit der frühen Texte Erbs lesen. Das bestätigt ein Ende 2013 geführtes Interview. Auf die Frage „Welche Texte sind Ihnen jetzt unverzichtbar?“ antwortet Erb:
Mein Schreiben ist eigentlich politisch orientiert. Aber jetzt habe ich von den frühen Texten einen so merkwürdig stillen Eindruck gehabt. So als ob es um gar nichts weiter geht. Jetzt habe ich gemerkt, dass diese genau die prinzipiellen Texte sind.10
Das ungewöhnliche Cover des Buchs gestaltete der Grafiker und Fotograf Michael Roggemann – wie auch die gesamte Typografie – in enger Zusammenarbeit mit der Dichterin.11 Vorder- und Rückcover zeigen einen vergrößerten, unscharfen Bildausschnitt aus einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Im Flirren wolkiger, diffuser Lichtflecken vor verschatteten Partien erkennt man rechts im Vordergrund eine Frau im Sommerkleid und im Mittelgrund, über Vordercover, Buchrücken und Rückcover hinweg, ein Paar. Der Ausschnittvergrößerung zugrunde liegt ein Bild aus dem privaten Fundus von Roggemann. Es ist in kleinem Format über die Vergrößerung auf das vordere Cover gesetzt, mit einem unregelmäßigen schmalen weißen Rand gerahmt, leicht verzogen und minimal schräg nach rechts unten gekippt. Bei dem Foto handelt es sich um eine Collage aus mehreren übereinander belichteten Fotografien, sodass kein Bildkontinuum entsteht. Der Vordergrund bildet eine diffuse Ebene. Links im Mittelgrund steht die Frau im Sommerkleid als Rückenfigur. Leicht dem Zentrum des Bildes zugewandt, wirkt sie wie eine Beobachterin der Szene. Im Hintergrund sieht man eine Figurengruppe, in der ein Mann und eine Frau in Blickkontakt treten. Dieses Bilddetail wird auf der Rückseite des Buchs auf die Vergrößerung gesetzt, abgegrenzt durch einen ungleichmäßig gezogenen schwarzen Rahmen. Erb sei das Foto zu sehr auf das Thema Beziehungen fokussiert gewesen, ihm seien jedoch das Zerreißen der Wirklichkeit und die Splitter von Assoziationen wichtig gewesen, so Roggemann.12 Das aber ist ohne Figuration kaum möglich, und intuitiv setzt der Grafiker in der Verflechtung von Fläche, Raum und menschlicher Figur die Bedeutung des Blicks in Erbs Dichtung um, die auch Marcel Beyer 1998 in seiner ersten Laudatio auf Erb herausstellt:
Das Gesichtsfeld eine Ebene, das Gesicht im Raum: Bei Elke Erb tauchen Innen- wie Außenräume, Natur wie Nichtnatur stets im Verhältnis zum Menschen auf, nie – vordergründig – für sich, allein, wie es heißt: unberührt. „Die Blumen boten einen Anblick angeblickter Blumen“, wie es bei T.S. Eliot heißt.13
Eine weitere Strategie Roggemanns ist die Spiegelung der Fotografien im Vorder- und Hintergrund, weshalb die Frau im Sommerkleid mal links und mal rechts auf dem Bild zu sehen ist; der ebenfalls seitenverkehrte Ausschnitt mit dem Paar ist leicht verschoben, sodass die Blickachse von der beobachtenden Frau zum Paar gebrochen ist. Direkte inhaltliche Bezüge erweisen sich damit als vordergründig. Oberhalb des kleinen Fotos steht der Name der Autorin in weißen Blockbuchstaben auf schwarzem Grund, unter dem Foto der Titel, dessen Blockbuchstaben mit einem kleinen Zwischenabstand gereiht und energisch mit einem schwarzen Balken unterstrichen sind. Die unregelmäßige Rahmung der Buchstaben lässt die Schrift springen, was den Leser ebenso irritiert wie das in seiner Unschärfe und Mehrschichtigkeit schwer zu lesende Foto.
Auch der von Bernd Giersch gestaltete Nachfolgeband Kastanienallee zeigt – dem damaligen Reihenprofil des Aufbau-Verlags folgend – eine auf Vorder- und Rückcover reproduzierte Fotografie, verfremdet durch das grobe Raster des Zeitungsfotos. In einem Gespräch mit Elke Erb und Brigitte Struzyk bemerkt Annett Gröschner: „Da war auf dem Umschlag die alte Straßenbahn vor dem Prater drauf, das hatte sofort so einen Wiedererkennungseffekt“, worauf Struzyk ergänzt:
Die Kastanienallee hatte Elke Erb damit mehr oder weniger besetzt. Es gibt Orte, wo du langgehst und sagst, Tag Elke Erb.14
Auf dem Vordercover des Bandes ist eine Häuserzeile zu sehen. Eine Frau steht auf dem Bürgersteig, den Blick nach links gerichtet. Erst mit dem aufgeklappten Rückcover wird deutlich, dass sie an einer Haltestelle wartet. Die Gewohnheit, Bilder wie Texte von links nach rechts zu lesen, suggeriert dem Betrachter, dass sich die Straßenbahn, die angeschnitten links im Bild zu sehen ist, der Haltestelle nähert und die Frau bereit ist einzusteigen. Tatsächlich aber fährt die Bahn in die andere Richtung, die Frau bleibt zurück. Beide Covergestaltungen illustrieren keinen Text von Erb; sie zeigen vielmehr im Bild, was die Titel besagen, aber verbergen, was im Buch geschieht.
Zur Beharrlichkeit und Genauigkeit des Blicks tritt ein unbedingtes Sich-Einlassen auf die Sprache, auf ihr ins Surreale umschlagendes poetisches Potenzial und auf ihre materiale Dimension. Diese autonome Sprachbewegung, die sich der vermeintlich naturalistischen Darstellung zugesellt, ist essenziell für die Spannung in den Texten Erbs.15 Sie bestimmt auch ihre Kontakte zur damaligen jüngeren DDR-Literatur, die kaum Öffentlichkeit hatte, sondern als „Hauptorte der Begegnungen“ auf „Jugendklubs, kirchliche Räume und Privatwohnungen“ angewiesen war.16 Deren damals „für bundesdeutsche Verhältnisse (…) fast unbekannte Aufmerksamkeit, Sensibilität (und auch Verletzbarkeit) gegenüber dem ,Material‘ jeder Literatur, der Sprache“, wird 1985 in einer von Sascha Anderson und Elke Erb – mangels Publikationsmöglichkeiten in der DDR – bei Kiepenheuer & Witsch herausgegebenen Anthologie ,neuer‘ DDR-Literatur sichtbar.17 „Besonders gut in Ableitungen von einem Wort zum anderen war Stefan Döring, der dann aufgehört hat, als die DDR aufgehört hat. Diese Einheit von Sozialem, Politischem und neuer Sprache. Im Westen Deutschlands gab es nur einen noch, bei dem ich das so gefunden habe: Thomas Kling“, äußert Erb in dem oben genannten Interview von 2013.18 Sie mache damit, so Kerstin Stüssel, eine „politisch-soziale Bedeutung geltend, die den oberflächlichen Assoziationen von konkreter Poesie und purer Autonomie ein erweitertes und komplexeres Verständnis, ja vielleicht sogar einen – erweiterten – Engagementbegriff entgegensetzt“.19 Dieser erweiterte, eine ,neue Sprache‘ mit einbeziehende Engagementbegriff bei Erb geht aber nicht einher mit einer leichten Zugänglichkeit ihrer Texte, im Gegenteil. Wenn es zu einem hohen Grad die Sprache ist, die das Schreiben vorantreibt, so formt sich ein äußerst eigenwilliger Text, in dem die Wörter sich neben und über und unter die anderen stellen und der Leser sich geradezu verläuft in den Worten wie in einer Berliner Hinterhausarchitektur. Das führt die poetologischen Überlegungen zu einem dritten entscheidenden Punkt, der Bedeutung der Topografie.
Es sind konkrete Orte, über die Erb schreibt, die Wohnung eines befreundeten Schriftstellers in einem Berliner Hinterhaus oder eine Straße wie die Kastanienallee in Prenzlauer Berg und Berlin Mitte. „Die Häuser erscheinen dabei mit dem Umzug vom Land in die Stadt“, so Beyer.
In Scherbach war alles heimlich, zum Heim gehörend. In Halle stellt Elke Erb die Frage zuerst: „dann guckst du auf die Häuser; da müssen doch Menschen drin sein“ („Nachts“ S. 181). (…) Das zuvor selbstverständliche Umgehen mit der Umgebung besteht in der Stadt nicht mehr. Der Umgang bedarf der Erarbeitung, jeglicher Umgang muß – um überhaupt zustande kommen zu können – hinterfragt werden. „Kastanienallee“ heißt es, nein, es heißt „Kastanienallee, bewohnt“, und: „Es wohnen Menschen, wie es Häuser sind“ („Unschuld“ S. 105).20
KASTANIENALLEE, bewohnt
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags
um halb fünf roch es flüchtig
nach toten, selbstvergessenen Mäusen. 1.1.198121
Die Straße, die dem Band den Namen gibt, findet sich in Titel und Eingangszeile des ersten Textes wieder, den die Autorin ausdrücklich als „Gedicht“22 bezeichnet, wenngleich der Werkfluss durch die Gattungen ein Charakteristikum des Schreibens von Erb ist, das den Leser von jeglicher gattungsorientierten Erwartungshaltung befreit. „Ob die Prosa Prosa ist, ob die Gedichte Gedichte sind, bleibt oft fraglich. Das ist aber hier höchstens von Vorteil.“23 Die präzise Angabe nummerischer Fakten wie Hausnummer, Uhrzeit und Datum kollidiert mit der surrealistisch anmutenden Wahrnehmung eines Geruchs nach „toten, selbstvergessenen Mäusen“, aber erst beides zusammen erzeugt die Authentizität des Beschriebenen.24 Doch geht es in Erbs Dichtung nicht nur um den geografischen Ort. Es ist auch das Papier, der Satzspiegel, das Buch ein Ort, ein Raum, in dem es Worte zu setzen, zu durchwandern und dann selbst wieder zu beschreiben heißt.
„Das erste Gedicht des neuen Bandes? – Nein. Mit dem ersten Gedicht fängt man noch nicht an, den Band zu schreiben. (…) Ein Gedicht betritt den Platz, den ein Band verlassen hat / (nimmt ihn ein)“, schreibt Erb.25 Worte und Texte als Dinge zu sehen, die hingestellt werden, denen etwas beigestellt wird, die ihren Ort finden müssen – diese materiale Auffassung von Sprache sucht Erb in der grafischen Umsetzung ihrer Texte transparent zu machen.
Selbst die Bände der Elke Erb sind ein Gedicht. Grafisch gesehen. Der letzte, Vexierbild (1983), kam daher auf mattblauem Papier, die Gedichttitel vertikal gesetzt.26
In der Tat setzt sich die ungewöhnliche Gestaltung des Covers von Vexierbild auch in dem aufwendigen Satz des Textes im Buch fort. Das beginnt schon mit der Wahl des Papiers, das der Rezensentin ins Auge fiel. „Dieses Papier war eine Rarität in der DDR“, berichtet der Grafiker Roggemann. Es habe großer Anstrengungen des damaligen künstlerischen Leiters des Aufbau-Verlags Heinz Hellmis27 bedurft, das durchgefärbte Werkdruckpapier zu beschaffen. Der Textlauf sei durch das Manuskript der Autorin vorgegeben gewesen. Er habe den Text dann mit der Hand skizziert und diese Typoskizze setzen lassen. Gemeinsam mit Erb sei daraufhin ein Klebeumbruch erstellt worden: „Wir haben in meiner Wohnung zusammen auf dem Boden gesessen und geschnippelt.“28 Schwarzer Vorsatz, fett gesetzte Schrift, breite waagerechte Linien, die die einzelnen Teile des Bands optisch gliedern, vertikal gesetzte Titel, dazu das graublaue, raue Papier, das als Textträger auftritt und den Worten eine Basis verleiht – der Band ist handfest, hat eine selbstbewusste, bodenständige Ausstrahlung. Jeder Text hat ein eigenes Gesicht, es gibt weder einen für das gesamte Buch verbindlichen Satzspiegel, selbst bei den im Blocksatz gesetzten Prosatexten nicht, noch einen einheitlichen Zeilenfall.
So ganz aus dem Nichts kommt das nicht. Der bei Erb übliche Wechsel zwischen Kurzprosa und Lyrik prägt bereits den Satz ihres ersten Buchs Gutachten. Poesie und Prosa innerhalb des mit „Poesie“ betitelten ersten Teils. Früh spielt sie mit dem Einzug einzelner Zeilen,29 dem Wechsel von Flattersatz, links- oder rechtsbündig, und Mittelachsensatz30 und dem Zweispaltendruck.31 Es gibt die der konkreten Poesie verwandten Bilder aus Worten.32 und es gibt eine radikale Auflösung der Linearität, die den Leser in ungewohnte Lesebewegungen führt, wenn einzelne Zeilen in den Weißraum vor alphabetisch geordnete, sich treppenförmig verkürzende Zeilen gestellt werden.33 In „Es saß ein klein“ laufen zwei Stimmen – das Zitat von vier Versen aus Der Zupfgeigenhansel und der eigene Text – gegeneinander, typografisch durch den Wechsel von links- und rechtsbündigem Druck ins Bild gesetzt.34 Die vier Verse des Lieds fordern damit eine eigene Lektüre geradezu heraus, vergleichbar mit dem Text „Schlamm“, in dem die in Versalien gesetzten Schlüsselwörter die Lektüre gegen den Strich provozieren.35 In Vexierbild entfernt sich Erb immer mehr von der linearen Darstellung, die einen Gedanken „resultativ“ verhandelt, und öffnet sich einer Schreibweise, die grundsätzlich alles Material „IN BEZUG AUF“ den Gegenstand zulässt und die sie als „prozessual“ beschreibt.36 Daraus entwickelt sich ein den Raum des Blattes immer stärker auf alle erdenklichen Möglichkeiten hin ausschöpfendes Schreiben, das sie in Kastanienallee fortführen wird.
„Was im 83er Band angedeutet ist, wird nun, vier Jahre später, bereits in den Untertitel des neuen Bandes Kastanienallee (Aufbau-Verlag, 7,20 M) genommen: Texte und Kommentare.“37 2016, nach rund 30 Jahren, greift Erb mit „Gedichte und Kommentare“ wieder auf diese Formulierung zurück.38 Auch hier illustriert die Umschlaggestaltung von Miriam Zedelius den Titel: Zwei Rechtecke aus übereinander getippten Sätzen, nahezu unlesbare Gewebe (lt. textus), überlagern sich versetzt und spiegelverkehrt wie das reflexive überschreiben der Gedichte im Kommentar. Der Zweiteilung in Text/Gedicht und Kommentar wird die Typografie durch unterschiedliche Schriftgrade gerecht oder durch die Gegenüberstellung von Gedicht und Kommentar verso und recto.
Auch Erbs Verständnis des Kommentars spiegelt ihre materiale Auffassung von Sprache wider: Sie sieht ihn „nicht als einen Beistand für die Leser, sondern als einen Beistand zu den Texten“, und versteht Beistand im wortwörtlichen Sinne:
das steht da oben und das steht da unten dabei.39
Ebenso wie in das Aufbrechen des konventionellen Schriftsatzes ist Erbs Schreiben von Anfang an in einen beständigen Prozess der Kommentierung eingebunden.40
Ihre Dichtungen entwickeln sich aus Notizen, die sie über Jahre hinweg zusammenträgt.41 Oft tragen die Texte zwei Datumsangaben, die weit auseinander liegen können, ein deutlicher Hinweis darauf, dass Notizen und Texte bereits in sich eine Art des wechselseitigen Kommentars bilden. Die Nachbemerkungen und Erläuterungen der Autorin in ihren Gedichtbänden als gängige Form des Kommentars und die den einzelnen Texten explizit beigestellten Kommentare sind dabei nur der augenfälligste Ausdruck dieses doppelten Schreibprozesses. Der Kommentar ist immer schon Teil ihrer „merkwürdig stillen“ Arbeits- und Darstellungsweise, verselbständigt sich jedoch zunehmend als „Beistand zu den Texten“. Insofern kommt den Bänden Vexierbild und Kastanienallee eine Schlüsselfunktion in ihrem Werk zu.
Der Beruf der Schriftstellerin bedeutet für Erb, die „neuen Schreiberfahrungen auszuleben und sie in das Textleben, den Lebenstext zu bringen“.42 Das Wortspiel stellt die Verbindung zu der eingangs aufgeworfenen Frage nach der Untrennbarkeit von Leben und Schreiben her. In Variation des Diktums Frischs vom „Leben im Zitat“ ließe sich die Poetik Erbs – und dies unabhängig von der Entstehungszeit ihrer Texte – mit „Leben im Kommentar“ auf eine prägnante Formel bringen. Sie selbst hat im August 1978 einen kurzen Prosatext über die Kunst verfasst, einer Kafka’schen Parabel gleich. Er handelt von der Bedeutung der Verschiebung um eine winzige Differenz als Bedingung der Möglichkeit für die – dem Laien nicht zugängliche – Kunst und führt gelebtes Schreiben und geschriebenes Leben im „Kommentar“ zusammen.
KOMMENTAR
Das Madrigal, das Claudio Monteverdi auf den Tod einer jungen
Sängerin schrieb, die in seinem Hause lebte, von großer Anmut
war und eine überirdisch schöne Stimme besaß, unterscheidet
sich für das Ohr des Laien in nichts von anderen Madrigalen…43
Gabriele Wix, in Text+Kritik, Heft 214 Elke Erb, edition text + kritik, April 2017
Es gibt nichts Schlimmeres, als recht zu haben
– Gespräch mit den DDR-Schriftstellerinnen Elke Erb und Rainer Schedlinski.
Im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg versammelte sich Mitte der siebziger Jahre eine alternative Kulturszene, die sich staatlicher Vereinnahmung konsequent verweigerte. „Nicht für oder gegen den Staat, sondern außerhalb des Staates“, situierten sie ihre literarische Produktion. Patrik Landolf und Christine Tresch, RedakteurInnen der Züricher Wochenzeitung, befragten die SchriftstellerInnen Elke Erb und Rainer Schedlinski über ihr Leben am Prenzlauer Berg, ihr literarisches Selbstverständnis und ihre Zukunftsperspektiven in der sich verändernden DDR. –
Patrik Landolf und Christine Tresch: Ihr lebt und arbeitet beide im Ostberliner Quartier Prenzlauer Berg. Dort hat sich seit Mitte der siebziger Jahre eine Literaturszene etabliert, die sich der Vereinnahmung durch die DDR-Kulturideologie entzog, vorhandene Erwartungen verweigerte, in ihren Texten radikale Demontage der herrschenden Sprache betrieb. Was bedeutet dieser Ort für euer Selbstverständnis?
Rainer Schedlinski: Es war eine Möglichkeit, bequem zu leben. Der Prenzlauer Berg ist eine Gegend, wo die Wohnungsverwaltung keinen Überblick über die Häuser hatte. Wenn man aus der Provinz kam, hat man sich zuerst am Prenzlauer Berg eine Wohnung gesucht, ist eingezogen, und das hat niemanden interessiert. Alle, die man kannte, wohnten um die Ecke. Die meisten kamen ja aus Dresden, Halle, Magdeburg und Leipzig. Mit der ersten Ausreisewelle 1984 ist nur noch ein Drittel übriggebliebn von den Altvorderen.
Landolf / Tresch: Ergab sich neben der Möglichkeit, dort billiger zu leben, auch schnell ein kultureller Zusammenhang?
Schedlinski: Ja, aber es entstand nicht nur eine Boheme, das wäre ein Mißverständnis, sondern eine soziale Gruppe. Künstler, Alkoholiker, Mädels, die haben genäht. Damit konnte man sehr viel Geld verdienen in der DDR. Die haben Hemden, Jacken, Hosen hergestellt, sind einmal im Jahr für eine Woche oder vierzehn Tage an die Ostsee gefahren, haben ihr Ware dort verkauft und leicht 50.000 Mark eingenommen. Davon haben dann zehn, fünfzehn andere mitgelebt. Das war eine ziemlich bequeme Art, ohne daß man sich Gedanken machen mußte, über die Runden zu kommen. Und das war eben am Prenzlauer Berg möglich, weil der soziale Druck und die Kontrolle nicht sei groß waren, weil man dieses Leben einfach nicht kontrollieren konnte.
Landolf / Tresch: Wie unterschied sich die Sozialistion dieser jungen Generation von der Aufbaugeneration?
Schedlinski: Es gibt einen sehr großen Unterschied: Als ich bei meinen ersten Westreisen die Linken kennenlernte, habe ich festgestellt, daß die nicht eigentlich rauskommen, die können nicht aussteigen in dieser Gesellschaft, weil das Geld immer wieder integrierend wirkt. Wenn man im Osten ausgestiegen war, war man draußen. Ohne Adresse, ohne Steuern, ohne Telefon und alles. Leben konnte man doch.
Landolf / Tresch: War dieser Freiraum immer schon da?
Elke Erb: Nein, das hat sich so entwickelt. Wir hatten uns früher auch offizieller aufgefaßt. Ich habe mein Studium unterbrochen. Das war damals eine ziemlich große Sache. Später wurden diese Abläufe schon in der Oberschule gebrochen. Dieser Freiraum hat sich elementar entwickelt mit dem Staat, weil auch die Autorität, die der Staat vertrat, schwand, die Parolen nicht mehr galten.
Landolf / Tresch: Das war also der Unterschied von der Aufbaugeneration zur schon in einen gewissen Wohlstand hineingeborenen?
Erb: Des realen Sozialismus. Wohlstand würde ich das nicht nennen. Nur eine Abwesenheit von Not. Keine Bettler.
Schedlinski: Es war nie ein Problem, in der DDR Geld zu machen, bloß man konnte damit nichts anfangen. Wenn man viel Geld hatte, mußte man kriminell werden, es gab ja keine Möglichkeit, es auszugeben.
Landolf / Tresch: Führte diese ökonomische Freiheit automatisch zur Selbständigkeit literarischen Arbeitens?
Erb: Ihr sagt sofort Vereinnahmung, wir sagen sofort Selbständigkeit. Diese Fragen kommen immer von außen, und du empfindest sie als ungerecht, weil sie dem eigentlichen Produkt, um das es geht, nicht gerecht werden können.
Schedlinski: Es war keine Konzeption für diese literarische Produktion vorhanden, sie ist aus einem Selbstverständnis heraus entstanden, auf andere Art zu musizieren, zu malen, zu schreiben. Das ist natürlich eine Reaktion, aber eine affirmative. Wie Anderson immer sagt: Nicht für oder gegen den Staat, sondern außerhalb des Staates.
Landolf / Tresch: Aber eure theoretischen Texte und die Anthologien, die es über die Literaturszene am Prenzlauer Berg gibt, zeigen doch, wie hoch das Reflexionsniveau auch der politischen Situation war. Ihr könnt nicht sagen, daß ihr euch dazu keine Gedanken gemacht habt!
Erb: Ja, gewiß. Es war überhaupt so, daß der Staat in eine Nicht-Funktion geraten war. Ich gehöre doch einer anderen Generation an. Wenn ich etwas nicht verstand, kamen immer sehr viele theoretische Erklärungen der Jungen. Das hätten wir damals nicht gemacht. Dies bedeutet wirklich eine komplexe Ablösung des bestehenden Apparates – weil der nicht mehr leistungsfähig war – und war insofern keine egozentrische oder private Ablösung, sondern einfach eine Funktionsablösung. Die politische Interpretation war dabei, aber sie lautete anders. Sie suchte nach Ursachen und setzte infolgedessen anders an. Für mich kam zum Beispiel aus der Szene ein sehr guter Begriff über Manipulation. Darüber hatte ich nie nachgedacht: Daß, wer sich mit dem Staat einläßt, von ihm manipuliert wird. Vorher, seit Mitte der sechziger Jahre, hatte ich nur einen Satz zur Verfügung, den ein alter Kommunist, bei dem ich zu Hause war, während ein Fußballspiel lief, äußerte. Er sagte: „Der Gegner bestimmt das Spiel.“ Ich verstand mich eigentlich als Opposition, habe weiter geschrieben, aber immer wieder kam dieser Satz als dumpfe Mahnung hoch. Erst durch diese junge Generation bekam ich Klarheit über die Art der Manipulation.
Landolf / Tresch: Warum wurde am Prenzlauer Berg vorwiegend Lyrik produziert?
Schedlinski: Weil der große zentrale Roman von vielen Voraussetzungen ausgeht, die nicht mehr gegeben waren. Es genügte einfach nicht mehr ein inhaltliches Auseinandersetzen mit den Argumenten, sondern wir befaßten uns mit der Sprache selbst.
Die Lyrik ist einfach eine bewußtere Sprachform. Da erinnere ich mich sehr gern an Bert Papenfuß, der, als er endlich anerkannt war, in der Akademie der Künste einmal lesen durfte. Auf die Frage, wie er eigentlich zum Schreiben gekommen sei, antwortete er: „Wir sind immer mit der Straßenbahn zur Schule gefahren und haben die Zeitung gelesen. Schon bei den Überschriften mußten wir immer lachen.“ Erst wenn man einmal die Absurdität dieser Sprache – und die war ja im Osten viel krasser als in der Bundesrepublik – erkannt hat, kann man sie verarbeiten.
Erb: Wir sind ausgestiegen und mußten prinzipiell neu anfangen. Lyrik hat, jedenfalls unsere, immer Theoretisches gehabt, so als ob du Gleichungen im Verhalten machst. Wenn du einen Roman schreiben willst, mußt du eine große Vorstellung haben; mit dem Überlieferten, mit dem Verständnis etwas Neues anfangen können. Für uns zählte das Überlieferte nicht mehr.
Eigentlich ist es beachtlich, daß der Staat an diese Grenzen, an diesen Bankrott hingewirtschaftet hat.
Schedlinski: Vor allem ist der zentrale Roman eine statische Form. Man muß dazu auch ein statisches Leben führen, man muß eingerichtet, saturiert sein. Und man muß von diesem archimedischen Punkt, vom Endpunkt der Geschichte aus betrachten können, weil ja am Ende das und das rauskommen muß. Wie Tschechow sagte: „Wenn in der ersten Szene ein Gewehr an der Wand hängt, muß das in der letzten Szene auch schießen.“
Landolf / Tresch: Ihr verweigert euch beide in euren Texten der Linearität der Sprache, dem herrschenden Diskurs. Was setzt ihr dem entgegen?
Erb: Ich komme ja aus dem tradierten Denken. Für mich gelten alle verfolgbaren Praktiken als Voraussetzung. Lyrik geht für mich von einer Art Lichtpunkt aus. Das, was linear denkbar ist, verschwindet als Voraussetzung. Die Lyrik ist erkundend, sie muß neu ergründen. Wir haben die Diktion geändert, die andern haben ja die Diktion gar nicht geändert. Die Logik ist nicht nur das Beherrschende, und du bist nicht einfach Teilhaber eines Systems, sondern du bist der Mensch, der die Möglichkeit hat, logische Abläufe als Mittel anzusehen und sich ihnen nicht unterzuordnen.
Der Sinn ist überhaupt eine untergeordnete Kategorie und die Linearität eines Textes ein Irrtum. Die Rede läuft in der Zeit ab, und das, was du schreibst, ahmt die Rede nach. Doch das ist gar nicht nötig, du kannst doch auf dem Blatt verteilen. Die Linearität bewirkt, daß ein ungeheurer Schaden angerichtet wird an der Fähigkeit, im Zusammenhang zu denken, weil du alles auf eine Linie bringen mußt.
Schedlinski: Ich möchte prinzipiell widersprechen. Ein fortlaufender, linearer Text ist mit den Mitteln der Logik überhaupt nicht überprüfbar. Man kann einen Satz auf Logik hin überprüfen, aber nicht den Text. Der ist immer demagogisch. Der ist entweder summativ, dann kann man ihn gerade noch überprüfen. Aber um ein diskursives Gebilde in seinen Operationen und Abläufen zu überprüfen, dazu sind die semantischen und logischen Werkzeuge zu klein. Das ist einfach keine Erklärung für einen Text. Der entzieht sich seinem eigenen Wahrheitsanspruch, indem er die Größen der klassischen Logik einfach überschreitet. Deshalb halte ich Gedichte für viel logischer, weil sie in dieser Sequenz überprüfbar sind.
Landolf / Tresch: Du siehst deine Gedichte als logischen Satz, als philosophisches Konstrukt?
Schedlinski: Ja, natürlich liegt ihnen nicht immer die semantische Bedeutung zugrunde, sondern manchmal die etymologische, seltener die phonetische.
Erb: Im Unterschied zu Rainer ist für mich etwas, was man erzählt, gleichbedeutend mit einer theoretischen Formulierung. Ich denke, daß sogar die Wissenschaft dazu übergehen muß, sich nicht mehr so linear auszudrücken, wie sie dies bis jetzt tut. Mir sind alle Mittel recht: Abstrakte Abfolge von Begriffen, dann kommt etwas wie Lyrik Aussehendes. Bis jetzt habe ich aber keine richtig epische Geschichte geschrieben.
Landolf / Tresch: Ihr habt mit verschiedenen Traditionen gebrochen. Gibt es trotzdem Anknüpfungspunkte, literarische Traditionen, in denen ihr euch seht!
Schedlinski: Die DDR-Literatur war immer zwiespältig. Natürlich gab es immer die, bei denen man noch ganz persönlich angeknüpft hat. Franz Fühmann zum Beispiel, Erich Ahrendt, Adolf Endler, Elke Erb sind genauso Anknüpfungspunkte für unsere Generation. Dadurch stellte sich auch eine gewisse Kontinuität her. Die hat es immer gegeben. Die beiden Spitzen dieser Traditionsschere sind eben desto weiter auseinandergegangen, je länger die Geschichte der DDR dauerte.
Landolf / Tresch: Welches sind die beiden Spitzen!
Schedlinski: Die ideologisierte Literatur und die Literatur, die sich davon hat freimachen können.
Erb: Was noch zur Linie gehört, ist der Fortschrittsglaube. Was heißt brechen? Mir scheint, daß da einfach so weggewelkt ist, daß da gar nichts zu brechen war. Vor allem in der schulischen Erziehung, in der Denkerziehung, in die du ja als armes unschuldiges Wesen nichtsahnend hineingerätst, in die Fänge der hierarchischen Begriffsbildung: Oberbegriff-Unterbegriff-Unterbegriff. Da hast du schon Kämpfe zu bestehen, um das zu durchbrechen. Ich hatte wirklich ziemlich schwierige Jahre, das zu durchstoßen. Dieser Prozeß hat nichts mit Ästhetizismus zu tun. Man kann keinen Ästhetizismus machen und erleidet dabei lauter Schiffbrüche und Suizidanfälle, gerät aus den Fugen und tobt.
Landolf / Tresch: Ihr habt die Machtstrukturen in der DDR durchschaut. Welche Möglichkeiten gab es, diese zu unterlaufen!
Erb: Wir haben die Macht beobachtet, wußten, wenn die Stasi uns einmal packen würde, wir ihnen nicht antworten dürfen. Das ist eine Intelligenz über Vollzüge der Macht. Wenn du antwortest, bist du ihnen ausgeliefert, dann bist du ins System eingestiegen.
Schedlinski: Es war ja auch ein Spiel. Mal einen Bullen provozieren, mitgenommen, richtig verhört werden. Eine Emanzipationsgeste, die aber eigentlich nur darauf hinauslief, diese Macht zu ignorieren, damit leben zu können. Weil es eine würdigere Form des Umgangs auf eine andere Art nicht gab.
Es gibt ja auch noch diese produktive Ignoranz. Detlef Opitz hat aus diesen Polizeigeschichten Literatur gemacht. Der hat sich ständig in Situationen am Rande der Legalität gebracht, weil er aus den ganzen Absurditäten, aus den Prozessen, aus den Auflagen, die er bekam, Literatur produzierte.
Landolf / Tresch: Diese Spiele klappen aber nur, wenn das Ende des totalitären Systems sich bereits ankündigt.
Schedlinski: Klar, die DDR war ja nie vergleichbar mit Rumänien. Das war eine ganz andere Situation.
Erb: Ich habe keinerlei Spiele mit der Macht betrieben. Ich konnte mit denen nicht anbandeln, weil mein Text und deren Text je andere waren. Ich kann nicht einen Polen ungarisch ansprechen, wenn ich weiß, der versteht das nicht.
Schedlinski: Da läßt sich nur schwer sagen, was gesünder ist: du oder deine Generation, die sich noch lauter gegenüber den Worten verhalten hat, oder diese zynische, ungläubige Variante meiner Generation, der wir wirklich nichts mehr geglaubt haben. Wir wußten aber trotzdem, daß man so bestimmte rhetorische Pflichten erfüllen muß, und sind durch diese Situation erst auf das Spiel mit der Macht gekommen. Darauf nämlich, daß man Sprache imitieren kann.
Landolf / Tresch: Dieses Spiel mit der Sprache, diese Subversivität gegenüber der herrschenden Sprache kann sehr schnell vereinnahmt werden. Bei euch ist diese sprachkritische Kreativität an den Demos vom Oktober und November aufgetaucht auf Spruchbändern und Plakaten. Wie geht ihr damit um, wenn ihr seht, daß auch diese produktiven Sprachspielereien unterlaufen werden von Machtinteressen!
Erb: Zuerst protestiere ich gegen den Begriff „subversiv“, weil „subversiv“ das andere als oben anerkennt. Ich muß wissen, wo die Interessen stecken, wo die dynamischen Kräfte herkommen. Aber das ist etwas ganz anderes. Ich verdächtige jede Parteiung der Art „links“-„rechts“ als ein Bett, in dem man sich ausruhen kann. Als eine quietistische Angelegenheit. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als recht zu haben. Und noch dazu mit aller Erfahrung des deutschen Recht-Habens, die gar keine Realität hat, in die sie sich einspeisen kann. Das ist eine alte Geschichte. Meine Eltern waren Kommunisten. Sie hatten immer recht, und die anderen haben es falsch gemacht. Das hat mich sehr gut gelehrt, wie man recht haben kann und trotzdem nichts bewirkt. Und wenn es nicht greift, meine ich, begreift es auch nicht. In der DDR hat man sich ganz leicht immer auf das Ganze beziehen können. Es gab ein Bannhorn, und das hieß „Staat“. Was mache ich jetzt mit einer pluralistischen Gesellschaft? Ich denke, ich werde mir ein Tagebuch anschaffen. Ich halte es für sehr wichtig, daß ein Ganzheitsdenken übertragen wird. Und wenn ich jetzt damit nicht zu Rande komme – ich kenne doch eure Gesellschaft nicht –, daß ich wenigstens die Stationen des Scheiterns protokolliere. Ist das ein Aufklärungsdenken. Was?
Landolf / Tresch: Es wird bald nicht mehr möglich sein, in der DDR mit dem wenigen Geld auszukommen, das bis anhin zum Leben reichte. Welche Konsequenzen haben die ökonomischen Veränderungen für eine Literaturproduktion!
Erb: Man stellt sich wirklich auf eine Front ein, geht in Angriffsstellung. Ich kam zurück aus dem Urlaub, und dann begann diese Revolution. Da dachte ich, so, jetzt kommen sie an, und jetzt soll ich mir Gedanken machen über die Wirtschaft. Jetzt, wo ich zweiundfünfzig bin.
Schedlinski: Für mich ist das kein Problem. Ich kann mit der ökonomischen Situation leben, das habe ich gelernt, und zwar, glaube ich, noch besser als manche bundesdeutschen Autoren. Ein Vorteil, den diese Wahlen mit sich gebracht haben ist, daß man offen sagen kann, daß dieser linksintellektuelle Anspruch, für das Volk zu sprechen, einfach nicht stimmt. Das Volk hat nicht links gewählt, und man soll sich endlich von diesem Anspruch trennen. Ich bin in dieser Nation großgeworden mit einem negativen Selbstwertgefühl. Mit dem Gefühl nämlich, daß man nur ein anständiger Mensch sein kann, wenn man kein richtiger Deutscher ist, und daß es dazu gehört, gegen deutsche Tugenden zu verstoßen, um moralisch integer zu sein.
Volkszeitung, 18.5.1990
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.
Keine Antworten : Elke Erb: Kastanienallee”
Trackbacks/Pingbacks
- montage nr. 663 | werkmaschine - […] wörter, wortteile und buchstaben herausgeklaubt aus: elke erb, landschaft in w. […]




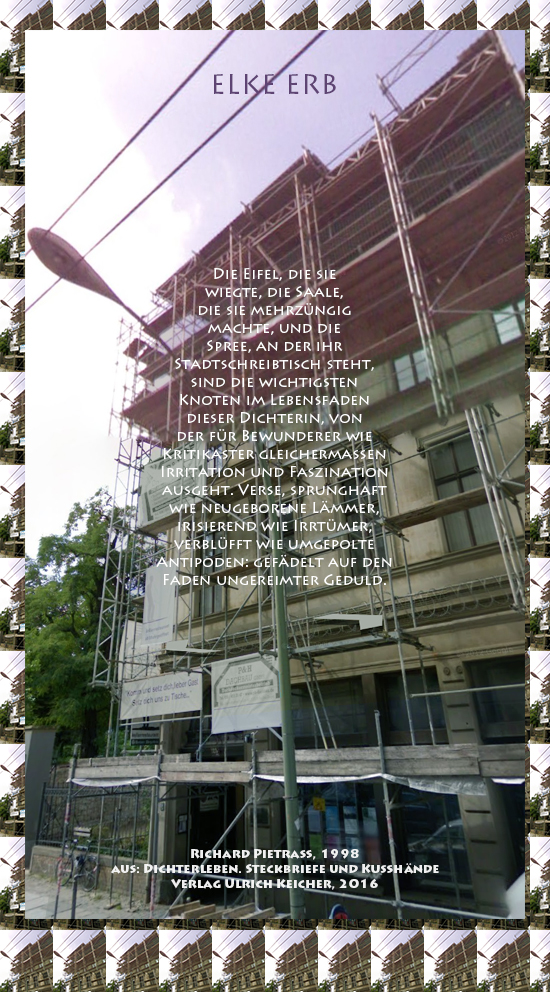












Schreibe einen Kommentar