Elke Erb: Sachverstand
FREILICH KÖNNEN LANGSAME AUCH
schnell sein, Schwung nehmen,
tun ja nichts anderes all die Zeit, als
ihre Karrenochsenfasern auf!!
zu wiegeln
und wenn dann der feste Körper des Denkens
& Fühlens, der gedrungene ihrer
langsam gewonnenen Ansicht
ihnen hochfliegt, das nenne ich aberschnell,
schnellend schnell, hellauf schnell,
an Schwirrkraft
fehlt nichts, und Sorgfalt ist gar
kein Wort für ihr vorher
unerbittliches Vor-
bereiten, Anwachsenlassen, bis
die Nötigung reift
also Betrachen, also Genügen den
stehenden Umständen – also deren
getreues Abbild, und
keinen Widerspruch duldend
(weil nicht einmal einen erwartend)
das Tempo der Langsamen ist,
in syntaktischem Doppelsinn, nämlich so oder so,
freilich niemals so schnell wie die Schnellen,
die gleichsam ja kaum
daß sie und – schwupp! – schon wieder
verschwunden sind und während noch –
– x-mal schon wieder – geschwind, in derart winzigen
Intervallen Winzigsteln flügelig wie schon
Luftteilchen nur noch, – auch
imposant das!
Elke Erb versammelt in ihrem neuen Buch Gedichte
und einige kurze Prosatexte aus den Jahren 1996 bis 1999. Für ihre Texte gilt immer noch, was Erich Fried einst (anläßlich des Erscheinens des Auswahlbandes „Tost“) über sie schrieb: „Ob die Prosa Prosa ist, ob die Gedichte Gedichte sind, bleibt oft fraglich. Das ist aber hier höchstens von Vorteil. Keiner dieser Texte, der auch nur vielleicht überflüßig wäre, keiner, der um eine Silbe zu lang ist. Und keiner, der literarisch oder literatenhaft anmutet. Dichten soll ja keine literarische Angelegenheit sein, soll aber gleichzeitig nicht unter das Niveau dessen fallen, was in ähnlichen Formen oder in der Auseinandersetzung mit ähnlichen Themen schon geleistet wurde. Alle diese Bedingungen erfüllt dieser kleine Band so sehr, daß er wahrscheinlich für viele Leser so unvergeßlich sein wird, wie für mich. Er hebt die Trennung zwischen Dichtung und Wahrheit ganz und gar auf, läßt dem Leser daher keine Rückzugswege.“
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 2000
Die Partitur der Dinge oder Wenn die Birne zur Geige wird
− Der etwas andere Sachverstand: Neue Gedichte und Notate von Elke Erb. −
Ein noch in der DDR, 1983 im Aufbau-Verlag erschienener Band Elke Erbs trug den Titel „Vexierbild“. Dieses Wort ist nicht nur Überschrift für Gedicht und Band, sondern beschreibt auch im Ungefähren die poetische Sprache der Dichterin. Vexierbilder sind Rätselbilder, sie irritieren damit, dass die Hauptfigur unter den Strukturen des zuerst wahrgenommenen Bildes versteckt liegt. Das Eigentliche schwebt verborgen, es muss entdeckt werden, aufgehoben mit den Augen. Zu den verborgenen Figuren in den Vexierbildern gelangt man am besten, wenn man sich das Gesuchte in Gedanken nicht bereits fertig und kompakt vor Augen führt, sondern sich dem Liniennetz des angebotenen Bildes überlässt, es mit den Augen abfährt, bis die Figur in den Sucher einkehrt, ihn entdeckt.
Elke Erbs Texten nähert man sich als Leser ähnlich. „Ich dechiffriere das anscheinend Einfache“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. „Immer wieder wird der Text solche Hintergrundarbeit, wie wir sie unbewusst leisten, aufdecken. Sie bleibt unterbewusst, weil sie von den Unbilden eines normativen Vordergrunds verdeckt wird. Wir leisten sie und haben, ohne von ihr zu wissen, das Gefühl zu versagen.“ Man muss einen poetischen Sachverstand zulassen. „Sachverstand“ heisst auch ihr neuer Gedicht- und Notateband, erschienen ist er bei Urs Engeler Editor. Diese Art von offenem Verstand ist kein angestrengter, künstlicher, schwer erlernbarer. Viel eher resultiert er aus einer Art ausgehaltenem Alltag und Dasein, er erscheint so gut wie von selbst, wenn man ausdauernd, lange und stumpf mit den Sachen zu tun habe, das bringe den Sachverstand, „das gewusst wie bringt ihn nicht… lange und stumpf – ein Einsehen, Eingesehenes kehrt ein in dich“.
Man solle vertrauen, denn die Geist-Materie sei bereits von Natur aus erstaunlich leistungsfähig. Aus dem Ertragenen wird so im Handumdrehen ein ertragreiches Einsehen. Schaut man in die Dinge hinein, fällt die poetische Ernte, fallen die Wortfrüchte auf den Tisch, platzen die rauen, abweisenden Schalen. Denn man hat, ein klein wenig nur, seine gewohnte Perspektive geändert und am Baum gerüttelt.
Das ihren Gedichten zugrunde liegende „Denkwegenetz“ lässt sich in diesem Buch ziemlich genau nachzeichnen. Der Band in seiner Verzweigtheit „thematisiert es als vorgefundenen Alltag, der siehe, Knospen ansetzt gewächshaft, virulent unablöslich“. Dichten bedeutet also zunächst nichts weiter als die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um gegenwärtig zu sein, geistesgegenwärtig. Aufnahmebereit für das Poetische, das vor den Dingen kauert, ihr Erscheinen vorbereitet. Das Gedicht „Mitteilen“ beschreibt sehr schön, wie dieses Poetische, Federleichte sich nähert und nährt: „Schneide ich etwa Feenfleisch aus / und lege es auf die Teller? // Und wird es von Feenfüchsen / im hindernislosen Mondlicht // (die auf Stühle springen / am runden Tisch, bei Messer und Gabel / aufs weisse Tischtuch die vorderen / Füsse aufstützen) // beschnuppert, bevor meinesgleichen daran kaut?“
Sonntagskuchen, summend
Hierzu spielen Geigen die Tischmusik. Sie schälen sich in einem Vers leicht und luftig aus der Form einer im Backofen trocknenden Birnenhälfte heraus. Die sanften Rundungen der trocknenden Frucht haben eine „Zwangsvorstellung“ in der Dichterin ausgelöst, in deren Folge sich ein Schema, ein Regelwerk offenbart, „ein Zügel im Gang der Dinge“, das sich wie ein duftender Sonntagskuchen aus dem Ofen herausziehen und aufschneiden lässt. Das Begreifen und Sehen passiert in einem Fest, vitalisierende Spannung dreht und steigert alles, bis die Schwingungen der Dinge zu summen beginnen, die Birne zur Geige, zum poetischen Instrument wird, „sie mustert ja violinengleich die Birnenhälfte mit ihren kleinen Hintern, Sage der Violinensaiten von Gris, von Braque.“ So gesehen ist Poesie auch eine Art von verstandener, wahrgenommener Partitur der Dinge, die in den Worten zu spielen, mit den Versen auszuspielen ist, die die tonlosen und unsichtbaren Schwingungen der Dinge verstärkt und dadurch erst hör- und aufnehmbar macht.
Aus dieser Perspektive lässt sich auch besser verstehen, warum Elke Erb in diesem Band davon spricht, dass die Kommunikation eigentlich noch nicht erfunden worden ist. Sie meint damit nicht die simple Form des Sprechens, die Verständigung als Warenaustausch von Worten praktiziert, sondern eine Kommunikation, die aus einer gewissen Sehnsucht heraus jemanden, wie sie schreibt, in weiterführenden Adern fliessend zu erquicken vermag. Die zu einer körpereigenen Reaktion wird, belebend, blutbildend, und aus einem Keim heraus organisch in ein ganzes Geflecht und Netzwerk wächst. Diese Verständigung spricht über die blosse Materialität von Worten heraus und klingt, zittert, vibriert, atmet. Das Wort Anwandlung taucht in diesem Zusammenhang in ihren Gedichten auf. Anwandlungen werden von irgendeiner beiläufigen Wahrnehmung ausgelöst, kommen plötzlich aus dem Ungefähren hervor und rücken in die Nähe der Aufmerksamkeit, sie wandeln sich der Person an, sie umwinden, umgarnen, umstricken sie regelrecht mit ihren Aufforderungen zu sehen.
Aufscheuchendes, ungemerkt
Elke Erb stellt auf poetische Art genaue Fragen nach einer ursprünglichen, elementaren Form von Kommunikation, denen man beim Lesen nicht ausweichen kann. Ihre Gedichte stellen in Frage, in das Licht und die Helligkeit einer fragenden Anteilnahme. Alles und jedes ist tauglich, untersucht zu werden, nichts ist so gering, dass es nicht in einem Gedicht sprechen, sich offenbaren könnte. „Es sei nichts Arges der Grund meiner Anrede. – Bin ich selbst die Gefahr? Oder warne ich? Wenn ich warne, bin ich verlässlich? – Dieser feine Spalt, Riss (wie er sonst auch genügen kann, tödlich zu sein) im Anfang des Aufscheuchenden (Aufscheuchen, Scheu, Scheuen – Stocken) – freilich merken wir ihn, glaub nicht, wir merken ihn nicht.“
Die mikrokosmische Detailarbeit, diese Präzision eines Uhrmachers am Rad der Zeit ist es, welche die Faszination ihrer Poesie ausmacht. „Was ich schreibe, lebe ich.“ In der Philosophie gibt es den Begriff des Fastnichts, des Presque rien. Ein Ausdruck, der im Barock aufkam und eigentlich das Unbegriffliche benennt, das, was man bemerken, aber nicht recht begreifen kann. Und der im Grunde genommen (fast) nichts als ein Synonym für das Schöpferische ist. Es bezeichnet jene Differenz, die das Poetische vom Alltäglichen unterscheidet, eine winzige Verschiebung nur, kaum wahrnehmbar, aber dennoch mit ungeheuren Folgen für das, was daraus entsteht und zurückwirkt.
Das Fastnichts liegt auf der Hand, aber auch der Poet muss es gleich dem Leser wie in einem Vexierbild erst entdecken, herausschälen, wie die Geige aus der Frucht halt. Diesen Vorgang macht Elke Erb nachvollziehbar, es hat etwas Ansteckendes, Virulentes für den Leser ihrer Gedichte, „wenn dann der feste Körper des Denkens… hochfliegt“, wenn ihre Verse sich in die Dinge hinein schreibtastend vorwärtsbewegen. Wenn sie sich nach allen Richtungen hinweg drehen und dehnen und bis in die Erinnerungen hineinrollen. Die aus dem Vergangenen erneut herphantasierten Anlagen, schreibt sie, nutze sie als mobilisierende Denkbilder.
Denkgebilde, sprachverrückt
Nun sind Erinnerungen, diese aus der Zeit gefallenen Existenzen trügerisch, weil sie flüchtig, vage sind. Hier hilft die sprachliche Imagination, welche die Bilder einholt, zurückholt, bis sie wieder pulsieren, „ich räume die einstige Gegend wieder hin, / als seien die noch vorhandenen Formen (Feld, Wiese, / Gebäude) im vollen Sinn ihres Anfangs geblieben“. Jeden Winkelzug dieser ihrer Arbeit lässt sie den Leser nachvollziehen, indem sie sämtliche untergründigen Bewegungen, die zu den Gedichten hinführen, detailliert beschreibt. Manchmal ähneln ihre Gedichte deshalb mehr komplexen poetischen Denkgebilden, eben Denkwegenetzen. Ihre ganz einfache Methode ist die der Sprachverrückung ins Gehirnuniversum, ein Welttransport, deren Differenz oder Wege- und Masseinheit jenes zunächst unscheinbare Presque rien ist, die schliesslich als Gedicht nachweis- und ermessbar dasteht.
Ich-Teil, flammend grün
Die Welt wird in diesem fortwährenden Prozess anverwandelt, einverleibt, und dafür bietet sie unerschöpfliche Nahrung in einer unendlichen Speisenfolge. Und indem die Dichterin spricht, sich äussert, veräussert, wird sie selbst ebenso ein Teil des Ganzen, in dieser wechselseitig anziehenden Annäherung schmelzen die Abstände, Fremdheiten, Begrifflosigkeiten am Ende dieses heissen Prozesses auf ein Minimum ein. „Das – von Kraut, Busch, Baum! – umschlossene ist mein Teil, mein Ich-Teil, ist flammend grün, denn ich spreche von ihm, das ich ermesse in mir.“ Die Distanzen sind bis auf jene winzige Verschiedenheit aufgehoben. Elke Erb spricht auch von einem Spiegelbild, das Draussen ähnelt ihrem Ich-Teil bis aufs Haar, „denn solange es – während des Ansehens – in mich fährt, ist es dasselbe… eine hohe Leistung… von einigem Charme“. Und das sind ihre Gedichte in der Tat.
Postscriptum: In einem Poem für Friederike Mayröcker schrieb Elke Erb einmal einige Zeilen, die man beim Lesen ihres jüngsten Bandes ebenso der Autorin zurückgeben kann: „Ich muss nicht … sollen, wenn ich ihr zuhöre, sie lese / trotz aller vielstufig geforderten Aufmerksamkeit- / ich muss nicht: konzedieren, zugutehalten- // Also sind ihre Orte wohl frei zugänglich. / Aufgrund welchen Wunders?“
Cornelia Jentzsch, Basler Zeitung, 12.1.2001
Diese kleine Borsigstraße da unten
− Neue Texte von Elke Erb. −
Der Titel des Buches führt absichtsvoll in die Irre; denn was ist das für ein Sachverstand, der die Frage aufwirft: „Schneide ich etwa Feenfleisch aus / und lege es auf die Teller?“, der bemerkt, „daß der Steiß, / während ich im Bett sitze und lese (…) Wurzeln zu schlagen trachtet“? Die Rechtschreibkontrolle meines Schreibprogramms moniert das „Feenfleisch“, schlägt als Alternative Feten- oder Femenfleisch vor; auch nicht schlecht. Es handelt sich also um „Poesie“. Der Literaturkritiker und Essayist Franz Schuh bekennt in seinem Buch Schreibkräfte: „Die Sehnsucht nach dem Nicht-Begrifflichen, die als das Poetische ausgestellt wird, teile ich nicht.“ Diese Art von Sehnsucht hat etwas Regressives, ist ein Plädoyer für den „Bauch“. Elke Erb wird eine solche Sehnsucht nach dem Poetischen gar nicht kennen; sie ist denkend und schreibend immer schon verstrickt in eine poetisch-anarchische Weltsicht. Sie treibt ihr Spiel aber so hemmungslos weit, bis in subjektivistische, gar privatsprachliche Gefilde, dass keine Gemütlichkeit aufkommen kann in dieser Poesie, dass alles beherrscht wird von einer großen Offenheit, auch Unberechenbarkeit.
Mit Sachverstand legt Elke Erb nach Mensch sein, nicht nun ihr zweites Buch bei Urs Engeler in Basel vor, Gedichte und kurze Prosastücke aus den Jahren 1996 – 99. Keiner der Texte umfasst mehr als sechs Seiten, die Grenze zwischen Lyrik und Prosa verschwimmt. Trug Mensch sein, nicht den Untertitel „Gedichte und andere Tagebuchnotizen“, so ist das tagebuchartig-skizzenhafte auch ein Kennzeichen des neuen Buches von Elke Erb. Alle Texte sind datiert, nehmen ihren Ausgang meist von einem punktuellen Ereignis, einem Gedankensplitter, sehr oft von einem visuellen Eindruck; nicht umsonst ist ein Text „Trinkt, oh Augen, was die Wimper hält“ überschrieben. „Ich höre nicht auf mich zu wundern“, schreibt Elke Erb. Da geht es z. B. um ein „Bild, hervorgerufen vom Anblick im Gras klumpenden Schnees“, da wird das Tragen eines Eimers über den Hof zu einer befremdlichen Szenerie verdichtet: „und im Rücken geistert irgendein Kuhstall“, der „Hilferuf“ eines aus dem Nest gestürzten Vogels wird zur Chiffre für Katastrophen, weckt den „Hilfstrieb / in einem lesenden und schreibenden Menschen“. Häufig evozieren diese Naturbilder Erinnerungen an die Kindheit in der Eifel, wo die heute in Berlin lebende Elke Erb 1938 geboren wurde. „Er hat auf Blechbüchsen / geschossen im Urlaub. Warum?“, lesen wir etwa im Gedicht „Weihnachtsurlaub“: „Er hat uns drei kleinen Töchtern gezeigt, / wie das Gewehr funktioniert.“ Mit wenigen Strichen, einer Skizze, in der von „Pfählen“, „Maschendraht“ und „Waldhorizont“ die Rede ist, wird ein weiter Assoziationsraum geöffnet.
Elke Erb verschreibt sich voll und ganz dem anarchischen Spiel der Assoziationen, nie sind die Bahnen ihrer Texte formal oder inhaltlich vorhersehbar. „Diese kleine Borsigstraße da unten“ evoziert beispielsweise das Bild von „düsterer Stickluft“, von einem Arbeiter, der „etwas Schweres“ rollt. In Wirklichkeit freilich ist die Luft dort frisch, „ein Blütenduft tanzte an“; dennoch: „Auf meinen Beinen aber zugleich schritt ein Arbeiter, als die Schlote der Industrialisierung rauchten (…)“. Man kommt aus dem Zitieren nicht mehr heraus, will man einen Eindruck dieser Texte vermitteln, die in ihrem radikalen Subjektivismus etwas Inkommensurables haben. Wie sagte Elke Erb einmal in der literaturWERKstatt, nachdem sie ein Gedicht vorgelesen hatte? „Das müssen Sie jetzt so hinnehmen.“
Florian Neuner, scheinschlag, Nr. 1/2001
Elke Erb: Sachverstand
Sachverstand heißt die neue Sammlung von Gedichten und Kurzprosa der in der Eifel geborenen, seit ihrem elften Jahr in der DDR aufgewachsenen und seit langem in Berlin lebenden Dichterin Elke Erb. Die Texte sind nach ihrer Entstehung geordnet, reihen Prosa (Blocksatz) und Gedicht (Flattersatz) in bunter Folge und umspannen einen Zeitraum von genau drei Jahren, vom 20. August 1996 bis zum 23. August 1999. Sie folgen damit chronologisch auf die Texte des Bandes „Mensch sein, nicht“, der 1998 im selben Verlag erschienen ist. Aus der genauen Datierung lässt sich mindestens zweierlei ablesen. Zum einen fällt auf, dass rund die Hälfte dieser Arbeiten in den Sommermonaten Juli und August entstanden ist. Zum zweiten bemerkt man, dass beinah alle Texte das Datum nur eines einzigen Tages tragen. Beide Beobachtungen können Aufschluss geben über die Arbeitsweise der Autorin und somit helfen, in ihre dem ersten Anschein nach vielfach sperrigen, also versperrten Sprachgebäude einzutreten. Offenbar verfolgt Elke Erb den poetischen Einfall nicht mit dem Ziel der rundenden Ausarbeitung einer begonnenen Skizze. Sie rückt den Entwurf nicht, ihn lange betrachtend, zeitlich von seiner Entstehung ab. Stattdessen soll alles zugleich geschehen. Blüte und Frucht sind eins; Beobachtung, Erinnerung, Reflexion erkennen einander blitzartig in der Sprache, fassen sich an; ursprünglicher Gedanke und fertiges Gedicht erscheinen so in ihre größte Nähe gerückt. „schund – rasches lebendiges wort, kann noch sein: hirschkopf, am tier. kommt weit her, noch aus dem stamm / leib, kann noch sein: nase. augen / unter der stirn. kann noch sein ohne schwund nach einem wechselvaterbalgdünkel.“ Seht her, so arbeitet es in meinem, nein: in deinem, nein: in einem Kopf, scheinen Gedichte (und Prosa) ein ums andere Mal sagen zu wollen. Wollen sie das? Kann man das wissen? Liegt man, etwas zu wissen meinend, nicht von vornherein neben der Spur? „Lange und stumpf zu tun haben mit den Dingen bringt den Sachverstand – das gewusst wie bringt ihn nicht“, weiß das Titelstück des Bandes, und spricht darin wohl eine Leseanweisung aus. Offenbar sind Lesen und Schreiben hinsichtlich Zeit und Geschwindigkeit einander entgegengesetzt. Aber ist nicht diese Überlegung genau falsch? Ist das lange, stumpfe Umgehen nicht im Gegenteil die erste Bedingung des Schreibenkönnens?
Blüte und Frucht, hieß es, seien eins? Aber reichen die Wurzeln dieser Gebilde nicht viel tiefer, als wir lesend überhaupt graben können? Graben, Knollen, Mutterboden. Es ist ländliche Umgebung, die den meisten und den schönsten dieser Texte ihre Bilder gibt, sie sind gleichsam damit gedüngt; man braucht nicht zu wissen, dass die Autorin seit vielen Jahren einen ländlichen Sommersitz in der Lausitz hat, um ihren Arbeiten abzuspüren, dass in einer offenbar geeigneten Umgebung der ästhetische Kurzschluss des Entlegensten gelingt. Berückend genaue Heimsuchungen einer mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Kindheit, in der schier immer Sommer gewesen sein muss, glaubt der Leser deshalb in einigen der Texte zu entdecken, die als Anlese-Tipps besonders empfohlen seien: „Mit drei, mit dreizehn“, „Verrichtungen“, „Wolken darüber, ich weiß nur das eine“, „Begegnung mit vormals Bekannten“, „aus dem krieg“. Aber auch dieses ganz andere, unsommerliche, schöne Gedicht: „es sei wie es will // ich höre nicht auf mich zu wundern: gleite jetzt wieder die weile / ab in den schlaf und über- // lasse mich dem – dennoch bekannten – / aspektwechsel um die drei ecken / die ihre stockwerke stapeln // kleinstädtisch einem bleichen / reizlosen jenseitslicht. gleichwohl: / wundert es mich.“
Norbert Hummelt, Göttinger Sieben (www-etk-muenchen.de), Februar 2001
Abstrakte Wahrheiten
− Elke Erbs sachverständiger Gefühlsunterricht. −
Die Gedichte und Prosaminiaturen Elke Erbs sind vergleichbar mit mathematischen Gesetzen und Regularitäten. In ihrem Prosa- und Lyrikband „Sachverstand“ gibt die Autorin ihren Lesern zu Beginn eine Formel – eine eigene Definition des Wortes „Handeln“: „Handeln lies als: Ich setze hier ab, bis alles weg ist / wende mich dann nach dort (Handelsstraße), / komme wieder als der… / rege; zuwege.“ Eine Lebensreise, Weltenfahrt liegt vor jedem Leser, harte Übersetzungsarbeit und logische Rekonstruktion wird ihm abverlangt, um den Wortsinn der Zeilen und Verse herauszuarbeiten. Der Leser ist aufgefordert, wörtlich zu nehmen, bildlich zu sehen und von verkrusteten Denk- und Verstehensweisen abzulassen. Begreifen bedeutet bei Erb nicht fassbar sein, sondern abtasten, die Sache dabei drehen und wenden.
Die Autorin benutzt einen speziellen Kode zur Bedeutungskonstitution, der ein einmal erworbenes Textverständnis in der nächsten Passage schon wieder zur Disposition stellen kann. Diese kommunikative Tugend prägt Erbs Texte durchweg. Hilfe bieten hierbei neben den erwähnten Begriffsbestimmungen auch die vorangegangenen bzw. nachfolgenden Gedichte und Prosavignetten, die eine Einheit und einen Zusammenhang stiften.
Die Lyrikerin arbeitet sich aus der „Standardphilosophie“ heraus, indem sie nicht, nach aristotelischem Denkmuster, Dinge durch ihre Eigenschaften bestimmt, sondern zwischen den Eigenschaften das eigentliche Individuum sucht. So befindet sich ihr lyrisches Alter Ego zwischen „Fußsohlen und Schädeldecke“, die „mit dem Boden und Dach des Liftes aufsteigen“. Eine immer wiederkehrende Methode in Erbs dichterischen und prosaischen Texten ist das Einbeziehen der Körperlichkeit, durch die der Eindruck unmittelbarer Erfahrungswelt entsteht. Durch den Körper erst erfährt das Individuum seine Umwelt. Der Körper als Medium zwischen hier und dort, außen und innen, letztendlich zwischen rege und zuwege. Durch ihn erst wird die endliche Weltenfahrt ermöglicht, ein stets wiederkehrendes Element der Erb’schen Poetologie.
Für einen graduierten Philosophen, belesenen Mythologen und weitsichtigen Historiker, einen Leser mit einem Quäntchen Wissen über orientalische Glaubensrichtungen und Sagenerzählungen, guten Kenntnissen in Grimms Märchen – sowohl primär-, wie sekundärtextlich –, einer guten Informationsgrundlage zu christlichen Denkschemata und einem gehörigen Maß an Bildung und Kompetenz nicht zuletzt auf sprachwissenschaftlichem Gebiet ist die Lektüre ein Genuss.
Christine Scheiter, literaturkritik.de, August 2001
Zur Rede gestellt, umgelegt
− Schönes Sinngerinnsel: Elke Erbs Werkbuch Sachverstand. −
Wem der Name Elke Erb vertraut ist, wird unter dem Titel Sachverstand nichts aus der Sachbuchabteilung erwarten, sondern Poesie – Poesie im weitesten Sinne dessen, was man mit Sprache anstellen kann. So verzichtet die Autorin völlig darauf, ihre poetischen Kurzwaren zu deklarieren. Auch der Leser tut gut daran, Scheidungen wie Gedicht, Aufzeichnung, Tagebuchnotiz zu ignorieren. Sachverstand ist eine Art Werkbuch; es enthält, chronologisch geordnet, Schreibresultate aus der Zeit von August 1996 bis August 1999.
Elke Erb, die seit den sechziger Jahren schreibt, liebt die Verbindung von Produktion und Reflexion. Ihr eilt der Ruf voraus, eine schwierige Autorin zu sein. Das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn der Band enthält einige leicht zugängliche Texte, etwa die Beschreibung einer Bohnenernte, von der die Autorin „nach einem halben Jahrhundert noch jeden Eindruck“ bewahrt. Oder das Gedicht „Weihnachtsurlaub“ mit dem Erinnerungsbild des Vaters: „Er hat uns drei kleinen Töchtern gezeigt, / wie das Gewehr funktioniert.“
Andererseits gibt es Arbeiten, die auch nach mehrmaligem Lesen kryptisch wirken; entweder weil sie zu Hieroglyphen zusammengeschnurrt sind oder absichtsvoll um so viele Ecke laufen, daß man den Faden verliert. Ich schätze die dunkle Prägnanz von „Sinngerinnsel“:
Zur Rede gestellt
Umgelegt.
Brachte ja die Zähne nicht voneinander.
Und zwar füsiliert.
,Eine Mauer des Schweigens.‘
Rom.
Welches Datum (im Sinne Celans) diesem Text zugrunde liegt, welcher Sinn hier schrumpfte, mag eine künftige Erb-Philologie ergründen. Vermutlich möchte der gegenwärtige Leser aber wissen, was es mit dem Titelwort Sachverstand auf sich hat. Der Anfang des gleichnamigen Textes sagt es klar und unverblümt: „Lange und stumpf zu tun haben mit den Sachen bringt den Sachverstand – das gewußt wie bringt ihn nicht.“ Elke Erbs Texte sind nichts für routinierte Leser, nichts für den schnellen Genuß. Man muß sich etwas Sachverstand erwerben; vielleicht also dies kleine, hübsch gemachte Buch.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.5.2001
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Cornelia Jentzsch: Tonlose, unsichtbare Schwingungen
Frankfurter Rundschau, 6.12.2000
Philipp Gut: Ein Ritt auf gläsernen Flügeln
Tages-Anzeiger, 20.2.2001
„Ich höre nicht auf, mich zu wundern“
– Elke Erbs poetische Weltsicht. –1
Es gibt einen kleinen, fast beiläufigen Text von Elke Erb aus dem Jahr 1980. Zunächst erscheint er wie eine mathematische Gleichung, absolut überschaubar, funktional und ohne Widerhaken:
BEWEGUNG UND STILLSTAND
Kommt man mit der S-Bahn von Mahlsdorf über Kaulsdorf und Biesdorf nach Friedrichsfelde-Ost, sieht man zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost links immer diese Neubauten, aus deren hunderten Fenstern man die S-Bahn zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost immer vor sich sieht.2
Klar, zuckt der Verstand: plattenbaukritischer Text. Ergänzt von der Stimme aus der Analyseregion: ins Gegenteil gekippt, Spiegeleffekt, Sichtverfremdung. Diese Spontanregungen aber hinterlassen einen rumorenden Rest. Könnte es bei diesem Text sein, dass nicht meine Augen an der Wirklichkeit entlangfahren, sondern dass etwas mit mir, mit meiner Wahrnehmung Zug fährt? An irgendeiner undichten Stelle kippt das Bild aus den statischen Blöcken der Ostberliner Plattenbauten, der geordneten Anzahl der Fenster und den festgelegten Schienen heraus ins Offene. Plötzlich wird deutlich: Da gehört schon allerhand poetische Chuzpe dazu, mit fünf knappen Zeilen die allgegenwärtige Sehnsucht in die Ferne – die ja sowohl aus jedem Fenster schaut, als auch in jedem S-Bahn-Wagen sitzt –, diese Sehnsucht fahrplanmäßig im Minutentakt unter dem Kreuz dieser gegenläufigen Bewegung zu begraben. Denn was man als abenteuerlich unbekannte Ferne zunächst dachte und ersehnte, ist nur das bewegte Gegenüber, das das Eigene abbildet.
Diesen glasklaren Spiegel zückt Elke Erb mit solch gewandter und rascher Wort-Bewegung, dass der Verstand offensichtlich einige Schocksekunden braucht, um das Angebotene in all seiner Hintersinnigkeit zu begreifen. Der knappe Text verwandelt sich, Einsichten blühen auf, beispielsweise: Wie man etwas dreht und wendet, man landet immer auf der eigenen Gegenseite. Die Welt ist bipolar eingerichtet – alle wesentlichen, animierenden Kraftfelder in ihr spannen sich zwischen Gegensätzen auf.
Wenn unter der Oberfläche eines solchen Textes eine Subschicht brodelt, hat Erb diese als blinden Passagier bereits mitgeliefert? Oder beflügelt ihr Text nur das Assoziations- und Denkvermögen des Lesers? Oder gibt es gar eine kulturelle Untertextur, die in allen Menschen bereitliegt und hier zu wirken beginnt? Sicherlich ist von allem Genannten etwas dabei. Poesie ist nichts weiter als eine besondere Form von Energie. Latent angelegt, benötigt diese jedoch eine Initialzündung, um sichtbar zu werden. Die Anlässe dafür können vielfältig sein.
Der kleine Text „Bewegung und Stillstand“ stammt aus dem Band Vexierbild von 1983. Vexierbilder sind Rätselbilder, in deren Bildstrukturen eine Suchfigur versteckt liegt. Das Eigentliche wartet verborgen. Es muss entdeckt, mit den Augen aufgehoben werden. Zur Suchfigur gelangt man durch Verzicht, indem man die Sinnangebote der Oberflächen ausschlägt und sich dem doppelbödigen Liniennetz des angebotenen Bildes überlässt. Man muss dieses Bild zugleich neugierig, entspannt und konzentriert mit den Augen abfahren. Nicht der Sucher entdeckt die verborgene Figur, sondern die Figur kehrt in den Sucher ein und entdeckt ihn. Insofern bezeichnet der Buchtitel nicht nur eine optische Spielerei, sondern etwas Wesentliches im poetischen Verfahren der Dichterin Elke Erb.
Ich dechiffriere das anscheinend Einfache. Immer wieder wird der Text solche Hintergrundarbeit, wie wir sie unbewußt leisten, aufdecken. Sie bleibt unterbewußt, weil sie von den Unbilden eines normativen Vordergrunds verdeckt wird. Wir leisten sie und haben, ohne von ihr zu wissen, das Gefühl zu versagen.3
In der Philosophie gibt es einen Begriff, der dieser Irritation, die Poesie auszulösen vermag, sehr nahekommt. Es ist der Begriff des ,Fastnichts‘, des presque rien. Ein Ausdruck, der im Barock, als Leibnitz und Newton mit der Infinitesimalrechnung unendliche Annäherungen an Null erfanden, das irritierende Verschwinden fixer Distanzen zu fassen versuchte. Dieser auf das Unvorstellbare reduzierte Moment explodiert zweieinhalb Jahrhunderte später bei Vladimir Jankélévitch zu einem existenziellen „Ich-weiß-nicht-was“ und „Beinahe-Nichts“. Auftauchen und Verschwinden, Sein und Nichts, finden für ihn beinahe gleichzeitig statt und werden so zur anwesenden Entsprechung des Todes. Heute, in einer weitestgehend rationalisierten und desillusionierten Welt, ist es wiederum jenes Fastnichts, in dem Hannes Böhringer Spuren von anti-rationalistischen Begrifflichkeiten, von Grazie und Gnade entdeckt.4
Bezogen auf die Dichtung, konkret auf Elke Erbs Poesie, ist dieser Moment (fast) nichts weniger als ein Synonym für den Moment des Schöpferischen. Es verweist auf etwas von der Sprache nicht mehr/noch nicht Fassbares. Das man zwar bemerken, aber nicht benennen kann. Das noch nicht zur Sprache gekommen ist. Jene Differenz, die das Poetische vom Nichtpoetischen unterscheidet. Eine winzige Verschiebung nur, kaum wahrnehmbar, aber mit ungeheuren Folgen für das, was daraus entsteht und zurückwirkt. Das poetische Fastnichts muss die Dichterin – wie in einem Vexierbild – erst entdecken, herausschälen oder besser, sie muss sich von ihm ergreifen lassen. Es hat etwas Virulentes, „wenn dann der feste Körper des Denkens (…) hochfliegt“.5 Elke Erbs Verse bewegen sich schreib-tastend in die Dinge hinein, spüren „Molekularvorgängen von geringer, nicht geringfügiger Bedeutung“6 nach, drehen und dehnen sich nach allen Richtungen und durch alle Zeiten. Dabei nutzt Erb in vielen ihrer Gedichte „die aus dem Vergangenen erneut herfantasierten Anlagen“ als „Denkbilder“,7 als Katalysatoren, die einen aktuellen Schreibprozess vervollständigen, weil sie die Spuren und Spiegelungen dieses Vergangenen in der Gegenwart aufgreifen.
Ich räume die einstige Gegend wieder hin,
als seien die noch vorhandenen Formen (Feld, Wiese,
Gebäude) im vollen Sinn ihres Anfangs geblieben.8
Jeden „Winkelzug“ ihrer Arbeit lässt Elke Erb den Leser nachvollziehen, sie beschreibt detailliert sämtliche untergründige Bewegungen, die zu den Gedichten hinführen (Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlußreiche Verhältnisse heißt ein 1991 erschienener Band). Ihre Gedichte ähneln komplexen Gedankengebilden, ausgebreiteten Denkwegenetzen.
Neben dem Fastnichts gibt es noch einen zweiten wichtigen Aspekt, der Elke Erbs Poesie zu einer besonderen macht. Er hängt zusammen mit jener generellen Ehrfurcht vor dem schöpferischen Moment, der sich in allem, was den Menschen ausmacht, wie auch in den ihn umgebenden Dingen offenbart. Diese Ehrfurcht respektive Wertschätzung schafft jene notwendige Distanz, die Erb poetisches Sehen lehrt. Sie verbindet sich mit einem Respekt, den die Dichterin den Dingen entgegenbringt und den sie gleichermaßen für sich als Dichterin und Mensch einfordert.
Alles, was da ist, empfinde ich als Majestät: Das ist für mich ein wichtiges Wort. Die Majestät der einzelnen Seins. Und was ich tue, das ist: eine Art Würdigung durch das Hinstellen.
Ich mache mit den Gegenständen im Grunde dasselbe, was ich möchte, daß man es mit mir tut: direkt vor mich hintreten, mich sein lassen und mich aufnehmen.9
In ihrem Buch Kastanienallee beschreibt Erb auch ihre Gedichte als Wesen mit einem autarken Eigenleben:
Ein Gedicht ist den Bedingungen entkommen, die es erfüllt.
Erfüllt es seine Bedingungen nicht, ist es nicht ihr Gedicht.
Erfüllt es sie, ist es selbständig.10
Diese Selbständigkeit wird den Gedichten wie mündigen Kindern zugestanden. Und wie die ins Leben entlassenen leiblichen Nachkommen bleiben auch sie dank ihrer Eigenständigkeit vital, überraschend, unergründlich – und rückkehr-affin. Sie kommunizieren weiterhin auf direkte Art mit der Autorin und antworten ihr noch Jahre später.
Immer wieder wurde Elke Erb gefragt, warum sie viele ihrer Gedichte mit Kommentaren versehe – von ihren frühen Büchern Kastanienallee und Winkelzüge bis zu den jüngst erschienenen Sonnenklar und (direkt) Gedichte und Kommentare. In den Kommentierungen nimmt nur eine veränderte äußere Form an, was ohnehin in ihren Gedichten angelegt ist; sie sind Fortführungen mit anderen Mitteln, bilden neue Wachstumsringe um einen vorhandenen Kern. Lyrik ist „arbeitendes Bewußtsein“.11 Dass das Bewusstsein kein einfaches, überschaubares, geradliniges ist, weiß jeder aus eigener Erfahrung. Es arbeitet sporadisch, entzündet sich auf verschiedene Weise. Seltsam, dass ausgerechnet einer Lyrik, die diesen Umständen sprachlich auf das Genaueste nachgeht, oft Unverständlichkeit und Hermetismus vorgeworfen wird.
Es geht nicht darum, absichtlich zu verschlüsseln, sondern darum, eine Regung, die du hast, so aufmerksam wie möglich wiederzugeben. Du baust damit auf etwas auf, du entwickelst etwas, und da, wo es manchmal am kompliziertesten erscheint, öffnet sich etwas. Und manchmal denke ich, der Mathematiker, der Philosoph, der Techniker müssten eigentlich an eine Situation dieses Typs gewöhnt sein.12
Elke Erbs Gedichte sind permanente Aufforderungen zum Weiter- und Darüberhinausdenken. Die Wege- und Maßeinheit ist jenes zunächst unscheinbare presque rien. Die Welt wird sich in diesem fortwährenden Prozess anverwandelt, einverleibt. Dafür findet die Dichterin unablässig neue Gelegenheiten und Zugriffsweisen.
Die Poesie verwandelt ihre Widerstände in Siege. Immer wieder und allseitig neu.
Je knapper die Siege sind, desto besser.
Das Gedicht grenzt nicht aus, verkleinert die Welt nicht.13
Sprache grenzt per se zunächst aus, reduziert die opulente Welt auf ein leichtes, kleines, tragbares Wort. Ausgesprochen, entstehen aus dem Wort „Feuer“ erneut Flammen, Brennbares, Gefahr, auch Schönheit. Eine Dichterin wie Elke Erb aber denkt weiter, ins Sprachoffene. Wenn sie vom Feuer spricht, benennt sie die Seele:
Sie ist eine Feuersäule
gleich jener, die spazierte
im Spatium zum Zeichen,
daß der Raum kein Traum sei,
eine wandelnde Säule aus Feuer.
Eine ständige Feuersäule.
Die immerfort brennt.
Unablässig erregt.14
Das lateinische „Spatium“ bedeutet „Leerzeichen“. Zwischenräume, Atempausen sind notwendig auch in der Poesie, Mallarmé verwendete diese sprechenden Auslassungen im Besonderen. Ein 2005 erschienener Gedichtband von Erb heißt Gänsesommer. Das Wort erinnert an Altweibersommer, wenn durch die noch immer warme Luft Fadengespinste mit Baldachinspinnen treiben. Das englische, lautähnliche „gossamer“ bedeutet „Spinnfaden“ oder „hauchdünn, hauchzart“, Gossamer nennt man auch einen fein verwobenen Stoff, ein leichtes, gaze-ähnliches Textil. Im titelgebenden Gedicht „Gänsesommer“ webt Erb, gossamer, feine Fäden zur geistesverwandten englischen Dichterin Emily Dickinson, bei der es heißt:
der Tau ließ zittern und frösteln –
denn einzig Gossamer, mein Kleid.
Damit meint Dickinson: gossamer, die Seele – die andere, gleichsam dem Tod zugewandte Seite der Seele. Fliegend, hauchdünn, immerzu Netze und Verbindungen webend, und darum auch leicht zerreißbar, verwundbar.
Der Dichter Uwe Kolbe sagt über Elke Erb, ihre „innere, meist unaufgeregt leuchtende, sich mehr und mehr gewisse Sprache war von Anfang an Haltung, war Würde“.15 Eine Haltung, die sich aus Beachtung und Wertschätzung der Dinge speist, die beobachtet, statt behauptet, schaut und staunt, statt zugreift. Eine Würde, die Erb im Titel ihres Buches Mensch sein, nicht erklärt und zugleich relativiert. Das Staunen ist eine ihrer Wesenseigenschaften – im Hintergrund ihr Lachen, mit dem sie Gespräche begleitet, ihre helle Freude über Entdeckungen im täglichen Weltgetriebe, mikrofeine Verästelungen und Verzweigungen hinter, zwischen und unter den Dingen, welche es eigentlich sind, die die Zeit vorantreiben und Ereignisse formen. Man sollte gelegentlich wie die Dichterin nur zuhören – und staunen, was geschieht und mitgeteilt wird. Im Allgemeinen unterscheidet (trennt) man mit Sprache – etwa in Kornblume, Margerite und Klatschmohn – und meint, Natur damit erfasst zu haben, wie Erb in ihrem Gedicht „Parabel“ bedauert. Forsch auch macht der unpoetische Praktiker aus einem „Wiesen-Grund“ einen verwertbaren „Grund und Boden oder einen Grund / causa“, einen „verhandelbaren, mit dem man begründen kann“, wie es im Gedicht „Grundbegriffe“ heißt.16 Wirklichen Gewinn dagegen zieht man aus Elke Erbs Dichtung – man nehme nur die fein komponierten Tonunterschiede, die die gesamte historische Epoche der Industrialisierung in knappster Form beschreiben:
Die Sichel tönt aufgebrachter, entschiedener, die Sense gereizt, wie überaus böse, so daß es hochsirrt, nicht aufzuhalten. (…) die Maschine übertönt den Halm. Bei allen anderen hört man ihn tönen im Schnitt. Die Maschine braucht einen anderen geistigen Ansatz.17
Erstaunen heißt: Man wird aus der Fassung gebracht. In diesem abrupten Vorgang sieht Elke Erb keinesfalls den klaren Verstand als Gegner eines unmittelbaren Staunens – sie begreift Geisteskraft als etwas diesem Geschehen Inhärentes.
Das Staunen ist nichts anderes als ein ungehindertes Wahrnehmen und Ermessen. Das nichts Absprechendes, Einschränkendes, nichts erledigend Einordnendes zu gewärtigen hat. Mit der Lust des Staunens gepaart ist die, daß es ihm gelingt zu entkommen, ehe die in ihm aktuelle Intelligenz Schaden genommen hat.18
Um zu einem solch gossamer Gedichtstoff zu gelangen, muss die Dichterin nichts unternehmen, nur poetischen Sachverstand zulassen (so der Titel eines Gedichtbands aus dem Jahr 2000). Diese Art Verstand ist weder angestrengt, künstlich, noch schwer zu erlernen. Er erscheine, meint sie, so gut wie von selbst, wenn man ausdauernd, lange und stumpf mit den Sachen zu tun habe. Die Geist-Materie sei von Natur aus erstaunlich leistungsfähig. So wird aus Ertragenem ertragreiches Einsehen, reift, schaut man die Dinge nur an, die poetische Ernte: Die Wortfrüchte fallen auf den Tisch und ihre verschlossenen Schalen platzen auf. Denn man hat, ein klein wenig nur, die gewohnte Perspektive geändert und am Baum gerüttelt.
Dichten bedeutet, so verstanden, (fast) nichts weiter, als gegenwärtig zu sein, geistesgegenwärtig. Aufnahmebereit für das Poetische, das allen Dingen anhaftet, ihr Erscheinen vor- und nachbereitet. Das Gedicht „Mitteilen“ beschreibt, wie dieses Poetische, Federleichte sich nähert und nährt:
Schneide ich etwa Feenfleisch aus
und lege es auf die Teller?
Und wird es von Feenfüchsen
im hindernislosen Mondlicht
(die auf die Stühle springen
am runden Tisch, bei Messer und Gabel
aufs weiße Tischtuch die vorderen
Füße aufstützen)
beschnuppert, bevor
Meinesgleichen dran kaut?19
In einem weiteren Text in Sachverstand beschreibt Elke Erb, wie das Obst, das sie gerade in ihrer Küche verarbeitet, poetisch zu klingen beginnt und sich in ein Gedicht verwandelt. Das vermutlich in der Oberlausitzer Landschaft um den Berg Czorneboh, in der Erb ihre Sommer verbringt, geerntete Obst. Man kann dieses Gedicht als Tischmusik zum vorherigen poetischen Mahl lesen. Die hier aufspielenden Instrumente sind kleine Geigen, sie schälen sich im Text leicht und luftig aus im Backofen trocknenden Birnenhälften heraus. Die sanften Rundungen der Früchte lösen in der Dichterin eine „Zwangsvorstellung“ aus, eine Assoziationskette entsteht. In ihrem Ablauf offenbart sich ein Schema, ein Regelwerk, „ein Zügel im Gang der Dinge“. Begreifen und Sehen werden zum rauschenden Fest, Neugier und Spannung drehen und steigern alles, bis die Dinge zu summen beginnen, die Birne zur Geige, zum poetischen Instrument wird und nachhaltig klingt. In diese Formen springen die Gedanken und sprengen sie, musikalisch begleitet von Pauken, Trompeten und jener leuchtendgelben Frucht.
Sie mustert ja violinengleich die Birnenhälfte mit ihrem kleinen Hintern (…) .20
Als fernes Echo ziehen Klänge der Violinen aus Bildern von Juan Gris und Georges Braque durch den Text. So gesehen ist Poesie eine Art wahrgenommener, verstandener Partitur der Dinge, die in Worten zu spielen, mit Versen auszuspielen ist. Sie verstärkt deren tonlose und unsichtbare Schwingungen, bis sie hör- und sichtbar werden. Aus dieser Perspektive lässt sich auch der Satz Erbs verstehen, die Kommunikation sei eigentlich noch nicht erfunden. Tatsächlich bietet der warengleiche Tausch von Worten in der medialen Öffentlichkeit keine wirkliche Kommunikation. Erbs Äußerung zielt auf eine Verständigung, die aus einer gewissen Sehnsucht heraus jemanden, wie sie schreibt, „in weiterführenden Adern fließend zu erquicken“ vermag.21 Diese Kommunikation geht über die bloße Materialität von Worten hinaus. Sie klingt, zittert, vibriert und atmet – auf beiden Seiten.
In diesem Zusammenhang taucht bei Elke Erb das Wort „Anwandlung“ auf. Solche erkenntnisverwandten Erhellungen erscheinen, von beiläufigen Wahrnehmungen ausgelöst, unvermittelt; sie wandeln sich der Person an mit der Aufforderung, zu sehen. Erbs Gedichte sind solche Anwandlungen, die ihre Gegenstände erhellen, sie ins Licht einer fragenden Anteilnahme stellen. Alles ist tauglich, betrachtet und untersucht zu werden, nichts ist zu gering für ihre poetische Achtsamkeit, als dass es nicht in einem Gedicht sprechen, sich offenbaren könnte.
(…) es sei nichts Arges der Grund meiner Anrede. – Bin ich selbst die Gefahr? Oder warne ich? Wenn ich warne, bin ich verläßlich? – Dieser feine Spalt, Riß (wie er sonst auch genügen kann, tödlich zu sein) im Anfang des Aufscheuchenden (Aufscheuchen, Scheu, Scheuen – Stocken) – freilich merken wir ihn, glaub nicht, wir merken ihn nicht.22
Man kann Elke Erbs Werk als ununterbrochene Zwiesprache bezeichnen – geführt mit allem, was ihre unversehrten, weil unvermindert beanspruchten und wachen Sinne berühren. Ihr Buchtitel Unschuld, du Licht meiner Augen spielt auf die Unschuld an, die man der Sprache gegenüber besitzen muss, damit sich einem die Worte in all ihrer ursprünglichen Beweglichkeit, Freiheit und aktivierenden Unvollkommenheit überlassen. Erst diese schöpferische Unschuld ermöglicht Sehen und Wahrnehmen im poetischen Sinn. Den Ursprung dieser Haltung beschreibt ein Gespräch mit Christa Wolf bereits 1977 in Der Faden der Geduld. Erb begreift ihre Verweigerung gegenüber zugeteilten Normativen als gewonnene Freiheit mit vitalen Möglichkeiten für sich und ihr Schreiben. Je strikter sie sich jedoch einer fatalen Schuld-Haft verweigert, desto mehr scheint sie für die anderen zu einer befremdlichen Bedrohung zu werden.
Elke Erb: Da ist, vor Jahren, die Entscheidung gefallen. Ich habe mir gesagt: Ich kann mich in den Berufen, die es gibt, nicht bewegen. So kann ich diese Formen, die die Menschheit hat, nicht richtig mitvollziehen. Ich bin außerhalb der Form. Und das ist eine Chance und ein Risiko. Die Menschheit geht mit mir ein Risiko ein, ich diene als Risiko. So ungefähr. Und in dieser Situation ergibt sich ja das Äußerste, was man als konstruktiver Mensch machen kann.
Christa Wolf: Dein Glück, daß dir außer Sensibilität auch Eigensinn mitgegeben ist. Vielleicht sogar die nötige Unbefangenheit gegenüber der Gefahr, der du dich „treuherzig“, wie du sagst, aussetzt…
Elke Erb: Und jetzt sah ich, wenn ich auf der Straße ging, plötzlich einen Krug und solche Dinge ganz deutlich. Das war, als es anfing, ein großer Sieg für mich.
Christa Wolf: Ein Sieg?
Elke Erb: Daß ich zu den endlichen Dingen gekommen bin – ohne Erklärung, ohne irgendeinen Katechismus. Wahrscheinlich wollte ich – eben weil ich das Risiko bin – so gegenständlich und von mir selbst anerkannt sein, wie so ein Ding ist.23
Entrückt, der Begrifflichkeit von Schuld entzogen – und hingerückt zu den Dingen, angekommen nahezu, denn hier existiert das Großartige, das Majestätische per se. Dinge müssen nicht ent-schuldet werden, sie sind behaftet, verwachsen mit: nichts. Sie sind, in vornehmster Weise und ausschließlich: sie selbst.
Elke Erbs Gedichte, Tagebuchnotizen, Kommentare, Gedankensplitter und Denkketten, kurz ihr gesamtes Dichten ist wie Ein- und Ausatmen, „einfach entlang / am Vorhandenen“.
Während ich einwirke, wirkt, was ist, auf mich ein.24
Liest man ihre Gedichte, beginnt sofort ein lebhafter Kreislauf von Geben und Nehmen, ein osmotischer Dauerzustand.
Dichter, Freunde, Leser schätzen und verehren sie ob dieser permanent Gedanken stiftenden Gabe. „Dasz sie / grosze Phantasie Façon hat, wissen wir alle“, sagt, stellvertretend für alle, Friederike Mayröcker.25
„(D)as Menschenlineal // ist aus Krummem zusammengestückelt“,26 „für diese Schwingungen bin ich die Glocke“,27 antwortet Elke Erb.
Dieses Krumme, Eigensinnige, Eigenständige ist das unerschöpfliche Material ihrer Dichtung. Krumme, das liest sich wie Krume, Nahrhaftes. Wenn die Dichterin sich äußert, entäußert, wird sie selbst als Teil zum Ganzen. In dieser Annäherung von Dichterin und Welt, einem wechselseitigen Prozess, verschwinden Abstände, Fremdheiten und Begrifflosigkeiten.
Das – von Kraut, Busch, Baum! – umschlossene ist mein Teil, mein Ich-Teil, ist flammend grün, denn ich spreche von ihm, das ich ermesse in mir.28
Nur in der Dichtung ist diese vorbehaltlose Nähe möglich, die zum Inhalieren, zum Hinübergehen wird – in der klar wird, dass es eigentlich keine Differenzen oder Schranken gibt, dass alles in allem schon immer enthalten, jedes mit jedem verbunden ist – „denn solange es – während des Ansehens – in mich fährt, ist es dasselbe“.29
Den letztmöglichen Schritt geht Elke Erb in vollkommener Unschuld, sie tilgt Ursache wie Wirkung und ignoriert jene letzte wenn überhaupt noch bestehende oder jemals bestanden habende Grenze. Ein reziproker Satz mit komplexer Wirkung:
Was ich schreibe, lebe ich.30
Das ist der Moment, in dem das Fastnichts deutlich aufscheint. Denn im Dichter fallen Sprache und Welt beinahe in eins, werden – fast – identisch. Poesie – das ist die Entschuldung der Welt, wieder und wieder. Die Entschuldung dessen, was der Mensch mit Sprache und die Sprache im Menschen angerichtet haben. Ein Klärungsprozess, keine Erklärung. Eine Sondierung vielleicht.
Cornelia Jentzsch, in Text+Kritik: Elke Erb – Heft 214, edition text + kritik, April 2017
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Urs Engeler: Fünf Bemerkungen zu E. E.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



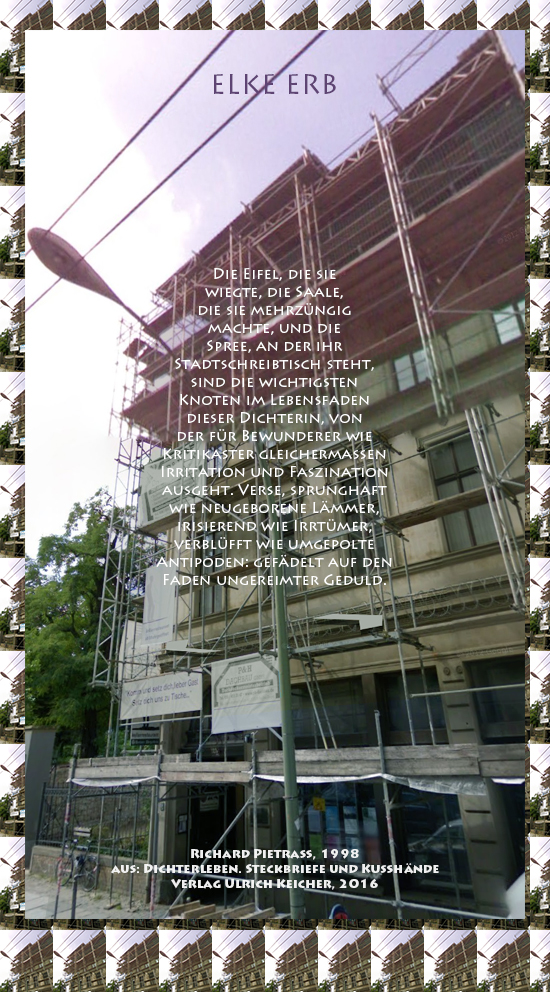












Schreibe einen Kommentar