Ernest Wichner (Hrsg.): Versuchte Rekonstruktion – Die Securitate und Oskar Pastior
DISKUSSION
1. Runde nach den Beiträgen von Ernest Wichner, Stefan Sienerth und Sabina Kienlechner
Catarina von Wedemeyer (taz): Meine Frage wäre: Warum ist Herr Schlesak nicht hier? Wurde er nicht eingeladen oder hat er die Einladung abgelehnt?
Ernest Wichner: Ich habe seine Vorwürfe in einer Weise für haltlos und gehässig gehalten, dass ich, mit Verlaub, keine Lust hatte, mich mit ihm darüber auseinanderzusetzen. Also ich persönlich. Ich bin nicht die Stiftung. Für die Stiftung sollte dann, wenn es einen Unterschied zwischen mir und der Stiftung gibt, Klaus Ramm bitte antworten. Ich weiß, dass er jenseits seiner eigenen Akte nichts gesehen hat im Archiv. Dann ist die Erkenntnisbasis ziemlich schmal, oder meinen Sie, er habe mehr gesehen? Das Archivgesetz in Bukarest erlaubt ihm auch gar nicht, mehr zu sehen – es sei denn, er lässt sich dort als Forscher akkreditieren und studiert das Material dort. Das habe ich getan, das hat Herr Sienerth, das hat Corina Bernic getan. Aber Dieter Schlesak hat das nicht gemacht. Mir haben die Archivmitarbeiter erzählt, wie er seine Akte zum ersten Mal gesehen hat, und zwar in Begleitung einer Person, die ihm das sozusagen vorgestellt hat, was da drin steht – also nicht ein Archivmitarbeiter, der sich auskennt, sondern eine Person, die er mitgebracht hatte. Er habe, so wurde mir dort erzählt, im Grunde nur nach Sachen von Oskar Pastior gesucht. Aber das ist ihm unbenommen. Kurz darauf hat er auch seinen Artikel geschrieben, als er diese paar Dinge gefunden hatte. Seine eigene Akte komplett konnte er damals noch gar nicht gesehen haben. Er hat dann eine Kopie seiner Akte bestellt, und die sollte er schon seit einem dreiviertel Jahr haben und ausführlich studiert haben können.
Klaus Ramm: Ich habe kurz nach dem ersten Artikel von Dieter Schlesak in der FAZ mit ihm korrespondiert. Er hat mir dann seine Quellen genannt, daraufhin habe ich in den genannten Quellen nichts gefunden. Dann hat er mir geschrieben, er hätte irrtümlich falsche Quellen benannt. Er erwarte aus seiner Akte noch weitere Akten zu Pastior; sobald er die hätte, würde er sie mir zusenden. Dann habe ich ihn nach Beweisen zu seiner Hoprich-These gefragt. Er sagte, das wisse er von Herrn Bergel und Herr Bergel würde das in der FAZ im Dezember 2010 alles belegfest veröffentlichen. Ich habe ihm noch einmal geschrieben, wann diese Veröffentlichung sei, denn im Dezember 2010 sei nichts erschienen und ich hätte auch von ihm keine weiteren Akten bekommen; daraufhin hat er sich nicht mehr gemeldet und nicht mehr geantwortet. Als wir überlegt haben, ob wir auch Dieter Schlesak als Referenten einladen sollten, sind wir zu demselben Ergebnis gekommen wie Ernest Wichner. Er hat im Grunde nicht mehr – jedenfalls hat er uns bisher nicht zu erkennen gegeben, dass er mehr hat. Insofern haben wir gedacht: Dann bleibt das wieder in der Sphäre von unbelegten Vorwürfen. Dazu kommt, dass Dieter Schlesak mir dann geschrieben hat, er hätte nie behauptet, dass Oskar Pastior irgendetwas mit dem Freitod von Hoprich zu tun gehabt habe; das habe er auch in der Siebenbürger Zeitung veröffentlicht. Diesem Artikel ist tatsächlich, wenn man ihn sehr genau liest, zu entnehmen, dass er seinen Vorwurf indirekt zurücknimmt: Er sagt, wir hätten alle seinen Artikel in der FAZ falsch gelesen, da stünde überhaupt nicht, dass er Oskar Pastior mit Hoprichs Tod in Verbindung bringen würde. Über diesen Widerruf hat die FAZ natürlich nie berichtet; erst hat sie ihm ein Forum für die Vorwürfe geboten, für die Zurücknahme dann aber nicht. Weil er diese Vorwürfe zurückgenommen hat, und da es inzwischen einen Artikel von Herrn Sienerth gibt über den Fall Hoprich, in dem auch Akten zitiert werden, aus denen deutlich hervorgeht, dass jedenfalls bisher – „bisher“ muss man an dieser Stelle immer sagen – überhaupt nichts zu finden gewesen ist, haben wir gedacht, da wir ja die Fakten aufarbeiten wollen, dass Schlesak dazu nichts beitragen kann. Deshalb haben wir ihn nicht als Referenten eingeladen. Das kann man kritisieren, aber das ist einfach die Begründung.
Caroline Fetscher: Er hätte ja durchaus auch als Gast kommen können. Es ist eine offene Veranstaltung.
Stefan Sienerth: Darf ich noch hinzufügen: Ich weiß, dass Herr Schlesak seine Akte gesehen hat und dass er sich damit auseinandersetzt und dass er einmal angedeutet hat, er schreibe darüber. Allerdings über seine eigene Akte, es soll ein Buch entstehen.
Regina Mönch (FAZ): Nur als Ergänzung: Ist das so geteilt wie bei uns, dass ein IM nicht seine IM-Akte lesen darf?
Ernest Wichner: Er darf alles lesen, was ihn betrifft, seine Opferakte, seine Täterakte. Er bekommt auf Antrag sämtliche IM-Namen, die in seiner Akte vorkommen, entschlüsselt von der Behörde. Was ihm auch möglich ist: Er muss nur mitteilen, dass er ein zeitgeschichtliches Buch schreibt zu diesem Thema, dann kann er sich dort auch akkreditieren lassen als Forscher und kann alles das einsehen, was in sein Interessengebiet fällt.
Regina Mönch: Er muss aber auch, wenn er jetzt von einem anderen die Akte liest, nicht um Erlaubnis fragen?
Stefan Sienerth: Wenn es im Zusammenhang mit seiner Biografie steht, dass er Leuten begegnet, die möglicherweise über ihn geschrieben haben, dann darf er diese Akten auch einsehen. Man darf aber immer nur die Akten einsehen, die zu dem entsprechenden Forschungsthema gehören. Herr Wichner oder ich zum Beispiel, wir können nur über rumäniendeutsche Literatur forschen, wir können jetzt nicht forschen über die rumänischen Parteien nach ’45, und das gilt für alle. Man gibt ein Forschungsthema an und über das darf man sich dann informieren.
Ernest Wichner: Vielleicht das noch dazu, damit man die Behörde ein wenig besser versteht: Man geht mit dieser Akkreditierung als Forscher sehr, sehr großzügig um. Es gibt Fälle, wo sich jemand akkreditiert hat, um über ein schmales Gebiet in der Literatur zu recherchieren. Das kann er dann ausweiten und über die Kirchen und Kirchenpolitik, über die Nationalitätenpolitik oder dergleichen forschen. Man braucht nur eine einigermaßen glaubhafte Begründung. Was nicht heißt, dass das Korruption ist, sondern man geht damit sehr großzügig und entgegenkommend um.
Corina Bernic: Ich möchte hinzufügen, das einzige Problem ist das Zeitproblem bei der Archivarbeit. Das liegt am Budgetmangel. Das Budget des CNSAS-Archivs wurde immer wieder, jährlich, gekürzt. Es gibt zu wenig Angestellte in der Behörde. Das einzige Problem ist, dass es ziemlich lange dauern kann, bis man die Akte, die man verlangt hat, in die Hände bekommt. Aber man erhält die Akte.
Ernest Wichner: Wir haben uns sehr, sehr viele Akten angeschaut, man begegnet sehr vielen IMs in diesen Akten. Man lernt mit der Zeit, diese Berichte zu lesen und auch sich vorzustellen, mit welchem Ethos so ein IM arbeitet. Anhand der Zahl der Berichte, anhand des Rhythmus, in dem sie abgeliefert werden, und auch an den Inhalten. Dann kann man allmählich unterscheiden zwischen Leuten, die mit großem Engagement dabei waren, auch investigative oder kriminelle Energie entwickelt haben, die sich die Ziele, die Ermittlungsziele der Securitate, quasi zu eigen gemacht haben als IM, oder andere, die widerwillig, dazu gepresst, unter Drohungen oder aus Angst mitgemacht haben. In der Regel unterscheiden sich diese Berichte im Tonfall, in dem, was sie mitteilen, und in der Regelmäßigkeit. Also, wie groß die Lücken von einem zum folgenden Bericht sind. Es ist schon erstaunlich, dass man in manchen Akten wirklich eine ganz große Regelmäßigkeit und Dichte von IM-Berichten findet. Also von „Silviu“ beispielsweise, diesem Hochschullehrer aus Bukarest, der von Ende der 50er Jahre bis zu seiner Ausreise aus Rumänien jahrzehntelang tätig war.
Caroline Fetscher: In den Akten der Stasi in der DDR sind, wenn ich es richtig verstehe, ja auch Namen geschwärzt worden. Man konnte eine Akte einsehen, aber bestimmte Namen konnte man in der Akte nicht sehen. Wird das auch in Rumänien so gehandhabt?
Stefan Sienerth: Wenn Sie als Forscher die Originale in die Hand bekommen, dann stehen die Namen natürlich ungeschwärzt da.
Thomas Eder: Ich hätte eine Frage zur Sprache der Akten und wie deren Übersetzung, wenn es eine Übersetzung ist, zu uns kommt. Wenn Sie jetzt aus diesen Akten zitieren, übersetzen Sie jeweils selbst? Wenn aus den einzelnen Berichten oder in den Aufsätzen zitiert wird, übersetzt jeweils der Verfasser dieser Beiträge aus der Originalsprache selbst? Oder gibt es da irgendwelche Standards, die eingehalten werden?
Ernest Wichner: Ich habe alles, was ich zitiert habe, selbst übersetzt. Herr Sienerth macht das wahrscheinlich auch so. Es gibt für die Begrifflichkeit Standards. Da lehnen wir uns an das an, was in der DDR in der Terminologie zur Stasi-Aufklärung niedergelegt ist. Es sei denn, die Institutionennamen unterscheiden sich. Es gibt kleine Einzelfälle, wo man für die Übersetzung vom Rumänischen ins Deutsche einen anderen Terminus benutzen muss. Ich habe heute in einem längeren Zitat, weil es um einen männlichen Informanten ging, das rumänische Weibliche ins deutsche Männliche übersetzt. Dort wird von „sursa“ gesprochen. Das wäre auf Deutsch dann „die Quelle“ geworden, was ja auch nur IM meint. Ich habe es aber mit „dem Informanten“ und nicht mit „der Quelle“ übersetzt. Sonst hätte ich den ganzen Satz im Femininum halten müssen und keiner hätte begriffen, dass es sich um einen Mann handelt. Das sind aber Übersetzungsprobleme, die man in anderen Fällen auch hat, nicht nur wenn es um die Securitate geht. Es gibt eine ganze Reihe sehr nützlicher Bücher, die von der Forschungsabteilung dieses Instituts erarbeitet worden sind. Beispielsweise ein Wörterbuch der Securitate mit allen Gesetzen, mit allen Veränderungen von Gesetzen, Verordnungen, sodass man die Funktionsweise dieser Institution, richtig akribisch genau beschrieben, historisch nachvollziehen kann – etwas sehr Hilfreiches.
Monika Reichert: Es war das Ziel des Vormittags, die Forschung und die Archivarbeit darzustellen im Fall Oskar Pastior. Nur der letzte Beitrag von Frau Sabina Kienlechner war doch ganz anders. Der hatte mit dieser Archivforschung nichts zu tun und da habe ich eigentlich vermisst – ich war recht erschrocken –, dass überhaupt kein Wort von Angst, von Trauma vorgekommen ist. Also das sind Kategorien, die auch miteinbezogen werden müssten in ihre Betrachtungsart.
Sabina Kienlechner: Wenn Sie das meinen – also ich meine das nicht. Und zwar deshalb, weil ich das eigentlich moralphilosophisch untersuchen wollte, das heißt eben nicht moralpyschologisch.
Monika Reichert: Trotzdem habe ich es vermisst.
Sabina Kienlechner: Ja, das tut mir leid. Dann müsste ich noch einen zweiten Aufsatz dazu schreiben, um Sie zufriedenzustellen.
Caroline Fetscher: Die Frage ist doch vielleicht, wie es gelingt, das zu trennen. Also wenn Sie ontologisieren, dann spalten Sie ja wiederum etwas ab, nämlich genau den emotionalen Aspekt oder den Bereich, den Frau Reichert eben anspricht. Also Sie haben dann ein ideales Individuum, das Integrität beherbergt und das sich nicht attackieren lässt, und ein sozusagen korruptes Individuum, dessen Integrität attackierbar ist. Die Frage ist doch, ob sich das tatsächlich zwischen Moralphilosophie und Moralpsychologie so auseinanderdividieren lässt.
Sabina Kienlechner: Ich meine schon, dass sich das nicht nur auseinanderdividieren lässt, sondern eigentlich dividiert werden muss, denn das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wenn wir objektive Kriterien finden wollen, dann können wir die nicht an Gefühlen festmachen, das geht nicht. Das ist ein anderes Gebiet. Objektive Kriterien müssten sich schon an die Moralphilosophie halten.
Caroline Fetscher: Eine Nachfrage: Wenn jemand tatsächlich erpresst wird entweder mit dem Leben seiner Verwandten oder mit der Drohung, dass er inhaftiert wird, ist das ja durchaus objektiv. Sie haben selber eingeklagt, der Wirklichkeit mehr Raum zu geben und nicht diese Relativierung vorzunehmen, jeder habe seine eigene Wirklichkeit. Das finde ich jetzt sehr einleuchtend, aber die Frage würde stehenbleiben für mich, inwieweit ist das nicht etwas ganz Objektives, wenn jemandem meinetwegen Haft angedroht wird.
Sabina Kienlechner: Das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Es ist so: Ich habe mehr aus der Sicht der Aktionsgruppe Banat gesprochen. Das war eine andere Zeit als die von Oskar Pastior. Das muss man immer berücksichtigen. Zu der Zeit der Aktionsgruppe war es so, dass den Spitzeln mit aller Wahrscheinlichkeit nichts oder nur wenig passiert wäre, wenn sie die Angebote der Securitate abgelehnt hätten oder wenn sie sich in ihren Kreisen dekonspiriert hätten. Das hat es auch gegeben und es ist ihnen nichts passiert. Das ist das Eine. Das Zweite, woran ich aber festhalten möchte, ist, dass ich in meinem Vortrag auch nicht ausgeschlossen habe, dass es Ausnahmen gibt. Ich würde sagen, Oskar Pastior ist so eine Ausnahme. Ich würde das zunächst einmal als Hypothese in den Raum stellen. Für die Ausnahmen muss es Begründungen geben. Ich habe nicht von einem Idealfall gesprochen, sondern von der Normalität, daran möchte ich auch festhalten. Die Normalität muss nicht begründet werden. Das heißt, in der Normalität gehen wir davon aus, dass uns unsere Mitmenschen unterrichten über Dinge, die uns etwas angehen. Wenn sie das nicht tun, und das gibt es durchaus, und wenn sie es zu Recht nicht tun, dann müssen sie es begründen. Wenn sie es tun, müssen sie nichts begründen. Ich wollte noch kurz etwas zur Angst sagen. Anders als im Fall Oskar Pastior, wo es ja niemanden gibt, der wirklich unmittelbar ein Geschädigter ist durch irgendeinen Bericht, habe ich solche Geschädigten sehr wohl erlebt. Also in der Aktionsgruppe gibt es eine ganze Reihe von wirklichen Opfern von Spitzelberichten, von Securitate-IMs. Ich muss sagen, ich habe erlebt, dass unter diesen Opfern eigentlich keiner das Argument Angst für seinen Fall zugelassen hat. Keiner verzeiht seinem Verräter aus dem Grunde, weil er Angst hatte.
Ernest Wichner: Aber da muss man hinzufügen, dass das die 70er Jahre waren und nicht die End-50er oder Anfang-60er Jahre, wo die Angst allgemein in der Gesellschaft war. Das haben Sie ja aber auch in Ihrem Vortrag gesagt. Das waren andere Verhältnisse in den 70ern. In den 70ern konnte man sich verweigern. Es ist einem nichts geschehen, es sei denn, man hat nicht so schnell Karriere gemacht, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
Zuhörerin: In den 50er und 60er Jahren, hat es da niemanden gegeben, der sich verweigert hat?
Ernest Wichner: Doch natürlich, Herr Sienerth hat doch davon gesprochen.
Stefan Sienerth: Natürlich haben sich die Leute verweigert. Ich habe das ja auch betont, gerade im Umfeld von Pastior. Ich hatte Dieter Fuhrmann beispielsweise angeführt, der versucht hat, hinzuweisen auf eine entweder tatsächlich existierende Nervenkrankheit oder auf eine, die er nur vorgetäuscht hat. Diese Möglichkeit hat es natürlich gegeben. Aber es gab natürlich auch Konsequenzen, wenn man sich verweigert hat. Wir brauchen jetzt nur an Grete Löw zu denken, der Name ist auch ein paar Mal gefallen, die sich verweigert hat und dann nachher mit Konsequenzen rechnen musste und ins Gefängnis gegangen ist. Eine andere Möglichkeit gab es auch noch. Hoprich zum Beispiel, den ich auch erwähnt habe, auf den, zumindest laut Aktenlage, in diese Richtung kein Druck ausgeübt worden ist. Er schien noch nicht geeignet zu sein. Aber durch seine antikommunistische Haltung und die Gedichte, die er geschrieben hat, war er von vornherein ein Feind des Regimes, und deshalb haben sie ihn dann auch eingekerkert.
Markus Bauer (NZZ): Ich glaube mich erinnern zu können, dass es einmal einen Stand der Forschung gab, bei dem gesagt wurde, nicht was ein Informant geliefert hat, ist entscheidend, sondern dass er geliefert hat. Das heißt, die Securitate baute ihre Anklagegebäude auf Informationen aus sehr vielen verschiedenen Quellen. Es ist ja üblicherweise so gewesen, dass nicht eine Quelle eine Person beobachtet, sondern viele Quellen. Man hat aus diesen Quellen dann irgendwelche Partikel herausgezogen, um jemanden zu belasten oder unter Druck zu setzen. Heute habe ich auch bei den historischen Beiträgen den Eindruck, von diesem Stand der Forschung ist man weggekommen. Heute diskutiert man darüber, ob jemand jemandem schaden wollte. Das ist eine legitime Diskussion. Es war auch bei dem früheren Stand etwas sehr abstrakt zu sagen, jener Beitrag war ein völlig unpersönlicher Beitrag, den die Securitate unter Umständen erst zu einer Waffe gemacht hat. Aber ich wollte doch darauf hinweisen, dass es zumindest diese Idee einmal gegeben hat. Dafür gab es durchaus Gründe: dass die Securitate aus den Spitzel berichten ihre Anklagen formuliert hat oder aufgebaut hat – egal, was der Spitzel gesagt hat.
Ernest Wichner: Es war nicht egal, was der Spitzel gesagt hat. Die Securitate musste sozusagen dieses Material nach ihrer Verwertbarkeit belichten. Entweder weil sie den Betreffenden auch anwerben will. Dann braucht sie Erpressungsmaterial. Das Erpressungsmaterial muss ein spezifisches Bedrohungsgewicht haben. Oder man will jemandem einen Prozess anhängen, dann muss man auch mit dem Bericht etwas vorweisen können. Es ist nicht unabhängig davon, was in dem Bericht steht. Ich meine, mit dem Bericht, den ich zum Beispiel über Walter Biemel gelesen habe, konnte die Securitate gar nichts anfangen. Nun kann man sagen, natürlich, das ist ja auch nachvollziehbar, aber dass jemand überhaupt einen Bericht über einen anderen schreibt, das ist das Skandalon. Das ist so und bleibt so. Wenn das so ist, dann kann ich mir gleichzeitig anschauen, was steht da drin und was steht in dem Text des anderen drin. Der unter den gleichen Verhältnissen, im gleichen Jahr, über den gleichen Sachverhalt auch einen Bericht schreibt. Inwiefern unterscheiden die sich? Ich muss alles, was ich über Zeitumstände, was ich über persönliche Umstände der betroffenen Menschen in Erfahrung bringen kann, lesen, gewichten und daraus Schlüsse ziehen. Soviel wie möglich. Was das Skandalon, dass da jemand über einen anderen berichtet und dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, nicht aus der Welt schafft.
2. Runde nach den Vorträgen von Jacques Lajarrige, Thomas Eder und Michael Lentz
Caroline Fetscher: Wir haben uns hier, glaube ich, vor allem literaturwissenschaftlich, poetologisch und historisch, zeithistorisch auf diesem Feld zwischen Verdacht und Befund aufgehalten. Am meisten Diskussion entstand, so mein Eindruck, als Frau Sabina Kienlechner anfing mit ihrem Versuch einer Objektivierung, also eines Festlegens dessen, was der Bezirk des Wirklichen ist, und dem Versuch, die Emotion davon abzuspalten. Für mich ist Abspaltung das Stichwort der gesamten Debatte, des gesamten Phänomens, das hier stattgefunden hat. Ich sage vielleicht einleitend, woran ich mich immer wieder erinnert habe während dieses Tages, nämlich dass es eine Tagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung vor einigen Wochen hier in Berlin gab, wo es um das Thema Spaltung ging. Der einleitende Vortrag zum Thema Spaltung war über die gespaltene Stadt Berlin, und der Psychoanalytiker, der dann im Tagesspiegel interviewt wurde, Herr Thomas Plänkers, hat Interviews geführt mit Stasi-Mitarbeitern. Er hat sie danach befragt, wie sie ihre Tätigkeit selber eingeschätzt haben und wie sie das legitimiert haben. Und das ist hier eigentlich die große Lücke bei dieser ganzen Rekonstruktion. Es sind zwei große Lücken, die Täter sind nicht da und sprechen nicht, und die Hauptperson, der Protagonist dieser Tagung ist nicht mehr da, um Antwort zu geben. Das heißt, alles gruppiert sich eigentlich um diese Leerstellen oder Lücken herum. Und Sie, Herr Lajarrige, versuchen, wie Herr Lentz eben auch, richtig intuitiv sich hineinfühlend sich dem zu nähern. Was kann er gemeint haben? Und es ist mir auch bei Ihnen sehr aufgefallen, dass es ja darum geht, interpretatorisch sich zu überlegen: Was heißen denn zum Beispiel die Sprachspiele? Sind sie der Ausdruck von einer Flucht oder sind sie der Ausdruck von einem Protest gegen die Sprache? Also der Versuch, aus dieser Sprache der Täter auszubrechen und etwas herzustellen, was nicht so leicht anzugreifen ist, was nicht zu begreifen, zu attackieren ist. Ich würde Sie dazu gerne fragen: Wie weit, weil ich Sie eventuell sogar missverstanden habe, geben Sie diesem Befund des Evasiven oder Flüchtenden im Wortspiel recht?
Jacques Lajarrige: Das ist immer eine schwere Frage, und die kann ich auch nicht so ohne Weiteres beantworten. Ich glaube, die Wortspiele bei Oskar Pastior würden auch bestehen ohne diesen biografischen Hintergrund, unabhängig davon. Dass es diesen biografischen Hintergrund gibt und dass wir ihn inzwischen auch etwas besser kennen, kann uns natürlich auch dazu veranlassen, alles neu zu lesen. Ich habe das auch kurz erwähnt, die Gefahr ist nun, dass man wirklich seine Texte so liest, dass man immer wieder, nach jedem Satz, der Versuchung unterliegt, sich zu fragen, was könnte sich wohl dahinter verbergen. Kann das nicht in irgendeiner Beziehung stehen zu dem, was wir wissen. Also meine Lesart von Oskar Pastior ist es nicht.
Herta Müller: Ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, uns Gedanken zu machen über ein Kalkül, das hinter dieser Art von Sprache steckt. Mir hat Oskar Pastior sehr oft gesagt: „Mir ist die Sprache im Lager zerbrochen.“ Und das ist eine Aussage. Das hat er mir nicht gesagt, um mir irgendetwas vorzumachen, sondern das hat er so gemeint. Ihm ist die Sprache im Lager zerbrochen. Er kam dann aus dem Lager nach Hause in ein stalinistisches Land. Vielleicht hätte er gleich so geschrieben, wie er später geschrieben hat, als er aus dem Land draußen war, aber das war in einem stalinistischen Land nicht möglich. Also hat er konventionell geschrieben, und zwar um sich unauffällig zu machen. Zur Mitarbeitererklärung, die Ernest Wichner vorgelesen hat, muss man auch wissen: Der Text ist diktiert. Also mich wollte man auch zur Mitarbeit zwingen. Jeder Mitarbeitstext ist diktiert von einem Offizier. Das ist kein eigener Text. Er sagt, ich muss mich rehabilitieren. Damit hat man Pastior schon gesagt, was er zu tun hat. Und zwar: Er hat sich zu rehabilitieren. Er war eigentlich Verurteilter mit Freigang. Er hat sich rehabilitiert, indem er diese Art von konventionellen, damals akzeptierten Texten geschrieben hat. Etwas anderes wäre undenkbar gewesen. Das ist das eine. Es hätte bei jedem, der für den Geheimdienst gearbeitet hat, seine eigene Sprache ergeben müssen. Wir haben von allen anderen ganz gewöhnliche Werke, ganz gewöhnliche Texte, in denen wir nicht einmal auf den Gedanken kommen, dass die für den Geheimdienst hätten gearbeitet haben können. Also, man muss das nicht tun, um sich zu verstecken.
Es ist auch unmöglich. Wer Pastior gekannt hat – das war seine innere Struktur, nachdem ihm das, was er erlebt hat, zugestoßen war. Und dann ist ihm natürlich noch einmal ein Schweigen auferlegt worden. Das ist das erste Schweigen, nach dem Lager. Er durfte über das Lager gar nicht sprechen. Meine Mutter war auch im Lager. Es durfte niemand über das Lager sprechen. Das hat es nicht gegeben. Dann hat er diese Gedichte geschrieben, er kam ins Visier des Geheimdienstes wegen antisowjetischer Propaganda. Dann war er noch einmal dran: Er war homosexuell, dafür gab es Gefängnis. Auch darüber musste er schweigen. Er hat nur schweigen gelernt durch Zwang. Er wurde zu dieser Unterschrift genötigt, weil er Freigang haben wollte. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er sofort ins Gefängnis gegangen. Er hat sich für den Freigang entschieden und er wusste, er ist nicht frei, er kann jeden Moment verhaftet werden. Das sind alles konkrete Dinge. Dann kommt einer 1968 nach Deutschland, er hat jahrelang über nichts reden dürfen. Dann soll er sich outen, soll überall herumlaufen und den Leuten erzählen, ich habe das und das gemacht. Leute, die mit den Sachen gar nichts zu tun haben. Er hat geglaubt, er sagt es der Institution, und zwar den Deutschen und den Alliierten. Und dann hat er gedacht, er hätte dafür etwas getan. Erstens hat er gedacht, das ist eine neutrale Behörde, damit werde ich das los. Zweitens hat es ihn vielleicht auch gequält, er fühlte sich verantwortlich und hat sich gedacht, das ist anständig, das gehört sich. Und drittens hat er sich gedacht, dann kann der Geheimdienst aus Rumänien ihn nicht noch einmal erreichen und wieder erpressen, und er wird nicht wieder zur Mitarbeit gedrängt. Wenn er sich dort outet, dann ist das vorbei. Und wenn so etwas passieren sollte, kann er zu denen gehen und sagen: „Ich habe euch gesagt, wie es war.“ Und er kann sich darauf berufen. Es war für ihn die Sicherheit, dass er das „Ekelpaket“ Securitate los ist, wie er das nennt. Über diese Dinge müssen wir auch reden. Er hat gesagt: „Mir wurde die Sprache zerbrochen im Lager.“ Das ist der Ausgangspunkt, das sind nicht Phantasien von Verstecken und Nicht-Verstecken. Es kann einer nicht 20 Bücher schreiben mit einem angenommenen Stil, den er sich ausgedacht hat, um sich zu verstecken. Dann müssten alle Securitate-Leute irgendwie eine andere Sprache gefunden haben. Und was heißt verstecken? Und die Funktionalität – was Michael Lentz auch gesagt hat –: Die Sachen sind in seinen Texten drin; gerade um sich damit auseinanderzusetzen, hat er so geschrieben. Und zwar natürlich alles. Er war der genaueste Mensch, den ich kenne, er hat millimeterweise gedacht, und dieses Problem hat er immer mit sich herumgeschleppt. Und ich sage heute, ich bin froh, dass er es mir nicht gesagt hat. Ich hätte ihm die Tür zugeknallt. Ich hätte keine Ahnung gehabt von den Akten, die hat man damals noch nicht hat lesen können. Als man sie lesen durfte, war er schon tot. Ich hätte ihm das auch angetan, wenn er gesagt hätte: „Ich habe nicht viel gemacht, sechs Berichte geschrieben in neun Jahren.“ Ich hätte ihm das nicht geglaubt. Vielleicht wusste er selber nicht mehr, wie viel er geschrieben hatte. Ich hätte ihm die Freundschaft gekündigt, mit meinen Erfahrungen. Und das wusste er. Das wollte er nicht riskieren, und das finde ich auch richtig. Ich könnte mich heute bei ihm nicht mehr entschuldigen, weil er tot ist.
Caroline Fetscher: Mir leuchtet das sehr ein, aber darf ich Sie trotzdem fragen, Sie hatten ja geschrieben: Ich hätte ihn umarmt.
Herta Müller: Ich hätte ihn dazu gebracht, selbst seine Akte zu lesen. Aber ich hätte ihn auch umarmt, wenn ich gesehen hätte, dass… Es gibt ja Spitzeltypen. Wenn man viele Akten gelesen hat, dann weiß man das. Es gibt Leute, die denken mit der größten Normalität täglich. Es gibt Leute, die denken in größeren Zeitabschnitten. Der Geheimdienst hat sofort gemerkt, wer etwas taugt für ihn. Und wenn man gesehen hat, einer taugt nicht, hat man ihn soweit wie möglich in Ruhe gelassen, weil es nichts bringt. Und Pastior hat sich seine Unschuld abzwingen lassen, aber er hat offenbar trotzdem versucht, sich nicht schuldig zu machen, so weit es gegangen ist. Es gibt keine kriminelle Energie, es gibt kein Bedürfnis, kein einziges Bedürfnis, dass er sagt: „Ich habe jetzt Lust, ich will dem jetzt eins reinmachen.“ Es gibt auch kein Interesse, dass er sagt: „Ich bin beim Rundfunk und will jetzt Rundfunk-Abteilungschef werden“. Für all das, für das man etwas hätte tun müssen, hat er es nicht getan. Er hatte auch gar nicht die innere Möglichkeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, aber ich habe gedacht: Vielleicht war er früher mal ganz anders. Ich habe ihn ja nur als älteren Menschen gekannt. Ich habe ja nicht gewusst, was in den Akten steht. Wenn man die Akten gelesen hat, muss man individuell auf die Dinge schauen und seine Schlüsse ziehen. Ich glaube, das hat Oskar Pastior jeden Tag beschäftigt, und selbstverständlich ist das in seinen Büchern. Jeder von uns, der schreibt, ist in seinen Büchern. Jeder versteckt sich durch seine Literatur und outet sich durch seine Literatur. Und es ist doch bei jedem Text beides vorhanden. Warum soll es bei Pastior anders sein?
Inhalt
– Klaus Ramm: Zu diesem Band
– Ernest Wichner: „Unterschiedenes ist gut“. Der Dichter Oskar Pastior und die rumänische Securitate
– Oskar Pastior: Die Russlandgedichte
– Stefan Sienert: Der Kreis um Oskar Pastior in Bukarest
– Sabina Kienlechner: Kann ein Spitzel eine moralische Orientierungshilfe sein?
– Jacques Lajarrige: „Gedichte wissen mehr als man nicht weiß“. Oulipobiografische Annäherungen an die Geschichte bei Oskar Pastior
– Michael Lentz: „so ging die Spur in Verlur“. Einige Vermutungen zu Oskar Pastiors Poetik der Camouflage
– Thomas Eder: „Wie schuldhaft ist die Sprache, wenn und weil sie ja die Wirklichkeit ist?“. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Oskar Pastior und Heimrad Bäcker im Umgang mit Geschichte und der eigenen Biografie
– Diskussion
– Notizen
Zu diesem Band
Im Juni 2012 hätte im Berliner Rathaus zum zweiten Mal der Oskar Pastior Preis vergeben werden sollen. Stattdessen gab es eine Atempause, ein Innehalten in der kaum begonnenen Geschichte dieses Preises und der Oskar Pastior Stiftung, die ihn alle zwei Jahre vergibt: Statt der Preisverleihung fand im Literaturhaus Berlin zum Thema „Die Securitate und Oskar Pastior“ ein Symposion statt, das die Grundlage war für die in diesem Sonderband versammelten Texte.
Unter dem Titel „Versuchte Rekonstruktion“ fand sich in Pastiors Nachlass eine handschriftliche Notiz zu seinen Erinnerungen an den „Ekelkomplex“ Securitate, „wahrscheinlich einiges davon vergessen und verdrängt“. Vier Jahre nach seinem Tod wurde dann aber im Spätsommer 2010 bekannt, dass Oskar Pastior vom rumänischen Geheimdienst Securitate nicht nur bespitzelt und bedrängt, sondern von 1961 bis 1968 auch als Informant geführt worden war.
Als hätten nach dieser Nachricht die widerstreitenden Gefühle zwischen Erschütterung und Beklommenheit, Trauer und Nachfühlen nicht schon Unsicherheit genug geboten, schoss die dann von allen Seiten heftig hereinbrechende öffentliche Diskussion weit über die damals schon von Stefan Sienerth wie auch von der Stiftung sorgfältig dokumentierte Tatsache hinaus; sie gipfelte in dem ohne Beleg verbreiteten Gerücht, Pastior träfe durch seine Informantentätigkeit eine Mitschuld am Freitod des siebenbürgischen Dichters Georg Hoprich. Das führte schließlich auch zu massiven Einwänden gegen das Fortbestehen der Stiftung und speziell gegen die Vergabe eines Preises in Pastiors Namen.
Im Verlauf dieser ausufernden, von Spekulationen und Unterstellungen begleiteten Diskussionen hatte sich die Stiftung, selbst den haltlosesten Verdächtigungen und Forderungen gegenüber, in der Öffentlichkeit so weit wie möglich zurückgehalten. Vielmehr hatte sich ihre Tätigkeit in dieser Zeit ausschließlich darauf konzentriert, das Ausmaß der Verwicklung Pastiors in die Machenschaften der Securitate mit externer Hilfe so vorbehaltlos wie möglich zu erforschen und so detailliert wie möglich zu klären – wenn das denn überhaupt erreichbar sein kann. Die bisher erreichten Ergebnisse werden nun in diesem Band vorgelegt und in ihren zeitgeschichtlich bedingten Abhängigkeiten erörtert: als unverbindliche Orientierung für die literarische Öffentlichkeit oder auch als Selbstvergewisserung für die weitere Arbeit der Stiftung, keinesfalls aber zur Rechtfertigung. „Rechtfertigung und Verteidigung“ – so Oskar Pastior in einem Gespräch mit Stefan Sienerth – „zeitigen meist nur blöde Texte“.
Dennoch sieht sich der Stiftungsrat auch in der Pflicht, allen Anschuldigungen gegen die Person Pastiors bis ins Einzelne nachzugehen. Die Stiftung, testamentarisch von ihm verfügt, vergibt ja nicht nur den Preis, sondern sie hat sich auch um den Nachlass und um das Werk, also das Leben Oskar Pastiors zu kümmern; sie gehört nicht den Mitgliedern des Stiftungsrats, sie würde auch ohne ihn weiterbestehen, denn sie ist allein gebunden an Pastiors testamentarische Verfügung und an das jahrzehntelang jedem einzelnen kleinen Honorar abgesparte und heimlich in seine Stiftung eingebrachte Erbe.
Daher gab es gar keinen anderen Weg, als in zeitraubender kleinteiliger Archivarbeit die Aktenlage unvoreingenommen erforschen zu lassen. Im Archiv der CNSAS in Bukarest – einer Art rumänischer Gauck-Behörde – hat Corina Bernic tausende von Akten gesichtet; beim Bundesnachrichtendienst und beim Bundesverfassungsschutz, denen Pastior sich nach seiner Einreise in die Bundesrepublik – „rückhaltlos“, wie er später notierte – offenbart hatte, blieben die Nachforschungen ergebnislos, da es nach deren Auskunft dort keine Akten mehr zu Pastior gibt. Auch der Geheimdienst der USA hatte Pastior damals eingehend verhört, doch der Zugang zu den Akten des CIA ist so gut wie unmöglich; dennoch arbeitet Herta Müller weiter daran.
Nicht nur für die künftige Beurteilung der Person und des Autors Oskar Pastior ist diese akribische Kleinarbeit unumgänglich, sondern – mit mindestens der gleichen Dringlichkeit – auch für die Zukunft des Werks von Pastior, wenn man diesen Unterschied überhaupt machen will. „Ich bin, was ich schreibe“, hat er immer wieder gesagt. Und wenn er seine Dichtung nahezu programmatisch als „Spiel gebrannter Kinder“ empfunden hat, so ist diese Selbstauskunft nun um eine dunkle Dimension abgründiger geworden: keine Doppelexistenz, sondern Deportation und Securitate als ein und dieselbe Grunderfahrung von fortwährendem Ausgeliefertsein, von Ausweglosigkeit, Erniedrigung und Selbsterniedrigung, von Feigheit und List.
Sein scheinbar leichthändiges Schreiben war keine Befreiung, im Gegenteil: auch die Sprache erlebte Pastior als Zwangssystem, dem nicht zu entkommen ist. Er begegnete ihr mit den größten Skrupeln, „als ob man ,über‘ etwas reden könnte“. Deshalb darf sich die Suche nach mehr Sicherheit nicht nur auf die Akten richten (so wichtig das auch ist), sie darf Pastiors dichterisches Werk dabei nicht aus dem Blick verlieren, das Spiel eines gebrannten Kindes. „Spielen ist verzweifelter Ernst“, führte er diesen Gedanken fort: „Daher die Trauer des Verwirrens, und die Trauer des Entwirrens“. Die Trauer des Entwirrens, der auch wir uns nun nachträglich ausgesetzt sehen, findet allein in seiner Dichtung Platz, weil Oskar Pastior, wie Ernest Wichner kurz nach der Entdeckung der Verpflichtungserklärung geschrieben hat, „seine persönliche Existenz allein durch seine literarischen Entscheidungen, die für ihn auch ethische und moralische waren, für gerechtfertigt hielt“.
Diese Überlegungen bestimmten das Konzept des Symposions und dieses Bandes: einerseits die Präsentation der Forschungsergebnisse, verbunden mit zeitgeschichtlichen Darstellungen und kulturpolitischen Erörterungen, andererseits ein Block von Beiträgen zu Pastiors Werk und zu seiner von biografischen – wie er selbst sagt – „Unruheherden“ geprägten Poetik. Während des Symposions am 23. Juni 2012 folgte jedem dieser beiden Blöcke eine Diskussion, moderiert von Caroline Fetscher; einige für den Druck redigierte Ausschnitte daraus sind in diesem Band dokumentiert.
„Es ging, und es ging auch nicht, um eine kühle Rekonstruktion der ,Geschehnisse‘“, notierte Oskar Pastior vor 20 Jahren zu einem Gespräch mit Grete Löw, und er fügte hinzu:
Bewältigung hat, wie immer man es dreht, mit willentlicher Gewalt zu tun. Ich bleibe lieber in der vermeintlichen Schuld.
Klaus Ramm, Vorwort
Versuchte Rekonstruktion
unter diesem Titel fand sich im Nachlass von Oskar Pastior eine handschriftliche Notiz zu seinen Erinnerungen an den „Ekelkomplex“ Securitate, „wahrscheinlich einiges davon vergessen und verdrängt“. Vier Jahre nach Pastiors Tod wurde im Spätsommer 2010 eine von ihm unterschriebene Erklärung bekannt, in der er sich 1961 verpflichtete, Informationen an den rumänischen Geheimdienst zu liefern. Aber war Pastior ein für die Securitate wertvoller Informant oder war er seinen Verpflichtungen nur auf formale Weise nachgekommen? Der Sonderband analysiert alle bislang zugänglichen Materialien und bewertet diese im politischen und kulturellen Kontext der Zeit. Darüber hinaus gehen Lektüreversuche der Frage nach, wo und auf welche Weise sich die Securitate-Erfahrung in Oskar Pastiors Werk auffinden lässt.
edition text + kritik, Klappentext, 2012
Der Umschattete
– Oskar Pastior Schlechte Berichte, gute Gedichte: Eine Tagung in Berlin beschäftigte sich mit den Spitzeldiensten des Dichters. –
Oskar Pastior war kein besonders hilfreicher Informeller Mitarbeiter für die Securitate, den rumänischen Geheimdienst. So viel steht fest bei dem Symposion zu der Spitzeltätigkeit des rumänisch-deutschen Dichters, das die Oskar-Pastior-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus am Samstag in Berlin abhielt. Von 1961 bis zu seiner Flucht nach Deutschland 1968 lieferte IM Otto Stein alias Oskar Pastior der Securitate Berichte über seine Mitmenschen, sechs haben die Forscher bisher in Archiven des Geheimdienstes finden können.
Nach einer Einführung des Stiftungsvorsitzenden Klaus Ramm versucht Ernest Wichner zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass der Freund sich als Informant verpflichten ließ, mit einem Blick in die Biografie: 1945 wurde Pastior als 17-Jähriger für fünf Jahre in ein ukrainisches Lager verschleppt. Herta Müller erzählte diese traumatische Episode in dem Roman Atemschaukel (2009). Vier Jahre nach dem Tod des Dichters – er starb 2006 während der Buchmesse – entdeckt der Historiker Stefan Sienerth Securitate-Akten, aus denen klar hervorgeht, dass Pastior nicht nur beschattet wurde, sondern auch selbst beschattete. Sowohl Sienerth als auch Wichner betonen jedoch, dass Pastior kein besonders effizienter Spitzel gewesen sein kann, und die Autorin Corinna Bernic schließt sich dem an, wenn sie zwischen „nützlichen und unnützen“ Informanten unterscheidet. Damit liefern die Redner den Konsens für die restliche Tagung. Nur die Essayistin Sabina Kienlechner erinnert die etwa 60 Anwesenden, von denen die meisten Pastior gekannt zu haben scheinen, daran, dass ein Spitzel im Allgemeinen moralisch zu verurteilen sei, Ausnahmen verlangten nach Begründung.
In der Tat hätte es Möglichkeiten gegeben, die Mitarbeit zu verweigern. Beispiele dafür sind Schriftstellerkollegen wie Herta Müller, Richard Wagner oder Georg Hoprich. Dieter Fuhrmann konnte den Geheimdienst dank einer Nervenkrankheit von seiner Untauglichkeit für den Informantendienst überzeugen, Grete Löw, die wohl wegen ihres hohen Alters nicht an der Tagung teilnahm, ließ sich verhaften und wirft Pastior bis heute mangelnde Integrität vor. Es fällt auf, dass gerade diejenigen, die schlecht auf den Dichter zu sprechen sind, auf dem Symposion fehlen.
Nach der Mittagspause geht es um eine möglicherweise notwendige Neubewertung des poetischen Werks Pastiors. Vortragende sind die Literaturwissenschaftler Jacques Lajarrige und Thomas Eder sowie der Lyriker Michael Lentz. Alle drei lesen einen doppelten Boden in der lyrischen Akrobatik des Oulipo-Poeten und halten sich damit an die Aussage Pastiors: Man weiß mehr als man weiß und Gedichte wissen mehr, als man nicht weiß.
Auch von „Umschatteten“ ist bei Pastior einmal die Rede, zu den Beschatteten ist es da kein weiter Schritt.
Mit brillanten Sprachspielen und mephistophelischer Stimme spricht Lentz von einem Pakt des gegenseitigen Verleugnens, den Oskar Pastior als eine Art Überlebensstrategie mit seiner Zweitidentität IM Otto Stein beschlossen habe. Den Preis, den die Stiftung unter anderen Umständen am Samstag zum zweiten Mal verliehen hätte, würde Lentz allerdings ohne Zögern annehmen. Die Stiftung kann allem Anschein nach also so weitermachen wie bisher, der Vorsitzende Ramm ist erleichtert, er scheint eine Art gesellschaftliches Gerichtsverfahren erwartet zu haben.
In der abschließenden Diskussion meldet sich Herta Müller engagiert und emotional zu Wort: Pastior habe sich nicht hinter seiner Sprache versteckt, sondern die Lyrik als Medium verwendet, gerade um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Autorin wartet momentan noch darauf, Akten der CIA einsehen zu dürfen, dieser hatte Pastior seine Kollaboration 1968 mitgeteilt.
Der Fall bleibt also weiterhin zu recherchieren, aber niemand, der Oskar Pastior gekannt hat, fürchtet noch kompromittierende Enthüllungen. Von all den Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß scheint Oskar Pastior eine der hellgraueren Sorte zu vertreten und mit der dialektischen Formulierung „schuldlos schuldig“ hat der Dichter sich wohl selbst am treffendsten verurteilt.
Catarina von Wedemeyer, die tageszeitung, 25.6.2012
„Pappkamerad? – oder Komplize?“
– Fast zwei Jahre nach der Entdeckung der Informantentätigkeit des Büchner-Preisträgers Oskar Pastior widmete sich das Symposion Versuchte Rekonstruktion. Die Securitate und Oskar Pastior am 23. Juni im Literaturhaus Berlin diesem schwierigen Thema. Bei der Tagung, die die Oskar Pastior Stiftung zusammen mit dem Literaturhaus Berlin organisiert hat, behandelten die Referenten am Vormittag die Akten und Oskar Pastiors Geschichte in Rumänien sowie den moralischen Aspekt der Spitzeltätigkeit; am Nachmittag nahm man seine Texte unter die literaturwissenschaftliche Lupe. Beiderseits wurde man fündig: So wurden noch weitere Geheimberichte von Otto Stein (Pastiors Deckname) gefunden, und die Literaturwissenschaftler entdeckten in seinem Werk Spuren, die auf diese Tätigkeit hin gedeutet werden können. –
In seiner Begrüßung sprach der Vorsitzende der Pastior-Stiftung, Klaus Ramm, davon, dass es eigentlich Zeit gewesen wäre, den Oskar Pastior Preis zu verleihen, dass man sich aber zu einem Innehalten entschieden habe, zu einer Atempause, seit der Erschütterung und Beklemmung, die die Entdeckung der Täterakte Pastiors ausgelöst habe. Man habe sich darauf konzentriert, das Ausmaß seiner Mitarbeit zu klären, und wolle heute die Ergebnisse im Zusammenhang mit seinem Werk präsentieren, nicht losgelöst von seiner von Unruheherden geprägten Poetik.
In seinem gewissenhaft recherchierten Vortrag stellte Ernest Wichner, Leiter des Literaturhauses Berlin und Freund Pastiors, den jetzigen Wissensstand über die Aktenlage dar. Es seien insgesamt nur sechs Berichte gefunden worden, zwei davon über seinen Bekannten und späteren Kritiker Dieter Schlesak, der ihn denunziatorisch, so Wichner, der Mitschuld am Selbstmord Georg Hoprichs beschuldigt habe (später nahm Schlesak diese Behauptung zurück): „Oskar Pastior taucht in Georg Hoprichs Akte weder vor seiner Verhaftung noch nach seiner Freilassung und bis zu seinem Selbstmord im April 1969 auf“, so Wichners Fazit. Die zwei Berichte in Schlesaks Akte, namentlich der eine, in dem Pastior ihn der Sympathie zur westlichen Poesie bezichtigte, seien aber wertlos, zumal das Interesse für die moderne westeuropäische Literatur damals, 1966, keine Gefahr mehr dargestellt habe. Dieter Schlesak war leider nicht anwesend, um dazu Stellung zu nehmen, wie vom Publikum bemängelt wurde. Auch die weiteren Berichte sollen größtenteils für die Securitate unbrauchbar gewesen sein. Auf den einzigen denunziatorischen Bericht hatte bereits Stefan Sienerth in den Spiegelungen hingewiesen, er stelle die Bukarester Germanistin Ruth Kisch in einem schlechten Licht dar, so der Leiter des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS). Ruth Kisch hatte Pastior ermahnt, so die Aktenlage laut Wichner, engagiertere Gedichte zu schreiben. Insgesamt ist es also eine magere Ausbeute gemessen an 214 Seiten der Opferakte von Pastior und im Vergleich zu anderen „engagierteren“ Spitzeln. Dies wurde von der Kulturmanagerin und Übersetzerin Corina Bernic, die ihrerseits Hunderte von Akten studiert hatte, im Wesentlichen bestätigt. Sie richtete den Blick auf Rumänien, auf den Fall Pastiors, der die Öffentlichkeit dort eben nicht bewegt. „IM Otto Stein hat total unbrauchbare Berichte der Securitate geliefert“, unterstrich Bernic. Und anlässlich der Errichtung einer Skulptur von Adrian Păunescu konstatierte sie: „Eine Welt, wo Ceauşescus Hofdichter gepriesen und Oskar Pastior als Otto Stein etikettiert wird, ist eine verkehrte Welt.“ Stefan Sienerth, vor knapp zwei Jahren Entdecker der Securitate-Akte, richtete sein Augenmerk auf Oskar Pastior als Verfolgten, im Dichterkreis, der sich in seinem Hause traf, an dem Georg Hoprich, Richard Adleff und Ingmar Brantsch teilnahmen. Dieter Schlesak gehörte auch am Rande dazu. Obwohl die Gruppierung nicht politisch agierte, kein Programm und kein Presseorgan hatte, wurde sie trotzdem von der Securitate beobachtet und Georg Hoprich wurde verhaftet.
Die Essayistin Sabina Kienlechner analysierte aus moralphilosophischer Perspektive, wie ein Spitzel zu beurteilen ist, wobei sie sich vor allem auf den IM Walter alias Werner Söllner und die Aktionsgruppe Banat bezog. Sie bedauerte, dass Spitzel, die sich offenbarten, besser behandelt würden als solche, die gar keine Spitzel gewesen seien. – Anmerkung der Verfasserin: Trotz des Unterschieds zu Werner Söllner, der wohl nicht mehr die schweren Repressalien aus den 60er Jahren befürchten musste, kann man als Außenstehender einwenden, dass Pastior sein ganzes Leben lang versäumt hat, Buße zu tun. Wer allerdings den Presserummel um die Entdeckung seiner Spitzeltätigkeit im September 2010 verfolgt hat, kann dunkel erahnen, warum.
„Kein Dementi schafft Nachrichten aus der Welt“, schrieb Pastior einmal. Ob er sein Leben lang deswegen ein schlechtes Gewissen hatte, darüber kann man nur spekulieren, auf jeden Fall hat er durch seine Offenbarung gegenüber den deutschen Behörden (Bundesgrenzschutz) versucht, reinen Tisch zu machen, wie einer Notiz aus dem Nachlass zu entnehmen ist, so Wichner. Doch ob dort oder eventuell auch bei der CIA etwas aktenkundig wurde, blieb unklar.
Herta Müller erleichtert
Umso interessanter war der zweite Teil der Tagung, in dem Jacques Lajarrige und Michael Lentz, jeder auf seine Weise, in Oskar Pastiors Werk nach Spuren suchten. Der Germanist Jacques Lajarrige fand nicht nur in den frühen Gedichten, wie etwa „Verhör“, sondern auch in den späteren, etwa in den Petrarca-Gedichten, einen biografischen Hintergrund, wobei er mahnte, vorsichtig zu sein und nicht in die Realismusfalle zu tappen. Er schälte einen Subtext heraus, zwar verstreut in den diversen Texten, der aber durchaus als Kommentar zu Pastiors Spitzeltätigkeit zu werten sei. Dabei meine die Zeile „Pappkamerad? – oder Komplize?“ aus den Petrarca-Gedichten sehr wohl den papierenen Kameraden Petrarca, sie könne sich aber auch auf die anderen Dichter beziehen, die Pastior bespitzeln musste.
Der Lautpoet Michael Lentz untersuchte ebenfalls Pastiors Texte „auf der Folie seiner Spitzeltätigkeit“ und definierte ihn als latenten Komplizen Otto Steins. Zur Sprache kam auch die staatstragende Poesie, „sozialistisch-realistischer Agitprop“, den Pastior auch geschrieben hat. Lentz sprach von einer „Poetik der Latenz“ bei Pastior, denn er musste zugeben: „Man wird bei Oskar Pastior keinen Text finden, der über seine Spitzeltätigkeit ohne Umschweife spricht“, seine Texte seien „erhellend dunkel“.
Thomas Eder stellte sich mit Oskar Pastior die Frage, wie schuldhaft Sprache sei, wobei er sich aber eher auf die Sprache des Nationalsozialismus bezog, die von den Opfern verwendet wurde, aufgrund von Heimrad Bäckers „nachschrift“. Offen blieb die Frage, „ob die Schuld, die der einzelne auf sich geladen hat, ausgelöscht werden kann durch einen avantgardistischen Umgang mit Sprache, wie bei Oskar Pastior“.
Insgesamt war es eine differenzierte und auch literaturwissenschaftlich sehr ergiebige Tagung, die das Dilemma um diesen ambivalenten und großen Dichter nicht auflöste, sondern im Gegenteil ausgeleuchtet hat. Der Tenor ging jedoch in Richtung einer Entlastung. Die Diskussionen haben gezeigt, dass noch viele Fragen offen blieben. Mehr Kontroverse hätte sich allerdings auch Klaus Ramm gewünscht. Herta Müller, die auch im Publikum anwesend war, gab zu, froh zu sein, dass ihr Freund Pastior, mit dem sie an ihrem preisgekrönten Roman Atemschaukel zusammengearbeitet hatte, ihr nichts von seiner Informantentätigkeit gesagt hatte. Sie hätte ihm die Tür zugeknallt und nichts gewusst, weil man die Akten damals noch nicht lesen konnte. Sie hätte ihm nicht geglaubt und ihm die Freundschaft gekündigt. Nachher bekräftigte sie jedoch, dass sie ihn dazu gebracht hätte, seine Akte zu lesen und dass sie ihn umarmt hätte. Denn es gebe angesichts der Spitzeltypen, bei Oskar Pastior keine kriminelle Energie, kein Bedürfnis und kein Interesse. Er habe offenbar versucht, sich nicht schuldig zu machen, soweit es gegangen ist. Wenn man die Akten gelesen habe, müsse man individuell auf die Dinge schauen. Natürlich fände sich das auch in seinen Büchern wieder. „Gerade um sich damit auseinanderzusetzen, hat er so geschrieben und zwar natürlich alles. Er war der genaueste Mensch, den ich kenne, und er hat millimeterweise gedacht. Und dieses Problem hat er immer mit sich herumgeschleppt“, so die Nobelpreisträgerin. Im November sollen die Vorträge in der Zeitschrift Text und Kritik veröffentlicht werden
Die Oskar Pastior Stiftung wird sich in zwei Jahren entscheiden, ob der gleichnamige Preis vergeben wird und wie sie weiterhin mit diesem nicht unumstrittenen Erbe umgehen wird. Das Symposion war ein guter Ansatz zur Aufarbeitung. Es hat gezeigt, dass man es einerseits mit einer dürftigen Aktenlage zu tun hat, zur weitgehenden Erleichterung, was die Täterakte betrifft, und andererseits mit einem verschlüsselten Werk. Was einen immer wieder auf die Texte zurückwirft und was Oskar Pastior sich vielleicht für sich selber auch so gewünscht haben mag. Um mit seinen Petrarca-Worten zu schließen, denn „auch Poesie ist Nachricht“:
Entworfen also – und dann aufgestellt, genau, und freigegeben: Pappkamerad? – oder Komplize? Da fällt Sonne, da schmilzt Schnee, da ist ‚Wachs‘ ein Notwort für ‚Bestürzung‘.
Edith Ottschofski, Siebenbürgische Zeitung, 4.7.2012
Schluchten des Argwohns
– Die Wogen schlugen hoch, als herauskam, dass Oskar Pastior einst Zuträger der Securitate war. Ein Forschungsvorhaben soll nun aufklären, was der verstorbene Büchner-Preisträger getan hat – und was nicht. –
Wer war Oskar Pastior? Ein großer Dichter? Ein schwacher Mensch, der denunzierte und darüber schwieg bis in den Tod? Sechs Berichte des Informanten „Stein Otto“ sind nun gefunden worden in den hinterlassenen Aktenbergen des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Nicht gerade viel für die hohe Erregung, die im Spätsommer 2010 die Nachricht auslöste, der 2006 verstorbene Dichter Oskar Pastior sei unter diesem Decknamen ein Securitate-Zuträger gewesen. Er soll, schlussfolgerten einige allzu rasch, enge Freunde und Kollegen verraten und in ernste Gefahr gebracht haben, was sich jedoch, nachdem Tausende Aktenseiten gesichtet und überprüft worden sind, nicht bestätigt hat. Trotzdem schlugen damals die Wogen hoch, es taten sich, wie Pastior im Gedicht „Die Karte“ notiert hatte, „Schluchten des Argwohns“ auf.
Denn der Dichter war Büchner-Preisträger und hoch verehrt, zudem ein enger Freund von Herta Müller, an deren Roman Atemschaukel, für den sie den Nobelpreis erhielt, er bekanntlich mitgearbeitet hat. Auch wenn Pastiors Gedichtbände nie auf Bestsellerlisten gerieten, blieb sein Erfolg nicht unbeneidet; und so schienen plötzlich viele Rechnungen offen, begann das in den Labors des Lügenimperiums Securitate entwickelte Gift des Misstrauens und der Verunsicherung zuverlässig wieder zu wirken. Das ging sehr weit, sogar seine Dichtung wollten einige grundsätzlich in Frage stellen.
„Versuchte Rekonstruktionen“
Die Oskar-Pastior-Stiftung gab schließlich ein Forschungsprojekt in Auftrag, um tatsächliche Verstrickung von bloßem Verdacht zu scheiden und Klarheit darüber zu gewinnen, was damals, in den sechziger Jahren des poststalinistischen Rumänien, wirklich geschah. Erste Ergebnisse wurden jetzt im Berliner Literaturhaus vorgestellt; im November wird außerdem ein ausführlicher Sonderband der Literaturzeitschrift TEXT+KRITIK dazu erscheinen. Versuchte Rekonstruktion, der Titel auch des Symposions, bezieht sich auf eine handschriftliche Notiz aus Pastiors Nachlass, die seit 2007 immer mal wieder auch öffentlich erwähnt wurde.
1992, die Akten waren noch nicht zugänglich, notierte Oskar Pastior genau, wonach eines Tages in seinen Securitate-Akten, „diesem ekelkomplex“, zu suchen sei: etwa das erste Securitate-Verhör, zu dem man ihn unter dem Vorwand, eine Künstler-Agentur wolle ihm etwas vorschlagen, regelrecht verschleppte – was der Aktenbericht seines Führungsoffiziers inzwischen bestätigt; ob er eine Verpflichtungserklärung unterschrieben habe, wie oft und unter welchen Umständen er danach „geholt“ wurde und „wer oder was dabei zur Sprache kam“.
Wertloser Bericht
Das alles liegt nun vor und kann bald vollständig nachgelesen werden. Unter den von der Securitate als wertlos eingestuften Berichten findet sich nach Einschätzung der beiden Germanisten Ernest Wichner und Stefan Sienerth, die Pastiors Securitate-Akten und die anderer rumäniendeutscher Intellektueller sichteten, einer mit denunziatorischem Inhalt. Darin berichtet „Stein Otto“ über die Germanistin Ruth Kisch, sie habe sich geweigert, zwischen sowjetischen und amerikanischen Atomversuchen zu unterscheiden.
Die in dieser Zeitung von Dieter Schlesak, Schriftsteller und Literaturkritiker, aufgestellte Behauptung, Pastior habe den Selbstmord seines engen Freundes und Dichterkollegen Georg Hoprich mitzuverantworten, weil er ihn verriet – was Schlesak mit Geschichten vom Hörensagen zu beweisen glaubte –, ist durch Securitate-Akten nicht belegt. Ernest Wichner nennt Schlesaks Unterstellung darum eine Denunziation. Das innige Freundschaftsverhältnis Schlesaks zu Pastior wiederum bezweifeln viele – und die Akten bestätigen das – genauso wie die von Schlesak beschworene Gefahr, man habe ihn als Kopf einer Widerstandsgruppe gesehen. In den Akten jedenfalls, so Ernest Wichner, finde sich dafür kein Beleg. Die zwei an sich wertlosen Berichte von „Stein Otto“ über Schlesak der Jahre 1965 und 1966 werden demnächst publiziert.
Der schuldlos schuldige Pastior
Pastiors IM-Akte, die sich im Bukarester Archiv des Nationalrates zum Studium der Securitate-Akten (CNSAS) befindet, sei ungewöhnlich, sagt Wichner. Sie versammele auf 214 Seiten nur Material, das gegen den Dichter und seine Familie hätte verwendet werden können. Pastior sei umstellt gewesen von Informanten, darunter seit 1957 einige seiner Lehrer, und er habe zu Recht befürchten müssen, wieder verhaftet zu werden. Eine genaue Skizze seiner Wohnung befindet sich in der Akte, die Namen all seiner Besucher und Kopien der abgefangenen Briefe.
Bis zu seinem Tod hielt sich Pastior für „schuldlos schuldig“ an vielem, was er nicht aufklären konnte, das aber als Erpressungsmaterial diente. So wähnte er sich mitschuldig an der Tragödie einer Jugendfreundin, die seine antisowjetischen Lager-Gedichte versteckte und 1959 verurteilt wurde. Dass es andere Gründe waren, die zu ihrer Verhaftung führten, wie die Akten jetzt offenbaren, hat er nicht mehr erfahren.
Mitarbeit durch Erpressung
Die mageren Berichtsfunde sind nur einzuordnen, wenn man sich die Situation vergegenwärtigt, in der sich der ehemalige Lagerhäftling Pastior und sein Freundeskreis in den späten fünfziger Jahren befanden. Stefan Sienerth (München), der an einer literaturhistorischen Studie über diesen privaten Zirkel arbeitet, rekonstruiert ihn nicht nur aus den Akten, sondern auch aus den Werken der Freunde, Zeitschriften und Fachliteratur. Die Geheimakten jedoch, so Sienerth, dokumentierten am eindeutigsten diese literarische Periode.
In Berlin skizzierte er auch die Vorgeschichte: die großartigen Lehrer, zumeist jüdische Intellektuelle, die Pastior, Georg Hoprich, Ingmar Brantsch, Dieter Fuhrmann und andere in Bukarest fanden; die Schauprozesse, die nach dem niedergeschlagenen Ungarn-Aufstand 1956 die Bevölkerung einschüchterten – ein Instrument, das man auch bei den Bukarester Studenten und späteren Schriftstellern anwenden wollte. Einige von ihnen hat man mit dieser Drohung zur Mitarbeit erpressen können, auch Oskar Pastior; andere weigerten sich. Aber auch Sienerth betont, dass es der Securitate trotz immensen Aufwandes nicht gelungen sei, die Freunde aufeinander anzusetzen.
„Mir ist die Sprache zerbrochen“
Als Pastior 1968 von einer Reise in den Westen nicht mehr nach Rumänien zurückkehrte, ließ ihn die Securitate als Informanten streichen. Er sei als solcher lustlos und unzuverlässig gewesen und „seinen Verpflichtungen nur auf formale Weise nachgekommen“, sollte darum auf die „Arbeitsebene“ überführt werden. Man schickte ihm also verschiedene Spitzel hinterher. Der in Deutschland so intensiv diskutierte Fall Pastior habe in Rumänien kaum jemanden interessiert, sagte die Publizistin Corina Bernic aus Sibiu, die in den Securitate-Archiven forscht. Auch sie bestätigt, dass die Kommentare der Führungsoffiziere zu den Spitzelberichten und die Intensität, mit der sie geliefert wurden, ein Urteil über den Wert eines IM erlauben. „Stein Otto“ habe, anders als Dieter Schlesak behauptete, zu den unbrauchbaren Quellen gehört.
Ob sich in Pastiors Gedichten Spuren dieser verzweifelten Jahre vorder- oder untergründig finden lassen, wird die Literaturwissenschaft noch lange beschäftigen. Herta Müller hat sie, die frühen wie die späten, nie anders gelesen, weil sie wusste, woher ihr Dichterfreund kam. Jeder Künstler verstecke und offenbare sich zugleich in seinem Werk, sagte sie jetzt im Literaturhaus. „Mir ist die Sprache zerbrochen im Lager“, habe Oskar Pastior ihr hundertmal gesagt, eine neue musste er sich also erfinden. Er sei ein „Verurteilter im Freigang“ geblieben, der um sein Leben schrieb. Seine Securitate-Verstrickung jedoch, erinnerte Herta Müller, habe Pastior nach seiner Flucht 1968 nicht ohne Grund einer offiziellen Institution, dem Geheimdienst, anvertraut. Dort sei er den „ekelkomplex“ losgeworden und damit nicht mehr erpressbar gewesen. „Ich aber bin froh, dass er es mir nicht gesagt hat“, erklärte sie den überraschten Zuhörern, „ich hätte ihm doch, nach meinen eigenen Erfahrungen, damals nicht geglaubt!“ Am Ende hätte sie ihm die Freundschaft aufgekündigt, unverzeihlich, nachdem nun die Akten offenliegen.
Regina Mönch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.6.2012
Ferne Zeitgenossen (I)
– Oskar Pastiors verhasste Träume. –
Für mich sind Träume eine unschätzbare, ja, unverzichtbare Bereicherung, aus der ich nicht zuletzt beim Schreiben … für das Schreiben immer wieder produktive Impulse beziehe, abgesehen davon, dass Traumzeit keineswegs nur verlorene Lebenszeit ist, sondern zugleich ein wundersamer, dabei ganz und gar realer Gewinn an Lebensraum, nicht euklidisch, versteht sich, aber als eine mögliche Welt mit eigenem Wirklichkeitsstatus.
Um so mehr war ich erstaunt, wenn nicht befremdet, als Oskar Pastior einst bei einem privaten Gespräch in seiner Berliner Wohnung auf einen Traumbericht (oder ein Traumgedicht?) von mir mit einem zornigen Ausbruch reagierte: Der Traum, das Träumen sei für ihn „das Letzte“, er hasse Träume, und er verachte alle Kunst, vorab die des Surrealismus, die mit Träumen arbeite und daraus einen „völlig unkünstlerischen“ Nutzen zu ziehen versuche.
Pastiors Ausbruch war so heftig, dass ich damals annahm, er hasse Träume nicht nur, er fürchte sie auch. Ich stellte ihm keine Fragen dazu, vermied es auch, von eigenen Träumen zu reden, lenkte das Gespräch statt dessen auf den Film … auf einige zu jener Zeit aktuelle Kinofilme, doch Pastior warf sofort ein, er sehe sich ausschliesslich TV-Krimis an: TV-Krimis mit ihren rational konstruierten Plots und ihrem stets absehbaren Finale seien für ihn „das Gegengift“ für seine Albträume. Und ganz unerwartet, um mir „zu zeigen, was das alles für ein Blödsinn ist“, erzählte er, was er „eben mal wieder vergangene Nacht“ geträumt habe:
Er sei mit M. F. am See spazieren gewesen, habe einen flachen Kiesel aufgehoben, um ihn mit einem kräftigen Schwung übers Wasser springen zu lassen, aber nein … aber ja, zuvor habe er mit einem dicken schwarzen Filzschreiber („oder war’s ein Stück Kreide?“) eine Botschaft auf den Kiesel gekritzelt („wie bei einer Flaschenpost!“), nämlich diese: „Schlag, mein Herz, du bist nicht Stein.“
Also was? Nichts als Blödsinn?
Erst viele Jahre danach wurde bekannt, dass Oskar Pastior unter dem Agentennamen „Stein“ als IM bei der rumänischen Securitate registriert war: Staatssicherheit!
Felix Philipp Ingold, aus Felix Philipp Ingold: Endnoten. Versprengte Lebens- und Lesespäne, Ritterverlag, 2019
Konrad Klein über Grete Loew, der Oskar Pastior seine Gedichte in Rumänien anvertraut hatte.
Herta Müller über Oskar Pastior in Aspekte am 24.9.2010.
Zu Gast bei Ernest Wichner: Wer moralisch integer blieb. Alexandru Bulucz besucht Ernest Wichner
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram +
Gespräch 1 & 2 + Johann-Heinrich-Voß-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skibas Autorenporträts + deutsche FOTOTHEK
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Interview mit Oskar Pastior für das Haus des Deutschen Ostens.
Interview mit mir. Diese Aufnahme beinhaltet ein poetologisch dichtes, leider aber nicht realisiertes Interview von Christian Prigent mit Oskar Pastior, dass vermutlich für die von Christian Prigent herausgegebene französische Zeitschrift TXT geführt wurde.
Lesung Oskar Pastior am 20.7.2005 im Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Herta Müller: Mein Freund Oskar
Franz Josef Czernin: Die Regel, das Spiel und das Andere. Zum Werk Oskar Pastiors.
Oskar Pastior liest aus seinen verschiedenen Texten und Übersetzungen ein Programm, das die Sprachbewegung jeweils in der Konzentration auf einzelne Laute und Buchstaben nachvollzieht. Aufgenommen auf einem mehrtätigen Festival mit dem Titel Für die Beweglichkeit im Kunstverein Maerz in Linz.
Zum 60. Geburtstag von Oskar Pastior:
Jochen Hieber: Die Suppe ist einmalig
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1987
Herbert Wiesner: Frauen-Bild-Beschreibungsschrift
die tageszeitung, 20.10.1987
Hans Bergel: Vom Rückzug der Sprache auf sich selbst
Siebenbürgische Zeitung, 31.10.1987
Zum 65. Geburtstag von Oskar Pastior:
Hannes Schuster: Ein „Wörtlichnehmer“, der das Wörtlichnehmen ertragbar macht
Siebenbürgische Zeitung, 15.11.1992
Zum 70. Geburtstag von Oskar Pastior:
Bettina Knauer/Gunnar Och (Hg.): Oskar Pastior, 70
Akzente, 1997
Herta Müller: Minze Minze
Die Zeit, 17.10.1997
Franz Mon: „die krimgotische Schleuse sich entfächern zu lassen“
Der Literaturbote, 2004
Jörg Drews: Eros & Callas?-: Ein Echo-Kollaps
Süddeutsche Zeitung, 20.10.1997
Zsuzsanna Gahse: Schwitt, Schwitter, am Schwittersten
Stuttgarter Zeitung, 20.10.1997
Harald Hartung: Jalousien aufgemacht!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1997
Paul Jandl: Die Hosenträger der Erkenntnis
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.1997
Cornelia Jentzsch: Gimpelschneise in der Winterreise
Berliner Zeitung, 20.10.1997
Dorothea von Törne: Der Meister der Wortlust
Der Tagesspiegel, 20.10.1997
Ernest Wichner: Magier der Vernunft
Frankfurter Rundschau, 20.10.1997
Thomas Krüger: hart pommern die fritten
Die Woche, 31.10.1997
Gerhard Mahlberg: Aus Anlaß seines 70sten Geburtstags am 20. OktoberDeutschlandradio
Zum 75. Geburtstag von Oskar Pastior:
Thomas Kling: Die Ballade vom defekten Kabel
Literaturen, Heft 10, Oktober 2002
Thomas Kling: Die glühenden Halden
Frankfurter Rundschau, 19.10.2002
Nachrufe auf Oskar Pastior: NZZ ✝ FAZ ✝ BZ ✝ Der Tagesspiegel ✝
Die Welt ✝ der Freitag ✝ die horen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ✝ AdK ✝
Chimaere ✝ Schreibheft
Weitere Nachrufe:
Nico Bleutge: Ein Verwandlungskünstler der Sprache
Stuttgarter Zeitung, 6.10.2006
Michael Braun: Vom Sichersten ins Tausendste
Basler Zeitung, 6.10.2006
Michael Krüger: Schamane des Experimentellen
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Christine Lötscher: Er verzauberte die Sprache und Menschen
Tages-Anzeiger, 6.10.2006
Martin Lüdke: Aus dem Staub gemacht
Frankfurter Rundschau, 6.10.2006
Peter Mohr: Ein Magier der Sprache
Badische Zeitung, 6.10.2006
Lothar Müller: Der Zungenzwinkerer
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Hubert Spiegel: Im Exil bei Freunden
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.10.2006
Fakten und Vermutungen zu Oskar Pastior + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1, 2 & 3
und zum IM Stein Otto
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK +
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Oskarine ist ein Gedicht-Generator von Ulrike Gabriel, der auf den Gedichten von Oskar Pastior basiert. Jedes Gedicht spricht sich selbst – immer neu und mit der Dichter-Stimme.


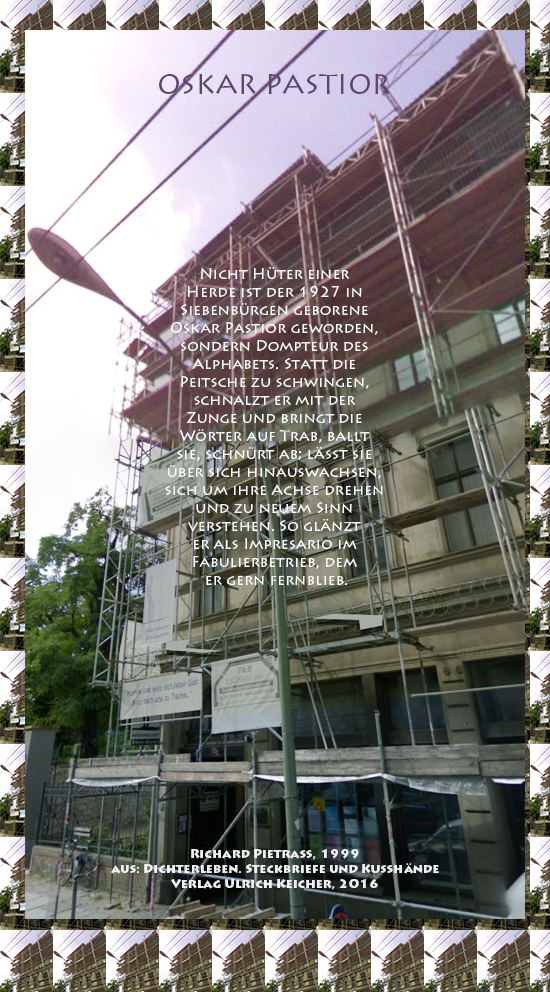












Schreibe einen Kommentar