Ernst Jandl: der beschriftete sessel
DER BESCHRIFTETE SESSEL
aaaaaaaaaaaaaaaaaafür harry & angelika
ich haben ein sessel
stehn JANDL groß hinten drauf
wenn ich mal nicht wissen
sein ich’s oder sein ich’s nicht
ich mich nur hinsetzen müssen
und warten bis von hinten wer
kommen und mir’s flüstern
Nachbemerkung
daß sich dein leben zu
buchstaben verhärtet, du
wolltest es nicht so haben.
e. j.
Dahin ist es gekommen, unwiderruflich: Nicht nur Autor und Text sind dem Leser Ernst Jandls auf immer verknüpft, sondern vor allem die Existenz der Person des Autors und die in ihr – in dieser durchaus privaten Existenz – formulierten Aussagen. Das Gedicht und sein Autor – ein Gleiches? Oder: Das Verschwinden des Autors in seinem Gedicht?
Wer die Texte dieses Bandes in ihrer chronologischen Abfolge wahrnimmt, wird seit der Mitte der siebziger Jahre gravierende Veränderungen, notwendige Verluste erkennen. Jandls Gedichte verlieren ihre – zum Teil spielerische – Konstruktivität, die auch ein Signal von Freiheit war, von freier Verfügbarkeit des Materials Sprache. Der Abstand zwischen Autor und Text wird tatsächlich geringer:
Man könnte sagen, daß der Autor unter Umständen dazu kommt, daß er sich letzten Endes selbst als Material verwendet und schaut, was er da herausbringt. (Jandl, 1983)
Jandl schreibt auf ein Ende hin; das Grimassierende, Überdeutliche seiner späten Arbeiten wird zunehmend automatisiert; eigentlich wäre es gut zu schweigen, im Leben und in der Literatur. In seiner Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises (1984) zitiert Jandl aus Dantons Tod:
„… wozu sollen wir Menschen miteinander kämpfen? Wir sollten uns nebeneinandersetzen und Ruhe haben. Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden, es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür, wir werden es einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns drum die Leiber aufbrechen.“ Das ist ein Wort zum Frieden, welches unsere Unvollkommenheit, unsere Fehlerhaftigkeit, unser vorauszusetzendes Scheitern einbezieht. Mehr wird für uns nicht zu erreichen sein, als uns nebeneinanderzusetzen und Ruhe zu haben.
Wer nichts mehr sagt, keine Überzeugungen, Ideologien, Utopien mehr zu vermitteln sucht, der hat den Kampf beendet; das wäre ein – letztes – humanes Ziel. Das Schreiben allerdings geht weiter:
Ich könnte mir also einen Autor vorstellen, der bis zuletzt schreibt und sich dann eine Kugel in den Kopf schießt oder ein Schlafmittel nimmt. Nehmen Sie Jean Améry: das war ja nicht ein Mann, der jahrelang resigniert geschwiegen und sich dann plötzlich umgebracht hätte. Sondern eigentlich hat er bis zuletzt gearbeitet. Er hat sich trotzdem als Person ständig diesem Punkt genähert, als Person und nicht unbedingt als Schreibender. Der Schreibende ist also offenbar ein Teil dieser doch etwas komplexeren Person. Keiner ist nur ein Schreibender, auch wenn er es vielleicht gerne wäre. Die Resignation könnte man sehr weit treiben, ohne deswegen aufzuhören zu schreiben. (Jandl, 1983)
Vor fast vierzig Jahren hat Ernst Jandl mit dem Schreiben begonnen; seine ersten Gedichte veröffentlichte er mit sechsundzwanzig Jahren in der von Friedrich Polakovics geleiteten Literaturzeitschrift Neue Wege. Andere Augen, ein erster Gedichtband, in einer Auflage von eintausend Exemplaren im Bergland Verlag erschienen, fand in der Literaturkritik kaum Beachtung. Erst mit dem Erscheinen von Laut und Luise (1966) erregte Jandl die Aufmerksamkeit der Medien. Seitdem ist er für viele zum Inbegriff des agilen und konzilianten Promotors sprachexperimenteller Literatur geworden. Das mußte zu Mißverständnissen führen: Zu keiner Zeitwaren die Verfahren „konkreter Poesie“ für Jandl etwas Absolutes; hier wie in den Traditionen des Lautgedichtes oder der visuellen Wortkunst sah er Wege, heraus aus einer scheinhaften, allzu oft verlogenen Abbildnerei, die der Illusion ganzheitlichen Denkens und Lebens immer erneut Vorschub leistete.
Das Zentrale seines großen Werkes scheint mir bis zum heutigen Tag die Abbrucharbeit am Überbau Sprache zu sein; das hat nichts Dramatisches, aber – erschreckend – Konsequentes.
Daß dieses Leben keine Geheimnisse birgt – welches denn täte es? –, jedoch genug, das mir die Zunge lähmt, die Kehle schnürt… Wovon also ließe sich berichten? Einzig doch von Gedichten, solange sie nicht darangehen, ihren Autor in Stücke zu reißen. Er drückt sie an sich, und er hält sie zugleich von sich ab, indem er sie auf Wege befördert, auf die er selbst den geringsten Einfluß besitzt, hinaus zu den Menschen. Dort dann zeigen sie sich in ihrer je eigenen Gestalt und lassen sich vernehmen in ihrer je eigenen Sprache, und vergessen, wenn es nach seiner Absicht ginge, ihren Autor. (Jandl, 1978)
Die hier vorgelegte Auswahl zeigt in der Chronologie ihrer Drucklegung Gedichte aus mittlerweile vierzehn Bänden. Der Autor kennt die Konzeption der Auswahl und hat sie gebilligt. Die Radierungen des Chemnitzers Thomas Ranft sind keine Illustrationen, sie stellen Korrespondenzen zu Texten her und dokumentieren eine Arbeitsbeziehung.
Dieses Buch ist ein Gruß des Verlages, des Grafikers und des Herausgebers an Ernst Jandl, der am 1. August 1990 fünfundsechzig Jahre alt wurde.
Klaus Pankow, Nachwort, August 1990
Beiträge zu diesem Buch:
heb: [Rezension zu „Der beschriftete Sessel“]
Stuttgarter Zeitung, 10.5.1991
Anonym: [Rezension zu „Der beschriftete Sessel“]
Der Morgen, 18.5.1991
Thomas Böhme: „die freude an mir“
Leipziger Volkszeitung, 31.5.1991
Thomas Böhme: Lust auf Jandl
Ostthüringer Zeitung, 12.10.1991
Peter Dittmar: Spiel mir das Lied vom Schatten!. Können die ostdeutschen Verlage ihr hohes Niveau bei der Buchillustration halten?
Die Welt, 22.6.1991
Achim Engel: Ernst Jandl: der beschriftete sessel
Stadtmagazin Insinde Magdeburg, Heft 10, 1991
Ulf Heise: Er „erfaßt die Sprache als Körpergeräusch“
Thüringer Tagblatt, 17.7.1991
Ulf Heise: Gegen das Possierliche in der Dichtung
Neue Zeit, 20.7.1991
Lothar Lang: Nachtwachen bei Reclam
Weltbühne, Heft 38, 10.9.1991
Ulf Heise: Sprache als Körpergeräusch
Chemnitzer Tageblatt, 13.9.1991
Anonym: Lyrik aus Leipzig. Reclam Ost hat sich Beachtung verdient
Westdeutsche Zeitung, 9.1991
Alexander von Bormann: Der Sund, die Sünde
Der Tagesspiegel, 13. 10. 1991
„Die Unwiederholbarkeit gilt für jedes gelungene Gedicht“
– Gespräch mit Ernst Jandl am 18.8.1987 in Wien. –
Siegfried J. Schmidt: Ernst, wie schätzt Du die Situation der gegenwärtigen Literatur, gesehen vielleicht auch im Zusammenhang mit der Kunst, insgesamt ein? Ist das für Dich eher ein Zwischenspiel, was sich im Moment auf dem literarischen Sektor tut, oder siehst Du eine konsequente Entwicklung der Literatur in den letzten Jahrzehnten?
Ernst Jandl: Ich glaube, es ist sehr schwierig, über eine konsequente Entwicklung der Literatur einer bestimmten Zeit – und noch dazu der Jahrzehnte, die bis zum gegenwärtigen Moment führen – zu reden. Man sieht verschiedene Strömungen nebeneinander herlaufen. Man merkt vielleicht oder kennt aus seiner eigenen Arbeit diesen oder jenen Punkt, wo solche Strömungen einander berühren und aufeinander Einfluß ausüben. Es ist, glaube ich, auch aus der gegenwärtigen Sicht nicht feststellbar, ob eine Epoche von 20 oder 30 Jahren bis jetzt eher Zwischenspielcharakter hat oder nicht. Es fragt sich überhaupt, ob diese in der Literaturgeschichte übliche Betrachtungsweise von Bergen und Tälern, von einem Hinauf zu einem Höhepunkt und einem Hinab und dann einem neuen Anlauf in eine neue Höhe, überhaupt der Literatur oder den Künsten entspricht. Das einzige, was feststellbar sein dürfte, ist der Ernst und die Überzeugung, mit der Schriftsteller arbeiten. Es mag Zeiten geben, in denen es weniger Leute dieser Art gibt und in anderen mehr. Aber das ist eine Frage der Statistik, mit der ich mich nicht beschäftigen möchte. Ich glaube, daß die gegenwärtige Literatur wohl in allen Sprachräumen, die als literarisch produktiv betrachtet werden, von einer großen Zahl von Autoren ernsthaft in der verschiedensten Weise betrieben wird. Andererseits gibt es zahlreiche filterartig funktionierende Instanzen, die den Blick der Öffentlichkeit – soweit sie sich für Literatur interessiert – auf eine ausgewählte Menge literarischer Phänomene und literarischer Persönlichkeiten zu lenken versucht.
Schmidt: Dabei müssen Qualitätskriterien in irgendeiner Weise berücksichtigt werden.
Jandl: Ich glaube, daß Qualitätskriterien überall berücksichtigt werden, sowohl bei der Arbeit der Autoren wie bei der Selektion, die auf die verschiedenste Weise und in der verschiedensten Richtung geschieht durch Personen, die sich der kritischen bzw. der wissenschaftlichen oder mehr oder minder wissenschaftlichen Literaturbetrachtung widmen. Sie alle haben Qualitätskriterien. Ob es ein absolutes Qualitätskriterium gibt, das letzten Endes moralisch gesehen das einzig wirksame sein dürfte, kann ich nicht sagen, bezweifle es aber sehr.
Schmidt: Nun gibt es ja neben der Auffassung von Bergen und Tälern auch die Auffassung, daß in der gegenwärtigen Situation eine völlige Pluralität von Möglichkeiten da ist, und sich jeder Schriftsteller aus diesem Arsenal von Möglichkeiten relativ frei bedienen kann. Das hieße also: im gegenwärtigen Zeitpunkt ist alles gleichzeitig möglich. Man kann nicht mehr von maßgeblichen Trends reden, vielleicht höchstens in bezug auf den Buchmarkt, aber nicht in bezug auf die interne Entwicklung der Literatur. Würdest Du einer solchen Einschätzung zustimmen!
Jandl: Mit gewissen Einschränkungen. Es ist alles möglich, wozu Personen, die schreiben, sich entschließen und imstande sind. Es ist alles möglich, wozu Personen, die Literatur verbreiten, sich entschließen und imstande sind, wobei unter dieser Gruppe von Verbreitern von Literatur die Kritiker, die Wissenschaftler die Verleger, die Herausgeber von Zeitschriften usw. zusammengefaßt werden müssen.
Schmidt: Und wie, meinst Du, reguliert sich die Entscheidung des einzelnen Autors? Bleiben wir einmal bei den Autoren, die Du als ernsthafte Autoren bezeichnen würdest, die glaubwürdig sind in ihrem Geschäft. Glaubst Du, daß es eine Art von persönlicher Affinität zu bestimmten literarischen Möglichkeiten gibt? Hängt diese ab von literarischen Sozialisationen, also eher von zufälligen Entscheidungen und Entwicklungen, oder muß es da einen notwendigen Zusammenhang geben, damit man sagen kann: das ist eine authentische, glaubwürdige, überzeugende Lösung, unabhängig davon, in welchem literarischen Ausdrucksfeld sich jemand bewegt?
Jandl: Der Weg, den ein Autor schreibend einschlägt, ist zweifellos zu jeder Zeit bestimmt von Tendenzen innerhalb seiner Persönlichkeit – also von dem, was er als Mensch ist – was wieder sehr eng mit Sozialisation zusammenhängt, also mit allem, was durch die Gesellschaft, durch die Umwelt, durch die Familie usw. in ihn eindringt und von ihm so oder so beurteilt, verwertet oder verworfen wird. Und es ist mehr oder minder abhängig von der Literatur der Vergangenheit wie der Gegenwart, zu der er sich hingezogen fühlt, die wenigstens in einer gewissen Phase seines Schreibens, aber auch u.U. immer wieder im Verlaufe seines literarischen Arbeitens, für ihn eine starke Anziehungskraft besitzt, also, m.a.W., für ihn etwas wie einen Modellcharakter hat, wobei er sich lernend dem Moment mehr oder minder stark annähern wird, dann aber einiges gelernt habend sich vom Modell möglichst weit distanzieren wird, um seine eigenen Möglichkeiten mit Hilfe des Erlernten zu entdecken und zu realisieren.
Schmidt: Nun gibt es ja bei der Einschätzung solcher Möglichkeiten für jeden Autor Vorlieben und Abneigungen, die verbunden sind mit persönlichen Bewertungen. Du hast sicher bestimmte Literaturentwicklungen, die Du weniger akzeptierst, für weniger interessant hältst. Viele Deiner Arbeiten sind ja auch in einer bewußten Konfrontation mit anderen Möglichkeiten entstanden. Was sind für Dich literarische Möglichkeiten, die in der gegenwärtigen Situation oder während der Zeit, in der Du geschrieben hast, uninteressant waren?
Jandl: Ich meine, daß alles, worin man als Schreibender eine Möglichkeit sieht, interessant ist. Wobei Möglichkeit hier doch eingeschränkt ist auf Möglichkeit für einen selber. Die von anderen als Möglichkeiten gesehenen Wege, in denen man selbst überhaupt keine Möglichkeit erblickt, erscheinen vielleicht überhaupt oder alsbald als wenig interessant oder ganz uninteressant. Dabei gibt es gewiß Literatur, die ich selber nicht ernsthaft als eine Möglichkeit für mich betrachte und die mir doch zeitweise Vergnügen bereiten kann, Dinge, die mich unterhalten, Dinge, die mir Spaß machen, Dinge, die ich spannend finde. Vorausgesetzt ich befinde mich in einem Zustand, in dem ich solcher Beruhigungsmittel oder Stimulanzien bedarf. Dann plötzlich erlischt das Interesse daran, kann aber durchaus wiederkommen in einer bestimmten persönlichen Situation. Es gibt z.B. zweifellos Möglichkeiten realistischen Erzählens, des Erzählens einer Geschichte, vom Umfang der Short Story angefangen bis zum Roman. Im 20. Jahrhundert wurde vor allem auch von angelsächsischen Autoren ein Areal abgesteckt, das man als Bereich realistischen Erzählens bezeichnen könnte. Und es gibt viele jüngere Autoren, die sich einen eigenen Platz in diesem Gebiet schreibend zu erkämpfen suchen. Um aus meiner bescheidenen Kenntnis Namen zu nennen, die das Areal sozusagen abgesteckt haben: Ein Graham Greene ist sicherlich ein vorzüglicher Erzähler spannender Romane, spannender Begebenheiten. Ein Evelyn Waugh ein Kenner der menschlichen Seele mit einem außerordentlichen Humor. Und dieses Gebiet – ich habe jetzt an einem extremen Punkt angefangen – erstreckt sich natürlich bis zum ULYSSES von James Joyce oder bis zu BERLIN ALEXANDERPLATZ von Döblin und bis zu erzählenden Werken von Virginia Woolf oder William Faulkner. Dieser Bereich erscheint mir unerschöpflich. Unerschöpflich nicht so, daß ich meinen würde, es sei alles, was man dafür braucht und was man in diesem Bereich machen könnte, in unerschöpflicher Fülle da, und man müsse nur sich in den Bereich begeben und Material, das noch niemand anderer ergriffen hat, ergreifen; sondern von allen Seiten, vom Leben aller Menschen, von den gesellschaftlichen und politischen Umständen und Veränderungen, von allen Bereichen der Wissenschaft her erfolgt eine ständige ungeheure Zufuhr von möglichem Material realistischen Erzählens. Ich meine, daß auch die Sprache, die sich ja in einem permanenten Prozeß der Veränderung und der Erweiterung befindet, eine Unzahl an Möglichkeiten für realistisches Erzählen offenhält, wobei ich allerdings glaube, daß extreme Leistungen auf diesem Gebiet – wie etwa der ULYSSES von James Joyce oder BERLIN ALEXANDERPLATZ oder die Werke von Virginia Woolf oder Faulkner – einer Literatursprache als Basis bedürfen, die jede Generation sich neu zu erarbeiten hat, wie sie aber gewiß in Werken der genannten Autoren Graham Greene und Evelyn Waugh da ist, ohne daß man hier von außergewöhnlichen Eingriffen in die Sprache selbst sprechen könnte.
Schmidt: Siehst Du diese Möglichkeitsfülle für nichtrealistisches Erzählen auch?
Jandl: Ich weiß nicht recht, was ich mir unter nichtrealistischem Erzählen vorstellen soll, nachdem ich den ULYSSES von James Joyce zu den Meisterwerken realistischen Erzählens zähle.
Schmidt: Ich meine mit nichtrealistischem Erzählen z.B. Versuche, ohne eine erzählte Story auszukommen.
Jandl: Ich glaube nicht, daß das Erzählen unbedingt eine Story zur Voraussetzung hat. Das Erzählen ist auf jeden Fall ein Nacheinander, also ein – wenn man will – linearer Vorgang, der in dieser Weise auch durch den Leser aufgenommen wird, wobei nicht gesagt ist, daß der Autor in dieser Weise beim Schreiben seiner Erzählung verfährt, also einfach linear weitergeht; das geschieht in vielen Fällen nicht, was übrigens auch für Erzählungen mit einer Story oft genug der Fall ist. Um Deine Frage kurz zu beantworten: Ich sehe für die Möglichkeiten einer Erzählung ohne Story, also ohne eine nacherzählbare oder herauslösbare Story, die wie eine Art Gerippe die Erzählung durchzieht, und die ich auch durchaus als realistisch bezeichnen könnte – das hängt davon ab, wie weit man den Realismus faßt – ich sehe die Möglichkeiten dafür mindestens genauso groß wie für Erzählen auf der Basis einer Story.
Schmidt: Aber was wäre denn nichtrealistisches Schreiben?
Jandl: Nichtrealistisches Schreiben wäre das Schreiben, das sich auf die Realität der Sprache zu beschränken sucht und bewußt die Einwirkung außersprachlicher Realität zu vermeiden bestrebt ist. Wie weit sich das verwirklichen läßt, ist eine Frage. Nichtrealistisch erzählen heißt z.B., unsemantische Wortfolgen zu erzeugen, mit unsemantischen Zusammenhängen. Die Bedeutung ist zwar vom Wort nicht abzulösen; die Wörter können aber so aneinandergereiht werden, daß sich keine syntaktisch-semantischen Gebilde ergeben. Wenn man in dieser Weise fortfährt, lassen sich Abschnitte, Absätze und Prosakomplexe machen, die z.B. dem Prosarhythmus der gesprochenen Sprache mehr oder minder angenähert sind. Man liest diesen Text und ist am Ende durch diesen Text durchgegangen, hat permanent Eindrücke empfangen, die sich aber nicht zu einem abschließenden Bild formen. Ich denke an gewisse Texte von Gertrude Stein zum Beispiel, wo im Text keine konturierten Einzelheiten, keine Personen, keine Bilder vorkommen, wo von Story keine Rede ist, keine Vorgänge geschildert werden, sondern Sprachabläufe da sind, deren Reiz – sofern einer da ist – entdeckt werden muß, von einem Leser entdeckt werden muß, der an sprachliche Abläufe dieser Art zuerst einmal nicht gewöhnt ist. Und diese Texte müssen stark genug sein, d.h. die Reize auf den Leser müssen stark genug sein, um diese Barriere des Gewohnten zu durchbrechen. Das muß von beiden Seiten her geschehen. Und ich glaube, daß etwa Texte von Gertrude Stein stark genug sind, um das zu tun, vorausgesetzt sie finden einen Leser, der bereit ist, auch von seiner Seite diese Barriere des Gewohnten zu durchbrechen. Ähnlich einem Bild ohne Fixpunkt, ohne Konturen, eine Fläche flimmernd von Flecken.
Schmidt: Nun hat man gegen diese Art von literarischen Möglichkeiten eingewendet, das sei eine einmal zu vollziehende Möglichkeit, die nicht wiederholt werden könne. Diese Durchbrechung der gewohnten Erwartungen an Literatur, des gewohnten Schreibens von Literatur, sei historisch einmal zu leisten ähnlich wie die Duchampschen Entdeckungen innerhalb der Bildenden Kunst. Aber das seien keine Möglichkeiten, die man genauso fortsetzen könnte wie realistisches Erzählen. Und ein Schriftsteller wie Alfred Andersch hat sogar einmal gesagt, ein Schriftsteller, der keine Geschichten erzähle, sei inhuman.
Jandl: Anderschs Kritik läßt m.E. völlig außer acht, daß das Material, aus dem solche Texte gemacht sind, ein zutiefst humanes Material ist. Nur der Mensch verfügt über dieses Material. Er hat dieses Material produziert. Es ist sein eigenes Material, mehr als das Material irgend einer anderen Kunst. Und damit ist schon diese Behauptung des Inhumanen vom Material her – glaube ich – unhaltbar. Gerade diese Texte, bei denen man nicht in eine Situation gerät, wo man Literatur vergißt und Personen begegnet, in Handlungen verwickelt wird, in Vorgänge, Vorfälle verwickelt wird, Länder kennenlernt, sich in einer fremden Stadt befindet, – diese Literatur zeigt in jedem Moment nichts anderes als Literatur, und zwar Literatur als Kunst. Und das kann ich nur als zutiefst human bezeichnen. Es geht dabei um eine Darstellung, eine Selbstdarstellung von Kunst als einer vorn Menschlichen nicht zu trennenden Art von Tätigkeit. Also mit Begriffen wie human und inhuman kann man hier m.E. überhaupt nicht operieren, sondern die Begriffe human und inhuman sind nur anwendbar auf erzählende Literatur, wo z.B. unter gewissen politischen Aspekten dazu inhumane Literatur geschrieben werden kann, die etwa Gewalttat und Krieg verherrlicht oder Völkermord legitimiert. Das geschieht und ist geschehen auf dem Gebiet der erzählenden Literatur. Und das wird von bestimmten politischen Systemen forciert, in denen Literatur nur eine weitere Art der Machtausübung ist. Und gerade in solchen Systemen hat dann die Literatur, die ihre erste Aufgabe darin sieht, sich als Kunst aus Sprache zu zeigen, es unerhört schwer oder wird überhaupt jeder Möglichkeit der Verbreitung beraubt.
Schmidt: Darf ich noch mal zu dem Punkt kommen, daß Arbeiten wie die von Gertrude Stein oder etwa FINNEGAN’S WAKE nur als einmalige literarische Leistung möglich aber nicht wiederholbar sind.
Jandl: Die Unwiederholbarkeit gilt für jedes gelungene Gedicht.
Schmidt: Ja, das gilt sicher für jedes gelungene Gedicht als ein Gebilde. Aber wenn man jetzt mal einen bestimmten Schreibstil als literarische Entwicklungsmöglichkeit ansieht, also etwa die Art, wie Joyce in FINNEGAN’S WAKE mit über 20 Sprachen wie mit großen mythologischen Zusammenhängen umgegangen wird: Läßt sich so etwas in Form dieser Möglichkeit – ich will nicht sagen wiederholen, aber weiterentwickeln? Oder sind das bestimmte Endpunkte der Entwicklung, die nicht mehr wiederholbar sind, sondern die nur durch Neuansätze beantwortet werden können?
Jandl: Viele literarische Produkte, viele künstlerische Produkte sind Endpunkte einer Entwicklung – große wie kleine. FINNEGAN’S WAKE, wohl auch ULYSSES, sind Endpunkte. Es ist vielleicht überhaupt nicht richtig, dabei von Entwicklung zu sprechen. Endpunkte einer Entwicklung: das ist vielleicht irreführend. Sie sind Endpunkte, sie sind unwiederholbar. Aber man kann Anregungen der verschiedensten Art daraus erfahren, um dann etwas anderes weiterzumachen. Ich glaube, man kann Literatur nicht so sehen, als gäbe es nur einen Weg, oder als sei irgendeine Art von Literatur ein Weg, wo man Schritt für Schritt von Station zu Station – wie auf einem Kreuzweg – bis zur Kreuzigung gelangt, und damit ist der Endpunkt erreicht, vielleicht auch die Grablegung. Das glaube ich nicht. Aber es gibt natürlich ein Panorama, wenn man so will, ein sich veränderndes Panorama. Und der Mont Blanc ist Mont Blanc und wird nicht wiederholt, und der Himalaja ist der Himalaja und wird nicht wiederholt, und der Dachstein ist der Dachstein.
Schmidt: Wir haben anfangs über literarische Möglichkeiten gesprochen, die für den einzelnen interessant und ergiebig sind. Wenn Dir ein Autor Texte schickt und Dich bittet, dazu etwas zu sagen, was sagt Du ihm, was kannst Du ihm sagen? Was sind Deine Gesichtspunkte, fremde Texte zu beurteilen?
Jandl: Ich bekomme mehr Post, als ich lesen kann. Ich bekomme zuweilen auch Post von jungen Autoren, die mir mehr oder minder umfangreiche Proben ihrer Arbeit schicken. Die größten Schwierigkeiten habe ich mit Texten, die sich mehr oder minder offen auf mich, auf meine eigene Arbeit berufen. Die sind meistens ganz schlecht, oder ich habe das Gefühl, sie seien ganz schlecht. Aber ich kann das leider nur so von außen sagen. Ich lese mir das durch und sortiere mir – wenn man so will – die Gedichte nach solchen, die mir gefallen oder die etwas enthalten, was mir gefällt, und solchen, die mir mißfallen, oder die etwas enthalten, was mir mißfällt, und versuche dann, dem Autor zu schreiben, warum mir dies oder jenes gefällt oder mißfällt. Die mögen nun von jemandem sein, der noch nicht zu einem eigenen guten Gedicht gelangt ist. Aber auch an imperfekten Gedichten, die er mir geschickt hat, mag ich Stellen entdecken, die ich für gelungen halte. Dann werde ich ihm entsprechende Hinweise geben, die ihm vielleicht weiterhelfen. Es können aber auch Gedichte sein, an denen ich nichts Positives feststellen kann. Und dann muß ich sie zurückschicken und erklären, daß ich mich nicht für kompetent halte, diese Gedichte zu beurteilen. Ich habe keine Kriterien. Ich habe Kriterien nie von den Texten selber abstrahiert. Es ließe sich wohl tun. Aber ich habe keine Veranlassung gesehen, mir einen Katalog von aus Texten abgelösten Kriterien aufzustellen. Ich beurteile aufgrund meiner Erfahrung mit bestimmten Texten, also z.B. mit Gedichten. Und nichts anderes kann gewünscht sein oder verlangt sein oder erwartet werden, wenn ein beginnender Autor einem endenden Autor eine Auswahl seiner Gedichte schickt mit der Einstellung: Du hast mir so und so viele Jahrzehnte voraus, du hast so und so viel veröffentlicht, du hast dafür den einen oder anderen Preis bekommen, jetzt schau dir mal das an, was sagst du aufgrund deiner Erfahrung dazu. Redlicherweise kann man nicht mehr verlangen.
Schmidt: Nun werden Dir ja nicht beliebige Autoren ihre Texte schicken, sondern ich nehme an, die Dir Texte schicken, haben das Gefühl, daß sie in irgendeiner Weise besonders affin mit Deinem Werk sind.
Jandl: Nicht nur. Aber vielleicht in der Mehrzahl.
Schmidt: Gibt es dabei auch richtige Jandl-Imitationen?
Jandl: Das gibt es. Aber die sind eigentlich immer sehr schlecht, genauer gesagt, sie gefallen mir nicht. Ich will ja keine Imitatoren, ich will nicht zur Imitation anregen. Aber das eine oder andere gelungene Produkt, das sich auf irgendeine Anregung von mir zurückführen läßt, das würde mich schon freuen. Wenn das, was ich geschrieben habe, überhaupt keine Ausstrahlung auf andere, auf nachkommende jüngere Schreibende haben kann, ist das ein gewisser Mangel. Aber Kinder haben es gekonnt. Mit „Ottos Mops“ haben Kinder ganz hübsche Sachen gemacht. Und wenn von diesen vielen Kindern eines – das ist vielleicht auch eine zu große Hoffnung – sich weiter mit Sprache beschäftigt, und sei es auch nur aus dem Bewußtsein heraus, aus dem es meinetwegen „Hannas Gans“ geschrieben hat, dann wäre das schon etwas.
Schmidt: Mit Deinem Namen, mit Deinem Werk ist in den letzten gut 30 Jahren eine bestimmte Entwicklung verbunden. Du hast gerade gesagt, es wäre schön, wenn jemand sich durch einen Text wie „Ottos Mops“ hätte anregen lassen; wie siehst Du Dein eigenes Werk in der Rückschau auf die Literatur der letzten Jahrzehnte?
Jandl: Ich möchte da noch sagen, gerade durch „Ottos Mops“ haben sich ja Kinder anregen lassen, das ist eine Ausnahme. Hier habe ich Beispiele von Texten gefunden, die aus der Anregung durch ein bestimmtes Gedicht von mir entstanden sind. Aber daß jemand durch Gedichte wie „Schützengraben“ oder „Ode auf N“ oder andere angeregt worden wäre, das habe ich eigentlich nicht gesehen, vielleicht habe ich es nicht wahrgenommen. Vielleicht sind das auch die ungeeignetsten Beispiele für eine Anregung. Nun zu Deiner Frage: Wie sehe ich meine Literatur im Gesamtzusammenhang. Sie nähert sich an gewissen Stellen der konkreten Poesie. Vieles davon gehört in den Bereich der experimentellen Dichtung, wenn man den Begriff experimentelle Dichtung überhaupt verwenden mag. Ich weiß, manche tun es nicht, indem sie sagen: Ein Experiment ist eine unabgeschlossene Sache. Ein Experiment ist eine Sache, bei dem man schaut, was herauskommt, und Experimente werden solange durchgeführt, eine Serie von Experimenten wird solange durchgeführt, bis man das hat, was man eigentlich will. Was soll also der Begriff experimentelle Dichtung? Ich verwende den Begriff trotzdem; denn es entspricht durchaus der Herstellungsweise meiner Gedichte, der Dinge, die ich selbst schreibe, daß man einmal schaut, was daraus wird. Daß ich also nicht schon weiß, was daraus wird, weiß was werden soll, sondern einfach schau, was daraus wird. Oft wird nichts daraus. Ich schau halt, was draus wird, was draus werden kann. Und wenn ich es dem Publikum präsentiere, so schau ich auch, ob etwas daraus wird. Und das Publikum, das sich bei Lesungen meine Gedichte oder meine Texte anhört, scheint mir auch daran interessiert zu sein, ob etwas daraus wird. Nämlich ob etwas daraus bei dem Zuhörer, bei ihm als Zuhörer, bei ihr als Zuhörerin geschieht. Und wenn das der Fall ist, dann wird meistens gelacht. Das heißt also, gelacht wird nicht nur, weil es so lustig ist, weil es so komisch ist, sondern gelacht wird auch, wenn es funktioniert hat. Ich bin nicht derjenige, der sein Werk jetzt in den Gesamtkomplex hineinstellt, um dann nun sozusagen seine eigene Stelle im Panorama zu bestimmen. Ich glaube nur, daß wo immer diese Stelle meines Werkes sich befindet, die Stelle meiner Texte sich befindet, diese Stelle doch – wie groß immer und wie klein immer sie sein mag – eindeutig markiert ist als meine eigene Stelle. Und nicht nur deswegen, weil ich mir das so sehnlich gewünscht hätte, sondern doch aus gewissen Gründen, die mir vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch bewußt sind, z.B. daß experimentelle Literatur ein gewisses unterhaltsames Moment besitzen kann. Daß sie verbunden sein kann mit Spaß, mit Humor, aber auch mit den verschiedensten menschlichen Gefühlen, auch dunklerer Art, und daß man auch mit großen Abweichungen – sowohl von der Normalsprache wie von der Poesiesprache – ja gerade mittels solcher Abweichungen Menschen sehr direkt treffen kann.
Dann habe ich vielleicht aus Unvermögen, es anders zu tun; gezeigt, daß man im Laufe eines Lebens Gedichte – aber dies im Laufe eines Lebens soll nicht wieder eine Entschuldigung sein, die Sachen laufen oft parallel – daß man sich mit Gedichten verschiedener Art beschäftigen kann. Daß es – jedenfalls für mich – nicht darum geht, konkret zu sein und zu bleiben, falls ich es je war. Ich bin ein Autor, der sich eigentlich immer mit kleinen Formen beschäftigt hat. Auch durch das Stück AUS DER FREMDE hat sich für mich da gar nichts geändert. Denn das Stück ist schließlich eine Aneinanderreihung von Dreizeilern. Literarische Großformen sind meine Sache bisher nicht gewesen und werden es wohl auch nicht sein. Ich sehe mich im Gesamtzusammenhang der gegenwärtigen deutschsprachigen Lyrik. Und ich glaube, daß ich eine Reihe von Gedichten geschrieben habe, die zwar nicht da wären, wenn ich sie nicht geschrieben hätte, ohne daß sie jedoch jemandem fehlen würden.
Schmidt: Das sagst Du.
Jandl: Erst wenn sie jetzt verschwinden würden. Wenn sie verschwinden würden und im Bewußtsein der Menschen noch irgend etwas davon da wäre, würde man vielleicht merken, da fehlt eines oder da fehlen zwei.
Schmidt: Wie ist eigentlich Dein Verhältnis zu Literaturkritikern und Literaturwissenschaftlern? Hast Du das Gefühl, fair behandelt zu werden?
Jandl: Ich glaube, daß beide eine ganz wichtige Funktion haben. Die Literaturkritiker sortieren den Buchmarkt – die Frankfurter Buchmesse meinetwegen – und bringen Möglichkeiten der Überschaubarkeit. Wenn man sich mit Literaturkritikern und ihrem Schreiben eingehender befaßt als ich es tue, wird man – und das wird jedem so gehen, der sich damit befaßt – alsbald merken, welchen Kritikern man eher folgt, wer also für einen schreibt, und wer eben einen anderen Teil des Leserpublikums sortierend bedient. Für die jeweilige Gegenwart ist die Literaturkritik eine sehr notwendige Sache. Die Literaturkritik trägt dazu bei, daß man Autoren und ihre Werke bemerkt. Und die Literaturwissenschaft hat einen ganz großen Anteil daran, daß Werke der Literatur am Leben erhalten bleiben, Werke lebender Autoren und Werke toter Autoren. Und daß dieser ganze Fundus an Literatur, der sich da so anhäuft durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte, immer wieder durchwühlt und immer wieder neu geschichtet wird. Literatur, so wie sie heute produziert wird, wie sie heute verbreitet wird, ist mir ohne eine Fortsetzung dieser Art von Literaturkritik und Literaturbetrieb, der ja schon ziemlich lange anhält, ist mir auch ohne Literaturwissenschaft überhaupt nicht vorstellbar.
Schmidt: Wenn Du die gegenwärtige Situation betrachtest, wo sind für Dich interessante Entwicklungen?
Jandl: Ich tue mich schwer mit dem Wort Entwicklung. Ich betrachte mit einigem Interesse das epische und dramatische Werk von Thomas Bernhard. Ich bin sehr betroffen von Stücken von Heiner Müller. Ich finde den Weg, den Friederike Mayröcker von kurzer experimenteller Prosa zu einer großen epischen Form ohne Story gefunden hat, sich erarbeitet hat, ganz außerordentlich. Ich halte das abgeschlossene lyrische Werk von Reinhard Prießnitz für das vielleicht überzeugendste Beispiel einer nachkonkreten Lyrik.
Schmidt: Und von den Jüngeren?
Jandl: Ich nenne zwei Lyriker: Franz Josef Czernin und Ferdinand Schmatz. Und als Prosaschreiber G.F. Jonke, Bodo Hell, Liesl Ujvary. Als Lyriker fallen mir noch Thomas Kling und Peter Waterhouse ein.
Schmidt: Wie siehst Du die Arbeiten Deiner Generationsgenossen, vor allem aus dem Umkreis der Wiener Schule, aus dem Umkreis der konkreten Dichtung? Jetzt nicht in der Einschätzung dessen, was sie von den 50er bis zu den 70er Jahren gemacht haben, sondern eher in dem, was sie heute produzieren?
Jandl: Ich schätze sehr hoch ein die Arbeiten von Gerhard Rühm auf verschiedenen Gebieten. Etwa auf dem Gebiet des Hörspiels. Sein Hörspiel über das Waldsterben hat mich äußerst beeindruckt. Seine Arbeit insgesamt ist für mich immer sehr interessant, spielt sich auf einem sehr hohen Niveau ab und ist äußerst konsequent. Ich schätze das Werk von Heinz Gappmayr. Hier wird wirklich ein ganz extremer Punkt erreicht. Das letzte, was ich von Achleitner kenne, ist der QUADRATROMAN. Der liegt schon einige Zeit zurück, ist ein erstklassiges Werk. Von Helmut Heißenbüttel gefallen mir die eher erzählende Prosa und die langen Gedichte gut. Der ist sehr witzig. Artmann hat – soweit ich die Dinge kenne – ein hohes Niveau gehalten. Und das typisch Artmannsche ist weiterhin ganz lebendig. Oskar Pastior hat sich m.E. an die Spitze der experimentellen Lyrik gestellt. Ludwig Harig ist ein ganz massiver Erzähler geworden, der hinreißende Sonette schreiben kann und schreibt. Von Eugen Gomringer habe ich erst vor kurzem in einem Ausstellungskatalog ein neues, sehr überzeugendes konkretes Gedicht gelesen, gesehen.
Schmidt: Die experimentelle Literatur hat ja lange als randständig gegolten. Siehst Du, daß diese Literatur die gegenwärtige Literaturszene nachhaltig beeinflußt hat?
Jandl: Sie ist da. Das ist alles, was man verlangen kann.
Schmidt: Und dann geblieben.
Jandl: Und dann geblieben. Und es gibt Literatur von Rang, die ohne die experimentelle Literatur nicht vorstellbar wäre. Aber es war für mich eigentlich nie zu erwarten, daß die experimentelle Literatur sozusagen den Gesamtbereich der Literatur erobert. Genausowenig wie ich erwartet hätte, daß die konkrete Poesie das je tun könnte. Ich meine, wir haben noch einiges zu erwarten an Aufzuarbeitendem, was aus der DDR kommt. Ich nenne Papenfuß-Gorek oder Sascha Anderson. Da wird noch einiges ans Licht kommen.
Schmidt: In den 70er Jahren ist ja sehr viel über die soziale Rolle der Schriftsteller gesprochen worden. Du selber hast dich ja auch z.T. stark engagiert. Siehst Du da, daß sich Dinge zum Guten verändert haben oder wie sähe Deine Utopie einer besseren Situation für Schriftsteller aus?
Jandl: Es haben sich in Österreich sicherlich Dinge verbessert, was, sagen wir, z.B. das Stipendienwesen (Preise aus öffentlichen Mitteln) betrifft und den Sozialfonds für Schriftsteller. Das sind große Veränderungen, große Verbesserungen. Ich muß sagen, eine Utopie einer für den Schriftsteller besseren Gesellschaft habe ich nicht, sehe ich nicht. Die beiden Extreme, mit denen man sich hier beschäftigen muß, sind die folgenden: Jeder, der schreibt, ist Schriftsteller und: aus einem langwierigen, harten, zuerst eigenen Enrwicklungsprozeß und von einem gewissen Punkte an Konkurrenzkampf kamen dann einzelne Schriftsteller heraus. Das Ganze irgendwie unter einen befriedigenden Nenner zu bringen, erscheint mir unmöglich. Schriftsteller als Beruf, da würde ich sagen: für jeden, der es sich leisten kann. Aber am lautesten kommt dieser Ruf nach dem Schriftsteller als Beruf von der Gruppe, von der Vielzahl derer, die sagen: wer schreibt, ist Schriftsteller. Ich bin Schriftsteller, ich schreibe. Dafür gibt es keine Lösung. Außer, die Schriftstellerei wird insgesamt auf den Status eines Hobbys erhoben, Schriftstellerei, Verlegerei wird ein Hobby. Freizeitgestaltung für alle, denen es Spaß macht.
Schmidt: Du glaubst, das ist die Entwicklung in den nächsten Jahren?
Jandl: Nein, sicher nicht. Dann ist es aus.
Schmidt: Also würdest Du auf jeden Fall sagen: Schriftstellerei ist nur als Hauptberuf möglich?
Jandl: Nein. Nein, das würde ich nicht sagen. Sondern Schriftstellerei, sagen wir lieber Literatur, muß in einem überaus harten Konkurrenzkampf sich durchsetzen. Der Konkurrenzkampf beginnt – das habe ich schon gesagt – bei einem gewissen Punkt. Ihm geht voran eine Phase des persönlichen Kampfes, des Kampfes mit sich selber, des Kampfes mit dem eigenen Leben und des Kampfes mit der Literatur, die einem gefällt.
Schmidt: Also Deine Vorstellung ist eher, daß es sich um eine Art von selbstregulierendem System handelt, in dem Literatur Literatur nicht nur produziert, sondern auch kontrolliert und auswählt?
Jandl: Man kann, glaube ich, nicht sagen, daß Literatur von außen her von irgendeiner Macht gesteuert würde. Sondern das geschieht natürlich im sich in ständiger Bewegung befindenden Großbereich Literatur, in dem letzten Endes alle drin sind, die sich mit Literatur beschäftigen. Mit dem Schreiben von Literatur, dem Rezipieren von Literatur, dem Kritisieren, dem Verbreiten von Literatur. Und da drängen immer neue hinein. Einigen gelingt es für einige Zeit, anderen überhaupt nicht. Einige etablieren sich. Plötzlich sind manche davon weg. Ich meine, ich sehe das ganze nicht isoliert von der übrigen menschlichen Welt. Die Literatur ist kein Konzentrationslager. Sondern sie steckt mittendrin. Aber über Distanzen hinweg gibt es dann die Brücken, die Verbindungen, die Informationswege und die Kämpfe. Aber ich glaube, das ist sowieso völlig klar.
Schmidt: Es gibt ja schon Vorstellungen, die ich nicht teile, aber die vertreten werden, daß Literatur weitestgehend von den Verlagen bestimmt, von Kritikern gesteuert wird. Da gibt es Stimmen dafür und dagegen. Die einen sagen: die Kritiker haben einen relativ geringen Einfluß. Andere sagen: sie haben zwar geringen Einfluß auf die materielle Verbreitung, aber einen großen Einfluß auf die Bewertungsstandards und auf die Qualitätseinordnung. Insofern ist es nicht ganz selbstverständlich.
Jandl: Also ich kann kein starres System erblicken. Und ich könnte kein starres System skizzieren.
Schmidt: Können wir noch zu einer letzten Frage kommen. Die konkrete Dichtung und die experimentelle Literatur haben sich immer schon sehr stark auch an anderen Künsten orientiert, an Musik, an Bildender Kunst. Das ist glaube ich vor allem für experimentelle Literatur sehr typisch gewesen. Siehst Du im Moment einen Zusammenhang zwischen dem, was z.B. im Bereich der Literatur passiert und dem, was etwa in der Musik oder in der Bildenden Kunst geschieht?
Jandl: Ich kann das nicht generell beantworten. Ich kann nur sagen, daß ich an Friederike Mayröcker sehe, wie sehr Bildende Kunst und Musik für ihre Arbeit notwendig sind und in ihre Arbeit hineinspielen. Ich sehe das Ineinandergreifen von Musik, Graphik und Text in einer faszinierenden Weise bei Gerhard Rühm. Und ich habe meine eigenen für mich sehr wichtigen Erfahrungen im Zusammenspiel mit Musikern gemacht. Zum Teil Musikern des Jazz, aber auch – etwa im Trio mit Orgel und Posaune – mit klassischen Organisten. Ich glaube aber nicht, daß es in erster Linie oder nur experimentelle und konkrete Poesie sind, die sich eingehend mit den anderen Künsten beschäftigen oder mit den anderen Künsten Kontakte geschlossen haben. Sie haben es gewiß getan. Und die experimentelle Dichtung und die konkrete Poesie waren u.a. auch der – wie ich glaube – gelungenste Versuch nach dem 2. Weltkrieg, die Literatur – vor allem auch die deutschsprachige Literatur – auf die Höhe der beiden anderen Künste zu bringen. Künste, die nicht vom Wort abhängig sind, und die sich daher in einer Zeit, da Europa weitgehend für die Kunst geschlossen war, anderswo – etwa in den USA – entfalten konnten. Und hier war dann – vor allem im deutschen Sprachraum – nach 1945 diese gewaltige Bemühung notwendig, Literatur wiederum zur Kunst zu machen.
Schmidt: Ist für Dich das, was im Moment unter dem Stichwort Postmoderne diskutiert wird, ein interessanter Diskussionszusammenhang?
Jandl: Nein. Ich fange mit dem Begriff der Postmoderne so gut wie nichts an. Wenn er bedeutet: alles ist möglich, alles ist erlaubt, gut. War es bisher anders?
Schmidt: Dahinter steckt die Vorstellung, die Moderne sei zu Ende. Eine Vorstellung, die ich nicht habe teilen können.
Jandl: Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Begriff ablehne, bzw. mit ihm nicht umgehe; denn die Moderne kommt immer wieder neu.
Schmidt: Wahrscheinlich stehen hinter dem Konzept Posmoderne auch Entwicklungsgedanken, die Du m.E. zu Recht während des ganzen Gesprächs als eigentlich unangemessen bezeichnet hast. Du siehst den Zusammenhang eher als eine Auswahl von Möglichkeiten, die gesteuert wird von Individuen, von der Art, wie Individuen mit ihrem Leben und mit Literatur und mit Kunst umgehen können und nicht als eine irgendwie geartete lineare Entwicklung.
Jandl: Richtig. Wobei man zu Individuen noch hinzusetzen könnte: Gruppierungen aus Individuen. Wie etwa die Wiener Gruppe.
Schmidt: Hat es eigentlich irgendwelche ähnlichen Gruppierungen gegeben wie die Wiener Gruppe oder gibt es sie?
Jandl: Ja, es hat die Noigandres in Brasilien gegeben. Es hat einmal den Versuch gegeben, eine Stuttgarter Gruppe zu definieren (um Reinhard Döhl, Bense, Heißenbüttel, Mon, Harig). Aber die Wiener Gruppe hat ihre Einzigartigkeit doch durch die Jahre der Zusammenarbeit, der Gemeinschaftsproduktion.
Schmidt: Und das Bielefelder Colloquium?
Jandl: Natürlich, ja.
Schmidt: Aber das ist keine Gruppe.
Jandl: Das ist keine Gruppe. Aber es ist eine sehr wichtige Sache. Ein zentraler Punkt für konkrete und experimentelle Poesie. Wie z.B. auch Heimrad Bäcker mit seinen NEUEN TEXTEN und der EDITION NEUE TEXTE und den Autoren, die sich darum gruppieren, der auch wieder eine Verbindung zu Bielefeld herstellt.
ERNST JANDL
Duft
Luft
Gruft
Schuft
Blut gut
Hut Mut
Haus gleich
Schmaus
Schluck
Schluck
Schlucken
ohne
mucken
Magen
Jucken
Innen
zucken
zuckt
zuckt
lahmer
ei der
daus
märchen
aus
jägerlein
messerchen
bauch
hinein
tut nicht
not
rotes
mädchen
tot
Peter Wawerzinek
DER GARTEN, FUNKELND WIE SEINE GEWÄSSER
für Ernst Jandl
mit zwei leeren Plastiksäcken über
den Hof, mir entgegen, mit zwei leeren windgeblähten
Plastiksäcken mir entgegen, über den Hof,
Abendessen zu holen für uns, links warum linkerhand
frage ich mich, rechts vermutlich die Zigarette, die
Zerreiszprobe, mir entgegen, linkerhand
die beiden im leichten Wind nach oben gebauschten
Plastiksäcke, statt Einkaufstasche, über
den Hof, mir entgegen, nie mehr zu verwischen
in mir dieses Bild, über den Hof, schwankend,
du, sorgend, linkerhand, und jetzt ja jetzt die
deutliche Erinnerung an die rechterhand
Zigarette, und an die Lippen
geführt, und dein Kusz, und
da ist wieder einer jener seltenen
Wahrheitsmomente, für die es sich lohnt weiter
zu leben, um derethalben
ich dich zu lieben glaube, zum Beispiel
Tremolo so verflochten, während ich,
Irrwisch, die Augen beschattend, dasz
schwimmenden Spiegels Spur
darin
du nicht sehen sollst
Friederike Mayröcker
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


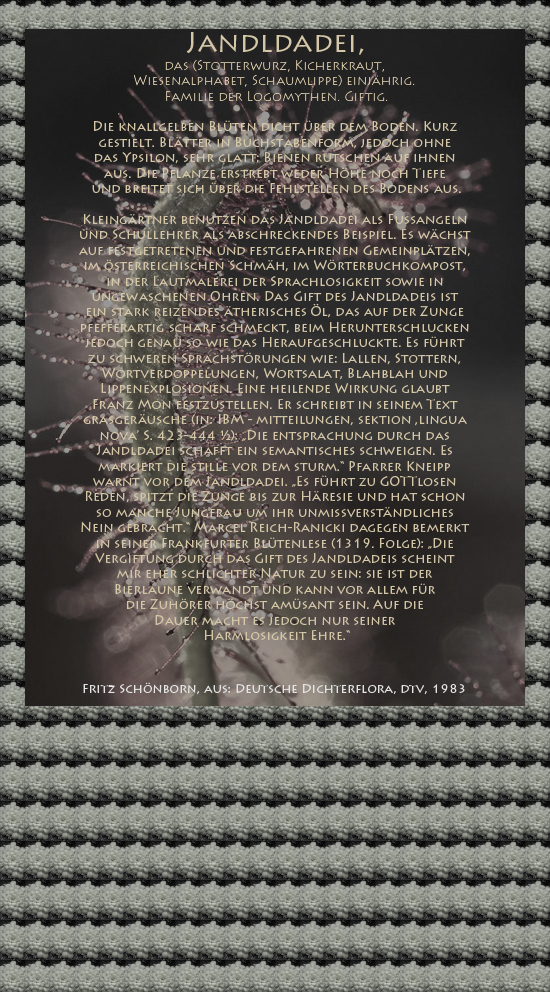












Schreibe einen Kommentar