Ernst Jandl: der gelbe hund
BUCH UND NASE
es sei ein buch, und wieder
sei ein buch, und noch, und noch eins
und noch viele; er nehme eins
und blättre darin, und nehme noch
und noch eins, blättere
und finde nichts, nichts das geringste
für ihn.
nichts für ihn jetzt, bis er erinnere
die nase dietrichs, seinen blonden kopf
die langen schmalen finger, die das buch
irgendein buch, geöffnet bis zum bersten
an diese nase hoben, und er tief
den duft des buches einsog.
dietrich war eher, als der krieg aus, tot.
Über meine Gedichtsammlung der gelbe hund
„Die rund 200 Gedichte des Buches der gelbe hund sind das Ergebnis der Jahre 1978/79. Sie führen vom Gedichtband die bearbeitung der mütze chronologisch weiter, in andere, wenngleich nicht entgegengesetzte Sprach- und Denkzonen hinein. Zudem verlaufen sie parallel zur Entstehung der Sprechoper Aus der Fremde, mit einzelnen deutlichen Anklängen an dieses ebenso artistische wie zutiefst pessimistische Bühnenwerk. Die Gedichte halten, was der Titel verspricht: die menschliche Dimension als Maßstab für die Welt ist ohne Gültigkeit. Sprache und Thematik dieser Gedichte bewegen sich demgemäß in Bodennähe, der Kopf reicht nicht höher nach oben als der des Lammes, des Hundes, der Amsel im Gras. Nichts bleibt an Gedankenflug außer logischen Sprüngen und Rissen, ein Verwerfen des als normal erachteten Denkens. Auf der Basis der Alltagssprache übt sich der Autor in der Kunst des Ausgleitens, Hinfälligkeit demonstrierend durch die gewaltsame Verformung auf der Wort- und Satzebene. Angesichts der Fehlerhaftigkeit menschlichen Lebens wird der sprachliche Fehler zum Kunstmittel gemacht, analog zu den Störungen und Zerstörungen in Musik, Plastik und Malerei. Die Unscheinbarkeit der eigenen Person und Existenz verbindet den Autor mit nahezu allen gleichzeitig Lebenden. Das macht Ihn sicher, verstanden zu werden, gerade auch dann, wenn er sich selbst, seine dürftige Rolle jetzt, die kläglichen Reste seiner Vergangenheit und sein Beharren auf der Unmöglichkeit der Zukunft in seine Gedichte mit aufnimmt. Jeden Versuch, ein die anderen überragendes Menschenbild zu entwerfen, in der Kunst, in der Politik oder sonstwo, vermag er nur mit einer Grimasse zu quittieren. Im übrigen richtet er, mit einer von ihm selbst verlachten Inständigkeit, seinen aussichtslosen Wunsch nach dem täglichen Gedicht an das ihn umschließende Nichts.“
Ernst Jandl, Luchterhand Verlag, Klappentext, 1982
Beiträge zu diesem Buch:
Ernst Nef: Ein neuer Jandl
Neue Zürcher Zeitung, 31. 10. 1980
Hermann Burger: Humorvoller Sprachzertrümmerer
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 11. 1980
Jörg Drews: Clown und Schmerzensmann. Ernst Jandls riskanter Gedichtband „der gelbe hund“
Süddeutsche Zeitung, 29./30. 11. 1980
Jürgen P. Wallmann: Absichtlich trostlose Gedichte
Der Tagesspiegel, 30. 11. 1980
Karl Riha: Ein kantig Kind mit 55 Jahr
Frankfurter Rundschau, 7. 3. 1981
Heinz F. Schafroth: Bodenlose Einfachheit
Die Weltwoche, 18. 3. 1981
Holger Jergius: Irrengedichte eines gewöhnlichen Menschen
Nürnberger Zeitung, 21. 3. 1981
Klaus Jeziorkowski: Das Wiener Wunderhorn
Die Zeit, 10. 4. 1981
„von einen sprachen“
– Über Ernsts Jandls „heruntergekommene Sprache“. –
1.
In diesem Juni erscheint ein Heft der Zeitschrift Akzente, das dem Thema der Schönheit gewidmet ist. In meinem Beitrag darin dient Jandls Hörspiel Das Röcheln der Mona Lisa (s. S. 511f.) als Beispiel für das schillernd-ambivalente Verhältnis, das ein zeitgenössischer Autor zum Phänomen der Schönen haben kann. Mein letzter Satz lautet, auch als ein Reflex auf das Röcheln der Mona Lisa:
Nicht nur das Schöne ist schön.
Als ich nun sein Gedicht „von leuchten“1 wieder las, wusste ich: Das ist genau das, was mein Satz sagt. Jandl hat es am 26. Oktober 1977 geschrieben. So lautet sein Text:
VON LEUCHTEN
wenn du haben verloren den selbst dich vertrauenen als einen
schreibenen; wenn du haben verloren den vertrauenen in den eigenen
kreativitäten, wenn du haben verloren den methoden, den techniken
zu richten den lebendigen und den toten; wenn du haben verloren
den zusammensetzen von worten zu satzen; wenn du haben verloren
den worten überhaupten, sämtlichen worten, du haben
nicht einen einzigen worten mehr: dann du vielleicht
werden anfangen leuchten, zeigen in nachten den pfaden
denen hyänenen, du fosforeszierenen aasen!
Für meinen durchgewalkten poetischen Sinn ist dies ein Fall definitiv gelungener Schönheit, wie sie auf dem Hinter- und Untergrund unseres Jahrhunderts noch möglich ist. Schauen wir genauer hin.
Das Gedicht besteht aus einem neun Zeilen langen Konditionalsatz:
wenn du haben verloren…, dann…
Fünfmal setzt der Wenn-Satz aufs Neue an, und bei jedem Mal werden weitere Verluste an poetischer Potenz aufgezählt, die das angesprochene Du betroffen haben könnten. Es ist ein rhetorisches Du, das der Autor auf sich selbst richtet. Es deutet aber, unbeschadet dieses Selbstbezugs, einen Spalt an, der die Aussage unauffällig in der Schwebe hält. Die Summe der fünf Wenn-Sätze würde das Aus einer dichterischen Existenz bedeuten: „wenn du haben verloren / den warten überhaupten, sämtlichen warten, / du haben nicht einen einzigen warten mehr: dann…“, heißt es im letzten Teilsatz. Die Negativität ist komplett. Der Leser kann nun voller Teilnahme mit dem armen, entkernten Poeten dies als eine Art klinischer Befundbeschreibung nehmen und fragen, ob eine Abhilfe, eine Therapie noch möglich wäre. Oder aber: der Spalt zwischen dem diagnostizierten Du und dem redenden Ich hat uns vorsichtig gemacht, sodass wir wohl die sprachlichen Normendefekte bemerken, sie jedoch nicht so schwer nehmen, da die sinnproduktiven Leistungen dabei durchaus noch funktionieren. Ist ein Moment von Hysterie mit im Spiel? Denn die desperate Diagnose wird von dem gelungenen Text selbst aufgehoben. Rücken wir noch ein Stück weiter ab und stellen uns quer zu dem, was da steht, so sehen wir uns gespannt der Satzserpentine folgen, die eine Spannung auf jenes Dann erzeugt, das dem Wenn unabweisbar folgen wird. Die Serpentine hat der Herr des Textes mustergültig mit einem zügigen Versrhythmus gezogen. Trochäen im Verbund mit Daktylen bewirken das ungestörte Fließen der Wörter. Das Auftakt-Wenn wird jedes Mal – durch einen Trochäus – auf der ersten Silbe der Zeile betont; seine Eventualitätsrolle also hervorgehoben, sodass die Möglichkeit, es könne auch anders sein, nicht vernagelt wird. Zum Kunstweg wird die Serpentine aber erst durch ein irritierendes Moment auf der Inhaltsebene. Als unkontrolliert eingedrungenes Fragment verwirrt die Formulierung in der 4. Zeile: „zu richten die lebendigen und die toten“ für einen Augenblick die Harmonie des Negativen. Doch der Versrhythmus führt es mühelos mit. Dieses Zitat aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis bezieht sich auf den endzeitlich erwarteten Christus und stammt offensichtlich aus Jandls Erinnerungsfundus. Es gelangt als unvermuteter Einfall aus einer anderen Welt ins Gefüge.
Die, normativ gesehen, defektiven Wort- und Satzformen, insbesondere die häufige Verwandlung der Verb- und Substantivendungen in homophone en-Lautungen, unterstützen den eben rhythmischen Verlauf und bewirken das Abschmelzen des lautlichen Profils. Mit diesem Kunstgriff wird die Monotonie hergestellt, die zu der Atemlosigkeit des fünffachen Ansatzes beim Aufreihen der Verluste gehört und ihre ins Extreme zielende Dynamik noch verflüssigt. Dieser letzte Satz: „und du haben nicht einen einzigen warten mehr“ klingt wie die definitive Ankündigung des Endes.
Erst in der späten 7. Zeile erscheint, lange hinausgezögert, das Dann als Komplementär des Konditionalsatzes. Wie das Wenn trägt auch das Dann den heraushebenden Akzent [hier eines Daktylus], und es verbindet sich alliterierend noch dichter mit dem Du. Hier wird der Möglichkeitsspielraum durch das „vielleicht“ offen sanktioniert: Es könnte, aber es muss nicht geschehen, nämlich die Verwandlung des depravierten Dichter-Dus in ein „leuchten“, das anders ist als ein bloßes Licht, von undefinierbarer Qualität. Die Parenthese am Schluss wird die Erscheinung in die jeder Auflösung entzogene Metapher „du fosforeszierenen aasen“ kleiden. Dessen Leuchten zeigt nächtlicherweise den Hyänen, den Aasfressern, den Weg zu ihrem Fraß, dem abgeschiedenen Du des Dichters. Der Rhythmus des Vordersatzes formt auch den Nachsatz. Der Kunstweg wird fortgesetzt, ja erreicht erst jetzt seine Vollendung. Denn auch die vokalische Abstinenz, die den Vordersatz mit dem O-Laut nur karg markierte, weicht nun einer vokalischen Vielfalt. Diese, darunter sechsmal das A, illuminiert geradezu die Szenerie, und sie verwandelt dabei ihren makabren Inhalt in ein unheimlich „leuchtendes“, phantasmisches Bild. Das Ausrufezeichen hinter dem „aasen“, leicht zu übersehen, gibt diesem Wortkörper eine verrückte Emphase.
Doppelsinnig dürfte sie sein. Denn sie bestätigt die Endgültigkeit des Kollapses im Vordersatz, und zugleich feiert sie den verendeten Dichter durch die auftrumpfende Metamorphose seines Kadavers in einer gloriosen Wortlauterfindung:
denen hyänen, du fosforeszierenden aasen.
Das einheitsschleifende -en in den Endsilben enthebt diese Wortwesen um ein Stück ihres kruden Realbezugs. Dieses so dunkelnd heraufgeführte Gedicht bringt durch eine Volte, die der Jandl’schen Poetik durchaus geläufig ist, ein eigentümliches Stück Schönheit zutage.
2.
An jenem 26. Oktober 1977 hat Jandl drei Gedichte geschrieben, was nicht so oft bei ihm vorkommt. Er befand sich selbst also keineswegs in der Zwickmühle des Verstummens, die er in dem Gedicht „ein leuchten“ aufgestellt hat. Es war das dritte an diesem Tag. Das mittlere hat den Titel „von einen sprachen“2 und ist für unseren Zusammenhang fundamental, da es, soweit ich sehe, das einzige Gedicht ist, in dem Jandl seine sogenannte „heruntergekommene Sprache“ zum Thema macht. Es geht auch hier um die Schreibarbeit des Autors – und was für eine! Hören wir es uns an:
VON EINEN SPRACHEN
schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen
sein ein demonstrieren, sein ein es zeigen, wie weit
es gekommen sein mit einen solchenen: seinen mistigen
leben er nun nehmen auf den schaufeln von worten
und es demonstrieren als einen den stinkigen haufen
denen es seien, es nicht mehr geben einen beschönigen
nichts mehr verstellungen. oder sein worten, auch stinkigen
auch heruntergekommenen sprachen-worten in jedenen fallen
einen masken vor den wahren gesichten denen zerfressenen
haben den aussatz. das sein ein fragen, einen tötenen.
Der Autor tritt in der Er-Form auf, noch distanzierter als im Du des vorigen Gedichts. Die verwendeten Wörter der „heruntergekommenen sprache“ sind in ihrer eigenen „stinkigen“ Qualität sowohl symptomatisch für die „stinkige“ Beschaffenheit seines Daseins wie aber auch das geradezu passende Werkzeug, mit dem dieses präsentiert werden kann, ohne zu beschönigen oder zu verstellen, wie es ausdrücklich heißt. Auch hier enthält die 7. Zeile einen Sprung in Gestalt eines fragestellenden „oder“. Der anstehende Satzinhalt wird durch die defektiven grammatischen Formen verwischt; auch fehlt dem Fragesatz das zugehörige Satzzeichen am Schluss. Im Klartext steht dort:
Oder sind Wörter, auch stinkige, auch in heruntergekommener Sprache gefaßte Wörter in jedem Fall eine Maske vor dem wahren Gesicht, das der Aussatz zerfressen hat?
Die Frage wirft einen Zweifel an der Leistung der Wörter im Hinblick auf ihren Gegenstand auf. Leisten sie tatsächlich die unterstellte, nicht beschönigende Präsentation des wahren, verwüsteten Daseins eines „solchenen“, dieses Menschen da? Oder maskieren sie nicht doch bloß dessen Realität? Wie quälend die Frage ist, besagt der Schlusssatz: „das sein ein fragen, einen tötenen“, – ein tötendes. Das Dilemma ruft das Wort ,Maske‘ herauf, das sich vor das zunächst zuhandene, handlich naheliegende der ,Schaufel‘ schiebt. Es droht die Totalität der Destruktion, die mimetische Identität von Werkzeug und Leben zu stören. Der Zweifel stützt sich auf das in die Frage eingefügte „in jedenen fallen“. Es kann ,immer‘ bedeuten, muss es aber nicht. Es lässt auch die Lesart ,von Fall zu Fall‘ zu, sodass zumindest die Möglichkeit der wesentlichen Identität von Sprachzeichen und seinem Referenten besteht.
3.
Jandl wägt mit der Maskenversion die ikonische Übereinstimmung von Sprachzeichen und Objekt – Muster-„Kuckuck“ – ab gegen die arbiträre, die beliebig-gelenkige Verbindung zwischen Wortkörper und Bedeutung. Diese macht in der Lebenspraxis die Sprache universell brauchbar, und sie öffnet unabsehbare Spielräume für poetische Erfindungen. Die hat Jandl sein Leben lang in vielen Variationen genutzt. Wenn man seine poetische Biographie durchgeht, findet man auf Schritt und Tritt das Spiel zwischen Wortlaut und Bedeutung. Das beginnt mit seiner Entscheidung für die experimentelle Arbeitsweise Mitte der 50er Jahre, deren frühe Ergebnisse in dem Band laut und luise gesammelt sind – etwa die „etüde auf f“, in der alle W-Laute durch den F-Laut ersetzt werden:
eile mit feile
auf den fellen weiter meere
Es folgen die sprechblasen von 1968 mit dem Potpourri verschiedenster Spracherfindungen und -verdrehungen in dem Gedicht „kneiemzuck“, dann der Band Der künstliche Baum – 1970 – mit der phonemischen Eskalation im Gedicht „fortschreitende räude“. Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Die von Jandl als „heruntergekommene Sprache“ bezeichnete Variante fügt sich nahtlos daran an. Dass sie Ausdrucksmedium neben anderen ist, zeigt sich schon an der Soloverwendung des Konjunktivs in der Sprechoper Aus der Fremde als normwidriges poetisches Mittel. Dies geschah in den 70er Jahren zeitgleich mit der Praxis der „heruntergekommenen Sprache“.
Während die Transformation der Satzaussage aus dem Infinitiv in den Konjunktiv nur die Modalität des Satzes und damit dessen Realitätsbezug antastet, greift die „heruntergekommene Sprache“ die Wortendungen und das Satzgefüge an. Die morphologischen und syntaktischen Simplifizierungen und Verschleifungen bewirken an vielen Stellen des Textes eine semantische Unschärfe, sei es als Diffusion der Bedeutungen, sei es als Zweifel am Aussagesinn. Das reicht bis zur Verrätselung der Wortfassung. Die Anregung zu dieser normzersetzenden Ausdrucksweise kam Jandl zufolge von der „sprache von leuten, die deutsch zu reden genötigt sind, ohne es je systematisch erlernt zu haben“.3 Dass es sich dabei nicht um die Imitation des sogenannten Gastarbeiterdeutschs handelt, wie bequemlichkeitshalber immer wieder zu lesen ist, erkennt man schon daran, dass die Normverletzungen in sich reguliert und, im Gegensatz zur Labilität eines nur oralen Idioms, stabil sind, also einer selbstgesetzten Normgebung folgen. Hin und wieder mögen Aspekte einer holprig unzureichenden Umgangssprache durchschimmern; was Jandl erfunden hat, ist jedoch eine artifiziell konzipierte Kunstsprache und dies im doppelten Wortsinn: als künstlich gebildetes Idiom, dessen sich gelegentlich auch Dritte in spielerischer Nachahmung bedienen könnten, und als ein poetologisch gefasstes Verfahren, mit dem literale Kunst, Sprachkunst erzeugt werden kann.
4.
Exemplarisch in diesem Sinn ist das Gedicht „gemiedenen“.4 Es ist am 16. Februar 1978, also im Horizont der „heruntergekommenen Sprache“ relativ spät entstanden. Darin nutzt Jandl die ganze Skala sprachlicher Transformationen, vom phonemischen Solopartikel bis zur Sinnverrätselung, die den Verstehensverlauf hemmt. Das Gedicht lautet:
GEMIEDEN
sehn ich so jung dein gesicht, und dornenbusch
ich rufen dornenbusch, mit ein spitz-messer-dolch-dorn, ein
dorn-scheren, zweikling, fürn jeden der beidigen augen.
beleidigen, beleidigen schöpf, schöpflöff den schöfen-akt,
schöffen, töff-töff und der sehensucht sein ein des
donnerbusch, ein flug-runt-rutsch, ein platsch
von einen boeing. sein zu sicheren doch DU
metallen-vockel, ein brütz, ts–c–h ts–c–h,
einen gewühl, pro domo klumperen. ich und mein
fertsch-tand. nach noch bein ich sichtig/süch
dünn-dick. Sünn
düch-dick, ein sonn
onnentag, ein pro pro pro pro
uganda uganda minenten
einen vertro/trie
traben haben schlapf, ein kapf, wappe.
tu den zweig nicht einbiegen du tun
ein der türen trau drauf den der schaum schäm sippil,
ein druuwi druuwi, bläääääää
tschlll.
aber sein ein vattern und bemorgen
einen an juckend, juckend!, ich-keit,
vor mooren sein ein schlafen-turunk,
ein ich nichti-nichti
nimmer-Meere
so augenlose ich solle ich sein. Oi-
dübuuus…
KLUMM!
Kaum verhüllt deutet der Titel das Motiv an: „gemiedenen“, also: ,gemiedener‘, ein, der Gemiedene. Die Auftaktzeilen enthalten die Exposition:
sehn ich so jung dein gesicht, und dornenbusch
ich rufen dornenbusch, mit ein spitz-messer-dolch-dorn, ein…
„sehn“ ist nicht nur ,sehen‘, es schwingt auch ,sehnen‘ darin mit – Ausdruck eines Glücksmoments, das von „dornenbusch“ jäh abgefangen wird. Dessen Widerständigkeit und abweisendes Wesen zeichnen sich schon im trochäischen, auf der ersten Silbe pochenden Akzent ab. Der Aufschrei in der Wiederholung des „dornenbuschs“ zieht in eine böse Assoziationskette:
ein
dorn-scheren, zweikling, fürn jeden der beidigen augen.
Es ist der ,gemiedene‘, der diese verzweifelte Absicht hervorstößt, seine Augen zu zerstören und mit diesen, ungesagt, das Sehen-Sehnen der Liebesanwehung. Diese Doppelbedeutung blüht in der Wortbildung „sehensucht“ der 5. Zeile noch einmal auf, jetzt im Widerspiel zum „donnerbusch“, zu dem der „dornenbusch“ mutiert ist. Die akustische und die semantische Veränderung sind Anzeichen einer bedrohlichen Entwicklung. Sie tritt zutage in der nächsten jandltypischen Lautverwortung, hier des tiefliegenden Vokals U in dem direkt anschließenden Dreiteiler:
ein flug-runt-rutsch, ein platsch
von einen boeing.
Es ist dieselbe artifizielle Lautwortkonstruktion wie zuvor die aus dem Vierteiler „spitz-messer-dolch-dom“ gefertigte. Die semantische Ader bestimmt dabei jeweils die Selektion der Wortkerne ebenso wie deren lautlich-artikulatorischer Magnetismus. Beide Momente flechten gemeinsam die phonische Kohärenz und die Zielgenauigkeit der Bedeutungen. In den Ablauf einer Flugzeugkalamität, die in Zeile 6 ansetzt, wird das – versal gewichtete – „DU“ eingeblendet und dabei zur Flugzeugmetapher verfremdet und unberührbar gemacht:
DU
metallen-vockel
(Zeile 7/8).
Das imaginierte Desaster mit seiner Geräuschkulisse mischt imitatorisch Lautsilbisches mit Wortsoli der Art wie das verständlich-unverständliche:
pro domo klumperen.
Mit einem Schnitt wird unmittelbar daran gesetzt:
ich und mein
fertsch-tand
(Zeile 9/10).
Das „ich“ trägt dabei den harten Akzent, der vom Vorangehenden trennt. Der zerquetschte Zustand des Wortes „fertsch-tand“ – man muss beim Lesen die phonetische Deformation auf die Zunge nehmen – präludiert die verbale Zerfledderung der nachfolgenden Bewusstseinsinhalte.
Der ganze Text kennt nur hin und wieder komplette Sätze. Zum überwiegenden Teil wird auch der semantische Nerv von silbisch gekappten Wortkernen gebildet. Dank ihrer gleichen oder ähnlichen Lautung entspringt einer aus dem anderen. Auslösend wirken inhaltliche Momente wie „sichtig/süch“, „dünn-dick“, „sünn/düch-dick“. Ihre lautliche Skulpturierung tritt an die Stelle der Satzorganisation und bewirkt den Zusammenhang. In der fragilen Folge der Sinnflecken tauchen auch Wörter oder Wortphantome auf – wie „uganda uganda minenten“ in Zeile 14 –, deren Bedeutung belanglos ist. Sie schlagen wie Meteore als Fremdkörper ins Textensemble ein und sollen als solche wahrgenommen werden. Lautliche Assonanz und semantische Dissonanz lassen auf ein desorientiert herumtastendes Bewusstsein schließen. Diese Art „heruntergekommener Sprache“ zieht sich bis ans Textende durch.
Dass diese Lautkörperfolge nicht lose im Wind hängt, verhindern die wie Bojen mehrfach auftauchenden Ich- und Du-Nennungen. Sie werden immer nur angetippt und vergehen alsbald wieder im phonemisch-silbischen Fließen und Springen. Doch sie genügen, auf das, was sich unterschwellig mitteilt, aufmerksam zu machen.
Auch dieses Gedicht hat die typische Zäsur vor dem letzten Drittel oder Viertel des Textes. Nach einem Exzess asemantischer Lautemanationen – „ein druuwi druuwi, bläääääää / tschlll“ – setzt sich (in Zeile 21) ein artikuliertes Aber mit seinem langen A-Laut scharf ab. Es folgt ein phonemisch dicht geknüpftes Netz von Wortkörpern, deren Bedeutungen übereinanderliegend verrutschen, sodass Divergentes im selben Blick ins Auge tritt. Das Ichwesen versucht, sich darin zu fassen. Dazu wird die Ich-Silbe aus dem Kontext gelöst und im Nichtich formatiert, mit einem lautsilbisch entspringenden Echo in der nächsten Zeile:
ein ich nichti-nichti
nimmer-meere.
Das „nimmer-meere“ gehört auch schon zur folgenden Äußerung:
So augenlose ich solle ich sein.
Der desperate Impuls des „gemiedenen“ aus dem Anfang des Gedichts, das eigene Augenlicht auszulöschen, wird beklommen erinnert. Wie ein Stoßseufzer hängt daran die eindringlich gedehnte, mythische Chiffre:
Oi-
dübuuus…
Der beschworene Name des Ödipus verleiht dem Zustand des Gemiedenen eine Aura, wenn auch eine verschattete, negative. Die drei Punkte dahinter sorgen für die Entgrenzung ins Weite, Vage. Damit könnte das Gedicht enden. Es endet aber erst mit dem „KLUMM!“ der 28. Zeile. Die Gewichtigkeit dieses Ausrufpartikels schafft erst die Versalschreibung und das Ausrufezeichen dahinter. Im Nachvollziehen seines artikulatorischen Verlaufs vom gaumenschließenden K über das dental, also vorne geortete L das dumpf tönende U bis zum Lippenverschluss des M, das als Dauerlaut nachsummt, wird das Schließen des Gedichts praktiziert. Zugleich wirkt es auch als Geste des Aufatmens und Abwinkens. Es ist genug der Sinnqualen. Das derangierte Ich kann sich endlich fallen lassen, und dem Leser wird bedeutet, dass diese verrückte poetische Sequenz auch einen Erlebniswert hat und zum Genuss freigegeben ist.
5.
Genau besehen, ist gemiedenen ein akustischer Text. Zwar drängt das erste Lesen zur Entschlüsselung der Szenik, die in den Anfangszeilen verbal verrätselt, in Gang gesetzt wird. Indem sich der Leser durch die miteinander verklammerten Ranken der Wortlaute, Lautwörter und Silbenlaute hindurchzwängt, gelingt es ihm, zu einer Deutung durchzudringen. Doch dabei konzentriert sich die Aufmerksamkeit und das Leseinteresse unvermeidlich auf die inhaltlichen, semantischen Aspekte, in denen die Sinninkubation vermutet wird, und zwar zu Lasten des Lautcharakters. Die gestisch-expressiven Aussagen der Lautierungen kommen zu kurz. Die visuelle Textur, gewohnheitsmäßig die sinntragende, überlagert nicht nur, sie knipst die phonetische geradezu aus. Dabei ist es im Grunde die sensibel und hochdifferenziert durchgeführte Rhythmik der Lautsilben, die die wenigen satzsyntaktischen Ansätze des Textes trägt. Substrat dieser rhythmischen Artikulationen ist die Lautsprachlichkeit der Solosilben und der Wortlautkörper. Sie verlangen, dass die Sprachzeichen, die sie vermitteln, die Buchstaben, nicht nur visuell gelesen, sondern auch oral realisiert, hörbar werden. Damit wird nicht nur eine andere Erlebnisebene, es wird auch eine anders gestimmte Verstehensebene erschlossen. Sie kann die literal-visuelle ergänzen und vervollständigen – das wäre der Normalfall; sie kann sich jedoch auch, dank ihrer mikrosensorisch-semantischen Einschlüsse, autonom entfalten. So gesehen, wird der vor Augen liegende Text zur Partitur einer oralen Realisation.
Die Schwierigkeit der Sinnfindung beim Lesen eines solchen Textes, wie sie sich vor allem aus der Partikelreihung, aber auch aus den collagehaften Einsprengseln von Wortfremdkörpern ergibt, schwindet, sobald der sprechend erzeugte Rhythmus mit seiner akzentsetzenden Konturierung bestimmter Textorte und der Unaufhaltsamkeit seines Zeitverlaufs die Regie übernimmt.
Die orale Präsentation seiner Gedichte hatte für Jandl immer eine besondere Relevanz (s. S. 434). Dies nicht nur, weil sie aus dem stillen Decodierer einer Zeichentextur, der Schrift, die nur mittelbar mit Sprache zu tun hat, einen Hörer macht, der seiner eigenen Sprachsprechhaftigkeit begegnet, sondern weil die gesprochene Sprache selbst verleibhaftigt ist. Deren mediale Ausdrucksbereiche ertasten ganz andere emotionale, voluntative, spirituelle Dimensionen als die des Schrifttextes. Im oralen poetischen Ereignis kann ihre ganze spontane wie kalkulierte artistische Reichweite ausgespielt werden. Jandls lautsprachlich unterfüttertes Gedicht „gemieden“ ist geeignet, diese zutiefst humane Qualität von Sprache im Sprechen und Hören zum Erlebnis werden zu lassen.
Franz Mon, Vortrag, Kolloquium in der Alten Schmiede, Wien, 9.6.2005, erschienen in Franz Mon: Sprache lebenslänglich. Gesammelte Essays, S. Fischer Verlag, 2016
Existenzgrammatiker, Lautforscher und
Künstler der Reduktion
– Ernst Jandls Dichtung im Porträt. –
Was wir heute unter Dichtung verstehen, erfuhr in den letzten 50 Jahren einen tiefgreifenden Wandel. Ernst Jandl, 1925 geboren und nunmehr schon vor zehn Jahren gestorben, hat unseren Begriff von ihr seit den 50er Jahren wie kaum ein anderer verändert, ihn wohl viel beweglicher, freier und weiter gemacht. Sein zentraler Beitrag zur Kunst der Nachkriegszeit kann rückblickend und ganz grundsätzlich als eine radikale Erweiterung sprachlichen Ausdrucks beschrieben werden. Er erprobte ihn in Form neuartiger Gedichte im Visuellen und im Akustischen, er bearbeitete den Sprachkörper als vibrierend lebendiges Gefüge, öffnete die Worte und Sätze, befreite sie aus ihrer Starre und Festgefahrenheit, stöberte in ihren Registern, isolierte einzelne ihrer Elemente und kombinierte sie neu, er horchte den Lauten nach, machte Gedichte aus Zwischentönen und anderen scheinbar marginalen und tatsächlich verdrängten Elementen, er arbeitete mit den idiomatischen und grammatikalischen Mustern der Sprache, er spielte und experimentierte mit ihr, ohne Rücksicht auf Verluste, dafür aber schonungslos genau.
Bis Jandl als der Dichter des Spiels und existenziell-kritischen Humors bekannt wurde, musste er allerdings bis zum tatsächlichen Auftauchen seiner Lyrik bis zum Erscheinen von Laut und Luise 1966 durchhalten. Seither gilt er als Dichter, der parallel zu Autoren der Wiener Gruppe und zu einigen anderen Weggefährten und Autorinnen ästhetisch-kulturelle Barrieren auf vielfältige Weise durchbrochen und abgebaut hat. Einige Wendungen seiner Gedichte sind, nicht zuletzt dank seiner außergewöhnlichen Vortragskunst, geradezu sprichwörtlich geworden, sodass auch heute noch mancher „mops“ durchs Gespräch „trotzt“ oder auch jemandem ein „bist eulen?“ entfährt. Jandl war in den 70er Jahren bereits zu einem auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Vermittler von Literatur geworden, der sowohl Anerkennung im universitären Milieu fand als auch Eingang in die Schulbücher. Die Popularität, die er dabei erlangte, konnte Jandl ab 1973 insbesondere in seiner aktiven Rolle als Mitglied, Mitbegründer und zeitweiliger Präsident der GAV, der Grazer Autorenversammlung, auch für seine Sache, die Literatur, und seine Kollegen als symbolisches Kapital einbringen. Jandl, der seinen Lebensunterhalt nach seinem Germanistik- und Anglistik-Studium als Lehrer verdiente, gab jedoch erst Ende der 70er Jahre seinen Brotberuf endgültig auf. Trotz seiner lebenslangen Verbindung mit Friederike Mayröcker seit 1954, aus der literarisch nicht zuletzt auch einige Gemeinschaftsarbeiten besonders im Bereich des Hörspiels entstanden, entwickelte sich sein Schreiben jedoch grundsätzlich abseits der Dynamiken innerhalb und rund um literarische Gruppierungen. Zwar im innovativen Anspruch und lebensweltlich nicht weit von der Aktivitäten der sogenannten Wiener Gruppe, zu der auch freundschaftliche Verbindungen bestanden, und die das, was man unter innovativer Literatur und Postavantgarde seit den 50er Jahren verstand, maßgeblich bestimmte, wurde der niemals freiherzig herbeigewunkene Jandl nie ein Teil von ihr. Während er gleichsam en passant das erneuerte, was als konkrete Poesie galt, ohne dass sich diese literarische Bewegung ihn jemals gänzlich einverleiben konnte.
Neben H.C. Artmann und auf einem anderen Register Paul Celan verkörpert Ernst Jandl die österreichische Dichtung der Nachkriegszeit gerade in seiner Singularität wie kaum ein anderer, und steht gleichzeitig für eine europäische, offene, alles andere als national bestimmbare Literatur, die weder im Spiel stehenbleibt noch hermetisch wird. Vielmehr fordern seine Gedichte auch nach Jahrzehnten noch zur Interpretation und zur Anteilnahme, zum Spiel und zur Variation, zur Nachahmung und zur intellektuellen Auseinandersetzung heraus, wie sich im Umgang im Literatur- oder Fremdsprachenunterricht, oder auch beim Vorlesen seiner Gedichte vor Kindern zeigt. Ein wesentlicher Grund für diese Verbindlichkeit und Widerständigkeit seiner Texte liegt vermutlich darin, dass sie sowohl mit seinen eigenen Alltagserfahrungen und einem allgemeinen Sprachgedächtnis verknüpft bleiben und gleichzeitig immer wieder aufs neue die eigene Ästhetik existenziell hinterfragen und aufs Spiel setzen. Jandl ist wohl deshalb auch kein Autor eines durchgehaltenen Stils, gerade einmal ein einziger Gedichtband besteht aus einer einzigen Art, Gedichte zu machen, nämlich seine stanzen von 1992, sondern er ist ein Autor der Innovation und Reflexion, Dieser ungeschützte und gleichermaßen mutige Zugang zur Produktion von Gedichten macht Jandls Werk letztlich zu einer existenziellen und poetologischen Recherche, die bedingungslos nach Ausdrucksmöglichkeiten sucht, Veränderungen im Ganzen, im Gesellschaftsgefüge anzuregen, die eben dort im eigenen Ich und seinem Alltag, im Selbst, in den eigenen vier Wänden ihre Spuren und Prägungen hinterlassen haben: „Ich versuche, meinen Gedichten gesellschaftliche Aufgaben zu stellen. Verschiedene – aber eine vor allem: die Beseitigung gewisser Vorurteile, die sich auf die Sprache beziehen“, schreibt er in einer kleinen poetologischen Notiz 1970. Trotz dieses gesellschaftlichen Anspruchs und der ästhetischen Neugier haben seine Gedichte vielleicht gerade in diesem nie ausgeklammerten Bezug auf die alltäglichsten Erfahrungen eine Art erzählerischen Anker. Ja, Jandl ließe sich durchaus als Erzähler der Poesie, ganz zugespitzt als Joyce der Poesie bezeichnen. Wobei wohl nicht zuletzt dank radikaler Aussparungen und Reduktionen jener Möglichkeitsraum entsteht, der sich stets mit Partikeln des eigenen Alltags verbinden lässt, sodass sich seine Dichtung nie gänzlich verschließt. Auch dies kommt bei näherer Betrachtung einem Paradox gleich, lässt sich seinen Gedichten ja dennoch ein Hang zur Autonomie, ja durchaus der Anspruch auf Autonomie im Sinne der Aufklärung, die diese Autonomie für die Kunst erstmals unzweifelhaft eingefordert hat, ablesen. Mit keinen biographischen oder sonstigen literaturwissenschaftlichen Erklärungsmodellen lässt sich deshalb auch Jandls Dichtung gänzlich beikommen. Ja, man müsste wahrscheinlich sogar umgekehrt sagen, diese Gedichte selbst werden zu neuen Formen jener Wissenschaften, die sie zu erklären versuchen. Jandls Gedichte lassen sich in diesem Sinne als angewandte Linguistik, als angewandte Psychoakustik, als sich selbst darstellende philosophische Exempla und als angewandte Grammatik verstehen, als Existenzgrammatik freilich, die herkömmliche grammatische Schulbuch- und Schulbeispiele gleichsam verdichtet, verwandelt, eben dichtet.
In seinen fünf Schreibjahrzehnten hat Jandl über 10 Gedichtbände verfasst, Essays, Hörspiele, einige Theaterstücke, Übersetzungen und es sind zahlreiche Tonaufnahmen nicht zuletzt gemeinsam mit Musikern und Jazzmusikern entstanden. Der zunächst noch starke kompositorische Impetus von Laut und Luise wurde in den 80er Jahren jedoch zunehmend von einer auch seiner manisch-depressiven Anlage geschuldeten Zurücknahme ersetzt. Die späten Gedichtbände wurden überhaupt zur Gänze von seinem Lektor beim Luchterhand-Verlag, Klaus Siblewski, zusammen gestellt. Während Jandl in den 80er Jahren einige der renommiertesten Preise erhielt, darunter etwa den renommierten Georg-Büchner-Preis, orientierte sich sein Schreiben immer grundsätzlicher an der Krise und den Krisenzuständen des Schreibens und der Existenz. Diese elementare Forschungsarbeit an Abgründen, Ausnahmezuständen und Randphänomenen fand spätestens seit den ab 1976 entstandenen Gedichten in sogenannter heruntergekommener Sprache, die Jandl selbst zu einer seiner großen ästhetischen Veränderungen zählte, ihren Ausdruck. Der kleine Gedichtzyklus tagenglas, in dem Jandl dieses ans sogenannte Gastarbeiterdeutsch angelehnte Idiom einer radikal vereinfachten, holprig wirkenden Sprache erstmals verwendete, lässt sich vermutlich sogar als ein Grundbuch der Dichtung verstehen und etwa mit dem kleinen 1912 erschienenen und Morgue betitelten Gedichtzyklus Gottfried Benns vergleichen, mit dem jener den toten Körper geradezu physisch auf den Leib rückt. Oder auch, um ein weiter zurückliegendes Beispiel ähnlich elementarer Dichterarbeit am Tabu zu nennen, mit Charles Baudelaires Les fleurs du Mal. Mithin mit jenen legendären Gedichten aus den 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, die erstmals die Abgründe und Abseitigkeiten der Stadt und ihrer Existenzformen in die Dichtung zogen und mit der Form des Sonetts paarten. Jandls Affinität als Englisch-Lehrer und immer wieder in der englischen Sprache dichtender Autor würde über derartige europäische Vergleiche wohl noch eine weitgefasste Untersuchung der amerikanischen und angelsächsischen Literatur mit Jandl nahelegen.
Feststellen lässt sich aber bereits, dass Ernst Jandl eine Art Synthese scheinbar heterogener Strömungen innerhalb der österreichischen und mitteleuropäischen Kunst gelungen ist, die sowohl das Erbe der Avantgarde der 10er und 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ohne Imitationszwang oder Abgrenzungsprobleme antrat, gleichzeitig die Forderungen nach einer engagierten Kunst der 60er und 70er Jahre ernstnahm und sich der Aufgabe einer gesellschaftsorientierten Kunst stellen konnte, ohne die Notwendigkeit einer selbstorganisierten Institutionalisierung der 70er und 80er Jahre zu ignorieren und darüber hinaus auch noch die Sehnsucht einer elitär als experimentelle Kunst definierten Kunstauffassung innerhalb der sogenannten avancierten Literatur und Szene nach einer realistischeren Dichtung und ihrer spielerischen Infragestellung zu erfüllen. Hinterlassen hat Ernst Jandl ein vielgestaltiges, letztlich immer am einzelnen Gedicht als einem universalen Ausdrucksmittel orientiertes Werk, das fast zur Gänze in Wien entstanden ist und dennoch seine viel komplexere Mitte im eigenen Ich und seiner von allen möglichen Strömungen durchkreuzten Gegenwartssprache von vielfältiger Welthaltigkeit findet. Das der fast 70jährige Jandl etwa im Rap und in den CD’s des Duos Attwenger substantielle Anregungen für seine stanzen fand, die als eine Art späte und inhaltlich-ästhetisch radikale Zusammenschau seiner gesamten Dichtung verstanden werden kann, ist in diesem Kontext so erstaunlich wie naheliegend: Jandl fand in diesen vierzeiligen Kurzgedichten von heiter-abgründiger Art Anfang der 90er Jahre einen weiteren Motor seiner Produktion und ließ sie gleichsam zu einem wilden Reigen auftanzen, in dem Tote, Alternde, Lüsterne und Gezeichnete, Hässliche und Heitere auf- und abtreten, dass nichts übrigbleibt, als vielleicht die Sprache selbst, und mit ihr vielleicht doch alles? Jandl lesend weiter zu erkunden steht immer zu Gebote.
Michael Hammerschmidt, aus Johann Georg Lughofer (Hrsg.): Ernst Jandl, Praesens Verlag, 2011
Die Sprache um ihr Selbstverständnis gebracht
– Autorenlesung Ernst Jandl im Theater an der Winkelwiese. Nach dem Premierenerfolg von Ernst Jandls Sprechoper Aus der Fremde nahm das Literaturpodium der Stadt Zürich die Gelegenheit wahr, den anwesenden Autor für eine Lesung zu engagieren, damit die Jandlischen Sprachexperimente einmal authentisch zu Gehör gebracht werden. –
Die literarisch interessierten Zuhörer der Autorenlesung drängelten sich im überfüllten Theater an der Winkelwiese und nutzten jede freie Ecke und jede Bodenlücke für einen Sitz- oder Stehplatz aus. Der. Wiener Sprachkünstler hatte sein begeistertes Publikum. Peter K. Wehrli führte wortgewandt den Dichter ein und verwies auf ein 15 Jahre zurückliegendes Ereignis, als Ernst Jandl in London vor 7.000 Engländern einen Sturm der Begeisterung entfachte. Die radikale Vermittlung von Kunst gewann auch jenseits ihrer konkreten Wortbedeutung Sinn, und die neue Wort- und Sprachverwertung erzeugte neue Bedeutungen. Ernst Jandl benutzt analog den Dadaisten das landläufige Sprachmaterial, um durch grammatikalische Umstellungen, Reduzierung, Amputation, Vokal- und Konsonantenveränderung die Kruste der Tradition aufzubrechen und die Sprache um ihr eingefahrenes Selbstverständnis zu bringen. Dabei gesellt sich auch die optische Gestik zur phonetischen und zur semantischen – als Ergänzung, Erweiterung und Spannung. Oft arbeitet Jandl mit Letternrudimenten, wo der Leser nicht mehr bis zum differenzierten Laut vordringen kann. Es bleibt die Imagination eines vielschichtigen Lautpotentials, das verschiedene Mitteilungen als möglich vorstellt, Ernst Jandl steht dabei in kritischer Distanz zu diesen Experimenten und ironisiert die „alphabetischen Klümpchen“, den „lexikalischen Schleim“, der „hinuntergeschossen vom Kopf auf die Finger, die flinken, fällt“.
Seinen Sprach- und Wortorgien ist stets ein Rhythmus inne, und seine Ideogramme werden von den klassischen Formen der konkreten Poesie bestimmt. Von Sätzen und Wörtern bleibt oft nur eine Ahnung, wobei die vom Hörer oder Leser selbst zu leistende Kombination und Assoziation den meisten Spass bereitet. Zuweilen mutet Jandls Sprache wie ein Gastarbeiterdeutsch an, und zugegebenermassen will er auch diese aus der Literatur verdrängte oder überhaupt noch nicht eingelassene Sprachform poetisch fruchtbar machen. „Ich sein ein gross’ Künstler“ aus dem Einakter Die Humanisten, wo der Text unter das Niveau der Alltagssprache fällt, soll ein Tabu brechen und der heruntergekommenen Sprache eine Artikulationslücke schaffen. Aehnlich wie die Dialektgedichte zur Wiedererweckung der konkreten Kunst gehört, sind die Sprachexperimente Ernst Jandls der Versuch, poetisch unverbrauchtes Sprachmaterial literarisch einzusetzen. Er vermochte mit seiner engagierten Lesung, die keineswegs der Heiterkeit entbehrte, einen amüsanten Abend zu gestalten, bei dem er wie ein Akrobat mit tollkühnen Balanceakten frappierte.
K. P., Neue Zürcher Nachrichten, 5.3.1980
Der unmanierliche Dichter, oder:
Individualstil und Experiment
– Über Ernst Jandl. –
Nach einem unwidersprechlichen Aperçu dieses Dichters lassen sich „rechts“ und „links“ leicht „velwechsern“. Es wird deshalb klug sein, die Unterscheidungskraft auch anderer Begriffspaare nicht unmäßig hoch zu veranschlagen, schon gar nicht, wenn man sie einzig zu Unterscheidungszwecken ins Spiel bringen möchte. Ich sage: ins Spiel, und ich meine die schon im Titel verwendeten Wörter „Experiment“ und „Individualstil“. Deren Bestimmung läuft zwar auf eine strikte Gegensetzung hinaus, doch die Pointe ihrer Anwendung auf die Lyrik Ernst Jandls wird ihre Verwechselbarkeit sein. Dies zu bemerken, o Leser, bereite dich vor. Es geht um die Feststellung der Nicht-Eigenart eines zugleich doch höchst eigenartigen Dichters. Und mir scheint, daß erst dann der poesiegeschichtliche Ort der Jandlschen Lyrik bestimmt werden kann, wenn sich mit der Nützlichkeit dieser Begriffe zugleich auch ihre Untauglichkeit erwiesen hat. Zu diesem Zweck muß man sie erst einmal hinreichend klar definieren, nämlich als Entweder-Oder.
Individualstil ist eine Erkennungsmarke in Texten, der Autor gewinnt durch ihn seine personale Kenntlichkeit. Wandlungen sind möglich, und für die verschiedenen Entwicklungsphasen eines Gesamtwerkes kann die Eigenart stark differieren; Sujet-Zwänge oder Gattungsnormen wirken modifizierend auf den Individualstil ein. Trotzdem wird er sich aus den Eigenarten des Wortgebrauchs, des Tones, des syntaktischen, bildhaften und kunst-handwerklichen Repertoirs hinreichend beschreiben lassen. Wo ein Individualstil sich zeigt, sollte der Kenner imstande sein, verschiedene Texte als Texte des einen Autors zu identifizieren, vielleicht sogar Imitationen als Imitationen. Anders beim Experiment, dessen wesentliche Voraussetzung gerade die Verwechselbarkeit des experimentierenden Subjekts ist. Zwar dürften nur wenige Auroren das Ziel einer individualstilistischen Kenntlichkeit anders erreicht haben, als auf dem Weg der Nachahmung und des Probierens. Ein solches Probieren steht aber im Dienst der erhofften Unverwechselbarkeit und kann gerade deshalb nicht Experiment heißen: es bleibt ein Erproben der Eigenart im Vorfeld des Individualstils. Sicher kommt der stärkste Antrieb zum poetischen Schreiben gerade aus dem Bedürfnis, sich selbst und anderen kenntlich zu werden, also der Verwechselbarkeit zu entfliehen. Die experimentelle Schreibhaltung aber ist über diesen Kenntlichkeits-Anspruch hinaus. Womit ich nicht sage, daß die Unkenntlichkeit etwa das Ziel solchen Schreibens wäre, wohl aber: daß der experimentierende Poet die Arbeit am Individualstil eher als eine Fron empfindet, deren Kenntlichkeits-Prämie ihm gegenüber der Freiheit seines Methoden-Wechsels zweifelhaft erscheint.
Soviel zur Definition dieser beiden Begriffe. Was sie bezeichnen, steht deutlich genug gegeneinander, und man wird finden: zu deutlich. Der Einspruch gegen so strenge Begriffe kommt von der poetischen Praxis, er kommt ebenso von den Ich-Poeten wie von den experimentierenden Dichtern, und er kommt aufs eindringlichste aus den Texten Ernst Jandls. Doch die Brauchbarkeit dieser Markierungen (und zwar über ihren heuristischen Zweck hinaus) deutet sich an, wenn man sich daran erinnert, daß die Entwicklung der experimentellen Poesie eins ist mit der Leidensgeschichte des Ich-Ausdrucks im modernen Gedicht. Die begriffliche Verfestigung dieser beiden Tendenzen will als der Reflex eines bestimmten Augenblicks ihrer gemeinsamen Geschichte verstanden sein: auf dem Höhepunkt der Konkreten Poesie, Anfang der sechziger Jahre, trat der Gegensatz von Individualstil und Experiment überdeutlich zutage. Damit war ein Maßstab zeit- und poesiegeschichtlicher Erfahrung gesetzt. Und jede nachfolgende Lyrik hatte zwischen diesen Extrempositionen ihren je eigenen Ausgleich zu suchen, wie labil er auch ausfallen mochte. Ernst Jandl gibt uns seit nunmehr drei Jahrzehnten das Beispiel eines solchen Ausgleichs – falls „Ausgleich“ das richtige Wort dafür ist; denn was hier begriffen und, falls möglich, benannt sein will, scheint mir sehr paradox. Jandl gilt als der Inbegriff eines experimentierenden Poeten, ich sehe aber keinen, dessen individuelle Kenntlichkeit größer wäre.
Jandl hat sich auf keine Schreibart, auf keinen Ton, keine Methode festgelegt oder festlegen lassen. Er praktiziert einen Methodenpluralismus, der phonetische und graphematische Demonstrationen ebenso einschließt wie traditionelle poetische Techniken. Sein gesamtes Werk könnte als ein gewiß nicht vollständiges, aber doch jederzeit durch ihn selbst zu ergänzendes Kompendium dessen gelesen werden, was in heutiger Poesie überhaupt möglich ist. Und wievieles ist möglich geworden und hat sinnliche Überzeugungskraft gewonnen, weil er es erprobte. Seine Entscheidung für die Pluralität der Methoden, für die Dichtung als sprachliches Experiment versteht er selbst als „eine fortwährende realisation von freiheit“. Diese Freiheit wird durch den Primat der Methode beim jeweils einen Experiment nicht etwa in Frage gestellt, sondern sie beweist sich gerade im beharrlichen Wechsel der Problemstellungen und der Prozeduren. Dadurch entsteht eine starke Unberechenbarkeit. Im einzelnen Text – oft erst bei sorgfältiger Prüfung erkennbar – herrscht Ordnung, strenge Beschränkung, Kontrolle des Materials, Wirkungsbedachtheit. Das Ganze aber ist widerborstig, ordnungswidrig, mit dem starken Geruch des Anarchischen behaftet. Dieses Anarchische kann ich durchaus nicht als heiter erkennen, auch wenn wir ihm so melancholisch-verspielte Texte wie „Hosianna“ oder „Otto Mops“ verdanken. Ich will dazu Sätze aus Jandls Vortrag „voraussetzungen, beispiele und ziele einer poetischen arbeitsweise“ (1969) zitieren:
die manipulatoren einer weitgehend gleichgeschalteten gesellschaft sehen ihr system gefährdet durch den anspruch der modernen kunst auf einen bereich, wo ohne lenkung von außen immer wieder neue modelle von freiheit entstehen. Bedrohlich erscheint ihnen, daß kunst zu einem muster für gesellschaft werden könnte, einer gesellschaft, in der zahlreiche gleichzeitig daran sind, sich jeder sein eigenes modell von freiheit zu zimmern.
Wer diesen Sätzen zustimmt, wird Jandls experimentelles Schreiben als eine beispielhafte „realisation von freiheit“ im Medium der modernen Poesie anerkennen, und er wird dafür dankbar sein, selbst dann, wenn er in einer Gesellschaft nicht leben möchte, in der allzu viele die anarchische Nachahmung dieses literarischen Exempels praktizieren.
Am Ende des Vortrags wird uns erklärt, daß die Freiheit des experimentierenden Schreibens allerdings eine Freiheit in Wind und Regen ist:
die experimentelle dichtung, wie jede art dichtung, und zu jeder zeit, entsteht zwischen den mustern der umgangssprache und den mustern der poesie. dazwischen – das ist ihr raum. um hervorzutreten, das heißt sich abzuheben, braucht sie distanz zu beiden. ihr ziel ist es, gerade jenen abstand von beiden zu finden, der notwendig ist, um sie vor allzu raschem verwittern zu bewahren. es regnet von beiden seiten unaufhörlich auf sie ein. und es gibt keinen schirm.
Eine klare Bestimmung. Natürlich gilt sie für jede Art Dichtung, nicht nur für die experimentelle. Der gleiche Regen. Was nützt da ein Schirm, wenn es von bei den Seiten kommt, aus den Muster-Wolken der Umgangssprache, aus den Muster-Wolken der literarischen Tradition und noch aus ganz anderen „Wolken“. Durch diesen „Schirm“ soll sich, sagt Jandl, die experimentelle Dichtung von jeder anderen, die gleichfalls im Regen steht, unterscheiden: für sie gäbe es diesen Schirm eben nicht. Hier ist ein Denkbild gesetzt, ein Gedanke ist ins Bild hinübergetreten, vielleicht ein Begriff, nach dessen Bestimmtheit gefragt werden darf. Haben denn, frage ich, die anderen, die nicht experimentierenden Poeten, wirklich ein solches Ding zur Hand, ein Etwas, das zwar nicht hält, was es verspricht, das aber doch vielleicht, indem man es hochhält, eine Art von Halt, die vielleicht notwendige Fiktion eines Schutzes ermöglicht? Und wenn sie es haben – dieses Etwas, diesen Schirm, der nicht schirmt – warum halten sie es (oder ihn) hoch, warum tragen sie ihn (oder es) dennoch durch diesen doppelten Regen? Was ist das für eine Tradition des vergeblichen Schirm-Hochhaltens? Sie läßt sich benennen. Es ist die Tradition des europäischen individualistischen Gedichts, des Gedichts als versuchter Ich-Aussprache und Ich-Behauptung.
„Ein Gedicht ist immer die Frage nach dem Ich“, heißt es in Benns Marburger Rede über „Probleme der Lyrik“. Für Paul Celan war das Gedicht der Versuch eines gefährdeten, von Stummheit bedrohten Menschen, sich in seiner „allereigensten Enge“ freizusetzen. Günter Eich nannte Gedichte „Definitionen“, Selbst-Versicherungen, Weltvergewisserungen, die zu gewinnen ihm „lebensnotwendig“ war: „In jeder gelungenen Zeile (schrieb er 1956) höre ich den Stock des Blinden klopfen, der anzeigt: Ich bin auf festem Boden.“ Dieses in die „allereigenste Enge“ Gehen, dieser „Blindenstock“ und jener „Schirm“ – ich denke, sie meinen dasselbe Etwas, an das sich fast alle modernen Lyriker, die noch „ich“ sagen wollen, klammern oder geklammert haben, jenes Etwas, das es für den experimentierenden Dichter nicht geben soll. Die Entscheidung zur Dichtung als einem sprachlichen Experiment wäre dann die Entscheidung gegen den „Blindenstock“ (bei vorgegebener Blindheit) und gegen den „Schirm“, das Erkennungszeichen dessen, der schutzlos im doppelten Regen steht; sie wäre also die Entscheidung gegen einen radikalen Ich-Bezug des poetischen Schreibens und gegen die für ein solches Schreiben notwendige Verfestigung des Sprachgebrauchs zum poetischen Individualstil.
In keiner literarischen Gattung ist aber die Frage nach dem künstlerischen Rang eines Autors so eng mit der Frage nach den unverwechselbaren Identitätsmerkmalen seiner Texte verbunden wie in der Gattung, die wir traditionellerweise „die Lyrik“ nennen. Trakl hat sich 1910 in einem Brief an Buschbeck bitter darüber beklagt, daß die „heiß errungene Manier“ seiner Gedichte schon nachgeahmt wurde, kaum daß er sie gefunden hatte. Eine solche individuelle Manier ließe sich für jeden bedeutenden Lyriker der Moderne beschreiben. Bei ihren Nachahmern tritt sie als Uneigenart hervor, und die Nachahmer sind in der Mehrzahl. Gerade die Ich-Poesie, mit dem Ziel der Unverwechselbarkeit vor Augen, führt allerdings verräterisch oft zu verwechselbaren Resultaten. Uneigenart bleibt die Regel, und Trakls Zorn könnte als tiefsten Grund die fatale Gewißheit haben, daß jenes vermeintliche Eigene zweifelhaft bleibt, weil es nachgeahmt werden kann. Und macht nicht bereits die Reproduktion des Heißerrungenen durch seinen Besitzer gerade das Eigene auch wieder fremd? Nämlich: die Manier eines Dichters gibt allen seinen Gedichten, was nur einem oder einigen von ihnen wirklich zusteht. Selbst unterm Schirm des Individualstils ist das einzelne Gedicht von der Verwechselbarkeit bedroht.
Es war seit jeher das Schwerste, unverwechselbar im Gedicht zu sprechen. Im 20. Jahrhundert haben sich aber die sozialen Rahmenbedingungen des Ich-Sagens drastisch verschlechtert – auf irreversible Art, wie wir fürchten. Nicht daß die Emphase des Ich-sagen-Wollens aufgehört hätte. Doch es grassiert ein Unrechts-Bewußtsein: Besitz ist in sozialen Verruf geraten und mit ihm fast auch der Anspruch auf Individualität. Wie sich im 18. Jahrhundert zuerst im Sprachrausch der Verse von Klopstock das Ich als Eigentum zu erkennen gab, so blieb bis heute die Dichtung der sensibelste Seismograph jeder historischen Ich-Verfassung. Die experimentelle Poesie ist ein Reflex jenes Unrecht-Bewußtseins; sie verstand sich in den fünfziger und sechziger Jahren ausdrücklich als Gegenbewegung zur Ich-Poesie, sie dokumentiert deren Krise.
Von dieser poesiegeschichtlichen Situation gibt es eine interessante Momentanaufnahme, einen Schnappschuß. Er findet sich in der Taschenbuchausgabe der Anthologie Mein Gedicht ist mein Messer, herausgegeben von Hans Bender. (Ernst Jandl kommt in dieser repräsentativen Sammlung von 1961 noch nicht vor.) Ziemlich genau in der Mitte des Bandes stehen ein Gedicht und ein Brief von Paul Celan und daneben zwei Texte von Helmut Heissenbüttel, ein theoretischer und ein poetisch-experimenteller. Celans Brief enthält eine scharfe Zurückweisung der experimentellen Schreibhaltung; Heissenbüttels Beitrag gehört zu den apologetischen Texten der experimentellen Poesie. Celan begründet zunächst seine Weigerung, sich zum Handwerk des Dichters zu erklären:
Handwerk – das ist Sache der Hände. Und diese Hände wiederum gehören nur einemMenschen, d.h. einem einmaligen und sterblichen Seelenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg sucht. / Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.
Mit polemischem Affekt spricht er dann gegen „das Herumexperimentieren mit dem sogenannten Wortmaterial“ gegen die „Mache“, die er in „Machenschaft“ enden sieht. Gedichte seien „Schicksal mitführende Geschenke“. Dagegen trägt Heissenbüttel, prägnant und nuancenreich, eine Diagnose des kulturellen Zustands am Beispiel des poetischen Sprachgebrauchs vor, der als individueller Sprachgebrauch historisch nicht mehr möglich sei:
Der Unterschied zwischen dem, was ich als mich bezeichne und dem, was ich nicht bin, verwischt. Gar nicht (oder von außen her) orientiert. Kann ich darüber reden?
Nicht in der Diagnose der kulturellen Verfassung unterscheiden sich beide Autoren, wohl aber in der poetischen Konsequenz. Sie hieß bei Heissenbüttel: „reiner sprachlicher Bezug“, also Poesie als Experiment, bei Celan: Individualstil, Versuch der Selbstbehauptung, trotz allem. Dieser Gegensatz erscheint in der Mitte des Benderschen Buches personalisiert. Momentaufnahme. Seine Zuspitzung hat das nicht-individuelle experimentierende Schreiben in den Konzepten der Konkreten Poesie gefunden; das ich-besessene Schreiben hatte seinen Höhe- und Krisenpunkt in Celans späten Gedichten. Die Konkrete Poesie scheint inzwischen in Langeweile untergegangen zu sein; Celan starb in der Seine. Sein Spätstil gibt das Beispiel einer tragischen Verkrampfung. Immer unzugänglicher wurde die Botschaft der Texte, immer unkenntlicher das Ich in der Anstrengung seiner Selbstbehauptung. Umso deutlicher trat in Celans Texten gerade die Materialität der geschundenen Worte zutage. Hier sehe ich eine Annäherung der Extreme: rein phänomenal lassen sich radikaler Ich-Bezug und radikaler Sprach-Bezug kaum unterscheiden. Der Extremismus des Celanschen Individualstils wie die strikte Ich-Ferne des konkreten Schreibens – beide hatten sich schließlich als Verengungen erwiesen. Die Aporien der Extrempositionen waren kenntlich geworden. Unter dem Eindruck dieser Erfahrung steht vorerst jede nachfolgende Dichtung.
Aber wie war diese poesiegeschichtliche Erfahrung zu bewältigen? Man kann aufhören, ein konkreter Dichter zu sein; man kann dem extremen Ich-Gedicht abschwören; man kann sogar überhaupt mit dem Dichten aufhören. Man kann, man konnte, und etliche haben es auch getan. Man konnte diese Erfahrung aber auch zu verdrängen suchen, konnte die Poesie von sich selber befreien, indem man sie in den Dienst von sozialen, politischen oder sonstigen Botschaften stellte. Ein Großteil der späteren lyrischen Texte wurde und wird bis heute offensichtlich unterhalb des einmal erreichten Erfahrungsniveaus geschrieben. Die neue Naivität, die neue Subjektivität im Gedicht – es gibt sie ja, und es gibt freilich auch eine Notwendigkeit des Vergessens, wenn es überhaupt weitergehen soll. Man kann die Erfahrung dieses Widerspruchs aber auch auszuhalten versuchen. Auf der Ebene der Begriffe scheint er zwar unaufhebbar; wer aber im Bewußtsein dieser Erfahrung weiterschreiben will, weil er nicht anders kann, dessen Schreiben wird eine angestrengte Probe auf die Vereinbarkeit des Unvereinbaren sein müssen. Das läuft auf Paradoxie hinaus, und die Paradoxie ist bekanntlich die bestimmende Denkfigur des Tragischen und der Narrheit. Wo die Grenze verläuft, bleibt ungewiß. Etwa im Spätwerk Günter Eichs: Geschwätzigkeit als Modus des Verstummens, Weisheit als Nonsense, Ich-Ausdruck und Beliebigkeit des Subjektes, beides zugleich – Dichtung als „Maulwurf“. Wie soll ich es nennen: Individualstil oder experimentelles Schreiben? Beim späten Eich wie beim späten Celan gibt sich die Materialität der Sprache zu erkennen. Tragisch oder närrisch bleiben ihre Texte auf Ich-Artikulation und Individualstil fixiert, aber es zeigen sich Merkmale experimentellen Schreibens. (Als Beispiel nenne ich Celans Gedicht „Huhediblu“ aus der Sammlung Die Niemandsrose.) Für solch ein Umschlagen von Individualstil ins Gegensätzliche sehe ich auf Seiten der experimentellen Poesie nur ein überzeugendes Pendant: Ernst Jandl. Ich sage damit nicht, daß im Werk dieses experimentellen Dichters etwa eine Art von Individualstil erkennbar wäre. Die Verwechselbarkeit des spielenden Subjektes ist bis heute die Voraussetzung des Jandlschen Schreibens geblieben. Dennoch zeigt Jandls Gesamtwerk – und in diesem Oeuvre der einzelne Text, die Textgruppe – einen überraschend hohen Grad an auktorialer Kenntlichkeit. Es scheint, als stelle sich bei Jandl gegen die Voraussetzung seines experimentellen Schreibens ein personaler Bezug her, gleichsam hinter dem Rücken des Experimentators. Man möchte erwarten, daß es nicht allzu schwer sein könnte, dafür im einzelnen Text die sogenannten philologischen Beweisstücke zu finden. Ich werde gern weitersuchen, aber noch habe ich keine gefunden.
Um meine Ratlosigkeit – eine staunende Ratlosigkeit – zu begründen, greife ich drei Gedichte heraus. Sie stehen in drei verschiedenen Sammlungen, könnten aber durchaus auch nebeneinander in Jandls letztem Buch Der gelbe Hund erscheinen. Nur die Verschiedenheit der Sprachbehandlung und das Fehlen auktorialer Erkennungszeichen möchte ich vorführen – eine Art Augenschein des ohnehin Augenfälligen.
Aus Jandls Gedichten ist zu begreifen – und nichts so sehr wie gerade dies –, daß der experimentierende Poet die Ausdrucks- und Beweisnöte des nach Sprache suchenden Individuums genau so gut wie jeder andere Schreibende und Sprechende kennt. Er lebt ja in derselben Zeit, in derselben gleichschaltenden Gesellschaft, weshalb sollte seine Leidensfähigkeit geringer, weshalb sollte es gerade ihm weniger schmerzlich sein, daß wir so verwechselbar sind. Dennoch oder gerade deswegen geht er auf Distanz zum Ich, entscheidet er sich für den kühlen Methodenwechsel, gegen das Eigenartig-sein-wollen- und -müssen. Er geht, mit Jandl gesprochen, auf „die andere seite der sprache“, dorthin, wo die Subjekte – das „Ich“ und das „Wir“ – zunächst nur grammatikalische Größen sind. Dort erscheinen dann die Wörter als pures Material, wenn auch immer als Material mit Geschichte. Die Geschichte der Wörter und Wortbedeutungen aber ist unsere Kulturgeschichte. Selbst in programmatisch subjektfrei gehaltenen Texten kann und muß etwas von ihr beredt werden, manchmal vielleicht sogar unverstellter als es in nicht-experimentellen Gedichten heute noch möglich scheint.
So leiden wir darunter, daß Worte, die wir benötigen, ihre Bezeichnungskraft verlieren. Wir können der Botschaft des Evangelisten Johannes nachsinnen: der Anfang der Schöpfung sei in einem Wort beschlossen gewesen, im Wort „Gott“. Wir mögen in Betroffenheit grübeln, was alles geschehen mußte, bevor dieses Wort für die meisten von uns zum Begriff einer Beziehungslosigkeit wurde. Und dann möge uns jemand darüber ein Ich-Gedicht schreiben mit Worten wie Hiob, wenn er es heute noch vermag. Ernst Jandl aber hat in seinem Text „fortschreitende räude“ die Anfangsworte des Johannes-Evangeliums einer technischen Verfremdungsprozedur unterworfen:
FORTSCHREITENE RÄUDE
him hanfang war das wort hund das wort war bei
gott hund gott war das wort hund das wort hist fleisch
geworden hund hat hunter huns gewohnt
him hanflang war das wort hund das wort war blei
flott hund flott war das wort hund das wort hist fleisch
gewlorden hund hat hunter huns gewlohnt
schim schanflang war das wort schund das wort war blei
flott schund flott war das wort schund das wort schist
fleisch gewlorden schund schat schunter schuns gewlohnt
schim schanschlang schar das wort schlund schasch wort
schar schlei schlott schund flott war das wort schund
schasch fort schist schleisch schleschlorden schund
schat schi unter schl uns scheschlohnt
s——————————–c———————————-h
s——————————–c———————————-h
schllls——————————-c———————————-h
flottsch
Den Sinn der Johannes-Verse zu erfassen, hat man sich wahrlich genug bemüht. Wie hat sich der Dr. Faust angestrengt, das Offenbarungswort in Goethes „geliebtes Deutsch“ zu übersetzen. Das alles geht hier kaputt, wird als bereits kaputtgegangen vorausgesetzt und von Jandls Sprachmaschine durchgehackt und ausgespuckt („flotsch“). Hier ist ein Text, scheinbar ohne Teilnahme eines Ich, scheinbar ohne Trauer, ein Text von subjektlosem Wahnsinn, voller Methode. Was ist unserer Kultur, unserem Glauben widerfahren, daß solche Texte möglich wurden: „fortschreitende räude“. Man friert, wenn man es liest. Aber nicht aus Jandls Text kommt die Kälte, der Text ist nur ihr Barometer. Sie ist außen, und sie ist in uns. Tatsächlich wird einer, der die Wirkung dieses experimentellen Gedichtes spürt, kaum noch zwischen Veräußerlichung und „allereigenster Enge“ (um Celans Wort zu wiederholen) unterscheiden können. Man ahnt, daß die Freiheit des experimentierenden Dichters eine ungemein anstrengende Freiheit sein muß. Offenbar ist das Tilgen der Ich-Spuren in einem solchen Text für den Schreibenden eine ebenso mühevolle Trauerarbeit wie die Arbeit jeder Ich-Definition im Gedicht. Ich halte „fortschreitende räude“ für ein verzweiflungsvolles Dokument moderner Poesie. Der von Heissenbüttel geforderte „radikale sprachliche Bezug“ vernichtet hier schließlich die Sprache selbst, und indem sie zunichte geht, ist zugleich ein großer Gedanke erloschen. Am Ende bleibt kein Sinn und kein Wort mehr bestehen, nur noch ein „flotsch“. Dieses „flotsch“ ist freilich nicht mehr von der „anderen seite der sprache“ her gestammelt – es steht jenseits der Menschensprache. (Ich darf hier vielleicht an Celans Gedicht „Tübingen Jänner“ erinnern, das mit dem Unwort des umnachteten Hölderlin endet: „Pallaksch. Pallaksch“.)
Wer auf jener „anderen seite“ bleiben könnte, beim reinen Wort-Material, müßte zu einer dauernden Ich-Verleugnung imstande sein; er müßte seine Arbeit als eine nicht nur schreibend zu vollziehende Selbst-Auslöschung verstehen oder zu schreiben aufhören. Darauf scheint das Absinken der Konkreten Poesie aus der forcierten Ich-Verleugnung in die Belanglosigkeit hinzudeuten und: daß es Konkrete Poesie heute, nach wenigen Jahren, schon fast nicht mehr gibt. Ich glaube, daß wir vor allem an Ernst Jandls Gedichten – zumal an seinen zuletzt geschriebenen – wirklich ermessen können, welchen hohen Gewinn das radikale ich-ferne Experiment der Konkreten Poesie unserer neueren Poesie gebracht hat. Mit den konkreten Poeten hat Jandl eine Zeit lang versucht, jenem fatalen Druck auszuweichen, der schon seit langem das Individuum aus der Sprache verdrängt. Um aber ganz auf der „anderen seite der sprache“ zu bleiben, war er nicht selbstvergessen genug. Er ist zu schmerzempfindlich, um sich am Rohstoff Sprache abarbeiten zu können, nur um die Literatur um ein paar Beispiele für jedermanns Verwechselbarkeit zu bereichern. Dazu ist er nicht verwechselbar genug. Gewiß, er hat die Freiheit des Experimentators gewählt, die Freiheit, keine Identitätszeichen setzen und keine „Manier“, keinen Schirm besitzen zu müssen. Aber gerade aus dieser Entscheidung gegen den Individualstil der Ich-Poesie sind ihm neue Möglichkeiten einer welt-, also schmerzbetroffenen Lyrik zugewachsen. Ein authentischer Ich-Ausdruck ist ihm möglich geworden: Ich-Ausdruck unter den Bedingungen der Uneigenheit.
Das Ich selber gibt sich in seinen Gedichten als Experiment zu erkennen; es hat seine Verwechselbarkeit leidend angenommen.
Die poetischen Resultate sind paradox. Ich sehe im Gewinn dieser Möglichkeit eines Ich-Ausdrucks unter den Bedingungen des Experimentes das bedeutendste Resultat des Jandlschen Schreibens und halte dies für ein poesiegeschichtliches Ereignis.
Wenn es eine Lyrik des wissenschaftlich-technischen Zeitalters gibt, die sich nicht auf verbale, sozusagen wort-semantische Weise, sondern durch ihre Methodologie – Poetik des Methodenpluralismus – kenntlich macht, so gab Jandl das eindrucksvollste Beispiel einer solchen Dichtung. Er hat die Sprache als den Rohstoff vieler, zu vieler Möglichkeiten vorgeführt, er hat sie in ihrer „fortschreitenden räude“ geradezu systematisch bloßgestellt und in Dienst genommen. In seinen letzten Büchern ist er dabei, sie zu schinden, wie nur ein Gequälter zu schinden vermag. „Erwarte / von wörtern nichts“ heißt es in einem Gedicht von 1979 – „(…) doch was du dem geringsten / von ihnen / angetan / kann / etwas sein.“ So nimmt er etwa den Wörtern ihre Flexionen oder beugt sie regelwidrig; er reduziert die Syntax auf ein primitives Niveau. Die ungebeugten Verben können mit kleingeschriebenen Substantiven verwechselt werden. Die fehlende Interpunktion macht die Sinneinheit von Wörtern unstet. Er unterläuft die vorgegebene Redeordnung und Sprachkultur. Er mutet der Sprache Dinge zu, die ihr bisher nur Kleinkinder, Sprachfremde oder Menschen zumuten durften, die ins Hirn geschlagen sind, nicht aber Lyriker. (Warum eigentlich nicht?) Es ist ein kunstvoller, ein ganz und gar experimenteller Infantilismus, den Jandl neuerdings erprobt (unter anderem), ein Infantilismus von oft überwältigender Ausdruckskraft. Wer aufmerksam zu lesen versteht oder solche Texte gar von Jandl selbst vorgetragen hört, wird seine eigenen Jedermanns-Erfahrungen wiedererkennen, und die Stimme des geschundenen, fast schon sprachlosen, sehr verwechselbaren Ichs vernehmen. So direkt, ja so herzbewegend, hat man sie in moderner Poesie seit langem nicht, in experimenteller Lyrik aber noch niemals gehört:
dies mich hauen hinunter
dies mich heben hinauf
dass ich nicht wissen schweben
nicht trauen ersticken und ersaufen
ich noch in kaltem land
manchmal spüren meines mutters hand
schweigen mein verstand
an ihr sein lang kein rühren
schweigen mein verstand
durchsausen mich mein ohren
neu nicht werden ich werden geboren
bevor in erden ich gehen wie eltern zu land
Mit diesem Gedicht schließt der Zyklus „tagenglas“ von 1976. Ich interpretiere es nicht; das ist andernorts schon geschenen. Ich verzichte auch auf die Beschreibung seiner Manier. Es genügt, zu bemerken, daß diese Manier völlig anders ist als die Manier des zuvor zitierten und erst recht des folgenden Textes, der dem „tagenglas“-Gedicht zeitlich nahe steht. Nichts würde uns zu der Annahme verleiten, dieses Gedicht sei vom selben Autor, außer, wir wüßten es schon. Seine Diktion ist die Diktion deutscher klassischer Poesie, sie kommt dem tragisch-erhabenen Reflexionsstil August von Platens nahe, vielleicht dem Duktus Shakespeare’scher Sonette, nachgedichtet von Karl Kraus. Ein vollkommenes strenges Gebilde, ein Exzerzitium in jenem hohen Stil, den es doch schon längst nicht mehr gibt. Oder gibt es ihn doch noch? Seine fortdauernde Möglichkeit beweist dieses experimentelle Gedicht. Zugleich aber verdankt sich der Text noch einem ganz anderen Experiment, einem, an dem jeder von uns fast täglich scheitert, wenn wir versuchen, jemandem „Glück“ zu wünschen und damit mehr zu meinen als beinahe nichts. „Glückwunsch“:
wir alle wünschen jedem alles gute.
daß der gezielte schlag ihn just verfehle;
daß er getroffen zwar, sichtbar nicht blute;
daß blutend wohl, er keinesfalls verblute;
daß falls verblutend, er nicht schmerz empfinde;
daß er, von schmerz zerfetzt, zurück zur stelle finde
wo er den ersten falschen schritt noch nicht gesetzt –
wir jeder wünschen allen alles gute.
Ein schlechthin unerfüllbarer Wunsch. In wessen Sprache wird er uns vorgetragen? Der ihn ausspricht, hat keine „eigene“, er sagt es uns in jedem seiner Texte. Ich habe nur drei Gedichte zitiert. Aber wer nennt mir ein einziges Merkmal ihrer Sprachgestalt, das auf individuellen Stil verwiese? Woran erkenne ich sie als Texte desselben Autors? Nein, Ernst Jandl hat keine „heiß-errungene Manier“. Hier schreibt ein unmanierlicher Dichter, der gleichwohl Manieren hat, viele. Und seine Kenntlichkeit – wo rührt die wohl her? Ich frage es staunend, denn ich weiß nur eine sehr unzulängliche Antwort.
Jandls Kenntlichkeit verdankt sich keiner individualistischen Erkennungsmarke; sie ist auch nicht etwa die Folge einer Inkonsequenz beim experimentellen Schreiben. Paradoxerweise ergibt sie sich gerade aus der besonderen Strenge der experimentellen Schreibhaltung, ich möchte sagen: aus deren Ethos. Begünstigt wird diese Kenntlichkeit vermutlich durch das Nachklingen der Sprechstimme Jandls im Ohr seines Lesers. Sogar strikt ich-frei gehaltene Texte – phonetische Experimente, „Sprechgedichte“ – gewinnen durch Jandls Vortrag individuelle Ausdrucks-Qualitäten, die beim Nachlesen erinnert werden. Selbst bei noch nie von ihm gehörten Texten können durch die Voraus-Information „dies ist von Ernst Jandl“ akustische, aber auch optische Erinnerungen mobilisiert werden (Gesicht und Stimme des Autors). Mir scheint, daß von so starken audiovisuellen Erinnerungsbildern eine ähnliche Wirkung wie von individualistischen Textmerkmalen ausgehen kann. Diese Wirkung wird irgendwann nachlassen, sicher, aber vorläufig ist sie groß und es lohnt sich, darüber nachzudenken, auch wenn sie als Erklärung nicht ausreicht.
Schließlich: der Name des Autors. Je schwächer in einem Text die individuelle Erkennungsmarke ist, desto nötiger wird die Kenntnis des Autornamens für die personale Zuordnung. Bei Texten der experimentellen Poesie scheint mir diese Kenntnis unerläßlich, gerade weil sie die Identität des Verfassers nicht preisgeben. Was für jede Poesie gilt, gilt erst recht für das poetische Experiment: der Autornamen ist ein wesentlicher Teil der Textinformation; er definiert das Gesamtwerk, er gibt für das einzelne Gedicht eine wichtige Lese-Anleitung. (Das Jahrhundert-Beispiel für diesen Sachverhalt ist der Maler Picasso.) Fehlt mir der Name des Autors, laufe ich Gefahr, die in einem oder in mehreren Texten praktizierte Methode für irgendjemandes individuelle Manier zu halten. Der Name Ernst Jandl macht es mir möglich, im Wechsel der Methoden, also in der Nichteigenart, Jandls Eigenart zu erkennen.
Jede bisherige Poetik geht davon aus, daß die Botschaft der Texte in deren Sprachgestalt vermittelt und also das Was nicht vom Wie zu trennen sei. Da ich aber im einzelnen Text die philologischen Indizien einer Eigenart Jandls nicht finde, muß ich annehmen, daß gerade dies für seine Lyrik nicht gilt, und er selber will es nicht gelten lassen. Im Vorspruch zu seiner Gedichtsammlung „Dingfest“ (1973) schreibt er (übrigens im selben Sprachgestus, den er 1979 in seinem Stück „Aus der Fremde“ durchhielt):
… er habe immer etwas zu sagen gehabt, und er
habe immer gewußt, daß man es so und so und so
sagen könne; und so habe er sich nie darum
mühen müssen, etwas zu sagen, wohl aber um die art
und weise dieses sagens. denn in dem, was man
zu sagen hat, gibt es keine alternative; aber für die
art und weise, es zu sagen, gibt es eine unbestimmte
zahl von möglichkeiten. es gibt dichter, die alles
mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche
weise, solches zu tun habe ihn nie gereizt; denn
zu sagen gäbe es schließlich nur eines; dieses aber
immer wieder, und auf immer neue weise.
Die beiden Begriffe, mit denen ich ernsthaft zu spielen versuchte, hier sind sie klar exponiert. Deutlich ist die Entscheidung: kein Individualstil, nicht „alles mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche weise“. Stattdessen „eine unbestimmte zahl von möglichkeiten“, das Experiment. Aber:
zu sagen gäbe es schließlich nur eines.
Doch was? Jandl-Leser mögen es wissen. Dieses Was entzieht sich jeder ästhetischen Kritik, es gehört diesem einen, es gehört vermutlich auch mir und dir, o Leser, und weil es dafür keinen Begriff gibt, vermissen wir ihn auch nicht und werden ihn auch nicht velwechsern.
Peter Horst Neumann, in Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 1, Februar 1982
WEISZHÄUTIGER SPRECHGESANG, ODER SZENE MATISSE
Für Ernst Jandl
ich öffne die Tür ein heller Fleck im Winkel: mächtiger
heller Fleck. Angestrahlt von mehreren Lampen, weites
Schwanengefieder –
hockend im weiszen Hemd am Ende des Bettes.
Ich öffne die Zimmertür im grellen Licht ein weiszer
blendender Fleck
groszes Schwanengefieder. Über Briefblätter gebeugt
oder Rechnungen, ohne Bewegung im weiszen offenen
Hemd
am Fuszende des Bettes. Dann sein kurzer Aufblick und
Grusz
zur geöffneten Tür wo ich stehe, meine Hand umklammert
die Klinke. Im Hintergrund
auf dem Kamin die SCHLACHTHAUSBLUME:
verfärbte
Lippenwülste einer welkenden Amaryllis
Friederike Mayröcker
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


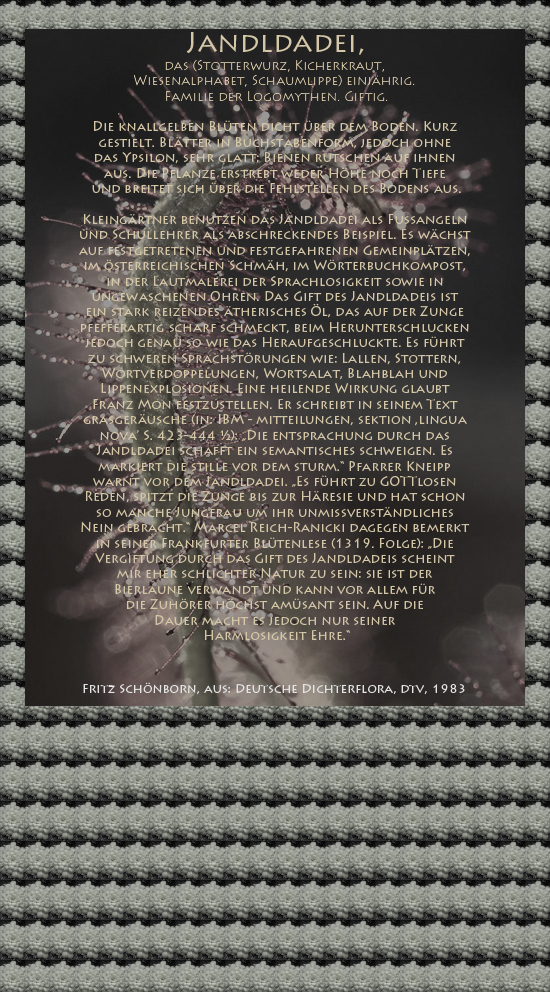












Schreibe einen Kommentar