Ernst Jandl: idyllen
oskar zu pastior
pastior zu oskar
oskar paßt zu pastior
pastior paßt zu oskar
oskar zu pastior paßt gut
gut paßt pastior zu oskar
oskar zu pastior: du paßt mir
pastior zu oskar: du mir auch
Ernst Jandl liest am 16.11.1989 im LCB aus seinem Buch idyllen
Die Sprache heult und lacht
− Großer Klamauk, tiefe Verfinsterung: Ernst Jandls Gedichtband idyllen. −
Idyllen? Nein, das nun wirklich nicht. Flüche, Obszönitäten, höhnische Abgesänge. Aber dann auch: Erinnerungen an Kindertage, an Inseln des Glücks – Zeilen, Verse, Gedichte voll Zartheit, Ausdruck einer unermeßlichen Verlorenheit.
Einer unter den Menschen, am Schreibtisch, geduckt, rettungslos – und verzweifelt, wenn wieder ein Tag ohne blitzendes Beieinander der zwei, drei einzig richtigen Worte vergangen ist. Dann geht er, „der kleine dichter, mindere poet“, der „minor poet“, los, hinaus; „bei zusammengebrochener Produktion“ sagt er sich: „aufrichten, die jacke nehmen, nach draußen gehen“, dorthin, wo das Leben ist, „zu den sich bewegenden leuten, als wäre man selbst zur arbeitsstätte unterwegs oder nach daheim“, als wäre man „nicht einfach unterwegs weil das sitzen wieder einmal nichts erbracht hat“.
Dichterklagen. Wen geht das an, wer will das hören? Sollen wir den Lyriker aus Wien, den großen Poeten Ernst Jandl, nicht einfach beim Wort nehmen: „kein name sei gegeben dem leben das ich führe ich schließe still die türe“?
Nein, bloß das nicht! Wie kommt es, daß wir um so gieriger auf Nachrichten aus dem Zimmer dieses Dichters warten, je mehr er sich (und seine Tür) zu verschließen droht? Ist das Voyeurismus? Auch, gewiß. Denn erbarmungsloser, entblößender, energischer ist nur selten jemand, auch als Schriftsteller, mit sich um, gegen sich vorgegangen. Voyeurismus also schon, doch dann und vor allem: Dermaßen knapp, konzis, überwältigend gekonnt präsentiert sich das, was sonst leichthin und als Vorwurf (gegen Literatur) unbedacht „Innenschau“ heißt, eben nicht alle Tage. Dazu gehört der Meister. Jandl ist einer – einer der ganz wenigen, die wir (auch unter gegenwärtigen Lyrikerinnen und Lyrikern) haben.
Gedichte aus sieben Jahren, 1982 bis 1989. Vor sechs Jahren erschien zuletzt ein Gedichtband von Ernst Jandl: selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr. Benedikt Erenz schrieb damals in dieser Zeitung am Ende einer rühmenden Kritik: „Es ist nicht mehr die Sprache, mit der Ernst Jandl jongliert – es ist die Verzweiflung selbst. Ich hatte mich auf dieses Buch gefreut; auf das nächste freue ich mich nicht mehr, ich fürchte es „ Das war mehr als die bloß elegant elegische Rundung einer Rezension: Jandls Verse sind seit vielen Jahren Ausdruck einer wachsenden Verfinsterung, einer bedrückenden, weil den Leser erfassenden Lebensbedrohung.
Das hat sich in den idyllen verstärkt. Es ist ein kleines Wunder, wie Jandl es versteht, die Gedichte dennoch immer wieder eine Handbreit über dem Boden eines ernüchternden Alltags schweben zu lassen. Aber eben, er schafft es – und das macht auch dieses Buch nicht nur erträglich, sondern gar zu einem Genuß. Ohne seine Klage an billigen Klamauk zu verraten, ohne sich also durch Pointen und Witzelei gegen die Wunden (auch die des Hohns und falschen Mitgefühls) abzuschirmen, gelingen diesem Wortbeherrscher wiederum herrlich kalauernde Zeilen:
es hat mich umgeschmissen mein leben ist zerrissen ich will von nichts mehr wissen da meldet sich das pissen und zerrt mich aus den kissen
Ein Wortbeherrscher, nicht nur ein Sprachspieler. Das war er einmal (Reprisen wie das Gedicht „insektenfresser“, in dem die Wörter „insekt“ und „mund“ graphisch miteinander verschmelzen, wirken eher matt) – und er war es nicht umsonst. Schule der grammatischen Geläufigkeit, Praxis der linguistischen Litanei: Er ist da durch, und das bleibt spürbar mit jeder Wendung, jeder Zeile, mag sie noch so schlicht, so eingängig, ja harmlos wirken. Und die Ahnen, die Experimentierer und Expressionisten, die Waghalsigen und Verwegenen: Er vergißt sie nicht, er fühlt sich – zu Recht – immer noch als einer der Ihren; in Widmungen, Widmungsgedichten erweist Ernst Jandl Reverenz.
Zum Beispiel ist „august stramm“ Held — und Titel — eines Gedichts, dessen erste Strophe so lautet: „er august stramm sehr verkürzt hat das deutsche gedicht“, die zweite dann: „ihn august stramm verkürzt hat der erste weltkrieg“, und schließlich: „wir haben da etwas länger gehabt um geschwätzig zu sein“. Geschwätzig? Raffinierter, komprimierter wohl läßt sich nicht Lob und Leben singen und eigene Position bestimmen.
Jandls Lieder werden immer deutlicher. Als „alternder dichter“ („mir ist so bang“) schont er niemanden, sich selbst am wenigsten. Die „hohe kunst“ ist nun die Reinigung der Zahnprothese, ein Gedicht bietet ein „kleines geriatrisches manifest“. In der Straßenbahn muß der Dichter erleben: „schöne junge damen springen auf wenn ich mich durch die tramway rauf“. Und wenn eine alte Frau – in dem Poem „alterndes paar“ (nicht einfach nur: „alterndes“), einem der wenigen längeren Gedichte dieses Bandes – ihren Mann ruft: „du alter arsch“, ihn anherrscht: „fick mich wie einst im mai, bis hin zum doppelschrei“, dann verbirgt solch lyrische Kraftmeierei nur um so deutlicher Verheerungen und Verluste, ist der forsche Ton verdrehte Trauer: „ach scheiße, wie die liebe oft sich zeigt wir hatten so gehofft, daß sich der tag nie neigt“.
Diese Verse halten sich nur schwer in der Balance, oft genug drohen sie wegzukippen, ins Bodenlose, ins gewollt Banale. Ein Gedicht, das nur ein Datum als Titel hat („25. februar 1989“), beginnt mit den Worten:
das ist vielleicht
das ende der gedichte
muß aber nicht
des schreibens ende sein
Vom Tod Erich Frieds und Thomas Bernhards ist da die Rede und von der Möglichkeit, vielleicht den Lebenserfahrungen anders als im Gedicht auf die Spur zu kommen: „ich denke manchmal etwas an geschichte die durch mein leben zieht könnte zu schreiben sein“.
Was damit gemeint ist, lassen die wenigen, enorm beherrschten Verse ahnen, die vom Verlust der Kindheit, der Eltern, der Geborgenheit überhaupt sprechen – wie dieses knappe, titellose Gedicht:
in der küche ist es kalt
ist jetzt strenger winter halt
mütterchen steht nicht am herd
und mich fröstelt wie ein pferd.
Idyllen, Verklärungen sind auch das nicht. Es gibt ganz unfreundliche Erinnerungen an die Kindheit, und es ist im übrigen nicht gestattet, alle diese Texte wie autobiographische Mitteilungen zu lesen, selbst dann nicht, wenn Ernst Jandl damit kokettiert: „immer von sich selbst erzählt da gibt es nichts zu lachen hat sich nicht die welt gewählt nur ein paar spielsachen“.
Wir sehen den Dichter am Schreibtisch, verzweifelt ja, doch munter auch, wenn die Verzweiflung Rhythmus geworden ist. Wenn die Silben tanzen, ist der Dichter glücklich, in all seinem Unglück. Sein „erstes sonett“ – reine Musik:
am reim erkennt man oft die zeile
auch an der wörter gleichen eile
am silbenschlag, der wir der takt
des drummers jene dichter packt
die nie beim jazz in ruhe bleiben
sondern es mit den beinen treiben
den füßen, die den boden schlagen
als könnten sie es nicht ertragen
baß, drums, trompeten, saxophonen
ohne bewegung beizuwohnen,
wir sind vom selben holz gemacht
ihr schlagt und heult, und in uns kracht
ohrenbetäubend tag und nacht
donner der sprache, heult und lacht.
Am Ende dann: „sprache“, „treusprüche“ („ich mag nichts neues ich mag nur treues“), gar nur noch „zeilen“: opake Verse, Abbreviationen, Ausklänge – undeutlich, verfließend, verwirrend. Zunächst noch eine Anhäufung von kleinen Sinneinheiten, Versen, Miniaturgedichten wie etwa: „ich bin nicht gerne, wo ich bin ich wäre nicht gerne, wo ich nicht bin ach, wäre ich gerne, wo ich nicht bin wäre vielleicht ich lieber, wo ich bin“; bald nur noch einzelne, fast gänzlich unzusammenhängende Zeilen, durch Striche voneinander getrennt. Da heißt es: „als weit dich noch schlug“, oder: „was brennt ihr so stumpf“. Dann schließlich, letzte Zeile, Schluß des Gedichtbandes: „ganz ernst sieht gott zu“. Ganz ernst, ganz Ernst? Der Lyriker Jandl ist noch nicht einmal 65 Jahre alt, mithin ein Schriftsteller in den besten Jahren; das Verstummen wollen wir ihm noch nicht gestatten. Ein wenig frühe Alterslyrik, schön und gut, er hat sie sich verdient – doch hoffen darf man auf einen neuen Aufschwung. Denn die poetische Kraft ist ungebrochen, die Könnerschaft eines Dichters, der den elegischen Ton mit dem ätzenden, den kalauernden Vers mit dem pathetischen zu verbinden weiß. Die Leser, so Jandls Devise („die schöne kunst des Schreibens“), „dürfen verlangen, zur Aufmerksamkeit gezwungen zu werden und sich nicht selbst dazu zwingen zu müssen“.
Er soll uns noch oft, noch lange zwingen: Einer unter den Menschen, einer an seinem Schreibtisch, einer, der selbst am meisten zu staunen scheint, wenn aus dem Nichts etwas entsteht, da auf dem Papier, wenn etwas dahingezaubert worden ist, von ihm – „gelegtes gedicht“:
hier liegt
ein gelegtes gedicht, darüber
brütet ein
dichter vielleicht
vielleicht noch lange
Ernst Jandl:
Volker Hage, Die Zeit, 8.9.1989
Wir werden ihn lieben
− Ernst Jandls idyllen: Ein Rückblick auf die Schaufeln der konkreten Poesie. −
Das zweite Gedichtlein gleich in Jandls neuem Gedichtebuch ist ein historisches Gedicht (ob es überhaupt ein Gedicht ist, ist eine andere Frage), es geht so:
der vater der wiener gruppe ist h.c. artmann
die mutter der wiener gruppe ist gerhard rühm
die kinder der wiener gruppe sind zahllos ich bin der onkel
− so also der Jandl der achtziger Jahre, wenn er gute dreißig Jahre zurückblickt, auf die schöne Zeit, als er die ersten ein- oder zweihundert seiner Gedichte gemacht hatte und mit Friederike Mayröcker zusammen sich Mitte der fünfziger Jahre regelmäßig mit Artmann und Rühm traf diese beiden wiederum waren derzeit aber inniger als mit jenen beiden sicher mit Oswald Wiener und Konrad Bayer und Friedrich Achleitner zusammen: Wenn man Rühm glauben darf, der 1967 ein Buch über die Wiener Gruppe veröffentlichte, dann waren eben nur diese fünf im engeren Sinne diese Gruppe (Rühms Buch ist seit einigen Jahren wieder bei Rowohlt zu haben, als gebundenes Buch jetzt freilich, und für 48 Mark).
Als Rühms Buch erschien, war das allermeiste längst vorbei, gleichwohl waren aber die endsechziger Jahre eine gute Zeit für die konkrete Poesie, die damals noch viele liebten bei uns: Rühm hatte gerade von Konrad Bayer (der 1964 Selbstmord begangen hatte) gesammelte Werke und darin den „Sechsten Sinn“ herausgegeben, von Oswald (Ossi) Wiener erschien, fast verspätet, der legendäre Antiroman Die Verbesserung von Mitteleuropa, Eugen Gomringers gesammelte Werke erschienen, herausgegeben und eingeleitet von Helmut Heißenbüttel, Friederike Mayröcker veröffentlichte erst unter dem Titel Tod durch Musen poetische Texte (Jandl gewidmet) mit einem Nachwort von Eugen Gomringer, dann schrieb Bense ein Nachwort zu ihren neueren Texten unter dem Titel „Minimonsters Traumlexikon“, von Artmann erschienen die gesammelten Stücke mit zwei wunderlichen Vorworten von Chotjewitz, Heißenbüttel veröffentlichte seine gesammelten Texte 1-6, Bense brachte seine gesammelten Vorworte und kleinen Aufsätzchen heraus. Bense war eigentlich der Kirchenvater dieser ganzen konkreten experimentierenden Poesie, wunderbar gelassen im Besitz einer beinah wissenschaftlichen modernen Ästhetik; ich sehe ihn noch an seinen Computern entlanggehn – Computer waren damals ziemlich groß – und ihnen Texte entnehmen, die er sie dichten gelehrt hatte, und dann brummte er „gut“ oder „nichts geworden“. Er mochte übrigens Hegel. So hingen sie alle mit allen zusammen, ein Dichterfilz; und hielten sich, und natürlich völlig zu Unrecht, für die ganze Dichterwelt; und dann saßen auf der Buchmesse 1969 einmal Franz Mon und Heißenbüttel beieinander und heckten den Plan zu einer Gedichtanthologie aus dem Geiste der ihnen gemeinsamen poetischen Theorien aus; zwar kamen sie bei der Ausführung des schönen Plans dann leider auseinander (das Ding hat zwei Nachworte, von jedem eins), aber die Anthologie, unter dem Namen Antianthologie, Gedichte in deutscher Sprache nach der Anzahl ihrer Wörter geordnet, ist nach wie vor eine unsrer schönsten Gedichtsammlungen (leider war sie wohl ein Flop und tauchte sehr bald nach Erscheinen im Ramsch auf) und enthält als zweites Gedicht (mit 13 Wörtern) das berühmteste von Jandl („manche meinen“) und als letztes Gedicht (mit nur zehn Wörtern; die Anordnung der Gedichte im Buch ist an- und abschwellend) das populärste von Gomringer („ping pong“). Kenner wie Rühm setzen neben die Wiener Gruppe eine Stuttgarter Ansammlung von tätigen Liebhabern der neuen Poesie, dazu zählen dann eben Heißenbüttel, Mon, Gomringer, Harig, Döhl, und zwischen seinen Computern eben Vater Bense.
Artmann ging dann bald nach seinem großen Erfolg (Med ana schwoazzn dintn) allein weiter. Heißenbüttel, immer recht skeptisch, ebenfalls, fast alle anderen verstummten oder blieben ein bißchen esoterisch in der Radikalität oder Konsequenz ihrer Experimente, und einzig und allein Jandl wurde zum großen Liebkind der Kritik und des Publikums, kriegte alle großen und guten Preise, die es bei uns gibt, und schrieb, und schrieb, und las, und las, und schreibt, und schreibt. Meistens läßt Ruhm sich ja nicht erklären; denkt man aber an die eben erwähnten beiden Gedichte von Gomringer und Jandl, so kann man schon sagen, daß Gomringer mit seinem Ping-Pong-Poem wie aus Versehn fast ausgerutscht war ins jedermann Zugängliche, während Jandl mit seinem Lechtsundrinks wie schlafwandelnd den Ton getroffen hatte, der jedes Experiment im Rahmen des Gefälligen hält und damit dort, wo es uns eher schmeichelt (auch ist der Titel seiner ersten großen Gedichtpublikation, Laut und Luise, zweifellos genial: gerade weil da schon dieses, wenn ich so sagen darf: im Grunde auch wieder postexperimentelle Rokokowesen von großen Teilen seines Werks anklingt). Hinzu kommt eine nicht nachlassende, ja geradezu atemberaubende Produktivität: ich habe in der dreibändigen – und schandbar teuren – Luchterhand-Werkausgabe von 1985 rund 1400 Gedichte gezählt, jetzt kommen noch einmal rund 250 dazu, das sind nahezu Rückertsche Dimensionen, und nicht bloß wegen der Zahl: Friedrich Rückerts’ Produktion ist ja weitgehend ein gleichsam artistisches Tagebuch eines Lebens, das auf diese Weise zum Stoff seiner Literatur wurde, und fast nichts anderes ist im Grunde das, was Jandl schreibt, wenn er anderes als nur Formen behandelt. Fast alle seine Gedichte in der großen Werkausgabe auf 1700 Seiten, nur für die Gedichte – sind auf den Tag genau datiert: das ist nun wirklich nichts Gewöhnliches, und in gewisser Weise, möchte man sagen, ist Jandls Gedichtwerk die Autobiographie eines Mannes, dessen Leben sich, darin erschöpfte, der Stoff dazu zu sein, Jandl ist 1925 geboren, die neuen Gedichte nun, mit schelmend zwinkerndem Auge (Altmännerauge?) idyllen genannt, sind zwischen 1982 und jetzt entstanden: Jandl in ihnen ist also runde sechzig und mehr Jahre alt, und so tritt er denn in diesen Gedichten meist entweder rückerinnernd als ein Kind auf oder eben als ein alt werdender Mann, und, das ist für ihn vorwiegend ein abbauender Körper, worin ein Dichter steckt. Hier einmal das Kind:
berge habe ich bestiegen aber nicht aus eigenem
sondern
als ein widerwillig mitgezogenes kind.
an jeder alten mühle machten sie halt; sie lagen
im walde. an einem bach und besaßen ein von wasser
gedrehtes rad; ach, und die großen schweren mühlsteine
Dieses Gedicht hat eine noch unabgenutzte poetische Diktion: sonst ist das große Problem für Jandl, daß die meisten seiner selbsterfundenen oder an geeigneten Diktionen durch den vielen ununterbrochenen Gebrauch (und vor allem dadurch, daß Jandl, da er wenig Inhalte hat, immerzu nur an Diktionen denkt und sie bedichtet: so altern Experimentatoren) etwas überaus Abgeleiertes an sich haben, Im nächsten Gedicht ist auch die Diktion unverbraucht, so unverbraucht wie der Gedanke unkokett und glaubwürdig:
ein junge weint nicht!
erst der mann soll weinen
wenn er um sich blickt
und die ihn immer noch liebende
gefährtin, ihm mut zu machen,
spricht: das ist dein werk!
der mann weint.
Irgendwie ganz der alte Jandl ist Jandl dann, wenn er mehr oder minder witzig seinen anatomischen Zustand beredet; und wenn er dann, noch weitergeht, fragt man sich eben doch schon, ob man denn wirklich wissen will, daß der alte Körper, was die Liebe angeht, zu deren Taten rascher unfähig geworden ist als die Seele, die sich noch gern erinnert, wie das alles war und ging, In solchen Gedichten verwendet Jandl dann gern den in den siebziger Jahren von ihm entwickelten underdog- oder Gastarbeiterton voller unkonjugierter Verben und solchen Sachen; aber das ist nun allmählich auch zu einer Attitüde verkommen (oder was ist das hier für ein verwittertes Rokoko:
gehen schauen ob schneeglöckchen schon
kommen seien in parken, läuten dann
frühling ein
und dann da werden sich primeln und veilchen und
fliederbuschen lilae und weißen
und mit dem triton wieder werden fahren ich
und läuten mit der glocke von triton?).
All das mindert nicht das Gefühl der Nötigung, wirklich in fast allem, was Jandl jetzt schreibt, nur noch das Tagebuch eines Dichters zu sehn, dem, wie einem Kind eine Schaufel, die Sprache nicht geradezu kaputtgegangen, aber sagen wir: verbogen worden ist, und durch eigne Schuld wohl, und jetzt will er so gern etwas sagen, immer wieder, immer noch, aber es geht nicht mehr so ganz, es wird immer heikler.
„die freude an mir / läßt nach“ – so beginnt er ein, mal ein Gedicht; dann zählt er alle die auf, bei denen die freude an ihm nachläßt, und endet, etwas weh und elend witzig: „die freude an mir / mag an allen verschwinden. / mir muß sie bleiben“, Wenn wir dieses Dichten als das Tagebuch eines endenden, aber in vieler Hinsicht auch musterhaften Dichters nehmen, der alles herzeigt (Warzen und alles, wie Heißenbüttel einmal so schön mit Diderot gesagt hat), dann werden wir Leser ihn doch trotzdem weiterhin lieben, anders vielleicht, als ihm einst lieb war oder noch lieb ist, aber wir werden ihn lieben und lesen.
Rolf Vollmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.1989
nur den lesern bleibe ich
Lacht der Clown, oder weint er? Ist er deshalb so komisch, der Freak, weil er in langen Latschen tragisch an der Erde klebt? Vom Theater wissen wir: Komisch ist nur einer, der seine Scherze todernst nimmt. Anders als im Leben, wo eher gilt: Komisch ist einer, der sich todernst nimmt.
Ernst Jandl mußte lange vergeblich darauf hoffen, daß, beim Vorherrschen des real existierenden Inhaltismus, seine Sprachexperimente als Dichtung, als sich selbst genügende Kunst ernst genommen wurden: als „werk, von dem sie nichts außerhalb seiner selbst verlangen können“. Kaum war ihm das gelungen, kaum erkannte auch eine breitere Leserschaft (Jandls Gesamtauflage 1985: immerhin über 150.000 – Lyrik!), daß entgegen allen Grundsätzen der Physik in der Sprache etwas aus nichts werden, Sprache sich aus sich selbst gebären und ernähren kann, daß Sprache nicht nur Bedeutung transportieren, sondern aus sich selbst offenbaren kann („lechts und rinks / kann man nicht velwechsern / werch ein illtum“) – da schrieb er über die Qualen des Schreibens und die Hinfälligkeit der eigenen Person, distanziert, belustigt und mit Ingrimm die eigene Hypochondrie betrachtend, Aus der Fremde, wie seine Sprechoper hieß. Die Wiedereinführung des Autors in seine Literatur (als Hiob). Eines seiner Anliegen war einmal die Befreiung der Sprache vom Sinn gewesen, zumindest vom voreiligen, selbstverständlichen, konventionellen Sinn, er machte die Konvention, das einverständlich Gewöhnliche sichtbar, indem er es störte. Nach allen Anstrengungen quer durch das „musterbuch moderner textverfahren“ (Karl Riha), nach Erfindung einiger eigener Methoden zur Sinn-Verstörung sagt Jandl im Frühling 1988 zum Musiker Matthias Rüegg, mit dem gemeinsam er in einer Reihe von Text-und-Ton-Veranstaltungen auftrat:
Ich habe nie oder selten den Versuch unternommen, der ja auch vor Mitte dieses Jahrhunderts von einer Reihe von Dichtern unternommen wurde, völlig ohne die außersprachliche Welt auszukommen. Also das, was an der Sprache an Außersprachlichem haftet, wegzunehmen und dann Dinge zu zeigen, die sich nur in der Sprache ereignen… Ich schreibe nicht ohne die Welt, in der ich drinnen bin. Ich schaffe also nicht einen fiktiven Zustand des nur mit der Sprache Verkehrens während des Schreibens eines Gedichtes.
Der eben erschienene neue Gedichtband von Ernst Jandl heißt idyllen. Der Titel ist zum einen ironisch zu verstehen, zum anderen gar nicht. Eidyllion heißt auf griechisch Bild oder Bildchen, den Sinn von friedlichem, naivem, stilisiertem Raum bekam der Begriff erst durch die Schäferei des 18. Jahrhunderts. Bei Jandl sind es Bilder, die mit seiner Kindheit zu tun haben – Gegenbilder zu dem, was ihm das Selbstgefühl des Dichters als alter Mann diktiert. Das bestimmt die Beleuchtung dieses finsteren, verzweifelten, verzweifelt komischen Buchs. Es ist nicht Freund Hain zugedacht wie der Wandsbecker Bote, vielmehr unter grotesk ohnmächtigem Schütteln der Faust gegen ihn entstanden. Manchmal, dünkt mich, macht sich der Autor besonders klein, damit ihn der Tod/Feind nicht sehe, und läßt doch keinen Zweifel aufkommen: Er weiß, daß sich der nicht täuschen läßt, nicht durch Schrullen und nicht durch voreilige Verzichterklärungen.
Schon die ersten zwölf Zeilen sind nur scheinbar ein Spaß („die ersten zwölf zeilen“ heißt das Gedicht), vielmehr ein kleines Schutzgitter gegen das Hereinbrechen der Ränder und eine verzweifelte Anstrengung gegen den Horror vacui:
die zeile die vor mir steht still
und eine zweite zeile will
ich habe diese ihr erfunden
und schon zwei weitre dran gebunden
ein ende ist noch nicht in sicht
ich mag sie bisher alle nicht
weil jede schamlos nur enthüllt
mein denken als von nichts erfüllt
nichts anderem nämlich als dem schreiben
von zeilen, welche zählbar bleiben
für den, der an zwei mehr noch glaubt
als ihm der finger zahl erlaubt.
Viele der Gedichte in diesem Band (…) sind gereimt, aber die Reime gehen in Brüche wie die Verse, wenn sie nicht unter ihrer Banalität zusammenbrechen. Es gibt in diesen Idyllen keinen Einklang mehr zwischen dem „einstigen jetzt und dem jetzigen einst“. Was hilft die Kunst im Herannahen der Dämmerung:
ich habe ja fast keine Kinder
also um himmelswillen
wie pflanz ich mich fort.
Ersticken, erblinden, vereinsamen. Das Überhandnehmen der Hinfälligkeit, das Auseinanderfallen von Ich und Körper (von Ich und Ich), der Hohn der zerfallenden Materie über den Geist, das sind die Themen, die hinter den Schnurren dieser Gedichte auszumachen sind, manchmal aber auch ganz ungewöhnlich direkt erscheinen, nicht getarnt durch die scheinbar selbstgezeugten Wortwitze. Ich zweifle nicht daran, daß, im allgemeinen Bestreben, das Leben lustig zu finden, auch dieses Buch als ein komisches gefeiert werden wird. Komisch ist es allenfalls in dem bestialischen Sinn, daß es den Homo homini lupus allemal mit grimmer Zuversicht erfüllt, wenn er den Andern untergehen sieht, was heißt: sich als Überlebenden erfährt.
GUTE KUR.
eine gute kur von rosen
ihre dornen dir in die augen gepreßt
eine gute kur von krähen
flatternd in deinen schlund gezwungen
eine gute kur von mäusen
stück für stück dir ins arschloch gestopft
eine gute kur von specht
der dir in den Nabel klopft.
In den Nabel? Der dich an dem Punkt vom Leben trennt, an dem du in dieses einstmals eingetreten bist.
VICTORY.
das husten des alten mannes
lieblich durchdringt sein tagwerk
worin besteht es? in intervallen
läßt es ihn auf die couch fallen
mitsamt seinen wütenden gedanken
dem schweren kampf in seinem kalkkopf
zwischen dem einstigen jetzt und dem jetzigen einst
bis ihn der husten erneut hochblockt
der sterbespecht auf seine glatze trommelnd
Dies ist ein verzweifeltes Buch, aber kein wehleidiges. Das Epitaph auf Leben, Lieben, Dichten und Trachten ist denn doch noch Anlaß, den Klang der eigenen Stimme zu vernehmen; kein Gejammer also, sondern im Ausdenken der schlimmsten Wendungen und (Sprach-)Windungen immer noch ein trotzigkomisch heroischer Akt der Selbstbehauptung (…) Alles aber läßt das Gedicht „der langsam gehende mensch“ hinter sich: den grimmen Witz des „geriatrischen manifests“, die Elegie der „klagenden dinge“ („die klagende seife, meingott, die weiße / klagende seife, und das weiße / klagende waschbecken…“), das „nachtstück, mit blumen“ (eine Art Selbstbildnis des alternden Dichters als zu erschlagende Fliege – das lyrische Ich als Täter und Opfer) den leisen Abschied von der Kunst („aus der dichtung großem glück / langsam zieh ich mich zurück / oder tue einen schritt / der mein dichtersein zertritt / nur den lesern bleibe ich / noch ein weilchen dichterlich“). Ein Memento von finster barocker, brutal expressiver Brutalität:
DER LANGSAM GEHENDE MENSCH
so als ob die kotze den mund
gefunden nicht hätte, statt dessen
eingesickert wäre in das kinn und die wangen
und in die zunge, die immer ein stück heraussteht.
Das ist schwärzeste Nachtseite der Idylle. Auch die Drastik ist ein Akt des Aufbäumens gegen das unaufhaltsame Diminuendo (auch die Drastik des sexuellen Vokabulars). Daneben gibt es in diesem Band freilich nicht nur den alten Jandl, sondern auch den alten Jandl:
pelz hieß der mann von dem die kunde kam
die vater mutter mein so oft zu munde nahm
als ich ein kind noch klein und weithin untam war
und mir wie pelz noch wuchs mein knabenhaar
und mein frisör hieß summerer.
Den Grundton bestimmt nicht mehr diese Poesie. Und nicht mehr glaube ich an die Verfinsterung als poetische Methode nach dem Motto: Nacht muß es sein, wo seine Witze strahlen. Nicht, daß Jandl der Humor abhanden gekommen wäre. Nur war der schon immer schwärzer, als die meisten seiner Bewunderer wahrhaben wollten.
Peter Rüedi, Die Weltwoche, 12.10.1989
Ich fliege nicht
Ich selbst bin kein mißgelaunter Mensch, ich schwärme vom schweifenden Denken, lobe den Aufschwung, rühme das Fliegen. Es ist zehn Jahre her, seit ich (analog zu Goethes Zwischenkieferknochen) den Brixiusknochen entdeckte, jenes os grammaticum, das den Menschen zum geistigen Aufflug befähigt; ich hielt mir sogar etwas darauf zugute. Doch nicht jeder fliegt mit, der eine mag nicht, der andere darf nicht, der dritte kann nicht mehr, denn das Gewicht der Welt zieht herab, „wie mit tausend Kilogrammen“, sagt Wilhelm Busch in Balduin Bählamm. Je älter man wird, um so lastender, ja lästiger zeigt es sich, Krankheiten, Enttäuschungen, Verzweiflungen malträtieren Geist und Körper: Das Leben war ein Mißgriff, denkt man, ein unaufhörliches Versagen. Ernst Jandl, der Sprachspieler und Sprechdenker, schrieb mir zu meinem 60. Geburtstag:
gern wollt ich dir schreiben
mein schönstes gedicht
das geht jetzt nicht
warum geht es denn nicht?
schau nicht nach oben
ich fliege nicht
dort auf dem boden
das war mein gesicht
deine sechzig zu loben
vergaß ich nicht
doch mein sturz aus dem bett
hat mir alles verschoben
such mich nicht oben
ich fliege nicht
ich stürz aus dem bett
mein bein zerbricht
Der da aus dem Bett gestürzt ist, das Bein gebrochen hat und am Boden liegt, dem sich alles verschoben hat, wie er sagt, ist ein großer Dichter. Er spricht von sich und damit von den anderen, und weil er ein Dichter ist und für sich spricht, spricht er für andere. Ernst Jandl, der Sprachzertrümmerer, der Sprachclown, wie er einst genannt wurde, ist weit gegangen, er hat sich vom witzigen Wortspieler zum weisen Denkspieler gewandelt, doch darf man nicht glauben, diese Wandlung sei eine Veränderung ins Harmlose, ins Ungefähre, ins Allgemeine. Jandl ist nicht zum abgeklärten Besserwisser geworden, der, weil er das Leben nun besser kennt als in jungen Jahren, seinen Lesern und Hörern in wohlgesetzten Worten seine Erfahrungen des reifen Sechzigers mitteilen will. Im Gegenteil, Ernst Jandl ist, was sein Sprechen anbetrifft, jung und aggressiv geblieben, er setzt sein Dichten aufs Spiel wie er sein Leben aufs Spiel setzt; mit unvermindert lapidarer Sprache riskiert er das Äußerste an möglichem Sprechen, und indem er so spricht wie er spricht, riskiert er Sprache und Sprechen selbst.
Als es an der Zeit war, die Marotten und Anmaßungen großer Tiere zu verhöhnen, verhöhnte er sie; als es an der Zeit war, die Launen und Verluste der Gesellschaft bloßzustellen, stellte er sie bloß. Immer tat er es auf seine unnachahmliche Weise: ich erinnere mich an Auftritte, als er, wie ein wortgewordenes Maschinengewehr, sein Schützengrabengedicht hämmerte, als er, gehaucht und sraccato den langen Assoziationsketten folgend, den mythischen Zusammenhang von Vieh, von Sophie und von Philosophie wie in einem neuen Merseburger Zauberspruch beschwor.
Nie war es ein unverbindliches Spiel, obwohl viele seiner Zuhörer sich vor Lachen nicht mehr fassen wollten und ihn für einen ausgekochten Spaßmacher hielten. Dann aber stellten sich nach und nach die Kenner ein: den Saarbrückern schrieb er nach einer Lesung am 15. Juli 1988 ins Stammbuch:
o wie glücklich ihr mich macht
eine stunde hat der tag
eine stunde hat die nacht
diese eine stunde hier
da ich mich verbunden spür
euch, vor denen ich berichte
was ich weiß, was ich weiß
was ich weiß, sind die gedichte
die ich schrieb, für euch, o freunde
meine liebliche gemeinde.
Jandl heißt Ernst, und so ist er auch. Dieses Nomen est Omen ist zugleich ein Wortspiel und die Beschreibung seiner Natur. Ernst spielt, und sein Spiel ist ernst. Jandl ist ein ernster Sprachspieler, aber es gibt keinen anderen, der die Doppelbeziehung von Spiel und Ernst so folgerichtig vorführt wie er. Die Ernsthaftigkeit des Spielerischen und das Spielerische des Ernstes sind in Jandl zur Totalität verschmolzen. Jandl ist ein ernster Mensch, der spielt, ja, er ist der leibhaftige spielerische und spielende Ernst. Diese und noch eine Stelle aus einer Rede, die ich einmal ihm zur Ehre gehalten habe, muß ich zitieren, um mein Verständnis von Ernst Jandl zu erhellen: Jandls Mutter hieß Luise; auch sie schrieb Gedichte, und sie ist die Luise im Titel seines Gedichtbuchs Laut und Luise. Ist nicht die Verbindung von Laut und Luise die gleiche Verbindung, die zwischen Ernst und Luise besteht, wobei der Ernst die spielerische Antithese von Luise und Luise die ernste Antithese des Spielerischen ist? Ja ist nicht der Ernst mit dem Laut so vollkommen identisch und Luise gleichermaßen mit dem Spielerischen, daß Ernst und Luise sich zueinander verhalten wie Laut und Spiel und, wie andererseits und auf vergleichbarer Ebene, Witz und Freiheit? „Freiheit gibt Witz…, und Witz gibt Freiheit“, heißt es bei Jean Paul.
Diese Trennung von Laut und Luise, das heißt diese gleichzeitige Separierung der Luise vom Laut und der Freiwerdung des Lautes von der Luise, diese Entbindung unter Jandlschen Schreien, diese schwere Geburt der Tragödie aus dem Geiste und auch aus dem Fleische der Musik, ist für Ernst Jandl eine Notwendigkeit gewesen: doch was einst ein hier angedeutetes Balancespiel über dem sicher geknüpften Netz der Sprache war, ist nun ein Trapezstück über dem Abgrund, ein Drahtseilakt auf Leben und Tod.
In seinem neuen Gedichtband idyllen nimmt Ernst Jandl kein Blatt mehr vor den Mund. Schon in der Sammlung der gelbe Hund (1980) brach er mit allen Konventionen und redete Fraktur, jetzt aber redet er Tacheles und zuweilen so völlig unverstellt, daß intimstes Sprechen zum obszönen Offenbarungseid wird. Das Oratorium „älterndes paar“, das ich ihn schon vor zwei Jahren beim Bielefelder Colloquium habe lesen hören, ist ein schockierender Fluch des Altgewordenen gegen den verheerenden Potenzverfall. Es ist eine ältere Frau, die vom zunehmenden Versagen ihres Partners spricht: Jandls Schimpf ist zynischer Einspruch, keine poetische Wehklage und schon gar kein Ratgeber über biederen Seniorensex.
es hat mich umgeschmissen
mein leben ist zerrissen
ich will von nichts mehr wissen
da meldet sich das pissen
und zerrt mich aus den kissen
Das Weh im Hirn, das Leberschrumpfsyndrom, das Übel mit der Blase: Ernst Jandl hat seinen Ton gefunden, davon zu sprechen, sein Wandel vom scheinbar reinen Wort – zum betroffenen Denkspieler ist in der Kontinuität seines Schaffens grundiert. Immer schon war er an persönlicher Stellungnahme, an individuellem Eintreten interessiert, was vor zwanzig Jahren noch Engagement genannt wurde. 1966 schrieb er in der Zeitschrift Motive:
ziel meiner arbeit, heute wie früher, sind funktionierende, lebendige, wirksame, direkte gedichte, gesteuert, von welchem material immer sie ausgehn und in welcher form immer sie hervortreten, von dem was in mir ist an richtung und neigung, an freude und zorn. was ich will sind gedichte die nicht kalt lassen.
Heute mehr denn je tritt in dieser heißen Lyrik Jandls das abgrundtief Komische hervor. Die Paradoxien des Lebens und der Welt, die im experimentellen Sprachspiel immer einen artifiziellen Charakter gewannen und nie ganz diese hergestellte Künstlichkeit verleugnen konnten, zeigen sich nun selbstverständlicher, unbezweifelbarer. Jandl legt in seinen neuen Gedichten das Mißverhältnis von Sein und Schein schamlos bloß, der Leser wird auf unmittelbare Weise des Risses gewahr, der zwischen Wunsch und Wirklichkeit hindurchgeht und lacht, obwohl ihm schon im nächsten Augenblick das Lachen auf den Lippen gefriert.
Stets war Ernst Jandl als Sprachspieler aufgetreten, er redete in kunstvoller Artistenzunge, in unbeholfener Kindersprache, in verballhorntem Ausländerdeutsch; jetzt stimmt er mehr und mehr das bewußt kunstlose Lied, den schlicht gereimten Gegengesang an. Er kümmert sich nicht mehr um die kanonisierten Schönheiten der Poesie, auch nicht mehr um die ausgefuchsten Poetologien experimenteller Schulen. Er verabscheut das Orthodoxe in dem Maße, wie es selbst diesen Abscheu ad absurdum führt, indem es sein Dogma des Unabänderlichen verkündet:
DER MANN WEINT
ein junge weint nicht!
erst der mann soll weinen
wenn er um sich blickt
und die immer noch ihn liebende
gefährtin, ihm mut zu machen
spricht: das ist dein werk!
der mann weint.
idyllen hat Ernst Jandl seinen neuen Gedichtband genannt. Das ist nicht einmal ironisch gemeint, versteht man sie im Schillerschen Sinn, der sie ja zur elegischen Gattung zählt. In ihr werde der verlorene Zustand als wirklich dargestellt, nicht als Gegenstand der Klage und Trauer wie in der Elegie. Der verlorene Zustand als der wirkliche, bei Ernst Jandl heißt das:
nur den lesern bleibe ich
noch ein weilchen dichterlich.
Ludwig Harig, Frankfurter Rundschau 2.12.1989
Die Sprache heult und lacht
Idyllen? Nein, das nun wirklich nicht. Flüche, Obszönitäten, höhnische Abgesänge. Aber dann auch: Erinnerungen an Kindertage, an Inseln des Glücks – Zeilen, Verse, Gedichte voll Zartheit, Ausdruck einer unermeßlichen Verlorenheit.
Einer unter den Menschen, am Schreibtisch, geduckt, rettungslos – und verzweifelt, wenn wieder ein Tag ohne blitzendes Beieinander der zwei, drei einzig richtigen Worte vergangen ist. Dann geht er, „der kleine dichter“, „mindere poet“, „der minor poet“, los, hinaus; „bei zusammengebrochener produktion“ sagt er sich:
aufrichten, die jacke nehmen
nach draußen gehen,
dorthin, wo das Leben ist,
zu den sich bewegenden
leuten, als wäre man selbst
zur arbeitsstätte unterwegs
oder nach daheim,
als wäre man
nicht einfach unterwegs weil das sitzen
wieder einmal nichts erbracht hat.
Dichterklagen. Wen geht das an, wer will das hören? Sollen wir den Lyriker aus Wien, den großen Poeten Ernst Jandl, nicht einfach beim Wort nehmen:
kein name sei gegeben
dem leben das ich führe
ich schließe still die türe?
Nein, bloß das nicht! Wie kommt es, daß wir um so gieriger auf Nachrichten aus dem Zimmer dieses Dichters warten, je mehr er sich (und seine Tür) zu verschließen droht? Ist das Voyeurismus? Auch, gewiß. Denn erbarmungsloser, entblößender, energischer ist nur selten jemand, auch als Schriftsteller, mit sich um-, gegen sich vorgegangen. Voyeurismus also schon, doch dann und vor allem: Dermaßen knapp, konzis, überwältigend gekonnt präsentiert sich das, was sonst leichthin und als Vorwurf (gegen Literatur) unbedacht Innenschau heißt, eben nicht alle Tage. Dazu gehört der Meister. Jandl ist einer – einer der ganz wenigen, die wir (auch unter gegenwärtigen Lyrikerinnen und Lyrikern) haben.
Gedichte aus sieben Jahren, 1982 bis 1989. Vor sechs Jahren erschien zuletzt ein Gedichtband von Ernst Jandl: selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr. Benedikt Erenz schrieb damals in dieser Zeitung am Ende einer rühmenden Kritik:
Es ist nicht mehr die Sprache, mit der Ernst Jandl jongliert – es ist die Verzweiflung selbst. Ich hatte mich auf dieses Buch gefreut; auf das nächste freue ich mich nicht mehr, ich fürchte es.
Das war mehr als die bloß elegant-elegische Rundung einer Rezension: Jandls Verse sind seit vielen Jahren Ausdruck einer wachsenden Verfinsterung, einer bedrückenden, weil den Leser erfassenden Lebensbedrohung.
Das hat sich in den idyllen verstärkt. Es ist ein kleines Wunder, wie Jandl es versteht, die Gedichte dennoch immer wieder eine Handbreit über dem Boden eines ernüchternden Alltags schweben zu lassen. Aber eben, er schafft es – und das macht auch dieses Buch nicht nur erträglich, sondern gar zu einem Genuß. Ohne seine Klage an billigen Klamauk zu verraten, ohne sich also durch Pointen und Witzelei gegen die Wunden (auch die des Hohns und falschen Mitgefühls) abzuschirmen, gelingen diesem Wortbeherrscher wiederum herrlich kalauernde Zeilen:
es hat mich umgeschmissen
mein leben ist zerrissen
ich will von nichts mehr wissen
da meldet sich das pissen
und zerrt mich aus den kissen
Ein Wortbeherrscher, nicht nur ein Sprachspieler. Das war er einmal (Reprisen wie das Gedicht „insektenfresser“, in dem die Wörter „insekt“ und „mund“ graphisch miteinander verschmelzen, wirken eher matt) – und er war es nicht umsonst. Schule der grammatischen Geläufigkeit, Praxis der linguistischen Litanei: Er ist da durch, und das bleibt spürbar mit jeder Wendung, jeder Zeile, mag sie noch so schlicht, so eingängig, ja harmlos wirken. Und die Ahnen, die Experimentierer und Expressionisten, die Waghalsigen und Verwegenen: Er vergißt sie nicht, er fühlt sich – zu Recht – immer noch als einer der Ihren; in Widmungen, Widmungsgedichten erweist Ernst Jandl Reverenz.
Zum Beispiel ist „august stramm“ Held – und Titel – eines Gedichts, dessen erste Strophe so lautet:
er august stramm
sehr verkürzt hat
das deutsche gedicht,
die zweite dann:
ihn august stramm
verkürzt hat
der erste weltkrieg,
und schließlich:
wir haben da
etwas länger gehabt
um geschwätzig zu sein.
Geschwätzig? Raffinierter, komprimierter wohl läßt sich nicht Lob und Leben singen und eigene Position bestimmen.
Jandls Lieder werden immer deutlicher. Als alternder dichter („mir ist so bang“) schont er niemanden, sich selbst am wenigsten. Die „hohe kunst“ ist nun die Reinigung der Zahnprothese, ein Gedicht bietet ein „kleines geriatrisches manifest“. In der Straßenbahn muß der Dichter erleben:
schöne junge damen springen auf
wenn ich mich durch die tramway rauf
Und wenn eine alte Frau – in dem Poem „älterndes paar“ (nicht einfach nur: alterndes), einem der wenigen längeren Gedichte dieses Bandes – ihren Mann ruft: „du alter arsch“, ihn anherrscht: „fick mich wie einst im mai, bis hin zum doppelschrei“, dann verbirgt solch lyrische Kraftmeierei nur um so deutlicher Verheerungen und Verluste, ist der forsche Ton verdrehte Trauer:
ach scheiße, wie die liebe oft sich zeigt
wir hatten so gehofft, daß sich der tag nie neigt.
Diese Verse halten sich nur schwer in der Balance, oft genug drohen sie wegzukippen, ins Bodenlose, ins gewollt Banale. Ein Gedicht, das nur ein Datum als Titel hat („25. februar 1989“), beginnt mit den Worten:
das ist vielleicht
das ende der gedichte
muß aber nicht
des schreibens ende sein.
Vom Tod Erich Frieds und Thomas Bernhards ist da die Rede und von der Möglichkeit, vielleicht den Lebenserfahrungen anders als im Gedicht auf die Spur zu kommen:
ich denke manchmal
etwas an geschichte
die durch mein leben zieht
könnte zu schreiben sein.
Was damit gemeint ist, lassen die wenigen, enorm beherrschten Verse ahnen, die vom Verlust der Kindheit, der Eltern, der Geborgenheit überhaupt sprechen – wie dieses knappe, titellose Gedicht:
in der küche ist es kalt
ist jetzt strenger winter halt
mütterchen steht nicht am herd
und mich fröstelt wie ein pferd
Idyllen, Verklärungen sind auch das nicht. Es gibt ganz unfreundliche Erinnerungen an die Kindheit, und es ist im übrigen nicht gestattet, alle diese Texte wie autobiographische Mitteilungen zu lesen, selbst dann nicht, wenn Ernst Jandl damit kokettiert:
immer von sich selbst erzählt
da gibt es nichts zu lachen
hat sich nicht die welt gewählt
nur ein paar spielsachen.
Wir sehen den Dichter am Schreibtisch, verzweifelt ja, doch munter auch, wenn die Verzweiflung Rhythmus geworden ist. Wenn die Silben tanzen, ist der Dichter glücklich, in all seinem Unglück. Sein „erstes sonett“ – reine Musik:
am reim erkennt man oft die zeile
auch an der wörter gleiche eile
am silbenschlag, der wie der takt
des drummers jene dichter packt
die nie beim jazz in ruhe bleiben
sondern es mit den beinen treiben
den füßen, die den boden schlagen
als könnten sie es nicht ertragen
baß, drums, trompeten, saxophonen
ohne bewegung beizuwohnen.
wir sind vom selben holz gemacht
ihr schlagt und heult, und in uns kracht
ohrenbetäubend tag und nacht
donner der sprache, heult und lacht.
Am Ende dann: sprüche, treusprüche („ich mag nichts neues / ich mag nur treues“), gar nur noch zeilen: opake Verse, Abbreviationen, Ausklänge – undeutlich, verfließend, verwirrend. Zunächst noch eine Anhäufung von kleinen Sinneinheiten, Versen, Miniaturgedichten wie etwa:
ich bin nicht gerne, wo ich bin
ich wäre nicht gerne, wo ich nicht bin
ach, wäre ich gerne, wo ich nicht bin
wäre vielleicht ich lieber, wo ich bin;
bald nur noch einzelne, fast gänzlich unzusammenhängende Zeilen, durch Striche voneinander getrennt. Da heißt es: „als welt dich noch schlug“, oder: „was brennt ihr so stumpf“. Dann schließlich, letzte Zeile, Schluß des Gedichtbandes:
ganz ernst sieht gott zu.
Ganz ernst, ganz Ernst?
Der Lyriker Jandl ist noch nicht einmal 65 Jahre alt, mithin ein Schriftsteller in den besten Jahren; das Verstummen wollen wir ihm noch nicht gestatten. Ein wenig frühe Alterslyrik, schön und gut, er hat sie sich verdient – doch hoffen darf man auf einen neuen Aufschwung. Denn die poetische Kraft ist ungebrochen, die Könnerschaft eines Dichters, der den elegischen Ton mit dem ätzenden, den kalauernden Vers mit dem pathetischen zu verbinden weiß. Die Leser, so Jandls Devise („die schöne kunst des schreibens“), „dürfen verlangen, zur Aufmerksamkeit gezwungen zu werden und sich nicht selbst dazu zwingen zu müssen.“
Er soll uns noch oft, noch lange zwingen: Einer unter den Menschen, einer an seinem Schreibtisch, einer, der selbst am meisten zu staunen scheint, wenn aus dem Nichts etwas entsteht, da auf dem Papier, wenn etwas dahingezaubert worden ist, von ihm – „gelegtes gedicht“:
hier liegt
ein gelegtes gedicht, darüber
brütet ein
dichter vielleicht
vielleicht noch lange
Volker Hage, Die Zeit, 8.9.1989
Die vergifteten Idyllen des Ernst Jandl
Die Werkausgabe Ernst Jandls datiert vier Jahre zurück. Manches, was bereits 1982 entstand, hat darin vorerst keinen Eingang gefunden. Jetzt entdeckt es der Bewunderer dieses „Onkels der Wiener Gruppe“ (Jandl über Jandl) zusammen mit einer respektablen Anzahl neuer und neuester Verse in dem Band idyllen, der – o meine luchterhand – im deutschen Hausverlag des Wiener Poeten soeben erschien.
Die idyllen Ernst Jandls sind, wie nicht anders zu erwarten, keine Idyllen. Selbst die (rührenden) Rückblicke in die Kindheit wirken perspektivisch verzerrt, merkwürdig minimundusmäßig, und die Natur, die es im neuen Band reichlich gibt, hat immer das, was den Städter an ihr stört, und sei es nur, daß sie ihn sticht oder zwickt.
Nicht neu im poetischen Kleinkosmos des Autors sind die hinreißend gemimte, längst echt gewordene Hypochondrie („was hast du gemacht heute? / ich habe mein medizintäschchen ausgeräumt heute / du weißt, von der reise / den ganzen tag lang? / du mußt denken, die reise / hat zwei tage gedauert…“) und die hellwache Bereitschaft zur sexuellen Assoziation, wo immer ein Wort-Bild gestattet, was die Moral verbietet.
Eine allgegenwärtige physische Mattigkeit macht das Ausleben der diesbezüglichen Phantasien allerdings zur Schwerarbeit, ja zum Gestopfe.
Und das Alter und der Tod sind auch in den Kreis der Motive getreten, wo sie umgehend und respektlos verjandlt werden:
erst wenn ich so tief unten greif
daß gott ich spür als schleim seim seif
weiß ich daß tief genug ich hab
mein scheißhand in mein scheißen grab.
In einer Technik, die bestechend souverän gehandhabt wird, wird nuanciert benannt, was jedes offizielle Vokabular erröten lassen muß.
Ich stoße an der Wolken Sitz
ich warte auf den ersten Blitz,
hat es (bei Nietzsche) vor hundert Jahren noch geheißen. Da hatten die Dichter noch Übergröße, schnappten Höhenluft auf Kothurnen und Stelzen, die unter Tuch verborgen wurden. Darum wohl gab es in diesen Tagen, jedenfalls öffentlich und schon garnicht am Papier, keinen von ihnen mit fehlenden – oder fallenden – Beinkleidern.
Bei Jandl gibt es ihn, wie man weiß, in Versen alltäglicher Selbstbetrachtung („scheißender mann“) schon vor Jahren, und jetzt nicht nur wieder, sondern gleichsam vollendet: Eine poetische Skizze, in welcher der sich selbst darstellende Dargestellte – von wo, ergänzt die Assoziationskraft des Lesers – „nur notdürftig gereinigt zurück ans telefon zappelt / die hose haltend und die welt verfluchend“.
So hat sich die Gefahr des Blitzschlags reduziert:
GUT GELAUNT, DER BAUM
schreibt sich an himmel, balgt
mit vögeln sich, berührt
drei seiner art; tausend
gewitter, doch
kein blitz noch der ihn
die birke
gebrannt hätte
So heiter die Birke, so sicher eine Irritation. „mein auge / du billiger / blinker“, blitzt in der Idylle schon ein Utensil des Tiermörders auf.
nimm seife, jäger, wasche dir die hände
damit du nachts nicht träumst von rehes ende.
Die Identitäten fließen ineinander:
ich sein hund in hasen
ich sein hasen in hund
das sein ein jagen.
Und noch tiefere Nöte treten hinzu:
der jäger greift sich an den schwanz
ist das verfluchte rohr noch ganz?
gefolgt von der bitteren Erkenntnis:
was ich in meiner hose berge
gebühret eher einem zwerge.
In Rohrmoos, dem notorischen Sommersitz, scheint Jandl in der Tat hauptsächlich zu sitzen:
ich ginge ja gern mit dir mit
wenn du hinunter gehst in den ort
aber das hier heroben ist der ort
des stuhls auf dem ich sitze.
Und:
ich setze mich hin
und weiß von nichts
ich stehe auf
und weiß von nichts
ein gedicht ist geboren
das schicksal zieht mich an den ohren.
Und:
setzt sich
und sitzt
stinkt ein bißchen
die nase
spürts
ein flugzeug
das ohr
hörts.
goldgrün
Ein Sommer nämlich, tief in Wien, schreckt diese Art von Bukoliker nicht wirklich. Und wenn es sich in der Stadt tausendmal unsicherer lebt. Und wenn man da nicht voraus blickend genug sein kann. „auf straßen geh ich nur im schutz von ärzten“, versichert (sich) der Bruch-Gepeinigte, dessen Erfahrungen mit Medizin, Ärzten und Krankenschwestern in den idyllen nicht fehlen.
In Wien widerfahren dem Dichter aber nicht nur Unfälle, sondern auch Begegnungen.
plötzlich hans hollein mir zur seite geht
eh mich mein ziel aus seiner richtung dreht.
Künstlerneid regt sich:
während ich nach wörtern zitzeln
muß, kann oberhuber kritzeln,
wird aber übertroffen vom Erstaunen über ein Wesen von Morgensternschem Zuschnitt: Das Zilk.
Wien ist nicht anders, sondern dort, „wo das zilk weidet“. (…) „das zilk blickt tief ins wiener herz“ heißen die Annäherungen. Sie gipfeln in einem Hymnus, der das Zilk an das Ende einer aufschlußreichen Reihe von möglicherweise evolutionär verwandten Wesen stellt, darunter ein falk, ein schalk und, hintergründig beigesellt, ein alk und ein elk.
Daß er in gewissem Sinn ein „minor poet“ ist, weiß Jandl und bekennt sich dazu. Kurzweilig aber ist er noch dort, wo er auf Kollegen anspielt, denen er dasselbe nicht zusprechen kann:
(„über die dörfer“)
das publikum ersitzet
der bühne zugewandt
des schauspiels dauer
Michael Cerha, Der Standard, 23./24.9.1989
Jandl weiß, was er weiß
In der Schule hatten wir moderne Lehrer und daher auch moderne Lyrik. Einmal mußte ich ein Gedicht von Jörg Fauser vorlesen, in dem von klatschenden Klöten die Rede war. Antje aus der letzten Reihe fragte, was denn Klöten seien. Das war allen sehr unangenehm. Auch Jandl wurde durchgekaut: „ottos mops kotzt“ und „lechts und rinks kann man nicht velwechsern“. Die Begeisterung des Lehrers wurde von der Klasse keineswegs geteilt. Wir fanden derlei sprödes Wortspiel einfach nur albern. Wenn unsereins damals zu Lyrik neigte, dann eher zu Rilke und ähnlich Geheimnisreichen. Und ein Geheimniskrämer ist Ernst Jandl nicht.
Auch in idyllen herrscht schonungslose Metaphernabsenz. Was Jandl weiß, das sagt er, dreist und ohne Scham. Knochentrocken huldigt er den beiden Funktionen des männlichen Gliedes, sein eigenes findet er etwas kurz. Ein Dichter verhöhnt seinen welkenden Körper. Seine alten Beine – „zusammen 126 jahr“ – könnten ebensogut abgehackt werden. Er scheint es versucht zu haben: „ringsum das blut zeugt vom bemühen“.
Ein guter Teil der Texte erzählt von nackter, grauenhafter Angst vor Siechtum, Ärzten und Hilflosigkeit. Aber Jandl jammert unterhaltsam:
hebt mich auf die bahre, engel
schaffet mich ins hospital
wo die edlen ärzte warten
zu beenden meine qual.
Ganz trostlos ist das Dasein auch nicht. Der Dichter freut sich an den kleinen Dingen, zum Beispiel lang im Bett zu liegen („hauptsache schlafen“), Jazz zu hören, zu onanieren („vielleicht nicht ganz so oft, nicht ganz so flott wie in den besten Jahren“), oder er trifft sich mit seinen schwerhörigen Freunden.
Stilistisch ist ihm jedes Mittel recht, genießerisch bedient er sich des Büttenredner-Versmaßes. Leider findet man aber auch abstoßende Übungen in konkreter Poesie vor. Ein Rechteck aus „238 m“ zu konstruieren und rechts darunter die Silbe ich zu setzen, ist einfach altbacken. Zwar ist hinreichend bekannt, daß es dem Dichter nicht auf Sinn, sondern auf Sprache an sich ankommt, doch derlei Spielchen mindern den Wert ganz erheblich.
Doch Jandl-Bücher sind sowieso egal. Jandl muß man hören. Jandl ist ein Lese-Star. Dann sitzt er da, knarzig, klein, gedrungen und macht aus Wörtern Lebewesen. Er sagt dreimal hintereinander leer, und man weiß, was leer bedeutet, man weiß es dann so sehr, daß einem schaudert. Jandl liebt Lesungen. Er sagt es im Gedicht:
… diese eine stunde
da ich mich verbunden spür
euch, vor denen ich berichte
was ich weiß, was ich weiß
was ich weiß, sind die gedichte
die ich schrieb, für euch, o freunde
meine liebliche gemeinde.
Ja, das freut ihn, der das Alter so verabscheut, wenn die jungen Leute zu ihm strömen und mit leuchtenden Augen liebevoll lauschen. Da vergißt er eine Stunde sein welkendes Fleisch. Lauschen kann man Jandl auch auf Platte: Seine letzte LP heißt vom vom zum zum, enthält neben lustig-piepsiger Jazz-Musik auch einige der besten Texte aus idyllen. Und ist dem Buch vorzuziehen.
Max Goldt, Die Welt, 10.10.1989
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Urs Allemann/Jürg Laederach: Von Sprachdonner und lockend lauerndem Alter
Basler Zeitung, 11.10.1989
Ludwig Harig: „Ich fliege nicht/Ich stürze aus dem Bett“
Frankfurter Rundschau, 2.12.1989
Jürgen P. Wallmann: Lachen, um nicht zu heulen
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 26.1.1990
Jörg Drews: Das eigene Altern, der Zerfall
Süddeutsche Zeitung, 10./11.2.1990
Jörg Rheinländer: Ich quill, ich quill
BuchJournal, Heft 3, 1989
Ernst Jandl: Idyllen
Sozialmagazin, Heft 10, 1989
Norbert Hummelt: Von Idyllen
StadtRevue Köln, Heft 11, 1989
Jochen Wittmann: Ernst Jandl: Idyllen
GIG, Heft 42, 1989
Fritz Müller-Zech: Neue Jandl-Gedichte
Am Erker, Heft 21, 1989
RB: Ernst Jandl: Idyllen
Treffpunkt Bibliothek, Heft 4, 1989
Jochen Wittmann: Heruntergekommene Sprache
PRINZ, Heft 12, 1989
Martin Ebel: „Er ist ja schon fort“. Ernst Jandls Schein-„Idyllen“
Badische Zeitung, [1989]
W. Christian Schmitt: „Wenn ich im Spiegel mich beschau“. Lyrik im Herbst 1989 / Aus den Programmen deutschsprachiger Verlage
Rheinische Post, 22.7.1989
W. Christian Schmitt: Lyrik-Trends
Darmstädter Echo, 29.7.1989
W. Christian Schmitt: Denn Verse sind nicht Gefühle – es sind Erfahrungen. Viel gedruckt, aber unverkäuflich? Lyrik-Ausgaben
Wiesbadener Kurier, 30.8.1989
Ronald Pohl: Moribund fürs Leben
Wochenpresse, 13.10.1989
Bruno Kehrein: Ernst Jandl: Idyllen
Düsseldorfer Illustrierte, 10.1989
J. Dr.: Messesplitter: Erfolge
Süddeutsche Zeitung, 16.10.1989
Anonym: Erfahrung als Datenschutz
Die Andere Zeitung, 10.1989
Bettina Steiner: Sprachspiele
Volksstimme, 18.10.1989
Ernst Nef: Ernst Jandls Rückzug
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.1989
Anonym: Ernst Jandl: Idyllen
Der kleine Bund, 4.11.1989
Jürgen P. Wallmann: Trügerische Idyllen
Darmstädter Echo, 11.11.1989
Manfred Stuber: „Ohne Wunsch kein Punsch…“
Mittelbayerische Zeitung, 14.11.1989
bmg: [Rezension zu „idyllen“]
Südwest Presse, 25.11.1989
ww: Hintersinnige Idylle
Südkurier, 30.11.1989
Erich Demmer: „Wien ist, wo Zilk weidet!“. Ein köstlicher Poesie-Band von Ernst Jandl
Arbeiter-Zeitung (AZ), 1.12.1989
Norbert Tefelski: „Schöne junge Damen springen auf“
Stadtzeitung Berlin, 23.11.–6.12.1989
Claudia Sander-v. Dehn: Herbe Daseinsflüche
Hessische Allgemeine Zeitung, 9.12.1989
Silvia Studer: Ernst Jandls „idyllen gedichte“
Bündner Tageblatt, 22.12.1989
Jürgen P. Wallmann: Durchaus unfreundliche Idyllen
Der Tagesspiegel, 7.1.1990
Rainer Stöckli: Jede Form ist ein Kerker. Über Sonette, sapphische Oden, Einzeiler, „Septemtriones“
Zürichsee-Zeitung, 24.2.1990
mü.: Heimtückisch
St. Galler Tagblatt, 8.3.1990
Jürgen P. Wallmann: schonungslos: Idyllen
Stadtblatt Münster, 3.1990?
Elisabeth Grotz: „Mit Sinn die Sprache ist beladen“. Gedichte von jungen und alten Meistern
Die Presse, 31.3./1.4.1990
Jürgen P. Wallmann: Lachen, um nicht zu heulen. „Idyllen“-Gedichte von Ernst Jandl / Des österreichischen Dichters gestörtes Verhältnis zur Welt
Rheinische Post, 26.5.1990
Jürgen P. Wallmann: Schreiben als Existenz. Ernst Jandl legt mit idyllen einen neuen Lyrikband vor
Mannheimer Morgen, 31.5.1990
Erika Tunner: Poeta Jandlicus oder Etwas über die vernünftige Tollheit. Zu den idyllen
In: Siblewski, K. (Hg.): Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder, Luchterhand Verlag 1990
Alexander Goeft: Darf ich denn dort ruhn. Neue Gedichte von Ernst Jandl
Tüte, Heft 2, 1990
Jürgen P. Wallmann: Ernst Jandl: Idyllen
Literatur und Kritik, Heft 241–242, 1990
rb: Brüllende Sprachkunst
SWF-Journal, Heft 2, 1990
Jürgen P. Wallmann: Wenn Gedichte zu Grimassen werden
Schwäbische Zeitung, 8.10.1990
Matthias Müller: Zipfel der Wahrheit
Appenzeller Tagblatt, 13.10.1995
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.1990
wirklich schön
Karl Riha: Ernst Jandl, Sie haben sich für Ihre Frankfurter Poetik-Vorlesung im Jahre 1984 einfallen lassen, daß man bei einem solchen akademischen Start alles und gleichzeitig nichts hat und daß alles dies zu tun habe mit dem Öffnen und Schließen des Mundes. Kann man das auf eine Situation wie unser Interview hier übertragen? Mit dem Öffnen und Schließen des Mundes hat ja ein Interview auch etwas zu tun.
Ernst Jandl: Ja. In dem Moment, wo ich, aufgefordert durch Sie, meinen eigenen Mund zu öffnen und schließen beginne, würde es dann heißen: das Öffnen und Schließen der Münder oder, um präzise zu sein, das Öffnen und Schließen zweier Münder.
Riha: Bleibt zu hoffen, daß wir mit unserem Münder-Öffnen und -Schließen vielleicht die Ohren der Hörer etwas öffnen. Das ist der Sinn des Gespräches. Wir wollen die Ohren öffnen für Ihr literarisches Werk, für Ihre Gedichte. – Der aktuelle Anlaß: Sie haben für Ihren Lyrikbank idyllen, der im letzten Jahr erschienen ist und rasch in die zweite Auflage gekommen ist, den Peter-Huchel-Preis erhalten, einen gut dotierten und angesehenen Literaturpreis. Es ist ein Preis in einer Kette von Literaturpreisen, die Sie erhalten haben. Ich erinnere an den Georg-Trakl-Preis, ich erinnere an den Georg-Büchner-Preis, ich erinnere an den Großen Österreichischen Staatspreis. Meine erste Frage im Zusammenhang mit diesem Literaturpreis: Was verbindet Sie, was verbinden Sie mit dem Namen Peter Huchel? Und ich darf vielleicht im Hintergrund erinnern, daß Sie zum Beispiel zu Arno Schmidt gesagt haben: Ich habe zu Arno Schmidt kein Verhältnis, und daß Sie umgekehrt gesagt haben, etwa zu Bertolt Brecht: Den würde ich gern getroffen haben; das war ein ganz wichtiger Autor des zwanzigsten Jahrhunderts. – Also: welches Verhältnis haben Sie zu Peter Huchel, der diesem Preis den Namen gegeben hat?
Jandl: Im Gegensatz zu Bertolt Brecht habe ich Peter Huchel tatsächlich zu treffen die Ehre und das Vergnügen gehabt. Ich traf ihn, wenn ich mich recht entsinne, zuerst einmal an der Akademie in Westberlin als einen freundlichen, interessierten und zugleich zurückhaltenden älteren Herrn. Der Name Peter Huchel war mir schon vorher bekannt, vielleicht weniger durch die Lektüre meinerseits seiner Gedichte, von denen mir sicher das eine oder andere, schon ehe ich ihn kannte, untergekommen ist, als hervorragender Chefredakteur der hervorragenden Zeitschrift Sinn und Form, die jedenfalls hervorragend war, solange Peter Huchel der Chefredakteur dieser Zeitschrift war.
Riha: Und er hat sich auch als ein couragierter Chefredakteur erwiesen; diese Zeitschrift über die Jahre zu bringen, war nicht so leicht. Und insofern hat er für die Nachkriegsliteratur sicher eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Jandl: Ja, ja. Und dann erinnere ich mich noch, daß Friederike Mayröcker und ich in der Gesellschaft für Literatur – so Mitte der siebziger Jahre muß es gewesen sein – eine Lesung von Peter Huchel uns anhörten und überaus beeindruckt waren, sowohl von den Gedichten, die wir zu hören bekamen wie auch von seiner Art, diese Gedichte vorzutragen. Ich kann nicht sagen, daß die Gedichte von Peter Huchel irgendeinen merkbaren, für mich selber merkbaren Einfluß, etwa auf meine Art des Schreibens, gehabt hätten. Niemand, der Gedichte von mir und Gedichte von Peter Huchel auch nur flüchtig kennt, würde so etwas ernsthaft vermuten. Aber die unerhörte Sprachkraft, die magische Qualität seiner Gedichte ist etwas, das auch ein auf einer anderen Position stehender Autor wie ich einfach nicht übersehen konnte – wovon ich also wirklich sehr beeindruckt war und auch bin. Das Einzelgedicht von Peter Huchel kann man – so habe ich es selber probiert – viele Male lesen, ohne daß es zu Ende gelesen werden kann. Es bleibt immer nahe, und es zeigen sich immer wieder neue Facetten in einem solchen Einzelgedicht. Man bleibt also in diesem Gedicht ein Entdecker, so wie man auf einem begrenzten Stück Land, wenn man es auch jahrelang bewohnt, die entsprechende Disposition natürlich vorausgesetzt, immer ein Entdecker von Neuem bleiben wird. Es ist Huchel meisterhaft gelungen, so scheint es mir, Mensch und Natur und, wenn man will, Kosmos und Mythos zu einer Einheit zu machen oder als Einheit darzustellen, wobei die Voraussetzung ist, daß sie als Einheit erlebt werden von ihm, daß die Welt nicht zerfällt in einzelne fest abgegrenzte oder abgrenzbare Sphären, sondern daß er imstande ist, innerhalb einer Zeile das Kosmische, das Menschliche, das Humane, in einer sehr packenden und ganz überzeugenden Weise als Einheit darzustellen. – Und ich will noch festhalten, daß ich bei ihm auch nicht unterscheiden kann zwischen seiner faszinierenden Sprachbehandlung und seiner Weitsicht. Es ist also nicht so, daß mich jetzt die Sprachbehandlung in erster Linie oder die Weitsicht in erster Linie interessiert, sondern beides zusammen – wiederum als Einheit untrennbar und von beiden Seiten betrachtet, also als Bild der Welt oder ein Blick in die Welt, ein blitzartiger Blick in die Welt und zugleich verblüffendste Arten der Sprachbehandlung.
Riha: Der Preis wurde Ihnen gegeben für den Band idyllen; wir wollen versuchen, uns in diesem Gespräch etwas den Blick auf diese Publikation zu öffnen. Es ist ein Gedichtband, der innerhalb Ihres Werkes nach der dreibändigen Ausgabe der Gesammelten Werke veröffentlicht wird. Es gibt wenige zeitgenössische Autoren, die eine solche Sammlung ihrer Werke erleben dürfen. – Meine Frage: wie steht dieser Gedichtband zu diesem großen Überblick über Ihr Werk, den die Werkausgabe darstellt? Handelt es sich bei den idyllen aus Ihrer Perspektive mehr um einen Nachtrag, oder führen Sie noch einmal alle Möglichkeiten des Gedichts vor, die Sie für sich erobert und gefunden haben, oder kommt es gar zu neuen Linien, die bisher kaum gezogen waren, im Sinne einer noch weiteren Ausdehnung der Grenzen des Künstlers, der Sie sich verschrieben haben? Oder handelt es sich um Abbrüche? Ich meine, daß es zumindest zwei, drei Texte gibt, die auch das Thema des Abbruchs des Schreibens fixieren, etwa das Gedicht auf den „25. februar 1989“, eines der letzten Gedichte, das in diesen Band Eingang gefunden hat.
25. FEBRUAR 1989
das ist vielleicht
das ende der gedichte
muß aber nicht
des schreibens ende sein
ich denke manchmal
etwas an geschichte
die durch mein leben zieht
könnte zu schreiben sein
doch starb vor kurzem erst
genosse erich fried
nach ihm dann thomas bernhard
auf größere distanz
wer garantiert mir zeit
– ich wünsche keinen glanz –
verstöße gutzumachen
stückwerk ganz
Zurück zur Frage: welchen Stellenwert hat, bezogen auf die Ausgabe der Gesammelten Werke, dieser Gedichtband idyllen? Kann man das überhaupt auf einen Nenner bringen oder gibt es ganz verschiedene Antworten?
Jandl: Wenn dieser Gedichtband bereits vorgelegen wäre, ehe die Herausgabe der Gesammelten Werke abgeschlossen war, dann wäre er an der entsprechenden Stelle, nämlich nach dem selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr aufgenommen worden. Das war der letzte Gedichtband, der geschlossen in die Gesammelten Werke, Band zwei – die ersten beiden Bände sind Gedichte – Eingang gefunden hat. Danach kamen dann noch verstreute Gedichte, die in keinem Band gesammelt worden waren. Wäre dieser Band idyllen vor der Herausgabe der Gesammelten Werke fertig gewesen, so wäre er einfach als letzter geschlossener Dichtband dort hineingekommen, und man hätte dann wohl sehen können, daß zwar das Selbstporträt im Sinne des selbstporträts des schachspielers als trinkende uhr vielleicht nicht konsequent fortgesetzt wurde, daß aber doch eine ganze Reihe von Gedichten die Person des Autors, das Leben des Autors berühren, und daß wohl mehr als in jedem Gedichtband zuvor der Autor sein eigenes Schreiben und Leben als Autor reflektiert, daß er einige Jahre älter geworden ist, daß er sich damit, vielleicht bewußter noch als früher oder öfter als früher, mit der Begrenztheit seines Lebens befaßt hat und daß diese Grenze des Lebens zugleich auch die Grenze des Schreibens ist, wobei immer die Grenze des Schreibens natürlich früher kommen kann als die Grenze des Lebens, nicht umgekehrt. Das ist jedenfalls einer der Eindrücke, die man wahrscheinlich von den idyllen bekommt.
Riha: Sie betonen den Zusammenhang zwischen Thema und Schreibweise. Betrachtet man die Schreibweisen isoliert, stellt man fest, daß auch in diesem zuletzt vorgelegten Band eine große Bandbreite der Schreibweisen dokumentiert ist, d.h. daß es sich um sehr unterschiedliche Gedichte handelt, die zeigen, daß Ernst Jandl ein Autor ist, der das Gedicht auf ganz unterschiedlichen Feldern in ganz unterschiedliche Richtungen weiterbewegt und am Leben erhalten hat.
Jandl: Diese formale Vielfalt ist sicherlich festzustellen. Zwar ist das Gedicht, das sich dem konkreten Gedicht annähert, nur noch in wenigen Exemplaren in diesem Buch vertreten, aber es sind zahlreiche andere Schreibweisen von Gedichten, soweit sie mir zur Verfügung stehen, hier in diesem Buch vorzufinden.
Riha: Auch traditionelle?
Jandl: Es sind sogar verhältnismäßig viele Gedichte, die den Reim verwenden, und ich empfinde es als eine Lust oder zuweilen als eine Lust, zu reimen, wobei mich der gewichtige Reim, Reimstellen, die mit gewichtigen Wörtern oder mit wichtigen Wörtern des Gedichtes zusammentreffen, interessieren, mehr jedenfalls als der so zufällig ins Gedicht hineingestreut erscheinende Reim.
aus der dichtung großem glück
langsam zieh ich mich zurück
oder tue einen schritt
der mein dichtersein zertritt
nur den lesern bleibe ich
noch ein weilchen dichterlich
Riha: Ein ironisches Gedicht, ein sentimentales Gedicht?
Jandl: Ich habe nichts gegen diese beiden Wörter ironisch und sentimental. Das Gedicht beginnt sentimental, aber zugleich mit einem gewissen ironischen Beigeschmack. Wenn ich sage: aus der Dichtung ziehe ich mich langsam zurück, so ist das gesprochen von einem alternden oder nicht mehr ganz jungen Dichter. Sicher mag das sentimental klingen. Wenn ich das erweitere zu: „aus der dichtung großem glück / langsam zieh ich mich zurück“, so liegt in diesem „großen glück“ Ironie, das glaube ich schon. Oder: „tue einen schritt / der mein dichtersein zertritt“, das ist, glaube ich, hart genug, um weder als sentimental noch als ironisch zu gelten. Der Schluß allerdings, der gewissermaßen den Wunsch darstellt, man möge über das Ende des Lebens hinaus noch im Gedicht lebendig bleiben – „nur den lesern bleibe ich / noch ein weilchen dichterlich“ – mündet sicher wieder in Ironie, schon durch das Wort „dichterlich“, auch durch das Diminutiv „noch ein weilchen dichterlich“.
Riha: Wir kommen später noch einmal auf die Vielfalt der Tonarten, die Sie dem Altersthema abgewinnen, zurück. Zunächst möchte ich beim Titel einsetzen. Sie haben diesem Band den Titel idyllen gegeben. Bei diesem Stichwort hat man zunächst literarhistorische Assoziationen. Der Hauptidyllenautor der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts war Salomon Geßner. Ich habe mir aus seinen Schriften folgende Definition der Idylle herausgesucht:
Diese Idyllen sind die Früchte einiger meiner vergnügtesten Stunden: Denn es ist eine der angenehmsten Verfassungen, in die uns die Einbildungskraft und ein stilles Gemüth setzen können, wenn wir uns mittelst derselben aus unseren Sitten in ein goldenes Weltalter setzen. Alle Gemählde von stiller Ruhe und sanftem, ungestörtem Glück müssen Leuten von edler Denkart gefallen; und um so viel mehr gefallen uns Szenen, die der Dichter aus der unverdorbenen Natur herholt, weil sie oft mit unsern seligsten Stunden, die wir gelebt, Aehnlichkeit zu haben scheinen.
Das ist ein zufälliges Zitat, eine Definition für Idyllen, die uns weit weg zu liegen scheint: achtzehntes Jahrhunderts, schöne Landschaft, idyllische Landschaft, locus amoenus. Ist es das, was der Titel meint, und ist es Ihr Versuch, zu zeigen, daß auch in unserer heutigen Zeit Idyllen geschrieben werden können im Sinne einer solchen Augenblicks- oder Momentserfahrung eines losgelösten, spontanen, unvermittelten, vielleicht auch unverdienten Glücks?
Jandl: idyllen als Titel für diesen Gedichtband bedeutet mehreres, gewiß nicht in erster Linie Punkte einer besonderen Glückserfahrung, wohl aber an manchen Stellen dieses Buches die Darstellung einer kleinen, stillen, ruhigen Welt, die sich auch in unserem bewegten Zeitalter finden läßt, ohne deswegen unbedingt in die Massenmedien einzugehen oder in den Massenmedien im Vordergrund zu stehen. Punkte der Ruhe, der Nachdenklichkeit, der, wenn man will, Besinnlichkeit – solche findet man schon in diesem Buch, und das allein scheint für mich schon den Titel idyllen zu rechtfertigen. Ein Beispiel:
gehen schauen ob schneeglöckchen schon
kommen seien in parken, läuten den
frühling ein
und dann da werden sein primeln und veilchen und
fliederbuschen lilae und weißen
und mit dem triton wieder werden fahren ich
und läuten mit der glocke von triton
Eine Anmerkung am Rande: triton steht österreichisch für Tretroller, ein Ding aus der Kindheit, heute kaum mehr zu sehen.
Riha: Triton – so aber auch der Name des griechischen Meergotts. Das hängt mit der Antike zusammen, und die klassische Idyllendichtung hat sehr häufig Natur und klassische Mythologie zusammengebracht. Von daher ist gerade dieser Text für mich ein sprechender Beleg für eine gelungene Fortsetzung der Idyllendichtung bis in die Gegenwart. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Texte, die man hier zitieren könnte, etwa „nach hause kommen oder gut gelaunt der baum“. Auch ein Gedicht auf eine Lesung in Saarbrücken; dort ausdrücklich die Formulierung „glücklicher moment“. Oder aber eine Reihe von Gedichten, die offensichtlich mit Gebirgsurlauben zusammenhängen, „skizzen aus rohrmoos“. Das sind solche Ausschnitte, für die das Stichwort Idylle sicher passend ist, wenn auch nicht mit dem Beiklang, den dieses Gattungswort aus dem achtzehnten Jahrhundert heraus hat, sondern: neue Idyllen, Augenblickserfahrungen, die in sich ihre aktuelle Berechtigung behaupten.
Jandl: Oft oder zuweilen auch Rückblicke in die Kindheit, Momente aus der Kindheit, so wie das eben gelesene Gedicht mit dem Triton und den Schneeglöckchen auch eine kindliche Sprechweise festhält oder zeigt. Ein anderes Gedicht noch, vier Zeilen, das ich auch durchaus als Idylle ansehe:
in der küche ist es kalt
ist jetzt strenger winter halt
mütterchen steht nicht am herd
und mich fröstelt wie ein pferd
Riha: Hier aber löst sich die Idylle doch schon in ihr Gegenteil auf. Es ist ja ein Einbruch von Frost und von Leere in den idyllischen Zusammenhang zu beobachten, und ich glaube, es gibt parallel dazu eine ganze Reihe von Gedichten, die das Idyllische als Absprung nehmen in eine seltsame Brechung der Idylle. Was ist das Gegenteil von Idylle?
Jandl: Ich habe auch keinen Ausdruck dafür. Man könnte es natürlich eine Anti-Idylle nennen, eine negative Idylle, eine dunkle Idylle. – Noch eines dieser Gedichte, die ich für so eine negative Idylle halte:
fahren aufs land
südbahnhof
noch keine bomben auf wien
vater hochhält den kopf
die drei knaben sind mit ihm
mutters tod darf die vier
nicht dauern zu boden ziehen
es wäre nicht nach mutters sinn
Eine Idylle, die auch wiederum diesen bitteren Beigeschmack hat. Hier geht der Vater mit seinen drei Söhnen auf den Bahnhof. Sie fahren aufs Land, so wie sie es getan haben, als Mutter noch lebte. Die Mutter ist tot, aber nach Mutters Sinn gehen sie weiter, fahren wiederum aufs Land.
Riha: Die Idylle in ihrer reinsten Form wäre eine Verklärung. Die Anti-Idylle bricht diese Tendenz zur Verklärung, führt Realität ein, führt Geschichte ein, führt auch Negatives ein als Moment der Realität. Heben wir unter den Texten in diesem Band, die ganz in die Richtung der dunklen Idylle, der Anti-Idylle, der Gegenidylle, gehen, die Gedichte „die klagenden dinge“ und „ich häng an einem ast“ hervor – in Opposition zu den Gedichten, mit denen wir eingeleitet haben:
DIE KLAGENDEN DINGE
die klagende seife, meingott, die weiße
aaaklagende seife, und das weiße
klagende waschbecken, das klagende
aaawaschbecken, und darüber
der klagende spiegel, mich
aaasehend, der klagende spiegel,
und die klagenden
aaahandtücher, durcheinander
aaageworfen die klagenden
aaahandtücher, welches wofür?
und die klagende
aaatür, die unge-
aaaölte klagende tür, wohin
aaageht sie auf wie der mond, gegen wen
aaaschließt sie? und die bäume, die fernen
bäume, wohin
aaaklagen sie? und ihr laub,
aaaund ihre früchte. mein stempel
trägt ein postfach, die klage
aaalautet: zwei zwei sieben.
ich habe mich erhoben; ich bin
aaazu boden geblieben.
Die Wiederholung des Wortes klagen verweist ihrerseits auf eine literarische Gattung: die Klage, die Elegie, die Jeremiade. Das sind Stichworte, die auf ihre Weise den Einbruch in die Idylle markieren.
ich häng an einem ast
die hand ist mir schon steif
der zweite ast, die zweite hand
sind weit.
vielleicht bin ich entzweit
mit mir und meiner zeit
Die Idylle setzt die Einheit der Person voraus. Mit der Entzweiung der Person mit sich selber ist ein grundlegender Konflikt angedeutet, der sich mit Idyllischem nicht mehr verträgt. Dabei markieren Alltagssituationen den idyllischen Absprung dieser Texte, Morgenstunden, bestimmte Erlebnismomente des Tages, dann aber ausgeweitet in die Klage und in diese Entzweiung des Ichs mit sich selber und der Zeit. Ich erinnere an Gedichte, die mit dem Zähneputzen, dem Putzen der Zahnprothese zusammenhängen, mit der Verrichtung der täglichen Notdurft: sehr grelle, zum Teil deftige, krude, finstere Motive – aber immer alle als ganz realistisch und auch sprachrealistisch gesehen. Weil sie im Alltäglichen ansetzen und die Idylle in die Klage und den Zwiekampf des Autors mit sich selber wenden, stehen diese Texte unter einer hohen Spannung – und Anspannung. – Wechseln wir das Thema. Wie alle Ihre Gedichtbände enthält auch dieser eine große Zahl von Texten, die man als literarische Standortbestimmungen bezeichnen könnte, in denen Ernst Jandl über sich als Autor spricht, über das Schreiben, seinen Platz in der Literatur. Sie sind oft nach Ihrer Stellung zur Wiener Gruppe gefragt worden. Das ist bekannt. Trotzdem: Sie haben unter die Gedichte der idyllen noch einmal einen Text aufgenommen, der nun definitiv klärt, wie Ihr Verhältnis zur Wiener Gruppe zu sehen ist:
VERWANDTE
der vater der wiener gruppe ist h.c. artmann
die mutter der wiener gruppe ist gerhard rühm
die kinder der wiener gruppe sind zahllos
ich bin der onkel
Das ist eine Art von Ablenkung; ich frage deshalb noch einmal nach: Was verbindet den Onkel und was trennt den Onkel von der Wiener Gruppe?
Jandl: Er ist ein Verwandter der Wiener Gruppe, er kann sich mit den Mitgliedern der Wiener Gruppe zu gemeinsamen Unternehmungen oder zu Gesprächen über Dinge gemeinsamen Interesses um den Tisch setzen. Er lebt von den Mitgliedern der Wiener Gruppe getrennt auf eine gewisse Distanz, auf eine nicht immer unkritische Distanz. Von seinen Kindern wird hier nicht gesprochen, also von denen, die, wie es ja bei der Wiener Gruppe der Fall war, von ihm gelernt hätten – schreiben gelernt hätten, wie das die Wiener Gruppe sicherlich als einen Einfluß aufwies. Er steht für sich und wird der Wiener Gruppe nicht – oder nur als entfernterer Verwandter – zugezählt. Die Kinder der Wiener Gruppe – das mag hier impliziert sein – interessieren sich zuweilen doch für ihn, vielleicht gerade deshalb, weil sie nicht immer – oder so oft – mit ihm beisammen sein müssen, wie das bei dem Beisammensein mit ihren Eltern der Fall ist.
Riha: Eine ironische Frage hinterher: Der onkel hat aber inzwischen selbst eine ganze Reihe von kindern, sprich: auch Jandl hat ja inzwischen als ein großer Anreger in der jüngeren Literatur gewirkt; hat er ein Verhältnis zu seinen kindern, ungewollten oder gewollten kindern?
Jandl: Er ist sich nicht immer ganz sicher seines Verhältnisses. Er kann jedenfalls sein Verhältnis zu eventuellen legitimen oder nicht legitimen kindern nicht auf einen Nenner bringen. Zuweilen ist er jedenfalls entsetzt, was seine Kinder so treiben.
Riha: Ist das mit Kindern aber nicht immer so? Sie sind ja dazu da, daß wir uns über sie entsetzen. Weshalb wären sie sonst auf der Welt? – Eine zweite Frage im Zusammenhang mit einem zweiten poetologischen Gedicht, das Gedicht „wissen, sagen“; in ihm stellen Sie das Dichten gegen eine große Kette anderer künstlerischer Tätigkeiten und setzen es dagegen ab.
WISSEN, SAGEN
die musiker mit ihren tönen
wissen was sie sagen
was sie mit ihren tönen sagen
das wissen die musiker
auch die maler mit ihren farben
wissen was sie sagen
was sie mit ihren farben sagen
das wissen die maler
ebenso die bildhauer mit ihren plastiken
wissen was sie sagen
was sie mit ihren plastiken sagen
das wissen die bildhauer
gleichfalls die tänzer mit ihren bewegungen
wissen was sie sagen
was sie mit ihren bewegungen sagen
das wissen die tänzer
schließlich die architekten mit ihren gebäuden
wissen was sie sagen
was sie mit ihren gebäuden sagen
das wissen die architekten
hingegen die poeten mit ihren wörtern
wissen diese was sie sagen
was sie mit ihren wörtern in wahrheit sagen
wissen das jemals die poeten
Jandl: Gewiß werden hier die Poeten den übrigen Künstlern gegenübergestellt, und das hat sicherlich mit dem Medium des Poeten – also Sprache – und den Medien aller übrigen Künstler zu tun. Von der Musik, von der Malerei, Bildhauerei, Tanz, Archtitektur ist kein Produkt der Notwendigkeit ausgeliefert, in eine andere Sprache übersetzt zu werden. Kein Produkt verweigert dem anderssprachigen den Zugang zu ihm. Das fragilste, das instabilste, das mehrdeutigste Medium künstlerischen Schaffens ist der Poesie, ist der Dichtung vorbehalten. Und die Aussage, das, was der Poet sagt mit seinen Wörtern, ist in keiner Weise mit der Stabilität der Aussage anderer Künste vergleichbar. Das Moment des Zweifelhaften, des Unaufgelösten, ist, glaube ich, in der Poesie in stärkerem Maße auffindbar als in der Kunst. Poesie spricht auch zu den Sinnen, aber nicht nur zu den Sinnen, während alle übrigen Künste eigentlich mit dem Sensorium eines Menschen erfaßbar sind.
Riha: Ein altes Thema: der Rangstreit der Künste, von Ernst Jandl aus einer ganz neuen Perspektive gesehen. Das Urteil schlägt um: Was im Negativen differiert, erhält ja dadurch ein besonders Gewicht und wird eine besondere Kunst gegenüber anderen Künsten. – Ein drittes Gedicht, das abermals in ein Zentrum poetischer, ästhetischer Fragestellungen zielt –
Jandl: – das Gedicht wirklich schön. Es ist Friederike Mayröcker gewidmet, und wer Texte von Friederike Mayröcker und von mir kennt und sie miteinander vergleicht, wird außerordentliche Unterschiede merken zwischen den Positionen dieser beiden Schreibenden und ihren Produkten. Man sagt Friederike Mayröcker – zum Teil sicher zu Unrecht – die schwere Verständlichkeit oder Unverständlichkeit nach, während man mir gerade das Gegenteil nachsagt und sogar zuweilen ankreidet:
WIRKLICH SCHÖN
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafür friederike mayröcker
einfachheit macht das komplizierte schön, who knows
kompliziertheit macht das einfache schön, who knows
einfach kompliziert sein ist vielleicht weniger schön
einfach einfach sein ist vielleicht auch nicht schön
vielleicht verlangt das komplizierte
nach einer einfachen darstellung, um schön zu sein
so wie vielleicht das einfache, um schön zu sein
nach einer komplizierten darstellung verlangt
jedenfalls haben manche das einfache lieber
als das komplizierte
und andere das komplizierte
lieber als das einfache
wenn dann das einfache das komplizierte ist
haben die die das einfache lieber haben das komplizierte lieber
und wenn das komplizierte das einfache ist
haben die die das komplizierte lieber haben das einfache lieber
so haben vielleicht alle alles gern, aber keinesfalls
sollte einer den anderen wegen seiner vorliebe schelten, sondern ihn gelten lassen
und sich selber auch, das allein
wäre dann erst wirklich schön.
Riha: Sie sprechen in diesem Gedicht von zwei unterschiedlichen Arten des Dichtens, Wollen wir die eine, die Sie mit dem Namen Friederike Mayröcker verbunden haben, für heute etwas auf der Seite lassen, und sprechen wir von Ihrer Poetik, soweit sie sich in diesem Text darstellt. – In verschiedenen poetologischen Statements, kleinen poetologischen Erklärungen, haben Sie gesagt, daß es Ihnen darauf ankommt, statt nach oben zu transportieren, nach unten zu projizieren. Sie sind sozusagen ein Poet von unten, der Bereiche des Elementaren neu eingeführt hat, wiedereingeführt hat in die Literatur, um der Literatur erneut lebendige Möglichkeiten zu eröffnen. Ich denke etwa an das Sprechgedicht, das anknüpft an die Artikulation der Stimme, an alles Lautliche, bevor daraus Worte und Silben werden. Ich denke aber auch an Ihre Orientierung an einer niederen Sprache, einer unteren, verhunzten Sprache, deren poetische Würde Sie aufgezeigt haben.
Jandl: Diese Position des Von-unten-Kommens hängt sicherlich auch – ich will nicht sagen: einzig und allein, aber sicherlich auch – mit der Erfahrung zusammen, daß gewisse Bereiche der Poesie für mich verschlossen sind. Und ich glaube, es gibt keinen echten Dichter, der diese Erfahrung nicht machen muß. Denn der Dünkel, der notwendig ist, um vor sich selber oder vor anderen zu behaupten, man verfüge über sämtliche Bereiche der Dichtung und wähle hier nun nach eigenem Gutdünken aus, ist für mich mit der Vorstellung eines wirklichen Dichters unvereinbar. Die Höhen, die Peter Huchel in seinen Gedichten erreicht hat, die Höhen, die Rilke und Hölderlin in ihren Gedichten erreicht haben, sind für mich nicht erreichbar. Ich glaube auch, daß die genannten Dichter eine unerhörte Anregung für einen heute Schreibenden oder heute zu schreiben Beginnenden sein können, daß aber gewisse Wege nicht weitergeführt werden können. Im Laufe der Jahre – bei meinen fortgesetzten Bemühungen um ein eigenes Gedicht – bin ich nicht zu einer Schreibweise gelangt, die meine einzige Schreibweise wäre und die nun, für jedermann unverkennbar, den Stempel Ernst Jandls trägt, sondern ich habe erst einmal versucht, auf verschiedenen Wegen zu meinem Gedicht zu kommen, habe aber andererseits den überhöhten Weg, also Dichtung, die über dem Boden und über den Bergen schwebt, kaum je beschritten. Wäre es mir passiert, hätte ich das Gedicht abgeändert oder auf eine andere Weise eliminiert.
Riha: Das Einfache, das Sie in dem Gedicht ansprechen, gewinnt bei Ihnen ganz unterschiedliche Bedeutung. Sie haben sowohl von den Gegenständen, den Themen der Gedichte wie von den Mitteln der Sprache her – und beides zusammengenommen – vorgeführt, daß sich das Einfache als eine dynamische Größe in die Literatur einführen und in ihr behaupten läßt und daß es seinen Wert hat gegenüber einer Höhenlage, die ständig von ihrer eigenen Bedeutsamkeit sowieso schon überzeugt ist. – Auch das ist ein Moment dessen, was in dem Titel idyllen steckt, sich in diesem Gedichtband im Positiven wie im Negativen auf Momente der Einfachheit einzulassen, die für viele Autoren gar nicht des Gedichts wert sind, bei denen Sie aber zeigen, daß hier gerade der Autor, der Dichter, legitim ansetzen darf und ansetzen muß, der aktuelle, der moderne Gedichte vorführen will, Gedichte, die nicht kalt lassen, wie Sie selbst ihren Anspruch formuliert haben.
Jandl: Ich glaube, daß man ähnliche Phänomene in der Malerei und in der Musik findet. Wenn ich in der Musik zurückgehe auf Eric Satie, den Zeitgenossen der Impressionisten in der Musik, und sehe, wie er mit ganz einfachen, mit radikal einfachen Mitteln arbeitet und hier eine eigenständige und von Leuten wie, ich glaube, Debussy, Ravel bewunderte Musik gemacht hat, oder das Phänomen des Jazz, wo man zwar klassische Elemente mit in die Musik hineinnahm, aber eine Musik machte, die für den einfachen Menschen, für den unkomplizierten Menschen in erster Linie geschaffen wurde, dann könnte man darin eine Parallele zu meinen Bemühungen erblicken. Es ist nicht so, daß muß ich auch sagen, daß ich meine Lyrik mißachten würde oder weniger achten würde gegenüber einem Paul Celan oder einer Ingeborg Bachmann.
Riha: Das zeigt, will man den dynamischen Anspruch von Dichtung aufrecht erhalten, daß man es nicht als Epigone von Autoren, die Sie genannt haben, tun kann, sondern daß man sich in seiner Position neu bestimmen muß.
Jandl: Ich kann das, was ich an Literatur mache und das, was ich für meine Literatur als Material verwende, eben als die einzige Literatur ansehen, für die ich zuständig bin, wo ich mir ein gewisses Spezialistentum erworben habe durch langjährige Übung, und von dem ich durchaus hoffe, daß es Verbreitung findet oder Anregung bietet auch für das Schreiben anderer, die nicht über den Wolken schweben wollen oder können, sondern die mit beiden Füßen unseren Erdboden nicht verlassen.
Riha: Wir sprechen über den Gedichtband idyllen. Sie selbst haben gesagt, dieser Band hätte sehr gut den Abschluß der Gesammelten Werke bilden können, wäre er rechtzeitig vorgelegt worden. Nun möchte ich mit einer Frage doch auf die früheren Publikationen zurücklenken und vor allem zurückverweisen auf den ersten Gedichtband, mit dem Sie als experimenteller Autor, als Autor der Neuerungen, aufgetreten sind: Laut und Luise. Diesem Band ist ein kleines Nachwort von Helmut Heissenbüttel angefügt, und damals sprach – verblüffend für alle Leser – Helmut Heissenbüttel in diesem Nachwort nicht von den Innovationen, den Neuerungen, die dieser Band bringt, sondern davon, daß es sich hier um Gedichte wie eh und je handelt, wenn es je Gedichte wie eh und je gegeben hat. Er verweist darauf, daß es Gedichte sind, die in einem ganz bestimmten Sinn auf Tradition bezogen sind, und er sagt, es handele sich um Lieder, politische Gedichte, Liebesgedichte, autobiografische Gedichte, didaktische Gedichte. Das war damals sehr provokativ. Ihre Entwicklung als Lyriker hat jedoch diese Provokation eingeholt, und Ihre nachfolgenden Publikationen haben gezeigt, wie sehr Helmut Heissenbüttel damals schon ein Moment an Ihnen bemerkt hat, das vielleicht für viele damals noch ganz verdeckt war. Darf ich es so zu kennzeichnen versuchen, daß das, was man bei Ihnen als Experiment oder Innovation bezeichnet, die Funktion hat, Lyrik wie sie immer war, Literatur, wie sie immer war, aktuell noch einmal möglich zu machen, wenn sie nicht unter das Verdikt des Epigonalen, des Wiederholten, des Breitgetretenen geraten will, und daß eben diese Innovationen im Dienste der Möglichkeit stehen, alle Themen der Literatur noch einmal erneut, ganz neu ansprechen zu können, wenn es nur mit neuen Mitteln geschieht, mit einem neuen literarischen Drive. Sie selbst sprechen dieses Thema in dem Band idyllen unter dem Titel göttliche komödie an:
GÖTTLICHE KOMÖDIE
beginnen Sie mit dem titel?
fast nie, diesmal aber schon.
es ist ein schwerer titel
oder vielleicht
erst schwer und dann leicht
er reicht um die ganze europäische literatur
wie ein ring für jeden liebsten
an den fingern einer jungen frau
Man kann dieses Gedicht in ganz unterschiedlicher Weise lesen. Auf Dante hin: göttliche komödie. Auf den Titel des eigenen Gedichtbandes hin: idyllen. Man kann es aber auch als ein poetologisches Gedicht auf das Verhältnis von alten und neuen Titeln und vor dem großen Hintergrund der ganzen Literaturgeschichte lesen, die ja bei jedem Text neu geschrieben wird, immer mit vorhanden ist und eben das eine Mal epigonal vermittelt wird, das andere Mal innovativ, über Experimente. Ist das das Thema dieses Textes?
Jandl: Ja, ich würde dieser Interpretation, wenn man das so nennen darf, durchaus zustimmen.
Riha: In der Verallgemeinerung könnte man sagen, daß Sie kein Gegner der Tradition sind in dem Sinn, daß Sie der Tradition generell absagen, sondern daß Sie zeigen, wie man mit neuen Mitteln der Poesie – Sprechgedicht, heruntergekommene Sprache, Minimal art, serielle Reihe, Konstellation – Momente der Tradition noch einmal aufnehmen und ihnen aktuell eine neue Gestalt geben kann.
Jandl: Wenn ich Gedichte schreibe, so ist das, was ich aus verschiedensten Zeiten an Gedichten kenne, nicht ausgelöscht oder zugedeckt, so daß es unsichtbar ist, sondern es bleibt vorhanden, es wirkt mit. Und wenn es in einer Weise mitwirkt, daß dabei etwas – sagen wir – Verblüffendes entsteht, etwas Unerwartetes, etwas Neues, dann bin ich sehr gern bereit, das als eine neue Möglichkeit anzuerkennen, während, wenn es mir passiert, daß ich in die Fußstapfen eines anderen plötzlich hineinfalle, es fraglich ist, ob dieses Gedicht repariert werden kann oder ob es in den Papierkorb zu wandern hat. Die Tradition ist unbedingt vorhanden, sonst würde ich auch nicht darauf kommen, wieder mal ein Sonett zu schreiben oder zu reimen oder ein vorgegebenes Metrum zu verwenden und müßte mich dann, wie es ja verschiedene mit mehr oder minder großem Erfolg getan haben, von allem, was bisher an Dichtung da war, so weit entfernen, daß durch meine Gedichte hindurch kein Blick auf diese lange und glorreiche Tradition des Gedichteschreibens mehr möglich ist. Da wäre dann nur noch das Gebilde, und dahinter steht nur die Betonwand. Und das will ich keineswegs.
Riha: In dem Sinn stellt für mich Ihr Œuvre so etwas wie eine Stromschnelle dar, die notwendig ist, damit das Wasser am Fließen bleibt. Denn wo die Stromschnellen fehlen, dort kommt es zu Brackwasser und wird sumpfig. Sie haben gezeigt, daß sich die Möglichkeiten des Gedichteschreibens im Fluß halten lassen und daß man nur aus fließendem Wasser Energie schöpfen kann… – Lassen Sie mich zum Abschluß auf das große inhaltliche Thema Ihres Bandes idyllen zu sprechen kommen. Es gibt sehr viele Gedichte in diesem Band, die mit dem Thema Altern zu tun haben, und ich möchte gern mit Ihnen aufzeigen, in welche ganz unterschiedlichen Richtungen sich dieses Thema öffnen läßt. Ich habe mir verschiedene Notizen dazu gemacht. Meine erste Notiz geht in die Richtung, daß Altern etwas mit der Erinnerung zu tun hat, speziell auch mit der Erinnerung an Menschen, die nicht so alt geworden sind wie Sie. Durch den Krieg etwa; Sie erinnern Ihren Vetter Herbert Humula, der in jungen Jahren gefallen ist.
Jandl: Ja. Es ist vielleicht das uns am seltsamsten Anmutende an dieser Erinnerung, daß Abiturienten, so wie es hier gezeigt wird, noch sozusagen ganz gesund gemacht wurden, ehe sie dann in den Krieg geschickt wurden. Und zwar ist das von der Familie ausgegangen. Hier trifft sich das absurde Denken des Gesundmachens, des Widerherstellens, des Tauglichseins – kriegstauglich hieß es, kv, kriegsverwendungsfähig, tauglich – mit dem Töten.
DIE GARBE
aaaaaaaaaaherbert humula gedenkend
wie kam mein vetter herbert denn
der die waldstein-sonate so schön
zu seinem nabelbruch und nicht ich
doch wurden beide repariert
im jahre 43
gleich nach dem abitur
bei mir die mandeln mußten raus
die jeden winter eiterten
wie gut darauf die weiteren
nur daß die chance ich nicht bekam
zum sprung in jene garbe
die unseren herbert zersiebte
Riha: Sie setzen sich als Autor, als Erinnernder, in Relation zum Erinnerten, und das ist eine sehr schneidende Perspektive, die sich da plötzlich auftut zwischen Ihnen und Ihrem Erinnerungsgegenstand. Das dann aber auch in literarischer Hinsicht. Unmittelbar parallel zu „die garbe“ steht für mich das Gedicht „august stramm“, in dem Sie einen Dichter erinnern, dessen Kontur Ihnen nun gerade aus dem Kontrast deutlich wird, wobei aus dem Erinnerten auch ein ironisches Schlaglicht auf Sie selber fällt, der Sie – unverdientermaßen, denn wer ist Herr seines Schicksals – sehr viel älter werden konnten als dieser für Sie beispielhafte Autor, der Ihnen den Zugang zur radikalen Moderne nach der Jahrhundertwende geöffnet hat:
AUGUST STRAMM
er august stramm
sehr verkürzt hat
das deutsche gedicht
ihn august stramm
verkürzt hat
der erste weltkrieg
wir haben da
etwas länger gehabt
um geschwätzig zu sein
Das ist die eine Seite des Themas Altern: Erinnerungen, wobei Personen und Ereignisse vorgeführt werden, die in beiden Fällen, in beiden zitierten Gedichten mit dem Krieg als Lebensverkürzer zu tun haben. Sie sind Ihr ganzes literarisches Werk hindurch ein Gegner des Krieges, ein Pazifist gewesen. – Eine andere Richtung des Themas markieren sehr drastische Gedichte über die eigene Erfahrung des Alterns als physischer Verfallsprozeß, bezogen auf Krankheit, Umstände, die den Körper schwächen. Eines dieser Gedichte signalisiert schon im Titel diese stark negative Erfahrung des Alterns:
DIE SCHEISSMASCHINE
großteils die scheißmaschine steckt in dir
du wunder mensch, verwundetes mirakel
du nicht ihr ingenieur, nicht ihr erfinder
doch ihr besitzer, nutznießer und pfleger
vom munde führt der lange weg nach innen
durch röhre, ranzen und durch windungen
die du nicht gerne läßt ans freie zerren
außer um krebs den weitergang zu sperren
für nas und zunge köstlich different
treten in dich, o mensch, die speisen ein
dein organismus sich mit leben füllt
und ebnet ein, was aus dem arschloch quillt
von hier an hast die scheißmaschine du
geliebt-gelobter mensch in deine hand genommen
muscheln gebaut, um stöhnend drauf zu sitzen
kanäle angelegt, darin die ratten flitzen
Ich assoziiere – auch von der Drastik des Details her – das barocke Memento mori. Geht das für Sie zu weit zurück?
Jandl: Das geht für mich nicht zu weit zurück. Es ist kein Zufall, daß gerade dieses Gedicht einem ziemlich regelmäßigen Metrum folgt und sich gewisser – wenn man will – Versatzstücke einer echt poetischen Ästhetik bedient, wie zum Beispiel die Anrede: „du wunder mensch, verwundetes mirakel“. Dann noch die Zeile: „geliebt-gelobter mensch“.
Riha: Aber das bestimmt die Höhe, aus der das Gedicht dann abfällt. Im Vordergrund steht ja doch, wie es der Titel sagt, die negative Erfahrung des Verkotens, der Schwäche des menschlichen Körpers, seine Hinfälligkeit. Würden Sie sagen, daß es sich hier um nihilistische und pessimistische Erfahrungen handelt, gerade auch in der Drastik ihrer Darstellung?
Jandl: Es sind sicherlich in dieses Gedicht Erfahrungen eingebaut, die negative Seiten des menschlichen Lebens ansprechen, wie zum Beispiel daß der Mensch seine Eingeweide nicht gern ans Freie zerren läßt, „außer, um Krebs den Weitergang zu sperren“, außer im Falle einer Krebsoperation, was heute als unerläßlich angesehen wird. Ansonsten scheint mir das Gedicht mit einer schon kräftigen oder drastischen Sprache einfache normale Vorgänge zu beschreiben. Diese „scheißmaschine“ ist Teil des Menschen, nämlich sein ganzer Verdauungsapparat, und wird erst, sobald dieser Verdauungsapparat seine Aufgabe erfüllt hat, weitergeführt durch Maschinen, wenn man so will, die der Mensch gebaut hat. Dazu gehört also bei uns das Wasserklosett und das ganze Kanalsystem, das nun außerhalb des Menschen die Reste seiner Verdauung einer Endlagerung entgegenbringt.
Riha: Das scheint ein anderer Fluchtpunkt dieser Altersgedichte zu sein, der Mensch als Fäkalmaschine. – Es gibt aber auch Texte, die das Altersthema mit Ironie, sogar mit einer gewissen Neugier behandeln. Für mich ist etwa „sentimental journey“ ein solches Gedicht. Das Alter erscheint hier als offenes Ende, und mit einem solchen offenen Ende verbinden wir in der Regel die Vorstellung der Neugier, also dessen, was noch kommen kann.
Jandl: Es hängt freilich bei diesem Gedicht „sentimental journey“ sehr viel vom Ausdruck ab, mit dem dieses Sprech-Gedicht gesprochen wird.
Riha: Es ist also im Sprechakt selber interpretierbar?
Jandl: Ja. Ins Negative wie ins Neugierig-Positive.
Riha: Der Band enthält auch ein Gedicht dezidiert mit dem Titel die „freude an mir“, und der Sinn dieses Gedichtes, ganz kurz zusammengefaßt, wäre der: Allen anderen mag die Freude an mir vergehen, mir selber muß sie bleiben. Wie immer eingedüstert, wie immer eingeengt, wie immer unterminiert – trotz aller negativen Erfahrungen des Alters behauptet sich hier doch ein bestimmtes Moment von Existenz-Lust! – Das Gedicht, das am stärksten und intensivsten und vielleicht mit allen Aspekten der Alterserfahrung sich beschäftigt, ist überschrieben „alternder dichter“, und mit diesem Text, meine ich, können wir unseren Blick auf den Gedichtband idyllen schließen, den wir hier etwas ausfalten wollten:
ALTERNDER DICHTER
nicht immer werden sie mir
alles geschriebene aus den händen reißen
um es zu drucken
sondern sie werden über mich hinwegsehen
über meinen kopf weg nach anderen spähen
und ich werde sie verstehen
ach wie klein ich geworden bin
werde ich mir sagen
keinem verstellt meine stirn mehr den blick
ich bin sehr in mich zusammengesunken
mir ist so bang
Wir hatten einleitend dieses Gespräch mit dem Rückverweis auf das Öffnen und Schließen des Mundes begonnen, das notwendig ist, um eine Vorlesung zu halten, um Sprechgedichte zu sprechen, das auch notwendig ist, um ein Gespräch anzufangen, wie wir es hier zu führen versucht haben. – Wir würden jetzt an das Öffnen des Mundes das Schließen des Mundes anschließen, indem wir ein Ende dieses Gesprächs machen. Eine letzte Frage, Ernst Jandl: Der Anlaß, uns zu unterhalten, war der Peter-Huchel-Preis für Ihren Gedichtband idyllen. Können Sie sich vorstellen, daß es irgendwann irgendwo einen Ernst-Jandl-Preis für junge Autoren geben wird, und daß man dann andernorts und zu anderer Zeit ähnliche Gespräche führen wird, sich im Zusammenhang eines solchen Verfahrens, eines solchen Preises Ernst Jandls erinnernd – oder ist Ihnen eine solche Vorstellung ganz unangenehm?
Jandl: Die Vorstellung ist mir nicht unangenehm. Die Vorstellung des Todes ist gewiß keine angenehme Vorstellung, aber daß es einen Ernst-Jandl-Preis geben könnte, hat nichts Unangenehmes für mich. Zuerst würde ich mir allerdings einen Friederike-Mayröcker-Preis wünschen.
aus Bernhard Rübenach (Hrsg.): Peter-Huchel-Preis 1990. Ernst Jandl, Jayne-Ann Igel; Texte, Dokumente, Materialien, Elster Verlag, 1991
Von Sprachdonner und lockend lauerndem Alter
idyllen heißt der neue Gedichtband von Ernst Jandl. Mit welchen Tricks die Jandl-Stimme die Jandl-Welt idyllisch macht, versuchen Jürg Laederach und Urs Allemann in einem schriftlichen Gespräch herauszufinden.
Jürg Laederach: Auf mich wirken die Gedichte, wenn ich mich nach den mich am meisten beeindruckenden Elementen der rund zweihundert Hervorbringungen befrage, nicht wie die Geschichte eines ungern erlittenen Altersprozesses, sondern wie das aggressive Programm eines entschlossenen Grauen Panthers, des Vertreters einer Hoch-Altersgruppe mithin, der mit seinen Mitteln und seiner Situation gesamthaft und ungeschminkt zum Angriff übergeht. Eine der Wirkungen dieser idyllen ist es, eine denkbare bedauernde Anteilnahme im vornherein zu ersticken und jeden, der zufällig jünger ist, in die Defensive zu treiben: Was, wenn überhaupt, hast du den Reizen des Alters entgegenzusetzen? Und: Warum überspringst du nicht deine nächsten zwanzig Lebensjahre und fängst gleich mit fünfundsechzig und der dazugehörigen Energie neu an?
Urs Allemann: Graue Panther, einverstanden. Ein aggressiv passiver Panther ist das. Ein siecher, mit bös diagnostisch spielerischem Bißblick. Ihm ist nicht wie dem Rilke-Panther, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Mit untraurigem Altersscharfblick sieht er: Diese tausend Stäbe sind die Welt. Das, was von ihr übrigbleibt, wenn der graue Pantherblick den Rest – Illusionsornamentik des Individuellen, Besonderen – weggeätzt hat. Tausend Stäbe (oder bloß sechsundzwanzig?): Das ist die graue Elementarausstattung des Weltbau/Erfahrungsbaukastens. Dieser Graue Panther sieht nur noch: Wie es ist. Und baut es im Gedicht nach:
es hat mich umgeschmissen
mein leben ist zerrissen
ich will von nichts mehr wissen
da meldet sich das pissen
und zerrt mich aus den kissen
Gott, der Oberbastler, der den Spielbaukasten entworfen hat – unter anderem ist er der Ingenieur und Erfinder der scheißmaschine, deren „besitzer, nutznießer und pfleger“ das „wunder mensch“ ist –, arbeitet mit ziemlich simplen Serien von Tricks, die ihm abzugucken der graue Lyrikpanther keine Mühe hat. „ganz ernst sieht gott zu“ heißt die letzte Zeile des Gedichtbands. Damit ist nicht gemeint, daß Gott irgend jemandem bei irgendwas zusieht, und das gar ernst. Das allumfassende Desinteresse des Witzboldes Gott ist bekannt. Sondern „ganz ernst“, das ist: „der ganze Ernst Jandl“ – der sprachlich sich selbst hier zu Recht nicht als Person, sondern in Analogie zu „ganz Europa“ als Erdteil faßt – sieht umgekehrt Gott beim Idyllen-Stanzen zu. Ergebnis: „graues gedicht“, die von „ganz ernst“ verfaßte Internationale der Grauen Panther:
grau
grau wie grau
alles ein bißchen grau
nur grau
alles nur grau
nicht nur sondern grau
grau in grau in grau in grau
und gar nicht traurig
Laederach: Der Schmerzensmann sucht sich Situationen aus, in welchen er sich des publikalen Beifalles sicher sein kann.
der zahnarzt bohrt und bohrt und bohrt
immer in ein und demselben zahn
bis er ihn endlich ziehen kann
dann kommt der nächste dran
Das fällt in die Kategorie des Ärztewirtes, die auch sonst nicht ganz schweigt. Die Altersbeklagnisse sind sorgsam vorbereitet, abgewogen, gezielt. Alles Eigenschaften, die in einer Notlage nicht mehr hergestellt werden könnten. Die Lektüre kann nur eine indirekte sein: Man staunt, daß derjenige, der sich durch seine Form als nicht-alt zu erkennen gibt, von dem Zustand, den er nicht hat, so ergriffen ist. Anders ließe sich auch lesen, daß gerade die Behandlung des Zustandes, der eher durch seine Unumkehrbarkeit (das nichtaufhaltbare Zeitvergehen, gekoppelt mit dem Älterwerden, der Verkürzung der Lebensfrist, die etwas Banales an sich hat) als durch seine Schrecken wirkt, den Autor zu seinen größten Lust-Exzessen hinreißt. Jene, welchen das Alter in Prosa und Versen so gelingt, was schrieben sie denn, als sie jung waren? Auf Seite 105 schreckt uns dann die Zahnprothese. Ich kenne jede Menge junger Leute, die haben drei Prothesen im Mund. Aber sie sind nicht alt, also dürfen sie darüber nicht mit Erfolg schreiben. Ich kenne einen Vierzehnjährigen, der hat zwei Kunstbeine, und zwei weitere, die man Krücken nennt. Er schreibt davon kein Wort. Wohl, weil kein Leser im Ernst annähme, er würde bald auch mit zwei Kunstbeinen umherlaufen. Merken wir uns: Es gibt Zustände, die bleiben, so entsetzlich sie sein mögen, individuell, niemals wird es dem Betroffenen gelingen, andere so richtig hineinzuziehen. Das Alter und seine Fährnisse haben die angenehme Eigenschaft, daß sie wie ein Fangnetz auf jeden warten. Lies heute Jandl, sei morgen so wie er. Aus dieser banalen Lauerstellung des Alters, das hinter den sieben Bergen auf jeden wartet, schöpfen die Gedichte ihr Kapital des Schreckens. Der erfolgreiche Leser des Bandes idyllen begeht ein Jahr früher, mit vierundsechzig, Selbstmord. Was besser als sonst etwas zeigt, daß die Ästhetik dieses Bandes nur auf Fristen beruht.
Allemann: Das ist eine interessante Beobachtung: daß der Dichter Jandl, einerseits vom Zustand Alter ganz ergriffen, andererseits in seinen Gedichten als nicht-alt sich zu erkennen gibt. Allerdings scheint mir: Das Erkennungsmerkmal des Nicht-Alten ist weniger das poetische Kalkül, die lyrische Ökonomie, mit der die Altersbeklagnisse vorgetragen werden. Notlage und Materialbeherrschung schließen sich, behaupte ich mal, nicht aus. Es ist was anderes, das als nicht-alt frappiert: die paradoxe Vitalität der Jandlschen Stimme. Im „kleinen geriatrischen manifest“ kommentiert Jandl sarkastisch die Ungleichzeitigkeit von geistigem und physischem Verfall: Das hohe Tempo des letzteren läßt den ersteren als fast gemütlich erscheinen. Weder schnell noch langsam, sondern: gar nicht verfällt die Stimme, die vom Verfall spricht. „in uns kracht / ohrenbetäubend tag und nacht / donner der sprache, heult und lacht“, heißt es im „ersten sonett“. Dieses Sprachdonnern, Sprachheulen und Sprachlachen, das der Jandlschen Stimme als ihres Sprachdonner-, Sprachheul- und Sprachlachrohrs sich bedient, ist von einer keinem Prozeß des Alterns unterworfenen physischen und geistigen (vor allem aber: physischen) Wucht. Vorstellbar beim Lesen dieser Gedichte: daß Ernst Jandl auf der Bühne steht; daß aus der weichen Fleischmasse Mund, die Ernst Jandl immerzu spaltet und zusammenpreßt, Gedichte von Ernst Jandl donnern; daß der Körper von Ernst Jandl im Theaterzeitraffer altert, verfällt, fault, zu Erde wird; daß aus der weichen Erdmasse Mund, die in dem Erdhaufen, der früher Ernst Jandl hieß, immerzu sich spaltet und zusammenpreßt, Gedichte von Ernst Jandl donnern. Das Stück ist nicht von Beckett, sonst würde die Stimme flüstern und murmeln; sie donnert aber. Donnert an gegen den Skandal, den das Anti-Friedhofbesuchsgedicht „duft“ aufdeckt:
(…) nicht einmal die erde
verbreitet gestank, obwohl sie die pflicht dazu hätte
wo in ihr doch die Verwesung tobt
was noch dazu lautlos geschieht
anstatt unter brucknergetöse (…)
These: Das Programm der Jandlschen idyllen ist es, den Gestank, den lebende, alternde, sterbende, tote Körper sang- und klanglos verbreiten, in einem präzisen stimmlichen Äquivalent, dem jandlgetöse, aufzuheben.
Laederach: Es muß gegen-ideologisch hinzugefügt werden, daß der alternde Körper Glaubenssache ist. Ich akzeptiere je länger, je weniger (je älter, je weniger) die Dichotomie zwischen Geist/Stimme und Körper/Physisreichweite. Was Jandl kann, ist, eine Rhetorik des Extrems aus jeder gegebenen Situation heraus zu entwickeln. Wäre er nicht alt, er müßte es aus rhetorischen Gründen sein: weil sonst die Dringlichkeit entfiele. Meine Ansicht, zum Extrem getrieben, sagt: Ernst Jandl belügt uns, was sein Alter betrifft, er sitzt in Wien als Zweiunddreißigjähriger und schlüpft, ehe er ausgeht, jedes Mal in ein Altmännerkostüm, das ihm Karl-Ernst Hermann schneidert (manchmal nimmt er es auch aus dem Fundus). Da lobe ich mir die simplen Erinnerungen, die wenigstens nicht alt, nur einfach in die Zeilen-Hackmaschine geraten sind:
(…) wie kam mein vetter herbert denn
der die waldstein-sonate so schön
zu seinem nabelbruch und nicht ich (…)
Dies ist nicht die schlechteste, will sagen, nicht die unplausibelste Bewußtseins-Sprache, die die neuronalen Spannungen des memorierenden Gedächtnisses kompetent nachbildet. Dem Unbewußten entnommen, klammern sich die Erinnerungen, sämtliche unangenehmer, also ungern-erinnerter Natur, an labernde Sprachformeln, die sie in ihrer Aufregung abkürzen. Er, „der die waldstein-sonate so schön“ ist kein Pianist, sondern ein erinnerter Pianist, der schon sehr lange her ist. Die Jandlsche Technik des oft fast gewaltsamen Verkürzens ist somit eine starke Abbildung von Erinnerungsvorgängen. Damit diese eindrucksvoll werden, müssen sie zeigen, daß sie riesige Hindernisse zu überwinden haben: erstens darf nicht gern erinnert werden, also muß das Erinnerte schmerzhaft, widerwärtig sein. Zweitens darf nicht über eine kurze Zeit erinnert werden, sondern alles muß aus längstentfernten Zeiten heraufgeholt werden. Damit wird die atemlose, oder kurzatmige, oder absichtlich kurzkadenziert schnaufende Anstrengung der Souvenir-Gedichte deutlich. Und zum Zweck, damit alles schön längstvergangen sei, muß das erinnernde Subjekt natürlich – du errätst es – sehr alt sein. Nur so hat Erinnerung ihren temporal entgegengesetzten Pol. Wir kriegen keine Pause in der Niedergeschlagenheit: auch wenn Jandl aus Rohrmoos und den späten achtziger Jahren dort berichtet, ist alles schon mehrere Jahrzehnte her. Zeitlich spatialisiert er, wo er kann. Ich füge an: In den Gedichten mit Zeitlichkeit ist diese ins Extrem getrieben. Daneben stehen absolut unmittelbare Instant-Gedichte, ohne jede Zeit-, Entwicklungs-, Ablauf-Perspektive. Was meine vorangegangene Bemerkung (letzter Brief) sagen wollte: Zu diesen Sub-Gattungen tritt auch die Lust-Gattung, und da scheint es mir denn doch erstaunlich, welche Bombenstimmung er ableitet aus so etwas wie
(…) du schwein dem seine pisse tropft
vom hosenbein und merkt es nicht
und sitzt im dünnschiß auf der beiselbank
wegrücken alle, ich nur, im gestank, bleib neben ihm (…)
Hier wird, unter beträchtlichem (frühkindlichem) Lustgewinn, die Welt in strenger Form beschrieben, und die Strenge selber wird fäkalisiert, voluptuös mit Alterskacke eingerieben. Der alte Goethe tat das nicht. Es ließe tief blicken, sagten wir nun: Den besprechen wir auch weniger gern.
Allemann: Aber von wemoderwas, bitte, werden denn – textintern – die strenge Form ( einverstanden) und – textextern – unsere Leser/Hörer-Ohren mit Alterskacke, Altersbrunz und entschieden mehr als drei tröpfchen Alterssamen eingerieben? Weroderwas fährt den früh- und spätkindlichen, prä- und postgenitalen Lustgewinn ein? Doch wiederum die Jandl-Stimme, in deren Verhältnis zur Wollust im besonderen sich das zu Alter und Verfall im allgemeinen spiegelt: So, wie sie unalt übers Alter spricht, so spricht sie strotzend vor Potenz über Inkontinenz und Impotenz. Drastisch gesagt: Die Klage übers beschädigte Schwundgenital („der jäger greift sich an den schwanz / ist das verfluchte rohr noch ganz? // was ich in meiner hose berge / gebührte eher einem zwerge“) schießt aus gänzlich intaktem erigiertem Riesensprachrohr. Dieses in verharmlosender Absicht zum geistigen zu immaterialisieren, wäre in der Tat ideologisch. Tu ich drum auch nicht. Sage vielmehr: Gerade die Stimme ist ja der Statthalter des Körperlichen im geistigen Bezirk, mit ihr ist dem immateriell-zeichenhaften Text ein irreduzibel Materielles eingeschrieben, und wenn einer kundtut, er sei nicht länger bereit, Geist-Physis-Dichotomien zu akzeptieren, dann verrät er damit einfach, daß er als seine Operationsbasis just diesen literaturstrategisch stimmigsten, die Gegensätze in der Consonantia oppositorum zusammenstimmen lassenden Stimm-Standpunkt seinerseits bezogen hat. – Bleibt zu erörtern, welche Energiequellen eigentlich angezapft werden, um den Schwellkörpern (hörtest du je von Schwellgeist?) des stupenden Jandlschen Sprachrohrs zur (voluptuös, das Wort zu benutzen) voluptuösen lyrischen Schwellung zu verhelfen. Keine kleine Rolle scheint dabei eine Variation der Identifizierung mit dem Aggressor, mit Vergewaltiger und Vergewaltigerin, zu spielen. Die Jandl-Stimme, die ruckweise herausflucht, wie die mit „schlaffem ding“ bestückte männliche Hälfte des „älternden paars“ von der weiblichen Hälfte aufs „schwarzgeschissene doppelbett“ geschmissen wird, bezieht ihre Fluch-Kraft (transponierte Fick-Kraft) von der (gefickt werden wollenden) Schmeißenden, nicht vom (fickunfähigen) Geschmissenen, dessen Stimme sie, den Regieanweisungen der Anführungszeichen zum Trotz, gleichwohl bleibt. Ähnlich im grauenvollen Schlaflied, wo die Jandl-Stimme zusammen mit der frühkindlichen Einnäßlust („ich sein zu faul sogar aufs klo zu gehn, ich schwein / so könnt ihr mich beschissen und verbrunzt / daliegen sehn. schlaf, kindelein“) den frühkindlichen Schreckensvater reaktiviert und, unverkennbar, dessen Straf- und Vernichtungsallmacht zum eigenen Kraftreservoir energetisch umfunktioniert:
(…) der vater mit dem hammer geht herum
dann haut er drauf – das war der kopf vom buben
schlaf, kindelein (…)
Nicht unterschlagen werden darf allerdings, daß die Gewalt, die die artikulierende Stimme vom Vergewaltiger borgt, im artikulierten Text (dem sie selbst angehört, die Stimme ist beides, artikulierend und artikuliert) sich in der Vielfalt, Allfalt einander jagenden Identifizierungen wiederum bricht:
(…) ich sein hund in hasen
ich sein hasen in hund
das sein ein jagen
ich sein jägersmann in hund
ich sein jägersmann in hasen
ich sein ein flinten
ich sein schrotpatron in flinten
Immerhin auch hier: vier Teile Täterformation – ein hasen.
Laederach: Die Groteske wäre damit bis ins Sprachgeröll hinein beschrieben: der Körperlichste aller Körperlichen ist – siehe da! – plötzlich nur noch Stimme. Das wirkt auf mich, als würde gesagt: er spricht schlimm, aber er spricht’s im Gedicht, er ist ja kein Mensch, sondern ein Vers. So entkörperlichen kann ich die Sache nicht. Was mich beeindruckt, ist nicht Stimme zu nennen, sondern Spracharbeit. In der Tat gerät man, Jandls Gedichte lesend, in genau dieselbe Welt, in der man schon steckt, und doch ist sie hinterrücks unter der Vorgabe, sie werde niemals verändert, eine verzaubert andere. Ich gebe bei allen Injurien gegen den Autor, gern zu, daß ein magical spell gewoben wird, und angesichts dieser Magie dockt jeder, der an einem Inhalt festmacht, am falschen Quai an. Jürgen Manthey beschrieb neulich – aus dem Gedächtnis rekonstruiert – den Dichter als Illusionskünstler, der jedem nur genau das gebe, was jeder ohnehin schon habe; der jedem als neu verkaufe, was bei jedem schon längst zu Hause stehe. Unter diesen Wiederverkäufern des schon Verkauften ist Jandl der brillanteste, da er zur Anpreisung seiner Welt – und jeder Autor beschreibt seine Welt, indem er ihr einen Lockstoff hinzufügt – mit Bedacht nur das Abstoßende wählt. Das Oxymoron, der allerschärfste Gegensatz zwischen Ursache und Wirkung, operiert auch auf dem Feld der Erlösung. Indem Jandl erbarmungslos die Hoffnung kassiert, läßt er etwas wie schöne Aussichten entstehen. Die Gefängnisbeschreibung als der große Freiheitsgestus, gewissermaßen. Das Leben, so Karl Kraus, ist eine Anstrengung, die einer besseren Sache würdig wäre. Die Jandlsche Leistung wird von einer Stimmlage, aber sicher auch von einer Ideologie erbracht. Ich weiß, warum die Stimmlage, weiß nicht, warum die Ideologie so plausibel ist.
Allemann: Und ich weiß nicht, ob’s Ideologie ist, ob der Begriff hier greift. Wie auch immer: Den Lockstoff, durch dessen Beigabe das Abstoßende zur Attraktion, zum mit oxymoröser Promesse de bonheur Anziehenden wird, finde ich im Jandlschen Text an zwei extrem entgegengesetzten Polen wirksam. Verheißen wird einmal, aus der Perspektive dessen, der ihrer im Augenblick ihrer Zerstörung inne wird: radikale Körperlichkeit. Einer der „sprüche“ artikuliert das als programmatischen Erfahrungsblitz: „wer hinkt / der geht“ (tritt zweitens ab, ist erstens des Gehens mächtig). Wir dürfen interpretierend variieren: Wer stirbt, der lebt. Wer stinkt, der ist sehr da. Wer fällt, der ist noch nicht gefallen. Wer „the head is not loved – chop it off“ brüllt, der trägt einen triumphal unabgehackten Schädel auf seinen Schultern. Das Fleisch fängt an zu faulen. Da geht ihm auf: es ist gar nicht dieser ehemalige Gymnasiallehrer; es ist gar nicht dieser von Schuldängsten geplagte Katholik; es ist gar nicht dieser Onkel der Wiener Gruppe; es ist gar nicht dieses Hirngespinst, diese Fiktion eines österreichischen (oder Basler) Autors. Sondern ein Fleisch, wenn auch in Fäulnis begriffen. Mehr Glück ist nicht zu verheißen. Es sei denn, wir wollten – was aber womöglich wirklich ideologisch wäre – auch jene Verschweißung von Kotze und Körper zum überlebensgroßen Fleischdenkmal unter Glückskategorien begreifen, die Jandl in dem grandiosesten Gedicht des Bandes, „der langsam gehende“ (nämlich wiederum: 2. beim Abtreten, schon auf dem Abtritt; 1. beim Schreiten beobachtete) mensch, gelingt:
so als ob die kotze den mund gefunden nicht hätte, statt dessen
eingesickert wäre in das kinn und die wangen
und in die zunge, die immer ein stück heraussteht
(Heraussteht nämlich, ich bestehe darauf, als durch die eingesickerte Kotze in vivo petrifizierter Stimmpimmel.) Dies ist Promesse, wenn nicht von bonheur, so von überwältigender réalite: durch enorme Fleischwerdung des Widerlichsten. Gegenpolig dazu lockt Jandl auch mit einer Promesse d’irréalite. Sie verheißt, gegen den schwergewichtigen Körper-Ernst, daß dieser bloß Schein und in Wirklichkeit alles körperloses, schwereloses, jederzeit reversibles Spiel (mit Sprache) sei:
die zeile will die zeile sein
hier muß nicht erst noch sinn hinein (…)
Das Fleisch fängt an zu faulen. Da geht ihm auf: es ist ja gar kein Fleisch, sondern ein Vers. Mehr (als dies von dir als Entkörperlichung Beanstandete) ist an Glück nicht zu haben. Wir müssen uns, mit diesem Dispens lockt Jandl uns in die Idylle, auf diese Verse kein Fleisch machen:
schade um dieses gedicht
o gott wie schade großer
gott wie schade wie schade
verdammte scheiße schade o schade o
… so schade vielleicht auch wieder nicht
Laederach: Das Elende und seine Schilderung sei das Großartige und dessen Darstellung. So will es die Dialektik, die kein Positives mehr erzeugt ohne seinen Abschaum. Sie ist eine bürgerliche Tugend, doch meine ich: Die Fristenlösung namens Leben wird in Jandls idyllen abgetrieben; was sie an Materie mit sich führt, kann man ruhig vergessen, der Autor nimmt uns die Arbeit ab und wirft es gleich selbst weg. Eine Dialektik, die daraus noch positiven Seim söge, müßte die Beschaffenheit eines Korkenziehers aufweisen: warum nicht? So, in permanenter Subtraktion befangen, den Stapel des Weggeworfenen anwachsen sehend, bleibt bei der buchhaltenden Zählung, was denn noch bleibe, prinzipiell nur das Immaterielle übrig: die Stimme. Waren Jandls konkrete Gedichte früher aus neutralem Konstruktionsstoff, aus concrete, also Beton, so verweisen sie heute auf die heiser staccatierende Stimme dessen, der sie vorliest. Ich schlage eine weniger erlösende Perspektive vor: Jandl schreibt hier nur noch Texte für einen, der laut Jandl liest; laut Jandl gelesen hat aber bisher nur Jandl. Wir stoßen auf die Gleichung: Gedicht = lauter Jandl = Jandls Stimme. Der Akt des lauten Lesens stülpt dem Lesenden den Text über, aber er legt auch Entfernung zwischen ihn und ihn, indem Jandl hier laut kommentierende, zweifellos existentiell unflätige Subtitel lieferte zu dem Film Jandls Leben, der mit und ohne Gedichte genau gleich abläuft. Sie verhalten sich, in bezug auf Eingriffsmöglichkeiten in den Ablauf eigenen Lebensfilms, hochgradig resignativ. Der ausgeprägte post-festum-Charakter zeugt davon: Immer ist ein (elender) Vorfall bereits geschehen, und das skribierende Subjekt kann nur noch reagierend tätig werden. Was als ein unerschrocken kondensiertes Summum an Autobiographie erscheint, ist in Wahrheit deren Verabschiedung: Es bleibt nicht genug übrig, als daß eine entstehen könnte. Freilich, die Methode, womit das herausgehoben wird, ist individuell und wir erkennen letztlich die Stimme, die vom Entleiben singt. Ob das, was Stimme hat, der Körper mithin, lebendig oder tot ist, spielt keine Rolle:
ich werde dir erscheinen
wie stets ich erschienen dir bin
und du wirst weinen
denn ich bin dahin (…)
Hier ist einer gegangen, und kommt doch noch. Die Glorie dessen, was Jandl von der Welt hätte übriglassen können, zog sich in diese Stimme zurück, die nichts anderes ist als die Fähigkeit, es hervorzubringen. Darum sind die Inhalte nicht so wichtig, wir bewundern ohnehin nur den Umstand, daß Jandl enstehen läßt. Das kann er, auch und gerade mit nichts, lange weiter tun. So feiern die Gedichte, daß sie entstanden, und die Stimme liest es laut stolz.
Allemann: Die Stimme: Fleischwolf, der aus dem Materiellen und Immateriellen, das er faschiert (Welt, Körper, Laute, Erinnerungen, der akademische Werdegang Kurzfickers, Sprachfetzen, Instant-Rapports, Husten und Hustenverfluchung samt „wütenden gedanken / dem schweren kampf in seinem kalkkopf / zwischen dem einstigen jetzt und dem jetzigen einst“), sich selbst, den materiell-immateriellen Fleischwolf Stimme, hervorbringt. Er muß gefüttert werden, der Fleischwolf (der Fütterungsvorgang wird gern Leben genannt), aber was immer oben hineingestopft wird, unten kommt er selbst heraus: der Fleischwolf. Wir könnten auch sagen: Fleischwerwolf, der sich selber anfällt, leersäuft (siehe unten). Oder: Kalbender Kot; kreißende Scheiße, die den Körper, der sie schiß und scheißen wird, unaufhörlich aus sich herauspreßt, stimmlich gebiert. Der Mund frißt Welt und (mit besonderem, selbstreflexiv gesteigertem Appetit) Mund; der Mund scheidet Welt und (mit besonderer, koprooral gesteigerter Lust) Mund aus; der ausgeschiedene Stimmkot (auch von Stimmkotze dürfte gesprochen werden, siehe „der langsam gehende mensch“) erweist sich als unbegrenzt welt- und mundfreßfähig. Diese Stoffwechselspirale produziert die Energie, die sie im Fluß hält, permanent selbst; sie heißt: Stimme. Ein – schwächeres; in einem schwächeren der Jandl-sprüche eingeführtes – Synonym für Stimme ist Absoluter Autovampirismus (siehe oben):
oh absolutes trinken
oh sich das blut aussaugen
oh sich berauschen
Jandl ist ein Voiceaholic; lies: Woissaholic. Frage: „was sie mit ihren wörtern in wahrheit sagen / wissen das jemals die poeten“. Antwort: Jein. Das Jandl-Hirn woissas nicht. Die Jandl-Stimme woissas. – Vielleicht sollten wir nicht schließen ohne den Hinweis, daß von unaufhörlich, permanent, unbegrenzt und absolut zu sprechen, natürlich blanke, wenn auch schwungvolle Mystifikation ist. Ganz ernstlich ist zu befürchten, daß selbst die Jandl-Stimme, trotz ernstester Observierung Gottes durch EJ, einen Trick des Beschatteten nicht drauf hat (weil der immer nur mit ihm angibt, ihn nie zeigt): zu blockieren den Switch des Circuitbreakers auf die Off-Position, genannt Tod.
Basler Zeitung, 11.11.1989
ERNST JANDL
Schmatz
Schmatz
Und
Tschüss
Peter Wawerzinek
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl – Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


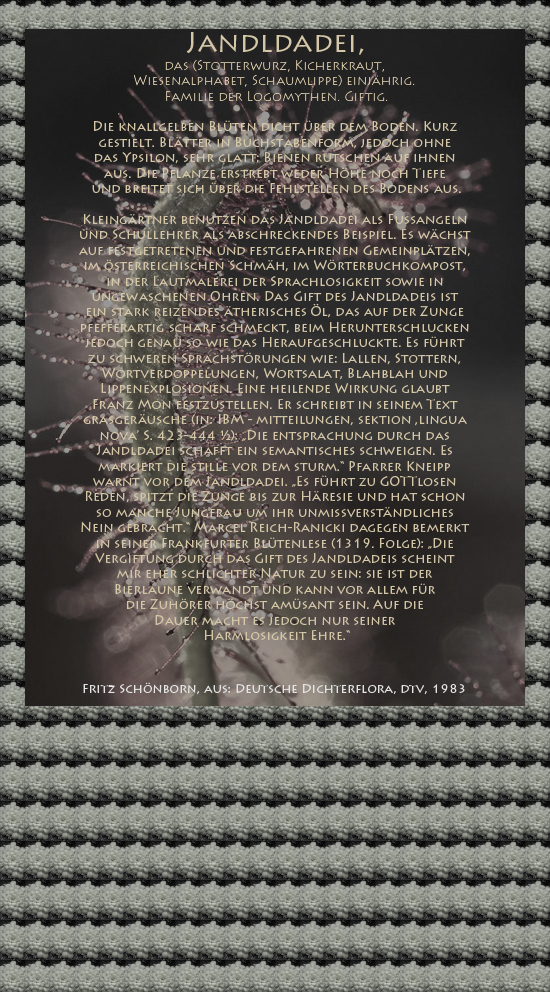












Schreibe einen Kommentar