Ernst Jandl: Laut und Luise
falamaleikum
falamaleitum
falnamaleutum
fallnamalsooovielleutum
wennabereinmalderkrieglanggenugausist
sindallewiederda.
oderfehlteiner?
Ernst Jandl spricht „falamaleikum“
Nachwort
Es gibt heute merkwürdige Klischees des Urteils: wer etwa für moderne Literatur ist, gilt von vornherein als Gegner der Tradition; aber auch umgekehrt, wer Vergangenes kennt und liebt, wird für einen Verächter der Moderne gehalten. Daß erst im Risiko der Progression, im Ausprobieren und ersten Benennen dessen, was eben nie vorher gesagt oder gezeigt worden ist, die Tradition sinnvoll eingelöst und ihr Erbe weitergetragen werden kann, dieser Gedanke widerspricht offenbar der Übereinkunft, auf die sich unsere Zeit eingelassen zu haben scheint.
Wenn ich sage: die in diesem Band vereinten Gedichte von Ernst Jandl sind Gedichte wie eh und je [soweit es je Gedichte wie eh und je gegeben hat], so dürfte ich das nach dieser Übereinkunft nur sagen als ein modernistischer Snob des Paradoxons oder aber mit der Ignoranz des Avantgardisten, der alles ignoriert, was vor 1911 geschrieben worden ist. Ich habe jedoch weder ein Paradoxon im Sinn, noch meine ich ein Ignorant zu sein. Ich sage in voller Überzeugung, daß dies Gedichte sind. Gedichte? Was ist ein Gedicht? Sind dies Gedichte? [Die Mechanik solcher Fragen scheint sich bis heute nicht merklich erschöpft zu haben.]
Es sind Gedichte sogar in einem ganz bestimmt auf Tradition bezogenen Sinn. Man erkennt es an den Überschriften der dreizehn Gruppen. „Mit Musik“: das sind Lieder. „Volkes Stimme“: das sind Dialektgedichte. „Krieg und so“: das sind politische Gedichte. „Doppelchor“: Liebesgedichte. „Autors Stimme“: autobiographische Gedichte. „Kuren“: didaktische Gedichte. „Der Blitz“: ein größeres Lehrgedicht. Ebenso: „Klare gerührt“. „Jahreszeiten“, „Zehn Abendgedichte“, „Bestiarium“: Naturlyrik. Und die „Epigramme“ bedienen sich selbst eines Namens, dessen Tradition unbezweifelbar ist.
Aber stimmt das wirklich? Ist das Gebilde, das aus den Wörtern: canzone, ganz, ohne, völlig beraubt besteht, ein Lied in dem Sinn, in dem das „Heideröslein“ ein Lied ist? Stellen die Buchstaben: s–––––c–––––h, tern, s––––––––––c––––––––––h, terben: soetwas wie ein Bekenntnisgedicht dar?
Jandl bezieht sich auf die Tradition und zieht sich zugleich zurück auf die bloßen Kennmarken des traditionellen Redens. Er zieht sich zurück auf ein sprachliches Rudiment [oder auch, an anderer Stelle, auf ein Sprachfeld, ein Sprachspiel, eine Redekette usw.], das er am Grunde dessen findet, was in der Überlieferung Gedicht hieß. Dies Rudiment [mit allem, was sich aus ihm, aus seiner Wortwörtlichkeit erschließen läßt] verarbeitet er zu einem Modell, an dem sich zeigt, wie der Redende [und sein Leser, sein Nachsprecher] sich in der Sprache befindet.
Eins läßt sich leicht sagen: natürlich sind dies nicht Gedichte, die so aussehn wie Gedichte von Andreas Gryphius oder Josef von Eichendorff. Aber sehen denn Gedichte von Eichendorff so aus wie solche von Gryphius, und sagt das irgend etwas darüber, wie weit es Gedichte sind oder nicht? Dies sind Gedichte von Ernst Jandl, verfaßt am Beginn der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Freilich gibt es zur gleichen Zeit auch Gedichte von Georg von der Vring oder Ingeborg Bachmann. Aber auch solche von H.C. Artmann oder Franz Mon. Was besagt das?
Ich sollte jetzt wirklich sagen was ein Gedicht ist, ein Gedicht schlechthin oder das Gedicht schlechthin. Und ich sollte sagen, worin das Besondere besteht, das zum Beispiel ein Gedicht von Goethe von dem Gedicht schlechthin unterscheidet. Oder eins von Jandl. Aber mache ich damit nicht ernst mit dem Klischee des Urteils, von dem ich doch im Grunde nichts halte? Tue ich nicht gerade den Gedichten Jandls unrecht, wenn ich sie so mit der großen Artillerie des historischen Gedankens verteidige?
Ein Gedicht besteht aus Sätzen, deren Inhalt und Form historisch bedingt ist. Aber es ist weder mit einer seiner historisch bedingten Redeweisen noch mit einer seiner historisch bedingten grammatischen Sonderformen identisch [auch diese sind einmal erfunden worden]. Auch Jandls Gedichte bestehen aus Sätzen [oder Satzbruchstücken oder Wörtern oder durch Buchstaben gekennzeichneten Lauten], die ihre historische Bedingung haben. Nicht in irgend einem weltanschaulichen Sinn oder im Sinn der zeitgemäßen Schlagworte. Sondern in Bezug auf das, was sie enthalten, auf Sprache, auf Redenkönnen, auf das Sagbare. Daß Reden und Wovon-Reden eine grundsätzliche Dimension überschritten oder erreicht hat, daß Sprache in eine Krise geraten oder erst jetzt in ihrem wahren Wesen erkennbar geworden ist, das gehört zu den Schlagworten, aber sie beziehen sich auf etwas, und dies, auf das sie sich beziehen, hinterläßt seine Spur. Auch im Gedicht. Das Gedicht antwortet darauf. Eine dieser Antworten, die radikalste, wenn man will, war die Erfindung des Antigedichts. Aber es blieb [sei es als „Parole in libertà“ der Futuristen, als i-Gedicht von Kurt Schwitters, als Ecriture automatique der Surrealisten oder als Ein-Vokabel-Gedicht der Konkreten Poesie] Demonstrationsgegenstand. Es gibt weiterhin Gedichte. Es wird weiterhin Gedichte geben.
Zum Beispiel die von Ernst Jandl. Er verfaßt Gedichte nicht, indem er sich „einstimmt“ oder eine Stimmung „verdichtet“ oder seine Kontakte zu Sonne Mond See Wald Rosen Mädchenaugen zu „magischen Beschwörungsformeln“ benutzt usw.; er verfaßt Gedichte, indem er sich der Sprache stellt, sie aufgreift und in sie eindringt. Er beschreibt nicht Imagination, sondern er geht den Offenheiten der Sprache nach, den Offenheiten der Satzfügung wie der Redegewohnheit, des Vokabulars wie der sprachlichen Kleinstteile, um die Möglichkeiten auszunutzen, die diese Offenheiten darstellen. Möglichkeiten, die, realisiert, wiederum in diesem historischen Augenblick, sagen, was sagbar ist. Und um, vielleicht, damit, hinterher, Imagination anzuregen. Offenheiten: die inhaltliche Assoziation wird ebenso benutzt wie die klangliche, die Diskrepanz zwischen Schrift- und Lautbild ausgenutzt, die Ausdruckskraft entdeckt des unvollständigen, rudimentierten Satzes und Worts wie des Kalauers, Übersätze zu Wortfeldern aufgeschwemmt usw. Immer wieder ist es nicht die Abfolge der grammatischen Logik, die den Zusammenhang bestimmt, sondern der Fortgang von Überraschung zu Überraschung. Überraschung, wortwörtlich Unerwartetes, schnellt Sprache fort. Das bedeutet zugleich Witz, Sprachwitz, Wortwitz. Kaum ein Band Gedichte ist so witzig wie dieser von Jandl. Aber so witzig er ist, so wenig ist Jandl doch nur ein Verfasser von witzigen Gedichten.
Und wenn. Warum nicht? Witzige Gedichte sind heute besser als tiefsinnige oder sentimentale. Das Symbol erweist sich in jedem Fall als Leerform. Das Gedicht, so könnte man sogar generell sagen, ist witziger geworden. Es kommt nicht mehr ganz ohne Witz aus. Selbst dort, wo es lakonisch, finster, bitter, aggressiv auftritt, kann es seinen Witz nicht ganz verleugnen. Das bedeutet, unter anderem, Freizügigkeit. Gemüt ist nicht länger exemplarisch. Es dient dem Witz, der Doppelzüngigkeit, dem Sprachspiel. Der Tiefsinn des vage Ahnbaren, des nebulosen Lustgefühls am Unaussprechlichen ist abgewandert in die Evergreen-Industrie und kann sich auch dort, wie es scheint, nicht mehr recht behaupten.
Das Individuum, wenn man es denn so nennen will, ist weniger durch seine Innerlichkeit als durch seine statistisch erfaßbaren Daten definiert. Name: Ernst Jandl. Geboren: 1.8.1925 in Wien. Wohnort: Wien 2, Untere Augartenstraße 1-3/1/19. Beruf: Gymnasialprofessor. Staatsangehörigkeit: Österreichisch. Usw. Die Abwandlung der Vokale in in dem Satz: du warst zu mir ein gutes Mädchen, genügt zu einem Liebesgedicht. So ist es mit unserer Rede und den Repräsentationsmöglichkeiten unserer Rede bestellt. Die von Metaphern quellenden Bekenntnisse sind, im Sinn der Aktualität, unverständlich geworden. Wenn wir sie verstehen wollen, müssen wir von einem solchen Satz Jandls zurückgehn und uns erinnern über uns selbst hinaus. Daß wir die Fähigkeit, dies zu tun, nicht verlieren, ist wichtig. Aber wir erhalten diese Fähigkeit nicht, indem wir das zu Erinnernde restaurieren wie ein Zimmer voll ererbter Möbel. Wir erhalten sie nur, wenn wir fortsetzen. Und Fortsetzung heißt: hier und jetzt.
Ich will hier weder eine Beschreibung noch eine Interpretation der Gedichte von Jandl liefern. Ich will andeuten und anreizen. Ich will sagen, daß dies Gedichte sind. Gedichte wie eh und je, wenn es je Gedichte wie eh und je gegeben hat. Gedichte von Ernst Jandl, verfaßt am Beginn der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Gedichte von Ernst Jandl, nicht verächtlicher als die von Friedrich Hölderlin oder Eduard Mörike oder Wilhelm Busch. Was sie „wirklich“ sagen, was, wenn man so will, ihre Wahrheit ist, oder was, wenn mans anders will, ihre Information, das sollte natürlich jeder Leser selbst herausfinden.
Helmut Heißenbüttel, Nachwort
Der erste große Sammelband
der experimentellen Gedichte Ernst Jandls – 1963 zusammengestellt, 1966 in einer limitierten Ausgabe erschienen – wird hier neu vorgelegt. Inzwischen sind diese Gedichte längst selbtverständlich geworden – wenn sie es nicht schon immer gewesen sind. „Gedichte wie eh und je, wenn es je Gedichte wie eh und je gegeben hat“ – so Helmut Heißenbüttel über Jandls Arbeit – „Er verfaßt Gedichte, indem er sich der Sprache stellt, sie aufgreift und in sie eindringt. Er beschreibt nicht Imagination, sondern geht den Offenheiten der Sprache nach, den Offenheiten der Satzfügung wie der Redegewohnheiten, des Vokabulars wie der sprachlichen Kleinstteile, um die Möglichkeiten auszunutzen, die diese Offenheiten darstellen… Immer wieder ist es nicht die Abfolge der grammatischen Logik, die den Zusammenhang bestimmt, sondern der Fortgang von Überraschung zu Überraschung. Überraschung, wortwörtlich Unerwartetes, schnellt Sprache fort. Das bedeutet zugleich Witz, Sprachwitz, Wortwitz. Kaum ein Band Gedicht ist so witzig wie dieser von Jandl. Aber so witzig er ist, so wenig ist Jandl doch nur ein Verfasser von witzigen Gedichten.“ – Die neue Ausgabe enthält Angaben über die Entstehungszeit der Texte sowie über die frühesten Abdrucke und Lesungen; der visuelle Text „klare gerührt“ erscheint in seiner ursprünglichen Form.
Luchterhand Verlag, Klappentext, 1971
Ernst Jandl: Laut und Luise bei Wikipedia
Spielgedichte zum Selbermachen
– Zu den lyrischen Experimenten des Wieners Ernst Jandl. –
Manche werden ihn einen Textebastler nennen wollen. Ernst Jandl, von Beruf Gymnasiallehrer, schreibt, was der Einfachheit halber als experimentelle Poesie bezeichnet wird. Doch er schlägt der Richtung ein Schnippchen. Es gibt eine Photographie von ihm, und schon darauf verrät er sich. Er steht dort, rechte Schulter hochgezogen, die linke hängen lassend, ein professioneller Aktentaschenträger, verschmitzt in die Kamera lächelnd. Seine Texte geben dieser Aufnahme recht. Walter Höllerer:
Lautgedicht, Poème object, Buchstabengedicht hat Jandl mit Witz durchschossen –, so pädagogisch der Gymnasiallehrer Ernst Jandl auch sein mag.
Ein nicht ganz einfacher Fall. Jandl hat, so scheint mir, aus Heißenbüttels Krümel-Text („1 Mann auf 1 Bank“) Methode gemacht, und seither gibt es im Bereich der experimentellen Poesie wieder etwas zu lachen, ohne daß man das unangenehme Gefühl zu haben braucht, man hätte irgend etwas theoretisch ungeheuer Kluges bloß falsch verstanden. Soweit ich sehe, meint Ernst Jandl es wirklich komisch, wenn auch keineswegs unernst. Schließlich ist er ja auch noch Pädagoge.
Abgesehen von einigen Veröffentlichungen an entlegenerem Ort liegen inzwischen zwei Bücher dieses Autors vor –
Ernst Jandl: Laut und Luise; Walter-Druck 12, Walter-Verlag, Olten/Freiburg; 208 S., 28,– DM
Ernst Jandl: Sprechblasen, Gedichte; Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied/Berlin; 96 S., 9,80 DM.
Beide Bände, zeigen ihren Verfasser von derselben Seite, was bedeutet, daß die siebenundsechzig „Sprechblasen“-Texte gegenüber dem ersten großen Sammelband Laut und Luise nichts grundsätzlich Neues bringen. Jandl scheint seinen Stil gefunden zu haben und innerhalb der selbstgesteckten Grenzen mit den vorhandenen Variationsmöglichkeiten spielen zu wollen. Überhaupt ist das Spiel mit der Sprache das wesentliche Prinzip seiner literarischen Technik.
Jandl hat versucht, die Sprache aus den Fesseln des konventionellen Sprechens und Schreibens zu befreien. Er macht sich in seinen Texten die Offenheiten der Sprache zunutze. Sie sind in den Lücken angesiedelt, die die syntaktischen und grammatischen Regeln, die Orthographie und die Interpunktion dem Benutzer der Sprache lassen. Und sie beweisen, daß es auch jenseits der durch Regeln festgelegten Sprache noch gibt, was üblicherweise für ihr Wesen angesehen wird, Verständigung nämlich:
BESSEMERBIRNEN
als mehr kanonen.
Wer wollte das bestreiten? Jandl läßt die Sprache gewähren, lauscht aber sehr genau auf das, was ihr, sich selber überlassen, alles so einfällt. Und dann macht er daraus ein Gedicht von Ernst Jandl.
Wie das Beispiel zeigt, braucht er dabei nicht viele Worte zu machen. Seine Gedichte sind zum großen Teil sehr kurz. In den „prechblasen findet sich unter dem Titel „sprach mit kurzem o“ lediglich das Wort „ssso“. Aber auch die umfangreicheren Texte kommen durchweg mit einem minimalen Grundbestand von Wörtern aus. Der Text „klare gerührt“, der sich über neunzehn Seiten hinzieht, besteht nur aus diesen beiden Wörtern. Durch Variation und Wiederholung wird die Wendung „viel / vieh / o / so / viel / vieh“ zu einer längeren rhythmisch gegliederten Komposition ausgebaut, und das dreieinhalbseitige Gedicht „bericht über malmö“ basiert allein auf den fünf Buchstaben des Wortes „malmö“.
Poetologische Voraussetzung dabei ist natürlich, daß die feste Lautstruktur des Grundwortes aufgelöst werden darf und die einzelnen Laute zu neuen Konstellationen zusammentreten können. So kommt es zu neuen Wörtern, bekannten oder unbekannten, und der „bericht“ ergibt endlich das Wort „malmö“ als das Ergebnis einer witzigen Multiplikation nach dem Muster: „alm / mal / lamm / mal / Öl / mal / alm / mal / lamm.“
Wer dergleichen als müßige Spielerei abtun will, der sei etwa an die Sprachalchemie mancher Barocklyriker erinnert und an deren Versuche, die paradiesische, die adamitische Ursprache zu rekonstruieren. Nun ist Ernst Jandl selbstverständlich kein barocker Sprachmystiker, und man braucht auch gar nicht bis zum Barock zurückzugehen, um Vorbilder für diese Art der Dichtung zu finden. Die Lyrik des zu Unrecht unterschätzten August Stramm zum Beispiel, sowie Expressionismus und Dada ganz allgemein, haben in den fünfziger Jahren den Versuchen der Wiener Gruppe zur Anregung gedient, und davon ist auch Jandl nicht unberührt geblieben.
Hat man sich erst einmal von der geläufigen und kaum je reflektierten Vorstellung freigemacht, daß Sprache ein festes, nach unveränderlichen Regeln aufgebautes System sei, dann eröffnet sich ihrem Benutzer eine Fülle neuer Möglichkeiten. Und dann wird einem auch Jandls Vorgehen weit weniger revolutionär erscheinen. Im Grunde betreibt er ja nur das mit Methode, was jeder Sprechende, wenn auch ohne Methode, täglich tut. Wer spricht, nutzt auch bereits, ohne groß darüber nachzudenken, die Offenheit der Sprache. Feststehende Redensarten, alltägliche formelhafte Wendungen sind jedermann verständlich, auch wenn sie nur fragmentarisch ausgesprochen oder vernommen werden. Ähnliches gilt für einzelne Wörter. Ist unsere Schriftsprache nicht überdeterminiert? Das Hebräische zum Beispiel kommt in seiner Schrift ohne Vokalbezeichnungen aus. Kann man im Zweifel darüber sein, was das Wort „schtzngrmm“ bedeutet? Jandl versucht daraus eine akustische Demonstration des Schützengraben, zu machen, mit dem Geratter der Maschinengewehre, dem Sirren der Geschosse, mit dem Gurgeln der Getroffenen, mit allem Grimm und Zorn der Schützen und einem langgezogenen „sch…“ als drastischem Kommentar.
Ein Wort kann aber auch, je nach Zusammenhang, Verschiedenes bedeuten, erst die Schreibung eines Lautes entscheidet über seinen Sinn. Es gibt inhaltliche Assoziationen und lautliche, es gibt Dialektgewohnheiten und physisch bedingte Sprechweisen (Lispeln). Ernst Jandl versteht in seinen Gedichten all dies und anderes mehr auszunutzen und beweist damit eine ungewöhnliche Sensibilität für die Sprache.
Diese Begabung hat zur Folge, daß der Autor mit seinen Einfällen verschwenderisch umgehen und die Gefahr, seine Prinzipien durch allzu häufige Wiederholung totzureiten, vermeiden kann. Und diese Gedichte besitzen sogar noch einen weiteren Vorzug, dessen viele andere derselben literarischen Richtung nicht selten ermangeln: Auch Ernst Jandl experimentiert mit der Sprache, doch seine Experimente begnügen sich nicht damit, angestellt worden zu sein. Sie zielen auf ein Ergebnis außerhalb des Sprachlichen. Häufig ist es ein Witz, immer eine Überraschung, und über manchen von Jandls Ergebnissen könnte man geradezu tiefsinnig werden. So über der auf einem simplen Konsonantenaustausch beruhenden „lichtung“:
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
verwechsern.
werch ein illtum!
Die Negierung eines irrtümlich behaupteten Sachverhalts wird schon in seiner Niederschrift augenfällig demonstriert. Die Einheit von Sprache und außersprachlicher Wirklichkeit wird hergestellt, eine für unüberschreitbar gehaltene Grenze im Nebenbei eines Epigramms übersprungen.
Interessant ist Jandls Stellung zu den überkommenen lyrischen Formen. Auf eine ganz eigene Art hält er an ihnen fest. Ein Gedicht mit dem Titel „sonett“ enthält lediglich dies eine Wort, vierzehnmal wiederholt, in den Reimen angeblich, „vereinfacht oder artistisch gesteigert“, aber in der klassischen Gruppierung von zwei Quartetten und zwei Terzetten. Auch Helmut Heißenbüttel hält in seinem Nachwort zu Laut und Luise ausdrücklich am Begriff des Gedichtes fest. Es seien, so sagt er, „Gedichte wie eh und je, wenn es je Gedichte wie eh und je gegeben hat“, und knüpft damit Jandls in der Lyrik scheinbar ungewöhnliche Formen an die Tradition an. Epigramm, didaktische Poesie, Natur- und Liebeslyrik, Lied und Bekenntnisgedicht, alle diese altehrwürdigen lyrischen Gattungen erscheinen bei Jandl wieder, umgeformt, manchmal reduziert, manchmal parodiert, immer aber ernst genommen.
Dennoch bleiben gewisse Vorbehalte. Sicherlich; man mag ein Gedicht wie „fragment“ der poetischen Lyrik zurechnen können:
wenn die rett
es wird bal
übermor
bis die atombo
ja herr pfa.
Man wird es sogar als witzig empfinden können. Ob es aber wirklich politisch ist? Ob Buchstabenspiele der Erfahrung des Schützengrabens gerecht werden? Jandl scheint die Realität in erster Linie als sprachliches Phänomen zu erfahren, und das hat notwendig einen gewissen ästhetischen Immoralismus zur Folge.
Gewarnt durch meine Erfahrung mit der Lyrik von Jandls Freundin Friederike Mayröcker, räume ich die Möglichkeit ein, daß ich auch Jandls Gedichte, gerade weil sie mir gefallen, falsch verstanden habe. Gleichviel. Ich habe sie als Anleitung zum Selbermachen gelesen, als Spielgedichte. Und als solche empfehle ich sie weiter.
Helmut Salzinger, Die Zeit, 28.3.1969
Und Jandl sprach: „so quait ander denn anderwo“
– Am Samstag wäre der große Wiener Wortakrobat Ernst Jandl 90 Jahre alt geworden. Eine gute Gelegenheit, um darauf hinzuweisen: Seine Gedichtsammlung Laut und Luise gehört immer wieder neu gelesen. –
Als Ernst Jandls Laut und Luise 1966 in den Walter Drucken erschien, umwitterte den Band sofort Skandalluft. Ganz gewöhnliche Buchstaben gerieten auf Abwege. Ganze Wörter rutschten aus den Satzverbänden heraus. Orts- und Personennamen wurden so lange durcheinandergeschüttelt, bis auch der letzte Laut sein volles Klangvolumen preisgab. „poleeeon / naaaaaaaaaaa / pooleon“, heißt es etwa zu Beginn des letzten Drittels der – ohne Titel – exakt 102-zeiligen „ode auf N“.
Der Urheber dieser verblüffend komischen und entsetzlich scharfen Gedichte war ein bürgerlich aussehender Englischprofessor aus dem Zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ernst Jandl (1925–2000) hatte mit Sprech- und visuellen Gedichten bereits in den 1950ern Furore gemacht. Selbsternannte Bewahrer des Abendlandes boykottierten Jandls Dichtung prompt. Er selbst führte höchst eigenständig fort, was die Vertreter der Wiener Gruppe (Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm, Wiener) aus dem Hut der Moderne gezaubert hatten. Jandl entblößte poetisch die Zähne. Den lyrischen Stimmungsmalern der Nachkriegszeit riss er die Sprachbrocken unter der Nase weg.
Der Band Laut und Luise genießt den Status eines unangefochtenen Klassikers. Was aber wäre, wenn das Büchlein ausgerechnet heute, am 90. Geburtstag Jandls, zum ersten Mal erschiene? Es würde, so steht zu befürchten, von niemandem rezensiert. Lyrikbände werden von den Kritikern der überregionalen Presse kaum noch angegriffen. Zu groß scheint das Risiko, sich in den Augen einschlägig Bewanderter zu disqualifizieren. Moderne Gedichte, so heißt es, müssten erst mühsam entziffert werden. Jandl vermeidet genau das, was einer als „dunkel“ und „hermetisch“ verschrienen Lyrik im Urteil der Allgemeinheit so schlecht zu Gesicht steht.
Sprachfenster auf!
Er reißt die Sprachfenster auf und sorgt für Durchlüftung. Er bricht die Poesie auf deren einfachste Elemente herunter. Jandls Dichtkunst ist demokratisch. Sie zeigt, woraus unsere Annahmen über die Welt zuallererst gemacht sind: aus Sprache. Die entsteht im Mund. Oft stellt sich für den Artikulierenden schon die Barriere der Zähne als unüberwindliches Hindernis heraus:
thechdthen jahr
thüdothdbahnhof
thechdthen jahr
wath tholl
wath tholl
der machen
heißt es dazu in dem herzzerreißenden Adoleszenzgedicht „16 jahr“.
Das Achselzucken hört man gleichsam mit. Sage keiner, ein gelernter Anglist wie Jandl hätte nicht auch seine Sehnsüchte gehabt.
ich was not yet
in brasilien
nach brasilien
wulld ich laik du go
lautet die erste Strophe in „calypso“. Es scheint jedoch, als ob dem sehr lobenswerten landeskundlichen Interesse des lyrischen Ichs doch sehr enge Grenzen gesteckt sind. Die zweite Strophe lässt profanere Interessen erkennen:
wer de wimen
arr so ander
so quait ander
denn anderwo
Die kleine Pointe hält sich zum Ausgang der Strophe gut versteckt. Könnte man den Vers „denn anderwo“ nicht auch so lesen, als ob das „denn“ – kraft seiner lautlichen Äquivalenz zu „then“ – ein Dementi enthielte? Meint Jandl etwa: Wenn es schon nicht nach Brasilien geht (etwa weil das Sprachvermögen mit den Gelüsten nicht Schritt hält), so ließen sich zur Not vielleicht ein paar Frauen „anderwo“ finden?
Erstes Wiener Heimorgelorchester spielt Ernst Jandls „calypso“
Wohlklang des Herren
Jandls Gedichte haben in den Jahrzehnten nach Laut und Luise ihre Publikumswirksamkeit hinlänglich unter Beweis gestellt. Vorgeblich gläubige Menschen fühlten 1966 das Andenken Christi beschmutzt, bloß weil es Jandl geraten schien, in der Buchausgabe auf den Abdruck seines visuellen Jesus-Gedichts zu bestehen. Neunundzwanzigmal ertönt der Vokal „e“ nach dem „j“, ehe zwei Bindstriche in der darauffolgenden Zeile eine Barrikade bilden. Erst nach deren Überwindung entlädt sich der ganze Wohlklang, der im Namen des Herren aufgehoben ist: „suss“.
Ernst Jandls unschätzbare Verdienste als Dichter, Vortragskünstler und Kulturpolitiker sollten niemanden davon abhalten, einen Klassiker wie Laut und Luise immer wieder aufzublättern und neu zu befragen: „schtzngrmm“, „wien : heldenplatz“. Der 90. Geburtstag des Wortkünstlers bietet dafür die beste Gelegenheit.
Ronald Pohl, der Standart, 1.8.2015
Laut und Luise
Ernst Jandl schrieb kürzlich über die „konkrete Dichtung“ – also auch und wohl vor allem über seine eigenen Arbeiten – „sie ist nicht illusionistisch und nicht didaktisch, sie ist eine dichtung die nichts enthält was man wissen kann, sie ist konkret, indem sie möglichkeiten innerhalb von sprache verwirklicht und gegenstände aus sprache erzeugt (statt, didaktisch-abstrakt, aussagen zu machen über gegenstände die ausserhalb von sprache angenommen werden, und, illusionistisch-abstrakt, mit sprachlichen mitteln die verwirklichung von möglichkeiten die ausserhalb von sprache angenommen werden vorzuspiegeln).“
In den Gedichten Jandls bestimmt nicht die grammatische Logik die Abfolge, sondern die Eigenbewegungen der Sprache selbst – die allerdings vom Autor in Gang gesetzt werden. Jandl arbeitet mit verschiedenen Sprachebenen, er arbeitet mit Vokabelreihungen, Wortzertrümmerung, Vokalvertauschung und -verschiebung, mit Lautverdrehungen und vielem mehr; er erzielt damit eigenwillige Laut- und Bildgedichte.
Bei einem solchen Schreiben dominiert das spielerische Element; ausgehend von den Eigenbewegungen der Sprache bastelt Jandl sozusagen freischwingende Sprach-Mobiles, die hübsch anzusehen sind. Ja, diese Gedichte sind ausgesprochen witzig, und wer Sinn für Sprachspiele hat, wird an diesen Texten seine helle Freude haben. Sicher erzeugt Jandl hier, wie er es von der „konkreten Dichtung“ gesagt hat, „gegenstände aus sprache“ – was ja schliesslich die Gedichte aller Zeiten sind –, aber natürlich machen diese Gedichte auch, ganz entgegen seiner Forderung, Aussagen „über gegenstände die ausserhalb von sprache angenommen werden“. Gerade die spielerische Verschiebung etwa der Vokale in diesen Texten, die neue Inhalte suggeriert, oder das Anspielen auf Doppelbedeutungen einzelner Wörter machen ja den Witz dieser Verse aus: der Bezug auf Wort-Inhalte, Wort-Bedeutungen ist also keineswegs ausgeklammert (was wohl auch nie ganz möglich ist, wenn Sprache, und sei es nur in ihren Rudimentärformen, verwendet wird). Helmut Heissenbüttel legt in seinem Nachwort Wert auf die Feststellung, dass Jandls Texte „Gedichte wie eh und je“ seien, und er definiert sie, ganz zu Recht, etwa als Lieder, Dialektgedichte, Naturlyrik, Liebesgedichte, politische Gedichte, didaktische Gedichte usw. Heissenbüttel bezeichnet sie als Gedichte, die sich auf die Tradition beziehen und sich zugleich aus ihr zurückziehen auf sprachliche Rudimente, die Jandl zu Modellen verarbeitet. Eine Tradition allerdings erwähnt er nicht, zu der diese Gedichte in engster Beziehung stehen: es ist der Dadaismus. So sehr viel anders als das, was vor einem halben Jahrhundert von Arp, Schwitters, Hülsenbeck und andern geschrieben wurde, lesen sich die Gedichte Jandls gar nicht, auch wenn Jandl eine moderne Theorie für seine Arbeit vorweisen kann. An Theorien allerdings war auch bei den Dadaisten, deren Texte denen Jandls so ähnlich sehen, kein Mangel.
Auch ein Leser, der tiefgründige Theorien ablehnt und sich nur ein bisschen an Jandls Sprachspielereien freuen will, findet für sein flüchtiges Interesse ein Alibi bei Ernst Jandl, der von der „konkreten Dichtung“ einmal schrieb:
kontakt mit einer solchen dichtung ist – im schauen, lesen, hören – ein vorbeigehen an ihr, wie an bildern, an ihrer oberfläche streifend.
J. P. W., die Tat, 10.12.1966
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Karl Krolow: Litaneien, Sprachspiele und Gewitzel – Drei neue Lyrikbände
Der Tagesspiegel, 6.11.1966
Peter O. Chotjewitz: Ernst Jandl: „Laut und Luise“
Literatur und Kritik, Heft 18, 1967
Karl Riha: Ernst Jandl: Laut und Luise. – Hosi-anna
Neue Deutsche Hefte, Heft 4, 1966
Helmut Salzinger: Luises leise Läuse
Der Monat, Heft 5, 1967
Helmut Salzinger: Spielgedichte zum Selbermachen. Zu den lyrischen Experimenten des Wieners Ernst Jandl
Die Zeit, 28. 3. 1969
Peter O. Chotjewitz: Ernst Jandl: Laut und Luise
Literatur und Kritik., Heft 18, 1967
anonym: Writing By Ear
The Times Literary Supplement, 28.9.1967
Stephen Bann: Concrete Poetry. An international Anthology Einführung
Magazine editions, 1967
Walter Höllerer: Ernst Jandl
Ein Gedicht und sein Autor. Lyrik und Essay (Literarisches Colloquium), 1967
Helmut Mader: Lyrik für die Bütt? Ernst Jandls Gedichte und Antigedichte
Stuttgarter Zeitung, 2.2.1969
Andreas Okopenko: Ärger, Spaß, Experiment u. dgl. Der Wiener Antilyriker Ernst Jandl
Wort in der Zeit, Heft 1, 1964
Alfred Kolleritsch: Ernst Jandl: Laut und Luise
manuskripte, Heft 18, 1966
Dietrich Segebrecht: [Rezension zu „Laut und Luise“, Freiburg: Walter 1966]
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.3.1967
Anonym: Blödeln für Fortgeschrittene
Vaterland, 5.5.1967
„hesch“: [Rezension zu „Laut und Luise. Ernst Jandl liest Sprechgedichte“, Berlin: Wagenbach, Schallplatte 1968]
Mannheimer Morgen, 1.12.1968
Anonym: Schwarzweisheit
Basler Nachrichten, 11.12.1968
Herbert Gamper: Emanzipierte Sprache
Die Weltwoche, 13.12.1968
h. h. h.: Gesprochene Avantgarde
Die Zukunft, Heft 1–2, 1.1969
Anonym: [Rezension zu „Laut und Luise“]
Die Zeit, 28.3.1969
O. Ottersleben: Ernst Jandl: „Sprechblasen“
ENGRAMME, Heft 3, 1969
p. k.: Lyrik für sehr Fortgeschrittene
Woche, 1.1.1970
Christiane Muschter: feilchen vür efa
Basler National-Zeitung, 7.3.1970
Anonym: Lyrik – zum Gebrauch bestimmt. Arbeiten von Ernst Jandl in der „Sammlung Luchterhand“
Bremer Nachrichten, 23.9.1970
Anonym: Verwegene Sprachspiele
Wiener Wochenblatt, 13.2.1971
Andreas Okopenko: Baum seitlich der Kunstbaumgruppe
Wort und Wahrheit, Heft 3, 5./6.1971
Jürgen P. Wallmann: Über Mitdenken zum Mitmachen anreizen
Rheinische Post, 25.5.1974
Jörg Drews: Ernst, ach Ernst, was du mich alles lernst!
Die Zeit, 8.8.1975
Anonym: Ernst Jandl: Laut und Luise
Westdeutsche Schulzeitung, 1.1978
Horst Christoph: „ich den kappen dehn“
Profil, Heft 40, 1.10.1979
Walter Hilsbecher / Hilde Rubinstein / Michael Scharang: Dürftige Zeiten
Frankfurter Hefte, Heft 6, 1969
Urs Widmer: Laut und Luise
Neue Zürcher Zeitung, 22.6.1994
Die Weisheit aus den Wörtern
– Dionysisches Doppelporträt mit Ernst Jandl. –
Jandl heißt Ernst, und so ist er auch. Dieses „Nomen est Omen“ ist zugleich ein Wortspiel und die Beschreibung seiner Natur. Ernst spielt, und sein Spiel ist ernst. Jandl ist ein ernster Sprachspieler, aber es gibt keinen anderen Sprachspieler, der die Doppelbeziehung von Spiel und Ernst so folgerichtig vorführt wie er. Die Ernsthaftigkeit des Spielerischen und das Spielerische des Ernstes sind in Jandl zur Totalität verschmolzen. Jandl ist ein ernster Mensch, der spielt, ja, er ist der leibhaftige spielerische und spielende Ernst.
Ernst Jandl spielt, indem er schreibt und malt. Schreibend und malend spielt er in aller Ernsthaftigkeit, und dabei verliert er keinen Augenblick die Contenance, auch wenn es einige gibt, die das bestreiten. Wenn er nun aber fast wortwörtlich davon spricht, daß ungefähr alle, ehe sie zu schreiben beginnen, malen, und dies dann, wenn sie, was meist in der Schule geschieht, zu schreiben begonnen haben und, weil sie es müssen, es weitertun, dort noch einige Jahre fortsetzen, was Ernst Jandl selbst auch getan hat, freilich mit dem unabwendbaren inneren Zwang, beides tatsächlich müssen zu müssen, im Unterschied zu vielen anderen, die unentwegt schreiben und malen, ihr Geschriebenes und Gemaltes aber weder geschrieben noch gemalt werden müßten, ja, wenn Ernst Jandl diese Verbindung, diese Verwandtschaft, diese beziehungsreiche Affinität von Schreiben und Malen so ausdrücklich betont, dann müßte ja auch ich müssen, und zwar nicht nur schreiben und malen, sondern beides in einem: nämlich auf der Stelle ein apollinisches Porträt Ernst Jandls entwerfen und zeichnen.
O wie gerne würde ich Ernst Jandl in einem apollinischen Porträt abkonterfeien, wie gerne erst würde ich mich mit Ernst Jandl in einem apollinischen Doppelporträt abkonterfeit sehen! Aber die Musik ist aus der Tragödie geboren, und die apollinische Vetternschaft ist wohl nur ein unerfüllbarer Wunsch. Wie schön wäre es, Apollo zu sein, Phöbus, der Lichte, der Glänzende, der Strahlende, aber das Malen und das Schreiben, wobei man etwas „herzeigen kann“, wie Jandl sagt, sind die plastischen Wunschträume des singenden Tragöden mit seiner „Freude an der Vernichtung des Individuums“.
Ja, das Malen ist wohl nur die traumatische Ersatzhandlung für tragisches Musizieren, um nämlich der apollinischen Weihen teilhaftig zu werden, die allerdings nur dem Ausübenden der Kunst zuteil werden, in der Apollo, wie Nietzsche sagt, „das Leiden des Individuums durch die leuchtende Verherrlichung der ,Ewigkeit der Erscheinung‘“ überwindet. „Hier siegt die Schönheit“, ruft Nietzsche aus, „der Schmerz wird in einem gewissen Sinne aus den Zügen der Natur hinweggelogen.“ Die ,Ewigkeit der Erscheinung‘ ist aber nur dort zu erlangen, wo man etwas fabriziert, „das man herzeigen kann“, und so hat Ernst Jandl lange gemalt und gezeichnet und das Auge bemüht, bevor er anfing zu sprechen und zu singen und endlich das Ohr entsprechend zu strapazieren. Ernst Jandl prüfte Wind und Wetter, er suchte Mittel und Wege, und genau dort, wo er an eine Stelle kam „mit noch mehr Wegen als bisher“ und „nun auf allen diesen munter voran(schritt)“, wie er selbst erzählt, da wurde ihm „auf einem davon (…) die Stimme frei“. Seit der Zeit spricht und singt er mit freier Stimme, aber der apollinischen Erscheinungs- und Vorzeigeherrlichkeit ist er naturgemäß verlustig gegangen.
Glücklicherweise haben wir immer noch Nietzsche bei der Hand, der uns diese kompensatorischen Gegenläufigkeiten der Künste sinnlich und sinnvoll und darüber hinaus mit Anspielungen auf die überlieferte und deutungsbewährte Mythe erklärt.
Im Gegensatz zu allen denen, welche beflissen sind, die Künste aus einem einzigen Prinzip, als dem notwendigen Lebensquell jedes Kunstwerks, abzuleiten
so sagt Nietzsche,
halte ich den Blick auf jene beiden künstlerischen Gottheiten der Griechen, Apollo und Dionysus, geheftet und erkenne in ihnen die lebendigen und anschaulichen Repräsentanten zweier in ihrem tiefsten Wesen und ihren höchsten Zielen verschiedenen Kunstwelten. Apollo steht vor mir als der verklärende Genius des principii individuationis, durch den allein die Erlösung im Scheine wahrhaftig zu erlangen ist: während unter dem mystischen Jubelruf des Dionysus der Bann der Individuation zersprengt wird und der Weg zu den Müttern des Seins, zu dem innersten Kern der Dinge offenliegt.
Ernst Jandls Mutter hieß Luise; auch sie schrieb Gedichte, und sie ist die Luise im Titel seines eigenen Gedichtbuchs Laut und Luise. Ist nicht die Verbindung von Laut und Luise die gleiche Verbindung, die zwischen Ernst und Luise besteht, wobei der Ernst die spielerische Antithese von Luise und Luise die ernste Antithese des Spielerischen ist? Ja ist nicht der Ernst mit dem Laut so vollkommen identisch und Luise gleichermaßen mit dem Spielerischen, daß Ernst und Luise sich zueinander verhalten wie Laut und Spiel und, wie andererseits und auf vergleichbarer Ebene, Witz und Freiheit? „Freiheit gibt Witz…, und Witz gibt Freiheit“, heißt es bei Jean Paul; Weisheit und Liebe durchdringen einander, nicht nur etymologisch, und beide, die Weisheit und die Liebe, entbinden sich dröhnend aus den Wörtern, worin sie verborgen sind und auf ihre Abnabelung von der mythischen Urmutter warten.
Diese Trennung von Laut und Luise, das heißt diese gleichzeitige Separierung der Luise vom Laut und der Freiwerdung des Lautes von der Luise, diese Entbindung unter Schreien, diese schwere Geburt der Tragödie aus dem Geiste und auch aus dem Fleische der Musik, ist für Ernst Jandl, der entbundenen Weisheit und Liebe wegen, eine Notwendigkeit gewesen und zeigt seine unhistorische, seine im wörtlichen Sinne ursprüngliche Mutterbindung an, während schon zu Nietzsches Zeiten „das ungeheuerliche historische Bedürfnis der unbefriedigten modernen Kultur“ auf den Verlust „des mythischen Mutterschoßes“ hinwies und „das fieberhafte und so unheimliche Sichregen dieser Kultur“ sich geradezu als das Kindbettfieber der alles verschlingenden emanzipierten Spätmutter erwiesen hat.
Ernst Jandl dagegen hat sich von einer Urmutter abgenabelt, sein Schrei ist ein Urschrei, ein schallendes, ein gellendes, ein dröhnendes Ding, „ein Ding, das ich bisher nicht kannte, und von dem ich, da ich mich umsehe, annehmen darf, daß es das bisher nicht gab“, wie Ernst Jandl selbst das Ergebnis dieses Prozesses beschreibt. Schallend, gellend, dröhnend sprechend, ja schreiend entbindet Ernst Jandl die Weisheit aus den Wörtern, im Sprechen befreit sich die Weisheit aus Buchstaben und Lettern, im Schrei trennt sich die Weisheit von Laut und Luise.
Was daran so tragisch ist? Was das überhaupt ist, das Tragische? Ja, sind wir Komödianten und Luftkutscher nicht allesamt heillose Tragiker und spielen in einer kuriosem Tragödie mit, ob wir wollen oder nicht, weil wir nämlich des homerischen Glaubens verlustig gegangen sind, Rhapsoden des Paradoxen, Sänger der Verzweiflung geworden sind, aber beileibe nicht etwa an deprimierenden Affekten verkommen, wie Aristoteles, in gesundheitsschädlichem Pessimismus ersticken, wie Nietzsche befürchtet? O nein, im Gegenteil, Nietzsche hat ja recht, wenn er sagt: „Indem man vermöge des Dynamometers die Wirkung einer tragischen Emotion mißt“, so „bekommt (man) als Ergebnis,… daß die Tragödie ein tonicum ist.“
So wie der apollinische Plastiker ins reine Anschauen der Bilder versunken ist, so ist der dionysische Sprechkünstler „ohne jedes Bild völlig nur selbst Urschmerz und Urwiederklang desselben“, aber ein Schmerz, der guttut, ein Wiederklang, der beseligt, „das große Stimulanz des Lebens.“ Dieses schallende Sprechen, dieses gellende Schreien, dieses dröhnende Singen Ernst Jandls ist ein ausgesprochen dionysischer Akt, der die Weisheit geradezu tonisierend hervorbringt, wie Weißdorn und Knoblauch, eine Weisheit mit Muskeln und Moral.
In Ingomar von Kieseritzkys Szenen aus der Geschichte der Vernunft mit dem Titel „Die ungeheuerliche Ohrfeige“, in denen drei Philosophen – Ploikos, Kabes und Kritos – auf der Suche nach dem Guten und dem Wahren die kuriosesten Abenteuer erleben, gibt es auch ein Schwein, das ihren Diskursen und Experimenten auf ganz schweinische Weise beiwohnt. Das Schwein heißt „Sophia“, was ja so viel wie „Weisheit“ bedeutet. Also: ein Schwein namens Weisheit nimmt an philosophischen Exkursionen teil und engagiert sich dabei; „Sophia (neigte) zum Grübeln“, sagt Kieseritzky, aber „Entschluß und Ausführung bei Sophias Handlungs-Regeln… sind bei diesem Schwein schwer zu übersehen“, so daß es zu folgender schwerwiegender Szene kommt (die ich Ihnen im Wortlaut nicht vorenthalten möchte):
Sophia
erstieg den Kasten, ohne die Augachsen zu bewegen, brachte sich in eine bequeme Hockstellung (weißt du, es sah sehr weiblich aus und ich mußte an ein Mädchen denken, das –) und pißte hinein, einfach so, nebenbei, als eine Art Realisation einer abrupten Neben-Absicht. Wir brüllten und warfen Gurken nach ihr, aber es war sozusagen schon vollbracht. Mit triumphierendem Grunzen rannte sie durch das Magazin, warf Ploikos im Vorraum einen zärtlichen Blick zu und verschwand im Hof. Sie hatte, stellten wir fest, die Stelle „Ethik als Wissenschaft“ erwischt, eine Stelle, die noch unfertig war. Ploikos hatte lediglich notiert: Wissenschaft Folge von Sätzen, d.h. unantastbaren wahren Aussagen; zerfallen in zwei Klassen; nämlich die Grundsätze, d.h. jene (Sätze), deren Wahrsein derart evident ist, daß sie weder eines Beweises fähig noch bedürftig sind; stelle also Grundsätze auf im Hinblick auf Gültigkeit des E – und damit endete die bepißte Stelle, die wir reinigten und trockneten.
In einer ganz anderen Geschichte, der Bildergeschichte „Der Bauer und sein Schwein“ von Wilhelm Busch gibt es die entscheidende Szene, in der sich das Schwein von der Leine, an der es gehalten wird, befreit und von nun an eine Folge von halsbrecherischen Situationen heraufbeschwört. Wilhelm Busch sagt an dieser Stelle: „Da zieht das Schwein, der Bauer fällt, weil er sich auf das Seil gestellt“, was im Grunde genommen ganz genau das gleiche bedeutet wie Sophias Emanzipation von der Ethik als Wissenschaft. Dieses Schwein von Wilhelm Busch ist auch Kieseritzkys weises Schwein Sophia, das sich nicht in menschliche, scheinbar einzig gültige Ordnungen fügt, und beide Geschichten lehren, was geschieht, wenn ein Schwein losgelassen, freigegeben, ja mündig wird und ins Ungewisse, ins Zweifelhafte, ins Doppelsinnige ausbricht, wohlgemerkt ein Schwein mit dem Namen „Sophia“, das zum menschlichen Normierungswahn auf seine schweinische Weise sagt: „Ça me fait pisser!“ und auch den Bauern zu Fall bringt, „weil er sich auf das Seil gestellt.“
Der Zusammenhang mit Ernst Jandl, die Beziehung, die Verbindung, der Berührungspunkt zwischen Ernst und Sophia ist evident wie das Wahrsein der Grundsätze des Ploikos: auch Jandls Wörter werden losgelassen, freigegeben, mündig und schließen sich zu ganz neuen Verbindungen zusammen. Ernst Jandl sagt:
viel
vieh
o
so
viel
vieh
so
o
so
vieh
sophie
und fährt etwas später fort:
so
viel
vieh
o
sophie
so
viel
o
sophie
und in einem dionysischen Akt entbindet er die Weisheit und darüber hinaus die Liebe zur Weisheit wortwörtlich aus seinen Wörtern.
O nein, Ernst Jandl braucht nicht mehr zu zeichnen und zu malen, sein dionysischer Akt „schließt mit einem Klange, der niemals von dem Reiche der apollinischen Kunst her tönen konnte“, um ein letztes Mal auf Nietzsche zurückzukommen. Bei Wilhelm Busch heißt es im dionysischen Distichon: „Heimwärts reitet Silen und spielt auf der lieblichen Flöte, / freilich verschiedenerlei, aber doch meistens düdellütt!“ Und Nietzsche fährt fort: „Damit erweist sich die apollinische Täuschung als das, was sie ist, als die während der Dauer der Tragödie anhaltende Umschleierung der eigentlichen dionysischen Wirkung: die doch so mächtig ist, am Schluß das apollinische Drama selbst in eine Sphäre zu drängen, wo es mit dionysischer Weisheit zu reden beginnt und wo es sich selbst und seine apollinische Sichtbarkeit verneint. So wäre wirklich das schwierige Verhältnis des Apollinischen und des Dionysischen in der Tragödie durch einen Bruderbund beider Gottheiten zu symbolisieren: Dionysus redet die Sprache des Apollo, Apollo aber schließlich die Sprache Dionysus: womit das höchste Ziel der Tragödie und der Kunst überhaupt erreicht ist“, was mir selbst ja auch die Gelegenheit gibt, mich zu Ernst Jandl und den Doppelgöttern hinzuzugesellen, damit Ernst Jandl nicht alleine ihnen gegenüber, womöglich sogar zwischen Apollo und Dionysus zu stehen kommt.
„O sophie“ schließt Ernst Jandls langes Gedicht über die Weisheit, und das ist letztlich nicht zu widerlegen, nein, dagegen gibt es kein Argument, es sei denn, man entzieht ihm das Wort und versiegelt ihm die Lippe, man stopft ihm das Maul und macht ihn mundtot und wird auf eine rabiate Weise Herr über ihn, wie man ja auch über die Weisheit, ja über ein Schwein nur Herr werden kann, wenn man es so macht, wie es das Ende von Wilhelm Buschs Bildergeschichte beschreibt. Dort heißt es:
Doch endlich schlachtet man das Schwein, da freute sich das Bäuerlein.
Ludwig Harig, Vortrag gehalten am 12.6.1981 in Wien. Veröffentlicht in Protokolle, Heft 4, 1982
Jandl und das Saxophon
1
Paradoxerweise gibt es von einem der größten Dichter des 20. Jahrhunderts viele Äußerungen, daß er lieber etwas anderes als Dichter geworden wäre. In einem Brief aus dem Jahr 1972 beispielsweise kann unmißverständlich nachgelesen werden:
Nicht daß ich mich nicht freuen würde (…), daß Sie eine Arbeit über meine Gedichte verfassen; aber wenn ich Musik machen könnte, würde ich keine Gedichte machen, oder höchstens ganz nebenbei.
Später. Mitte der 80er Jahre, gesteht Jandl sogar in einem Gedicht seine Liebe zur Musik ein, die mit seiner Leidenschaft für das Schreiben nicht Schritt halten könne. Und Jandl geht in diesem Gedicht noch einen Schritt weiter, er schreibt, welches Instrument es ihm derart angetan hat und welche Art von Musik er sich so sehr begeistert, daß er das schreiben von Gedichten dafür sogar vernachlässigen würde:
LIEBER EIN SAXOPHON
lieber ein saxophon hätte ich ja auch
an die lippen geführt anstatt
mit dem kugelschreiber an meine
veränderten zähne zu tippen mit der frage
was kommt denn dabei heraus, was kann denn
dabei herauskommen, wenn es nicht
sonny rollins ist oder gerd dudek
um einfach zwei lebende zu nennen
Saxophonist wäre Jandl also gerne geworden, Jazzmusiker – und offenbar glaubt er, daß es ihm nicht nur größeren Spaß gemacht hätte, zu komponieren und aufzutreten, er ist auch der Ansicht, als Musiker sähe er sich nicht mit der Frage nach dem Sinn seines Tuns konfrontiert, die ihn als alternden Autor drückt. ABER: Ein Musiker ist aus ihm nicht geworden. Er hat nicht einmal die zartesten Anstrengungen unternommen, daß je ein Musiker aus ihm hätte werden können. Dafür hat er alle seine Kraft und Lebensenergie verwendet, daß aus ihm ein bedeutender Schriftsteller wird. Und nicht nur das. Unter den Autoren zählt er zu den wichtigsten Neuerern, der das Gedicht aus den geschmackvoll gefriedeten Bereichen, dem Rest an romantischem Erbe, selbst die kühnsten Gedichte anderer Autoren noch mit sich schleppen, heraus geführt hat und eine Art zu Schreiben praktizierte, die einem höchst aktuellen Geist entstammte, einem Geist, der vom Lärm des 20. Jahrhunderts begeistert und noch mehr verstört war, und der diesen Lärm, wann immer er ihm in ästhetischen Produkten begegnete, in sich aufsaugte – vor allem in der zeitgenössischen Musik. Also war Jandl, obwohl er Dichter und Zeit seines Lebens nichts als Dichter war, doch auch ein Musiker? Ein Musiker, der anstelle eines Taktstocks Bleistifte in den Händen hielt und dessen Instrument nicht das Saxophon war, sondern seine Stimme, mit der er Melodien spielen konnte und seine Stücke waren nicht aus Noten zusammengesetzt, sondern aus Sprache komponiert, und in Jandls so sehnsüchtig formulierten Wunsch, Musiker sein zu wollen drückt sich etwas aus, was er ohnehin schon ist?
Doch Achtung, Jandl hat nie geschrieben, als würde vor ihm ein Blatt mit Notenlinien liegen, und als sei er eigentlich mit Komponieren beschäftigt – er hat zu keiner Zeit wie ein Musiker gedacht. Er hat nie versucht, Gesetze des Komponierens auf die Literatur zu übertragen. Wenn er sich mit seinem Gedicht beschäftigte, dann setzte er sich mit nichts anderem auseinander, als mit dem Vokabular. Er war unter den Schriftstellern ein ausgesprochener Purist. Wenn er schrieb, konzentrierte er sich ausschließlich auf die Sprache und die Eigengesetzmäßigkeiten der Form, mit der er es bei diesem Gedicht zu tun hatte. Ihm ging es immer nur um genau das eine Gedicht und den einen Text, mit dem er beschäftigt war. Und obwohl Jandl mit einer derart ausschließlichen Konzentration auf seine jeweilige Arbeit Dichter war und für ihn nichts anderes zählte, als das was jeweils als gelungen angesehen werden durfte, ist es nicht zu weit hergeholt, ihn als ersten Saxophonisten unter den Dichtern zu bezeichnen. Ohne seine Empfänglichkeit für Musik, wäre seine von Text zu Text immer wieder neu vollzogene Revolutionierung der Literatur undenkbar. Er hat sich zu einem Schriftsteller entwickelt, der die Literatur aus dem Geist der Musik neu geschaffen hat. Und diese Empfänglichkeit für Musik besaß Jandl von früh an.
Jandl:
Zu den frühen musikalischen Eindrücken, die ich hatte, gehörte natürlich das Radio. Das war damals ein sogenannter Detektor-Apparat, bei dem man Kopfhörer benötigte, also keinen Lautsprecher, zwei Kopfhörer konnte man einstecken. In den Ehebetten meiner Eltern ist dann dieser Detektor-Apparat, ein schwarzes Holzkästchen zwischen den beiden Ehegatten gestanden; jeder hat Kopfhörer aufgehabt, und da haben sie am Abend vor dem Schlafen, wenn sie nichts anderes tun wollten oder konnten, Musik oder sonst was gehört. Und hier und da, mein Gitterbett ist auch in diesem Zimmer gestanden, und hier und da wurde ich gerufen und durfte da auch hineinhören.
Der Erwachsenenwelt näher zu kommen, war für ihn reizvoll. Aber auch in einen Bezirk des Familienlebens aufgenommen zu werden, der ihm sonst verwehrt ist, und dort etwas von der erotisch zwittrigen Stimmung aufnehmen zu können, war und blieb ein Faszinosum für Jandl. Und darüber hinaus aus dem kleinen Familienkosmos trotz Weltwirtschaftskrise mußte Jandl keine wirkliche Not leiden –, hinaus in die große Welt der Nachrichten und Klänge zu gelangen, das hat Jandl nicht nur geprägt; diesen Kontakt hat er, wann immer möglich, wieder und wieder gesucht – auch mit seinen Gedichten die Verbindung zwischen privater und öffentlicher Welt gesucht und den Lesern ein Medium an die Hand gegeben, das es ihnen die Möglichkeit bietet, aus ihrer Welt herauszutreten.
Daß sich Jandl via Detektor vermutlich auf Unterhaltungsmusik gestoßen sein wird, hat ihn keineswegs abgestoßen. Im Gegenteil: Er mochte Kitsch. Jandl:
Als meine Mutter gestorben war, gab es das sogenannte Trauerjahr, da durfte man in kein Kino gehen, da durfte man in kein Theater gehen, eine verrückte Idee, daß ich allerdings so gefeiert habe, daß ich ein- bis zweimal am Tag, während mein Vater als kleiner Angestellter bei der Bank arbeitete, ins Kino ging. Das Trauerjahr wurde für mich insofern zum Jubeljahr. Als ich endlich mir den Wunsch des Kinos erlauben konnte – bis dahin hat es große Vorbehalte von allem von meiner Mutter gegenüber dem Kino gegeben, weil das Kino sehr viel enthielt, was mit ihrer strikten katholischen Moralvorstellung nicht zu vereinbaren war.
Eine große Karriere als Kinogänger hätte Jandl damit offengestanden. Doch bevor er diese Laufbahn überhaupt einschlagen konnte und damit lange bevor er auch nur daran gedacht hat, das erste Wort in seine Bestandteile zu zerlegen und in den auf diesem Weg gewonnenen sprachlichen Kleinteilen poesietaugliches Material zu entdecken, hatte sich sein Leben auf eine Weise verfinstert, die ihn nicht nur in einer lustvollen Richtung aus den kleinbürgerlichen Lebensbahnen stieß. 1940 starb seine Mutter, für Jandl eine Katastrophe, über die er in seinen Werken Auskunft gegeben hat. Eine bislang unbekannt gebliebene melodramatische Zuspitzung in seinem Leben hat aber mindestens ebenso großen Einfluß auf seine Arbeiten, auch wenn sich die Folgen nicht so direkt nachzeichnen lassen wie die Veränderungen, mit denen er nach dem viel zu frühen Tod der Mutter zu tun bekam.
Jandl:
Wir waren drei Buben, mein Vater hat im Büro arbeiten müssen, eine Wirtschafterin nach der anderen ist zu uns gekommen und hat alsbald die Flucht ergriffen. Dann kam ein Mädchen, durch irgendeinen Freund meines Vaters vermittelt, ein Mädchen vom Land, aus dem Weinviertel, sie war 19 Jahre alt – und in diesem Mädchen habe ich die Möglichkeit gesehen, doch einmal zu einem Sexualverkehr zu kommen, ’42 muß das gewesen sein.
Dieses Melodram findet kein happyend. Sie wird schwanger, er bekennt sich dazu, der Vater dieses Kinds zu sein, obwohl er sich dessen nicht sicher ist. Was sich als Abenteuerfilm gut konsumieren läßt und was in Liebesfilmen einen schönen, von Jandl so sehr geschätzten erotisierenden Schauer hinterlassen kann, zeigt sich im Alltag, eine unliebsame Entdeckung, von seiner ungleich kantigeren Seite. Nach Frauen sehnt er sich und die Zeit war danach, seine Sehnsucht extrem zu steigern: Jandl ist 16, 17 Jahre alt, ein Ende des 2. Weltkriegs will sich nicht abzeichnen, und er muß damit rechnen, daß er dem Militär nicht entgehen, und wie an Schülergenerationen vor ihm als „Kanonenfutter“ an irgendeiner Front verschleudert werden wird. Davor will er wenigstens einmal ein Mädchen in den Armen gehalten haben. allerdings bekommt er es gleich mit den (für ihn extrem gefährlichen Seiten der Sexualität zu tun: Erst hatte er Mühen, jemanden zu finden, dann muß er sich mit einer Schwangerschaft auseinandersetzen, von der in der Schule z.B. niemand etwas erfahren darf. In dieser Situation macht er eine weitere Entdeckung, die sich, ästhetisch gesehen, in denkbar weiter Entfernung zu seinen geliebten Melodramen im Film befand. Er stieß u.a. auf drei Gedichte von August Stramm: „Untreue“, „Patrouille“ und „Ritt“.
Diese Gedichte unterscheiden sich extrem von allem, was Jandl bisher lesen konnte. Gearbeitet wird mit kurzen, kurzatmiger werdenden Zeilen, die Sprache ist unter der Gewalt dessen, was sie zum Ausdruck bringen möchte verbogen, regelrecht gezeichnet. Die Semantik löst sich vom verwendeten Vokabular und stellt sich auf eine neue Art ein. UND: es wird mit Lautelementen gearbeitet; den Vorgängen werden die Geräusche abgehört, von denen sie begleitet sind. In einem Gedicht wie „Sturmangriff“ geht Stramm so weit, die Lautqualitäten der einzelnen Wörter („Kreisch“ / „Peitscht“) zu einem Klangereignis zusammenzufassen, das sich in immer kürzeren Sequenzen verdichtet, bis es mit einer Silbe und danach mit nichts mehr zum Stillstand gebracht wird. In diesem Gedicht herrscht ein brutaler Klangnaturalismus, der für Ernst Jandl im Nazi-Wien unerhört und neu war, von schlagender Evidenz.
Später wird Jandl das Klangerlebnis dieser Gedichte in dem Satz zusammenfassen: „Der Krieg singt nicht“. Bevor aber Jandl in der Lage sein wird, das auszudrücken, was mit ihm bei der ersten Lektüre dieser Gedichte geschehen ist, bevor er überhaupt ernsthaft mit Schreiben begonnen hatte, war er schon von zwei stark auseinander strebenden Ästhetiken erfaßt: dem schönen Kitsch, der zwar mit seinen Liebes(Lebens-)erfahrungen kaum Schritt halten konnte, dafür aber Ablenkung und Unterhaltung versprach, und den Gedichten eines August Stramm, die einen harten Ton anschlugen, dafür aber seine Ängste auszudrücken verstanden, die ihn überwältigten, sobald er daran dachte, was nach dem Abitur mit ihm geschehen würde, wenn aus ihm zwangsweise ein Soldat geworden wäre und er sich auch zu einem Sturmangriff bereit machen müßte.
2
Als Jandl 1952 dann mit Schreiben begann, hätte er gerne Gedichte geschrieben, die sich in größerer literarischer Nähe zu den Versen August Stramms befunden hätten. Doch der Beginn war bescheidener, nachkriegsrealistischer. Geschult an Autoren wie Carl Sandburg oder Jacques Prévert (diese Autoren zu entdecken muß im konservativen Literaturbetrieb in Wien bereits als Leistung angesehen werden) entstanden jedoch zunächst Gedichte, die einen klaren wirklichkeitsnahen Ton anschlugen. Der Alltag, der Jandl beschäftigte, gleichgültig welcher Ästhetik er sich nahe fühlte, belieferte ihn mit dem Material, das er in seinen Gedichten bevorzugt verwendete, und das ein Quelle blieb, durch die er sich mit immer neuem Material versorgt sah, solange er schrieb. Über die Jahre entstanden Gedichte wie „Donnerstag“, „luise“, „mit der eisenbahn“, „tramway“, „nachtstück mit blumen“, „die morgenfeier“, „sentimental journey“, „kleines geriatisches manifest“.
Doch der Stramm-Ton war in Jandl keineswegs verklungen. Wie konnte er aber selber zu radikalen Gedichten gelangen, von denen er überzeugt war, daß sie geschrieben werden müßten. Denn extreme Gedichte, weit extremer als die, die ihm bislang gelungen waren, wollte er schon schreiben. Aber wie konnte er dorthin gelangen? Mit der puren Willensanstrengung war es nicht getan, und bevor Jandl überhaupt daran denken konnte, Gedichte von einer vergleichbaren Radikalität zu schreiben, kam es zu einer überraschenden biographischen Wendung.
Durch das Schreiben kam eine Dynamik in Jandls Leben, von der er nicht einmal ahnte, daß es sie gäbe, solange er nicht schrieb. Nach den privaten Erschütterungen, nach Militär und Kriegsgefangenschaft hatte Jandl den Eindruck, sein Leben müsse in ruhigeren und friedlicheren Bahnen verlaufen: er heiratet, qualifizierte sich für einen Beruf, wollte Kinder. Das Schreiben war aber eine dauernde Quelle der Unruhe, die sich nicht besänftigen ließ, solange Jandl an dessen Fortsetzung dachte – und Jandl kam auf gar keine andere Idee, als seine Arbeit an eigenen Gedichten, nachdem er 1952 endlich ernsthaft mit Schreiben begonnen hatte, unter allen Umständen fortzuführen.
Das geordnete Leben zerbrach langsam und ohne daß sich rabiate Folgen zunächst abgezeichnet hätten. 1955 lernte Ernst Jandl die Schriftstellerin Friederike Mayröcker kennen, eine Begegnung, die jedoch alles andere als von harmloser Natur war und sich keineswegs auf den Austausch literarischer Ansichten und Erfahrungen beschränken ließ, wie sich herausstellen sollte. Als Jandl und Mayröcker nach Wien zurückgekehrt waren und dort an ihr Leben wieder anknüpfen wollten, das sie vor ihrer Fahrt nach Innsbruck geführt hatten, ging das nicht mehr. Zwei Ehen mußten geschieden werden und sollten nach Jandls Willen auch für beendet erklärt werden. Die aber von ihm so sehnlich erstrebte Ruhe und Übersichtlichkeit in seinem Leben sollte sich in der Form nicht wieder herstellen lassen, wie sie Jandl in der Zeit genossen hatte, als er Friederike Mayröcker noch nicht kannte. Seine persönliche Nachkriegszeit war beendet.
In dieser Zeit, als er sich mit Mayröcker in neuem Glück und unbekanntem Leid verstrickte, mußte er erkennen, daß es mit dem Schreiben realistischer Gedichte endgültig vorbei war. Unbedroht war dieser Anfang seines Schreibens nicht gewesen, und die Gefahren rührten nicht nur da her, daß er sich nie sicher sein konnte, ob er, worunter andere große Lyriker auch leiden, seine Produktion fortsetzen könnte. Nach dem Krieg – er hatte, was eine Leistung war, überlebt –, nach Studium, Promotion und Ausbildung zum Lehrer konnte er endlich mit Schreiben beginnen, und er war glücklich, wenn Gedichte z.B. wie „Donnerstag“ (in Andere Augen) entstanden.
In dieser aufgeregt-aufregenden Zeit schlug die Stunde der Musik. Jandl hatte in den ersten drei Arbeitsjahren den durch die Tradition gegebenen literarischen Spielraum nach Kräften ausgeschöpft. Zu Gedichten, die er in ästhetischer Hinsicht für seine Zeit als angemessen angesehen hätte und die er für schreibbar hielt, die literarischen Voraussetzungen waren dafür nicht nur von August Stramm sondern auch von Eugen Gomringer geschaffen worden, der Jandl zeitlich viel näher stand, ist er nicht gelangt. Dazu mußte er einen eigenen neuen Weg finden.
Schon während seiner Schulzeit hatte sich Jandl zusammen mit einem musikalisch hoch begabten Freund einen Klavierauszug von Ernst Kreneks Oper Johnny spielt auf besorgt. 1943 hatte Jandl das erste große Jazz-Erlebnis, in Brünn hörte er sich ein Konzert von Gustav Brohm und seiner tschechischen Band an. In den 50er Jahren hätte Jandl in Wien häufig in den Strohkoffer gehen können, wenn er sich getraut hätte, sich dort unter dem ihm fremden Besucher zu mischen. Dafür zog es ihn, ohne daß seine Berührungsängste aktiviert worden wären, zu Veranstaltungen in der Wiener Universität, die dort zum Thema Jazz abgehalten wurden. Dort diskutierten der Pianist Friedrich Gulda und der Flötist Johann Steps, ob Duke Ellington als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts angesehen werden dürfe, und Jandl hatte bei dem für ihn ohnehin entschiedenen Hin und Her der Argumente (wer sollte, aus Jandls Perspektive, Duke Ellington in den Schatten stellen können) all seine Sensoren auch dort peinlich genau auf Empfang gestellt: Es ging um ein vitales Thema für ihn.
Denn: Im Jazz hatte Jandl eine Ausdrucksform gefunden, die seinen auf Melodramatik und Sentimentalitäten reagierenden Alltagsenttäuschungen ebenso zugetan war, wie sich diese Musik seinen intellektuellen Ansprüchen gewachsen zeigte. Der Jazz ist laut, nervös, mitreißend und weit von allem entfernt, was Jandl gerne an gutem Geschmack und parfümiertem Wohlklang hinter sich lassen wollte. Dieses Klangereignis ließ ihn einen Ton immer deutlicher hören, den seine Gedichte ebenfalls anschlagen sollten, von dem er aber nicht wußte, wie er ihn erzeugen könnte, es sei denn, er ließe alles hinter sich, was er bisher geschrieben hatte, und versuchte, wozu er im Zusammenleben mit Friederike Mayröcker sich schon gezwungen sah, neue Formen zu finden. Mit Platten von Dizzy Gillespie und Benny Goodman im Gepäck brach Jandl zu seinen ersten poetischen Expeditionen in unbekannte Gegenden der Literatur auf, und in wenigen Monaten entstanden Gedichte wie: „chanson“, „etüde in f“, „calypso“, „die tassen“, „im delikatessenladen“, „minz den gawn“, „auf dem land“, „bestiarium“, „c-h“, „gute nacht gedicht“, „gehaucht“…
Selten hat man in neuerer Zeit einen Dichter mit derart viel Vergnügen bei der Arbeit gesehen! Er bringt die Silben mit einer Leichtigkeit zum Tanzen, daß rasch übersehen werden kann, welchen Weg er sich bahnen mußte, damit diese Art von extremen Gedichten entstehen konnten. Er mußte den Laut in der Sprache als autonomes Element entdecken, das genügend eigenes Gewicht besitzt, um, zunächst einmal nur darauf gestürzt, Poesie entstehen zu lassen. Er mußte die Silbe und in manchen Fällen die noch kleineren Wortpartikel, den Buchstaben, in ihrer jeweils eigenen Klangqualität als neuen und sich selber genügenden Bedeutungsträger entdecken und damit zu arbeiten lernen. Als ihm das gelungen war, hatte er einen Quantensprung in seinem Schreiben und in der Literatur vollzogen. Jandl war auf eine Gedichtsorte gestoßen, die vor ihm noch niemand entdeckt hatte, und die, in jeweils wechselnden Gestalten, eine der wesentlichen Grundlagen seines Werkes bildet: Das „Sprechgedicht“. Mit diesen Gedichten hatte er das tonale System verlassen, dem Gedichte bis dahin in ihrer überwiegenden Mehrzahl mit einer nicht hinterfragten Selbstverständlichkeit gefolgt sind. Und an ihre Stelle hat Jandl ein neues atonal-tonales System gesetzt, das wiederum das Schreiben von Gedichten mit sinnlicher Präsenz ermöglicht. Gleichzeitig übersetzt er den Lärm seiner Zeit in formal streng gebaute Tonfolgen. Er nimmt den Naturalismus der Geräusche auf, läßt ihn aber in der Künstlichkeit des Gedichts verändert aufleben: als (die beschriebenen Vorgänge in kritische Distanz bringende) amelodiös-melodische Tonfolgen in Gedichten wie „schtzgrmm“, „wien : heldenplatz“, „zertretener mann blues“, „scheer“, „im reich der toten“.
Ungleich finsterer als in seinen verspielten Lautgrotesken geht es in diesen poetischen Beinhäusern zu. Jandls stark entwickelter Widerspruchsgeist hatte ihm als Schüler im Nazi-Wien und später als Soldat, das Leben gerettet. Er beendete seine Karriere beim Militär ohne Dienstgrad und lief bei passender Gelegenheit zum Feind über. Dieser Eigensinn findet in Jandls komponierten poetischen Explosionen den gleichermaßen gedichtermöglichenden wie entschieden von diesen Wirklichkeiten sich abgrenzenden Ausdruck. Die Kraft für diese künstlerisch höchtes Feingefühl und äußerste Robustheit erfordernde Gradwanderung schöpfte Jandl indirekt – wiederum aus dem Geist des Jazz. Für Jandl hatte das körperliche Moment in dieser Musik eine große Bedeutung. Vom beuat, vom drive, dem Rhythmus wird der menschliche Körper unmittelbar angesprochen, und darin sieht Jandl ein neues Element, das von der Dichtung aufgegriffen werden müßte, wenn sie sich der Welt der Maschinen und Motoren gewachsen zeigen will, und nicht weiter wie die klassische Musik eine Ton pflegt, dem das Trappeln von Hufen und der Klang des Horns anhaftet.
Der Jazz hatte Jandl also ein Gefühl dafür entwickeln lassen, welche zeitgenössischen Freuden und Schrecken ein Ton aufnehmen kann, und daß die Vorstellung, etwas Neues machen zu wollen, ein ausgeprägtes Bewußtsein von Moderne erforderte. Dieses Bewußtsein stachelte ihn immer wieder an, nach seinem unverwechselbaren Ton zu suchen, einem Ton, von dem er sich ausdrücklich wünschte, daß er seiner Zeit und dem Gedicht gleichermaßen gewachsen war. Eines durfte der Dichter schon lange nicht mehr sein: naiv. Und das hieß, wie beispielsweise das legendäre Gedicht „schtzgrmm“ mußten seine Gedichte rhythmisch scharf durchgebildete Gedichte sein; im Rhythmus finden diese Gedichte ihre irritierende Identität, ihren Werkcharakter, was nicht nur die Anhänger traditioneller Lyrik gegen Jandl aufbrachte, auch die aufgeschlosseneren Geister fühlten sich durch diesen aufwühlenden beat in ihrem poetischen Empfinden zu Recht verletzt. Jandl wollte die durch Geschmack gesetzten Grenzen hinter sich lassen. Kurz mußten seine Gedichte sein, in maximal 3 Minuten, der Länge eines Musikstücks auf einer Schellackplatte mußte restlos alles gesagt sein. Und das eröffnete ihm wiederum auch die Möglichkeit, Elemente aus der traditionellen Lyrik zu übernehmen: auf eine erkennbare Pointe sollten seine Kompositionen mit Sprachlauten zusteuern. Der Zuhörer sollte wissen, worum es Jandl zu tun war. Diesen unformalistischen (an Inhalte gebunden bleibenden) Formalismus hatte Andreas Okopenko schon früh an seinem Dichterfreund Jandl beobachtet. Okopenko in einem Gespräch: „In den hitzig geführten Diskussionen über Literatur war Jandl immer derjenige, der stärker den formalen Aspekt betont hat, den formalen Reiz…“
3.
Mitte der 70er Jahre als Jandl in der 2. Hälfte seines Lebe verstärkt Texte schrieb, in denen der alltägliche Gebrauch der Sprache wieder eine unangefochtene Rolle spielte, ließ er sich keineswegs davon abbringen, seine mutigen Entdeckungsreisen in das Reich der Klänge und Töne weiter zu unternehmen und unter den Lyrikern der poetische Klangkünstler zu bleiben, zu dem er sich entwickelt hatte. Auch in den durch Grammatik, Syntax und eingeschliffene Wortwahl klarer gefaßten Grenzen einer Sprache, die auf Mitteilung abgestellt ist, realisiert er seine Kompositionen und schafft Neues. Diese Texte können den selben literarischen Rang für sich beanspruchen wie die frühen Entdeckungen, die Jandl zum Sprechgedicht geführt hatten. 1976 – in diesem Jahr ließ er sich pensionieren und entgegen der Vorstellung, daß er nun „freier“ Schriftsteller sei, ihn am Schreiben nichts mehr hindern müßte, war sein Konzept in Scherben zerbrochen, wie er sich eine Schriftstellerexistenz immer dachte: gestützt durch einen Beruf – 1976 also stieß er auf ein Prinzip, wie innerhalb der Alltagssprache und mit Elementen des alltäglichen Sprachgebrauchs lyrische Gebilde sich herstellen lassen, die wiederum aus ihrem Klang heraus leben und als neue Variante seiner Sprechgedichte angesehen werden können.
FRANZ HOCHEDLINGER-GASSE
wo gehen ich
liegen spucken
wursten von hunden
saufenkotz
ich denken müssen
in mund nehmen
aufschlecken schlucken
denken müssen nicht wollen
beisel
blunzen essen
dazu trinken ein seidel
noch ein blunzen essen
dazu trinken noch ein seidel
andern zuhören sprechen
andern zuschauen essen
blunzen essen den dritten
dazu trinken den dritten seidel
(jeweils aus dem Zyklus „tagenglas“)
Wie ließen sich in Gedichten die Gefühle noch genauer fassen, die bei Zwangsvorstellungen mit im Spiel sind? Oder bei Freßanfällen? Jandl nimmt emotionales Gerümpel als Stoff und baut daraus jetzt mit Hilfe seiner „heruntergekommenen Sprache“ seine Klangereignisse, deren Reiz sich aus dem kunstvoll eingesetzten Verletzungen der Sprachnorm ergeben. Das reiche Klangmaterial gewinnt Jandl aus einer verkommenen Sprache, die weit davon entfernt ist, überhaupt für poesietauglich angesehen zu werden, da sie im Einsatz ihrer Mittel zwar sicher aber auf eine Literatur verhindernde Weise beschränkt ist. Diese sprachlichen Ungeschicklichkeiten erlauben es Jandl, seinen Gedichten die Signatur eines Individuums einzugravieren, das seine Individualität nur noch in Trümmern wahrnehmen kann.
Diese Intonationsgedichte zogen Musiker an, die aus den verschiedensten Arbeitsphasen sich Gedichte heraussuchten und wie Dieter Glawischnig etwa in Suiten mit eigenen Kompositionen darauf antworteten. Und Jandl selber begann 1976 auch damit, diesen Ton zu längeren Stücken auszuarbeiten – das Oratorium die humanisten entstehen. 1978 ist seine weitläufigste Komposition beendet: die Sprechoper Aus der Fremde.
Bei diesem Porträt eines Schriftstellers, als das Aus der Fremde auch gelesen werden kann, benutzt Jandl erkennbar das eigene Lebensgeröll als Material und überführt es durch die Verwendung von Konjunktiv, strikter Dreizeiligkeit der Verse und Sprechen in der 3. Person in eine opernhafte Künstlichkeit. Dieser mit höchstem Kunstanspruch hergestellte Ton hält sich mit voller Absicht in den Niederungen kruder Lebensabläufe (mit und ohne Tiere) auf, von denen auch Jandls Balladen (u.a. „glückwunsch“, „der fisch“, „der wahre vogel“, „geschlechtsumwandlung“) und seine 1993 durch den Rap amerikanischer Musiker angestoßenen „stanzen“ handeln. (Auch hier ist es wiederum eine Mixtur aus biographischen Ereignissen und dann die Musik, die Jandl erst das Schreiben dieser Verse ermöglicht.)
Zugleich schraubt Jandl seine Stücke in artifizielle Höhen hinauf. Komposition und Libretto sind bei ihm ein und dieselbe Sache und noch etwas fällt bei Jandl zusammen: eine Figuren reden nicht nur pausenlos, alles was sie tun, begleiten sie mit einer Sprecharie, die von nichts anderem handelt als davon, was sie gerade tun. Reden und Tun sind eins, und je größer der Ausstoß an Vokabular, je aktiver diese Figuren also werden, um so deutlicher wird, wie festgefahren sie eigentlich sind und wie wenig ihnen die Sprache zur Erklärung dessen, was mit ihnen geschieht eigentlich zur Verfügung steht.
Auch Jandl spricht in vielen Gedichten (u.a. „graues gedicht“, „erstes sonett“, „zweites sonett“, „liegendes gedicht“, „gelegtes gedicht“, „nasses gedicht“, aber auch „oberflächenübersetzung“) von nichts anderem als von Gedichten:
ZWEITES SONETT
die zeile will die zeile sein
hier muß nicht erst noch sinn hinein
mit sinn die sprache ist beladen
und dreckig, also laßt sie baden
im reinen schaum der schönen lieder
und fürchtet nicht, sie käm nie wieder
wie ihr sie kennt und wollt und braucht
wie wir erst aus dem schlamm getaucht.
Wir setzen uns mit tränen nieder
denn unser leben war zu kurz
wir strecken eben erst die arme
nach einem schönen bilde aus
da riß es sich aus seinem rahmen
nichts blieb darin zurück. amen. aus.
Das Bewußtsein von Modernität gehört für Jandl als eine wesentliche Voraussetzung zum Schreiben dazu (und das schließt für Jandl die Bedeutung der Musik – „schönen lieder“ – für das Schreiben und den klaren Sinn für die Inkompatibilität von Mensch und Leben ein) und in diesen poetologischen Gedichten belebt Jandl seine Vorstellung von Moderne immer wieder von Neuem. In jedem seiner Verse steckt die unverrückbare Behauptung: Ein Gedicht ist das, als was ein Gedicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten angesehen werden muß: ein vollendetes, sich jeweils selber genügendes Kunstprodukt. Zugleich ist in diesen Gedichten, seinen reinsten Saxophonsoli, die er sich als Schriftsteller buchstäblich an den Mund geschrieben hat, sein Ton am unverstelltesten ausgebildet: Er ist karg, entblößt von allem überflüssigen Zierrat, in jedem Fall elementar, und in seinen besten Momenten erlaubt dieser Ton nach all den Anstrengungen des Lebens und Hinhörens das Kostbarste, was Jandl kannte: ein Lachen.
Klaus Siblewski, manuskripte, Heft 150, 2000
(Dieses Manuskript war die Basis eines Features desselben Titels. das vom Bayerischen Rundfunk realisiert und ausgestrahlt worden ist.)
Vom damaligen Jandl in meinem jetzigen Kopf
Aber darin besteht ja die Kunst, unter anderem, daß Fesseln abgestreift oder gesprengt werden können, wo keiner sie bisher bemerkt hat.
Ernst Jandl: 1. Frankfurter Vorlesung
Von Erinnerungen muß man erwarten, daß sie tun, was sie gerne tun – trügen. Ich kann ja nicht herbeirufen, was in den Fünfzigern, Sechzigern objektiv der Fall war – ich erzähle, was in meinem Kopffilter hängengeblieben ist, weil es mir wichtig war. Ich konzentriere mein Gedächtnis auf das triste Arbeits- und Lebensklima dieser Zeit und auf Jandls frühe visuelle Texte und Laut-Gedichte, die im Umfeld damaliger konventioneller Produktion überraschend hervorblitzten und eine mit Freude verbundene Beunruhigung darstellten.
Ich erinnere mich an einige wenige zufällige Begegnungen bei den damals selten stattfindenden Veranstaltungen, das berühmte nicht zusammenlebende Paar Jandl und Mayröcker glaube ich erstmals anläßlich der von Friedrich Polakovics bestrittenen Lesung aus Artmanns eben erschienenem Gedichtband med ana schwoazzn dintn im Herbst 1957 gesehen zu haben. (Anschließend im Beisl in der Porzellangasse Mayröcker, noch nicht auf Rabenschwärze eingeschworen, im erbsengrünen Pulli.)
Nachdem ich die ersten Lautgedichte Jandls („philosophie“, „schtzngrmm“, „ode auf N“) und visuellen Gedichte („vision“ z.B.) im Mai 1957 in den Neuen Wegen mit freudigem Erschrecken gelesen hatte, wünschte ich mir, Jandl einige meiner Gedichte zu zeigen, verwarf aber die Idee als indezent und ganz und gar unpassend. Erst 1962 (wenn mich mein fokussierendes Gedächtnisauge nicht trügt), als ein kleines Gedichtbändchen von mir erschienen war, schenkte ich es Ernst Jandl, der es freundlich aufnahm. Es war ja nicht zu einer raschen und direkten Einflußnahme auf meine Produktion gekommen, aber eine größere Beweglichkeit, Durchlüftung, Gegenbewegung zu der von Hermann Hakel diktatorisch verordneten klassischen Literaturauffassung war zu bemerken. Durch diese „Einstiegsdroge“ war ich in den Stand gesetzt, „befreite Wörter“, von Metrik und Syntax erlöste Sprache in neuen, vorher unbemerkten Qualitäten zu erleben. Wovon man (mit manchen Menschen) nicht sprechen kann, darüber muß man schreiben.
Anders als mit Andreas Okopenko oder Ernst Kein, mit denen ich aus dieser Zeit viele lustige, traurige und produktive Gespräche in Verbindung bringe, gelingt es mir mit Jandl nur wenige Begegnungen herbeizurufen. Nachdem ich auf Einladung des Literarischen Colloquiums im Winter 1963/64 in Berlin gewesen war, wurde ich mit meinem damaligen Ehemann Gerald Bisinger zwei- oder dreimal in Jandls winzige Wohnung eingeladen. Die Gespräche drehten sich um Berlin, die Unmöglichkeit, in einem ordentlichen Verlag zu publizieren, unser aller vergebliche Anstrengung. Nach einem Imbiß, reichlichem Trinken und Qualmen der Männer und dem Lauschen von Jandls Jazz-Platten gingen wir fast getröstet heim in unser Elendsquartier in der nahegelegenen Rembrandtstraße. Ein-, zweimal besuchten Jandl und Mayröcker uns sogar in unserem Kabinett in der Substandard-Wohnung meiner Mutter, die uns (wir waren mit Großmutter und Tante zu viert) 1942 von der Nazibürokratie als angemessen zugeteilt worden war und auch vom demokratischen Nachkriegsösterreich (wieder zu viert, diesmal mit Mutter, Mann und Baby) für ausreichend befunden wurde.
Ich erwähne diese äußere und innere Eingezwängtheit, weil ich jedes Aufbrechen und Aufbegehren gegenüber rigiden Strukturen mit erleichtertem Durchatmen begrüßen mußte, weil jedes Auflehnen eines Kräftigen (Jandl und Mayröcker waren wohlbestallte Lehrer, nicht wie ich unter dem Existenzminimum) den Schwächeren stärkte.
Befreiend kamen diese neuartigen Gedichte im Mai 1957 auf mich zu wie neue Freunde. Hier begegneten einander einzelne, vereinzelte Wörter – wie Personen – und eröffneten einen Dialog (sozusagen ohne unnötiges „soziales Beiwerk“) oder zeigten ihren Chemismus, indem sie, ihre Elemente neu geordnet, etwa unsinnig gewordene Ordnungen verhöhnten oder anderen erhellenden Schabernack trieben. Soviel konnte ich erkennen/erfühlen, daß die Konventionen außer Kraft waren und ein anarchisches Potential für den Moment der Rezeption lustvoll freigesetzt war.
Der Lyrik-Redakteur Polakovics wurde für dieses Neue Wege-Heft gefeuert, der Aufstand war erkannt worden, und zementiert, wie die Verhältnisse damals waren, konnte er nicht von der Schulbürokratie (die für die Verteilung dieser Zeitschrift an den Schulen Österreichs zuständig war) geduldet werden. Jene, die ihr Unverständnis zu einem Wert machten, würgten ab, was sie nicht verstehen konnten oder wollten (es war die Zeit des kalten Krieges und der Literatur-Diktatur), realistisch schreibende Autoren distanzierten sich irritiert, einmal, wie ich glaube, eigene anarchische Gelüste abwehrend, zum anderen in Sorge, ihr konventionskonformes Tun neu überdenken und vielleicht in Frage stellen zu müssen.
Nachdem die Einstiegsdroge bei mir ihre Wirkung entfaltet hatte, suchte und fand ich vereinzelt diese neuartigen Gedichte in alpha, Wort in der Zeit – 1959 erschien hosn rosn baa (Mundartgedichte von Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Gerhard Rühm) – und besuchte die wenigen Lesungen, die es damals gab.
Die besondere Nähe zu Jandls Gedichten und meine Sympathie für sie erkläre ich mir unter anderem mit seiner Beachtung trivialer Alltagserfahrung, seiner traurigen Lustigkeit, seiner Selbstironie, seinem Blick für Komik und für soziales Unrecht, eine Besonderheit unter den mit der Sprache als Material arbeitenden Autoren. Weder falsches noch echtes, gerechtfertigtes Pathos, das sehr wohl in diesem Klima der asketischen Strenge der Reduktion entstehen kann (wie in Eugen Gomringers exemplarischem Text „schweigen“, den ich für mich Anbetung der Stille nenne), haben eine Chance, wo Jandls anarchischer Witz wütet. Was treibt der Jandl der siebziger und achtziger Jahre (natürlich der „Jandl in meinem Kopf“)? Wieder das Themenspektrum erweitern – ich denke an Jandls spätere schonungslose selbstquälende Thematisierung von Krankheit, Behinderung, Schmerz und Tod. Etwas von dieser desillusionierenden Sicht ist viel früher schon zu sehen in dem Gedicht „lustig“, das in ein Verticken der Zeit übergeht. „was in der Zukunft geschieht, ist immer schon jetzt geschehen, und geschieht auch jetzt jetzt, denn jetzt ist schon immer die Zukunft von allem bisher gewesen, und so geht es immerzu weiter“, spricht Ernst Jandl. Und ich sage, lieber Ernst Jandl, bitte weiter so.
Elfriede Gerstl, TEXT + KRITIK, Heft 129, 1996
Was heißt hier Subjekt?
– Helmut Heißenbüttel, Ernst Jandl und das Verhältnis der österreichischen zur bundesdeutschen Nachkriegsavantgarde. –
In seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen aus dem Jahr 1963 zitiert Helmut Heißenbüttel aus einem Leserbrief, in dem der Schreiber sein Unverständnis angesichts des Gedichts „I Mann auf I Bank“ in Form eines Fragenkatalogs zum Ausdruck bringt:
Wieso ist das ein Gedicht? Wieso ist das überhaupt etwas, was den Anspruch erhebt, Literatur zu sein (und das tut es doch!) […] Daß Sie das lesende Publikum zu veräppeln beabsichtigen – wie einige meinen –, kann ich mir nicht denken, diese Erklärung kommt mir zu primitiv vor. [ÜL 136]
Helmut Heißenbüttel nützt diese symptomatischen Argumente, wie er sie nennt, um mit den Vorurteilen gegenüber nicht konventioneller Lyrik und den Missverständnissen, die sich aus der Begegnung mit solchen Texten ergeben, ins analytische Gericht zu gehen. Am Beispiel des Leserbriefs zeichnet Heißenbüttel in systematischer Manier die veralteten Kategorien bei der Beurteilung ästhetischer Gebilde nach – mit dem Ziel, normative klassische Poetiken als nicht mehr zeitgemäß zu erklären, mit völligem Recht natürlich.
Ernst Jandl hat mit diesem Gedicht Helmut Heißenbüttels jedoch eine ganz andere Erfahrung gemacht; eine Erfahrung, die er auch mit eigenen Gedichten machte. Am 7.10.1965 schreibt er an den für seine Karriere als Schriftsteller entscheidenden Vermittler, der ihm die Publikation seines bahnbrechenden Gedichtbandes Laut und Luise ein Jahr später im Walter Verlag ermöglichen wird, folgenden Brief:
Lieber Herr Heißenbüttel,
gestern gab es in der Neuen Galerie in Linz an der Donau, in der Ausstellung „Dada bis heute“ einen literarischen Abend […] Ich trug dabei dem Publikum (etwa 100) aus Ihrem Textbuch vier die Texte „Möven und Tauben auch“, „kam nachts es war kino und“, „1 Mann auf 1 Bank“ [sic], „zu rück rücken“ und „geh ich“ mit Vergnügen (meinem und der Zuhörer) vor. Wichtig schien mir, und das wirkte, die Pausen auszusparen, eher willkürlich (aber auch das wirkte aufs Publikum) war es wohl, alle „1“ in „1 Mann auf 1 Bank“ als „eins“ („ains“) zu sprechen (also: „eins Mann auf eins Bank, eins Zwieback“ etc.). Dies schienen mir Ihre Dada (und vielleicht auch mir) am nächsten stehenden Arbeiten.1
Reagierte das kaum vorhandene Publikum und ein Teil des Literaturbetriebs in den 1950er und 1960er Jahren oft mit Aggression und Unverständnis auf die Texte Jandls, Heißenbüttels und anderer, wenn es mit diesen in gedruckter Form konfrontiert wurde, so war die Einschätzung bei Lesungen weitaus positiver. Bereits frühe Reaktionen auf Lesungen Jandls in den 1950er Jahren bezeugen dies. So hob das oberösterreichische Tagblatt, „Zeitung des schaffenden Volkes in Stadt und Land“, in einem Artikel über eine Gruppenlesung mit Ernst Jandl im November 1957 dessen Originalität im Vortrag hervor:
Er brachte, in klar-lebendigem, persönlichkeitsbestimmtem Vortrag, zwei Arten seiner Gedichte. Solche, in denen er, entfernt irgendwie an Karl Kraus, an Peter Altenberg, auch an Morgenstern erinnernd, den Weg zurück geht vom geschwellten und gespreizten Wort, wie es in der lyrischen Bemühung der Zeit üblich geworden, zum einfachen, scheinbar kunstlos gesetzten, aber um so ursprünglicher und stärker wirkenden. Formungen entstehen da, die man etwa als Gedichte in Prosa bezeichnen könnte; sie alle durcheilt etwas wie eine elektrische Spannung, zumeist die Elektrizität der Ironie.
Resümierend stellt der Rezensent fest, dass Jandl, „ob man nun hinfand zu seiner Ungewöhnlichkeit oder nicht, wirklich zu fesseln“ wusste.2 Das Linzer Volksblatt äußerte sich über dieselbe Lesung, die unter dem Motto „Wort der Jungen“ stand, deutlich abfälliger, wenn der Rezensent auch nicht umhinkann, vom Erfolg der Lesung zu berichten:
Mit dem schallenden Gelächter, mit dem das großteils jugendliche Publikum gerade diese Zeilen quittierte [Zeilen, die der Rezensent misslungen fand, B. F.], bewies es, dass es ebenso wenig ernstzunehmen ist wie diese Art von ,Dichtkunst‘, die ihm hier geboten wurde.3
Der Soziologe und Dichter Gunter Falk beschrieb anlässlich einer Lesung Jandls im Grazer Forum Stadtpark, wie das Publikum „mit sichtlichem Genuß dem bewundernswert beherrschten, präzisen und artikulierten Vortrag Jandls folgte“.4
Zwischen der negativen und der positiven Aufnahme des Heißenbüttel-Gedichts liegt der Vortragskünstler Ernst Jandl, der sich nicht scheut, dieses Inventur-, dieses Alltagsgedicht zum Zwecke des effektvollen Vortrags zu seinem eigenen zu machen. Jandl erzielte durch die bewusste Interpretation des gedruckten Gedichts einen Effekt, an den der Verfasser wohl nicht gedacht hatte. Stand bei Heißenbüttel der reduzierte, lyrische Konventionen durchbrechende Text im Vordergrund, der eine alltägliche Beobachtung mit scheinbar unlyrischen Mitteln wiedergibt, so verfremdet Jandl das Gedicht, indem er über die Abweichung von der vermeintlichen poetischen Norm in Form der römischen I und die Aussparung von Verben noch hinausgeht, wodurch etwas Spielerisches, der Sprache von Kindern Ähnliches in das Gedicht hineinkommt. Er nimmt eine Änderung vor, die dem Leserbriefschreiber wohl auch gefallen hätte, monierte dieser doch:
Nichts ist unlyrischer und häßlicher und vor allem unverständlicher als die immer wiederkehrende – in einem wortmagischen Gebilde völlig aus dem Rahmen fallende – römische I. [ÜL 125]
Die jandlsche Vortragsversion interpretiert „I Mann auf I Bank“ als Gedicht mit dadaistischen Qualitäten, sowohl sinnauflösenden als auch lautlichen. Die Abweichung von der Sprachnorm im Vortrag erzeugt eine komische Wirkung. Im Vortrag Jandls kommt etwas hinzu, was im Widerspruch zum neutralen, aufzählenden Gestus des Gedichtes steht: die einmalige und unverwechselbare Subjektivität eines Sprechers und die Auflösung des in der Druckversion und in der Vorstellung erratischen ,Gegenstandes‘ „Mann“: „eins Mann auf eins Bank“.
Ob Jandl daran gedacht hat? „Ohne Nachdenken, so kann man etwas übertreibend sagen“, formulierte Heißenbüttel 1963 als Maxime dichterischer Arbeit,
läßt sich heute literarisch kein Satz mehr bilden. Erst nachdem ich durch reflektierende Beobachtung und Zersetzung den Regelkodex der Grammatik und das Widerspiel seiner Beziehungen ins Licht des Zweifels ziehe, finde ich wieder Lust zur Sprache. Zwar ist der Drang zum unreflektierten Sprechen groß und das Heimweh danach fast unausrottbar, in Wirklichkeit gelingt es nicht mehr. [ÜL 90]
Diese genau kalkulierten Sprachzerlegungen gehören zur Produktionsweise der konkreten Poesie. Im Nachlass Ernst Jandls findet sich eine ganze Reihe von Blättern, die das bezeugen. Allerdings, und das sei hier als Überzeugung formuliert, ist das Ergebnis umso besser, wenn sich zum sprachanalytischen Kalkül das Kalkül des Unkalkulierbaren gesellt; das heißt wenn das Ergebnis der Sprachanalyse – isolierte, nach Gruppen geordnete Wörter, nach permutativen und aleatorischen Prinzipien wiederholte Teile von Sätzen, Wörtern oder Lauten und Lautverbindungen – sich mit Fragen nach den Reaktionsmöglichkeiten der so gewonnenen Teile mit irgendeinem außen liegenden Ganzen verbindet. Wird dieses Ganze, als politische Absicht des Gedichtes etwa, oder als Statement zur Notwendigkeit konkreter Poesie, zum dominierenden Moment, dann ist das Ergebnis zumeist weniger überzeugend. Ist der Text hingegen offen für möglicherweise ganz anderes, wie Heißenbüttels von Jandl interpretiertes Gedicht, dann wirkt das Ergebnis auch nach 50 Jahren noch unverbraucht, uneingeholt von der inzwischen weiter gegangenen Evolution der literarischen Gattungen.
In welcher ,Wirklichkeit‘ gelingt etwas nicht mehr? In einer Wirklichkeit jedenfalls, die in vielen theoretischen Arbeiten der 1960er Jahre wenig Grund zum Lachen bot, einer Wirklichkeit, in der die Sprachlust durch Reflexion geläutert sein musste, in einer Wirklichkeit, in der der großen Masse der Verblendeten unterstellt wurde, in etwas zu leben, was „in Wirklichkeit“ gar nicht mehr gelingen kann. „Werch ein illtum“, um mit Jandl zu sprechen. Er war, was das Verhältnis der Theorie zur dichterischen Praxis anbelangte, immer weniger asketisch als andere, was ihn zeitweise in Distanz brachte zur strengen Lehre der Wiener Gruppe und zur Theorie ganz allgemein. Dass er sich nie auf eine ausschließliche Position festlegen ließ, hat ihn zu einem Verwandten – Jandl bezeichnet sich in einem Gedicht selbstironisch als deren „Onkel“ – der Wiener Gruppe gemacht. Trotz der freundschaftlichen Verbundenheit vor allem mit Gerhard Rühm wurde Jandls vielleicht explizitestes politisches Gedicht, das 1957 entstandene „deutsche gedicht“, „von Artmann und Rühm heftig abgelehnt. Ich vermute, es erschien Artmann und Rühm damals nicht statthaft, im Gedicht politisch zu sein; das verstieß offenbar gegen Vorstellungen von Reinheit der Kunst. Vorstellungen, die ich selbst nie gehabt hatte.“5 In Bezug auf Helmut Heißenbüttels Positionen Ende der 1960er Jahre zeigt sich noch eine andere Differenz: In einem Aufsatz über zwei auch für Jandl zentralen Gestalten in seiner Entwicklung als Schriftsteller, Gertrude Stein und Kurt Schwitters, schreibt Heißenbüttel 1969:
Wenn verachtete Wörter und der Schriftsprache für unwürdig gehaltene Schichten des Sprechens in die formalisierte Sprache vordringen, ja deren Deformalisierung bewirken, die zugleich Erstarrung von Überformalisierung zeigt, ist das nicht nur das Zeichen, sondern die Wahrheit über den Zustand, in dem die so noch Sprechenden sich befinden.6
Erkennen können den Zustand nur diejenigen, die „redend den Zustand des Redens zu erkennen“7 versuchen. Diese Arroganz der Eingeweihten in politischer und ästhetischer Hinsicht, Signum vieler Statements um 1968, fehlte Jandl. Er wollte mit seiner „heruntergekommenen Sprache“, einem armen Infinitivdeutsch, keineswegs den armseligen Zustand vorführen, in dem ein Großteil der Sprechenden oder auch eine überformalisierte Sprache sich befinden; er wollte im Gegenteil die Poesiefähigkeit auch einer heruntergekommenen Sprache unter Beweis stellen, ihre Fähigkeit, existenzielle Erfahrungen wie Krankheit oder Glaubenszweifel und ,hohe‘ dichterische Gegenstände wie die Liebe mittels einer einfachen Sprache anzusprechen.
Die Missachtung, die ein großer Teil des Publikums der experimentellen Literatur, weniger der avancierten Neuen Musik und den Entwicklungen in der Bildenden Kunst, in den 1950er und 1960er Jahren entgegenbrachte, führten bei Jandl nicht zum Rückzug auf eine exklusive Position, sondern verstärkten nur seinen Wunsch, für ein großes Publikum zu schreiben: In einem unveröffentlichten Entwurf zu einem Nachwort für den Band sprechblasen schreibt er vermutlich 1967 oder 1968:
für massen zu schreiben, potentiell, das schien mir, als versuch, immer der mühe wert; nie als held, nie als genie. Weder im politischen, noch im poetischen, sind solche nötig, ja auch nur erträglich: also fort damit.8
Der Exklusivitätscharakter einer Poetik mit hohem theoretischem Anspruch war ihm ebenso fremd wie der Habitus des literarischen Snobs oder Bohemiens. Jandl wollte Wirkung. Dahin zielt – und damit an der Richtung des Heißenbüttelschen Nachworts scharf vorbei – Jandls Dankbrief an Heißenbüttel nach Erscheinen von Laut und Luise:
Sie haben nicht nur das Risiko auf sich genommen, dieses Buch herauszubringen, sondern noch das größere Risiko, zu erklären, dass diese Gedichte Gedichte sind, was sie, wenn ich überhaupt eine Ahnung habe, was Gedichte sind, sind. (Etwas jedenfalls, bei dem Sprache so verwendet wird, dass man nicht das Gefühl hat, es sei nichts geschehen; oder so wollte ich es wenigstens. Etwas, bei dem man aus dem Sessel fährt.)9
Aus dem Sessel fahren sollten die Leserinnen und Leser in Helmut Heißenbüttels vermittelndem Nachwort gerade nicht, sie sollten sich vielmehr nach der ersten Erregung wieder setzen, um nachzudenken. (Damit soll der Einsatz Heißenbüttels für Jandls Werk nicht im Geringsten geschmälert werden, ohne seine Diplomatie wäre Laut und Luise wahrscheinlich nicht erschienen.)
(…)
Bernhard Fetz, in Hans-Edwin Friedrich/Sven Hanuschek (Hrsg.): „Reden über die Schwierigkeiten der Rede“. Das Werk Helmut Heißenbüttels, edition text + kritik 2011
Gegen E. J. und P. H.
schon lange wohnt der trotzende mops ernst
mit dem hilferufenden peter
im falfischbauch
der außenwelt
um unsere sprache
zu verwechsern,
während sie über den bodensee reiten
versuchen lauter nette leute
dem tormann die angst vor dem elfmeter zu nehmen,
falamaleikum,
viele teilnehmende personen
werden die heimat nicht fiedersehn,
ihr sprachdekadenzler,
ihr morbiden stilbanausen,
habt ihr es endlich geschafft,
der büchnerpreis war schon immer nicht viel wert.
Christoph Knorr
LAUT UND LUISE
In Erinnerung an Ernst Jandl
Luise ist laut.
Luise ist leise.
Luise ist lustig.
Luise ist still.
Luise denkt leckt mich
und tut, was sie will.
Uwe-Michael Gutzschhahn
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


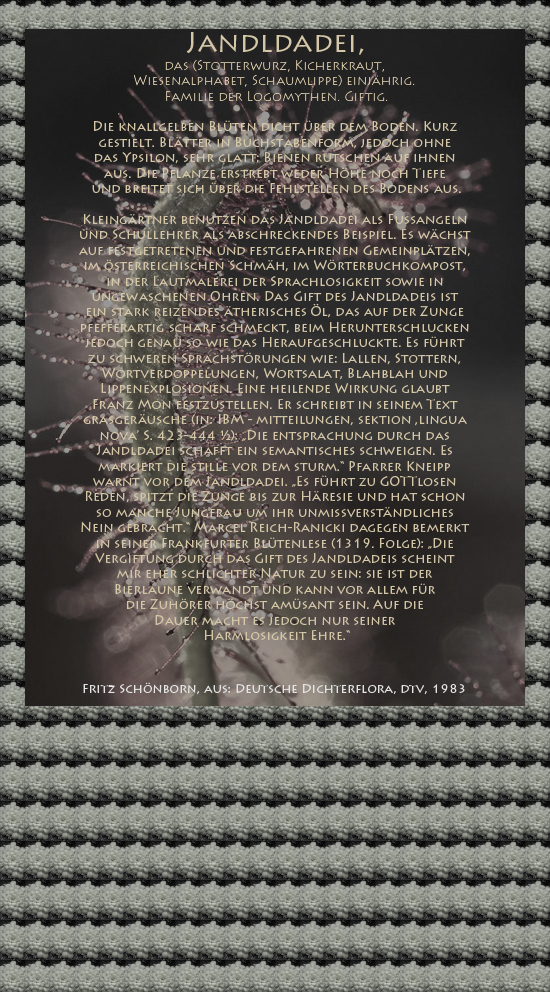












Schreibe einen Kommentar