Ernst Jandl: Letzte Gedichte
WIDMUNGSGEDICHT
der vater
ist tot
die mutter
ist tot
ich schreibe
daß der vater
tot ist
daß die mutter
tot ist
du
schreibst dann
daß ich
tot bin
Jandls letzte Gedichte
– Editorische Notiz. –
if it makes you happy,
why the hell are you so sad
Sheryl Crow
In der Zeit vor Jandls Tod wurde verstärkt wieder über einen Band mit neuen Gedichten von ihm gesprochen. 1996 war peter und die kuh erschienen, die letzte Veröffentlichung eines neuen Gedichtbands von Ernst Jandl. Allerdings verhinderten seine Lebensverhältnisse in den letzten Jahren ein kontinuierliches Arbeiten. Er wurde häufiger ins Krankenhaus eingewiesen, seine schlechter werdende Gesundheit zwang ihn zu längeren Pausen, dann zum Umzug in eine neue Wohnung. Was er zum Schreiben an Manuskripten in den unterschiedlichsten Fertigungsgraden benötigte, blieb in der alten Wohnung zurück – für jemanden wie Jandl, der auf festgefügte Ordnungen einen großen Wert legte, eine schwierige Situation. Dennoch: Das sporadisch immer wieder geführte Gespräch über einen neuen Gedichtband wurde fortgesetzt. Für die Tage nach Pfingsten 2000 war in Wien ein Treffen verabredet worden, um möglicherweise erste Manuskripte zu sichten, einen genauen Plan, mit welchen Arbeiten die Zeit ausgefüllt werden würde, gab es nicht. Vier Tage vor diesem Treffen, am 9. Juni, starb Ernst Jandl.
Während dieser vorbereitenden Gespräche war sich Jandl keineswegs sicher, ob er über ausreichend viele Gedichte für ein neues Buch verfügen würde. Wenn er schlechter Stimmung war, sprach er davon, daß er kein einziges neues Gedicht habe. Seit er sich in der neuen Wohnung (ab 1999) befände, darauf kam er in den Wochen vor seinem Tod öfter zu sprechen, sei seine Produktion vollkommen zum Erliegen gekommen, länger als jemals zuvor, seit er 1952 mit Schreiben begonnen hatte. Abschreckend wirkten diese hin und wieder formulierten Befürchtungen nicht: Bevor die Arbeiten an dem Band peter und die kuh begonnen hatten, warnte Jandl ebenfalls virtuos: Es gäbe nichts, und es würde sich nicht lohnen, mit der Suche nach neuen Manuskripten überhaupt zu beginnen. Bald stellte sich damals jedoch heraus, daß Jandl ein großes Reservoir an Gedichten besaß, weitaus größer, als man sich anzunehmen erlauben durfte, wenn man Jandls Warnungen in ihrem ganzen Ausmaß ernst genommen hätte. Nichts sprach also dagegen, daß er auch nach Erscheinen von peter und die kuh in den bei ihm zu beobachtenden zyklischen Auf- und Abschwüngen seine Arbeit fortgesetzt hatte. Es war sogar durchaus vorstellbar, daß es auch aus den Jahren vor Erscheinen von peter und die kuh noch Gedichte gab, die dem Herausgeber unbekannt geblieben sind und an die sich der Autor damals nicht erinnerte. Jandl hatte sich schon einige Zeit davor in einen Dichter verwandelt, der zwar Gedichte schrieb und den Gedanken an neue Gedichte nie aufgab, aber kein Bewußtsein mehr von seiner Produktion besaß.1
Ermutigend war, daß sich Jandl auf Gespräche über die Wünschbarkeit eines neuen Gedichtbands überhaupt einließ. Mit Gesprächen dieser Art hatte auch die Arbeit an peter und die kuh begonnen, lange bevor der Autor oder der Lektor und Herausgeber auch nur ein Manuskriptblatt in Händen hielt. Ob diese Gespräche Jandl – im Unterschied zu peter und die kuh – dazu gebracht haben, sich eine erste Grundlage für die Arbeit zu schaffen, indem er Material für dieses Buch zu sammeln begann, oder ob er herausfinden wollte, ob seine pessimistische Sicht die realistischere war, läßt sich nicht sagen. Jedenfalls fanden sich nach seinem Tod zwei Einschlagmappen unterschiedlicher Dicke gut sichtbar auf seinem Schreibtisch plaziert. In der einen Mappe befanden sich knapp 100 Blätter, vorwiegend mit Schreibmaschine hergestellte Typoskripte. Zuoberst lag ein mit Füller geschriebenes Manuskriptblatt, eines der wenigen Ausnahmen in diesem Ordner, das mit „gott ist rot“ begann und das in diesem Buch an vorletzter Stelle seinen Platz bekam. Diese Einschlagmappe aus weicher Pappe war oben rechts in Jandls üblicher Handschrift mit einem in Klammer gesetzten + gekennzeichnet. Jandl benutzte einen Bleistift dazu. Darunter lag eine um vieles schmalere Einschlagmappe mit 10 Typoskripten. Diese Mappe trug ebenfalls mit Bleistift geschrieben und in Klammer gesetzt ein –.
Wie gesagt: Es ist denkbar, daß Jandl sich mit einer Vorauswahl für ein neues Buch zu beschäftigen angefangen hatte oder (vorsichtiger gesagt) zumindest jenes Material zusammengetragen hat, das ihm eine Weiterarbeit an seinen Texten ermöglichen sollte. Er reagierte gerne auf Anlässe und Anregungen, und die Nachricht, daß die Sammlung Luchterhand neu gestartet werden würde und ein Band mit neuen Gedichten von ihm an erster Stelle stehen und die Reihe eröffnen könne, hatte ihm sehr zugesagt. – Die Mappe mit dem + wurde als Grundlage für diesen Band mit Letzten Gedichten genommen, allerdings konnte nur ein Teil der darin enthaltenen Manuskripte in diesem Band aufgenommen werden. Oben lagen jene Gedichte, deren Bearbeitung Jandl als abgeschlossen angesehen haben wird. Je weiter man in das Typoskriptkonvolut hineinblätterte, um so mehr stieß man auf Bruchstücke und Ansätze zu Gedichten.
Im Flur der Wohnung, die Jandl von 1974–1999 ununterbrochen bewohnte, fanden sich weitere Ordner und Mappen mit Manuskripten. Neben den Ordnern, die Jandl während der Arbeit an der ersten Werkausgabe von 1985 bereits angelegt hatte, fanden sich weitere Mappen. Diese Manuskripte wollte er nicht an das Österreichische Literaturarchiv überstellen, das seinen Nachlaß erworben und damit begonnen hatte, die erworbenen Materialien in das Archiv zu überstellen. Fünf Manuskriptsammlungen mit hauptsächlich lyrischem Material enthielten Gedichte für Jandls Letzte Gedichte:
- ein Leitz-Ordner mit Typoskripten, aus denen er gelegentlich vorlas, wenn er nicht nur auf erprobte Texte zurückgreifen, sondern Unbekanntes vortragen wollte
- ein Leitz-Ordner mit der Aufschrift „Zur weiteren Bearbeitung“
- zwei Flügelmappen ohne Beschriftung
- eine Flügelmappe mit Gedichten in Handschrift.
Die Ordnung in allen diesen verschiedenen Ordnern und Mappen ähnelte sich jeweils: Die meisten Texte hatte Jandl auf grobem, holzhaltigem Papier mit einer mechanischen Schreibmaschine getippt. Zwei Ordnungsprinzipien überschnitten sich: Die Typoskripte waren in eine grobe chronologische Reihenfolge gebracht. Die Typoskripte mit jüngerem Entstehungsdatum lagen zuoberst; daran schlossen sich einzelne Gedichte und Bruchstücke von Gedichten (mit zunehmenden handschriftlichen Zusätzen) aus erkennbar früheren Arbeitsphasen an. Gleichzeitig war Jandl bestrebt, die Gedichte, die er als fertig betrachtete, zuoberst zu legen und die unfertigen Gedichte nach hinten zu sortieren. In Einzelfällen befanden sich aber auch bereits publizierte Gedichte in ihren verschiedenen Typoskriptstadien in diesen Sammlungen.
Vor allem bei den beiden Leitz-Ordnern ließ sich erkennen, in welchem Umkreis viele der darin enthaltenen Manuskripte entstanden sein werden. Der erste Ordner barg auffallend viel Material aus den 80er und den späten 70er Jahren, das Eingang in den Band idyllen gefunden hat. In dem mit „Zur weiteren Bearbeitung“ gekennzeichneten Ordner fand sich Material, das sich den Gedichtbänden die bearbeitung der mütze und der gelbe hund zuordnen ließ. Allerdings waren auch wenige Texte aus viel früheren Arbeitsphasen in diesen Ordnern zu finden.
Entnommen wurden diesen Ordnern und Mappen die intakten Gedichte jüngeren Entstehungsdatums, die in keiner offensichtlichen Beziehung zu einem der Gedichtbände standen, die Jandl früher publiziert hatte (und die von ihm möglicherweise aussortiert waren) und die in den Umkreis jener Gedichte gehörten, die in der mit + markierten Mappe enthalten waren. Daraus ergab sich ein Konvolut von Gedichten, die in den Jahren 1990–1998 geschrieben wurden, die Mehrzahl in der ersten Hälfte der 90er Jahre. (Aufgenommen wurde kein Gedicht, das bei der Zusammenstellung von peter und die kuh schon bekannt gewesen wäre).
Dieser nun vorliegende Band kann als Gedichtband angesehen werden, der von ihm selber publiziert worden wäre. In diesem Buch sind die Gedichte Ernst Jandls versammelt, die er zuletzt geschrieben und noch nicht publiziert hatte, und dieser Band entspricht auch insofern seinen Intentionen, die er mit den meisten seiner Gedichtbände verband – ihn mit allen seinen literarischen Möglichkeiten zu zeigen, die er sich in den jeweiligen Jahren erarbeitet hatte.
Der Titel „Letzte Gedichte“ spielt darauf an, daß Jandl in vielen dieser Gedichte „letzte Dinge“ als Material benutzte und daß die offene und verdeckte Beschäftigung mit diesen Themen auch gewisse Rückwirkungen auf die Form der Gedichte hatte. Jandl ahnte, daß seine Zeit knapp werden würde, und dieses Gefühl hat ihn anscheinend in der Neigung bestärkt, sich kürzer zu fassen, kürzer häufig sogar, als er sich früher in seinen ohnehin prägnanten Versen sonst schon faßte.
Reihung und moderate Auswahl (aus Gründen der literarischen Tendenz des Buchs) hat wie seinerzeit bei dem Band peter und die kuh sein Lektor übernommen. Es gehörte zu der Aufgabenteilung zwischen Autor und Lektor, daß der eine für das Schreiben der Gedichte zuständig war, der andere sich mit den dann folgenden Aufgaben beschäftigte. Die Gedichte legten ihre Abfolge in diesem Band nahe: von kurzen Texten hin zu immer geräumigeren und umfangreicheren, von Versen, in denen von Frühling und Morgen die Rede ist, zu Sprachgebilden, die Abend- und Endstimmungen aufnehmen etc. Daß bei Formulierungen wie der vom „mißglückten tag“ auch an Jandls Todestag gedacht wurde und daß viele dieser Gedichte auf die Endlichkeit des Lebens reagieren bzw. als Reaktion darauf gelesen werden können, war eine der Überlegungen, die sich beim Nachdenken über eine mögliche Abfolge dieser Gedichte aufdrängte.
Am Ende sollte ein Gedicht aus den frühen 50er Jahren stehen. Damit wird nicht nur eine Eigenheit von Jandl aufgenommen, der bei der Zusammenstellung seiner Gedichtbände manchmal ein Gedicht aus früher Zeit mit Gedichten aus späteren Schreibphasen kombinierte („my own song“ z.B. in selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr), Mit dem Gedicht „das feuer“ schließt sich vor allem aber in zarten Andeutungen der Kreis zwischen Jandls späten Gedichten und seinem Anfang. In weit über 45 Jahren ist Jandl wie kein anderer viele Wege (darunter auch viele unbekannte Wege), die heute mit seinem Namen verbunden sind, gegangen. Er fühlte sich, wenn er an Gedichten schrieb, nichts als der Literatur verpflichtet und wollte deren Grenzen ausweiten. Einige Motive beschäftigten ihn dabei hartnäckig: Das Feuer als Bild gehört weniger dazu, aber sehr wohl eine Schönheit, die aus Gewalt und Vernichtung herrührt und bei Jandl mit einem Selbsthaß zu tun hat, der sich, obwohl Jandl unter Todesängsten litt, bis zu Selbstauslöschungsphantasien steigern kann. Zu den lebensfrohen Dichtern zählte Jandl nicht einmal bei seinem hoffnungsfrohen Beginn als Schriftsteller, und je mehr er in jene merkwürdige Dialektik verwickelt wurde, berühmt und immer berühmter zu werden, dabei aber gleichzeitig einsam und immer einsamer zu werden, um so weniger. Und damit ist man am Ende dieses Buchs auf Jandls Anfänge verwiesen und überraschend ebenso wieder in Zentrum seiner „letzten Gedichte“ angekommen.
Klaus Siblewski, Nachwort
In der Küche ist es kalt
Nein, Ernst Jandl hat sich in seinen letzten Jahren nicht zum Publizieren gedrängt. Das Alter erschien ihm nicht lustig, das Schreiben immer fragwürdiger, und auch der wachsende Ruhm konnte seine Depressionen nicht vertreiben. Für Handkes frohe Botschaft vom geglückten Tag hatte er nur die Umkehrung übrig:
ich beginne den mißglückten tag
Dennoch hing er am Tropf des Schreibens und hoffte inständig auf tägliche Produktion:
ein gedicht, ein einziges, kurzes gedicht
müßte doch
drin sein
Der aus gesundheitlichen Gründen erfolgte Umzug in eine neue Wohnung schnitt ihn, den Ordnungsliebenden, von den in Mappen und Ordnern abgelegten Materialien ab, die er zur Weiterarbeit benötigte. Dennoch fanden sich nach Jandls Tod zwei Mappen auf seinem Schreibtisch, die dickere mit einem eingeklammerten (+), die dünnere mit einem (–). Daraus und aus weiteren Mappen hat Klaus Siblewski einen Nachlaßband zusammengestellt. Jandls Letzte Gedichte sind also nach Titel, Auswahl und Komposition das Werk seines Lektors. Dennoch könne das Buch – so Siblewski – als Gedichtband angesehen werden, der vom Dichter selbst publiziert worden wäre.
Da sind immerhin Zweifel erlaubt. Schon bei dem Band peter und die kuh hatte es eine Arbeitsteilung gegeben, die Siblewski so definiert, „daß der eine für das Schreiben der Gedichte zuständig war, der andere sich mit den dann folgenden Aufgaben beschäftigte“. Man fragt sich, ob zu diesen Aufgaben auch die Aufnahme von Notizen und Vorstufen gehört – und sei es, um das Bändchen ein wenig aufzufüllen. Anders gewendet: Hätte man die vorhandenen Textvarianten nicht wenigstens kenntlich machen sollen? Ein Beispiel. „dann vielleicht“ und „letzte worte“ sind offenkundig solche Varianten. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in einer Zeile. Aus „lebt wohl ihr lebenden“ wird „lebt wohl ihr weiterlebenden“. Stünden beide Fassungen nebeneinander, könnte der Leser sich ein Urteil bilden und womöglich der etwas sentimentalen Wendung an die „Lebenden“ die nüchternere an die „Weiterlebenden“ vorziehen. Sie ist ja auch dezidiert „letzte worte“ überschrieben.
Nun ist – ein Jahr nach Jandls Tod – gewiß nicht das letzte Wort der Jandl-Philologie zu sprechen. Und jeder Jandl-Fan ist für einen Band dankbar, der neben dem Vorläufigen und Skizzenhaften auch etliche Texte bringt, die noch einmal die Klaue des Löwen zeigen. Die Texte demonstrieren den altersgrimmigen und depressiven Poeten auch als Meister des Kalauers.
Er brilliert in den „computer gedichten“, die vielleicht nur deshalb so heißen, weil eins davon so beginnt:
komm, puter, truthahn, oder komm, butter
Stark und ungeniert ist Jandl auch in der sarkastischen, wahrhaft ins Fleisch schneidenden Betrachtung hinfälliger Körperlichkeit, vorzugsweise der eigenen. Die besonders obszönen Motive vertraut er dem Englischen an. Was es mit dem „joystick“ auf sich hat, kann so über die Geschmacksgrenzen hinaus exerziert werden. Jandls besondere Sprachscham, die sich in der Exhibition versteckt, war schon immer sehr ausgeprägt, und dem späten Dichter mag sie als eines seiner Leiden erschienen sein. Denn dieser Wortzweifler war ein verzweifelter Wortgläubiger. Nur einem inbrünstig Liebenden kann diese lapidare wie phantastische Reihung von Schmähungen einfallen:
metaphernspucke
buchstabenklosett
lyrikklistier
speichelreim
reimspeichelkäse
metaphernatter
schamhaaranagramm
poesiephimose
speichelkäsegedicht
pentametervers
silbenschiss
wortabort
Wie eigen der „pentametervers“ daraus hervorleuchtet, als letzte Erinnerung an eine Poesie, die noch wahr und schön sein konnte.
Wo das Wort so umworben und bezweifelt wird, ist der Glaube nicht fern, in diesem Fall ein barocker Ton von Beichte und Bekenntnis. Manchmal versucht der Dichter es noch ein letztes Mal mit Psychologie und Analyse. „Ich klebe an gott“, heißt es da, und das Gedicht schließt mit der Selbstbezichtigung, er sei feige und unfähig, „willentlich unterzutauchen ins unausweichliche“. Aber dann kommandiert die Poesie. Liedstrophe und Reim, die alten Ausdrucksformen von Frömmigkeit, setzen sich gegen die Selbstverhärtung durch. Vielleicht das anrührendste unter den Letzten Gedichten trägt den Titel „katholisches gedicht“. Gewiß, es ist eine Melange von Ironie und Verzweiflung, doch es lebt von Hoffnung wider alle Hoffnung. Auch der frech-fromme Schluß:
ich scheiß auf die sonne und hätte
so gern einen strahlenden sohn
eh ich in die erde mich rette
zu gott, muttergottes, gott sohn
Dagegen kommt Jandls persönliche letzte Botschaft sehr diskret daher, als „widmungsgedicht“, gerichtet an die Gefährtin seines Lebens und Schreibens. In einfachen Zeilen hält er fest, daß er vom Tod des Vaters und vom Tod der Mutter geschrieben hat, und schließt – um die Trias zu vollenden:
du
schreibst dann
daß ich
tot bin
Friederike Mayröckers Requiem ist die Erfüllung dieses Wunsches oder Auftrages. Der erste dieser sechs Texte ist wenige Wochen nach Jandls Tod, im Juli 2000, geschrieben. Er ist ein Zeugnis von Trauer und Erschütterung, und berührt den Leser durch seine zarte Empirie. Die Autorin fixiert das Bild des Dichters auf Krankenlager, der die im Oberlichtfenster erscheinenden Flugzeuge zählt, und zeigt ihn auf dem Totenbett, „1 Zähnchen, in die Oberlippe eingebissen“.
Aber der Leser soll auch den lebenden Jandl im Gedächtnis behalten, und so lesen wir eine Szene aus dem Winter 88, aus der unbeheizbaren Nordküche von Jandls Wohnung. Beim Suchen nach Manuskripten zieht die Freundin und Kollegin diesen Vierzeiler hervor:
In der Küche ist es kalt
ist jetzt strenger winter halt
mütterchen steht nicht am herd
und mich fröstelt wie ein pferd
Im Juni 2000, drei Tage vor Jandls Tod, schreibt Mayröcker dazu diese Kontrafaktur:
in der Küche stehn wir beide
rühren in dem leeren Topf
schauen aus dem Fenster beide
haben 2 Gedicht im Kopf
Dieses eine Gedicht, und die lebenslange Suche danach, ist nicht das einzige, das Ernst Jandl und Friederike Mayröcker verband. Das sie immer noch verbindet.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.6.2001
„Suche unsterbliche Seele. Zahle Höchstpreis“
– Aus einem Band mit Ernst Jandls jüngsten Texten sind nun die Letzten Gedichte geworden. –
„Jandl wollte wieder Gedichte veröffentlichen“, lesen wir im Klappentext, „und die Vorstellung, daß mit seinem Buch die neue Sammlung Luchterhand gestartet werden sollte, beflügelte ihn. Er unterstützte immer Bemühungen, Gedichte in preisgünstigen Ausgaben zugänglich zu machen. Aus dem geplanten Band mit neuen Gedichten ist nach seinem Tod“ – am 9. Juni des vergangenen Jahres – „nun die Veröffentlichung seiner Letzten Gedichte geworden“.
Der österreichische Autor wusste jedoch – schon seit Jahren – um seinen schlechten Gesundheitszustand, und so spielt in seine jüngsten Gedichte, die durch den Zugriff des Todes zu seinen letzten werden sollten, fast zwangsläufig die Vorahnung des Sterbens hinein und legt eine ganze Reihe seiner Texte auf dieses Thema fest. Gleich im ersten Poem, das sich in vereinzelten Druckzeilen über mehrere Druckseiten erstreckt, lesen wir:
suche unsterbliche seele; zahle höchstpreis
Einige der einschlägigen Poemata lesen sich ganz direkt und unmittelbar als lyrischer Reflex auf die Krankheitsgeschichte:
vibramycin
ob dieses medi-
kament und al-
kohol
einander aus-
schlössen
er meine wein;
nicht un-
bedingt
sagte mit
einem jä-
hen glanz im blick
der arzt, doch sie schlös-
sen
einander nicht unbedingt ein
Andere erfassen den krankheitsgesteuerten Alltag, den Gang zum Briefkasten zum Beispiel, oder apostrophieren ganz direkt das nahende Sterben:
letzte worte
und was wirst du dann sagen?
lebt wohl, ihr lebenden…
das heißt, wenn jemand bei mir ist
werde ich das vielleicht sagen
Einbezogen in diese Vorahnung des Todes sind Reflexe auf das Schreiben von Gedichten – so etwa:
ein gedicht, ein einziges, kurzes gedicht
müßte doch
drin sein
an diesem tag
heute, freitag
der 22.
februar
oder wenigstens
ein paar zeilen
konservierbar
für morgen
einen besseren
tag vielleicht
oder wenigstens
ein wort
ein einziges
einzelnes
wort (…)
Es handelt sich jedoch um keine herkömmliche Ich-Lyrik, sondern, wie schon in den letzten Buchpublikationen Jandls zu beobachten war, um den Versuch, eben diese Verse, die ganz unmittelbar aus dem Erleben zu kommen scheinen, durch Ableitungen aus dem literarischen Experiment neu aufzuladen und damit einem allzu dichten Lebensnexus zu entwinden. Folgerichtig heißt es deshalb unter dem Titel „leben und schreiben“:
was ich schreibe
ist nicht mein schicksal
was ich schreibe liegt außerhalb
meiner kreatürlichen existenz
mein schicksal kann davon zehren
was ich schreibe
und es kann ebenso
daran zerren
aber keine zeile wird am humbug
meines lebens verrotten
kein werk mein leben krönen
Jeder Text dieser Sammlung hat seine eigene formale Struktur; es kommt zu keinen Reim- oder Strophenschemata, die sich gleichen – so hat man den Eindruck einer größtmöglichen Vielfalt. Verfolgt man diese Perspektive durch die Summe der insgesamt siebenundneunzig Texte, die uns hier als Letzte Gedichte gegenübertreten, registriert man diverse Formen grammatikalischer Dekomposition, serieller Wiederholungen mit Variation, Wortverfremdungen, sub- bzw. surrealistischer Dialekt-Notationen etc. Von den kürzesten Gedichten mit zwei und drei Zeilen spannt sich der Bogen zu längeren Gedichten mit oft mehreren Strophen – und gelegentlich sind sogar kleine thematische Zyklen-Bildungen zu beobachten: so etwa zu Stichworten wie „sehen und hören“, „ohren“ oder „katholische reminiszenzen“, unter denen man auf folgende Verse stößt:
ich klebe an gott dem allmächtigen vater
schöpfer des himmels und aller verderbnis
und an seinem in diese scheiße hineingeborenen sohn
der zu sein ich selber mich wähne (…)
Der Englischlehrer, der Jandl über viele Jahre seines Lebens war, ehe er sich als Autor freisetzte, vergegenwärtigt sich in vier englischen Poems, aus denen wir unter anderem erfahren:
i still get letters asking me for readings;
i have them framed and put them on the wall
Hierher gehören auch fünf ausdrücklich als solche ausgewiesene „computergedichte“, die dem Leser signalisieren, dass der Autor sozusagen bis in seine letzten Lebensstunden nach Innovationen und Neuerungen im Bereich der Literatur Ausschau gehalten hat.
Ich schließe meinen Reflex auf Jandls Letzte Gedichte mit einem Hinweis auf „wahnsinniges gedicht“, das in seiner Art noch einmal über alles Gedruckte hinausweist, indem es den Horizont für das Nicht-Gesagte – für immer im Kopf des Dichters Verschlossene – und mit ihm zu Grabe Getragene öffnet.
weder durch flüstern, sprechen, schreien
heulen, tränen spritzen
noch spucken, schlucken, husten, kotzen
die nase schneuzen, in der nase bohren
ohrenausblasen, ohrenschmalz entfernen
sei es bislang aus seinem Kopf herausgekommen und je in die Form von Schrift gelangt:
es fraß ihm das gehirn auf;
wahnsinn dankt
Karl Riha, Frankfurter Rundschau, 18.9.2001
Ernst Jandls Letzte Gedichte sind erschienen
– 94 an der Zahl und doch nicht die Letzten. –
Letzte Gedichte, die Ernst Jandl vor seinem Tod im vorigen Jahr verfasst hat, wurden am Mittwoch in Berlin präsentiert. In den letzten beiden Lebensjahren Jandls, als er schon von Krankheit gezeichnet war, soll er immer wieder gesagt haben, es gebe „nichts Neues“ von ihm, er schreibe keine Gedichte, erinnert sich der Verlagsleiter von Luchterhand, Gerald J. Trageiser.
Als er den Künstler mit der Überlegung unterbreitete, die alte Sammlung Luchterhand mit neuen Taschenbüchern und vor allem Werken Jandls zu eröffnen, soll dieser aber doch sehr erfreut darüber gewesen sein und neue Werke produziert haben. Jandl wies den Verlag kurz vor seinem Tod darauf hin, dass sich in seinen drei Wiener Wohnungen vielleicht doch noch etwas finden lasse. Dort lagen auf Jandls Schreibtisch mehrere Dutzend neuer Gedichte in drei Mappen mit Hinweisen: „Zu veröffentlichen“, „vielleicht zu veröffentlichen“ und „zu veröffentlichen in meinem Nachlass“. Aus den ersten beiden Mappen sind letztlich 94 Gedichte im neuesten Band erschienen, für 2002 ist freilich Weiteres angekündigt.
Jandls Anliegen war es, seine Bücher auch in preisgünstigen Ausgaben anzubieten. So hatte er etwa ein Heftchen mit seinen Werken in Lizenz bei Reclam herausgebracht. Luchterhand war aber sein Stammverlag geblieben. Nun wird die von Otto F. Walter gegründete Sammlung Luchterhand neu aufgelegt: Jandl eröffnet sie mit seinen Gedichten und der Buchnummer „2001“.
APA, der Standart, 29.3.2001
Der schriftliche Tod
– Zwei Bücher über und Letzte Gedichte von Ernst Jandl. –
„Autobiographie unterscheidet sich von Biographie vorwiegend durch zweierlei“, schrieb Ernst Jandl in dem Aufsatz „Autobiographie und Literatur mit autobiographischen Zügen“:
durch die unterschiedliche Distanz vom beschriebenen Gegenstand und durch die Kenntnis vom physischen Ende desselben, seinem Tod, der als vollendetes Ereignis für Autobiographie unerreichbar bleibt.
Ernst Jandls Tod ist seit dem 9. Juni 2000 zum vollendeten und beschreibbaren Ereignis geworden, er selbst konnte sich dem nur – gewissermaßen im Futur II – asymptotisch annähern:
der vater
ist tot
die mutter
ist tot
ich schreibe
daß der vater
tot ist
daß die mutter
tot ist
du
schreibst dann
daß ich
tot bin
Da die Sprache seit der Erfindung der Schrift vom Sprecher ablösbar geworden, also nicht mehr an das sterbliche Ich gebunden ist, kann dieser Text mit einem anderen kommunizieren, in dem die erwartete Vergangenheit zur vergangenen Zukunft geworden ist:
zugestandenermaßen, an jenem Tag zu Mittag den dampfenden Strunk Karfiol mir ins Maul gestopft und heruntergeschluckt, sage ich ihm, statt dir beizustehen, stopfe mir 1 BUNCH Buschen Sträußchen Karfiol ins Maul (,Heißhunger‘ / ,Hungerschmerz‘), nämlich um die Mittagsstunde. Da hatte er noch 6 Stunden zu leben…
Drei Bücher, auf denen Jandl groß vorne draufsteht, sind seit seinem Tod erschienen. Der neue Gedichtband, aus dem das zitierte Gedicht stammt, war noch zu Jandls Lebzeiten geplant, erschien aber nun postum als Letzte Gedichte in der wieder eingerichteten Sammlung Luchterhand. Der zweite Text ist dem Requiem für Ernst Jandl von Friederike Mayröcker entnommen. Bereits letztes Jahr erschien der sehr schön gestaltete biographische Bildband a komma punkt ernst jandl – Ein Leben in Texten und Bildern von Jandls Lektor Klaus Siblewski. Das Buch beruht auf einer Ausstellung im Münchner Literaturhaus und sollte eigentlich den 75. Geburtstag des Autors ehren, den dieser nicht mehr erlebte.
Jandl selbst hat sich ja stets dagegen gewehrt, eine Autobiographie zu verfassen, und wollte seine Texte auch nicht autobiographisch gelesen wissen, auch wenn in ihnen besonders seit den achtziger Jahren verstärkt vom Ich bzw. meistens in der dritten Person von ihm die Rede war. „Daß niemals / er schreiben werde / seine autobiographie“ – schrieb er vor zwanzig Jahren in selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr – „daß aber niemals / er zögern werde / in den dreck zu fassen // um herauszuziehen / was vielleicht / einen stoff abgäbe // für poesie / seinen widerlichen / lebenszweck“. Sein Leben war ihm also Material – übrigens schon in den sprachspielenden experimentellen Texten, was sich etwa am Namen seiner Mutter im Titel des Bandes Laut und Luise als Indiz ablesen läßt, so daß der Leser sich mit der Person (oder mit der Figur) Ernst Jandl vertraut fühlte. So ist es jedenfalls schön, in dem biographischen Materialienband auf die Suche gehen zu können, etwa nach der früh verstorbenen Luise Jandl, die ebenfalls Gedichte schrieb und deren schwärmerischer Katholizismus auch Jandls letzten Gedichten noch Reibungsfläche bietet. Es gibt großartige Fundstücke, wie Jandls erste Gedichtpublikation (mit zwölf Jahren), die mit den bezeichnenden Versen „Ist die schönste Welt / Ein Trümmerfeld“ endet, und sein erstes Buch, ein in englischer Kriegsgefangenschaft handgeschriebenes Wörterbuch Englisch/Deutsch, ein früher Höhepunkt seiner formal-materialen Spracharbeit sozusagen. Neben dieser Wortliste finden sich eine ganze Reihe anderer Listen, Namenslisten für den Versand von Büchern, Gedichtlisten für Lesungen etc. – profane Verwandte von Jandls poetischen Listen, von denen noch die Rede sein wird.
Überhaupt laden diese drei sehr verschiedenen Bücher dazu ein, nach Berührungsstellen zu suchen. „Und was wirst du dann sagen? / lebt wohl, ihr lebenden… / nämlich, wenn jemand bei mir ist / werde ich das / dann vielleicht / sagen“, heißt es bei Jandl. Und bei Mayröcker: „Auf welcher Handynummer wirst du dann erreichbar sein, sagt er, wenn es soweit ist.“ Zur Beziehung Mayröcker/Jandl muß wohl nicht viel gesagt werden, sie ist bereits Legende (und nachzulesen z.B. in einem eigenen Kapitel in a komma punkt). Jedenfalls muß man sich wohl ihr Bündnis als ein so enges vorstellen, daß sie niemals gemeinsam wohnen konnten. Der schmale Band Requiem für Ernst Jandl stimmt auf nur 45 Seiten eine äußerst intensive und vielschichtige Klage des Verlustes an, was nicht zuletzt durch die Unterschiedlichkeit der gesammelten Texte gelingt: zwei Prosatexte, zwei Gedichte, zwei Texte zu Gedichten Jandls und ein Antwortgedicht. Die beiden zentralen Prosamonologe sind unmittelbar nach Jandls Tod entstanden und sprechen zu jeweils einem Dritten über ihn. Die sprechende Stimme präsentiert sich als eine, die sich durch die Rede wieder konstituieren muß, die sich selbst, und das heißt vor allem: ihre Sprache, verloren hat:
am Tag nach deiner Beerdigung in die Zunge gebissen, ja die Zunge fast abgebissen, das Blut fließe ihr aus dem Munde…
Sie muß sich und ihre Erinnerungen, Assoziationen und Fragen wieder zusammenfügen zum Fluß der Rede:
Bin reißend daß ich so reißend bin wie dieser Fluß und mich segeln lassend dahin, treiben lassend, mit den Wellen und schlehenfarben, die Stille das Rauschen der Stille, während wir saßen am Ufer und hielten unsere Hände…
Was dabei an die Oberfläche gespült wird sind vor allem winzige Details, die bedeutsam werden, wie jenes „Zähnchen“, das unter der zugenähten toten Oberlippe sichtbar war.
Trotz – oder vielleicht wegen – ihrer gerade auch literarischen Vertrautheit miteinander waren die Texte Mayröckers und Jandls in den meisten Fällen sehr verschiedenartig, gegenpolig geradezu. Es gab aber auch Schnittstellen, und eine davon findet sich in den beiden Gedichten Jandls, auf die sich die Paraphrase und die Lektüretexte beziehen: „die Identifikation mit der Kreatur“. Im zärtlichen Umgang mit den Gedichten, „ottos mops“, dem wohl berühmtesten, und einem Vierzeiler mit „erbarmungswürdig fröstelndem pferd“ läßt sich der Dialog mit dem Autor aufrecht erhalten, und das Buch wird so zu einem Anti-Requiem, denn requiem aeternam, ewige Ruhe, ist einem Schriftsteller eben gerade nicht zu wünschen, vielmehr langes Leben für seine Sprache.
Ob seine dichterische Sprache noch am Leben sei, darüber schien Jandl in seinen letzten Lebensjahren selbst im Zweifel gewesen zu sein. Schon bei dem vorherigen Band peter und die kuh berichtete Klaus Siblewski, wie er gemeinsam mit dem Autor nach Manuskripten suchen mußte, wobei jener bestritt, daß es überhaupt welche gebe. Jandl habe, so Siblewski, kein Bewußtsein mehr von seiner Produktion besessen, denn Texte waren reichlich vorhanden. So ergriff auch bei dem neuen Band der Lektor die Initiative, wobei er diesmal auf weniger Widerstand stieß. Das geplante Treffen kam zwar nicht mehr zustande, aber es fand sich auf Jandls Schreibtisch eine Manuskriptmappe, die die Grundlage für Letzte Gedichte bildete. Siblewski traf daraus und noch aus anderen Ordnern und Mappen mit Arbeiten offenbar neueren Datums eine Auswahl, so daß er die konkrete Gestalt des Bandes zumindest mitzuverantworten hat. Zu den weggelassenen Texten läßt sich leider nichts sagen, bei den ausgewählten irritieren Kleinigkeiten: So handelt es sich bei „hört sich schon an die tür kommen“ allem Anschein nach um eine Vorversion von „nach hause kommen“ aus idyllen und bei „dann vielleicht“ und „letzte worte“ werden zwei fast identische Gedichte abgedruckt, mit einigen Seiten Abstand, also offenbar auch nicht mit kontrastierender Absicht. Darüber hinaus gibt es noch wenige vereinzelte Gedichte, deren Aufnahme mir fragwürdig erscheint, aber das soll natürlich den Dank an den Herausgeber nicht mindern, die Gedichte überhaupt zugänglich gemacht zu haben.
Der Zweifel, ob die eigene Sprache noch vorhanden sei, findet sich auch in den Gedichten. Gleich auf den ersten Seiten wird einer ekelhaft rufenden Taube das ekelhaft schweigende lyrische Ich gegenübergestellt, und später heißt es in einer Goethe-Kontrafaktur:
wozu besitze ich
noch eine stimme
noch finger die
ein wort hinschreiben können
ich habe keinen ruf
ich schreibe keinen brief
die vöglein im walde erklingen
Nun ist der wortreiche Sprachzweifel ein bekanntes und traditionsreiches Paradox. Auffällig ist hier die Rückgebundenheit an den zentralen Bezugspunkt des Gedichtbandes: den Körper und seinen Verfall. Sprache ist hier nicht als Phänomen des Geistes dem Körper gegenübergestellt, sondern sie braucht diesen als Sprech- und Schreiborgan – so daß sogar die geistlose, aber vitalere Kreatur als die wortmächtigere erscheint. Viele von Jandls früheren Gedichten, vor allem die Laut- und Sprechgedichte, können ja nur durch den Körper leben, durch die Artikulation, das Öffnen und Schließen des Mundes.
War also der Körper in der Sprache stets präsent, wird es nun dessen Verfall:
END OF SPEAKER
i’m really grateful, i might say: to god
that this my dirty mouth, including lips
teeth, tongue, gums, larynx, vocal cords
is all that broken, rotten, frayed, decayed, whatever,
that it will never say another word
…
Auch andere Themenkreise werden im Maßstab des Körpers ausgemessen. Die nackten aneinandergepreßten Körper in „nackt“ scheinen erst das Bild einer phantasmatischen Glücksverheißung, des irdischen Paradieses zu sein und sind dann doch ein „gaskammerschnappschuß“. In der „menschlichen figur von vorn“ ist die Geschichte des Erwachsenwerdens bereits anatomisch vorgezeichnet:
der nabel
ist einzig
der fuß
ist doppelt
Einige Gedichte beschäftigen sich mit der körperlichen Bedingtheit von Wahrnehmung, der Abhängigkeit des Sinns von der Sinnlichkeit und der Frage, wie die große Welt – ein Elefant etwa – überhaupt durch die kleinen Augen nach innen kommen kann. Der Körper wird so zu einem pulsierenden Organ, das aufnimmt und abgibt und in diesem Vermittlungsprozeß seine Welt, seine Sprache konstituiert, sofern es denn gelingt:
weder durch flüstern, sprechen, schreien,
heulen, tränen spritzen
noch spucken, schlucken, husten, kotzen
die nase schneuzen, in der nase bohren
ohrenausblasen, ohrenschmalz entfernen
ist es aus seinem Impf herausgekommen
je in die form von schrift gelangt;
es fraß ihm das gehirn auf;
wahnsinn dankt
Sprachlichkeit, und das heißt hier konkret das Schreiben von Gedichten, ist also unerläßlich zur Selbsterhaltung, was das Paradox des Verzweifelns an der Sprache bei andauernder Produktion durch die wiederkehrende Forderung des „da setz dich hin / da schreib dein gedicht“ zu erklären vermag. Es entfaltet sich dabei der Prozeß des Sich-Fixierens und Sich-Verlierens, der die Spannung dessen ausmacht, was man entsprechend des oben zitierten Jandl-Aufsatzes „Literatur mit autobiographischen Zügen“ nennen könnte: Das, was einer schreibt, kann – invers zum traditionellen Autobiographieverständnis – zu einem Teil seines Lebens, zu seiner Selbstdefinition werden. Es ist aber gleichzeitig als Literatur immer Allgemeines, Unpersönliches. Die Depression des Gedichtes ist nicht die Depression des Autors, auch wenn sie die gleichen klinischen Symptome zeigt. In einem bedeutenden Fall entspricht die Dialektik von Allgemeinem und Individuellem dem Phänomen selbst: Der Tod ist dem einzelnen nur als allgemeiner, d.h. als fremder, zugänglich – bekanntlich sterben immer nur die Anderen –, aber nur als der eigene ist er von existentieller Bedeutung. Mit den Zeilen „du / schreibst dann / daß ich / tot bin“ katapultiert sich das Ich des Gedichtes mit einem simplen Trick in sein eigenes Jenseits – ein Kunststück, auf das biographische Ichs bestenfalls hoffen dürfen.
„Was ich schreibe liegt außerhalb / meiner kreatürlichen existenz“. Im Gegensatz zur gesprochenen Sprache, die des Sprechorgans bedarf, ist die Schrift vom Körper ablösbar, somit nicht von dessen Sterblichkeit angekränkelt. Eine mögliche Beschreibung der verbindenden Tendenz von Jandls späten Gedichten wäre vielleicht die Hinwendung zur Schriftlichkeit, die mit der Thematisierung des körperlichen Verfalls einhergeht. Während Jandls Laut- und Sprechgedichte die gesprochene Sprache auf die elementare Ebene der Laute reduzierten, erscheint hier Schriftlichkeit zu ihren basalen Strukturen skelettiert. Die ältesten überlieferten schriftlichen Zeugnisse waren Listen von Waren, Lagerbestände von Kaufleuten. Viele von den Gedichten sind oder enthalten Aufzählungen, Listen von dem, was geblieben oder verlorengegangen ist – oder inventarisieren die Verkommenheit der Sprache selbst: „metaphernspucke / buchstabenklosett / lyrikklistier…“ Andere Gedichte sind wie Notate, die als kurze Mitteilung auf den Küchentisch gelegt werden oder als Gedächtnisstütze dienen. In „end of a speaker“ sind es banale Mitteilungen, Briefe mit nicht mehr erfüllbaren Lesungswünschen, die gerahmt an der Wand das Verstummen des Lesenden überdauern:
i still get letters asking me for readings;
i have ehern framed and put them on the wall.
Die Schrift gewährt so ein kleines Stück virtuelle Transzendenz, Befreiung von der Sterblichkeit. Allerdings um den Preis, daß sie immer schon tot ist oder sogar tötet, wie etwa jenen Käfer, der eben noch munter krabbelte und dann dem „zertretenen gedicht“ den Titel gab. Dennoch, wie es bei Friederike Mayröcker heißt:
Wir halten uns an die Schrift, weil, ein anderes Geländer haben wir nicht, schreibt Thomas Kling…
Das Ringen mit den letzten Dingen prägt also die meisten der Letzten Gedichte sowohl thematisch wie formal. Allerdings soll hier nicht der falsche Eindruck erweckt werden, daß es nicht auch anderes gäbe, leichtfüßig Verspieltes, unbeschwert Witziges – allem Anschein nach zumindest:
DER HELLSEHER
sage mir
wie du heißt
und ich sage dir
wer du bist
gib zu
daß du lebst
und ich werde dir
beweisen
daß es stimmt
Alexander Frank, neue deutsche literatur, Heft 538, Juli/August 2001
Existenzielle Obszönität
– Ein Blick auf Ernst Jandls spätere Lyrik. –
Ein Mann uriniert; die Fülle seines Bauchs verhindert ihm den freien Draufblick auf sein Glied; zwar fühlt er das Entweichen des Harns; aber wohin der strömt, wer kann das wissen… Das ist Poesie; die Poesie derer, die zur Immanenz verurteilt sind und darunter leiden; die sich an der Jämmerlichkeit der Metaphysik rächen mit der Penetranz des Banalen; Jandl also.
Das Gedicht, „computergedicht nr. 4“, stammt aus Jandls letztem Band, den posthumen Letzten Gedichten (2001), und weist auch sonst viel Jandl-Typik auf:
komm, puter, truthahn, oder
komm, butter, kuhkäse, alles
so freßbar, amerikanisch wie
antik. der antiquar ein paar
haare aus seinem schlitz zieht
auf seinem kopf indes kaum noch
was wächst. wechselt der tyrann
zum augenlosen, weil so füllig
der bauch davor steht, er immer
noch fühlt das entweichen der
flüssigkeit, aber wohin es strömt
aus seiner blase, wer
könnte das wissen…
1
Jandls Obszönität ist existenziell; sein Beharren auf der Thematik des Unterleibs kommt vor allem aus der Wut darüber, dass der Kopf nichts taugt; der kopfferne Unterleib mit seinen geistfernen vegetativen Funktionen der Ausscheidungs- und Geschlechtstätigkeit ist der geeignetste Schauplatz für die wütende Feier von Jandls Anti-Humanismus („unterleib o unterleib“, so beginnt das „computergedicht nr. 3“); die metaphysisch und ästhetisch unversorgte Banalität des Körpers richtet Jandl hoch auf gegen alle Zumutungen eines Humanismus, der sich anmaßt, den Menschen heilen oder retten zu können. Nicht, dass Jandl Heilung/Rettung nicht gebraucht hätte, aber alle Heilslehren haben sich historisch und biographisch in einem Maße als unbrauchbar erwiesen, dass sie nur, wie es dem frustrierten Humanisten zusteht, durch aggressiven Anti-Humanismus abzugelten waren; die Apathie einer nihilistischen Haltung hätte da nicht gereicht. Was Jandl in den humanisten (1976) ein Stück lang durchexerziert hat, lässt sich auch in fast jedem seiner Gedichte nachweisen: die lustvoll-aggressive Demontage unseres Humanismus; sie ist so schmerzvoll wie die Gottverlassenheit. Jandls persönlichste Not ist zugleich seine politischste: Er gehörte zu einer Generation, die noch hautnah erlebte, dass die gesammelte Schlagkraft der abendländischen Humanprogramme (von der griechischen Demokratie über das Christentum, die bürgerliche Aufklärung bis zum Sozialismus) nicht ausreichte, um Hitler und Holocaust zu verhindern. Das entblößte die Wirklichkeit des Menschen auf obszöne Weise. Zu dieser heillos entblößten Wirklichkeit gehört gewiss auch die Obszönität des nackten Unterleibs in Jandls Gedicht; der Skandal an der Blöße ist aber die Unbrauchbarkeit der Kleidung.
Jandls Obszönität steigerte sich mit dem Altern, d.h. mit dem physischen Verfall, der seine metaphysische Untröstbarkeit immer unausweichlicher klarmachte. Aber selbst die Obszönität aus der Frühzeit der Sprachspiele mit ihrer Beimengung an „unbeschwertem“ Männerwitz liest sich aus Spätsicht leichter auch als Kulturkritik:
runzte ber
kin den übel
kin den übel
aaaaaaaaaaarunzte ber
aaaaaaaaaaarunzte ber
dach nem okitus
dach nem okitus
aaaaaaaaaaarunzte ber
aaaaaaaaaaarunzte ber
o natur
o natur
aaaaaaaaaaakin den übel
runzte ber
Die romantische Emphase („o natur“), mit der das vulgäre Geschehen (in den Kübel brunzte er nach dem Koitus) als Natur gefeiert wird, ist Kulturverhöhnung, Verhöhnung der ästhetisch-philosophischen Rechtfertigungspraktiken für die krude Wirklichkeit. Die Provokation läuft auch lautlich, über den fröhlich obszönen Ton der ausgetauschten Anfangsbuchstaben.
2
Es gibt sehr viel Sekundärliteratur über Jandls Experimentalpoesie der 60er und 70er Jahre (von Laut und Luise, 1966, bis etwa dingfest, 1973). Jandl selbst hat sich über seine Sprachexperimente ziemlich häufig theoretisch geäußert, am ausführlichsten und eingehendsten in den „Mitteilungen aus der literarischen Praxis“, 1974, und in seinen Frankfurter Poesie-Vorlesungen 1984.
Nach den Frankfurter Vorlesungen gibt es kaum mehr poetologische Selbstäußerungen Jandls. Die Theorie ging ihm wohl auch deswegen aus, weil seine „konkrete Poesie“ einfach theorietauglicher und theoriebedürftiger war, als was dann folgte (ohne dass es einen wirklichen Bruch in seinem Schaffen gab). Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die germanistische Sekundärliteratur sich mit dem frühen Jandl mehr beschäftigt als mit dem späten. Das wiederum ist für diesen Aufsatz ein Grund, sich mehr um Jandls depressives Spätwerk zu kümmern, zumal sich seine Haltungen und Formungen ohne Mühe bis ins Frühwerk zurückverfolgen lassen. Das Thema des Aufsatzes ist Jandls verzweifelte (und vergebliche) Enthumanisierung seiner Poesie.
Eine tiefe kulturelle Frustration liegt wohl schon seinen „konkreten“ Ansätzen zugrunde, auch wenn sie sich an der Oberfläche als die optimistische Botschaft von der immerwährenden Innovation präsentieren, von der Poesie als Einübung ins Ungewohnte; zumindest unterliegt Jandls Schreiben der Gewissheit, dass man als Autor nach dem Krieg nicht einfach im alten Poesiejargon weiter reden könne, als ob nichts geschehen wäre. Erst mit der radikalen Änderung der Redeweise hat man die politische Katastrophe auch als kulturelle begriffen. Die Spuren der politischen (= humanitären) Katastrophe finden sich im Übrigen auch inhaltlich unvermindert bis in seine spätesten Gedichte. Vor allem im Band peter und die kuh, 1996, verdichtet sich die Abrechnung mit der Vergangenheit. In einem der härtesten Gedichte führt Jandl die Katastrophe der eigenen Existenz über die familiäre auf die politische Katastrophe zurück:
hättet ihr auf eure lust verzichtet
nichts an meinen plagen hätte stattgefunden
und ihr wolltet mich sogar erziehen
fortsetzung eurer erzeugungslust
der durch euch entfachte mensch
jeder kann sich als mich und mich als sich bezeichnen
hervorgegangen aus dem vater-und-mutter-spiel
aller vorfahren, deren säbel geschliffen, pistolen geladen waren
und die stricke gedreht für die hälser ihrer brut
und die heil hitler schrien und das kaiserlied sangen
fahnen schwangen und atombomben ausbrüteten
was kann ich tun für euch, als harten fußes
auf eure gräber treten und drum beten
daß diese kraft, die euch zerstäubt hat
nie wieder aus euch leben, form und geist schafft.
1969 hat Jandl die Dichtkunst als „fortwährende Realisation von Freiheit“ verkündet: 20 Jahre später, in den Idyllen, 1989, lautet eine Gedichtzeile programmatisch: „ich bin frei und mir ist schlecht“. Das etwa beschreibt Jandls Entwicklung. Jeder Wohllaut verliert seine Berechtigung, wenn’s innen knirscht und kracht.
Rückblickend kann man Jandls zahlreiche Sprachexperimente als Instrumentierung eines kulturellen Widerredens schlechthin auffassen; wenn der Sprachbrei der Politiker, der Medien und der Tenor der Kultur das eine Reden ist, dann sind Jandls Gedichte das ganz andere Reden. Die Störung der Rede erwies sich immer deutlicher als Folge einer Störung der Existenz. Kaum ein Kulturschaffender hat in Österreich (abgesehen von der Wiener Gruppe und ihrer radikalen Anti-Kultur) der Kultur ihre Formen so konsequent verweigert wie Jandl.
3
Zurück zum „computergedicht nr. 4“: Eine Beleidigung für die Sinn-Wirtschaft unserer Kultur ist allein schon die Methode, mit der Jandl seine Themen aufbringt und weiterbewegt. Sie folgen weder der Schlüssigkeit eines Gedankengangs, noch fügen sie sich in einen allgemeinen Zusammenhang der Dinge, sondern entwickeln sich hier und oft über die (zufällige) Assonanz ihrer Bezeichnungen. Wahrheitsfindung läuft übers Ohr, eine weitere Entmachtung des Geists. (In den Letzten Gedichten gehört eine ganze Gedichtserie dem Ohr.) Aber es ist egal, wo man beginnt und wie man fortsetzt, Jandls abschüssige Poesie landet sowieso ganz unten, wo der Mensch Tier ist und Schmutz macht.
Jandl also hat sich mit den Ohren zum Gedicht gesetzt, er spielt mit der Lautung des Worts „Computer“ und kommt zu lauter „freßbarem“ (Pute und Butter). Der Truthahn offensichtlich kommt ihm „amerikanisch“ vor; und ab jetzt regiert der Vokal a: Am „antik“ ist „amerikanisch“ wohl mitschuld; das „antik“ sicher am „antiquar“ und dessen betonte Schlusssilbe „-quar“ an „paar“ und am „haar“. Und sobald für die Haare der Hosenschlitz geöffnet ist, läuft’s von selbst, wir sind unten angekommen beim Thema. Vom haarlosen Kopf geht’s zum augenlosen Tyrannen (Ödipus-Assoziation? „gemiedenen“, ein wüstes Gedicht aus dem Band die bearbeitung der mütze, 1978, endet mit den Selbstvernichtungszeilen:
ein ich nichti-nichti
nimmer-meere
so augenlose ich solle ich sein. Oi
dübuuus…
KLUMM!);
die Blindheit des Tyrannen hat hier aber banalere Ursachen: Der Bauch hindert ihn daran zu sehen, wohin er ausrinnt. Auch der Thementransport von der Glatze zum blinden Tyrannen erfolgte assonantisch: „wächst“ – „wechselt“.
Jandl kurvt akustisch durch mindestens ein halbes Dutzend Zufallsthemen, bis die Schwerkraft seiner Verfassung das Gedicht verlässlich dorthin zieht, wo Gedichte nicht mehr kulturüblich sind. Jandls Notdurftpoesie entwickelt die grimmige Lust, den approbierten geistigen Zusammenhängen in die Fugen zu scheißen. Die Lust kommt wohl daher, dass, was zusammenhängt, sich für Jandl im besseren Fall als nutzlos, im schlechteren als mörderisch erwies.
In Thematik und Methodik ist das Gedicht durchaus exemplarisch. Auch darin: dass anstelle der großen Fragen und Antworten das Banale zu existenzieller, existenzumfassender und manchmal existenzbedrohender Monstrosität anschwillt. Die Schlussfrage des Gedichts, „wer könnte das wissen…“, ist in ihrem philosophischen Tonfall der Lächerlichkeit ihres Inhalts (Schwierigkeiten beim Wasserlassen) völlig unangemessen. Mag die Frage auch Hohn gegen den Tonfall von Daseinsfragen überhaupt sein, sie erhebt jedenfalls auch die Banalität selbst zur Daseinsfrage; dafür spricht ein Vergleich mit vielen anderen Gedichten.
Schließlich zeigt das Gedicht ansatzweise, was in anderen Gedichten durchgehenderes Formprinzip ist: Poetizität als Verhöhnung der Poesie. Jandl verwendet gerne traditionelle Lyrismen (Reim, Rhythmus, Wortschatz, Wortstellung), gerade weil er zeigen will, dass der zur Verfügung stehende Stoff die ästhetische Harmonisierung durch den Wohllaut der poetischen Sprache nicht verträgt. Es gibt keine Wirklichkeit, die sprachlich zu heilen ist. Poetizität enthält in unserem Gedicht vor allem die in Gedichten übliche Umstellung der Satzglieder: „der antiquar ein paar haare aus seinem schlitz zieht“; „er immer noch fühlt das entweichen der flüssigkeit“. Dazu später mehr.
Bisweilen führt Jandl sein Misstrauen gegen die poetische Form bis zu ihrer völligen Verweigerung; dann stehen die Banalitäten ungefällig und roh da. Ein kleines Beispiel aus peter und die kuh, 1996:
ungewaschen
lege ich die kleidung
des vortags an
Kein Geist, keine Seele, keine Menschheit, keine Botschaft, kein Wohlklang, kaum Form (nur der Zeilenbruch): bloß eine etwas unappetitliche Notiz aus dem Alltag, intellektuell und ästhetisch völlig vernachlässigt. So will’s Jandl: der Wirklichkeit ihren ästhetischen Schutz entziehen. Man muss schon von den gewaltigen ideellen und formalen Zurüstungen gängiger Lyrik auf dieses Textchen herüberschauen, um sich freuen zu können an seiner unbehandelten Gestalt. So klein es ist, so gründlich ist sein Kulturprotest.
4
Der Körper dient bei Jandl vor allem dem Dementi des Geists. Um sich gegen eine Herkunft „von oben“ zu verwahren, macht Jandl den Unterleib nicht nur zum Thema seiner Poesie, sondern auch zu ihrer Produktionsstätte. In den Letzten Gedichten gibt es ein „ejakuliertes werk“, auch eine Sammlung von 13 Poetik-Komposita, deren Zweitteil in sieben Fällen aus dem Unterleibsvokabular stammt: „buchstabenklosett“, „lyrikklistier“, „metaphernafter“, „poesiephimose“, „schamhaaranagramm“, „silbenschiß“, „wortabort“. Anti-Poesie: Jandl lässt seine Poesie den Unterleibsöffnungen entquellen, dort sind sie sicher vor Schönheit, Seele und Sinn, den großen Kulturlügen. Ausdrücklich geschissen oder gefurzt werden Gedichte vor allem in peter und die kuh. Und wo Jandl den Mund als Öffnung für Poesie zulässt, wird diese oft gespuckt oder gespieen („metaphernspucke“, „speichelreim“), oder sie hat ihre Schönheit schon vorher im Kehlkopf oder an den Stimmbändern eingebüßt. Zwei Gedichte aus peter und die kuh titelt Jandl „verstimmtes gedicht“, um den existenziellen Misston als poetischen laut werden zu lassen.
Das „verkrustete gedicht“ aus demselben Band lautet:
der klang des teufels
hat mich benutzt. wissen sie
was das heißt? ich habe mich
verkutzt, ja verkutzt, und ich
ersticke fast daran.
woran, fragen sie.
einfach an diesem, ja
einfach an diesem
verkrusteten gedicht,
hilfe! scheiße! hoppla!
Gedichte sind Brocken, Kotzbrocken („verkutzen“ kommt von „kotzen“); nicht mehr zu singen/flöten/deklamieren, sondern zu erbrechen; phonetisch ein Würge- und Hustgeräusch; ein „verkrustetes“ Unding, nicht geglättet, mundschlüpfrig gemacht durch Verhältnismäßigkeit, Eingängigkeit und Gefälligkeit, sondern formlos wie von außerhalb der Poesie. Grob brechen die außerpoetischen, ungeformten Ausrufe der letzten Zeile – Hilferuf, Fluch und endliches Erbrechen („hoppla!“) – ab, was am Gedicht Poesie gewesen sein mag. Der Dichter ist nicht das mächtige abendländische Ich mit dem freien Willen und der sinntönenden Stimme, sondern die zum Zischen, Knurren, Knirschen genötigte Kreatur, deren vegetativen Geräuschen ihrer Notdurft wir lauschen.
Vielleicht ist nicht ausreichend bekannt, wie früh, ausgereift und wütig Jandl das eigene Dichten (an das er gleichwohl buchstäblich sein leben hängte: „poesie / sein widerlicher / lebenszweck“) als unappetitliche Sache von Körpersäften verfluchte. 1977, „kleinere ansprache an ein größeres publikum“: Der „beschissene kopf“ werde die Gedichte zu den Schreibhänden „hinunterspucken, alphabetische klümpchen, lexikalischen schleim, und an jedem solchen dreck wird ganz klein ein blutiges sein, eine rote spur von dem dreckigen ich, dieses schändliche stümperwerk, auf dessen ausräumung und beförderung in den müll er sein leben lang wartet.“ Jandls Menschenbild funktioniert mit erhöhter Verlässlichkeit als Selbstbild: den Geist zum Körper degradieren, den Körper hassen.
5
„zwei brustwarzen stehen mir zur verfügung / verdammt noch mal ich brauch sie nicht“. Jandl hasst seinen Körper (meistens und zunehmend). Er ist das primäre und peinigendste Erfahrungsfeld seiner Selbstentfremdung. Wir haben längst eine komplette lyrische Körpergeografie Jandls, buchstäblich von Kopf bis Fuß. Die schonungslose Entblößung aller Körperteile ist schon als Geste sowohl Humanismus-Verweigerung als auch Auto-Aggression.
Humanismus-Verweigerung:
THEMEN
die großen
themen
kommen
mit den tiefen
einsichten
mein rechter
daumen
wenn ich ihn ansehe
fordert mich
zum arzt
schon lange
es geht
von ihm
was weg
Das tiefe Sinnen des abendländischen Denkers tastet nach dem geradezu mystischen Wesen der Dinge; die ahnungsvolle Betrachtung gilt dem eigenen Daumen, dem Geheimnisträger und Geheimniskünder. Ergebnis der Betrachtung: Seinem Aussehen nach gehörte er wohl einmal medizinisch behandelt. Das ist die Verhöhnung des Tiefsinns durch die Banalität von Körperzuständen. Jandl selbst sagte zum Gedicht (in der Dankrede zur Verleihung des Mülheimer Dramatikerpreises 1980):
Daumen, Bananen – ihnen eignet die rechte Größe und Form zur Darstellung des Schönen. Banales – kenne ich nicht. Außer vielleicht: die großen Themen (…), die tiefen Einsichten.
Das Wunder des menschlichen Körpers weist nicht auf Gott, sondern zum Arzt. (Die Assonanz von „Wunder“ und „Wunde“ blieb von Jandl natürlich nicht ungenützt: „du wunder mensch, verwundetes mirakel“, heißt es in seinem Gedicht „die scheißmaschine“.)
Auto-Aggression:
DIE HÄNDE
unschmuck erscheinet die haut, wo die schäbige
kleidung sie sichtbar läßt für den sich ohne
spiegel beschauenden, das ist fürwahr
an den händen, aus deren fleckigen
verrunzelten rücken bläulich die adern
pressen ohne druck, bis heran an die
arschlochjucker, die nasenstierer, die
onanistenbräute; dann dreh die beiden
auf die verkackte wahrsageseite und
spuck, was dir an speichel geblieben ist im
ausgetrockneten säufermaule, auf die wundmale
herrn jesu christi
Auch die Hände gehören zum Arzt („fleckig“, „verrunzelt“, bläuliche Adern ohne Druck). Was formal als dieselbe Kulturverhöhnung beginnt wie im letzten Gedicht (mit dem hohen Ton eines ehrwürdigen Kulturhabitus: „unschmuck“, „erscheinet“, „fürwahr“), endet in blanker Wut gegen die buchstäblich gottverlassene Verfassung des Körpers. Der erste Wutanfall überkommt den Autor, als er bei der Betrachtung seiner Finger angelangt ist: „die arschjucker, die nasenstierer, die onanistenbräute“, eine Beschimpfung, die die Finger ausschließlich im tabuisierten Dienst an den Ausscheidungs- und Geschlechtsorganen fixiert. Einmal in Wut geredet, wird der Indikativ des Gedichts zum Imperativ: Hände auf die Innenseite drehen und hineinspucken! Die Beschimpfung der Innenseite holt sich Jandl wieder aus dem Unterleib („verkackt“); beschissen wird die Gier des Menschen, Physisches zu transphysischer Bedeutung zu heben (also Kultur zu machen): „wahrsageseite“ spielt auf die Ausdeutbarkeit der „Lebenslinien“ an. Dasselbe Muster (körperlicher Unflat gegen geistige Höhenflüge) funktioniert gleich ein zweites Mal und als Höhepunkt: Spucke auf die Wundmale Christi. Diese Blasphemie ist enttäuschte Heilserwartung, wie alle Blasphemien Jandls.
Christi Opfertod war umsonst oder erlogen. Der Gang des Gedichts ist für Jandl exemplarisch: vom Körperteil zur Existenz, die verflucht wird, weil sie nicht über den Körper hinausgeht, dessen Verfluchung dann also wieder existenziell ist.
Wenn man einkalkuliert, wie oft Jandl das Dichten als Scheißen und Spucken apostrophiert hat, dann lässt sich das Anscheißen/Anspucken der Handinnenfläche im Gedicht poetologisch interpretieren: Dichten als Bescheißen/Bespucken der Metaphysik.
In anderen Beispielen treibt Jandl die Aggression gegen den eigenen Körper bis zum Abhacken der Gliedmaßen:
DIE BEINE
so, jetzt wollen wir einmal
deine beine messen.
wie alt sind diese?
zusammen 126 jahre.
und wieviel wiegen sie?
es mag an dieser axt liegen
daß ich sie noch nie
vom rumpf gebracht.
ringsum das blut
zeugt vom bemühen.
In „morgenstund“ liegen Arme, Beine, Finger und Augen im Zimmer herum.
6
Jandls Menschenbild ist die „scheißmaschine“. Auch dieses Bild findet sich schon früh (1971: „daliegen / sich anscheißen / (…) / und in himmel kommen“) und häuft sich später. Das demoliert das Bild des Menschen als Kulturwesen.
Diese Demolierung vollzieht Jandl lustvoll an denen, die als Geistesgrößen unserer Kultur gefeiert werden.
Jeden Versuch, ein die anderen überragendes Menschenbild zu entwerfen, in der Kunst, in der Politik oder sonstwo, vermag der Autor nur mit einer Grimasse zu quittieren. Im übrigen richtet er, mit einer von ihm selbst verlachten Inständigkeit, seinen aussichtslosen Wunsch nach dem täglichen Gedicht an das ihn umschließende Nichts.
Das ist das Ende von Jandls Begleitkommentar für seinen Gedichtband der gelbe hund, 1980.
Jandl hat einige phantasievoll erbarmungslose Goethe-Zerstörungen vorgenommen (vor allem in den Bänden der künstliche baum, 1970, und die bearbeitung der mütze, 1978). In Goethe findet Jandl eine Art Antipoden. Der ästhetisch wie moralisch hochgerüstete Ordnungssinn des nachitalienischen Goethe reizte Jandl dazu, am Lehn- und Lehrstuhl des Meisters zu sägen, ob seinen Lippen beim Sturz nicht doch ein unklassischer Laut entfährt. (Das Verhältnis Jandls zu Goethe wäre einmal eine umfangreichere Untersuchung wert.)
Ein Kapitel in Jandls Demontageprogramm könnte heißen „Der gewöhnliche Dichter“, nach seinem frühen Zyklus (aus den 70ern) „der gewöhnliche rilke“, in dem er das Genie-Format des Autors und den Genie-Kult seiner Verehrer mit blanken Banalitäten unterläuft (z.B. „rilkes schuh“: „rilkes schuh / war einer / von zweien // jeder schuh rilkes / war einer / von zweien // rilke in schuhen / trug immer / zwei / / wade an wade / stand rilke / aus den beiden schuhen heraus“).
Das letzte Beispiel von Klassikerbanalisierungen, „computergedicht nr. 2“, richtet sich gegen die griechische Lyrikerin Sappho:
saffo oder sapfo, zapfo
jeder spreche wie er will
der poetin edlen namen
nicht zu schüchtern, nicht zu schrill
tief verbeuge jeder sich
vor ihr, die nicht wein nicht bier
und schon gar nicht whiskey süffelt
allenfalls noch PAGO schnüffelt
während ihrer verse tosen
still durchwässert ihre hosen
Umfassende Jandlsche Denkmalschändung:
Erstens geht’s von jeder Höhe bergab zum Unterleib.
Zweitens die schon erwähnte Materialisierung (Entgeistung) des Redezusammenhangs auf seine phonetischen Assoziationen: Jandls Reime stehen unter dringendem Verdacht, die inhaltliche Gedankenflucht zu fördern oder gar verantworten zu müssen. Die merkwürdige Wendung von der Verehrung der Dichterin („tief verbeuge jeder sich / vor ihr“) zu ihren Trinkgewohnheiten könnte zumindest dadurch begünstigt sein, dass „bier“ einen Binnenreim zu „ihr“ abgibt. Den Verdacht, dass nicht der Inhalt das Reimwort erzwingt, sondern bloß die Akustik, durfte man schon beim Reimwort „schrill“ haben (denn wie käme man sonst auf die Idee, den Namen der Dichterin schrill auszusprechen, wenn „schrill“ sich nicht auf „will“ reimte?). Mit dem Reimwort „bier“ haben wir wohl auch die Erhabenheit der Antike verlassen, so dass „whiskey“ und „PAGO“ nunmehr ganz leicht von den profan gewordenen Lippen des Autors gehen. Da macht auch schon das despektierliche „süffelt“ Spaß und zieht mühelos das unsinnige „schnüffelt“ nach sich. – Schon die Anfangszeile beginnt die Demontage der Dichterin übers Phonetische. Gegenüber Sapphos Bedeutung ist die Aussprache ihres Namens ein läppisches Akzidens (die „gewöhnliche Sappho“!), Dass man das unkorrekte „saffo“ (statt „sapfo“) thematisiert, ist schon unwichtig genug. Aber kein Mensch sagt „zapfo“, weil es für das z gar keine Veranlassung gibt. Das ist allein Jandls böses Mundwerk, das Sapphos Namen mit dem Anklang an den deutschen „Zapfen“ herabwürdigen will.
Drittens: Eine fast durchgehende Methode Jandls zur Entpoetisierung der Poesie ist der Missbrauch ihrer Mittel. Außer dem Reim findet sich im Gedicht an sarkastisch eingesetzten Formen traditioneller Poesie noch der vorangestellte „poetische“ Genitiv („der poetin edlen namen“, „ihrer verse tosen“), der imperativisch eingesetzte elitäre Konjunktiv („jeder spreche“, „tief verbeuge jeder sich“) und die trochäische Rhythmisierung des Texts.
All dieser Wohlklang unterläuft seine eigene Berechtigung. Jandls Banalisierungen unserer Kulturgrößen sind nicht Attentate auf poetische RivalInnen, sondern Attentate auf unsere Kultur.
7
Jandls aggressive (und auto-aggressive!) Enthumanisierung: Derselbe Vorgang, in dem Jandl den Geist auf den Bauch rückstuft, wiederholt sich in der Rückstufung des Menschen auf das Tier und in der Rückstufung der Sprache auf das Geräusch oder außerkulturelle Äußerungsformen.
Die komprimierteste poetologische Selbstäußerung Jandls ist der schon anzitierte Begleitkommentar zum Gedichtband der gelbe hund, 1980. Darin heißt es:
Die Gedichte halten, was der Titel verspricht: die menschliche Dimension als Maßstab für die Welt ist ohne Gültigkeit. Sprache und Thematik dieser Gedichte bewegen sich demgemäß in Bodennähe, der Kopf reicht nicht höher nach oben als der des Lammes, des Hundes, der Amsel im Gras. Nichts bleibt an Gedankenflug außer logischen Sprüngen und Rissen, ein Verwerfen des als normal erachteten Denkens.
Tatsächlich brachte Jandl das Wort Mensch ohne Tiernamen kaum mehr über die Lippen: Ratte, Schwein, Hund, Gnu… Die zentrale Strophe aus dem großen Gedicht ,,1000 jahre ÖSTERREICH“ lautet:
zwei tiere reichten aus, maskulin feminin, um ineinander
steckend, schwitzend keuchend schreiend oder geräusch vermeidend
einen neuen menschen zu schweinen: mich, ERNST JANDL.
Die Bestialisierung des Menschen endet und beginnt mit der Selbstbestialisierung. Subjekt („tiere“), Prädikat („schweinen“) und die adverbialen Bestimmungen („ineinander steckend“…) sind animalisch; dass in solcher Grammatik ein „neuer mensch“ produziert wird, ist wohl Ironie. Die traditionellen Kulturtröstungen kassiert Jandl eine Strophe weiter als „eierfromme seligkeit“, deren Verkündigung aus den bekannten Körperlöchern erfolgt:
die eierfromme seligkeit der bestie mensch
die beschissenen erschütterungen seiner fortpflanzungen
könnte er nicht ein krokodil sein ein schakal ein skorpion? er ist es
und aus seinen löchern fahren engel auf
Menschenlos (bisweilen sogar ichlos) also wünscht Jandl sich die Welt, ausdrücklich die Natur. Sie ist ja der populärste Schlupfwinkel des Humanums, Sanatorium und Exekutivbüro des deutschen Geistes zugleich. Deswegen:
DAS SCHÖNE BILD
spar aus dem schönen bild den menschen aus
damit die tränen du, die jeder mensch verlangt
aussparen kannst; spar jede spur von menschen aus:
kein weg erinnere an festen gang, kein feld an brot
kein wald an haus und schrank, kein stein an wand
kein quell an trank, kein teich kein see kein meer
an schwimmer, boote, ruder, segel, seefahrt
kein fels an kletternde, kein wölkchen
an gegen wetter kämpfende, kein himmelsstück
an aufblick, flugzeug, raumschiff – nichts
erinnere an etwas; außer weiß an weiß
schwarz an schwarz, rot an rot, gerade an gerade
rund an rund;
so wird meine seele gesund.
Das Humanformat der Natur als Ursache von Jandls Erkrankung; ihre Enthumanisierung bis zur Bedeutungsfreiheit (rot = rot, rund = rund…) als Voraussetzung für seine Gesundung. Die Verwandlung von Natur in Kultur, Jandl möchte sie aufheben, zumindest wenn Kultur so aussieht wie unsere. Aber das ist Utopie. Vorläufig mobilisiert Jandl seinen ganzen Schatz an Negativassoziationen gegen die Humanverklärung der Natur:
DIE GRÜNE PEST
verdrossen grunzt das sonnenschwein
der erdball sollt verbrennet sein
die grüne pest des grases frißt
noch jeden der mensch gewesen ist
und henker der baum zeigt hinauf hinauf
da knüpf an mein ast und dein hals dich auf
das lichte schalt ab und den tag tu weg
in die ohren gefüllt ist der vogeldreck
Das homöopathische Themeninventar der Naturpoesie – Sonne, Gras, Baum, Vogelsang – wird gewendet: Die Sonne, jetzt ein Schwein, will die Erde verbrennen; das Gras, jetzt grüne Pest, begräbt uns noch alle unter ihrer Narbe, der Baum, ein Henker, lädt uns ein zum Selbstmord an seinen Ästen, und der Vogelsang ist Dreck, der uns die Ohren verklebt. Am besten: abschalten. – Und die infantilisierre Sprache unterschreitet die Standards der Naturpoesie von der Form her.
8
Jandl selbst erklärte, dass die feste Form vorgefundener oder selbst erfundener Sprachmuster seine lyrische Produktion wesentlich stimulierte. Zugleich wurden sie bei ihm nur dann zum Stimulans, wenn sie subkulturelles Format hatten: Die „konkrete Poesie“ materialisierte die geistige Substanz der Sprache zu Lautbild und Schriftbild; die „heruntergekommene sprache“ unterlief die grammatikalischen Normen; Kindersprache infantilisierte die intellektuellen Ansprüche; Ausflüge in schizophrenes Sprachverhalten (Jandl bewunderte Ernst Herbeck und widmete ihm sein „schizophrenes“ Gedicht „das kalb“) waren Ausflüge in ein kulturell nicht approbiertes Gebiet; ebenso die volkstümlichen Gstanzln mit der Vulgarität ihres Inhalts und ihrem Dialekt. Gemeinsames Sprechmotiv ist die Verweigerung einer intakten Kultursprache nach dem Verlust einer intakten Kultur. Ein letztes Mal Jandls Begleittext zum gelben hund:
Auf der Basis der Alltagssprache übt sich der Autor in der Kunst des Ausgleitens, Hinfälligkeit demonstrierend durch die gewaltsame Verformung auf der Wort- und Satzebene. Angesichts der Fehlerhaftigkeit des menschlichen Lebens wird der sprachliche Fehler zum Kunstmittel gemacht, analog zu den Störungen und Zerstörungen in Musik, Plastik und Malerei. Die Unscheinbarkeit der eigenen Person und Existenz verbindet den Autor mit nahezu allen gleichzeitig Lebenden. Das macht ihn sicher, verstanden zu werden, gerade auch dann, wenn er sich selbst, seine dürftige Rolle jetzt, die kläglichen Reste seiner Vergangenheit und sein Beharren auf der Unmöglichkeit von Zukunft in seine Gedichte mit aufnimmt.
Jandls sprachliche Verfahren sind viel beschrieben und gut geklärt. Mehr lohnt daher vielleicht der Hinweis auf Jandls Selbstzweifel gegenüber seinen Sprachverfahren. Sie heben sich durchaus ab von seinem allgemeinen Misstrauen gegen Poesie, Teil seines Kulturmisstrauens. In den Letzten Gedichten findet sich ein „kind gedicht“:
auch das wie ein kind gedicht
allsdann wird wackellicht, auch das
wie ein schizophren gedicht wird
allsdann wackellicht. So werden all
allsdann gedicht balld-mal wackel-
licht, meins, deins, seins, ihrs,
unsrs, eurs, theirs. irr-licht.
Alle Gedichte werden wackelig, d.h. unverlässliche, labile Orientierungsgrößen (als ,,-licht“), egal ob sie in Infantil- oder in Schizophrenensprache ihre Gegenpoesie entworfen haben. Die altertümliche Endung „-icht“ (statt „-ig“) ermöglicht nicht nur den wichtigen Reim auf „gedicht“, sondern phonetisch die Herstellung des Leitbegriffs „Licht“, man braucht nur das l davor zu verdoppeln: „wackellicht“. Die neue Endung macht aus dem Adjektiv ein Substantiv, das Wackel-Licht, wie es in der Worttrennung Zeile 5/6 auch bestätigt wird; endgültig dann in der Variation am Schluss: „irrlicht“. „irr-licht“ als Irrlicht ist ein Licht, das in die Irre führt: Gedichte also sind irreführende Äußerungen (was etwa der Bedeutung von Wackellicht entspricht). In der Getrenntschreibung „irr-licht“ ist das Gedicht außerdem lesbar als „irres Licht“ (Anklang an oder Wiederaufnahme des „schizophren gedicht“). Gedichte sind also irreführend und/oder geistgestört. Beides entspricht Jandls Poetologie.
Der Weg zum Leitbegriff „irr-licht“ ist wieder ein phonetischer. Zunächst ist die Aufzählung der Possessivpronomen in den beiden Schlusszeilen eine Verstärkung der Behauptung, dass tatsächlich alle Gedichte („all“ findet sich auch in „allsdann“ und vielleicht in „balld-mal“) die genannte doppelte Labilität haben, meine, deine usw. Die (umgangssprachlich) korrekte Bildung des Possessivpronomens („meins, deins, seins“) verformt sich allerdings über „ihrs“ bis zu den unmöglichen „unsrs, eurs“, eine Verformung, die (vgl. „yours“) das englische „theirs“ vorbereitet. Das englische „theirs“ besetzt in der Aufzählung den Platz des deutschen „ihres“. Nicht ohne Grund: „ihres“ wird im abschließenden „irr(-licht)“ phonetisch nachgeholt und zugleich zum entscheidenden Begriff des Gedichts gewandelt.
Das Gedicht ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jandl mit seinen phonetisch-semantisch kombinierten Verfahren zu präziser Mehrdeutigkeit kommt. Das Hauptanliegen: Gedichte sind Irrwege, auch in seinen (Jandls) gegenkulturellen Bemühungen.
Diese späte Erkenntnis entspricht ziemlich genau der frühen des Gedichts „von einen sprachen“; das bestätigt ein weiteres Mal die Kontinuität der Verzweiflungsthematik in Jandls Werk: eine notwendige Bemerkung, da Jandl immer noch da und dort zum sprachlichen Spaßmacher verkürzt wird.
schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen
sein ein demonstrieren, sein ein es zeigen, wie weit
es gekommen sein mit einen solchenen: seinen mistigen
leben er nun nehmen auf den schaufeln von worten
und es demonstrieren als einen den stinkigen haufen
denen es seien. es nicht mehr geben einen beschönigen
nichts mehr verstellungen. oder sein worten, auch stinkigen
auch heruntergekommenen sprachen-worten in jedenen fallen
einen masken vor den wahren gesichten denen zerfressenen
haben den aussatz. das sein ein fragenen, einen tötenen.
Das Gedicht ist ein Stück Jandlscher Sprachphilosophie. Nebenher (weil Jandls Sprachphilosophie eine existenzielle ist) läuft meistens das Lautwerden seiner existenziellen Depression („seinen mistigen leben“, „den stinkigen haufen denen es seien“). Die Sprachphilosophie: Die Benützung einer (unserer) verkommenen Sprache ist immer auch die Demonstration ihrer Verkommenheit. Diese Verkommenheit demonstriert Jandl, indem er die Sprache so weit beschädigt, dass sie ästhetisch den (Tief-)Stand der Wirklichkeit erreicht, den sie beschreibt. Keine Beschönigungen mehr, keine Verstellungen. Jandl hebt in seiner Redeweise sowohl die Ordnung auf, mit der die Sprache die Wirklichkeit strukturell, als auch die Schönheit, mit der die Sprache die Wirklichkeit ästhetisch versieht. Die bange, ja tödliche Frage am Schluss aber ist, ob nicht auch die vorsätzliche Beschädigung der Sprache („auch stinkigen / auch heruntergekommenen sprachen-worten“) nichts anderes als eine Verhüllung der verkommenen Wirklichkeit („den wahren gesichten denen zerfressenen / haben den aussatz“) ist; ob nicht jede Anti-Ästhetik Ästhetik ist, jede Form von Kulturverweigerung Kultur. – Natürlich ist sie das, und Jandl wusste es. Ein anderer Aufsatz müsste dann die Schönheit von Jandls hässlichen Gedichten nachweisen.
Die Defekte der „heruntergekommenen sprache“ unseres Gedichts (und vieler anderer): Das Verb wird ausschließlich im Infinitiv verwendet statt in der finiten Form, die Nomen werden ausschließlich mit der Endung -(e)n versehen, wie sie aus der schwachen Deklination kommt (einzige Ausnahme: „aussatz“), was zu Groteskformen wie „solchenen“ führt. Beide Fehler sind typisch für die grammatikalisch mangelhafte Sprachbeherrschung von Fremdsprachigen und erinnern an das sogenannte „Gastarbeiterdeutsch“. Jandl wollte damit ausdrücklich nicht eine Herabsetzung der Gastarbeiter erreichen, sondern ein weiteres Mal eine subkulturelle Sprachform in Anspruch nehmen.
9
Die konsequenteste Form von Kulturverweigerung ist Aussageverweigerung: Rücknahme des Kulturgenerators Ich. Nichts zu sagen bedeutet aber nicht, nichts zu sagen, sondern zu sagen, dass man nichts sagt. Erst dann ist es Kulturprovokation. Jandls frühe Aussageverweigerungen waren ein zorniger Reflex auf die Schwemme der großen Sager, die zwar unsere Kultur aufblähten, aber nichts am Jammer und an der Jämmerlichkeit des Menschen änderten. Zwei Beispiele, aus den 60ern und den 70ern:
nein realistisches gedicht
nein was will
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaader her
nein ich hätte
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagern
nein orangen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawieviel
nein der herr
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanun ja
nein vielleicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaein kilo
nein was wollen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaader herr
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasonst noch
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavielleicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaein paar
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabananen
Das linke Gedicht untertitelt Jandl mit „(beantwortung von sieben nicht gestellten fragen)“. Es weist die Beantwortbarkeit von Fragen kategorisch zurück, noch bevor solche gestellt werden; oder noch wahrscheinlicher: Es weigert sich zornig, ins Geheul der Antworten einzustimmen, deren Ergebnis nichts anderes als der heutige Weltzustand ist.
Das rechte Gedicht stellt einfach ein Stück Alltagswirklichkeit vor den Leser, wohl eine Marktszene: Seine Form des Nichts-Sagens besteht in seiner Kommentarlosigkeit; keine Ideologie, keine Moral, keine Religion, keine Nachdenklichkeit macht das rohe Stückchen Wirklichkeit verständlich. Kultur beginnt erst mit dem Kommentar. Hier verkauft jemand einem Kunden Obst, und es gibt nichts dazu zu sagen; das heißt: kein Kommentar mehr zur Welt, keine Kulturpflege der Wirklichkeit. Jandl hat den amerikanischen Experimentalmusiker John Cage sehr bewundert, ein Textchen von ihm übersetzt und für sich geltend gemacht:
Ich habe nichts zu sagen
und ich sage es
und das ist Poesie
wie ich sie brauche
Mit Jandls Älterwerden bekommen seine Aussageverweigerungen zunehmend die tragische Dimension seiner existenziellen Leere. Nichts sagen – nichts zu sagen haben – nichts haben – nichts sein – nicht sein wollen: So lassen sich die Stufen seiner Annullierungspoesie, alle mit Gedichtbeispielen mehrfach belegbar, von der Kulturprovokation bis zum Todeswunsch beschreiben. „ich bin zur zeit im garten“, erklärt Jandl scheinheilig, wie aus den wohlbestellten Verhältnissen eines Hausbesitzers heraus. Der Garten ist baumlos und strauchlos; Blumen und Gemüse gibt es nicht; nicht mal Unkraut; keinen einzigen Grashalm sogar. Erde wenigstens?
also erde gibt es keine.
nichts ist da, das an einen garten erinnert
außer dem zaun da. der bin ich
Leere innerhalb der Konturen des Ichs.
Solche Leere entleert auch die Gedichte. Geradezu programmatisch wird der Band idyllen, 1989, eingeleitet mit dem Gedicht „die ersten zwölf zeilen“:
die zeile, die vor mir steht still
und eine zweite zeile will
ich habe diese ihr erfunden
und schon zwei weitre dran gebunden
ein ende ist noch nicht in sicht
ich mag sie bisher alle nicht
weil jede schamlos nur enthüllt
mein denken als von nichts erfüllt
nichts andrem nämlich als dem schreiben
von zeilen, welche zählbar bleiben
für den, der an zwei mehr noch glaubt
als ihm der finger zahl erlaubt
Das Gedicht sagt nicht nichts, sondern sagt, dass es nichts zu sagen hat; kein nichtssagendes Gedicht also, sondern ein tragisches. Die Provokation der Verkündigungspoesie besorgt es, indem es nichts als die Zählung der eigenen Zeilen verkündigt und dieses Nichts in der klassischen Form der Verkündigungspoesie präsentiert (reibungsloser Reim- und Rhythmusverlauf). – Auf der Aussage der Aussagelosigkeit beharrt Jandl bis zu seinen Letzten Gedichten:
ALS DIESES
natürlich
können gedichte länger sein
als dieses
„du sollst dich verkleinern / bis du für keinen mehr / sichtbar bist“, heißt es in einem anderen der Letzten Gedichte, und im Band zuvor: „i bin anfoch a nui“. Jandls Annullierungspoesie entspricht eine hartnäckige Tendenz zur Selbstannullierung. Ihre psychologische Deutung als Auto-Aggression lässt sich von der „politischen“ als Kultur-Aggression nicht trennen. Die biographischen Grundlagen (Jandls Elternhaus und sein Kriegserlebnis) sind noch nicht wirklich eingehend untersucht. Erste Hilfe bietet Klaus Siblewskis 2001 erschienener Band a komma punkt ernst jandl. Ein Leben in Texten und Bildern. – Auch die Deklassierung des Subjekts ist ein bruchlos nachweisbares Kultur- und Individualverhalten Ernst Jandls. Das Gedicht „schritte“ stammt aus dem Band selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr, 1983:
der nebel
den berg
der berg
den baum
der baum
das blatt
das blatt
den käfer
der käfer
mich
So geht Jandl mit seinem und unseren Ichs um! Im Größen- und Bedeutungsvergleich der Naturerscheinungen rangiert es an letzter Stelle, unterhalb des Käfers. Und die Grammatik lebt: Alle Phänomene (der Nebel, der Berg, der Baum, das Blatt, der Käfer) dürfen auch im Nominativ des Subjekts auftreten und über ein Objekt bestimmen (den Berg, den Baum, das Blatt, den Käfer, mich), für das Ich bleibt allein der Akkusativ des Objekts. Das Ich rutscht nicht nur in seiner Größe unter das geringste Tier, sondern auch in seiner Macht: Es entbehrt die Fähigkeiten des Subjekts, also Erkenntnis, Gestaltung und Führung des Objekts. Eine solche Diagnose ist zum einen Teil depressive Erkenntnis, zum andren Teil aggressive Herausforderung, nämlich unserer Humanillusionen; ein ungesegneter Autor verflucht ein Schreiben lang die Praktiken der Segnung.
Helmut Gollner, neue deutsche literatur, Heft 551, September/Oktober 2003
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hille Kück: Die Endlichkeit des Lebens
literaturkritik.de,, August 2001
Theo Breuer: Universalpoesie in der „neuen“ Sammlung Luchterhand
titelmagazin.com, 12.2.2004
Felix Philipp Ingold: rot sei gott
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 4. 2001
Jörg Drews: Hiob in Wien
Süddeutsche Zeitung, 21. 4. 2001
Ernst Jandl Letzte Gedichte (2001): „Vom Leuchten“ / „Metaphernspucke“ / „Ich klebe an Gott“. Performed by Emmanuel Alloa (Stimme) & Tibor Elekes (Contrabass)
Bildnisse von Dichtern – Ernst Jandl
Das muß man gesehen haben, wenn ihm die blauen Zornäderchen an der Schläfe anschwellen. Dann stammelt sein Mund, aus seiner Kehle kommt Staub und seine Augen verdrehen sich. Die, die ihn kennen, tun die Finger in die Ohren. Dann schreit er. Niemand schreit so wie er. Wenn wir einmal einen Krieg auszufechten haben werden, spannen wir ihn vor unsern Karren und er schreit uns eine Schneise in die Feinde hinein. Mit dieser Technik haben die Schweizer schon einmal die Österreicher besiegt, bei Sempach. Er spricht ein Englisch wie ein Berserker. Wie er wohl ißt, und was? Er donnert die Gabel, die er mit der Faust hält, in den Rehrücken und säbelt mit einem Tranchiermesser ellenbogenlange Stücke herunter. Er frißt sie rasend schnell. Man meint, jetzt platzt er, aber nein, er lacht plötzlich ganz laut. Wir sehen uns an, dann ihn, und jetzt lachen wir auch. Sein Gesicht glänzt, er sieht jetzt aus wie ein Mond, und wir denken, schade, daß er nicht unser Vater ist oder wenigstens unser Onkel. Dann setzen wir uns zusammen an einen Tisch und spielen eine Partie Schach. Ich ruckle an meinen Bauern herum, er aber kracht gleich mit seinen Türmen übers Brett, und daß er dabei ein paar Rösser verliert, ist ihm wurscht. Sowieso hupfen die so unvorhersehbar. Auch den König mag er eigentlich nicht. Ihm sind die Figuren am liebsten, die wie Kegelkugeln dahinfegen können. Ich schaue auf das Chaos, das er auf dem Brett angerichtet hat und denke, wie er wohl Schnippschnapp spielt, mein Lieblingsspiel, früher, vor jetzt dreiunddreißig Jahren.
Urs Widmer, Manuskripte, Heft 47/48, 1975
ZUM 10. TODESTAG VON ERNST JANDL
aaaaaaaaagestern war ich auf dem Ätna droben, da
aaaaaaaaafiel der grosze Sizilianer mir ein der
aaaaaaaaaeinst des Stundenzählens satt, vertraut
aaaaaaaaamit der Seele der Welt, in seiner kühnen
aaaaaaaaaLebenslust sich da hinabwarf in die herr-
aaaaaaaaalichen Flammen ..
aaaaaaaaaHölderlin, Empedokles
ist dir was so frag ich ihn, ich bin so allerhand, bin in den Berg
hineingeritten. Er ist sehr still ich lieb ihn weil er still ist,
er leckt die Steine ab in seinem Grab dasz sie von neuem glänzen
sollen : Steine vom Meer in Griechenland, er hat zu tun er zeigt
mir dann den abgeleckten Stein : prächtiges Kleinod Maserung I
Trittstein zwischen hier und dort. Sein nackter Fusz zerbrochen, im
hochgewachsenen Gras vom Regen sumpfig, mit bloszen Füszen durch
die nasse Wiese er ist so still ich liebe ihn weil er so still, er
spricht kein Wort zu mir er blickt mich an gebrochnen Auges, sein
Kämmerchen aus Schlamm und Regenbogen – ob ich ihn je
aaagekannt, fra-
ge ich mich, komm lasz uns pflücken die ersoffnen Blumen die vio-
letten Schwertlilien gelben Iris. Schwimmgürtel, Unterwelt. Ge-
schwister sind wir, haben nämliche Temperamente, hält sich die
Ohren zu mit I Polster, Vogelschwarm
Friederike Mayröcker
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Zum 70. Geburtstag des Herausgebers:
Hanns-Josef Ortheil: Klaus Siblewski wird siebzig
Börsenblatt, 16.10.2020
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram +
Facebook + Archiv + Kalliope
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


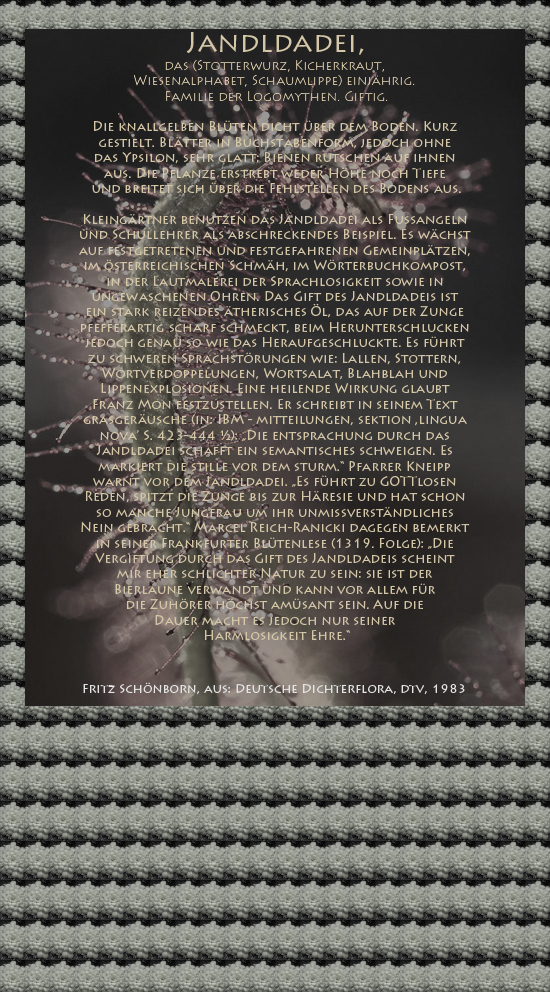












Schreibe einen Kommentar