Ernst Jandl: stanzen
anst woa da hans ARP
scho a oat inspiration
heit is des da RAP
ob ma woin oda ned
Nachwort
mitte august 1991, während eines vom 2. august bis 1. september dauernden urlaubs in puchberg am schneeberg in niederösterreich, gelang es mir unversehens, einen motor anzuwerfen, der für eine gewisse zeit eine kontinuierlich rapide gedichtproduktion ermöglichte, wie ich es in meiner schriftstellerischen laufbahn mehrmals erlebt hatte, z.bsp. 1952 den durchbruch zur realistischen dichtung der Anderen Augen (1956), 1956/57 das einsetzen sogenannten experimentellen schreibens und vor allem der „sprechgedichte“ der sammlung Laut und Luise (1966) oder 1976 die verfügbarkeit einer „heruntergekommenen sprache“, dargestellt im buch die bearbeitung der mütze (1978).
nie zuvor jedoch war mir der funktionsbeginn eines solchen motors zur weiterführung der arbeit am gedicht, samt seinen voraussetzungen, so deutlich geworden wie diesmal. die stanze („das gschdanzl“), eine vierzeilige volkstümliche gedicht- bzw. strophenform, lernte ich in meiner frühen kindheit (etwa bis 1929) während des jährlichen sommeraufenthaltes in niederösterreich auf bauernfestlichkeiten kennen und vergass sie nicht wieder. es gab bei solchen gelegenheiten einen gschdanzelsänger oder, besser noch, zwei, die zugleich improvisierend und klischees anwendend eine bauerngesellschaft bei stimmung hielten: diese stanzen wurden zu immer derselben melodie als eine art sprechgesang dargeboten, und dies natürlich im niederösterreichischen dialekt, der sich in einer gewissen nähe zu den wiener dialekten bewegte. meinen erziehungspersonen, vor allem meiner mutter, galt der grossstadtdialekt als ein klassenstigma. Zwangsläufig jedoch geriet ein in wien aufwachsender dem dialekt in die nähe, ohne dass dies seine sprechweise färben musste; er hatte einfach eine zweite sprache tief in sich.
den jähen und heftigen beginn dieser stanzendichtung im august 1991 sehe ich durch vier vorangehende ereignisse vorbereitet: durch die begegnung, per rundfunk, danach per LP und CD, mit einem relativ jungen, in grossstädten entstandenen, von gossenvokabular bestimmten, essentiell improvisierten, sehr rasch und rhythmisch pointiert vorgetragenen kritischen sprechgesang junger amerikanischer farbiger; durch den kauf einer CD namens most am 20. märz 1991, 18 nummern der attwenger markus binder, schlagzeug, und hans-peter falkner, ziehharmonika, musik und text, die einen kenner von jazz, rock und konkreter poesie nicht unbewegt lassen konnten; durch den erwerb, am 10. juli 1991, des anregenden wiener dialekt lexikons von wolfgang teuschl; schliesslich durch den schon etwas früher erfolgten vorschlag von mathias rüegg, leiter der jazzband vienna art orchestra, auf der basis von jazz-nummern texte für seine formation zu verfassen, was zur – noch zu realisierenden – vorstellung führte, englisch, so wie ich es leidlich beherrsche, zu einem echten medium deutschen dichtens zu machen, also ausser konkurrenz zur angelsächsischen poesie, so wie ja auch picasso nicht immer nur blau, sondern mit einem mal rosa malen konnte.
mein neues medium hier, in den stanzen, war diese spezifische art des vierzeilers und der dialekt. dieser fluktuiert in schreibung und sprechweise – bis hin zu selbst erfundenen formen wie „sittä“ für sittich, wohl von niemand bisher gebraucht. es ging nicht an, eine normierung des dialekts zu erstreben, wo zu den poetisch nutzbaren vorzügen dieser art sprache gerade ihre ungenormtheit zählt. dialekt ist freilich stets gesprochene sprache, und diese „stanzen“ sind daher um nichts weniger „sprechgedichte“ als jene in Laut und Luise. (dort gab es übrigens eine abteilung zum teil im dialekt, „volkes stimme“; ein stärkerer kontrast zu den „stanzen“ ist kaum vorstellbar.)
die von mir angewandte form der „stanze“ ist ein vierzeiler. jede zeile enthält, von einer deutlichen zäsur auf distanz gebracht, zwei stark betonte neben einer jeweils freien zahl von minder betonten oder unbetonten silben. letzteres bietet ungeahnte möglichkeiten der variation.
die tragfähigkeit der stanze wird hier an einzelnen beispielen von hochdeutschen, englischen und gemischtsprachigen stanzen erprobt. dabei zeigt sich: die stanze hält mehr, als sie verspricht.
da viele dieser vierzeiler über keinen titel verfügen, wurde für das inhaltsverzeichnis eine dem leser hilfreiche methode ersonnen: es wurde jeweils die erste zeile bis zur zäsur, dem deutlich vernehmbaren einschnitt, zitiert; das ist eine nicht gering zu achtende hilfe für den leser dieser stanzen, der ja zu einem stanzen-sprecher, wenn schon nicht stanzen-sänger, zu entwickeln sich suchen sollte.
je weiter er sich, seinem ursprung nach, von wien als dem zentrum seiner poetischen begierden entfernt, umso mehr wird er fürs erste des beigegebenen glossars bedürfen, um dieses alsbald wieder entbehren zu können.
seine hochdeutschen sprechgewohnheiten sollte er bei der übertragung der stanzen in akustisch wahrnehmbares nicht zu hoch einschätzen: das wienerische verbindet sich nicht selten mit den vorzügen ästhetisch wirksamer aussprachefehler, wofür die sprechweise des viel bewunderten schauspielers hans moser ein beredtes zeugnis ablegt. was immer der geneigte leser bisher an poetischer höhe zu erreichen getrachtet hat, wird sich ihm auch in diesen stanzen eröffnen – bloss mit einer da und dort merkbaren verschiebung in die tiefe der poesie. er hat schliesslich nicht ein büchlein der „menschenkunde“ erworben, wie so viele, vor allem erzählende, literatur zu sein es vorgibt; auch kein büchlein der „seelenkunde“, wie so manches psychologische und religiöse machwerk; nicht einmal ein büchlein der „heilkunde“, was immer sich hinter diesem üblen ausdruck verbirgt. sondern er hat ein buch poesie erworben, ein buch erhebender und niederschmetternder sprachkunde, und nichts sonst.
Ernst Jandl, Nachwort, 23.2.1992
Zu Ernst Jandls stanzen
I have always found that Angels have the vanity to speak of themselves as the only wise; this they do with a confident insolence sprouting from systematic reasoning.
(William Blake, „The Marriage of Heaven and Hell“)
HOHES UND NIEDRIGES
aus aian orphischn oaschloch
druckts es maunchmoe a batzal
nemtsas glei auf de zungen
olle lyrik gheat gsungen
Die ersten drei Verse sind durch eine Zäsur vom vierten Vers geschieden. Erst mit diesem stellt sich die Mehrdeutigkeit des Gebrauchs von batzal heraus: daß sich dieses Wort hier nicht ausschließlich auf ein Stück weichen Exkrements bezieht, sondern auch auf Lyrisches. Vielleicht sind also das batzal und die lyrik von Anfang an identisch, oder im Zuge der Handlung verwandelt sich das batzal ins Gedicht oder das Gedicht ins batzal.
Was – wenn denn irgendetwas Bestimmtes – geschehen müßte, damit die angesprochenen Besitzer eines orphischn oaschlochs, also wohl die Lyriker selbst, die Identität oder die Verwandlung des batzals oder des Gedichtes hervorrufen können, bleibt ungesagt, dafür wird es getan: Die Aufforderung selbst ist – weil sie ein, nein, weil sie dieses Gedicht ist – das, was geschehen muß, um das batzal zum Gedicht oder das Gedicht zum batzal zu machen oder das eine in das andere zu verwandeln.
Die Aufforderung selbst ist lyrik, jedoch wird das erst mit dem Ende des letzten Verses unabweisbar, der deshalb zu einer überraschenden Pointe gerät: Mit dem wohl schon oft gebrauchten Schlußreim „zungen / gsungen“, in dem sich das Liedhafte und Sangbare – beides gehört zur Form des Gstanzls – geradezu triumphal ausruft, wird das Lyrische mit einem Schlag deutlich. (Die ersten drei Verse sind, wie es die Form des Gstanzls vorsieht, unregelmäßig gefüllt und fordern, ist man mit jener Form nicht vertraut, kaum zum Singen heraus; sie sind eher prosaisch.)
In dem Nichtgesagten, dem Zwischenraum, der Zäsur, dem augenblicklangen Einhalten vor der Offenbarung des Liedhaften und der Selbstoffenbarung des Gstanzls, zwischen drittem und viertem Vers also, könnte das Entscheidende geschehen – das, was die Identität oder die Verwandlung des bazals oder Gedichtes erfahrbar machte. Es wäre dann gleichgültig geworden, daß alltägliche Welt- und Wirklichkeitsvorstellung ein batzal nicht lyrik und lyrik kein Exkrement sein oder werden läßt; daß keine Chemie (allenfalls eine Alchemie) denkbar ist, die eine Verwandlung des einen in das andere möglich machte.
*
Der Gang dieser stanze als fortschreitende Offenbarung der Identität des Gedichtes mit einem Exkrement oder als Verwandlung des einen in das andere betrifft nicht nur das batzal und die lyrik: Auch die anderen Worte können bestimmte Momente des Lyrischen und seiner Produktion bezeichnen: oaschloch könnte den sozusagen anderen, den unteren Mund des Dichters und dessen (orphische) Ausdruckspoesie meinen und zugleich eine nur wenig verhohlene dialektale Beschimpfung der angeredeten Lyriker sein; die Wendung druckts es könnte für den Vorgang (lyrischen) Ausdrückens und die zungen für die Sprache selbst stehen. Liest man das Gedicht in diesem Sinn – und nimmt man an, es sei ekelerregend und verwerflich oder schimpflich, die Exkremente in den Mund, auf die Zunge zu nehmen –, dann ist es die Aufforderung an die Dichter, das Ekelhafte, Verwerfliche oder Schimpfliche zu besingen oder zum Singen zu bringen, dieses Niedrige – die Lyriker, diese orphischen oaschlöcher, sind es auch selbst – zum Gegenstand des Gedichtes und dieses auch mit seinem Gegenstand identisch zu machen, das Gedicht in seinen niedrigen, verwerflichen oder schimpflichen Gegenstand zu verwandeln oder diesen in das Gedicht.
Jener Aufforderung kommt das Gedicht nicht nur dadurch nach, daß es selbst lyrik ist und das batzal singt: auch indem es die niedrige Sprache, den Dialekt – dieser wird von der Lyrik als hoher Literatur ansonsten zumeist ausgeschieden – gleichsam in den Mund nimmt, vollzieht es das, was es fordert.
Daß der Dialekt hier selbst als das ansonsten von der (hohen) Lyrik Auszuscheidende anzusehen ist, zeigt sich auch durch die hochdeutsche Schreibung der Worte orphischen und lyrik (es könnte ja auch oafischn und lürig heißen). Diese Worte sind zudem in doppeltem Sinne Fremdworte: Zum einen sind sie altgriechischen Ursprungs und zum anderen stammen sie aus einem vokabulären Bereich, der vergleichsweise höhere Bildung voraussetzt. (Das Wissen etwa, daß Orpheus der mythische halb göttliche Stammvater der Dichter ist, der durch seinen Gesang selbst die Steine rührt, dem es durch seinen Gesang beinahe gelungen wäre, seine tote Geliebte Eurydike aus der Unterwelt ins Leben zurückzuholen usw.) Beide Momente sind der durch die Form des Gstanzls und auch durch den Dialekt evozierten Sphäre entgegengesetzt. In paradoxer Umkehrung der üblicherweise geltenden Verhältnisse werden diese hochsprachlichen Worte, die das Hohe, Erhabene, ja Halbgöttliche der Lyrik und des Lyrikers anklingen lassen – die Lyra selbst gehört zur Ikonographie der Orpheusdarstellung –, zu dem für das Gedicht nicht recht Assimilierbaren; zu etwas, das von dem Gstanzl nur wie ein Fremdkörper berührt wird. So wird das Hohe und Hochdeutsche selbst ein gleichsam Ekelerregendes, das von dem Lyriker, der das batzal aus dem oaschloch singen soll, kaum auf die Zunge genommen werden darf; als ob es die das Hohe oder Erhabene in Anspruch nehmende Tradition der Lyrik selbst wäre, die als hier Verwerfliches ausgeschieden werden müßte, um andererseits die normalerweise als verwerflich oder niedrig angesehenen Gegenstände singen zu können.
(Daß die Worte lyrik und orphisch in dieser stanze vorkommen, ist überdies ein Zeichen für die Distanz der stanzen zu jeglicher Volksdichtung: Diese Gedichte gehören ebensowenig ins Gasthaus oder in die Bezirkszeitung wie die Dialektdichtungen der Wiener Gruppe aus den fünfziger und sechziger Jahren. Diese Künstlichkeit, aber auch die Gegensätzlichkeit von Hohem und Niedrigem, zeigt sich schon im Titel der Sammlung: stanzen ruft – anders als Gstanzl – die Erinnerung an den Begriff der Stanze hervor, weniger vielleicht an die achtzeilige romanische Strophenform als an den generischen Gebrauch von Stanze im Sinne von Gedichtstrophe.)
Schimpfen und Schimpfliches
Das Schimpfen, das Ungehobelte, Grobianische und überhaupt jegliche Drastik sprachlichen Ausdrucks werden häufig als Anzeichen für das Unterschichtige oder Unkultivierte angesehen; umgekehrt wird der Dialekt, als das Anzeichen für das Unterschichtige und Unkultivierte, häufig auch für etwas Ungehobeltes, Grobianisches und wohl auch Schimpfliches gehalten. Wenn also nun, wie in den stanzen, bei des zusammentrifft – das Schimpfen wie auch der Gebrauch des Dialektes –, dann schließt sich ein solches zweifach niedriges Sprechen nach traditionellem (sowohl vormodernem als auch alltäglichem) Verständnis beinahe selbstverständlich von der Lyrik, einem der beispielhaften Fälle des Kultivierten und Hochsprachigen, aus; ja, ein solches niedriges Sprechen ist das, wogegen sich die sogenannte hohe Literatur oft abgrenzt oder wenigstens abgegrenzt hat (denn die Moderne mag da die Maßstäbe einigermaßen verändert haben).
Eine Form des Schimpfens äußert sich in der abwertenden Bezeichnung von menschlichen Körperteilen: Aus Mund oder Händen wird in der Hochsprache etwa Maul oder Pfoten (menschliche Körperteile werden aufs Tierische heruntergestuft). Eine andere geläufige Form des Schimpfens – ob nun in der Hochsprache oder im Dialekt – identifiziert den Beschimpften mit Körperteilen und -funktionen, die den üblichen Regeln gesellschaftlichen Umgangs zufolge nicht oder jedenfalls nicht direkt bezeichnet werden und noch weniger als Anrede einer Person gebraucht werden dürfen: Arschloch beziehungsweise oaschloch, Scheißkerl, im Wienerischen Gschissana, Fut oder das im Wienerischen auch als Schimpfwort gebrauchte Beidl (Beutel=Hoden) sind bekannte Beispiele dafür.
In einer Reihe der stanzen werden Körperteile und -funktionen in Zusammenhängen benannt, die sie als Formen des Schimpfens nahelegen:
I scheiss da in d’bappm
und du deafst as schlickn
daun scheissd du marin mei bappm
und i deaf dron dastickn
Diese stanze kann, ähnlich wie aus eian orphischn oaschloch, nicht nur als wörtliche Wiedergabe eines Vorgangs, sondern auch als dessen Verwandlung in Sprache gelesen werden. Das Gedicht kann etwa den Austausch verbaler Aggression von zwei Personen, also ihr wechselseitiges Beschimpfen darstellen. Der Angesprochene könnte der Leser sein, es könnte das Verhältnis des Dichters zu seinem Leser kommentiert werden; es handelte sich dann um einen Kommentar, der die stillschweigenden Abmachungen dieses Verhältnisses brutal außer Kraft setzt, wird doch üblicherweise vorausgesetzt, daß sich der Leser dem von einem idealen Autor dargebotenen Sinn als einem idealen (interesselosen) Subjekt in schöner hermeneutischer Freiheit hinzugeben habe. Dieses kommunikative und kontemplative Verhältnis wäre hier durch eines wechselseitiger Gewaltsamkeit ersetzt: Der Autor scheisst dem Leser in d’bappm, der Leser muß, was der Autor produziert, schlickn. Doch der Leser bleibt dem Autor nichts schuldig, ja er hat – und das ist ja bei der Rezeption von Gedichten tatsächlich der Fall – das letzte Wort und bringt den Autor – durch seine Deutung? – gleichsam um. So würde die (hohe) Literatur und mit ihr vielleicht alle höflich-gepflegten kommunikativen Verabredungen in einer speculation à la baisse (Robert Musil) als wortreiche, aber unredliche Sublimierung gewaltsamer Verhältnisse lesbar. (Mit dem pardoxen Pferdefuß allerdings, daß jegliche Interpretation der Aufkündigung des kommunikativen Vertrags diesen wieder in Kraft setzt.)
Die Drastik, das Gewaltsame und Ekelerregende des vorzustellenden Vorgangs stellt sich allerdings selbst als Künstliches aus, überdreht sich ein wenig, verformt sogar ein Wort gewaltsam: das Wort schlickn ist ein Neologismus, kein tatsächlich existierendes Dialektwort. So werden der Dialekt und die stanze insgesamt als künstlich ausgestellt; ein Moment, das Gegenstand der folgenden stanze ist:
i hob da in mia
so ar oat dialekt
den howi ned von da muata griagd
howin grad east entdeckt
Wird der Dialekt einmal nicht negativ als Niedriges, Unterschichtiges oder Unkultiviertes gesehen, sondern positiv bewertet, so wird er häufig als Authentisches, Natürliches oder Ursprüngliches verklärt. Eben dieses Klischee wird hier kenntlich gemacht: Das lyrische Ich behauptet den Dialekt als nicht muttersprachlich. als etwas im Gegenteil, das es gerade erst in sich selbst entdeckt habe – und bedient damit sogleich ein weiteres Klischee: daß Lyrik etwas Innerliches sei, das sich einem In-sich-Hineinhören, einer Introspektion verdankt. Auch diese Entdeckung im eigenen Inneren wäre, wie es eine Mythologie der Kunst will, etwas Authentisches, Natürliches oder Ursprüngliches; und so mag nicht entscheidbar sein, welche der beiden konkurrierenden Natürlichkeiten hier den Vorrang hat.
Indem die beiden Klischees einander ausgesetzt werden, ja schon dadurch, daß der Dialekt selbst thematisch wird, werden beide – und mit ihnen das Natürliche oder Ursprüngliche des Dialektes und der stanze selbst – zweifelhaft. Eine Zweifelhaftigkeit, die sich zudem dadurch ironisch akzentuiert, daß von einer Art Dialekt (ar oat dialekt) die Rede ist – von einem Dialekt, der also vielleicht keiner im wörtlichen Sinne ist –, wie auch dadurch, daß ausgerechnet das Wort Dialekt ein hochdeutsches Wort oder von einem solchen nicht zu unterscheiden ist. Und schließlich wird die Künstlichkeit des Dialekts in dem prosaischen Dahinstolpern der stanze merklich: Sie wirkt wie eine schwerfällige Übersetzung aus dem Hochdeutschen. Der Dialekt und die Form des Gstanzls stehen hier also in vielfältigem Widerspruch zu dem, was die stanze explizit behauptet.
Ähnlich verhält es sich in i scheiss da in d’bappm, da der durch den Reimzwang bedingte Neologismus den Widerspruch zum Dargestellten deutlich macht. Das erfundene Reimwort schlickn dient keineswegs der sprachlichen Mimesis der Gewaltsamkeit, sondern verweist, im Gegenteil, auf die Form der stanze. Auch die Komik des Gedichtes verdankt sich jenem Widerspruch: Einen gewaltsamen und nach üblichen Ansichten ekel erregenden Vorgang ostentativ von einem Reim, vom Erfüllen einer jeglicher Unmittelbarkeit zuwiderlaufenden Regel abhängig zu machen, kann das Gewaltsame oder Ekelerregende in ein Lachen verwandeln – obwohl eine solche Komik unversehens als Gewaltsamkeit zweiter Stufe empfunden werden könnte.
Im Übrigen scheint das Gedicht ohne weitere Rätsel, da es – anders als in eian orphischn oaschloch – seine Mehrdeutigkeit nicht nach und nach entfaltet, sondern von Anfang bis Ende des Gedichtes gleichermaßen suggeriert. Komplexer und wesentlich eindrucksvoller ist diese stanze:
d’oede in ian zuan
drogt s oaschloch jetzt fuan
ihre duttln drogts hintn
und ihr fut kaumma iwahaupt ned fintn
Zunächst scheint hier der Zorn (zuan) einer Frau so beschrieben zu werden, als würde er ihren Körper wesentlich verändern, sind doch verschiedene Organe nicht mehr dort, wo sie normalerweise sind: Das oaschloch wird jetzt vorne getragen, die Brüste (duttln) hinten und die Vagina (fut) kann man überhaupt nicht finden.
Die offenbare physiologische Unwahrscheinlichkeit der Szene legt jedoch die Annahme fern, es handle sich allein um die Wiedergabe eines sinnlich wahrnehmbaren Vorgangs. Naheliegt vielmehr, auch die Darstellung dessen anzunehmen, was die Frau und ihr Zorn dem zufügen, der von ihm getroffen wird und davon berichtet. Die Zürnende zeigt dem Berichtenden ihr oaschloch – vielleicht beschimpft sie ihn mit Hilfe dieses Wortes; oder sie wendet ihm das oaschloch zu, um ihren Zorn zu zeigen –, und sie entzieht ihm wohl auch ihre Sexualität; eben deshalb sind ihre Brüste (duttln) für den beschimpften Mann – mindestens metaphorisch – nicht mehr erreichbar. Auch die Vagina (fut), die ihm noch wichtiger sein mag als alles andere, wird ihm entzogen: Sie ist überhaupt nicht mehr zu finden, sei es tatsächlich oder im metaphorischen Sinn. Daß dieses Wichtigste, in welchem Sinn auch immer, überhaupt nicht gefunden werden kann, steht erst am Ende des Gedichtes fest, mit den letzten beiden Worten. (Als ob die Suche nach diesem zentralen Punkt erst im letzten möglichen Augenblick des Gedichtes aufgegeben und ihre Vergeblichkeit eingestanden würde.)
Doch das Gedicht legt noch einen andere Lesart nahe, die sich indirekt, durch den Sprachgebrauch, offenbart: durch die schimpfendabwertende und dialektale Bezeichnung von (weiblichen) Körperteilen. Erkennbar wird dabei etwas Verallgemeinerbares: daß die häufige Gewohnheit – vor allem eine männliche Gewohnheit wohl –, über das andere Geschlecht in Form der Reduktion auf primäre oder sekundäre Geschlechtsteile oder auf Ausscheidungsorgane zu sprechen und häufig auch zum Gegenstand von Witzen, Spott oder eines Schimpfens zu machen, der Ausdruck der versuchten Abwehr einer Macht sein kann, der man sich ausgeliefert fühlt. Diese weiblich Macht – deren Behauptung männlicherseits allerdings selbst stark klischeehafte Momente hat – wird um so fühlbarer oder furchterregender, je mehr d’oede – damit ist zumeist die eigene Ehefrau gemeint – zürnt. Es wäre dann auch diese Furcht, die zu der seltsamen ambivalenten Vision führte, die das Gedicht evoziert: Die (Ehe-)Frau wird zu einer bedrohlichen Göttin oder auch zu einer vielleicht als hexenhaft empfundenen Vettel; zu einer Gestalt jedenfalls, die das, was Erotik, Leben, Lust verspricht, entzieht. Zugleich wird diese Vision (nicht zuletzt durch ihre groteske Komik) auch als Projektion – als ob da jemand eine parodistische Eheszene an die innere Wand malen würde – und als Darstellung eines Klischees fühlbar; als Klischeedarstellung allerdings, die beunruhigenderweise eine seltsame Überzeugungskraft gewinnt, die nicht zuletzt auf der dialektalen und idiomatischen Selbstverständlichkeit dieser stanze beruht. Wenn es sie nicht tatsächlich gibt, so sind doch idiomatisch-dialektale Wendungen denkbar, die den Zorn einer Frau und zugleich die eigene Furcht vor diesem Zorn mit die drogts oaschloch aber fuan, oder de drogt de duttln hinten bezeichnen und deshalb auch den bezeichneten Sachverhalt zur selbstverständlichen Wahrheit machen. (Anders als in i hob da in mia / so ar oat dialekt widerspricht der Dialekt also in dieser stanze nicht dem, was dargestellt wird, sondern bestätigt es, ja ruft ihre Wirkung wesentlich hervor.)
Nur der letzte Vers, der, überlang, sozusagen über sich hinaus stolpernd und stotternd die komische Fassungslosigkeit des Berichtenden evoziert, dieser letzte Vers, der erst im letzten Augenblick, wie eine unverhoffte Pointe, das Reimwort findet (aber keineswegs die fut), ist – in seinem wie verdattert auf den Reim Zuholpern – selbst nicht idiomatisch, sondern eine Konsequenz der idiomatisch plausiblen Schimpf-Bezeichnung und zugleich des Zürnens der Frau wie der Furcht des lyrischen Ich, das sich erst im letztmöglichen Augenblick mit dem, was die Frau ihm antut, oder seiner eigenen Vision, abzufinden scheint.
Darstellung und Dargestelltes
Das Verhalten im Zusammenhang mit Gegenständen oder Vorgängen, die häufig starke Empfindungen, etwa solche der Lust oder des Ekels hervorrufen, ist zumeist vergleichsweise genauen Regelungen, etwa bestimmten Verboten, unterworfen. Beispiel dafür ist der Umgang mit Sexualorganen oder sexuellen Handlungen ebenso wie mit Ausscheidungsorganen oder Ausscheidungen. Dasselbe gilt für die Wiedergabe oder Darstellung solcher Gegenstände oder Vorgänge: Häufig dürfen sie nicht oder nur in eingeschränktem Maß oder nur in verblümter Weise sprachlich bezeichnet werden. Sowohl die Gegenstände oder Vorgänge, die Verbote veranlassen und zu deren Übertretung verführen, als auch die Übertretungen werden häufig als niedrig, verwerflich oder schimpflich angesehen.
Wenn nun in den stanzen in einem Atemzug zwei Verbote übertreten werden, insofern ein verbotener Umgang mit Gegenständen oder Vorgängen auf verbotene Weise (etwa unverblümt) evoziert wird und dies zudem in einem dialektalen Idiom geschieht, das selbst ein für die Hochsprache gleichsam Verbotenes und Unberührbares ist, geschieht und überdies im Gstanzl, das als orale und dialektale Form, normalerweise wie selbstverständlich als von der hohen Literatur Auszuschließendes vorausgesetzt wird, so können alle diese Momente zu Kräften werden, durch die das als niedrig, verwerflich oder schimpflich Angenommene dargestellt werden kann.
Doch was heißt Darstellen in Gedichten? Heißt es nicht auch, an den dargestellten Dingen, an ihrer Wirklichkeit und Wirksamkeit teilzunehmen? Entspricht die Annahme, die ästhetische Darstellung von Gegenständen, etwa von sexuellen oder Ausscheidungsvorgängen, die zumeist als niedrig gelten oder Verboten unterworfen sind, sei von den Dingen oder Vorgängen selbst ein für alle Male und kategorisch zu unterscheiden, nicht einer allzu sauberen und zugleich vernunftgemäßen Scheidung? Ist nicht die Tatsache, daß sich die Verbote sowohl auf die Dinge oder Vorgänge wie auf ihre, beispielsweise, sprachliche Darstellung beziehen, ein Hinweis darauf, daß jene Unterscheidung auch im Fall von Kunstwerken zweifelhaft ist? Und ist dieser Hinweis nicht insbesonders in Bezug auf die Dichtung bedeutsam, die doch ihrerseits die gegenstandumfassende Macht des Wortes voraus- oder wenigstens auf ihr Spiel setzt? Und enthält dieser Hinweis deshalb nicht, daß die ästhetische Darstellung eines als niedrig, verwerflich oder schimpflich Angesehenen selbst als ein Niedriges, Verwerfliches oder Schimpfliches, ja, gegebenenfalls, als Übertretung des entsprechenden Verbotes begriffen zu werden hat? Will oder soll das Kunstwerk nicht auch tatsächlich das sein, was es darstellt?
Nicht zuletzt deshalb, weil diese Fragen nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten sind, führen sie in das Herz der Poesie und der Ästhetik.
Ja und nein bezeichnen hier nur Extreme, widersprüchliche Momente, die beide im Kunstwerk zu ihrem Recht kommen wollen. Denn in einem seiner Extreme oder Momente konstituiert sich das Kunstwerk tatsächlich durch die Trennung von dem, was es darstellt (das batzal Exkrement ist keineswegs vorhanden im Gedicht); es ist ein Zeichen, das vom Dargestellten durch einen kategorialen Abgrund geschieden ist. Viele der wiederkehrenden Skandale um eine als anstößig oder verwerflich empfundene Gegenständlichkeit von Kunstwerken beruhen darauf, daß jener Abgrund übersehen wird; auf einem Mißverständnis also, das das künstlerische Zeichen ohne weiteres mit seinem Gegenstand identifiziert und deshalb das Verbot, das sich auf den Gegenstand bezieht, unvermittelt auf seine Darstellung überträgt.
Und doch enthält dieses Mißverständnis mehr als ein Korn Wahrheit. Denn das Kunstwerk ist nicht allein das, was kategorial anders als seine Gegenstände ist, sondern in seinem anderen Extrem oder Moment ist es auch das, was eben jenes Anderssein zu überwinden sucht. Es hat auch die Tendenz, sich mit dem Dargestellten in eins zu setzen. Das Gedicht soll das batzal sehr wohl auf seiner Zunge zergehen lassen, oder das Lyrische sehr wohl ein Teil dessen werden, was es darstellt. (In der bildenden Kunst sind die Darstellungen des Wiener Aktionismus ein flagrantes Beispiel). Es ist also auch eine Art Mißverständnis der auf verstandesgemäßer Systematik und Ordnung fixierten (semiotischen) Vernunft selbst – und entspricht auch einer häufigen, in eifriger Verteidigung der Freiheit der Kunst, unterlaufenden Verharmlosung des Kunstwerks –, wenn einzig und allein auf der Differenz von künstlerischem Zeichen und seinem Gegenstand beharrt und so getan wird, als wäre die Identifikation der Darstellung mit dem Dargestellten oder des Dargestellten mit der Darstellung – mit den möglichen, für manche skandalösen Konsequenzen – völlig unberechtigt.
Da das Kunstwerk, in seinen gegenläufigen Tendenzen zur Differenz von und zur Identität mit seinem Gegenstand, sowohl als Gegenstand als auch als Zeichen erscheinen kann, ist die Verwirrung der bei den Momente oder Extreme, ihre unangemessene Identifikation, wie auch ihre unangemessene Unterscheidung, nur allzu naheliegend und auch verständlich. Wenn so das Mißlingen von Kunstwerken dadurch erklärbar sein kann, daß jene Momente nicht in der angemessenen Weise aufeinander bezogen werden, kann ihr Gelingen eben durch das angemessene Wechselspiel von Identifikation und Unterscheidung von Darstellung und Dargestelltem begriffen werden.
Je stärker aber die Empfindungen, die Wertgefühle und -urteile wie auch die Regelungen, etwa Verbote, sind, die durch einen Gegenstand oder dessen ästhetische Darstellung evoziert werden, um so schwieriger ist es, jenes Wechselspiel auf überzeugende Weise hervorzurufen. Die bekannten Probleme bei der Darstellung von schwerwiegenden und mit heftigen Empfindungen verbundenen Gegenständen oder Vorgängen, wie es etwa Sterben und Tod oder Liebe und Lust sind, bezeugen das, ebenso wie die Probleme der Darstellung von, nach häufiger Empfindung, Ekelhaftem, etwa von körperlichen Ausscheidungen oder Ausscheidungsvorgängen.
In vielen stanzen nun sollen Gegenstände dargestellt und deshalb auch Darstellungen gegenständlich werden, die mit äußerst heftigen Empfindungen oder mit stark wirksamen Werturteilen beziehungsweise Regelungen, etwa mit Verboten, verbunden sind. Da nun – jedenfalls zufolge der skizzierten Dialektik – einerseits jegliche Darstellung von als niedrig, verwerflich oder schimpflich empfundenen Gegenständen oder Vorgängen ins Dargestellte und deshalb in Niedriges, Verwerfliches oder Schimpfliches selbst übergehen kann, andererseits auch jeglicher als niedrig, verwerflich oder schimpflich empfundene Gegenstand in seine Darstellung (und also bei des auch die entsprechenden heftigen Empfindungen, Werturteile auslösen kann), bewegen sich die stanzen in einem außerordentlich gefährlichen und gefährdeten Gebiet. Sie setzen sich in besonderem Maß dem Risiko aus, daß das Wechselspiel der Identität mit und der Unterscheidung von ihrem Gegenstand nicht auf angemessene Weise vollzogen werden kann: Entweder, weil die Tendenz der wechselseitigen Teilhabe von Darstellung und Gegenstand auf Kosten der gegenläufigen Tendenz zur Distanzierung vorherrscht – der so stark wirksame Gegenstand triumphiert einseitig –, oder weil, umgekehrt, die Distanzierung, die semiotische Differenz vom Gegenstand, allzusehr die Oberhand gewinnt. (Die Flucht vor dem so stark wirksamen Gegenstand triumphiert einseitig.)
In welcher Weise sich jenes doppelte Risiko auswirkt, zeigt sich gerade durch den Vergleich der stanzen, in denen es sich in außerordentlich hohen ästhetischen Gewinn verwandelt, mit einer, die, wie ich glaube, vergleichsweise weniger gut gelungen ist:
PISSING PARTY
du setzt di aufs klo
i mochs in dein mund
so gehds auf amoe
wischerln is gsund.
In den ersten beiden Versen wird eine Szene evoziert, die – im dritten Vers – durch eine zweideutige Begründung erklärt wird. Entweder wird das Urinieren durch die seltsame Position der involvierten Personen für eine von beiden wieder möglich – es geht auf einmal wieder –, oder die Szene wird durch eine, wie immer absurde, Ökonomie begründet: Von zwei Urinierenden braucht sich nur einer aufs Klosett zu setzen, da, wenn ihm der andere in den Mund uriniert, das Urin durch den Körper des ersten in die Klosettmuschel rinnen soll.
Nimmt man die erste Bedeutung der Begründung an, so ist der vierte Vers so etwas wie ein erleichterter Stoßseufzer, der sich das Heilsame dessen zuruft, was endlich gelingt. Folgt man der zweiten Bedeutung, dann ist der vierte Vers überraschend: Denn er erläutert nicht die zunächst angedeutete Ökonomie des Vorgangs, sondern behauptet noch einen weiteren Zweck jener Szene, indem er das Urinieren (wischerln) für gesund erklärt. Für wen, bleibt offen: für den, der auf dem Klosett sitzt, für den, der dem auf dem Klosett Sitzenden in den Mund uriniert, oder für beide.
In beiden Fällen ist es ein geradezu klassischer Topos des Ekelerregenden und der (sexuellen) Perversion – auch ihn hat sich der Wiener Aktionismus bekanntlich zunutze gemacht –, der hier besetzt und durch die kommentierenden Pointen zugleich offengelegt wird.
Daß, wie ich glaube, pissing party viel weniger gut gelungen ist als manche andere stanzen, etwa als d’oede in ian zuan oder aus eian orphischn oaschloch, hat viele Gründe und nicht alle von ihnen mögen auf den Begriff gebracht werden können; einige jedoch lassen sich durch den Vergleich mit den zitierten stanzen und in Hinblick auf die Komplexität des Verhältnisses von Darstellung und Gegenstand begreifen.
Die in pissing party dargestellte Szene ist physisch und phyisologisch beinahe plausibel. Der einzige Aspekt, der sie als phantastisch-surreale Vorstellung nahelegt. ist die eine der beiden Bedeutungen der Begründung im dritten Vers: denn Urin kann nicht einfach durch die auf dem Klosett sitzende Person rinnen. (Würden die Personen nur lange genug warten, wäre in gewissem Sinn auch das möglich; aber dann wäre die behauptete Ökonomie hinfällig.)
So beschränken sich die ersten beiden Verse von pissing party auf die Wiedergabe eines (möglichen, vielleicht auch schon vollzogenen) körperlichen Geschehens.
In d’oede in ian zuan dagegen kann die evozierte Szene – wegen ihrer pysiologischen Unwahrscheinlichkeit – nicht allein als Wiedergabe eines physischen Vorgangs verstanden werden, auch legt der Begriff des Zorns die Deutung von seelischen Zuständen nahe und damit die entsprechenden Mehrdeutigkeiten. In aus eian orphischn oaschloch wiederum ist die Durchdringung von Begrifflichem und Körperlichem von Anfang an in der Kombination von orphisch und oaschloch gegeben.
Eine Folge der Beschränkung auf die Wiedergabe eines körperlichen Geschehens in den ersten beiden Versen von pissing party ist, daß die Szene selbst und die sie kommentierenden Pointen – : so gehds auf amoe / wischerln is gsund – weitgehend voneinander geschieden sind. Während sich in eian orphischn oaschloch die verschiedenen Gegenständlichkeiten (die konkrete physische und die des Lyrischen) im Verlauf des Gedichtes – etwa mit der Verwandlung des batzals in lyrik – immer mehr durchdringen und die Pointe im vierten Vers schließlich wie notwendig aus dem Vorgang selbst entspringt; während in d’oede in ian zuan die Szene selbst unkommentiert bleibt und zugleich ihre Mehrdeutigkeit in sich bewahrt – handelt es sich um eine Projektion des Mannes? Malt er sich seine Parodie eines Weibsteufels an die Wand? Oder wird davon erzählt, daß sich die oede dem lyrischen Ich (sexuell) verweigert hat –, bleibt in pissing party die evozierte Vorstellung des Einnehmens einer bestimmten Position in der Eindeutigkeit ihrer Wiedergabe gleichsam eingeschlossen und die kommentierenden Pointen seiner Vorstellung äußerlich.
Natürlich läßt sich die Szene dennoch als mehrdeutig lesen. Doch eben weil sie, wenn überhaupt, als Ganze zu übertragen wäre, weil also die Möglichkeit zu einer solchen Übertragung entweder von Anfang bis zum Ende gleichermaßen vorausgesetzt oder von Anfang an gleichermaßen negiert werden kann, ist sie weniger wirkungsvoll als in d’oede in ian zuan und aus eian orphischn oaschloch: Sie wird beinahe zur selbstverständlichen Annahme – alle literarischen Texte sind nicht eindeutig –, während im selben Maß das Stoffliche, eben die vorgestellte Szene selbst, allzu beherrschend wird. Der gewaltsame oder ekel- oder vielleicht auch perverse sexuelle Lust erregende Vorgang ist also dominant. Wenn es sich auch, ähnlich wie in i scheiss da in d’bappm – auf diese stanze trifft manches von dem hier Vorgebrachten zu –, um die Darstellung einer Beziehung, oder spezieller einer bestimmten kommunikativen Situation innerhalb der Beziehung handeln könnte, so wäre diese Lesart hier nicht schlüssig genug – anders als dort wird keine Wechselbeziehung zweier Personen dargestellt, sondern das lyrische Ich gebraucht die andere Person einseitig gleichsam als Vorrichtung –, um die Vorherrschaft jener Szene aufzuwiegen. So paßt sich dieses Gedicht seinem als ekelerregend und niedrig erachteten Gegenstand in höherem Maß als die anderen zitierten stanzen an und setzt zugleich, da es sich mit einer eindeutigen Wiedergabe begnügt – denn diese unterliegt wie der Gegenstand selbst den erwähnten Regelungen und Verboten –, auch die Niedrigkeit oder Verwerflichkeit der Wiedergabe ohne weiteres voraus. Das Gedicht nimmt diese angenommene zweifältige Niedrigkeit allzu sehr als Wirkung in Anspruch, die Darstellung gibt sich allzu selbstverständlich mit seiner Einheit oder Einigkeit mit dem dargestellten Gegenstand zufrieden, und das Moment oder das Extrem der Distanz zum Gegenstand, also das Zeichenhafte, wird nicht hinreichend wirksam. (Ich behaupte damit nicht, daß in diesem Fall die übliche negative Bewertung von Darstellung und Dargestelltem falsch sei, sondern nur, daß das Gedicht, wenn es überhaupt mit ihr umgeht, sie auch wirksam auf ihr Spiel zu setzen hätte; das Ergebnis eines solchen Aufs-Spiel-Setzen könnte durchaus die Bestätigung der Niedrigkeit oder Verwerflichkeit von etwas sein, selbst die Berechtigung entsprechender Verbote.)
Im Gegenzug signalisieren die beiden kommentierenden Pointen, ihre forcierte Munterkeit, ihre Form des Zynismus – auch der Titel pissing party trägt dazu bei – ein einseitiges Distanznehmen, welches das, worauf es sich bezieht, unangetastet läßt. So geben auch die Begründungen oder Erklärungen für die Szene ihren Gegenstand unvermittelt aus, bemächtigen sich ihrer eigenen Gegenständlichkeit allzu gewaltsam, sind deshalb von dem, was sie begründen oder erklären, ohne Weiteres unterscheidbar, ja, stoßen sich von der vorgestellten Szene ab.
Mit dieser Dominanz des Gegenständlichen wird auch das Dialektale vergleichsweise unwirksam oder unwesentlich. Es änderte nicht viel, wäre diese stanze in Hochdeutsch geschrieben; die Funktion des Dialekts wird in ihr vor allem darauf reduziert, das Zur-Sprache-Kommen des Dargestellten ein wenig zu verfremden und zugleich die Niedrigkeit des Gegenstandes zu bestätigen.
In d’oede in ian zuan dagegen enthält die dialektale Redeweise durch die selbstverständliche Idiomatik ihrer Bildhaftigkeit andere als die auf sinnlich Wahrnehmbares bezogenen Bedeutungen und kann deshalb verschiedene Gegenständlichkeiten, also verschiedene Lesarten, ins Spiel bringen und einander aufwiegen lassen. In aus eian orphischn oaschloch wiederum wird der Widerspruch von Hohem und Niedrigem auch innerhalb der Sprache als der von Hoch- oder Bildungssprache auf der einen Seite (orphischn, lyrik) und dem Dialekt auf der anderen ausgetragen. In beiden Fällen also spielt die dialektale Form und mit ihr die Form des gstanzls eine konstruktive Rolle.
Ein möglicher Einwand gegen meine Kritik von pissing party wiegt allerdings schwer: Gehört das (relative) Mißlingen einzelner stanzen nicht zur Konzeption ihrer Sammlung? Werden die weniger geglückten in ihrer Folge nicht selbst zu Momenten oder Extremen jener skizzierten Dialektik, so daß ihr relatives Mißlingen selbst sprechend wird? Eben angesichts der Vorstellung, daß die so saubere vernunftgemäße Trennung des Kunstwerkes von seinem Gegenstand nur ein Moment oder Extrem seines angemessenen Begreifens ist, könnte das (relative) Mißlingen einiger stanzen, wird es anderen, geglückteren aus- und entgegengesetzt, das Niedrige, Verwerfliche als ästhetisch Mißlungenes in paradoxem und pervertiertem Gelingen darstellen.
Gutes und Böses
Bestimmte Körperteile und körperliche Funktionen sind nicht die einzigenGegenstände, die heftige Empfindungen auslösen oder mit stark wirksamen Werturteilen verbunden sind. In einer Reihe von stanzen wird denn auch mit andersartigen Brisanzen umgegangen; etwa mit bestimmten gesellschaftlichen Erscheinungen und den widersprüchlichen Haltungen ihnen gegenüber. In ihnen zeigt sich der Widerspruch von moralisch zweifelhaften, häufig als verwerflich empfundenen Haltungen und solchen, die, wie es scheint, sachlich oder moralisch unantastbar sind:
es is de naduua
de wos a madl zua hua mochd
oda maanst es woa d’gsööschofd
di mi voraunlosd hod dazua
Folgt man dem Wortlaut, so vertritt das lyrische Ich eine Haltung, die heute als falsch oder wenigstens als moralisch höchst anfechtbar, ja häufig als inhuman gilt: Die Natur – eine nach zeitgenössischer Ansicht unbrauchbare Kategorie zur Beschreibung sozialer Phänomene – wird von einer Prostituierten (oder einem Mädchen, das sich aufgrund ihres sexuellen Verhaltens metaphorisch mit einer Prostituierten gleichsetzt) als Ursache ihres Verhaltens behauptet, während die (wenigstens bei den meisten Lesern zeitgenössischer Lyrik) geläufige und unbestrittene Ansicht, die gesellschaftlichen Verhältnisse führten dazu, daß Mädchen Prostituierte werden oder sich selbst als solche charakterisieren, in einer rhetorischen Frage als eklatant unzutreffend geradezu verhöhnt wird.
Dennoch liegt zunächst eine Deutung nahe, die mit der einer, wie es scheint, heute für stichhaltig und zugleich human geltenden gesellschaftstheoretischen Erklärung vereinbar und zudem psychologisch plausibel ist: daß das lyrische Ich durch seine Sozialisation zur Nichterkenntnis seines eigenen Zustandes verurteilt ist; daß es eben deshalb das, wie es scheint, triviale Klischee – die nicht zuletzt für es selbst unzumutbare Erklärung – blindlings produziert; als Folge jener Entfremdung vielleicht, die eine zeitgenössische Gesellschafts- oder Seelentheorie ihm als Preis für die soziale Rolle, die es zu spielen verurteilt ist, zuschreiben würde.
Einer solchen Deutung widersprechend wird der Dialekt hier aber als eine subversive Gegenstimme hörbar, die dieses Gedicht anderen Lesarten ausliefern kann, die einen wahren Abgrund peinlicher und peinigender Fragen aufreißen.
Denn stellt das lyrische Ich nicht die moralisch und erkenntnistheoretisch als unantastbar angesehene Erklärung gerade durch ihre Form in Frage? Wird die Erklärung durch das mit dem Dialekt angedeutete gesellschaftliche Milieu nicht etwas Fremdes oder Entfremdetes und deshalb etwas lächerlich Unangemessenes? Diese Erklärung wirkt angesichts der in Anspruch genommenen natürlichen oder naturgemäßen Erfahrung des lyrischen Ich – hier wird das Natürliche durch den Dialekt tatsächlich nahegelegt; allerdings keineswegs verklärt – ebenso weit hergeholt, wie sie abstrakt, ja womöglich auch leerlaufend erscheint. Und dieses Weithergeholte, Abstrakte oder gar Leerlaufende zeigt sich insbesondere dadurch, daß das Wort Gsööschofd, so wie es hier – als geradezu soziologischer Terminus – verwendet wird, keines ist, das in die Sphäre des Dialekts hineinpaßt. Es ist sozusagen dialektisiert und bleibt – als eine Art Fremdwort – fremd.
So mag in dieser stanze die subkutane Abhängigkeit der Gesellschafts- und Seelenwissenschaften von der zumeist nicht reflektierten Dichotomie Natur/Gesellschaft und zudem von ethischen Normen fühlbar werden und damit auch etwa die Frage nach der Wissenschaftlichkeit oder dem empirischen Wert der Gesellschafts- und Seelenwissenschaften. Vielleicht wird hier also die Unangemessenheit eines gesellschafts- oder seelentheoretischen Diskurses bloßgestellt, der es gut meint, aber die Rechnung ohne die Natur des Menschen, ja der Wirklichkeit selbst – was immer beides sei – macht. Und diese Möglichkeit führt zur vielleicht beunruhigendsten Lesart: Wird durch die Sprechmaske der Prostituierten oder des Mädchens, das sich als solche metaphorisch bezeichnet, nicht so etwas wie Spott und Hohn über die angebliche Emanzipation des Menschen von der Natur und über all seine Kategorien der Selbstaufklärung ausgeschüttet? Die brutal-zynische Erklärung, die ein soziales Verhalten als Natürliches und deshalb Unveränderliches, endgültig Vorgegebenes klassifiziert, wird hinterrücks und peinlicher, ja peinigender Weise auf ihre Art plausibel. Umgekehrt geraten dann aber auch die gesellschafts- und seelentheoretischen Erklärungen, ja das Nachdenken über die menschlichen Dinge überhaupt, in Verdacht, nichts anderes zu sein als ein Reflex der Natur, nichts als die unwillkürliche Legenden- oder Mythenbildung einer gebildeten, des Hochdeutschen mächtigen und insofern privilegierten Schicht, die sich dem Schein hingibt, daß sich ihre Erklärung von eben jenen Bedingungen emanzipieren könnte, die sie als unangemessene oder triviale und klischeehafte Metapher Natur zu demaskieren vorgibt.
Wird diese stanze so gelesen, dann führt sie wahrlich in die Dunkelheit – und nicht zuletzt zurück in die Dunkelheit der Fragen nach dem Verhältnis des lyrischen Ich und der lyrik zu ihrem Gegenstand: Wer oder was spricht in dem Gedicht und worüber spricht das, was spricht, und was kommt in dem Gedicht in welchem Sinn zur Sprache? Wenn in dieser stanze nicht oder nicht ausschließlich in einer Art Rollen-Lyrik die brutal-reduktionistischen und zugleich so trivialen wie klischeehaften Vorstellungen eines als moralisch verwerflich internalisierten Verhaltens in kritischer Absicht (wie es so schön heißt) vorgeführt werden, wenn das Gedicht andererseits auch nicht einfach eine brutale, triviale und klischeehafte Äußerung, also Zynismus in Gedichtform, ist – was wäre dann dieses Dritte, zu dem seine Momente und seine widersprüchlichen Lesarten zusammenfinden oder aus dem sie entspringen?
Unchristliches Christliches
In seinem nachwort zu den stanzen schreibt Jandl:
was immer der geneigte leser bisher an poetischer höhe zu erreichen getrachtet hat, wird sich ihm auch in diesen stanzen eröffnen – bloß mit einer da und dort merkbaren verschiebung in die tiefe der poesie.
In schöner Untertreibung und subtiler Ironie deutet Jandl hier die Spannweite seiner stanzen an: Mit aller poetischer Höhe, etwa mit dem orphischen Dichtermythos. mit all den großen klassischen Themen Tod, Liebe, Dichtung, wie sie sich in den stanzen entfalten, hinab in die tiefe der poesie, bis zum letzten Dreck, zu den Ausscheidungen, ja dem Ausgeschiedenen, seien es die Klischees, Trivialitäten, Gemeinheiten und Dummheiten eines sogenannten Volksmundes oder auch das batzal Exkrement auf der Zunge.
Wie schon manche andere seiner Gedichte (etwa jene in einer „heruntergekommenen Sprache“) vollziehen die stanzen auf ihre Weise ein Hinabsteigen in die Unterwelt. Auf daß diese auch wirklich die untere Welt sei, wird der orphische Mythos aus seinen klassischen und seinen erhabenen Bezügen gelöst, ja vielleicht aufgelöst: Aus der Unterwelt wird das, was ethisch oder ästhetisch, gesellschaftlich oder seelisch unten ist. Der Jandlsche Gesang rührt vielleicht nicht die Steine, aber er bringt das eine oder andere batzal zum Singen und vor allem das nach allgemeiner Übereinkunft Niedrige, Schimpfliche, Verächtliche. Die Lyrik, das Hohe selbst, soll das Tiefste werden, das Erste das Letzte und das Letzte das Erste; vielleicht, mit der Folge all der erwähnten peinlichen und peinigenden Fragen, die solche letzten Dinge eben durch ihr Zur-Sprache-Kommen zu stellen verlangen.
So läßt sich angesichts der stanzen und im Besonderen von in eian orphischen oaschloch der Mythos des Orpheus verallgemeinern: Das Gedicht wird zu dem, was die höheren und niederen Sphären oder Welten in all der Vieldeutigkeit dieses Wortes zusammenbringt, indem es die höheren hinabsteigen läßt oder das Hohe auch im Tiefen entdeckt. Und eben deshalb läßt sich jener Mythos – wie es in Dichtung, aber auch bildender Kunst oft genug geschehen ist – als Bild eines Erlösungsversuches. etwa als ein Bild Christi sehen, so daß andererseits der Kunst – wie ihre höchsten, erhabenen oder auch lächerlichsten Vorstellungen es wollen – ihrerseits eine Art Erlöser- oder Christus-Rolle zugemutet wird.
Und so ist es wohl kein Zufall, daß sich am Ende der stanzen vier thematisch christliche Gedichte finden („Christtag, No. 1–4“). Konsequenterweise sind aber auch diese Gedichte alles andere als erbaulich oder affirmativ, ganz im Gegenteil scheinen sie die christlichen Glaubens- und Hoffnungsinhalte, ja die christlichen Grundannahme, daß alles seinen Sinn habe, schonungslos zu destruieren:
CHRISTTAG, NO. 4
ob i amoe in himmö kummat?
friara howe a menge bett.
ob ma des hait wea aunrechnan datt?
i waass nett
Einmal abgesehen von dem Wink, das Wort Christtag als einziges der ganzen Sammlung mit einem Versalbuchstaben beginnen zu lassen – als ob nur es allein, weil der Begriff Christus in ihm enthalten ist, die Großschreibung verlangte; oder ist auch dies vor allem ironisches Zitat einer Konvention? –, scheint die schwache Hoffnung, die bleibt, eine ex negativo zu sein: daß man schließlich auch nicht wissen kann, ob Glaube, Hoffnung, ja die Sinnvorstellungen des Christentums tatsächlich unsinnig sind.
In der folgenden stanze aber ist nicht einmal mehr diese Hoffnung aus dem Negativen gegeben. In ihr erscheinen christliche Glaubensinhalte nur noch als brutale Infamie:
CHRISTTAG, NO. 2
geschrian hods oes wiara sau, soge da
bein ooschdechn – derawäu hods
gwis a gaunz a schippl glaane sintn biasst
was nix nutzn daadad, wauns int höll miasst
Der ganzen bösartigen Dummheit ihrer allzumenschlichen Gestalt ausgeliefert scheinen hier die christlichen Vorstellungen. Es sei denn, man schöpfte daraus Hoffnung, daß sie in den stanzen zur Sprache kommen, daß sie – wie jenes orphische batzal – lyrik werden können. Dann könnte die angesichts von Gewalt, Leid und Tod himmelschreiende Absurdität, ja Nichtigkeit christlicher Glaubensinhalte dennoch nicht das letzte Wort haben. Als ob die Poesie erst dann, wenn sie sich an das Kreuz der anscheinend trivialsten, abgeschmacktesten Vorstellungen des Christlichen nagelt und diese sich an die erbärmlichste Form der Poesie – wenn sie also den Opfertod Christi als Selbstopfer des Gedichtes nachvollzieht –, ins Niedrigste, Verwerflichste und Schimpflichste, ja in ihr tiefes Grab hinabsteigen könnte und durch diesen rückhaltlosen Untergang zu dem leisen Zweifel daran berechtigte, daß alles vergeblich ist:
LITERATUR UND TOD
d literatur, des wisz jo
is a gaunz a diaffs grob
wo kaana drin waas
ob a jemoes a r aufaschdehung hod
Franz Josef Czernin, aus Franz Josef Czernin: Apfelessen mit Swedenborg, Grupello Verlag, 2000
Jandls stanzen im Kontext der österreichischen VolXmusik
Von den Schwierigkeiten der Literaturwissenschaft mit Jandls stanzen
Literaturwissenschaft und Literaturkritik hatten ihre Probleme mit diesem schwer zu fassenden Werk. So stammt wohl die meist zitierte Reflektion zu den stanzen aus dem selbstverfassten Nachwort Jandls, in dem er den „Tiefgang“ der Texte anklingen lässt:
was immer der geneigte leser bisher an poetischer höhe zu erreichen getrachtet hat, wird sich ihm auch in diesen stanzen eröffnen – bloss mit einer da und dort merkbaren verschiebung in die tiefe der poesie.
Auf offensive Weise bringt Jandl in dieser Sammlung die literarische Produktion nicht nur in umgangssprachlich-dialektale Nähe, sondern vergleicht sie sogar mit dem Stuhlgang:
aus aian orphischn oaschloch
druckts es maunchmoe a batzal
nemtsas glei auf de zungen
olle lyrik gheat gsungen
Anhand dieses Gedichts geht der österreichische Schriftsteller, Literaturtheoretiker und Kritiker Franz Josef Czernin den Mehrdeutigkeiten in stanzen nach und zeigt dabei Jandls Grenzwanderung und fehlende Unterscheidung zwischen hoher und populärer Literatur, etwa bei den außerdialektalen terminologischen Einschüben wie „orphisch“ und „lyrik“. In dieser wie in anderen Stanzen werde dem Dichter nahegelegt, Verwerfliches und Tabuisiertes zu besingen. Dieses zweifach niedere Sprechen – Schimpfen im Dialekt – rückt Czernin nach der Besprechung einzelner Gedichte, wobei sich so manche Brüche zwischen den Texten und deren Besprechungen offenbaren, in die Nähe des Abstiegs in die Unterwelt, eines verallgemeinerten Orpheusmythos, der einem Erlösungsversuch gleichkommt und der Kunst eine Christusrolle zumutet. Dabei werde aber die christliche Grundannahme der Hoffnung und des Sinns schonungslos destruiert.
Wenn man Jandls stanzen in ihrer Gesamtheit liest bzw. hört, fällt es schwer, Czernin beizupflichten. Die Abstraktheit seiner Interpretation steht in einem fühlbaren Kontrast zur Direktheit der stanzen. Czernin gesteht seine Probleme mit verschiedenen Stanzen ein, so mit der folgenden:
PISSING PARTY
du setzt di aufs klo
i mochs in dein mund
so gehds auf amoe
wischerln is gsund.
Die Distanzierung der Darstellung vom Gegenstand und somit das ganze Gedicht erscheint Czernin hier nicht gelungen. Besonders mit der Zweideutigkeit des dritten Verses tut sich seine genaue Lektüre schwer:
Entweder wird das Urinieren durch die seltsame Position der involvierten Personen für eine von beiden wieder möglich – es geht auf einmal wieder –, oder die Szene wird durch eine, in diesem Zusammenhang absurde, Ökonomie begründet: Von zwei Urinierenden braucht sich nur einer aufs Klosett zu setzen, da, wenn ihm der andere in den Mund uriniert, das Urin durch den Körper des ersten in die Klosettmuschel rinnen soll, vermischt offenbar mit dem Urin dessen, der auf dem Klosett sitzt (beides geht auf einmal). Der auf dem Klosett sitzt, wird also selbst zu einer Art Klosett, sein Mund zum Abfluss.
Czernin sieht in der physischen und physiologischen Plausibilität einen Verlust der Mehrdeutigkeit. Nur ein Teilaspekt lege die Szene als surreale Vorstellung nahe, nämlich eine weitere Bedeutung des dritten Verses:
denn Urin kann nicht einfach durch die auf dem Klosett sitzende Person rinnen. (Würden die Personen nur lange genug warten, wäre in gewissem Sinn auch das möglich; aber dann wäre die behauptete Ökonomie hinfällig.)
Dialektsprecher und Kenner der volkstümlichen Gstanzeln haben wohl mit dieser Auslegung ihre Schwierigkeiten, denn das Gedicht erscheint durchaus mehrdeutig – es vermischt auf ironisch-respektlose Weise Gesundheitsmotiv, sexuelle und sadomasochistische Vorstellungen mit manchem mehr.
Gerade der letzte Vers muss nicht in einer linear-aufbauenden Logik zu den vorhergehenden gedacht werden. Oftmals lenken die letzten Verse oder das letzte Reimwort der traditionellen Gstanzeln von der zuerst erzählten Anekdote oder vom zentralen Gedanken ab und enttäuschen die Erwartunghaltung. Dabei entfernen sie sich meist von vorbereiteten sexuellen Anspielungen und bestätigen sie zugleich durch diese Verneinung, oft durch einen fehlenden Reim, wobei ein erwartetes – aber nicht gesungenes – reimendes Wort der vorhergehenden sexuellen Anspielung gerecht werden würde. Bei Jandl hingegen führt die letzte Zeile nicht von sexuellen Assoziationen weg, sondern leitet sie in neue, weniger gebräuchliche Richtungen, wobei er den Bruch des letzten Verses der Gstanzeln beibehält.
Es ist somit ein Text, der sich bewusst einer literaturwissenschaftlichen und allzu rationalen Auseinandersetzung entzieht – und man kann ihn nur im Kontext der Traditionen schätzen, verstehen und letztlich darüber lachen.
Auch Wendelin Schmidt-Dengler schlägt in eine ähnlich abstrakte Presche. Für ihn machen die stanzen insbesondere die Kluft zwischen Leben und Poesie bewusst und zeugen davon, dass diese beiden nicht harmonisch nebeneinander bestehen können.
Michael Hammerschmid nähert sich den stanzen behutsamer und weist vor allem auf ihre Absurdität und Mehrstimmigkeit hin, statt Details zu (über)interpretieren. Als übergreifendes Prinzip erkennt er die Variation sowie die Grundspannung der Ambivalenz, welche als überraschende Wendungen, als Paradox, als dialektische Szene, als skeptischer Widerstreit, als unauflösbarer Gegensatz, als depressive Ich-Spaltung oder als rabelais’sches Lachen auftaucht. Mit seinem Hinweis darauf, dass die Texte ihre Stärke aus einer Naivität, einer Bauernschläue, einer infantilen Lust, einer Grenzenlosigkeit und einer Hemmungslosigkeit beziehen, rückt Hammerschmid die stanzen in die Nähe der traditionellen Gstanzen, wenn auch nicht explizit. Er erwähnt das Festartige, wobei jede Stanze für einen Moment aus dem Kollektiv heraustritt und nach seiner Geschichte wieder ins Glied zurücktritt.
In einem weiteren Beitrag betont Hammerschmid auch die „rücksichtslose Neugierde und Offenheit anderen Ausdrucksformen gegenüber“, die im Auftauchen von englischen und schriftdeutschen Stanzen offenbar wird. Der Subjektivierung und Singularisierung des Ausdrucks stellt er das Sprechen als kollektive, heterogene Tätigkeit gegenüber, in der Redewendungen, Floskeln, Allerweltsätze und Plattitüden eingearbeitet sind.
Hammerschmid ist sich auch der Grenzen der philologischen Zugänge bewusst, wenn er in folgender Stanze die Rede von der eigenen Sexualität zwar erkennt, aber nicht festmachen kann und so zu fragen fortfährt:
i waas ned wie oft
und scho goaned ob immer
aber eher a bissl weniga
und amoe gwiss nimma
Woher aber kommt die Gewissheit, dass es sich tatsächlich um den Sex handelt? In welchen Feinstrukturen des Sprechens bildet sie sich ab? Kein Lexikon dürfte diese Nuancen in der nötigen Präzision verzeichnen. Und dennoch scheint die Deutlichkeit dieses anspielungsreichen Sprechens zum Allgemeinwissen zu gehören, das sich gleichsam unterhalb der offiziellen Sprache äußert. Woher aber stammt dieses Wissen? Sind es die Gemeinplätze und Klischees des (sprachlichen) Bewusstseins, in denen es sich ablagert? Wo aber fängt ein Klischee an, und wo hört es auf?
Nicht ganz zufällig führen die stanzen zu mehr Fragen als zu Antworten. Darum mag ein Wegrücken von literaturwissenschaftlichen Annäherungen und ein kulturwissenschaftlicher Zugang, der die Sammlung in eine Tradition stellt, hier erhellend sein.
Jandl als Musiker
Klar ist, dass sich der Dichter zutiefst von Musik beeinflussen hat lassen. Eine große Affinität zur Musik und eine intensive Auseinandersetzung mit musikalischen Formen wurde mehrmals festgestellt. Jandl ließ sich sogar zu Aussagen hinreißen wie „Wenn ich Musik machen könnte, würde ich keine Gedichte machen, oder nur ganz nebenbei.“
Seit seiner Schulzeit war er ein großer Fan des Jazz, doch seine beeindruckende Sammlung von über 1.100 Schallplatten und ca. 700 CDs deckt eine erstaunliche Bandbreite an (auch sehr progressiven) Genres ab. Selber arbeitet er ab 1966 mit Jazzmusikern, zuerst mit dem Pianisten Dieter Glawischnig und dem Bassisten Ewald Oberleitner, später mit der Big Band des NDR. In mehrere Schallplattenaufnahmen mündet die Zusammenarbeit mit dem Vienna Art Orchestra unter Mathias Rüegg in den 80ern Jahren. Doch auch viele andere österreichische Musiker mussten Jandl nicht lange zu seiner Zusammenarbeit überreden, so Roland Leopold Neuwirth oder Martin Haselböck. Immer wieder schreibt er vom Jazz wie in dem affirmativen und überschwänglichen Gedicht „ja“:
ja
ja
jazz
yes
jazz
jesus
Diese Erhebung ins Religiöse – bzw. die Mehrdeutigkeit des finalisierenden erstaunten Ausrufs – wird im Gedicht „rebirth“ mit einer überbordenden sexuellen Phantasie noch übertroffen:
when born again, i want to be
a tenor saxophone
and who d’you think will do
the blowjob?
if it’s up to me, there’s gonna be
total promiscuity
Wenn auch der Jazz Jandls musikalischer Hauptreferenzpunkt bleibt – seine Variationen und sein Rekombinieren der Textelemente spiegelt an manchen Stellen die Spontanität des Jazz wider –, thematisiert Jandl darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer musikalischer Gattungen, Werke und Komponisten in seiner Lyrik, vom Marsch zum Weihnachtslied, von der Hymne bis zum Boogie-Woogie, vom Choral bis zur Oper. Einzelne Gedichte fixiert er gar als Partituren. Später entdeckt er sein Interesse für Rap, Hiphop und eben für die progressive österreichische VolXmusik.
Attwenger und die österreichische VolXmusik
Die Band Attwenger, bestehend aus Markus Binder (geb. 1963) und Hans-Peter Falkner (geb. 1967), löste sich von der 1989 in der Linzer Stadtwerkstatt gegründeten und traditionelle Musik spielenden Formation Urfahraner Durchbruch aufgrund ihrer extremeren musikalischen Auffassungen. Attwenger wurde zum Aushängeschild einer Bewegung, welche von den 90ern bis heute in Österreich und Bayern die Musik des Crossover-Bereichs entscheidend mitprägt: die VolXmusik, welche sich mit dem X im Namen bewusst von dem Musik-Genre der Neuen Volksmusik mit kommerzieller ausgerichteten Künstlern absetzt. Es handelt sich dabei um eine aggressivere Richtung, welche Elemente der Volksmusik in neue Kontexte setzt, Punk oder HipHop dazu aufgreift und in den Texten zumeist die eigenen Landsleute kritisiert. Gerade mit dem X in VolXmusik wird ein politisches Statement über eine Ablehnung der traditionellen Orthographie und die klare Distanzierung vom belasteten deutschen Wort „Volk“ hinaus gegeben: Das X wird einerseits immer wieder auf Wahlplakaten im Schriftbild in einer zweiten Bedeutung als Wahlkreuz eingesetzt, andererseits ist die Verwendung des X ein Zeichen linker Unabhängigkeitsbewegungen wie der Basken.
Rückbesinnung findet bei der österreichischen VolXmusik in diesem Sinne weniger hinsichtlich einer geschönten Heimat statt, sondern hinsichtlich eines lokalen, anarchistischen oder linken Widerstands, der zumeist kultureller Natur gedacht wird. Bei den vielen Livekonzerten – zuerst in alternativen Kulturstätten wie der Linzer Stadtwerkstatt und der Kapu sowie dem Schwertberger Kanal – wurde die Musik vom Publikum mit dem Pogo, einem Anti-Disco-Tanz der alternativen Punkbewegung, sowie mit Stagediving, Sprüngen einzelner Zuhörer von der Bühne in die sie auffangende Menge, begleitet. Die alpenländische Volksmusik wird dabei übrigens vom zumeist urbanen Publikum oft genauso exotisch empfunden wie andere sogenannte Weltmusik aus anderen Teilen des Globus.
Attwenger und stanzen
Im Nachwort erwähnt Jandl selbst die bestimmenden Einflüsse für seine stanzen. Die erste CD Attwengers most wird dabei als Inspiration hervorgehoben und gelobt:
,attwenger‘ markus binder, schlagzeug und hans-peter falkner, ziehharmonika, musik und text, die einen kenner von jazz, rock und konkreter poesie nicht unbewegt lassen konnten.
Volker Kaukoreit zitiert einen Kurier-Artikel, der von Jandls begeisterten Ausruf 1991 weiß: „Konkrete Poesie ist Attwenger“ und zeigt Berührungspunkte zwischen Attwenger und der experimentellen Literatur rund um Jandl auf – z.B. typographische Anordnungen im Booklet der CD most oder Mehrdeutigkeiten der Texte.
Dabei zeichnet er ein Bild, in dem die Musikgruppe vermeintlich von der Konkreten Poesie inspiriert wurde, und dreht damit die Ausgangbasis um. Seine These untermauert er mit der Dominanz der Kleinschreibung, spielerischen Neologismen, Wortbedeutungs-Reflexionen, Chiasmen, kuriosen Lautfolgen und der Beschäftigung mit dem Dialekt als Schnittstellen der Attwenger-Texte mit der Konkreten Poesie und Jandl. Allerdings kann seine Annahme so wohl nicht bestehen, denn diese erwähnten Elemente sind wohl beim Großteil aller progressiven Künstlerbewegungen Österreichs zu finden, die aber nur sehr bedingt bewusst auf Arbeiten der Konkreten Poesie aufbauen. Weniger Attwenger steht in der Tradition Jandls, als umgekehrt, wobei selbstverständlich nicht die Originalität Ernst Jandls angezweifelt werden soll, sondern seine Offenheit gegenüber anderer Genres betont wird.
Kaukoreit erkennt zwar aggressive Seiten dieser Musik, doch er kümmert sich nicht um eine weitere Einordnung dieses Genres, welche aber für die Verortung des Einflusses von großer Bedeutung ist. Jandls eigene Erwähnung Attwengers als Inspiration seiner stanzen kann ruhig ernst und wörtlich genommen werden. Er blieb übrigens auch nach dieser Arbeit an den Produktionen des eigenwilligen Duos interessiert; in seinem Nachlass finden sich mehrere ihrer CDs.
Doch zurück zu Jandls stanzen und zur ersten CD der Gruppe, auf der zumeist traditionelle Gstanzln, die Tanzmusik des Landlers begleitende Vierzeiler, zur aggressiv gespielten Landler- und Schleunige-Melodien gesungen werden. Neben einem Akkordeon sorgt ein Schlagzeug für die kraftvolle Dynamik der Punkmusik sowie des traditionellen Schuhplattelns, Stampfens und Paschens, des gemeinsamen rhythmischen Klatschens, bei dem per Kombination aus Klatschen mit der flachen und der hohlen Hand komplizierte Rhythmusgebilde entstehen können. Das Schlagzeug stellt hier einen idealen Ersatz dar.
Attwenger konnte dabei auf ein großes Reservoir an Texten zurückgreifen. Die traditionellen und sehr lebendigen Gstanzln werden in weiten Teilen des Alpenraums noch immer aus dem Stegreif im Dialekt gedichtet und weiter entwickelt. Eine – auch heute noch großteils – schriftlose Überlieferung erlaubt immer wieder neue Improvisationen und Variationen. Der Vortrag der frechen Texte kann auch in einer Art Wettkampf mit wechselseitigem Singen ausarten, bei der die Schlagfertigkeit und Kreativität unter Beweis gestellt werden soll. Da verwundert es wenig, wenn Jandl von dieser Form in Bann gezogen wurde wie von keiner Textsorte zuvor: Allein bei Spaziergängen in Puchberg am Schneeberg im August 1991 zeichnete er seine über 200 stanzen nahezu komplett auf:
Meine Mobilität erfuhr durch die Aufzeichnung der zahlreichen Gedichte keine nennenswerte Einschränkung, da die vierzeilige Kurzform des ,Gschdanzels‘ (im Bayrischen ,Schnadahüpfels‘ – vermutlich ein ,Lied‘ das zum Tanz der Schnitter gesungen wird) sich auf kleinsten Zetteln auch im Gehen notieren ließ. Es war, in meiner Zeit als Autor, das erste und bisher einzige Mal, daß eine vorgegebene poetische Form so vollständig von mir Besitz ergriff, daß diese die alltäglichsten Themen in spielerischer Leichtigkeit sich entfalten ließ.
Zum ersten Mal schreibt er exklusiv in einer literarischen Form und schätzt sie hoch, denn im Nachwort stellt er die Beschäftigung mit den stanzen auf eine Ebene mit seinen großen Schaffensperioden, seinen realistischen Gedichten ab 1952, dem Gang ins Experiment ab 1956 und der Entdeckung der heruntergekommenen Sprache 1976.
Jandls Dialektverwendung
Wie in der urbanen Aufführungspraxis Attwengers ist der Dialekt bei Jandl keine authentische Sprechweise, nichts Urspüngliches und Originales, sondern als Abweichung, Experiment und Verwandlung zu verstehen.
Jandl lernte zwar den niederösterreichischen Dialekt (und Stanzen) bei Sommeraufenthalten kennen, ein Dialekt, der dem Jandl vertrauten Wiener sehr ähnlich war. Prägend für Jandls Verhältnis zum Dialekt dürfte seine Stigmatisierung durch die Eltern gewesen sein, nach denen die gebildete Schicht Schriftdeutsch zu sprechen habe. Dieses Klassenstigma, das die Mutter Jandls auf den Dialekt projiziert, erkennt Hammerschmid als eine Grundspannung in Jandls Stanzensprache, deren Gestus oft mit ketzerischem Ton aufgeladen ist. Dementsprechend sind die Dialektgedichte keine Rückkehr in die Sprache einer Kindheit, sondern etwas Erfundenes.
i hob do in mia
so ar oat dialekt
den howi ned von da muata griagd
howin grod east entdeckt
Jandls Vierzeiler spricht von einem neu entdeckten Dialekt, der nicht von außen kommt, sondern eine innere Sprache bedeutet. Er verwendet selbsterfundene Dialektworte, Neologismen außerhalb der schriftdeutschen Sprache. Der Dialekt „fluktuiert in schreibung und schreibweise – bis hin zu selbst erfundenen formen wie ,sittä‘ für sittich, wohl von niemand bisher gebraucht. es ging nicht an, eine normierung des dialekts zu erstreben, wo zu den poetisch nutzbaren vorzügen dieser art sprache gerade ihre ungenormtheit zählt.“
Das Rohmaterial des Dialekts fasziniert Jandl schon lange. In seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen erläutert er seine „heruntergekommene Sprache“:
diese Sprache [ist] poetisch unverbraucht, wie es einst, zu Beginn der fünfziger Jahre, der Dialekt war; sie erlaubt die Behandlung von Themen, die im Gedicht konventioneller Sprache heute kaum mehr möglich sind.
Der Dialekt wird aber von Jandl mit den stanzen lange nach den 50er Jahren, in denen man in der Wiener Gruppe intensiv mit dem Dialektgebrauch in der Poesie experimentiert hat, als direkter Draht zum Leser und Publikum und zur Verstärkung der Aussagen genutzt, einmal wird er explizit als Übersetzungshilfe für existentialistische Schwere gebraucht:
mia r olle san entlich
oda is des zu schwaa faschdäntlich
mia miassn olle boid grepian
ged viellaichd laichda in aicha hian
Attwengers most als direkte Inspiration
Die Entscheidung, den Dialekt 1991 zu verwenden, war vor allem der Gruppe Attwenger geschuldet. Dass die Begeisterung Jandls für Attwenger seine guten Gründe hat, zeigt sich nicht nur in der radikalen Einstellung zur Kunst, welche die Gruppe vertritt (z.B. nicht enden wollende Soundchecks während ihrer Konzerte machten diese des Öfteren zu nächtelangen Veranstaltungen). Doch auch ihre oft von Geselligkeit und Alkoholkonsum berichtenden Gstanzln weisen tiefe Hinter- und Abgründe in spannenden sprachlichen Umsetzungen auf.
Ein Nachweis der Beeinflussung Jandls durch die traditionellen Gstanzln vermutlich durch die Vermittlung Attwengers sei anhand einiger ins Auge – oder besser gesagt ins Ohr – fallenden Beispiele genannt.
Die Themen und die Sprache der Gstanzln der namenlosen, spontanen Dichter und Sänger können zärtlich und emotional, aber auch derb und hart sein, wobei ein traditioneller – mittlerweile auch geschriebener – Ehrenkodex ,unsaubere‘ Gstanzln in Männerrunden zu späteren Stunden verbannt. Jandl befreit diese Gstanzln in seinen Texten von den verrauchten und alkoholschwangeren Hinterzimmern und bringt sie in den Vordergrund. Dabei spricht er Sexualität und Tod genau wie diese versteckte Tradition sehr deutlich und schonungslos an, bzw. geht über die Traditionen in seiner Brutalität hinaus, wenn er z.B. Pädophilie aus der Sicht der Täter schildert.
Inwieweit er dabei in der Nähe der traditonellen Gstanzeln bleibt, zeigt sich immer wieder:
hiatz schmeiß i mein huat in bo
und spring eam söba no
jo wie mi mei oida schotz
a niama mog.
So lautet ein Vierzeiler von Attwenger, eine traditionelle Gstanzl, wobei die angesprochenen Selbstmordgedanken durch den lebensfrohen Rhythmus konterkariert werden. Die bekannten Verse hatte Jandl sicher im Ohr, als er selber in derber Form dichtete:
i schmeiss mäne eia
am besten ins feia
mein schwonz obm drauf
befua r i dasauf
Die intertextuellen Bezüge auf lexikalischer, phonetischer sowie semantischer Ebene sind offensichtlich. Inhaltlich gibt es weitere klare Berührungspunkte zwischen den Texten, z.B. die nachträgliche Perspektive auf die ausschweifende Jugend und ihre Lebenslust, nochmals Attwenger:
waun is aufdeng auf mei junges lebm
wo is überoi bin ummanaundagleng
hintan heibodntial und im henastoi
woaß da deixl ned wo überoi
Auch hier zeigt sich Jandl um eine Nuance pessimistischer, sein singendes Ich musste seine Promiskuität mit Syphilis bezahlen, immerhin bleibt ihm noch die Musik:
mai god i hobs drimm
und daun fongi an siff
seita mochi nua no musi
owa ned ima nuar an riff
Attwenger singt, wie die traditionellen Gstanzln, gern von rauschenden Festen und von der Lust nicht mehr heimzugehen. Jandl übernimmt auch diese volksnahe Einstellung in manchen Versen:
ge, gimma rosch a bia
hob heit gaunz an haufn gschrim
owa dos i draun vaduascht
wa ma weniga wuascht
Die Ambivalenz, der Widerspruch zwischen den frohen Rhythmen und den trübsinnigen Worten, ist dabei für Jandl typisch:
homa boa floschn drunkn
schbritzn scho a boa funkn
miassn a boa floschn no hoin
waumma glicklich sein woin
Jandl übernimmt sogar manches der semantisch-lexikalischen Logik der Traditionen, so wenn er das Knie wie bei Attwenger als erotisierenden Körperteil ortet, was in den 90ern des letzten Jahrhunderts wohl keineswegs mehr den außertextuellen Gegebenheiten entsprach.
sie stön si recht reizend 4
sogoa bis zu die knia
weida deafst ned auffischaun
Ähnlich wie in dieser Attwengerstrophe konzentriert Jandl erotische Gedanken auf das Knie:
gge, liabe mariiia –
ziag däne knii aun
i deed soo gean amoe do druntaschliafn
maansd daadad i des diaffn?
Wie Attwenger und die zur späten Stunde vorgetragene Volksmusik scheut auch Jandl nicht vor vulgärer Sprachverwendung zurück und gebraucht eine Unzahl von Kraftausdrücken. Insbesondere das „Scheißen“ hat es ihm angetan, z.B.:
scheissn, und in kopf
is sofuat a neix gedieht doo
kunnt ma do ned sogn „a gedicht scheissn“?
wauns a gschissanes gedicht is, joo.
Neben den semantischen und lexikalischen, gibt es manche sprachliche und grammatikalische Parallelen, wie etwa die Lust an Aufzählungen, eine Technik, mit der Attwenger sogar vollständige Lieder formt, z.B. auf der CD pflug: „& a kiaschkern & a reamscheibm / & a boßgeing & a glosschaem“ oder „a weng a suppm & a weng a fleisch / a weng a mogas & a weng a foasts“. Bei Jandl sieht dies dann etwa so aus: „a schdiggl flääsch und a haufn baana“.
Attwenger verwendet gerne Inversionen, Chiasmen, Anadiplosen und Kyklosen, woraus mit immer weiterführenden Reimanschlüssen ein ganzes Lied konstruiert wird, wie „1+2,3“:
und koid is ned woam
und reich is ned oam
oam is ned reich
und ungrod ned gleich
gleich is ned ungrod
da wong dea hod 4 rod
4 rod hod da wong
und singa is ned song
usw.
Inversionen und Wiederholungen sind ein immer wiederkehrendes Stilmittel der traditionellen Volksmusik wie der punkigen VolXmusik:
gestan und heit
hod die sunn so sehe gscheint
hod nu nia so sehe gscheint
ois wia gestan und heit.
Jandl bewegt sich diesbezüglich sogar auf der Metaebene und spricht das Stilmittel der Umkehrung direkt an, wenn er erwähnt, dass man einen Sachverhalt auch anders „drehen kann“:
bessa schdumm sein oes gschduam
maanen die aan
bessa gschduam sein oes schdumm
so kaummas aaa draan
Doch vor allem ist es der vielschichtige und paradoxe Gebrauch der Möglichkeitsform, des dialektalen Konjunktivs, den traditionelle Gstanzln und Attwenger auf bizarre Höhen treiben, so eine verdrehte Stellungnahme des „singenden Ichs“ zu seiner Angst vor der weiblichen Sexualität:
und aum heibodn is a mensch drobm
und wauns ned drobm wa, war is lengst scho drobm
und weis dromen is, is ma goa ned gwiß
weis aum heibodn dromen is.
Die Unsicherheit der Sexualität im Konjunktiv findet sich auch bei Jandl:
wauni in buch be ag nidaesterreich a woama waa
wissad i ned owe ned in buchbeag nidaesterreich a oama waa
wäue i nämlich goaka gsööschofd hed
wauns in buchbeag nidaesterreich laichd ned an zweidn woaman gebm ded
Jandl steht Attwenger auch sonst nicht nach, seine Konjunktivkonstruktionen bilden skurrile Gedankengerüste:
BLEIBEN WERDEN
waun i weadat wiari sein woiddad
wari weniga gean hin
oes i waa waun i des blaiwad
wos i dodsechlich bin
Sogar sein professionelles Wappentier flicht Jandl in ein Gedankenspiel mit Möglichkeitsformen auf mehreren Ebenen ein:
DER MOPS
des is dea dea i waa
wauni oes a mops aufd wööd kuma waa
oowa wäu i ned oes a mops boan woan bin
is des ned drin
So wie Attwenger wortgetreu traditionelle Gstanzen übernimmt, endet Jandl außerdem immer wieder in Schlussversen, die stark an traditionelle Gesänge wie Wiener Lieder erinnern.
de hod duttln wiara maura
wauna maura duttln häd
wissts bleed samma r olle
owa soo bleed samma need
wos i ma do eibrockt hob
i kenntat schdundenlaung rean
oo de wööd is so bitta
und da himmö so fern
Statt eines Schlussworts: Jandls Offenheit, die stanzen und die Politik
Obwohl es für manche Literaturkritiker und -wissenschaftler unverständlich zu sein scheint, hat sich Ernst Jandl direkt vom jungen oberösterreichischen Volksmusik-Punk-Crossover beeinflussen lassen. Trotz seiner Offenheit und Kooperationsbereitschaft mit Musikern kam es aber nie zu einem gemeinsamen Auftritt mit Attwenger, doch immerhin zu aufeinanderfolgenden im November 1997, sowie zu einigen Telefonaten.
Nach der Veröffentlichung in Buchform 1992 wurden die stanzen immerhin von Akkordeon begleitet aufgeführt – und zwar mit Erich Meixner, der bei der österreichischen politischen Popformation Die Schmetterlinge Gründungsmitglied ist. Die Schmetterlinge werden insbesondere mit der von Heinz Rudolf Unger getexteten Proletenpassion (1977) assoziiert, eine marxistische Geschichtsbetrachtung von den Bauernkriegen bis zur Gegenwart. Gratzer bemerkt, dass die stanzen „1994/1995 an – ihrem Kulturbegriff nach – denkbar unterschiedlichen Orten präsentiert [werden], z.B. zunächst im Wiener Akademietheater (12.10.1994) sowie in den Münchener Kammerspielen (25.4.1995). 1995 erscheint das gemeinsame Programm stanzen auch auf CD.“ Unerwähnt lässt er eine größere Zahl von Aufführungen im Gewerkschaftstheater Akzent im vierten Wiener Gemeindebezirk. Dieser Ort, die Aufführung mit Erich Meixner sowie das Interesse für Attwenger weisen auch auf Jandls politische Ausrichtung hin: Jandl persönlich war zwar eher ein konservativer Mensch, „ein Freund bürgerlicher, manchmal etwas steifer Umgangsformen. Ein Deutschlehrer eben.“ Doch er war ein unbeirrbarer Parteigänger der Sozialdemokratie. Seit 1951 war er Mitglied der Sozialistischen Partei Österreichs (ab 1991 Sozialdemokratische Partei Österreichs), 1975 war er einer der „Österreicher für Kreisky“ und stellte der Partei gar einen Text für die Wahlwerbung zur Verfügung. Wie gut sich auch der Kulturpolitiker und Präsident der Grazer Autorenversammlung (1983–1987) Jandl mit der Wiener Sozialdemokratie arrangierte, zeigt sich in den Ordnungskategorien in seinen Hängeordnern der 1980er Jahre: schon die 4. Mappe galt dem damaligen Bürgermeister „Zilk“.
Die Verarbeitung der österreichischen Volksmusik musste wohl von einer klar als links positionierten Bewegung kommen, wie es die VolXmusik ist. Sonst hätte sich Jandl wohl nur schwer angesprochen gefühlt.
Dies gelang aber Attwenger – und der in diesem Beitrag geleistete Vergleich mit den traditionellen Texten der Gruppe und damit eine Einordnung in die österreichische Tradition – vermittelt durch die progressive VolXmusik erscheint gewinnbringender als eine rein textimmanente literaturwissenschaftliche Annäherung, welche bei Jandls stanzen fast zu Fehlinterpretationen gezwungen ist.
Die punkige Gruppe Attwenger gab sich übrigens staatsmännisch, auf ihrer dritten CD Luft (1993) füllten sie die letzte Seite mit Grüßen. Unter den 65 genannten Personen, Familien und Institutionen scheint auch Ernst Jandl auf, leicht ironisch gebrochen, denn auf seinen Namen folgt gleich ein Gruß an den Trainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft bis 1992 Ernst Happel, der als Weltklassespieler und -trainer sowie als grantiger Volksrhetoriker in die Populärgeschichte Österreichs einging. Ernst Jandl musste sicher lachen!
Johann Georg Lughofer, aus Johann Georg Lughofer (Hrsg.): Ernst Jandl, Praesens Verlag, 2011
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jürgen P. Wallmann: Ernst Jandl cumple 65 años: El poeta pacífico y los polémicos „objetos hechos de lenguaje“. Siestra y diniestra
Humboldt, Heft 101, 1990
Fritz Popp: A glaana literarischer schmäh
Literatur und Kritik, Heft 265/266, 1992
W. Christian Schmitt: Ernst Jandl und sein literarischer Schmäh
Rheinische Post, 31.3.1992
Wendelin Schmidt-Dengler: „Wia r a nochdigoe“
Falter, Nr., 25, 1992
Anonym: Buchtip
Der Landbote, 24.4.1992
Damian Bugmann: Seitenhiebe und natürliche Bedürfnisse
Bieler Tagblatt, 6.5.1992 und Seeländer Bote, 6.5.1992
Taschenbuch Besonderheiten. Neu im Frühjahr
Berliner Zeitung, 6.5.1992
Matthias Heine: Österreichs einziger Rapper: Ein 66 Jahre alter Dichter
Berliner Zeitung, 16.5.1992
Christian Seiler: Ernst Jandl: stanzen
Die Weltwoche, 21.5.1992
Lutz Holzinger: Stanzen wie gestanzt
Salto, Heft 21, 22.5.1992
Anita Pollak: oes a oad von zoo
Kurier, 27.5.1992
Anonym: Jandls böse Gstanzln. Erhebend und niederschmetternd zugleich
Kronenzeitung, 2.6.1992
mü.: Unverfroren verspielt
Appenzeller Tagblatt, 3.6.1992, St. Galler Tagblatt, 3.6.1992, Ostschweizer Tagblatt, 3.6.1992
Paul Jandl: Singet von jederlei Not, o Musen von Puchberg
Der Standard, 4.6.1992
Ulrich Weinzierl: Das wohltemperierte Hackbrett. Ein wenig Hund, ein wenig Hase
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.6.1992
Jürgen P. Wallmann: „An haufn gschrim“. Ernst Jandl als Stanzelsänger
Der Tagesspiegel, 7.6.1992
Jürgen P. Wallmann: „Neiche Sochn“ vom Jandl Ernst
Schwäbische Zeitung, 12.6.1992
Jürgen P. Wallmann: „Kaune me faschdentlich mochn?“. Der Sprachjongleur Ernst Jandl spielt mit Dialekt und Stanze
Darmstädter Echo, 13.6.1992
DRGEGE: Ernst Jandl: stanzen
Burgenländische Volkszeitung, 17.6.1992
Norbert Hummelt: Wien und die Welt in 250 Vierzeilern. Ein literarisches Ereignis: Ernst Jandls Stanzen
Kölner Stadt-Anzeiger, 18.6.1992
Michael Scharang: Dialektik des Dialekts
Profil, Heft 27, 29.6.1992
Karl Riha: Späte Grüße im Neckvers
Passauer Pegasus, Heft 19, 1992
Bernd Berke: Ernst Jandl: Auch das Obszöne ist bodenlos traurig
Westfählische Rundschau, 1992
Wilhelm Pauli: Jodljandls Gstanzltanzl. Notwendiger Nachtrag zur Lyrik-Hitparade ’92
Kommune, Heft 7, 1992
Paul Jandl: „ein mensch, ein wenig hund, ein wenig hase“
Der Standard, 3.7.1992
ORF: Stanzen von Ernst Jandl
Neue Zeit, 17.7.1992
Wolfgang Gerold Ölz: Dadaistisches Urgestein
Neue Vorarlberger Tageszeitung, 18.7.1992
Damian Bugmann: „…mei hosn is ma zguat…“
Bieler Tagblatt, 30.7.1992
Anonym: Gestanztes
Klappe auf, 9.1992
Michael Braun: Literarischer Schmäh. Gedichtbände von Ernst Jandl und Dirk von Petersdorff
Badische Zeitung, 19./20.9.1992
Jürgen P. Wallmann: jandls gschdanzel. Neue Kurz- und Kürzestgedichte vom österreichischen Meister des hintersinnigen Wortspiels
Rheinischer Merkur, 25.9.1992
Cornelius Hell: Gschdanzln
Die Furche, 1.10.1992
Andreas Kramer: Ernst Jandl: stanzen
GIG, Heft 77, 10.1992
Karl Riha: Späte Grüße im Neckvers
Frankfurter Rundschau, 31.10.1992
Elfriede Schmidt: ernst jandl: stanzen
Forum Marchfeld, Heft 16, 12.1992
Anonym: Rap gschdanzelt
Gegenwind, Heft 56, 12.1992/1.1993
André Bucher: Alpenländischer Rap
Neue Zürcher Zeitung, 17./18.12.1992
Peter Anliker: Ausgestanzt
Berner Tagwacht, 18.12.1992
Anja Lehmann: Eine zweite Sprache
Hessische Allgemeine Zeitung, 25.2.1993
Reinhold Aumaier: Dichta im Zoppeschritt. Jandl und Meixner auf CD
Wiener Zeitung, 2.9.1994
Ludwig Blaha: Modernistischer Populismus
Literatur aus Österreich, Heft 236, 6.1995
Arno Dusini: Ernst Jandls „Stanzen“
manuskripte, Heft 135, 1997
KB: So gehds auf da Wöd
Süddeutsche Zeitung, 20.9.1997
FOTOGRAFIE
für Ernst Jandl
mit seiner groszen linken Hand
bedeckt er meine grosze rechte Hand
mit seiner groszen warmen linken Hand
bedeckt er meine grosze kalte rechte Hand
ich habe meine grosze rechte kalte Hand versteckt es liegt
beschützend seine grosze linke warme Hand auf meiner flüchtigen
rechten groszen kalten Hand während
uns Stefan Moses fotografiert im Jahre 76
mit unserer je anderen groszen Hand Gesicht verdeckend
(wie Stefan Moses es verlangt) –
wir halten uns umklammert so in dieser unscheinbaren
Geste die mir im nachhinein die Träne preszt
aus meinem unsichtbaren Auge… dein
Blutstrom flieszt in meinen Blutstrom über
dann in verwilderter Unsterblichkeit von Liebe
Friederike Mayröcker
Lesung im LCB am 8.12.1995: Ernst Jandl,
Friederike Mayröcker
Moderation: Hajo Steinert; Gesprächspartner: Walter Höllerer, Klaus Kastberger
Einführungsgespräch: Die Teilnehmer sprechen u.a. über das Gesicht der österreichischen Nachkriegsliteratur und die Zusammenarbeit der beiden Autoren.
Lesung I: Ernst Jandl liest Gedichte (u.a. „stanzen“) und Prosa.
Gespräch I und Lesung II: Kurzes Gespräch über die Bedeutung der „stanzen“ und Übersetzungen von Jandls Texten. Klaus Kastberger berichtet von seiner Arbeit im Friederike Mayröcker-Archiv, anschließend liest die Autorin unveröffentlichte Prosa.
Gespräch II, Lesung III, Abschlussdebatte: Nach einer Interpretation Mayröckers Prosa durch Klaus Kastberger setzt die Autorin die Lesung fort. Abschließend sprechen die Gäste über Gemeinsamkeiten in den Texten Jandls und Mayröckers.
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


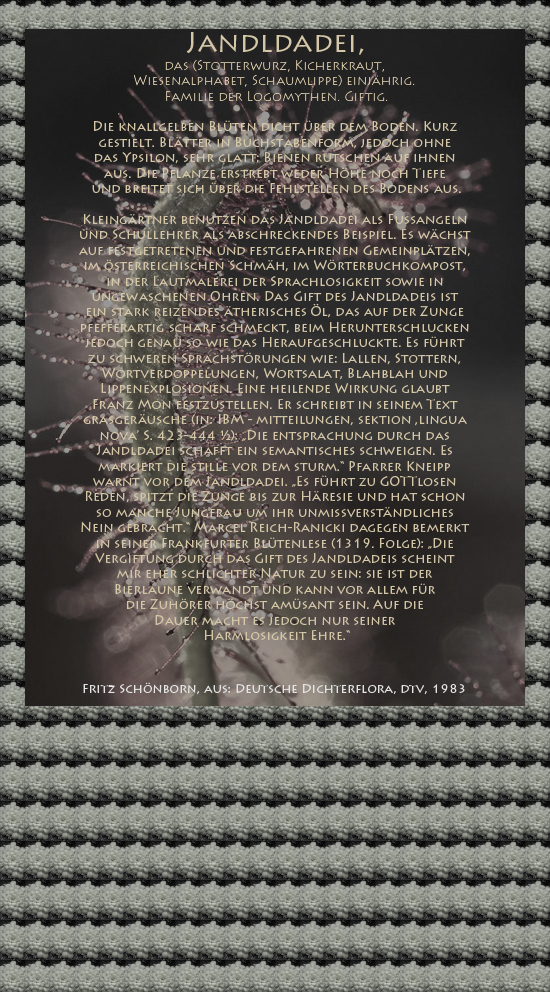












Schreibe einen Kommentar