Ernst Jandl / Jürgen Spohn: falamaleikum
IM SCHLAF
er traf einen baum.
er baute darunter sein haus.
er schnitt aus dem baum
einen stock heraus.
der stock wurde seine lanze.
die lanze wurde sein gewehr.
das gewehr wurde seine kanone.
die kanone wurde seine bombe.
die bombe traf sein haus und riss
den baum an den wurzeln aus.
er stand dabei und staunte,
aber auf wachte er nicht.
Lautgedichte, Nonsensverse, Abzählreime,
Gedichte in erfundenen, gefundenen Sprachen – eine Sammlung von lustigen, makaberen, derben, spielerischnen Jandl-Gedichten ist in diesem Band zusammengetragen worden. Kinder werden an den überraschenden Pointen ihre Freude haben und Erwachsene, denen der Spaß nicht verlorengegangen ist, mit Sprache zu spielen, sich neue Worte auszudenken, die niemals in einem Lexikon geführt werden. Dies ist ein ideales Buch zum Vorlesen, das überall verwendet werden kann, auf dem Spielplatz, in der Schule, in der Straßenbahn und vor dem Einschlafen.
Der Berliner Grafiker und Kinderbuchautor Jürgen Spohn – ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 1981 – hat eigens für diesen Band eine Serie von zehn Aquarellen angefertigt..
Luchterhand Verlag, Klappentext, 1983
Beitrag zu diesem Buch:
Alexander von Bormann: Flatternd im Raum. Ernst Jandls Surrealismen
Neue Zürcher Zeitung, 26. 2. 1993
Rede auf Ernst Jandl
– Leicht gekürzte Laudatio anläßlich der Verleihung des Kleist-Preises an Ernst Jandl in Potsdam am 23.10.1993. –
Die Versuchung ist groß, als Auftakt ein Verhältnis zwischen Preisträger und des Preises Namenspatron zu konstruieren. Im Jargon der „humanisten“, des „konversationsstücks in einem akt“ von Ernst Jandl, müßte man dergleichen Bemühen wohl „ahnenfangen“ nennen. Ob und wie der Dichter Jandl mit dem Dichter Kleist verkehrt oder verkehrt hat, ich weiß es nicht. Nur ein winziges Detail möchte ich – um das Existenzminimum geistiger Wahlverwandtschaft herzustellen – erwähnen. Erinnern wir uns des Schlusses von Kleists Lustspiel Amphitryon, an den berühmtesten Seufzer deutscher Dramatik, mit dem die erotisch getäuschte Alkmene zusammenfaßt, was ihr widerfuhr. Sie sagt nicht mehr als „Ach!“, dann fällt der Vorhang. Wahrlich, in diesen drei Buchstaben ist das Schicksal einer Frau Laut geworden.
Und auf ebensolche Konzentrationstechnik versteht sich der Poet Ernst Jandl wie heute kaum ein zweiter. Manchmal ist man sogar versucht, seine Literatur mit einem italienischen Etikett zu versehen: sie als „letteratura“, also Letternkunst in des Worts buchstäblichem Verständnis zu interpretieren – ob sie sich nun als graphisches Bild präsentiert oder als quasi dadaistisches Geräuschgemälde.
Denken wir bloß an seine „love story, dringend“, die durch listige Zerlegung des Begriffs „dringend“ eine alte, immer neue Geschichte in komprimiertest möglicher Form berichtet, mit allen Stationen von sexueller Tat über die Ehe bis zur Auflösung: „drin“, „ring“, „inge“ und schließlich und naturgemäß – „end“. Oder wer könnte das lieblichste Tier aus Jandls Bestiarium literaricum vergessen? „ottos mops“, der trotzt und hopst und klopft und kommt und kotzt – die Hommage an einen durchaus animalischen Vokal? Das Gegenstück dazu bildet das Kriegsgedicht „schtzngrmm“: Sämtliche Selbstlaute wurden dem Schützengraben brutal entzogen, und weil Zuchtmeister Jandl das Konsonantenmaterial gnadenlos durchexerziert, erzielt er furchterregende Wirkung: Wir vernehmen das Knattern eines Maschinengewehrs.
So vermag der Minimalist Jandl mit denkbar geringem Platzaufwand Tragödien und Komödien, Moritaten und Grotesken, Abenteuer am Schreibtisch und aus dem angeblich echten Leben zu erzählen – nicht durch Aussprechen, sondern durch Andeuten. Der eigentliche Text, den wir uns in Kopf und Herz zusammenreimen, findet sich stets zwischen den Zeilen, zwischen den Silben.
Auf Grund von Liveauftritten, dank Videocassetten und Schallplatten ist Ernst Jandl, der Rezitator seines Werks, einer der populärsten Schriftsteller, genauer: Lyriker deutscher Zunge geworden. In jeder Hinsicht spielend, füllte und füllt er Riesensäle, bis hin zur Londoner Royal Albert Hall. Anno 1991 meinte ein Interviewer der Zürcher Weltwoche, Jandl habe doch „alle großen Literaturpreise Deutschlands und Österreichs bekommen, oder steht noch einer aus?“ Der Befragte gab schlichte Antwort:
mir geht jedenfalls keiner ab.
Ich war und bin diesbezüglich abweichender Ansicht. Warum aber nun wirklich Ernst Jandl den Kleist-Preis zuerkennen, da er immerhin schon im Namen Georg Büchners geehrt wurde? Nicht zuletzt darum, weil Jandls Œuvre damals, 1984, keineswegs abgeschlossen war, auch nicht mit der 1985 erschienenen und sehr würdigen Ausgabe der Gesammelten Werke in drei großformatigen Bänden. Seit vier Jahrzehnten veröffentlicht dieser Wortarbeiter nunmehr seine unverwechselbaren Produkte. Er hat die literarische Avantgarde zwar nicht salonfähig gemacht – das war nicht nötig –, aber er hat sie, wenn man so sagen darf, publikumsfähig gemacht, auch in breiten Leserschichten vom Odium der Sterilität und Langeweile befreit. Ich kenne niemanden, der sich mit so unterschiedlichen Kunstmitteln überzeugend, ja exemplarisch ausdrücken könnte und kann wie Ernst Jandl, der Avantgardist als Klassiker. Alles ist ihm – auch die Verwendung traditioneller Formen – Experiment, Versuch über die und mit der Sprache. Bei Aufbrüchen zu neuen Ufern sich selbst treu zu bleiben und dabei ohne Pose und Manier immer radikaler zu werden – das dürfte das Geheimnis seines Erfolges sein, um den er freilich lange zu kämpfen hatte.
1925 in Wien als Sohn eines Bankbeamten geboren, studierte er nach der Kriegsgefangenschaft Germanistik und Anglistik, promovierte mit einer Dissertation über Arthur Schnitzlers Novellen und war von da an bis 1979 im Brotberuf als Gymnasiallehrer tätig. Seiner Mutter, die lange dahinsiechte, eine fromme Frau gewesen ist und selber Gedichte verfaßte, verdankt er die Passion für Literatur. In einer „Biographischen Notiz“ heißt es über sie:
Sie starb, als ich vierzehn war, und dies war die erste der Katastrophen, aus denen sich mein Leben seither zusammensetzt.
Ab 1952 veröffentlichte er in Zeitschriften Lyrik, 1956 erschien sein Debütband Andere Augen, dessen Aufnahme der Autor später folgendermaßen beschreiben sollte:
beim bergland verlag
hab ich mein erstes
buch verlegt
und futsch wars.
Schon in den frühen Versen und im programmatischen Titel steckt in Ansätzen der gesamte Dichter Ernst Jandl, mit seinen Themen und Obsessionen, mit seiner sehr besonderen „Weltanschauung“. Drohend hebt das Bändchen an:
Es kann alles noch sein.
Noch nie war das Schlimmste ganz da.
Ein anderes Gedicht nennt sich „Einlaß zu finden“ und fährt unmittelbar fort:
in eine Art Mutter
die umschließt ohne Ausgang und Ende
wie ein Berg
Nach Aphorismus klingt das Ende von „Ikarus“:
Ikarus ging unter
hoch über den anderen
Eine Parabel vom Künstlertum im 20. Jahrhundert, aus der Bahn geworfen durch zwei Weltkriege, trägt den Titel „Zeichen“:
Zerbrochen sind die harmonischen Krüge,
die Teller mit dem Griechengesicht,
die vergoldeten Köpfe der Klassiker –
aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter
in den Hütten der Töpfer.
Und das Finale des Poems „Pharmakologisch“ verweist bereits auf Künftiges:
Mitleid (commiseratio)
3 mal tägl. 2
Äußerlich!
Die Fülle von Beispielen des nicht ganz so notorischen Jandl verfolgt einen bestimmten Zweck: Kontinuität zu betonen, die Grundlagen seines Dichtens und Denkens freizulegen. Daß Ernst Jandl nicht in Österreich zu Ansehen und Ruhm gelangte, dort erst nach einer unfreiwilligen Kavalierstour durch deutsche Verlage beachtet wurde, ist kaum weiter buchenswert – es ist das Los der meisten österreichischen Literaten der Epoche. Daheim warnten einst Pädagogen vor dem schreibenden Lehrer, dessen Geschriebenes verblöde bloß die Schüler, sei nichts als besserer Schmutz und Schund.
In die Literaturgeschichte ist Jandl anno 1966 eingegangen – mit seiner wohl beliebtesten Sammlung Laut und Luise. 1984 bekannte der Verfasser:
ein Titel wie dieser kommt kein zweites Mal. Und wozu auch – er steht für alles. Selbst für den Beginn, mit Gedichten, meine Hand geführt mit Gedichten von meiner Mutter, Luise. In ihr, mein Herz, hat zu schlagen begonnen; in mir, immer noch, ihres schlägt.
Nun hat Ernst Jandl allzeit eine wahrhaft glückliche Hand für seine Titel bewiesen: Hosi-Anna, das röcheln der mona lisa, flöda und der schwan und das matte horn, Jandls leider nichtexistentes „bergsteigerbuch“, prägen sich dem Gedächtnis unauslöschlich ein. Aber Laut und Luise ist tatsächlich in seiner Simplizität ein Geniestreich. Wiens größter Romancier pries den Autor:
Verehrter Herr Jandl! Diese Anrede ist nicht redensartlich. Sie gebührt dem Künstler. […] Was Helmut Heißenbüttel im Nachwort schreibt, ist klug und richtig. Einfacher wäre zu sagen: wer in der Kunst nicht technisch was wagt, gehört auf den Mist. […] Nehmen Sie Glückwunsch, Dank und Bewunderung von Ihrem Heimito Doderer. (30. Sept. 1966)
p.s. Welch ein Weg, von Andre Augen, drin schon viel Tüchtiges, bis Laut und Luise!
Ohne Zweifel ist Laut und Luise aller Bewunderung wert. Allein schon ob der Vielfalt der artistischen Methoden – Sprechgedichte neben visuellen und tückisch scheinbarem Nonsens – erweckt diese Generalversammlung der Worte, Töne und Zeichen den Eindruck eines außerordentlich lebendigen Museums der modernen Poesie. Auch und gerade für Wissenschaftler ein gefundenes Fressen, ließen sich doch anhand jenes Bandes zugleich Nähe und Ferne zu den Vertretern der sogenannten Wiener Gruppe vor Augen führen; andererseits zu den deutschen konkreten Poeten bis hin zu Jandls verehrten Vorbildern Gertrude Stein, Kurt Schwitters und August Stramm. Wichtiger als solch höhere Beziehungskunde scheint mir allerdings die unmittelbare Wirksamkeit der Texte in ihrem hintersinnigen Witz und ihrer Pointiertheit zu sein. Man könnte fast sagen: die Mustergültigkeit in Clownerie und tieferer Bedeutung. Indem Jandl den Leser überwältigt und verblüfft, belehrt er ihn, indem er die Semantik wider den Strich bürstet, entlarvt er die Normalität der Verhältnisse und des sprachlichen Durchschnittsgebrauchs.
Musterhaft ist auch der politische Dichter Ernst Jandl, in Laut und Luise mit seinem Mahnmal „wien : heldenplatz“ präsent, das die triebgeladene Massenhysterie nationalsozialistischer Kundgebungen – „und brüllzten wesentlich“ – ins beschädigte Wort faßt. Nicht wohlmeinender Antifaschismus will da aufklären, sondern pure, bewußt eingesetzte Ästhetik. Ein Gleiches läßt sich von Jandls in jedem Sinne enormer Etüde des Schreckens und der Trauer behaupten: „deutsches gedicht“ aus dem Jahre 1957:
jüdin
in
jüdin
in
jüdin
in
germany
jüdin
in
jüdin
in
jüdin
in
germany
verbrennt euch die zunge nicht
sagt nicht: deutschland […].
In seinen Anmerkungen zu diesem vielseitigen Opus hat Jandl übrigens klargestellt:
hitler wurde und wird von mir stets als 100-prozentiger österreicher gesehen – keiner anderen nation, auch nicht der deutschen, ist die hervorbringung eines solchen mannes bisher gelungen.
Nein, dieser Künstler ist nicht weltfern, in seiner Klause abgewandt der Zeit und ihren Problemen. Er nimmt sie zur Kenntnis und sich zu Herzen. Nur gestaltet er eben statt versifizierter Leitartikel sprechende, bisweilen schreiende Form. Und die Tendenz zum politischen Engagement beschränkt sich keinesfalls auf seine Lyrik: die humanisten, Jandls „konversationsstück“ für den steirischen herbst 1976, ist eine fulminante Abrechnung mit der charakteristischen Mischung aus reaktionärer Kulturanbetung und Restposten provinzieller Nazigesinnung, ein mißtönendes Hohelied auf das „kunstvaterland“ Österreich, die „salzenburger fetzenspiele“, „burgentheatern“ und „schrammenmusik“. Im Bezirk der „humanisten“ hat man erkannt: „viel kunst heut nicht gut sein“, „sein viel viel nicht kunstler / sein kunstschmutzen / sein schmutzen / schmutzen finken / schmutzenbacher / pfui gack“.
Bühnenautor wurde Jandl erst in relativ vorgerücktem Alter, dafür hatte er bereits 1968 – gemeinsam mit Friederike Mayröcker, der Gefährtin seines Lebens und seines Schaffens – Rundfunkgeschichte gemacht. Fünf Mann Menschen – hörspiel ist ein doppelter imperativ, stand in Variationen auf dem Umschlag der Buchausgabe – hat von seiner Faszinationskraft bis in unsere Tage nichts verloren.
In seinem Vorspruch zu dingfest (1973) lesen wir:
es gibt dichter, die alles mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche weise. solches zu tun habe ihn nie gereizt; denn zu sagen gebe es schließlich nur eines, dieses aber immer wieder, und immer neue weise.
Unter der Devise „auf immer neue weise“ geht Ernst Jandl beharrlich und Text für Text seinen poetischen Weg. Der indes mündet oft mitten in dunklen Gefilden. Numero 2 seiner „jahreszeiten“ etwa scheint im absoluten Pessimismus beinah den Anspruch einer Zurücknahme des Streicherglanzes eines Antonio Vivaldi zu erheben:
der sommer
ist die hölle.
der herbst hingegen
ist die hölle.
anders der winter;
er ist die hölle
erst der frühling
ist die hölle.
Von Hans Mayer stammt eine „Kurze Verteidigung Ernst Jandls gegen die Lacher“, worin der advocatus melancoliae ausführt:
Tragik allenthalben, die verlacht wird: durch Ernst Jandls Verehrer.
Er hat wohl sehr recht, doch hin und wieder ist Lachen der einzig wirksame Schutz vor dem Sog der Verzweiflung, den Jandls Poesie desto stärker erzeugt, je älter und reifer der Poet wird.
Wie unbeschwert konnte man sich seinerzeit über die Kürzestepigramme „phallus klebt allus“ oder „herrlich ist das geschlechtsleben / keine rose ohne dornen“ amüsieren. In den siebziger und achtziger Jahren trat jedoch ein bemerkenswerter Wandel ein. Die Sprechoper Aus der Fremde beispielsweise, worin sich Jandl als Erfinder des kategorischen Konjunktivs bewährt, atmet schmerzliche Tristesse, Trauer ohne ersichtlichen, zureichenden Grund. Zugleich ist nicht zu überhören, was weiland Hugo von Hofmannsthal das „furchtbar Autobiographische“ seiner Jugendproduktion genannt hat. In dem 1979 publizierten Buch die bearbeitung der mütze, im Zyklus „tagenglas“, bediente sich Ernst Jandl erstmals einer „heruntergekommenen Sprache“, eines verstümmelten, verkrüppelten Idioms, das einer verächtlich als Gastarbeiterdeutsch stigmatisierten Ausdrucksweise zum Verwechseln ähnlich schaut. Dennoch ist Jandl imstande, selbst aus diesem vermeintlich untauglichen Material Funken zu schlagen: „doktor ich nicht können aufhören krepieren“, endet das Gedicht „visite“, „du mir geben mittel für krepieren.“ Daß zwei Texte des Bandes der gelbe hund dem Selbstmörder Jean Améry gewidmet sind, scheint kein Zufall. Der Leser ist schon erleichtert, wenn sich unter all den am Rande des Abgrunds angesiedelten selbstzerstörenschen poetischen Akten wenigstens einer zu zorniger Blasphemie aufschwingt:
ich klebe an gott dem allmächtigen vater
schöpfer himmels und aller verderbnis
und an seinem in diese scheiße hineingeborenen sohn.
Und wenn der Fegefeuerflaneur Ernst Jandl im folgenden Band, selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr, auf der „grünen pest des grases“ unlustwandelt, gibt es nur Hoffnung auf ein Wunder. Genau das aber geschieht. Nicht wie Phönix, eher wie Orpheus aus der Asche steigt der Dichter Ernst Jandl aus der Unterwelt psychischer Höllenqualen. Und seine Ausbeute an Versen ist so schneidend scharf wie haltbar, unter unerträglichem Hitzedruck gehärtet. Mit ein bißchen Talent zum Kitsch könnte man von schwarzen Diamanten sprechen, deren Finsternis leuchtet. Ein rühmender Kritiker resümierte sein Urteil in dem Bekenntnis:
Ich hatte mich auf dieses Buch gefreut; auf das nächste freue ich mich nicht mehr, ich fürchte es.
Auch ein Kompliment, gewiß. Denn in der Tat kann einen der Jandlsche Altersstil das Fürchten lehren, so viel böse Wut, Selbstekel und stumpfes Grauen artikuliert hier ein lyrisches Ich – in düsteren Abgesängen auf das Leben und das, was man einmal Liebe zu heißen sich abgewöhnt hat. Mit den idyllen von 1989, fern jeglicher romantischen Beschaulichkeit, hat Ernst Jandl seine Hinfälligkeits- und Todeslitaneien konsequent fortgesetzt und den ihm eigentümlichen Hohn dazu. Immerwieder blitzt darin nämlich aberwitzige Komik auf – sie erinnert an tolldreiste Eigenschadenfreude. Unter dem eleganten Stichwort „duft“ verbirgt sich äußerste Drastik:
es stinkt der mensch, solang er lebt
von arschloch, mund und genital
auch achselhöhlen wirken mit
Zudem darf man sich an Sinnsprüchen ergötzen, die weise-abgeklärten Trotz offenbaren. Niemand würde etwa den hochprozentigen Wahrheitsgehalt des Zweizeilers bestreiten wollen:
wer hinkt
der geht.
Karl Valentin hätte die Einsicht des gelernten Depressionshumoristen mit dem Befund quittiert: besser wie gar nix is es. Während eines Produktivitätsanfalls entstanden im Sommer 1991 die stanzen, die selbstverständlich nicht halten, was das hehre Genre verspricht, handelt es sich doch dabei um Vierzeiler in einem ausgeklügelten Kunstdialekt. Dieser behindert – wahrscheinlich ist’s ein Glück – mangels Verständnismöglichkeit die Verbreitung der teilweise entschieden unzüchtigen Gedichte nordwestlich von München. Kenner erliegen jedoch sofort dem bezwingenden Reiz von Jandls musikalischer Variationskunst. Soll man den klangversessenen Lautmaler vorziehen oder den tragischen Karikaturisten, dessen Einfälle von einer Prise suizidaler Heiterkeit gewürzt sind? Sorgsam tastet sich der stanzen-Verfertiger Ernst Jandl von Abis Z durchs Alphabet. Deshalb kann man ihn getrost als Komponisten des wohltemperierten Hackbretts feiern.
In der Abteilung „verstreute gedichte“ der Werkedition stoßen wir auf ein 1963 geschriebenes – längst ist „das hundelvieh“ jedem Fühlenden ans Herz gewachsen: „zerbrechlich ist das hundelvieh“, wird da gewarnt, „drum wirf es aus dem fenster nie“. Und bloß eine einzige „stanze“ kommt in reinem Hochdeutsch daher, verschmäht ländliche oder englische Kostümierung. Sie lautet:
noch sitz ich fest
in letzter lebensphase
ein mensch, ein wenig hund
ein wenig hase.
Wer des sterbenstraurigen Spaßmachers Jandl Œuvre überblickt, der weiß, daß die getreuen Vierbeiner in seiner literarischen Phantasie eine Sonderrolle spielen: Sie sind Objekte dauernder Zuneigung, fast so etwas wie Wappentiere einer Poesie im Zeichen des Saturns. Denn Jandls Hunde sind immer gefährdete, bemitleidenswerte, arme Hunde und gleichen somit den Menschen, zumindest der erdrückenden Mehrzahl unserer Gattung. Ihnen gilt, ungeachtet eines vordergründigen Zynismus, die Sympathie des bedeutenden Leidensgenossen, dieses verteufelt humanen, nicht landläufig humanistischen Autors. Sein Gesamtwerk ist ein Lehrbuch der österreichischen, der deutschen Dichtung. Es zeugt vom Glanz der Sprachkunst in unserer Zeit – und vom Elend des Sprachkünstlers, also des Lebens.
Ulrich Weinzierl, Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 1994
Ernst Jandl – Die Aktentasche
Ernst Jandl war mir lieb, ist mir lieb und fremd zugleich; wir lernten uns 1979 in Stuttgart kennen, wo ein Rudel Autoren in der Herrmannstrasse vom Nachmittag bis zum Abend lesen sollte; von Jandl kannte ich nur die positiven Seiten:
Er schrieb keine Romane, lebte in Wien und mochte Jazz. Die Kollegen sassen an einem langen Tisch und die Lesungen wurden ausgelost. Ich sass neben Jandl und wir liessen den Damen grossmütig den Vortritt: ,Ist mir gleichgültig wann ich les’,‘ sagte er dicht über dem Tisch, während er seine linke Hand baumeln liess, unauffällig über einer braunen Aktentasche, die er, wie jeder wusste, niemals verläßt.
Das Los traf uns für einen Termin am späten Abend und das hiess Trinkverbot, was mitten unter Autoren nicht leicht fällt. Jandl trank vorsichtig Selterwasser und ich beobachtete ihn und seine magische Aktentasche. Jandl gegenüber sass Heissenbüttel, der mit seiner imaginären Hand einen Haufen Jazzplatten hütete – ihn traf das Los für Mitternacht.
Als Jandls Zauberkiste betrachtet, mochte die Aktentasche einen ganzen Kosmos enthalten, vielleicht ein nagelneues Manuskript nach der Bearbeitung der Mütze. 1979 war Jandl ein wenig rundlich, aber er bauchte noch nicht wie 20 Jahre später. So, dachte ich voller Achtung und Sympathie, sieht also ein Dichter aus, dem das lyrische Ich fehlt oder abhanden gekommen ist. Besonders der Darmstädter Lyriker Krolow vermisste bei Jandl ein zuverlässiges und schlagkräftiges lyrisches Ich; was mochte wohl mit Jandls im Laufe der Zeit passiert sein? Hatte es sich einfach verkrümelt? Hatte es, wie ein Meteor, die Kurve nicht gekriegt? Jandl machte jetzt einen schiefen Kopf und versuchte, die Titel der Heissenbüttel-Platten zu entziffern.
Der Schlesiendichter Bienek hatte sich auch schon über Jandl gebeugt und ,leere Artistik‘ und auch ,Perioden der Regression‘ diagnostiziert, ja, gottlob! Aber Dichter mit einem lyrischen Spätrückgeführten-Ich sollten Jandl gar nicht erst lesen – seine Stanzen, Sonette, seine wüsten Permutationen, seine monadischen Glossarien – ich komme ins Schwärmen und soll doch sachlich bleiben. Der Dichter B. hätte Jandl hören müssen, der nicht mit goldener Zunge redete; er liess sie stolpern und diszipliniert stammeln und produzierte dann mit seinem gesamten Sprechapparat furchterregende Geräusche (die jede Logopädin ins Irrenhaus geführt hätte) – mit denen er ,Sinn‘ und ,Bedeutung‘ heillos verstrickte.
Jandl beugte sich noch tiefer über die Tischplatte und berührte mit den Fingerspitzen der linken Hand den Griff der Aktentasche, sein tragbares Universum mit Griff, das an diesem Nachmittag im langweiligen Stuttgart alles enthielt, was ich an Jandl schätzte; seine grammatologischen Abenteuer, seine strengen Lamento-Gedichte über die Sterblichkeit, den Zerfall des Körpers, Reflexionen in Sackgassen mit Hilfe von Flexionen – und es drängte mich zu einem Sprech-Akt: – Ich habe, sagte ich, gerade „Die Humanisten“ gelesen und bin vor Lachen aus dem Bett gefallen. Ernst sah mich an und wurde ernst. ,Gott ja,‘ sagte er grämlich, ,lachen müsse man da schon, da bleibe einem gar nix anderes übrig – aber aus dem Bett gefallen?‘ Symbolisch, sagte ich.
Der grosse Reduktionist, der buchhalterische Destruktive, der einsame Meister der Deklinationen der Nomina, der Virtuose der Konjugation der Verba sagte enttäuscht: ,Ach so, nur symbolisch.‘
Vielleicht hatte Jandl durch eine geniale Antizipation in die Zukunft gesehen oder seine divinatorische Begabung liess eine gewisse Verachtung für symbolische Bett-Stürze zu, wie in einem schlechten Traum, aus dem man dennoch blessiert erwacht. Irgendeine der Dichterinnen, – ich weiss nicht mehr welche, denn es war ein Jandl-Nachmittag –, war mit dem Los unzufrieden, das auf sie gefallen war und Jandl packte mit dem Griff eines Vaters, der sein Kind vor dem Ertrinken retten, seine Aktentasche, den Kosmos, und sagte: ,Gehens mit, i muss was trinken.‘
Im Herrmannstrassengarten, bewacht von den Klett-Cotta-Verlagsräumen, bestellten wir Bier – ,is ganz unbedenklich,‘ sagte Jandl, sitzend auf einer Bank. Er hielt die Aktentasche jetzt wie ein Baby auf seinem Schoss und erreichte dadurch, im Verhältnis Bauch mit Aktentasche gegen Tisch eine grosse Bequemlichkeit und Würde.
Jandl, ein Hasser von Gösser-Bier genoß das Stuttgarter Bier und wir lauschten befangen Elton John, der aus einem der Lautsprecher drang; ,Pimperlmusik,‘ sagte Jandl und schüttete seinen kugelrunden Schädel.
Beim zweiten Bier – wir tranken äusserst umsichtig – legte Heissenbüttel die erste Jazzplatte auf den Dual-Teller und Jandl betastete seine Aktentasche im Takt. Es war ein guter Nachmittag. Er besuchte meine Lesung nicht, ich nicht seine und so war alles in Ordnung.
15 Jahre später las Jandl im Akademie-Theater seine Stanzen; aber was soll schon heissen: er las? Furchtbar bauchend benutzte er den ganzen Leib zum Singen. Das Publikum war erschüttert. Nach der Lesung waren wir in einem Keller-Beissel hinter dem Akademie-Theater verabredet; er kam auch richtig und setzte sich wie ein ungnädiger Buddha mit dem Rücken zu seinen Freunden an einen Tisch und schlang einen Riesenteller Lungenbraten, den die greise Wirtin sofort servierte. Jahre später sahen wir uns beim Bielefelder Kolloquium und während der ersten Pause sagte er vorwurfsvoll: ,Wo bist‘ damals gewesen? Wir sind’s doch im Keller-Beissel verabredet g’wesen.‘
Haben/sein/gewesen/ – wohl niemals passte ein Vorname besser zu einem Namen: Ernst. Sein Humor war kein ausschweifender und er benutzte ihn konjunktiv, aber niemals disjunktiv wie glücklichere Humor-Naturen. Der je schlimmste Schluß war ihm so selbstverständlich vertraut wie sein Bauch. Über die Verwaltung der Effekte wusste er die letzten Dinge:
Die Stimmung des Stückes liegt in der Nähe des Tragischen. Daher ist im Sprechen wie im Agieren jeder Anflug von Komischem oder Groteskem unbedingt zu vermeiden; gerade dadurch sollen Witz und Ironie, wo immer sie im Text aufscheinen, zu besonderer Wirkung gelangen. Jede Verwendung von Musik ist zu unterlassen.
– so lautet die vierte Anweisung zur Sprechoper Aus der Fremde.
Von Zeiten zu sprechen – sein das heuten Tag sein es ein scheissen Tag – hat einen Ewigkeits-Wert, der durch nichts gemildert werden kann.
Ingomar von Kieseritzky, manuskripte, Heft 151, 2001
Gespräch mit Ernst Jandl
Herlinde Koelbl: In diesem Arbeitszimmer arbeiten Sie schon seit zwanzig Jahren. Brauchen Sie eine bestimmte Ordnung, wenn Sie schreiben?
Ernst Jandl: Ich brauche eine halbwegs leere Schreibfläche, leeres Papier und mein Schreibgerät.
Koelbl: Mit welchem Schreibgerät schreiben Sie denn?
Jandl: Am liebsten mit dem Füller, der ist flexibel, die Goldfeder gibt nach. Mit diesem hier schreibe ich schon seit meinem fünfzigsten Geburtstag, seit mehr als zwanzig Jahren also. Der Füller stellt eine Verbindung zu einer Zeit her, in der es Kugelschreiber überhaupt nicht gegeben hat, also zur Kindheit und zum ersten Schreiben in der Schule. Kugelschreiber gab es für mich erst nach dem Krieg.
Koelbl: Entstehen mehrere handschriftliche Passungen, bevor Sie in die Maschine tippen?
Jandl: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich unterwegs bin, notiere ich mir viele Gedanken auf Zettel, und das setze ich hier mit der Hand fort, bevor ich an die Maschine gehe. Und manches schreibe ich direkt in die Maschine. Reden zum Beispiel, oder Prosatexte.
Koelbl: Ihr Leben würde man gemeinhin nicht als bürgerlich bezeichnen.
Jandl: Na ja, bürgerlich. Ich lebe auch nicht anarchistisch oder revolutionär. Ich war einmal verheiratet, mit einer Studienkollegin. Nach ungefähr sechs Jahren ließen wir uns scheiden. Ich hatte Friederike Mayröcker kennen gelernt.
Koelbl: Da hat sich vermutlich etwas Entscheidendes bei Ihnen verändert. So eine Verbindung zwischen zwei Schriftstellern ist doch sicher sehr spannend.
Jandl: Natürlich. Zuerst haben wir uns sehr für die Arbeit des anderen interessiert. Friederike hat sogar, als wir uns kennen lernten, eine Zeit lang das eigene Schreiben sehr zurückgestellt. Später hat sie dann sehr lange experimentelle Gedichte geschrieben. Sehr schöne, komplizierte Gedichte, die 1966 in dem Band Tod durch Musen bei Rowohlt herauskamen, im selben Jahr wie mein Laut und Luise. In diese Zeit fällt auch die Phase unserer gemeinsamen Hörspiele. Seither gibt es keine Zusammenarbeit mehr. Unser Schreiben geht jetzt in völlig verschiedene Richtungen, Friederike hat eine grundlegend andere Auffassung von der Behandlung von Sprache.
Koelbl: Trotzdem hat es doch zwangsläufig gegenseitige Anregung gegeben?
Jandl: Die Anregung bestand darin, dass man einander zeigte, was man geschrieben hatte. Und dass der andere das akzeptierte und sagte: Ja, das ist toll, so musst du weitermachen! – Aber es ist von vornherein klar gewesen, dass jeder seine Sachen machen muss. Kritik gab es natürlich auch, aber es war nie Kritik am Prinzip. Es war völlig akzeptiert, dass man losmuss von den herrschenden Mustern. Denn es hatte sich in der Nachkriegszeit eine österreichische Lyrik formiert, die Muster geschaffen hat. Von denen musste man loskommen!
Koelbl: Der Mensch ist ja nicht immer edel. Gab es nie Rivalitäten?
Jandl: Friederike ist imstande, ein viel größeres Arbeitspensum zu schaffen als ich. Ich könnte nie so lange Prosatexte schreiben. Ich hätte nie diese Durchhaltekraft gehabt! Und Friederike hat viel mehr veröffentlicht als ich. Aber deswegen habe ich nicht das geringste Gefühl einer Rivalität. Es gab eine Zeit, in der meine Sachen überall rezensiert wurden und ihre nicht. Das war für sie wirklich qualvoll. Aber Rivalität ist auch da nicht entstanden. Nach zwei, drei Jahren kam dann der Durchbruch für sie. In der Zeit ist ein großer Artikel über sie erschienen; dann kamen sehr gute Rezensionen.
Koelbl: Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen?
Jandl: Ich habe als Kind zu schreiben begonnen, unter dem Einfluss meiner Mutter, die in ihren letzten Jahren Gedichte schrieb, die auch in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurden. Sie konnte sich dadurch über ein schweres, unheilbares Nervenleiden hinwegsetzen. Diese Gedichte waren eine Angelegenheit für die ganze Familie. Sie wurden von meinem Vater abends vorgelesen, und wir bewunderten sie.
Das brachte mich schon sehr früh auf den Gedanken: Ich werde Lehrer sein, und ich werde Gedichte schreiben.
Koelbl: Weil Sie auch vom Vater gelobt werden wollten?
Jandl: Ich habe gedacht, dass Gedichte, wirkliche Gedichte, an sich etwas sind, was bewundert wird, nicht, dass ich bewundert würde. Damals hat es mit dem Schreiben begonnen. Und als mein Studium vorbei war, habe ich mein Doktorat gemacht und intensiver angefangen mit Gedichten oder mit Kurzprosastücken. Von da an war es eigentlich keine Frage, dass es weitergeht, weitergehen muss.
Koelbl: Warum „muss“?
Jandl: Weil diese Gedichte einen gewissen bescheidenen Anklang gefunden haben, weil sie abgedruckt wurden und sich andere Leute dafür interessierten, wenn auch eine gewisse Zeit nur Friederike und Reinhard Döhl. Anfang der sechziger Jahre gab es dann Anerkennung in Österreich und vor allem in Deutschland. Was ohne diese Anerkennung gewesen wäre? Ich weiß nicht, ob ich so vernünftig gewesen wäre aufzuhören. Von da an war es etwas, was ich unbedingt weitermachen wollte, weil ich mich damit in den deutschsprachigen Literaturbetrieb einschalten konnte.
Koelbl: Das ist das Äußere. Aber gab es nicht noch eine innere Motivation?
Jandl: Dieses Innere ist gleich das Äußere. Es ist das Funktionieren. Ein Gedicht funktioniert, oder es funktioniert nicht. Man ist der erste Leser des eigenen Gedichts, man ist der erste Kritiker des eigenen Gedichts. Man hat Erfahrung auch mit Gedichten anderer, das geht ja bis in die Kindheit zurück. Man hat an Gedichten anderer gemerkt, dass Gedichte toll funktionieren können, dass sie mäßig funktionieren können oder gar nicht oder nicht mehr. Wenn man in Anthologien der Jahrhundertwende liest – was man da alles findet, das jetzt weg ist, also doch nicht funktioniert hat, dann erkennt man bestimmte Kriterien.
Koelbl: Schreiben ist ja nicht immer nur Freude. Warum setzt man sich den Mühen aus? Muss man sich was von der Seele schreiben?
Jandl: Ich schreibe mir nichts von der Seele. Ich schreibe, um ein funktionierendes Gedicht zu machen. So wie ein Maler malt, um ein funktionierendes Bild zu machen oder ein Musiker ein funktionierendes Musikstück. Das Glücksgefühl hinterher stellt sich ja nicht immer ein.
Koelbl: Wie kommt es denn zu einem funktionierenden Gedicht? Haben Sie einen Stundenplan beim Arbeiten?
Jandl: Durch die verhältnismäßig lange Tätigkeit als Lehrer war der Rhythmus von der Schule bestimmt. Am Vormittag konnte ich ja damals nicht schreiben, und das tue ich auch heute noch kaum. Ich habe am Nachmittag und am Abend geschrieben. Aber ich habe ja kein tägliches Pensum zu erledigen. Am schönsten sind die Perioden, in denen man irgendeine Sache für sich entdeckt hat, einen Motor oder so was, und dann ein Gedicht nach dem anderen produziert. Das gibt es. Aber leider gibt es auch Zeiten, in denen das nicht der Fall ist.
Koelbl: Dennoch schreiben Sie: Es wird nicht immer so gut, wie es einst gewesen ist.
Jandl: Wenn man den Anspruch hätte, immer besser zu werden, würde das heißen, dass nur die letzten Gedichte die allerbesten sind. Die neuen Gedichte sollen aber nur anders sein. So, dass man diejenigen, die man früher gemacht hat, noch mal ansehen kann. Die Angst vor dem Versagen ist natürlich jedes Mal da, wenn ich mich an das leere Blatt setze. Es wandert vieles in den Papierkorb! Versagen gibt es ja oft genug, das Gefühl: Oh Gott, vielleicht ist es aus, vielleicht schreibe ich nie mehr ein brauchbares Gedicht. Diese Angst muss man vergessen. Ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen mit der Angst vor dem Versagen. Und ich gehe ja nie an eine Aufgabe heran, für die es nur eine Lösung gibt.
Herlinde Koelbl: Schreiben!. 30 Autorenporträts, Knesebeck Verlag, 2007
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


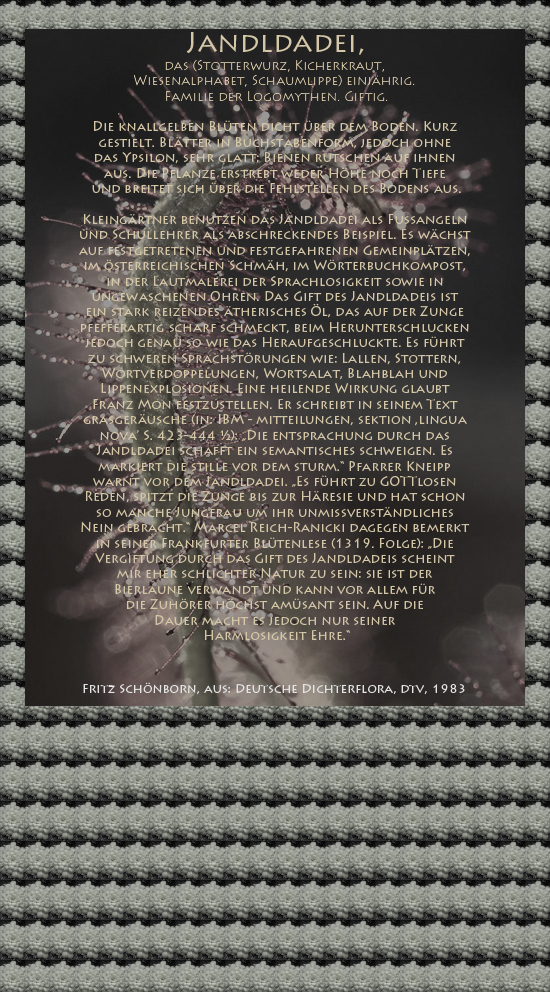












Schreibe einen Kommentar