Felix Philipp Ingolds Skorpioversa – Poesie der Aufzählung (Teil 4)
Poesie der Aufzählung
Anmerkungen zu Inger Christensens «alfabet»
Teil 3 siehe hier …
In ihrem lyrischen Essay über «Die klassenlose Sprache» (1971) hält die Dichterin, fast schon prgrammatisch, fest: «Ich betrachte es als die Aufgabe eines Schriftstellers, einen Code | zu konstruieren, der den Würfelwurf lesbar macht, | und sich ein Zeichensystem vorzustellen, das die Blindheit übermittelt, | kurzum, ich betrachte es als die Aufgabe des Schriftstellers, | sich mit dem Unmöglichen zu beschäftigen …»
Bei der Ausarbeitung ihrer Gedichtfolge verfuhr Christensen so, dass sie die Anzahl der Verse mit der Fibonacci-Reihe in Übereinstimmung brachte – 1 Vers auf Seite 1, 2 Verse auf Seite 2, 3 Verse auf Seite 3, 5 Verse auf Seite 4, 8 Verse auf Seite 5, 13 Verse auf Seite 6 und so weiter in rasch steigender Anzahl, bis die jeweils hinzukommenden Texte mehrere Druckseiten in Anspruch nahmen. Diese sollten gemäss dem lateinischen Alphabet nacheinander mit den Buchstaben a, b, c, d, e, f … beginnen, also wie die Lemmata in einem Lexikon. Der 14. Schritt in der Reihe erbringt den Zahlenwert 377, der dazugehörige Buchstabe im Alphabet ist n. Bis dahin hat Christensen ihren Text – im Ergebnis ein umfangreiches Poem – nach der alphanumerischen Vorgabe durchgeschrieben, an dieser Stelle aber aus Platzgründen abgebrochen: Mit a wie «aprikosenbäume» beginnt ihr erster, mit n wie «nächte» ihr letzter Eintrag.
… Fortsetzung hier …
© Felix Philipp Ingold & Planetlyrik


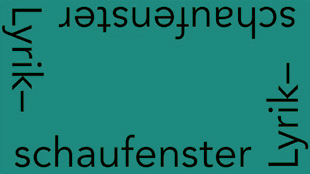
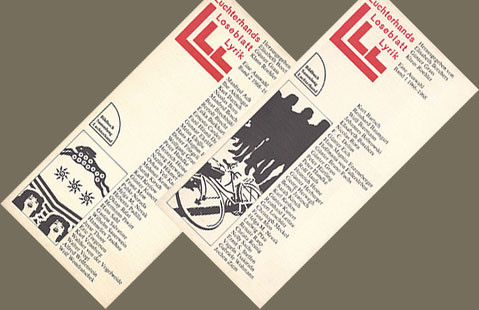



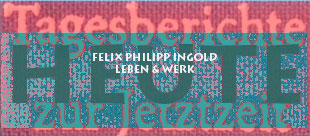
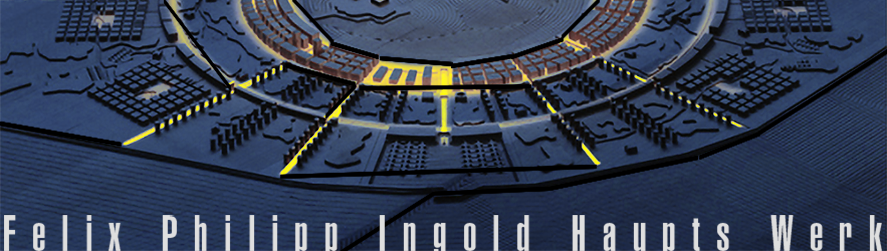
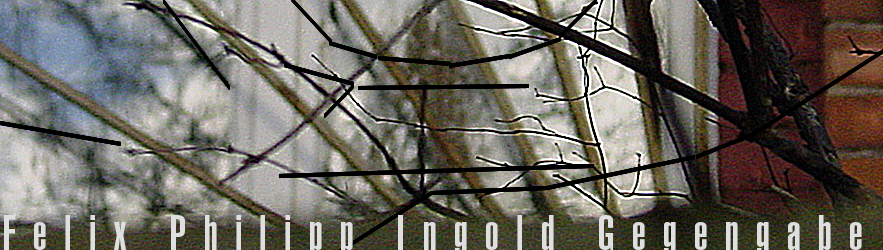
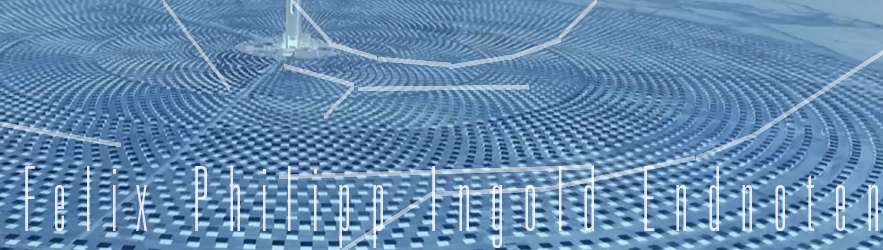

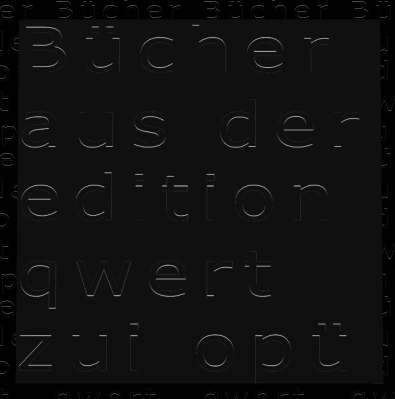
Schreibe einen Kommentar