Felix Philipp Ingolds Skorpioversa – Poesie und Poetik des Namens (Teil 8)
Poesie und Poetik des Namens
Beispiele, Analysen, Kommentare
Teil 7 siehe hier …
Autoren, die als produktive Briefeschreiber bekannt sind, tendieren in aller Regel auch dazu, ihre dichterischen Texte mit persönlichen Adressen zu versehen. Rainer Maria Rilke steht eindrücklich als Beispiel dafür, seine «Neuen Gedichte» (anderer Teil, 1907/1908) bestehen fast ausnahmslos aus Namens- und Widmungsgedichten. «Die Sonette an Orpheus» (1922) sind gleichzeitig dem legendären Sänger und einer realen Person (Wera Ouckama Knoop) gewidmet. Die Anzahl solcher Texte – seien sie an Privatpersonen oder an mythologische Gestalten gerichtet – ist kaum überschaubar, ihre Vielfalt und Vieldeutigkeit schwerlich auszuloten.
Rilkes letztes grosses Namensgedicht – eine lyrische Anrufung der russischen Autorin Marina Zwetajewa – entstand kurz vor seinem Tod (1926) und wird als nachträgliches Schlussstück den «Duineser Elegien» (1912-1922) zugeordnet. Tatsächlich bildet diese sogenannte «elfte Elegie» das Finale zu einer umfangreichen Korrespondenz zwischen den beiden Dichtern, die sich persönlich nie begegnet sind. «Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her» – mit diesem Vers aus der neunten Duineser Elegie scheint Rilke die viel spätere Briefbekanntschaft mit Marina Zwetajewa einzuspuren.
Die titellose Dichtung gibt sich rhetorisch, imaginativ und gedanklich als Fortschreibung der vorausgehenden Elegien zu erkennen, ihre Besonderheit besteht allerdings darin, dass hier der Name der Adressatin im Text selbst mehrfach genannt, assoziativ ausgedeutet und mit dem Absender intim in Verbindung gebracht wird. Rilke nimmt den sprechenden Namen «Marina» (von lat. «mare», «mària» für Meer) wörtlich und setzt ihn symbolhaft ein, so dass die angerufene reale Marina zu einer ozeanischen Urgewalt mutiert, die ihn und sie gleichermassen umfängt und verschlingt: Marina ist das Meer, und sie ist darüber hinaus noch viel mehr, sie ist die liebende Verschwenderin und ist auch die unaufhaltsam Verschwindende – der Gleichklang soll es bestätigen:
…
Wäre denn alles ein Spiel, Wechsel des Gleichen, Verschiebung,
nirgends ein Name und kaum irgendwo heimisch Gewinn?
Wellen, Marina, wir Meer! Tiefen, Marina, wir Himmel.
Erde, Marina, wir Erde, wir tausendmal Frühling, wie Lerchen,
die ein ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft.
…
So, Marina, die Spende, selber verzichtend, opfern die Könige.
Wie die Engel gehen und die Türen bezeichnen jener zu Rettenden,
also rühren wir dieses und dies, scheinbar Zärtliche, an.
Ach wie weit schon Entrückte, ach, wie Zerstreute, Marina,
auch noch beim innigsten Vorwand.
…
Liebende dürften, Marina, dürften soviel nicht
von dem Untergang wissen. Müssen wie neu sein.
…
Meer, Tiefe, Wellen, Untergang, Rettung – dafür steht hier der Name Marina, und mit all diesem bleibt er verbunden: «Von der Mitte des Immer, | drin du atmest und ahnst, schließt sie der Augenblick aus.» Die Vertrautheit, die Vertraulichkeit geht so weit, dass Rilke an dieser Stelle den Namen Marinas anagrammatisch dem Vers buchstäblich einverleibt: «drin du atmest und ahnst» – die hervorgehobenen Lettern fügen sich zu Marina.
Nachfolgend verlässt Rilke abrupt die Vergleichsebene mit dem Meer und identifiziert Marina unversehens mit einer «weiblichen Blüte», die er «nächstens» bestreifen (bestäuben) möchte – eine nicht eben überzeugende metaphorische Verschiebung, die möglicherweise implizit auf die pflanzliche «Marina» verweist, eine Gewächsgattung der Schmetterlingsblütler. Die Elegie insgesamt lässt erkennen, wie viele unterschiedliche Bedeutungen ein geläufiger Personenname annehmen beziehungsweise zugeordnet bekommen kann.
… Fortsetzung am 25.2.2025 …
© Felix Philipp Ingold & Planetlyrik


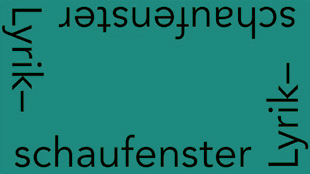
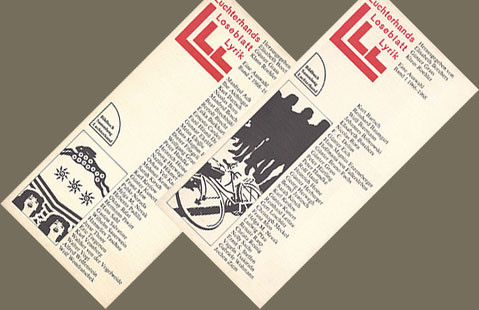



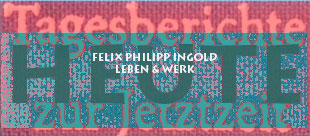
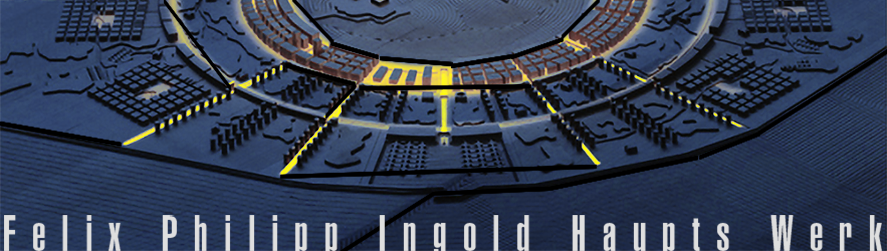
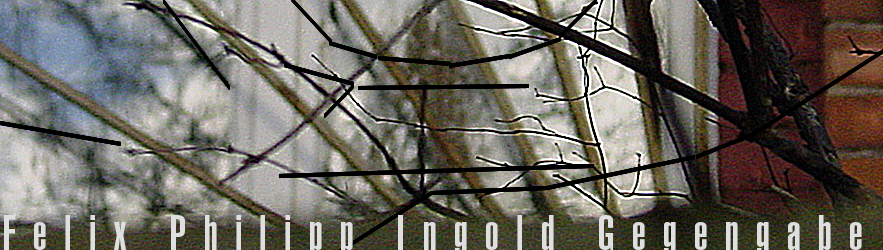
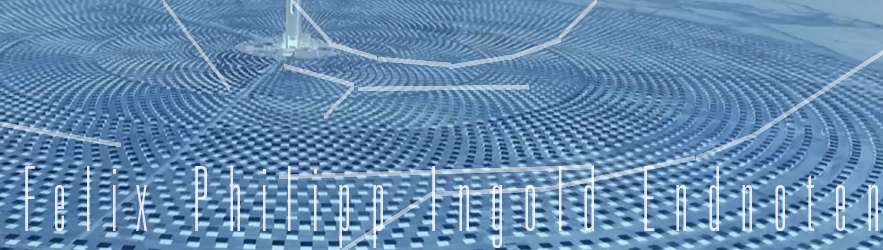

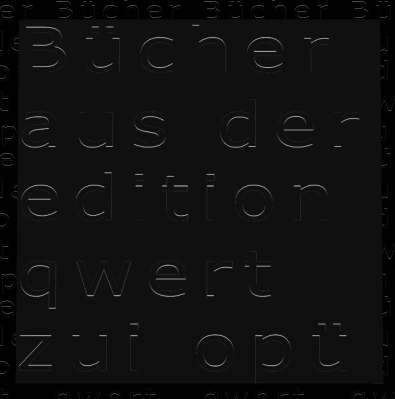
Schreibe einen Kommentar