Francesco Petrarca: Poet’s Corner 4
SONETTO XXXVI
aaaaaS’io credesse per morte essere sacrco
Del pensiero amoroso che m’atterra,
Colle mie mani avrei già posto in terra
Queste membra noiose, et quello incarco;
aaaaaMa perch’io temo che sarebbe un varco
Di pianto in pianto, et d’una in altra guerra,
Di qua dal passo ancor che mi si serra
Mezzo rimango, lasso, et mezzo il varco.
aaaaaTempo ben fôra omai d’avere spinto
L’ultimo stral la dispietata corda
Ne l’altrui sangue già bagnato et tinto;
aaaaaEt io ne prego Amore, et quella sorda
Che mi lassò de’ suoi color depinto,
Et di chiamarmi a sé non le ricorda.
Vermeinte ich durch Tod befreit zu werden,
von Liebes=Wehn, die mich zu Boden drücken,
ich hätte längst des Leibes öde Krücken
aus Eignern abgeschüttelt hier auf Erden.
Doch weil ich weiß, daß ältere Beschwerden
ich nur in neue wandle, Tück in Tücken,
verharr ich, ach! inmitten dieser Brücken,
halb dort, halb hier, noch unter Menschenherden.
Wohl schiene mir der Zeitpunkt hochwillkommen,
da mich der letzte Pfeil vom strengen Bogen
zu treffen wüßte, dieser Welt zum Raube.
Den Tod bitt ich darum, doch der Stock=Taube,
der mich mit seinen Farben angezogen,
hat mich zum Sterbegang nicht mitgenommen.
Benno Geiger (um 1958)
Glaubt ich, der Tod könnt mir die Freiheit geben
von Liebesängsten, die mich niederpressen –
mit eignen Händen sucht ich das Vergessen,
begrüb die Lasten, dieses lästige Leben.
Doch da ich fürcht, ich müßte weiter beben
und Leid um Leid und Streit um Streit durchmessen,
zuck ich zurück, von Zweifeln angefressen,
und zaudere in schlaffem Widerstreben.
O schickte sie, die Stunde ist erreicht.
den letzten Pfeil von mitleidloser Sehne,
die Schneide noch von anderm Blute feucht!
So flehe ich den Amor an und jene,
die mir, entschwindend, Haut und Haar gebleicht.
Vergebens wart ich, daß ihr Rufe ertöne.
Hubert Witt (1982)
Glaubte ich, Tod befreit und ließe rasten
Von, was in Staub mich wirft, liebendem Denken –
Mit meiner Hand wollte dem Staub ich schenken
Des Körpers Last und alle diese Lasten.
Doch, fürchtend, das wär nur ein übergehen
Von Trän zu Träne, einem Krieg zum andern,
Muß diesseits jenes Schritts ich Ärmster wandern
Im Hier, im Dort halb, und statt hingehn gehen.
Zeit wäre wohl, daß nun auch er, der letzte
Pfeil abflög von der mitleidlosen Sehne,
Den Vieler Blut schon färbte und benetzte.
Ich bitte Amor drum und sie, die Taube,
Die mich rückließ in gleicher Farb wie jene
Und mich vergaß, der ich allein ihr glaube.
Rainer Kirsch (1982)
Nachwort
Wer ist Petrarca? Jedenfalls nicht jener unentwegt schmachtende Liebesrhapsode, als der er gemeinhin gilt. Gewiß, er unternimmt es, über zwei Jahrzehnte hin eine Frau, die er mit dem Namen Laura (Gold, Lorbeer, Aura, Aureole, Morgenröte) besetzt, entschieden zu bewundern. Aber bewundert er, indem er nicht nur auf die Frau, sondern auch auf deren Unerreichbarkeit sieht (Laura ist kinderreich verheiratet, vermutlich an einen de Sade, allerdings Hugo) – bewundert Petrarca nicht vielmehr sich selbst, d.h. die energetische Unablässigkeit seines Bewunderns? Weint er nicht eben sie froh durch, wie schon Klopstock ahnt?
Immerhin meint P. sein Diktum ernst, der „Canzoniere“, das Kompendium der, ausnahmsweise italienisch geschriebenen, Erosgedichte, beanspruche innerhalb des Œuvres einen minderen Platz. Tatsächlich wird ihm der Dichterlorbeer, übrigens unter erheblicher Anteilnahme der römischen Einwohnerschaft, aufgesteckt für das fragmentarische Epos „Africa“, die Zuschneidung der Vergilschen Änëis auf Roms Sieg über Karthago. Und natürlich weiß der selbstbewußte Weltbürger aus dem Florentinischen um den Wert seiner Briefliteratur, die ihm den Platz wenn nicht des Ersten, so doch des ersten Humanisten der aufkommenden Renaissancezeit zumißt.
Wer ist ein Humanist? Einer, der in Ären der Verwerfung sich selber als einzig gesichertes Betrachtungsobjekt scharf ins Auge faßt und einer Gesamtheit (in Petrarcas Fall der durch das überrationelle Latein erreichbaren Teilmenschheit) durchblickstiftend Bericht gibt. Und welche Ära wenn nicht die Petrarcas ist eine der Verwerfung, mithin der einigermaßen unleidlichen Zustände.
Mehrfach geht es P. bei dessen häufigen Reisen an den Kragen; und kaum einer der Briefe gelangt, zumal unterwegs ungelesen, an den Adressaten. Einfacher gesagt: Italien zerbröselt in den Dauerfehden seiner Regionalpotentaten. Nicht anders Frankreich – es reibt sich, wie Gegner England, in den quengelnden Scharmützeln des beginnenden Hundertjährigen Krieges auf. Die gestaltformende Hand fehlt: weder Papst – noch (deutsches) Kaisertum haben die Kraft zu ordnender europäisierender Friedfertigkeit. (Daß eine Florentiner Bank schon im Trecento über sechzehn Niederlassungen auf dem Kontinent verfügt – von London bis Zypern – und so den unwiderstehlichen Absolutismus des Kapitals ankündigt, dafür hat Petrarca noch keinen Blick; ja und hätte der ihn getröstet?)
Als eines Jahres 3 Päpste gegeneinander amtieren (ein Geschehnis, das an Mysteriosität die Unbefleckte Empfängnis in den Schatten stellt), zerstiebt das festlich feste Weltbild der Scholastik ganz und gar; und in den frösteln machenden Konzeptionsschauer (Friedell) hinein bricht zudem eine nichtendenwollende Pestepidemie mit noch heute unglaublichen fünfundzwanzig Millionen Opfern – unter ihnen eines der drei Kinder, die P. mit (einer?) Unbekannten zeugt.
Kurzum, die Welt scheint aus den Fugen. Was tun? Nichts. Was tut Petrarca? Er sucht einzurenken. An den Altrömer Seneca richtet er einen Briefessay ausschließlich deshalb, um sich (oder uns) die ehrende Schlußtat des berühmten Stoikers auszureden. Freitod, so Petrarca, sei unstatthaft weil Desertion aus dem Amt. In diesem Wort gründet der engagierte Intellektuelle der Neuzeit.
Seines Amtes, meint P., sei es, der Heraufführung einer Respublica beizuhelfen: der des sich einigenden Italiens, wo nicht Mitteleuropas. Daß ihn die Diversität seiner Mitteln nicht anficht, belegt nur den Wollensernst. Zunächst, in den Vierziger Jahren, setzt er auf den Volkstribun (Cola di Rienzi); hernach, als dieser an Machtrausch untergeht, auf den Kaiser (den in Prag residierenden Karl IV.). Vom Brutus zum Cäsar – den jugendlichen Leser, den diese Kehre mit Ingrimm erfüllt, mag milder stimmen, daß P. gegen den römischen Kaiser (als er am Lebensende dessen Biografie arbeitet) erzieherische Klarsicht walten läßt: in „De gestis Caesaris“ findet sich dessen Vita, wie gar Gundolf sagt, aus den echten Quellen wieder vollständig zusammengestellt, als Ausßluß einer geschichtlichen Einheit und gereinigt von den Zutaten des magischen Wahns und der schweifenden Phantasie.
Selbstredend mißlingt die Fürstenbelehrung, und P. setzt, wie es dermaleinst die Weimarer Dioskuren auch tun werden, auf allgemeinere Langfristaufklärung. Kennzeichnend, daß er erstmalig den Gedanken einer öffentlichen Bibliothek aufwirft und als deren Grundstock seine unikale Schriftensammlung anbietet. Petrarca, der übrigens fünf, sechs Kopisten unterhält, läßt den Homer übersetzen; und nach unentdeckten Manuskripten etwa Ciceros durchfahndet er brieflich, unter Vabanque-Vorauszahlung, oder selber reisend nicht nur ganz Italien, wo ich ja bekannt bin, nein sogar Frankreich und Deutschland, Spanien und England und, du wirst dich wundem, selbst Griechenland.
Freilich unternimmt er die Reisen durchaus auch, um der Melancholie zu entgehen. Nicht daß Petrarca vom Leiden an Welt nicht gezeichnet wäre; indessen verabsäumt er nicht das Aufzeichnen dieses Leidens, an dem nicht schuld zu sein er begehrt. Anders als noch, ein Halbjahrhundert früher, die Riesengestalt Dante, findet sich Petrarca nicht mehr willens, die Azedie (eben Verdrossenheit, Lauheit, Melancholie) als eine der 7 Sünden anzuerkennen, d.h. sie zerknirscht zu verinnerlichen. Deutlich weist er dorthin, wo deren Verursachungen zu finden sein müssen: ins Drunter und Drüber des Draußen.
Wie aber nun die Liebeslyrik? Sie als das gänzlich Andere? Nein. Eben nicht ist sie wehe-süßlich hingescharrt fliegenden Kiels in Verzichträuschen; das ganze Abgebrochene, stoßweise Seufzende, Notgedrungene, wahrhaftig Leidenschaftliche – wie J.M.R. Lenz schön sagt – ist eben nicht ihr Kern. Statt betörten Außer-sich-Seins obwaltet ein betörendes In-sich-Schauen; Petrarca leckt seine Wunde derart, daß sie, nicht verheilend, das Innen auszuspähen gestattet. Liebe als Sporn der Erkenntnis, ihre Qual Quell schwierigen Genießens.
Die Kanzonen, Sestinen, Ballaten, Madrigale und vor allem die Sonette, durchweg strengt geformt zeigen denn auch ihre Konstruktion offen vor – uns leuchtet sie regelrecht entgegen aus den hier versammelten Übersetzungen, insbesondere den Meisterstreichen innerhalb des 1982er Eindeutschungsschubs. Und der „Canzoniere“ insgesamt: er enthält, der Zahl der Tage im Jahr entsprechend, 365 Gedichte; was wunder, daß Amors Pfeile ausgerechnet im 97. Gedicht in die mittelbreite Brust des Florentiners schwirren: Der Karfreitag, an dem der Zweiundzwanzigjährige seine Laura erstmalig erblickt haben will (wie Goethe seine Herzlieb an einem Advent), fällt in jenem Jahr just auf den siebenundneunzigsten Tag. Petrarca – allenthalben pocht er auf Vernunft. Und staunen macht schon, daß er (endlich kurzsichtig auch im übertragenen Sinn; seit dem sechzigsten Lebensjahr benötigt er eine Brille) seinen Nachruhm administrieren zu müssen (und zu können) glaubt. Im Testament verfügt er vorrangig den Kauf eines Stücks Land, mit dessen Zinserlös ein alljährliches Ewiges Petrarca-Fest bestritten zu werden habe. – Immerhin, Boccaccio wirft er erkleckliche 50 Florentiner Golddukaten aus (ein Viertel des Preises besagter Immobilie) zu einem Winterkleid für das Studium und das Arbeiten bei Nacht; ein nobler, so menschlicher wie menschheitsdienlicher Akt.
Peter Gosse, Nachwort
Poet’s Corner in jede Manteltasche! Michael Krüger: Gegen die Muskelprotze
Hans Joachim Funke: Poeten zwischen Tradition und Moderne. Eine neue Lyrikreihe aus der Unabhängigen Verlagsbuchhandlung Ackerstraße.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope


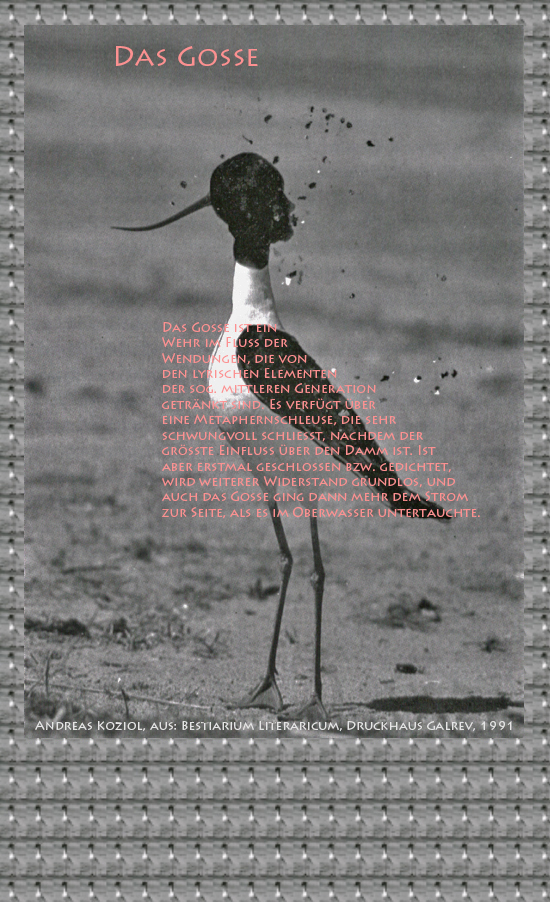
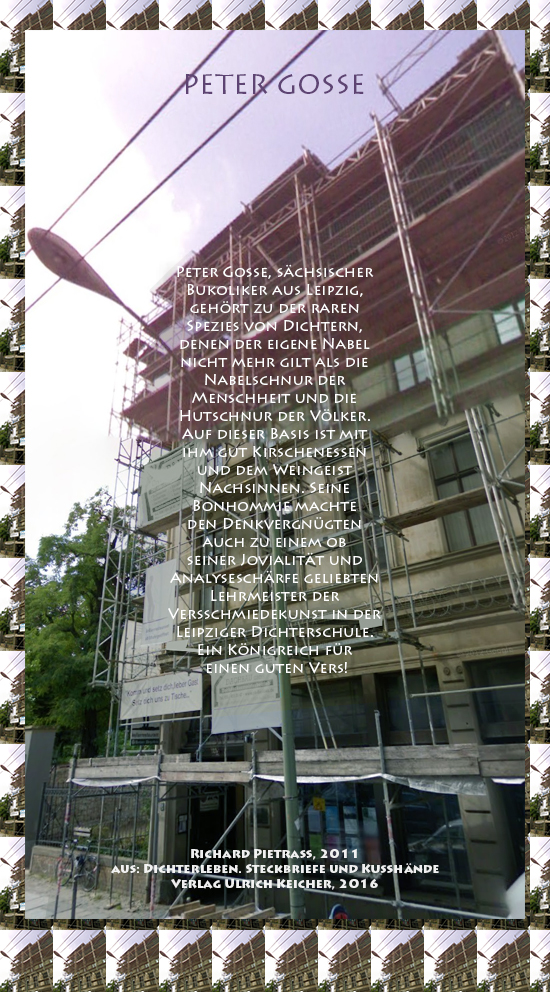












Schreibe einen Kommentar