Friederike Mayröcker: Gesammelte Gedichte
SONNENFINSTERNIS ’99 / BAD ISCHL
Für Ernst Jandl
Erst wieder in 700 Jahren sagt ER
1 Jahrhundert Ereignis sagt ER
solltest du nicht versäumen sagt ER
auf dem Balkon ER setzt die Spezialbrille auf
verkrieche mich mit dem Hündchen in der
aaaaaSchreibtischnische
die Vögel verstummen −
1 Jahr danach SEINE ewige Finsternis
Seit über sechs Jahrzehnten knüpft Friederike Mayröcker
in ihren Gedichten an einem magischen Sprachteppich. Die Sprachfäden schießen ineinander, entfalten ein filigranes wie weit austreibendes Geflecht, das alle Festlegungen überschreitet. Unermüdlich erprobt die Dichterin die Übersetzbarkeit von Materie in Sprache, wagt sich immer neu durch unerschlossene Schichten. Gesehenes, Erlebtes, Erfundenes, im Geiste Erlebtes und Geträumtes – alles findet Eingang ins Textgewebe. Wortneuschöpfungen stehen neben Fremdzitaten und Selbstverfremdungen, spuren ihrer Auseinandersetzung mit Werken von Kollegen neben solche ihres Umgangs mit Malerei und Musik – in allem spricht sich eine ungestüme Wahrnehmungskraft aus, ein Abtasten der Welt, das nicht ausschließt, aufs Ganze geht.
Der hier zum 80. Geburtstag der Autorin von ihrem Kollegen Marcel Beyer herausgegebene Band präsentiert neben sämtlichen bislang veröffentlichten Gedichten (in Buchform oder verstreut publiziert) auch alle unveröffentlichten Gedichte, die nach Durchsicht der Manuskripte von der Autorin für „gültig“ befunden wurden, und zwar von 1939, als sie mit dem Schreiben begann, bis heute.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2004
Grenzüberschreitende Honigkeiten
− Friederike Mayröckers Gesammelte Gedichte 1939–2003. −
Ein „gebratenes Wort“ ist in Friederike Mayröckers Gedichten kein Fremdkörper. Der Mond ist dort essbar, eine Stunde „fleischfarben“, die Liebe „moosgrün“. Sinneswahrnehmungen aller Art, Gedanken und Gefühle gehen ungewöhnliche Verbindungen ein. Auch die Sprachmaterie hilft dabei, verschiedenste Dinge zu assoziieren: „Orchideen Iden Ideen“.
Eine umfangreiche Sammlung erstaunlicher Spracharbeiten kann nun entdeckt werden: Denn zum 80. Geburtstag, den Friederike Mayröcker am 20. Dezember 2004 gefeiert hat, sind alle bisherigen Gedichte der österreichischen Autorin in einem Band erschienen, viele davon zum ersten Mal. Schon ein einziger dieser vielschichtigen Texte bietet Stoff für seitenlange Analysen. Wie soll man da gleich 1037 Gedichte vorstellen, die außerdem nur einen Bruchteil von Mayröckers literarischem Gesamtwerk ausmachen (2001 verlegte Suhrkamp die Prosa der Autorin in 5 Bänden)?
Auf eine Besonderheit dieser Sammlung weist Marcel Beyer, Mayröckers junger Dichterkollege und Herausgeber der Gesammelten Gedichte, in seinen editorischen Notizen hin. Er hat, dem Wunsch der Autorin folgend, die Gedichte chronologisch geordnet. Diese Anordnung, durch die die ‚ursprüngliche‘ Einbindung der Gedichte in Zyklen und Gedichtbände unsichtbar wird, eröffnet Beyer zufolge „ein neues, so bisher nicht wahrnehmbares Geflecht von Bezügen“.
In der Tat: Mit dieser Ausgabe sind nicht nur alle Gedichte zugänglich gemacht worden – einschließlich derer, die Mayröcker 2002 und 2003 nach ihren Texten für den Band „Mein Arbeitstirol“ verfasst hat. Es erschließen sich auch Einsichten, die ohne die von Beyer präsentierte Gliederung nicht möglich wären. Beim Vergleichen einzelner Gedichtbände nämlich kann der Leser den Eindruck gewinnen, Mayröckers Schreiben sei vor allem von stilistischen Umorientierungen und thematischen Brüchen geprägt. In ihren Gedichten treten klassische ‚wie‘-Vergleiche und Genitivmetaphern neben modernste Verfremdungstechniken. Der Leser findet traditionelle Liebesgedichte – die bewegendsten sind Mayröckers Lebensgefährten, dem 2000 verstorbenen Dichter Ernst Jandl, gewidmet −, surrealistische Naturbeschreibungen und Experimente, die an die sprachreflexiven Texte der Wiener Gruppe erinnern. Und erst die „Gesammelten Gedichte“ lassen entdecken, in welchem Maße sich diese heterogenen Züge durchdringen. Wer den Texten in ihrer chronologischen Anordnung folgt, merkt, dass für eine Phase Typisches später nicht einfach verschwindet, und kann wellenartige Verschiebungen beobachten.
Schon früh entfernt sich Mayröcker von klassischen Formen. Ihre ersten beiden Gedichte aus dem Jahre 1939 nutzen Strophen mit Kreuzreim. Danach sind Endreime, abgesehen von ihrem gezielten Einsatz in einem Dutzend Aphorismen, Kinderliedern oder ironischen Texten, kein einziges Mal mehr zu finden. Mayröcker entwickelt andere Mittel, um vor allem Details aus dem Alltag, Landschaftsbeobachtungen, Träume und die Gefühle des Liebens und Trauerns zu verworten. Nach und nach werden Elemente in die Texte integriert, die über das Sprachmaterial nachdenken lassen. Experimentiert wird zum Beispiel mit einzelnen Wortteilen – „Ur-werk“, „heli kopter maien käfer“ – oder mit der Wortart: Die Morgensonne „astgabelt“, dem Wort „nachtigallen“ ist die Erklärung „(adj.)“ beigegeben. Und schon in Gedichten der späten 50er und frühen 60er Jahre zeichnet sich ab, was bis heute prägend ist: Mitten im Satz endende Gedichte, Zitatsplitter, eine private Typografie („Barfüszler-Buszgedichte“) und der Dialog zwischen verschiedenen Sprachen, Sprechweisen und Themen. Liest man die Gedichte in zeitlicher Folge, sieht man, wie hermetische Züge mehrmals zu- und wieder abnehmen, wie härter gefügte Montagen langsam zu leichter verständlichen, erzählenden Gedichten überleiten und umgekehrt. Am spannendsten ist die subtile Verschmelzung von beidem, die Mayröcker in den meisten Texten gelingt. Interessant sind auch sparsam eingestreute poetologische Selbstkommentare, in denen der Leser sein eigenes Verwundertsein gespiegelt sehen mag:
wie (= als) Vivaldi ruderte / „radelte“ / auf dem Teich auf dem krummen gleiszenden Glanzpapier nämlich auf Algen-, Zypressen Grund .. aus dem Humus das Zünglein der Zöglinge (Pflanzenstock) : oder ist das alles zu hermetisch? – sollte ich lieber schreiben : in seinem Bettuch das Brandloch von der vergessenen Zigarette? ach ich weisz es gibt nichts zu GREIFEN BEGREIFEN
Überall ist bei Mayröcker die Suche nach dem Ungeläufigen zu spüren. Um sprachlich näher oder anders an die Dinge heranzukommen, reichen ‚gewöhnliche‘ Wendungen nicht aus. Selbst da, wo die Wörter stilistisch nicht verfremdet werden, überraschen und irritieren sie. Mayröckers „Liebesspiel mit der Sprache“ kennt keine logischen Grenzen, es sucht und findet „das zärtliche Durchwachsensein grenzüberschreitender Honigkeiten“.
Dass diese sprachlich avancierte Lyrik eine starke Wirkung auf die jüngeren Autorengenerationen ausübt, ist nicht verwunderlich. In sprachreflexiven Gedichten österreichischer und auch deutscher Lyriker (wie beispielsweise Thomas Klings und Ulrike Draesners) ist ihr Einfluss spürbar.
Die „Gesammelten Gedichte“ eignen sich für den Lyrik-Liebhaber, der Mayröckers Texte kennen lernen will, wie für den geübten Mayröcker-Leser, der hier eine gründlich recherchierte, mit Nachweisen ausgestattete Sammlung vorfindet.
Indra Noël, literaturkritik.de, Januar 2005
Das Gedicht, die Daten und die Schöne Zunge
(…)
Friederike Mayröcker
Ich habe bei Celan nicht nachgezählt. Doch im Fall der nun achtzigjährigen Friederike Mayröcker und der 855 Seiten des Bandes Gesammelte Gedichte sind es rund 1.000 Gedichte aus 65 Jahren. Das erste hier gedruckte stammt aus dem August 1939; das Gedicht einer Vierzehnjährigen hat ein zartes Nachsommeraroma:
ein frühkusz stürzt nachsommersüsz
wie eine Sonn’ herab
ein reifer Blütenleib den blies
der Wind ins Grab.
Aber nicht Stifter oder Hofmannsthal waren die entscheidenden Erfahrungen, sondern die in den fünfziger Jahren in Wien rezipierte internationale Avantgarde, vor allem Surrealismus und Konkrete Poesie. Tod durch Musen (1966) hieß Mayröckers erster Sammelband mit Gedichten 1945–1965; er trug den changierenden Gattungstitel „Poetische Texte“. Eugen Gomringer rechnete die Autorin im Nachwort dem „wachsenden Feld der experimentellen Literatur“ zu, war aber auch bereit, sie trotzdem gern eine „Dichterin“ zu nennen. Mayröcker wiederum zeigte sich bereit, auch mit modisch-versnobten Begriffen wie „Random“ und „Entropie“ zu kokettieren, sprach aber auch, simpler und bescheidener, von „Reiztexten“.
Die genaueste Beschreibung ihrer Methode gab sie 1983 in Magische Blätter, einem Bändchen Kommentare und Statements. Dort spricht sie von der „kalkulierten Jagd nach der fruchtbringenden Irritation von außen“ und beschreibt das Ineinander von Leben und Kunst:
einziger Lebensreiz: allerhand dunkle Gefühle, Gedanken heraufziehen ins überblickbare Bewußtseinsfeld um sie dann bis zum äußersten zu entdecken und auszuzählen.
In Versalien fährt sie fort:
ICH SCHREIBE FÜR NERVENMENSCHEN.
Seit fast sechzig Jahren führt Friederike Mayröcker ihr Schreibleben: Aus dem Hieronymusgehäus ihrer von Papieren zugewachsenen Wiener Wohnung sind über siebzig Bücher hervorgegangen, eine ununterbrochene Poesie. Altern als Problem für Künstler – so Benns berühmte Formulierung – scheint für die Mayröcker nicht zu existieren. Lassen wir die vielen Prosabücher beiseite, bleiben wir bei der Lyrik. Ihr Gedichtband von 1992 besingt Das besessene Alter. Rüstigkeit der Phantasie bezeugen sowohl die Notizen auf einem Kamel (1996) wie – geradezu augenzwinkernd – Mein Arbeitstirol (2003); und eben jetzt die Gesamtausgabe, die etwa zweihundert weitere Gedichte nachträgt. Wer das alles liest oder gelesen hat, ahnt den Preis, den diese strömende Poesie kostet. Wo Schreiben Leben ist und Leben Schreiben, herrscht „Biographielosigkeit“. Die Dichterin hat das mit mehr Verwunderung als Bedauern konstatiert. In einem der späten Gedichte lesen wir die wohl radikalste Formulierung ihres Lebensprogramms:
mich interessiert das nicht was in meinem
Körper vorgeht was mit meinem
Körper geschieht, solange er noch
sitzen kann und Wörter schreiben auf der Maschine.
Mayröckers Wort- und Nervenkunst ist erstaunlich geschichtslos. Etwas wie die furiose Schilderung einer aufgeputschten Menge wie in Jandls „Heldenplatz“ sucht man bei ihr vergebens. Immerhin kommen ein paar Stichworte vor, überwiegend in den früheren Gedichten: Katyn, Kirkenes, Budapest, Führerhauptquartier, oder die Reminiszenz:
September 44; am zehnten; vormittag; drei einarmige
machen noch keinen frieden.
Was Mayröcker an Lebensstoff aus einer „hermetischen Kindheit“ herübergerettet, ist von Geschichte unverletzt – immerhin beim Jahrgang ’24 erstaunlich. Biographielosigkeit heißt freilich nicht Abwesenheit von Schmerz. Davon spricht auf anrührende Weise das Requiem auf den Tod ihres Lebensgefährten. Aber dies Requiem für Ernst Jandl (2001) enthält auch die tröstende Überlegung, „daß man weiter mit diesem HERZ- und LIEBESGEFÄHRTEN sprechen kann nämlich weiter Gespräche führen kann.“
Jandl ist auch in den zwischen 1996 und 2001 geschriebenen Gedichten die Zentralgestalt; über zwanzig sind ihm ausdrücklich gewidmet. Mayröckers späte Lyrik insgesamt wird zum lyrischen Tagebuch, zur Mitschrift seelischer Prozesse als Sprachbewegungen. Einmal heißt eine Überschrift „Melancholie, oder das dritte Gedicht dieses Tages“ – nämlich des 20.3.99. Ein anderes Gedicht bezeichnet noch genauer seine Entstehung: „5. Juni 98, zwischen 4–5 Uhr früh.“ Nach Jandls Tod wandelt sich der oft spielerisch-zärtliche Tonfall zum Ausdruck von Schmerz und Verlust. Ein volksliedhafter Ton klingt auf:
bin jetzt hier bist noch dort
dort war Blume Schmerz und Wort
kann dir nicht sagen wie es hier ist –
oh dasz du mir verloren bist.
In diesen späten Gedichten öffnet Mayröcker ihre Schreibweise. Die einst behauptete Biographielosigkeit verbarg einen Fond an erlebtem Leben, der nun im Alter zu Tage tritt. Immer noch ist ihr die Kunst enorm wichtig, hat sie „Sehnsucht nach meinen (noch) nicht geschriebenen Werken“. Aber nun geht es ihr um wichtigeres, um das Ineinander von Leben und Kunst.
Die prägnanteste Formulierung dafür findet sich in einem titellosen Gedicht. Man möchte es einen Hymnus an das Leben nennen. Er beginnt mit einem Stammeln:
dies dies dies dieses Entzücken ich klebe an dieser Erde.
Die Dichterin rühmt die Wollust der Augen und die „Flitzerei“ eines plötzlichen Engels, um in einem Ach zu enden:
ach ich KLEBE an diesem
Leben an diesem LEBENDGEDICHT.
Harald Hartung, Merkur, Heft 674, Juni 2005
Wilder Honig
− Friederike Mayröcker pflegt die Einheit von Kunst und Leben. −
Berühmter als ihre Hand- und Herzliebe zu Ernst Jandl ist wohl nur Friederike Mayröckers Arbeitszimmer, jene Schreibhöhle mit all den Bücherstapeln und Regalen, den Schachteln und Plastic-Körbchen, aus denen Hunderte von Zetteln hervorquellen. Irgendwo dort muss sie an ihrem Tischchen sitzen und arbeiten, vor sich die Hermes Baby, ihre heiss geliebte Schreibmaschine. „Ich bin verheiratet mit meiner Hermes Baby – ich knie mich so hinein wie der Glenn Gould in sein Klavier“, hat sie einmal verraten. Die erste Maschine hat sie sich mit 22 gekauft, da war sie gerade Lehrerin geworden. Und weil bei dieser Schreibmaschine das „ß“ fehlte, benutzte sie fortan ein „sz“. Auch das ein kleiner Mythos.
Schreibstoffe
Eigentlich ist es merkwürdig, wie sehr sich Friederike Mayröckers Werk ins Reich der Legenden verabschiedet hat. Denn auf den ersten Blick wirken viele ihrer Texte, die Prosatexte zumal, wie Mitschriften des eigenen Lebens. Wahrnehmungsfäden und Hautspuren, Erinnerungsreste und kleine Gedanken laufen hier ineinander, verschlingen sich, um plötzlich hart geschnitten in einem Zitat zu enden. Zugleich aber zeigt sich schnell, dass nicht nur das Stimmengemurmel der Texte, sondern auch all das, was wie konkret erfahrene Realität aussieht, immer schon als künstlerisches Bild angelegt ist. – Trotzdem ist dieses eigene Leben der Fundus, aus dem sie ihren Schreibstoff gewinnt. Die Kindheit in Wien, in der sie schon früh ein wehmütiges Kunstgefühl verspürte. Die enge Beziehung zur Mutter, der sie bis zuletzt aus ihren Büchern vorgelesen hat. Und natürlich die lange Liebes- und Schreibliaison mit Ernst Jandl. Dazu wachsen, von Jahr zu Jahr stärker, die Erfahrungen der eigenen Lektüre, eine geradezu manische Lesewut überkommt die Schreibende immer wieder, die alle Autoren – Schriftsteller, Philosophen, Maler vor allem – über Zitate in die Texte schleift. Wenn es überhaupt so etwas wie ein Stempelchen gibt, das man Friederike Mayröcker aufdrücken könnte, dann ist es die romantische Sehnsucht nach einer Einheit von Leben und Kunst.
Diesem Traum von der absoluten Poesie kann man jetzt in einem fast 900 Seiten starken Wälzer nachgehen. Zum 80. Geburtstag der Autorin hat Marcel Beyer ihre „Gesammelten Gedichte“ herausgegeben, sorgfältig sortiert nach der Entstehung und flankiert von einem genauen editorischen Nachwort. Man mag es ein wenig bedauern, dass durch diese chronologische Lesart die Komposition der einzelnen Gedichtbände aus dem Blick gerät. Doch Beyer hat die ursprüngliche Anordnung im Anhang genau verzeichnet – und das Hin-und-her-Blättern gehört bei der Mayröcker-Lektüre ohnehin dazu. Endlich hat man ihre „Nerven Stenographien“ in Gänze zur Hand und kann die Entwicklung ihres Schreibens verfolgen. Dazu gibt es gut hundert unveröffentlichte Gedichte. In einem findet sich dies: „wilder Honig so 1 kl. wildes / Honig Gedicht“.
Nicht nur der Rhythmus ihrer Gedichte, sondern auch die jüngsten Prosaarbeiten verraten etwas über die ersehnte Einheit von Leben und Kunst. Sie beginne jeden Tag, heisst es in dem kleinen Prosagewächs „Die kommunizierenden Gefässe“, indem sie versuche, jede noch so unscheinbare Verrichtung, jeden Handgriff in Worte zu fassen. Schon in der Morgendämmerung sitzt die Ich-Erzählerin im Bett, die Schreibmaschine auf den Knien, und tippt die ersten Zeilen. Auch ihre Träume werden dabei zum Stoff, aber es sind allenfalls Verbalträume: „Ich träume in Wörtern und Sätzen, schreibe sie auf und arbeite mit ihnen bei Tag.“ Bücher werden gnadenlos auf Worte und Stellen hin durchsucht, die sich in den Texten anwenden liessen.
Am wichtigsten jedoch sind die haarfeinen Wahrnehmungen und Irritationen eines „Augen- / Ohrenmenschen“, der ohne Sprache nicht sein kann: „Ginster des AUGEN TRIEBS – ach schauen! schauen ! : sich / einverleiben die Berührung der Hand des Fuszes (spirituell) oder / Verheiszung eines Glücks“ liest man in dem Gedicht „Azuren / Auroren“. All dies ist ihr das „manische Zungenmaterial“, mit dem sie in das Schreibgeschehen eintaucht:
So werden Lebens Schritte zu Worten übersetzt, sage ich, so wird Leben zu Sprache verwandelt.
Jedes Ding, „was du dazu ernennst“, kann zum Kunstwerk werden.
Wollust und Depression
Allerdings bleiben die Dinge in diesem alchemistischen Sprachdenken nicht unverändert, im Gegenteil:
Das ist 1 Schreiben hinter dem Schreiben, sage ich, es löst sich alles in Sprache auf, aber manchmal frage ich mich auch, wo ich das Leibliche (Stoffliche) meiner Texte finde.
In einer Art euphorischem Zustand, einer „Beseelung“, wie es einmal heisst, schafft die Schreibende die Dinge zu Sprache um. Doch die Verwandlung endet fatal: Zurück bleibt ein Nichts. Vielleicht deshalb wechselt sich die „Wollust des Schreibens“ mit Phasen der Depression ab, in denen es scheint, als sei alles nur Betrug: „kein Wort und kein Satz vorhanden, der absolute Zusammenbruch des Gehirns“.
An dieser Stelle möchte man die Dichterin gerne trösten. Denn das „Leibliche“ – ihre Honiggedichte zeigen das allesamt – hat sich nicht nur auf die Seite dessen verlagert, was man mit einem etwas unschönen Begriff den „Akt des Schreibens“ nennen könnte. Jenes Durchströmtsein von Sprache, wenn der ganze Körper zu pulsieren scheint und die Silben noch in den Fingerspitzen spürbar sind. Vielmehr kehrt es wieder in den Texten, als Rhythmus, als „talismanische Kraft“ kunstvoll verschlungener Lautgirlanden, die sich vor dem Leser nach und nach ausbreiten. Die ihn umgarnen und an sich ziehen, die ihn aber zugleich etwas sehen und hören lassen: „diese ganze sichtbare Geheim Welt“ und das „Zirpen von Weltfülle“. – Wie schade ist es, dass man dieses wunderbare Zirpen kaum mehr in Friederike Mayröckers eigenem Tonfall hören kann. Nur noch selten verlässt sie die Wohnung, um auf einer Lesung mit ihrer leisen, immer ein wenig schläfrig klingenden Stimme dem „Wirrwarr der 1000 Zungen“ zu huldigen. Doch die Gesammelten Gedichte sind ein Trost. Und gewiss kein kleiner.
Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung, 31.12.2004
Wenn Zettel träumen
− Unüberhörbar, poetisch: Zum 80. Geburtstag von Friederike Mayröcker ist ihr lyrisches Gesamtwerk erschienen. −
Die knapp Fünfzehnjährige dichtete:
ein reifer Blütenleib den blies
der Wind ins Grab
Und so dichtete sie mit 79:
unter Bäumen saszen
wir und schwiegen unter Bäumen ich allein und
schweigend ohne dich unter Bäumen du allein und
schweigend ohne mich
Zwischen „August“ von anno 1939 und „unter Bäumen Tränenmorgen“, entstanden im August 2003, liegt ein gewaltiges poetisches Werk. Ernte eines radikalen, absolut konzentrierten „Schreiblebens“, wie es die deutschsprachige Literatur sonst kaum kennt. Friederike Mayröcker, die Büchnerpreisträgerin 2001, hat es in unermüdlicher Arbeit geschaffen.
Sie konnte und kann nicht anders, ihr Zwang zur Kreativität ist, das sagt sie selbst, ein „Gnadenfluch“. Dieser Tage feiert sie, und Wien mit ihr, ihren 80. Geburtstag. Ein Alter, in dem man ihresgleichen gerne als „Grande dame“ bezeichnet. Doch ihr stünde der mittlerweile inflationär gebrauchte Ehrenname schlecht zu Gesicht. Friederike Mayröcker ist nämlich viel zu sehr Künstlerin, um Dame zu sein. Diese müßte, metaphorisch ausgedrückt, zumindest einen literarischen Salon führen. In ihrer Wohnung wucherte indes ein Papierurwald, füllte ein Dschungel aus Texten die Räume bis zur Decke. Und die Zettel begannen miteinander zu kommunizieren und voneinander zu träumen. Sie tun es bis heute.
Der jetzt von ihrem Schriftstellerkollegen Marcel Beyer vorgelegte, beeindruckend umfangreiche Band Gesammelte Gedichte, der neben sämtlichen bis dato veröffentlichten Gedichten auch unpublizierte enthält, eröffnet dank chronologischer Anordnung faszinierende Ein- und Überblicksmöglichkeiten: Sichtbar wird ein wahres work in progress.
Obwohl das Späte an das Frühe anzuknüpfen scheint, ist es doch etwas grundlegend anderes: Verwandelt durch Erfahrung, naturgemäßes menschliches Leid und ästhetisches Experiment, entwickelte sich aus dem vertraut herkömmlichen Ton von einst eine neue Einfachheit voller Suggestivität. Auf der Höhe der Zeit ist schon ein durchtrieben aphoristisches Kürzestgedicht gewesen, das sie 1957/58 zu Papier brachte:
DIE GÜRTELROSE
blüht im
verborgenen
Zeitlos schön der Vers: „o Europa Silberdorn; Raubtierzähnchen unsrer Welt“. Inspiration war für diese Dichterin nie ein Fremdwort, und sie glaubt – in ihrem Fall – mit Fug und Recht daran.
Tod durch Musen, das 1966 erschienene Buch mit dem unvergeßlichen Titel, hat Friederike Mayröcker im Literaturbezirk bekannt gemacht. Genauer gesagt: zu einer von Kollegen und den Happy Few der Kenner und der Experten der Wissenschaft geschätzten, ja sogar bewunderten Autorin. Denn für das große Publikum schrieb die hartnäckige Avantgardistin damals zu vertrackt, zu hermetisch. „tod durch musen“ lautete die letzte Zeile des gleichnamigen Gedichtzyklus, von „cleo“ bis „euterpe“.
Noch fast 40 Jahre danach hat jenes Buchstabengespinst nichts von seiner verlockenden, verführerischen Fremdheit eingebüßt. Die Worte stehen da und blicken uns, mal wie von nah, mal ganz von fern, unverwandt an. Sie wollen nicht entschlüsselt sein, bloß Anstoß zu Assoziationen, die von Begriff und Klang, von Syntax und Druckbild evoziert werden. Mayröckers Lyrik nahm Anregungen und Akzente von überall auf, sei’s Hölderlin oder Gertrude Stein, sei’s Bachs „Kunst der Fuge“ oder Marguerite Duras. Lebendige Tradition und künstlerische Zeitgenossenschaft über die Genregrenzen hinweg waren und sind ihr eins: Mit beidem befindet sie sich in einem fortwährenden Dialog.
Zugleich ist Friederike Mayröcker aber eine Wahrnehmungsvirtuosin, eine Meisterin in der Schule des Sehens, berufen zur Feier der Dinge, der Natur. Betörend beginnt „an eine Mohnblume mitten in der Stadt“ (1985):
aus meinen Köpfen sprieszt
das Feuerwerk der Tränen, der
Flieder rostet, der Liguster
weht, die Camouflage des
Sommers läszt Gewitter ahnen
Und magisch verklingt auch das Ende:
im Aufwind flügelschlagend
steht
raubvogelgleich mein Herz nach Beute äugend
Friederike Mayröckers ungebrochen kraftvolle Altersproduktion zählt zu den beglückendsten Überraschungen ihres Œuvres. Zum Beispiel „5. Brandenburgisches Konzert“ aus dem vor einem Jahr erschienen Band Mein Arbeitstirol:
NACKEND NACKEND NACKEND
END von Ende gehst
in die Erde hast nicht Faden an dir nicht Aufschreibbüchlein noch
Brille noch Stift hast nicht Frohsinn nicht Kusz nicht Auge und Ohr
nicht Musik nicht Wort noch Himmel und Wolke
schnüffelst Erde und Wurm ELLENDES ELLEND…
Ein barockes, trotzdem aber modernes Lamento über dem pochenden Rhythmus eines Trauermarschs.
Vor einem halben Jahrhundert hatte Friederike Mayröcker Ernst Jandl kennen gelernt. Er wurde ihr „Hand- und Herz- und Liebesgefährte“. Eine künstlerische Existenzgemeinschaft von außergewöhnlicher Intensität und Dauer: In den Gefilden der Poesie und in der Prosa des Alltags bildeten sie ein unzertrennliches Paar. Jandls Tod, zu Pfingsten 2000, war für die Mayröcker eine Katastrophe im ursprünglichen Sinn – alles brach zusammen. Das schwarze Loch, das der Entschwundene hinterließ, drohte die Verlassene zu verschlingen. Ausschließlich durch die Therapie des Schöpferischen vermochte sie sich zu retten. Ihr Requiem für Ernst Jandl (2001) beweist, daß immer noch Totenklagen ohne sprachliche Schmerz-Klischees möglich sind. Aber auch später schrieb sie Elegien von klassischem Format, die nichts Antiquiertes an sich haben. Der Schlußchoral aus der Matthäus-Passion ist ihr Schwurzeuge:
Wir
setzen uns mit Tränen nieder denn unser Leben war zu kurz
1988 antwortete Friederike Mayröcke auf die Frage „Was möchten Sie sein?“ selbstbewußt, so stolz wie schlicht:
Eine unüberhörbare poetische Stimme.
Es ist ihr, leise und eindringlich und unverwechselbar, längst gelungen.
Ulrich Weinzierl, Die Welt, 18.12.2004
Mayröcker, Friederike: Poesie der tönenden Bilder
Metamorphose visueller Eindrücke. Schreiben als behutsam komponierte Klanggeste – drei Versuche einer Annäherung an Friederike Mayröckers Poesie, die angesichts der Vielschichtigkeit ihres Werkes, immer nur Aspekte eines schillernden Ganzen spiegeln können. Denn Mayröckers Meisterschaft in Sachen Poesie erweist sich im Lauf eines anscheinend unabgeschlossenen Prozesses.
Schreiben bedeutet für die 1924 in Wien geborene Dichterin, die am 20. Dezember ihren 80. Geburtstag feiert, immer ein Weiterschreiben. Ein Blick auf ihre Werkliste bestätigt diesen Eindruck: Die letzten 45 Jahre hindurch hat Mayröcker jährlich etwa zwei Bücher publiziert. Diese immense Schreibleistung findet Niederschlag u.a. in den Bereichen Prosa, Lyrik, Kinderbuch und Hörspiel.
Die Musik der Sprache
Dass die Grande Dame der Poesie im Vorfeld des heurigen Literatur-Nobelpreises zu den Mitfavoritinnen zählte, darf einerseits als eine (mehr als verdiente) Geste der Anerkennung verstanden werden, grenzt aber andererseits doch wiederum an ein Wunder. Und zwar aus einem einfachen Grund: Mayröckers Werk entzieht sich mit Bedacht allen rationalen Einordnungsversuchen. Es hat den Anschein, als folge Mayröckers Poesie eher musikalischen denn linguistischen Prinzipien. Das Bild wird zum Wort, das Wort zum Klang, der Klang zu Inhalt und Form zugleich. So entstehen tönende Bilder, voller Symbolik und Zeichen.
Manchmal fungieren punktuelle Erinnerungsfragmente als Initialzündung für einen Text, dann wiederum magisch anmutende Wortschöpfungen. Beiden wohnt eine schillernde Opulenz inne, ein Tonfall, der die deutschsprachige Literatur um eine wesentliche Dimension bereichert. Dass Mayröckers dichterisches Werk selbst von Zitaten, Sätzen und Worten (u. a. von Hölderlin, Derrida, Arno Holz, Roland Barthes) inspiriert wird, rundet den Kreislauf einer miteinander verknüpften und doch völlig freischwebenden Dichtkunst ab.
Ihr viel zitierter und im wahrsten Sinne des Wortes haptischer Zugang zum Schreiben hat allerdings eine Vorgeschichte: Friederike Mayröckers Mutter war Modistin, die im Rahmen ihrer Arbeit auch Puppen entwarf. Auf einem riesigen Tisch lagen sämtliche Materialien und Stoffutensilien versammelt, die Mayröckers Mutter für ihre Kreationen benötigte. Bildhaft gesprochen, wurde auf einen Stoff zugegriffen, um daraus eine ihm entsprechende Form zu schaffen.
Im Gespräch mit der Wiener Zeitung bestätigte Mayröcker diese Analogie:
Das ist ganz richtig. Wir haben die gleiche Arbeitsweise – wenn auch auf einem anderen Gebiet. Ich mache es genauso. Ich decke mich mit Material zu.
Konkret bedeutet das, dass Mayröcker „kisten- und körbeweise“ Briefe, Zeitungsausschnitte und Notizzettel aufbewahrt, um sie im gegebenen Fall weiterzuverarbeiten. Auf diese Weise wird jedes entlehnte Wort zu einem glänzenden Mosaikstein im Schreibprozess. Oder anders formuliert: Das Zitat ist Mittel zum Schreibzweck, ist Material, das in einen neuen „Aggregatzustand“ versetzt werden will.
Mayröckers Poesie bewegt sich zwischen Hitze und Kälte. Die beiden Pole scheinen allerdings des Öfteren nur einen Atemzug voneinander entfernt zu sein. Herznahe Erinnerungen können von einem Wort zum nächsten – vom kühlen Schatten, den der Tod in jeder Sekunde vorauswirft – überlagert werden. Ähnlich wie bei doppelt belichteten Fotografien entsteht der Eindruck von Überblendungswelten, die, jede für sich, einen abgeschlossen Kosmos darstellen. Abhängig vom jeweiligen „Seh- und Hörwinkel“ des Betrachters, können Friederike Mayröckers Texte wie Piktogramme des Augenblicks, aber auch wie raum- und zeitlose Gemälde einer unerschöpflichen Gedankenwelt gelesen werden.
Lyrik aus 65 Jahren
Die Dichterin selbst wagte einmal folgenden Vergleich:
Meine Prosa könnte ich mit der Arbeit eines Steinmetz vergleichen, die Gedichte dagegen sind gleichsam meine Aquarelle.
Zeitgerecht zu ihrem 80. Geburtstag sind sämtliche Gedichte von Friederike Mayröcker im Suhrkamp Verlag erschienen. Der mehr als 850 Seiten starke Sammelband wurde von Marcel Beyer herausgegeben, der das schier Unmögliche möglich machte und rund 1.000 Gedichte (darunter über 100 Erstveröffentlichungen) in eine chronologische Abfolge brachte. Die Zeitachse, um die Mayröckers Texte rotieren, ist exakt 65 Jahre lang.
Ein Detail am Rande: Was mit dem ersten, im Jahr 1939 geschriebenen Gedicht „August“ beginnt, lässt Marcel Beyer mit Mayröckers zum Zeitpunkt seiner Redaktion letzten, im Jahr 2003 geschriebenen und Ernst Jandl gewidmeten Text „unter Bäumen Tränenmorgen“ ausklingen:
unter Bäumen saszen wir und Waldes Brausen unter
Bäumen sprachen zu einander schwiegen blickten
in den Wald der schon die Blätter warf und fegte
Lindenblütenblätter auf den Wegen unter Bäumen saszen
wir und schwiegen unter Bäumen ich allein und
schweigend ohne dich unter Bäumen du allein und
schweigend ohne mich
Der Tod ihres langjährigen „Hand- und Herzgefährten“, Ernst Jandl im Jahr 2000 schwingt in nahezu allen danach entstandenen Texten mit. Aber auch die Trauer um die „vorgestorbene“ Mutter manifestiert sich in Mayröckers Spätwerk wie ein verklungener und dennoch immer wiederkehrender Schatten, der sich nicht vom Licht lösen kann und will.
Die Leidensspur
Noch ein Wort zu ihrem ersten Gedicht: Obgleich Friederike Mayröcker im Alter von 15 Jahren „noch nicht genau wusste“, was sie mit dem Schreiben bezwecke, war da bereits jene treibende Kraft, die bis zum heutigen Tag anhält:
Ich musste einfach schreiben. Was genau, habe ich mir nie vorstellen können. Ich muss vorausschicken, dass wir bis zu meinem elften Lebensjahr die Sommermonate in Deinzendorf, einem Dorf nahe der tschechischen Grenze, verbracht haben. Das war für mich der große Kosmos, der mir zugewachsen ist. Ich habe dort eine wunderbare Kindheit verbracht und mir alles einverleibt, was an Natur aufzufinden war. Ich erinnere mich, dass ich nachmittags stundenlang beim Brunnen gesessen bin und auf meiner Mundharmonika herumgespielt habe, ohne irgendeine Melodie herauszubringen.
Damals hatte ich genau dasselbe Gefühl wie jetzt, bevor ich zu schreiben beginne. Eine Art Melancholie oder Wehmut. Damals wusste ich noch nicht, was es bedeutet. Heute weiß ich, dass es die Vorbereitungszeit für meine Schreibanfänge mit 15 war. Es war eben dieses Gefühl: Ich bin auf einer Leidensspur. Und das hat sich fortgesetzt.
So wie Mayröckers Texte, die wie Flächen ins Unendliche zu reichen scheinen.
Christine Dobretsberger, Wiener Zeitung, 17.12.2004
Mayröcker, Friederike: Gesammelte Gedichte 1939–2003
Im Frühjahr 2005 erfreute der Buchhandel die Gemeinde der Lyrikfreunde gleich mit mehreren Werksausgaben namhafter Lyriker und Lyrikerinnen von Nicolas Born bis Sarah Kirsch. Hier präsentiert nun der Suhrkamp Verlag sein Geburtstagsgeschenk an Friederike Mayröcker zu ihrem 80. Geburtstag.
Der Band Gesammelte Gedichte enthält alle Gedichte aus 65 Jahren, egal ob sie gesammelt in Büchern oder verstreut in Zeitschriften erschienen sind. Das früheste Gedicht stammt aus dem Jahr 1939, das jüngste wurde erst vor knapp zwei Jahren veröffentlicht.
Die österreichische Dichterin, am 20. Dezember 1924 in Wien geboren, hat von jeher in ihrer Poesie auf die Zusammenhänge von Zeit, Ort und Kausalität verzichtet. Ihre Gedichte sind virtuose Montagen von Dialogen, Assoziationen, Reflexionen, Erinnerungsfragmenten, Zitaten und Wortneuschöpfungen, womit immer wieder neue Bezüge hergestellt werden. Hauptthemen sind die Magie der Sprache und die Bildende Kunst. Friederike Mayröcker war 46 Jahre lang die Lebensgefährtin von Ernst Jandl.
Sie waren „das Paar“ der dichterischen Avantgarde, beide auf unverwechselbare Weise genial. Sie beeinflussten einander und gingen trotzdem jeder seinen eigenen Weg. 46 Jahre lang. Obwohl Mayröcker sehr zurückgezogen lebte, hat sie das Draußen stets in ihre Gedichte aufgenommen, besonders die letzten Verse sind sehr welthaltig.
„Man weiß nicht, wohin man kommt – man lässt sich tagtäglich neu überraschen“, hat Friederike Mayröcker ihr dichterisches Credo einmal beschrieben. Es ist die immer erneute Suche nach einer Zeile, die sie vorantreibt. „Wenn ich ein, zwei Tage nicht schreiben kann, bin ich verzweifelt.“ Eines der Wunder von Mayröckers Poesie liegt in der Kunst, der Sprache Verblüffendes zu entlocken, was beim Leser immer wieder Erstaunen hervorruft. Bei allem, was Friederike Mayröcker schrieb, war sie stets eine Grenzgängerin zwischen den literarischen Genres, vom Surrealismus über die experimentelle Poesie bis zur typischen Mayröcker-Textmontage. Im Laufe der Schaffensperioden haben sich so unterschiedliche Ausdrucksformen entwickelt.
Friederike Mayröcker ist eine der bedeutendsten modernen Poetinnen. Stets hat sie nach neuen Wegen gesucht, um eine neue Kunst zu versuchen. Ihre Gedichte sind häufig ein innerer Monolog, ja mühevolle und schmerzhafte Selbsterforschung, in der Eindrücke, Gedanken und Erinnerungen aufeinanderstoßen. Dabei hat Mayröcker in mehreren Interviews Biographielosigkeit als Lebenshaltung für sich reklamiert, um ihr literarisches Werk für sich selbst sprechen zu lassen. In der vorliegenden voluminösen Ausgabe sind die rund 1.000 Gedichte (darunter 100 bislang unpublizierte) in der Chronologie des Entstehens angeordnet. Ein Register im Anhang ermöglicht aber die Einordnung in ihren ursprünglichen Publikationszusammenhang. Ein editorisches Nachwort des Herausgebers und Dichterkollegen Marcel Beyer rundet den wirklich gelungenen Sammelband ab.
Manfred Orlick, buchinformationen.de
Aus Splittern eine Welt
− Rund 1.000 Gedichte in einem Buch: That’s a lot! Ein freudiger Ausruf, denn die Büchner-Preisträgerin Friederike Mayröcker wird bald 80. Grund genug für den Suhrkamp-Verlag, die klug edierte Werkausgabe durch den Band Gesammelte Gedichte zu ergänzen. −
Gleich vorweg: Wer keine Zeit hat, sollte besser die Finger von der Lyrik Friederike Mayröckers lassen. Mal eben in der Hoffnung reinzuschnuppern, sich gierig den Duft einer wohlriechenden, für den eiligen Konsumenten parfümierten Literatur in die Nase saugen zu können, führt zur Resignation oder vielmehr noch zu der niederschmetternden Erkenntnis, dass man diesen Arbeiten so gar nicht gewachsen ist, dass sie für den schnellen Blick zu spröde und resistent sind und damit keine präzise und angemessene Erkenntnisgrundlage bieten.
Prinzip der „Zersplitterung“
Das liegt vor allem am Prinzip der „Zersplitterung“, mit dem Friederike Mayröcker alles, was ihr die Sinne oder der Verstand an konkreten und abstrakten Materialien zugänglich macht, in der Isoliertheit der Wahrnehmung oder des Gedankens belässt, quasi atomisiert in den Vers zu den anderen Bruchstücken bettet und so schließlich dem Leser die reizvolle, ergiebige und doch auch anstrengende Arbeit überträgt, sich aus diesen Splittern eine eigene Wirklichkeit zu bauen. Warum auch nicht? Ist unser Blick auf die Welt nicht vor allem durch Vereinzelung, durch Zusammenhanglosigkeit, durch fehlende Kohärenz geprägt? Ist nicht jede Geschichte bereits fragwürdig, weil hier literarisch zusammenwächst, was im wirklichen Leben vielleicht gar nicht zusammengehört?
Vergangenes im Zitat
Mit den Splittern verbinden sich auch die Zitate, die in den Arbeiten verwendet werden und die häufig, aber nicht immer, durch Anführungszeichen oder andere Drucktypen kenntlich gemacht sind. Auch sie wirken wie hineingepuzzelt in den Text und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, da sie so offensichtlich den Akt des Sichaneignens von fremden Sprachpartikeln anzeigen. Wer spricht da gerade? So könnte man fragen, und doch ist klar, dass die Sprache des lyrischen Ichs sich aus den verschiedensten Stimmen zusammensetzt, die sich gleichzeitig abstoßen und anziehen und die in den unterschiedlichsten Momenten geäußert wurden. So schimmert in diesen Sprechweisen so etwas wie Geschichte, oder vorsichtiger ausgedrückt, gelebtes Leben durch – doch nur bruchstückhaft als ein Teil einer Wirklichkeit, die es zu entwerfen gilt.
Avanciert und frei
Jedes einzelne Gedicht appelliert unaufdringlich an die Phantasie des Lesers, die in den Texten wohnende innere Gravitation wirken zu lassen und die Bezugsfelder zu entdecken, um die sich die verschiedenen Materialien gruppieren. Das Gedicht „Aus der Tiefe“ lautet so:
Mit dieser Überbürde süsz und herz-zäh wie Blumen
(ein einsamer Wassertropfen im schwarzen Ziehbrunnen schwebender Wolken
eine seidene Monsterprozession schnurgerader sonniger Ameisen
eine endlose Strasze bei Nacht
eine fremde Begrüszung über bernstein-fragenden Tieraugen
Gewaltsames leiden die verkerbten Steine von Stonehenge
ein grausiges knarrendes Feld unbändiger Steinheere
horizontal-massige Gehege
harte Gevierte aus Luft
Versunken wie Wasser blaszblau ein geahntes gepfähltes Paradies
ein schwimmendes graues Paradies von Wolken gestützt
preisgegeben dennoch : der heimsenden Tiefe
den fischblauen Kanälen den verwirrenden Stegen und Katzen-Brücken
den Morgendämmerungen) beweint bekränzt..
Eine große gedankliche Freiheit wird dem Lesenden hier zugetraut, die noch durch die Tatsache gestützt ist, dass Friederike Mayröcker in vielen Gedichten auf durchgängige Vorschriften bezüglich der Verslänge, der Rhythmisierung oder der Strophenform verzichtet. Mitte der sechziger Jahre sind Arbeiten entstanden, die sich so unbekümmert und lustvoll über die tradierten lyrischen Mittel hinwegsetzen, dass man die Glaubwürdigkeit immer noch spüren kann, mit der sie ihr Konzept einer avancierten, sich immer wieder selbst auf den Prüfstand stellenden Literatur vertreten hat. Der von Marcel Beyer herausgegebene Band versammelt Gedichte aus den Jahren 1939–2003. An den späten Arbeiten wird ersichtlich, dass die Dichterin in der letzten Zeit – wenn man so will – geschlossener und zugänglicher schreibt. Erkennbar auch der starke Einfluss von autobiographischen Eindrücken, der vermutlich nicht zuletzt durch den Tod ihres Lebensgefährten Ernst Jandl noch forciert wurde.
Ein monumentales Unterfangen
Gesammelte Gedichte wirkt durch den Umfang von gut 850 Seiten bereits monumental; verstärkt wird dies nur noch durch die Entscheidung, die Arbeiten von ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Sammlungen zu lösen. Allein das Alter eines jeden Gedichtes entscheidet also über den Platz in diesem Teil der Werkausgabe. Wuchtig wirkt dieses Unterfangen, und schnell wird deutlich, dass eine chronologische Lektüre nicht unmöglich, wohl aber kräftezehrend ist. Im Übrigen macht der Titel ja schon deutlich, dass man mit diesem Buch etwas nahezu Definitives erwirbt, auf das man zurückgreifen kann in der lyrischen Not, in schlimmen Zeiten also, in denen diese lyrischen Besonderheiten vielleicht einmal fehlen werden.
Thomas Combrink, titelmagazin.com, 6.12.2004
Eichkatze auf Postkasten
FRIEDERIKE MAYRÖCKER Am 20. Dezember feiert die Grande Dame der österreichischen Literatur ihren achtzigsten Geburtstag. Eine neue Ausgabe ihrer Gedichte zeigt ihre verblüffende Vielfalt zwischen Surrealismus, Sprachexperiment und Klassizität.
Es wäre ein Leichtes, sich über die aus dem August 1939 stammenden Jugendgedichte von Friederike Mayröcker lustig zu machen:
metallisch klingt der Morgen auf
ein Sehnen faszt die Welt
da stürzen Lüfte sich zuhauf
von Silberseen umwellt.
Was die 15-jährige Wienerin am Vorabend des Zweiten Weltkrieges in Eichendorff’scher Manier dichtet, ist – abgesehen vom romantisch verpackten Bezug auf die heraufziehenden Stahlgewitter – retrospektiv gesehen der erste und zugleich höchst selbstbewusste Schritt zu einer nachhaltigen Einübung ins Unvermeidbare: das Gedicht.
Die Biografie kurz gefasst: 1924 geboren, ab 1946 im Schuldienst, 1969 davon beurlaubt, seitdem freie Schriftstellerin. Für ihre Gedichte, Prosa, Bühnentexte, Hörspiele und Kinderbücher erhielt Friederike Mayröcker zahlreiche nationale wie internationale Literaturpreise, darunter den Georg-Büchner-Preis. Das in sechs Jahrzehnten entstandene, rund tausend Gedichte umfassende Œuvre der Friederike Mayröcker wurde jetzt anlässlich ihres achtzigsten Geburtstages von Marcel Beyer neu herausgegeben.
Auch wenn sich auf den 850 Seiten Zeilen wie folgende finden: „Hölzern wirkt der Astronaut / wenn er aus dem Walde schaut“ oder „winzig war das Pantheon / winzig war die Butter / aber meine Tante – ooohn! / frasz nur Vogelfutter“ – typisch für Mayröcker sind dergleichen Scherzgedichte und Kalauer nicht. Im Gegenteil, sie gilt als schwierig, hermetisch, dunkel, und es sind auch ihre vorgeblich düsteren Texte, die sie zu einem beliebten Objekt obskurer germanistischer Begierden werden ließen: als Beweismittel für avancierte Poetik und die Tragfähigkeit diverser Theoriengebilde sowie deren dichterische Überwindung. Lesen kann man die Mayröcker trotzdem: als eine Bewegung von traditoneller Natur- und Liebeslyrik über Surrealismus und experimentelle Dichtung hin zu einem hohen, fast klassisch anmutenden modernen Gedicht in jüngster Zeit.
Epigonal war Friederike Mayröcker bei all dem nie, auch wenn ihr Dichten in den Fünfzigern mit vielen Erleuchtungen, Engeln und zyklamfarbenen Blicken raunend beginnt:
siehst du den Abendstern? ich sehe
hörst du den Wind? ich höre
fühlst du die ewigkeit? ich fühle…
Auch wachsen viele Hortensien und Rosen durch das Gedicht; das rasche Andocken an den Surrealismus aber, die mächtigste internationale künstlerische Strömung jener Zeit, sowie das Umfeld der Wiener Gruppe ersparen Autorin wie Leser jenen Kitsch, den zur selben Zeit ein Paul Celan oder eine Ingeborg Bachmann produzieren.
Wenn die Hauptschullehrerin Mayröcker von Medea spricht, wirkt das nicht symbolistisch; werden Claude Debussy oder Aaron Copland genannt, wirkt das nicht betulich. Schwarzer Humor, mit dem am Ende der Nachkriegszeit und der beginnenden Frauenemanzipation der „Tod durch Musen“ beschworen wird, ist früh von Belang. In „The last Round-up oder Kitti-Kitt“ heißt es:
fangen wir von neuem an
Luftballon im Totenzimmer
ach die toten Frauenzimmer
nymphoman nymphoman
fangen wir von neuem an.
Das „ich liebe dich“ wird als „Gebetsmühle für den Tag unserer gemeinsamen Aktion“ tituliert.
Die anfänglich schrittweise, bald in rasantem Tempo sich fragmentierende poetische Rede der Mayröcker, die eigentlich immer ein dichterischer Liebesdiskurs ist, klingt in den Sechzigerjahren so:
Komm ich führe dich ich geleite dich ich nehme dich mit
in den Lerchenschlag in das beschattet Auge von Siena
in den gemähten Tulpenwald in die sinkenden Katakomben
Das Liebeslied, das zugleich immer ein Todeslied ist, endet mit:
ich nehm dich mit
mit dir überall hin
ich fürchte mich nicht
mit dir überall hin überall hin
Zwar treiben in den Textmäandern auch zahlreiche zähflüssige Symbole wie die „trauerreiche Muschel“ oder eine „Hiobs-Palme aus Händen“; mitunter reimt sich auch ziemlich kühn Eichkatze auf Postkasten; vor allem aber hebt jene verrückte und verzückte Rede an, die bis heute nicht mehr verklungen ist:
du Schneefeld!
Laubgeraschel!
Turmvogel!
Brunnenwinde!
Schnee-Beil!
vergrabenes Glück!
Auf das Glück wird so lange eingeredet, bis es sich ausgräbt und blüht.
lasz dich beschlafen mein Wild mein Reh lasz dich beschlafen mein Liebster
Kehrseite und Sackgasse dieses überquellenden Sprechens à la Diotima sind Texte, die auf zehn, 15 Seiten Länge die ohnedies längst hinfällige, traditionelle Unterscheidung von Lyrik und Prosa hinter sich lassen und als polyphones sowie polyglottes Stimmengewirr den Leser gehörig ins Freie setzen:
ibisse-feuerlook-frisée
in könik-lichter erwartung
(punkt null)
das donauknie
der rathausmann
à la jolie madame
(ahnung davon!)
tonheizers rosenmund: ,la plus belle chose du monde et le secret doux–‘−
,avec ton amour tu me fais heureux tourjours.‘.
Auch wenn hier etwas wie Liebe und Exil beschworen werden, der Leser wird zum „Ostereiersuchen nach dem Sinn“ (Oswald Wiener über Arno Schmidt) vergattert. Umso überraschender ist es dann, dass sich Friederike Mayröcker nicht nur an sehr einfachen konkretistischen Bildtexten versuchte, sondern im Mai ’68 mit „Liebesgrüsze Linz“ auch augenzwinkernd politisch engagierte:
Als die Lokomotive Junge kriegte
sagte sie zum Linzer Singverein
schnallt euch eine enjambierte
Taube um die Wiese
laszt uns bis in unsre Garnituren fröhlich sein.
In den Siebzigerjahren wird die therapeutische Sprachverwirrung auf die Spitze getrieben. Die Buchstaben verlieren ihre Festigkeit, der inflationäre Gebrauch von Klammern, Strichpunkten und Gedankenstrichen ist mitunter nichts als mühselig-manierierte Begleitmusik, das völlig zersplitterte lyrische Ich zerrinnt wie der Leichnam der dahingeschiedenen experimentellen Dichtung.
In den Achtzigerjahren, zu einer Zeit, da Gedichte endgültig als verbrauchte Spezies von Literatur angesehen wurden, erfolgt eine Rückkehr zu einfacheren Formen. Titel wie „vom Tode“ oder „Meeres Welt“ haben Hölderlin’sche Dimensionen und den entsprechenden Klang; neben depressiven Idyllen und zahlreichen Betrachtungen zum eigenen Altern – Seele und Leib sind „2 feuchte Lappen“ – stehen Erinnerungen an die eigene Kindheit und an die Eltern. Über die Mutter heißt es da:
wie alt bin ich denn jetzt?
es fiel ihr nicht ein, erzählt sie, aber
anstelle des Alters die Uhrzeit, halb-
sieben, statt fünfundsiebzig
und vergisz bitte nicht auf die
Fliegerschokolade ruft sie,
wenn du mich wieder besuchst
Vor allem entstehen jetzt subtile Stillleben und Naturbetrachtungen, Friederike Mayröcker scheut sich auch nicht – dichterisch unzeitgemäß – den „Bruder Amsel“ direkt anzusprechen, der an „mildem Frühlingsabend blaszviolett“ vom kommenden neuen Leben kündet. Neben der Bildhauerei ihrer großen Prosa (wie sie diese selbst charakterisiert) aquarelliert sie unzählige, explizit bukolische Reise-Bilder:
von Blumenfeldern umfächelt die Stirn im westlichen Windhauch
ein weiszes Schiff einen Augenblick lang steht steht still auf der Anhöhe
Wie souverän Friederike Mayröcker in ihrem achten Lebensjahrzehnt dichtet, zeigen die fast konventionell anmutenden Gedichte aus der jüngsten Zeit. In „Lebenslauf“ entwirft sie ein Selbstporträt der Dichterin als alte, kinderlose Frau, sie greift das traditionelle Vanitasmotiv des Spiegels auf und schreibt es bis zu ihrem eigenen Verschwinden zu Ende:
während ich meine
mich demütigende Häszlichkeit in einem Spiegel.
Das abschließende „sehe“ fehlt, Original und Abbild sind verschwunden, was bleibt, ist die klagende Stimme in die Leere.
Das ist mehr als „ut pictura poesis“, die Lösung der Bildhaftigkeit in der Literatur. Und von unüberbietbarer Meisterschaft ist das letzte Gedicht des Bandes „unter Bäumen Tränenmorgen“, eines der zahlreichen Requien für Mayröckers Lebensmenschen Ernst Jandl: Der größte denkbare Ausgriff der Dichterin über den eigenen Tod hinaus, der Versuch, sich die Welt ohne sich selbst vorzustellen, wird mit der Erinnerung an den Geliebten zu einem Bild von geradezu elysischer Selbstgenügsamkeit verknüpft.
Wo auch immer so gesprochen werden mag, Friederike Mayröckers Gedicht verfügt hier über lazarenische Macht. Wendelin Schmidt-Dengler bezeichnete das Duo Mayröcker/Jandl (mit dessen Namen die Gesammelten Gedichte auch enden) einmal als eine der größten Liebesgeschichten der Weltliteratur – in diesem Gedicht ist der Tote auferstanden. Um seinetwillen wurde die Litanei des „ich liebe dich“ angestimmt; ob die Auferstehung tatsächlich erfolgt, ist in Anbetracht dieses Textes fast gegenstandslos. Gegenstandslos, das heißt jenseits der Gegenstände, Klang nur noch und Fülle, voll wie das Glück – zugleich die absolute Definition des Gedichts.
Erich Klein, Falter, 15.12.2004
Eine Frau! Eine Österreicherin! Eine Weltliteratin!
Hier gibt es, pünktlich zum 80. Geburtstag am 20. Dezember, sämtliche bisher verstreut publizierte sowie über hundert noch unpublizierte Gedichte einer der großartigsten lebenden Poetinnen. Hinter dem zugeknöpften Titel verbergen sich unter anderem ein Lebensbuch, ein Tagebuch, ein Traumbuch, ein Erinnerungsbuch, ein Mitternachtsbuch, ein Herbstbuch, ein Totenbuch, ein Liebesbuch, ein Wolkenbuch, ein Schmerzensbuch, ein Vergeblichkeitsbuch, ein Kinderbuch, ein Tierbuch, ein Abschiedsbuch, ein Philosophenbuch, ein Ernst-Jandl-Gedächtnisbuch, ein Reisebuch, ein Regenbuch, ein Mutterbuch, ein Sterbebuch, ein Nachtigallenbuch, ein Zauberbuch, ein Wortmag iebuch – wir sagten ja schon: Weltliteratur.
Iris Radisch, Die Zeit, 14.10.2004
Plankton des Auges
− Wacholderherz: Die Gedichte von Friederike Mayröcker. −
„So wird Ekstase zur Disziplin.“ Genauer und knapper als mit ihren eigenen Worten läßt sich der ungeheure, über fünfzig Jahre währende Vorgang nicht beschreiben oder gar erklären, der in Friederike Mayröckers Gesammelten Gedichten Gestalt angenommen hat.
Friederike Mayröcker wurde 1924 in Wien geboren, verbrachte eine stille Kindheit mit großelterlichem Paradiesgarten in Deinzendorf, der 1934 verlorenging. Die Bindung an die Eltern war und blieb stark – und plötzlich waren Wunsch und Fähigkeit, Gedichte zu schreiben, einfach da. „Ich notierte auf einem grünseidenen Kanapee / mein erstes Gedicht.“ Das ist noch sehr preziös gesagt, wie auch die Trochäen „Durch die Gitter meines Herzens / scheint die Welt mir seltsam fremd“ bloß nach kopiertem Rilke klängen, folgte da nicht der Schluß:
manchmal wirfst du eine Rose
wie ein Stückchen rohes Fleisch
im Vorübergehn herein
Die Lässigkeit des Vergleichs wischt das Epigonale blitzschnell beiseite und läßt an eine Großkatze denken, die eine einzelne Kralle ausprobiert. Es folgen kleine Gedichte mit der paradoxen Stringenz eines Bildgedankens von Magritte:
die Eisenbahnen
mit ihren gewissenhaften Rädern,
emsig nähen sie die grüne
(oder graue oder weisze)
Landschaft zusammen
wie eine Nähmaschine
das Tuch.
Aber was an poetischer Kraft in Friederike Mayröcker allmählich zusammenschoß, wurde erst 1966 in der großen Gedichtsammlung Tod durch Musen kenntlich, die Gedichte ganz unterschiedlicher Bauformen enthält. Durch Affirmation und Negation polar zusammengespannte Strophenpaare stehen neben zwei Oden, schwingende Langgedichte und Textmontagen bilden indes den Hauptteil des Bandes, der die errungene Höhe zu Mitte der sechziger Jahre zeigt: vielstimmige Konstruktionen, die die „Stereotypie Europas“ durch Collagen aus Gesehenem und Aufgelesenem durchbrechen.
Tod durch Musen versammelt Gedichte aus zwei Jahrzehnten und verdeckt so die lange Latenzzeit, aber auch die intensive Arbeit, die Friederike Mayröckers Kunst durchlaufen mußte. Zwar hatte sie im konservativen Nachkriegswien früh in Zeitschriften publizieren können und Kontakt zur Wiener Gruppe, zu Andreas Okopenko und zum Literaturbetrieb gefunden, zwar trat 1954 Ernst Jandl, der „Herz- und Handgefährte“, ins Leben von Friederike Mayröcker, aber der Brotberuf des Englischunterrichts behinderte Werk und Leben bis 1969: „meine frischesten Jahre gingen darauf“ heißt es noch 1984. Erst als sie sich vom Schuldienst befreien kann, setzt eine stete Produktion ein, der vier Fünftel der fünfbändigen Prosaausgabe von 2001 zu verdanken sind, und auch mehr als zwei Drittel der Gedichte sind erst seit den frühen siebziger Jahren entstanden.
Woraus nun speist sich dieser Sprachstrom, der auf den ersten Blick wie mäandrierende Berichte aus einer Schreibwerkstatt und wie „huschende“ Assoziationen aussieht? Aus unbegrenzter Aufmerksamkeit. „Es ist ein unausgesetztes Rezipieren, ein unausgesetztes Registrieren der schaubaren, hörbaren Welt“: Friederike Mayröckers Kunst gleicht einem Meßgerät für kosmische Strahlung, das aber im Unterschied zu allen technischen Apparaturen den wahrnehmenden Menschen, die Sprache und das „Lunatische neben der Präzision“ voraussetzt. Allein die „im Kosmos der Sprache wildernde Muse“ vermag den eigenen Blick, Geist, Sprachtrieb als Medium darzustellen, in den etwas einbricht, in dem etwas geschieht, das wir durch unsere benutzte Alltagssprache weder wahrnehmen noch aussprechen könnten.
Wörter, Dinge, Gedanken, Bilder, Zitate, Farben und Gerüche verfangen sich in einem hochsensiblen Kollektor, um zunächst auf Zetteln fixiert zu werden. Reflexhaft bilden sich spontane Junkturen wie „jauchzende Vergeblichkeit“ und Wort-Komposita. „Bergtröster, Gefühlsschäbigkeit, Wacholderherz, Lichtverschmutzung, Schwalbenschuhe, Lebensfehler. Hirnschaber, Komponierseide…“ – die Liste meteoritenhafter Einwortgedichte ließe sich endlos fortsetzen. Eines der schönsten ist „Selbstverschwendung“, da es gleichsam den Extrakt aus drei programmatischen Versen bietet:
zerstreute Gelassenheit –
rabiate Performance: ich bin
mein eigener Minderbruder
Diese Ethik weist den Einwand subjektiver Beliebigkeit zurecht, den man solchem Agglomerieren von „Plankton des Augs“ machen könnte. Auf den Akt spontaner Sammlung folgt radikale Arbeit, die die Preisgabe des eigenen Lebens fordert:
Literatur der Zersplitterung (als Medium des Mitleids).
Der Verzicht auf ein starkes Subjekt ist nicht Ergebnis der – offensichtlichen – Einflüsse der Dadaisten, des Surrealismus, Gertrude Steins, Roland Barthes’ oder Jacques Derridas, sondern entspringt dem Wunsch, ganz bei den Dingen und Menschen zu sein. Diese Rückhaltlosigkeit, „daß das Spontane nie dem Maßvollen untergeordnet werden dürfe“, wird nur durch den immensen Kunstwillen verwirklicht, „daß… die Kontrolle über das Schweifende (also die eigentliche poetische Substanz) nie erlahmen dürfe“.
Friederike Mayröcker hat diese Prozeßhaftigkeit vor allem in den großen Prosabüchern einsehbar gemacht, deren Komposition die einzelnen Motive aus den Momenten ihrer Genese löst. Für die Lyrik muß dies der Leser selbst leisten. Viele Gedichte scheinen unmittelbar zugänglich, wollen aber wirklich genau gelesen werden, etwa das „für Ernst Jandl“ geschriebene Liebesgedicht „der Garten, funkelnd wie seine Gewässer“. Hinter dieser Paradiesverheißung tut sich äußerst Prosaisches auf:
mit zwei leeren Plastiksäcken über
den Hof, mir entgegen, mit zwei leeren windgeblähten
Plastiksäcken mir entgegen, über den Hof,
Abendessen zu holen für uns…
Zwei Anläufe mit minutiös variierter Interpunktion und tastender Rhythmik sind nötig, um aus zwei Facetten eine Wahrnehmung zusammenzusetzen, die aber immer noch nicht genau genug gelingen will, die noch durch eine „Zerreißprobe“ hindurch und ein weiteres Mal wiederholt werden muß, ehe es zu einem Kuß kommt, „und / da ist wieder einer jener seltenen / Wahrheitsmomente, für die es sich lohnt weiter / zu leben“. Das Gedicht endet aber nicht mit dieser Sentenz, sondern fährt nüchtern fort:
um derethalben
ich dich zu lieben glaube, zum Beispiel
Tremolo so verflochten, während ich,
Irrwisch, die Augen beschattend, dasz
schwimmenden Spiegels Spur
darin
du nicht sehen sollst.
Erst jetzt zeigt dieser Text Wirkliches. Was als Versuch objektiver Beschreibung einsetzte, um in einem Kuß zu kulminieren, wird reflexiv zerlegt („zu lieben glaube, zum Beispiel“), spöttisch zersungen („Tremolo“) und mündet in Tränen der Rührung, die dem anderen verborgen bleiben sollen. Die „Gewässer“ verschließen die eigenen Augen zu einem Spiegel. Nur solch wahrhaftiger Kunst vermag auch das irdische Scheitern zu glücken.
Die jetzt, kurz vor dem achtzigsten Geburtstag Friederike Mayröckers erschienene Ausgabe der Gesammelten Gedichte ist eine Pracht, enthält sie doch neben den in Büchern enthaltenen auch verstreute und mehr als hundert unpublizierte Gedichte aus früher und jüngster Zeit. Die Anordnung folgt, soweit sich diese rekonstruieren ließ, der Chronologie des Entstehens. Die Daten sind im Inhaltsverzeichnis nachgewiesen, ein Register und die im Anhang aufgeschlüsselte Anordnung der Gedichte in den ursprünglichen Bänden ermöglichen die Zuordnung von Entstehung und Publikationskontext. Das Verfahren ist nicht unproblematisch, da die Chronologie zu einer biographischen Lesart verführt; Marcel Beyer begründet das Vorgehen im Anhang jedoch ebenso umsichtig, wie er die Edition insgesamt gestaltet hat. Trotzdem muß man viel blättern, um ein klares Bild zu gewinnen, um zu ordnen und um die Ordnung lesend wieder aufzulösen.
Zu entdecken ist dabei die Tatsache, daß der Tod Ernst Jandls im Juni 2000 auf Seite 693 versteckt ist. Nach drei Monaten des Verstummens beginnen erneut Gedichte zu entstehen, insgesamt achtzig Seiten tiefster Trauer, erinnerter Lebenslust („ratterten die Wiese hinab usw.“), Briefgedichte an Freunde, Meditationen über Kunstwerke („Morandi“) und physischen Verfall, Poetik („ich arrangiere ein Gedicht“) und Momente der Klarheit: „ich denke Sprache“. Man muß diesen Satz mehrmals lesen, um zu spüren, wie fremd die Sprache geworden sein muß, um sie denken zu können – und wie lebendig Friederike Mayröcker am nächsten Morgen (11./12. Februar 2003) neu beginnt: „habe gerade die Sprache erfunden rasende Sprache“.
Die Dichterin, deren Ich von sich sagt, „mit verkohlten Augen“ zu leben, schreibt weiter am „Lebendgedicht“. Liest man dieses rückwärts und sucht erneut nach seinem ersten Keim, so findet man auf Seite 8 den Ausruf „O Knospe“, der vom 8. Juli 1946 datiert:
In ihr ist alles schon
da: jedes lockere
Lächeln und der bereite
Sturz in den schimmernden
Nacken und jener
Aufschwung im Aug
der entzückt.
Beglückend, hinreißend, zum Niederknien (wie der Wiener sagen würde).
Thomas Poiss, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.11.2004
„Ich denke in langsamen Blitzen“
− Wie bei der Nicht-Erzählerin, Wort-Dompteuse und Skriptomanin Friederike Mayröcker der platonische Coitus zum Dauerzustand wird. −
Jeder kennt Friederike Mayröcker, doch wer kennt ihre Bücher? Die Mayröcker wurde (außer vom in die Jahre gekommenen Thomas Bernhard) die längste Zeit geliebt und gelobt, doch wenig gelesen, ihre Werke hat man gepriesen und bepreist, doch kaum ausprobiert. Vielleicht ändert sich das nun, da ihre Gedichte aus 64 Jahren gesammelt vorliegen.
Als sie 2001 den Büchner-Preis bekam, wurden im deutschen Feuilleton Stimmen laut, die Unverständnis kundtaten: Diese Textwucherungen, Zitate, Widmungen, diese Privatsprache – wohin sollte das führen? Die unentwegte Wegbereiterin der wirklich modernen Literatur in Österreich und anderswo hat tatsächlich kühne Pfade beschritten. Aber der Leser, der ihr in schwindelnde Höhen folgt, wird für seinen Schweiß belohnt – solange er nicht versucht, die „Geschichte“ zu fixieren.
Es gibt nämlich keine. Friederike Mayröcker verweigert sich früh der Story und schreibt an ihrer Statt Larifari. Ein konfuses Buch (1956). Aber Vorsicht:
Was ich auch immer sage, es ist nicht endgültig gesagt, und ihr sollt deshalb auch nicht vorwurfsvoll feststellen: hier und dort hast du dich über dieselbe Sache anders ausgesprochen.
Wirklich konfus wird es erst zehn Jahre später, als Mayröcker in den Sog der Wiener Gruppe gerät und so richtig zu experimentieren beginnt, was zweifellos zu lustigen Ergebnissen und zu einer Hochkonjunktur des „&“ führt. Dass dies der Dichterin, wie sie in einem Interview sagte, „einfach keinen Spaß mehr gemacht“ hat, kann man ihr freilich nachfühlen. Die völlig enthemmte Sprachmaschinerie läuft sich irgendwann tot.
Mayröcker versucht nun doch das Erzählen – „eine pose nämlich des erzählens nicht wirklich erzählen“. Diese Technik der ständig sich selbst sabotierenden Erzählung perfektioniert sie spätestens in „mein Herz mein Zimmer mein Name“, einem punktlosen Rede- und Gedankenfluss, in dem die Ich-Erzählerin sich immer wieder selbst ins Wort fällt, „das blanke das nackte das krude erzählen“ abfängt, abwendet, ein Schritt vor, zwei zurück, und doch viel verrät, „warum auch nicht narrativ“ – der Text kommentiert den Text und nimmt dem Kommentator die Arbeit ab. Der Leser jedenfalls „soll sich endlich einmal ergehen können in diesem Buch“, sich ergehen, aber eben nicht schnurstracks losmarschieren, gelegentlich verwirrt ihn eine Lichtung, „Mehrfachbelichtung“ – „und ich denke in langsamen Blitzen“, heißt es in einem Gedicht.
Einsatz des „Ohrenbeichtvaters“
Alle Gedichte – es sind rund tausend – liegen nun in einem Kompendium vor. Hier kann man, etwa in den Versen des Bandes Winterglück, kleinweise besonders schön verfolgen, was Friederike Mayröcker mit der Sprache macht. Sie lässt sie in sich selbst zu Wort kommen, die Worte, nein, die Wörter schlagen aneinander, bringen einander zum Klingen, befriedigen sich selbst, befruchten einander und gebären neue – dahinter steckt nichts, alles darin:
wie Orchideen (Iden/Ideen) um meine Ohren
wachsen wehen, züngelnd
in Parma, unter perlmuttfarbener
Pergola deines Lids, Licht-
einfall, Binario, Atem doppel-
zügig verwirrt Kopfregen blendend mein
Balsambaum.
Gut: zwei Menschen, Züge und Atemzüge, es regnet, so viel ist klar; und eine prosaische Stimme, die wir Ernst Jandl zuschreiben möchten, mischt sich ein:
ACH, ruft mein Ohrenbeichtvater dazwischen, KÖNNTEST DU DIR DOCH DIESE DEINE VERFLUCHTEN ALLITERATIONEN VERKNEIFEN!
Selbstvergessenheit, Sich-Anheimgeben verheißen Mayröcker-Texte nicht. Man sollte sie sich, im vollen Wortsinn, zu Gemüte führen, auch kulinarisch: Sie zergehen förmlich auf der Zunge, „gebratenes Wort“, „Fleisch des Gedichts“, Kunst-Genuss eben. Die Bilder wollen bezwungen sein, die Wörter dressiert, die „nächtlichen Wortfunde“ archiviert – die Wort-Dompteuse schreibt um ihr Leben („überhandnehmender Text oder Tod“).
Entfesselte Asketin am Werk
Wer schreibt mehr? Jahr für Jahr erscheint nicht bloß ein neuer Titel, meist sind es zwei oder drei, einmal, 1989, waren es gar sieben. Und Mayröcker ist eine begnadete Titelfinderin: je ein umwölkter gipfel, Das Herzzerreißende der Dinge, brütt oder Die seufzenden Gärten, Notizen auf einem Kamel, Mein Arbeitstirol. Normal ist das nicht, dieser Eros des Schreibens, „Furor“, diese wahre Inbrunst, „das verzehrende Feuer“. Schreiben als Leben, als Rettung, als Lust. Eine „sprachliche Erektion“ jagt die andere, der „platonische Coitus“ wird zum Dauerzustand. Wo die Wörter kopulieren, nimmt sich die Dompteuse ganz zurück und liefert sich ihnen zugleich aus, übt eine „Askese der Maßlosigkeit“.
Tatsächlich ist das scheinbar Entfesselte ein Produkt strengster Selbstbeschränkung, genauester Feilarbeit. Mayröcker nähert sich der gültigen Form in mehreren Anläufen, bis aus der Masse der Notizen destilliert ist, was so und nicht anders zu sagen war. Die Arbeit an der Reinschrift überträgt sich, nach dem Bericht der Dichterin, auf die Körperhaltung, ganz Disziplin, ganz Konzentration, nichts Überflüssiges mehr, da sei sie „wie in einer Montur drinnen, wie in einem eisernen Helm“. Was an Rohstoffen der Existenz auf diese Weise verbucht, was in der Schrift verkörpert ist, darf vergessen werden: Literatur wird zur „Reinschrift des Lebens“, wie der Kritiker Klaus Kastberger anmerkt.
Die Spuren dieses Prozesses, Sammelgut und Wortabfall, wirken freilich ganz konkret zurück auf das Leben der Schreibenden, der die steigende Papier- und Bücherflut in ihrer Wohnung, mehrfach fotografisch dokumentiert, buchstäblich kaum noch Platz zum Sitzen, Essen und Schlafen einräumt. Nur schreibend lässt sich das Unbegrenzte realisieren. Da die „Lebens- und Schreibgelassenheit“ ohnehin unerreichbar scheint, ergibt sich die Asketin der Ausschweifung, der Abschweifung („ist Herbsteuphorie oder was“), sie versteht selber nicht „meines Lebens wildesten Wahnsinn“, nicht „diese entfesselten Hirnrezitative“, jedenfalls:
Entschlüge ich mich der Kunst ich müßte sterben.
Romantischer Rohstoff, raffiniert
Zu verstehen gibt es da nichts: Wer zweifelt daran, dass Friederike Mayröcker eine Zauberin ist? Ihre Zauberkunst besteht auch darin, dem Leser zu suggerieren, das Werk entziehe sich dem üblichen Instrumentarium der Textkritik, der Literaturwissenschaft (was nicht stimmt). Es entfalte seine sinnliche Wirkung jenseits aller hermeneutischen Anstrengung (was stimmt). Mayröckers Blick – „mächtige Lebens- und Weltüberschwenglichkeit“ – entzündet sich an den Dingen und entlockt ihnen Geistes-Blitze („Der Blitzandrang ist groß, die Blitzrichtung ungenau“).
Das bedeutet eine „ungeheure Beschleunigung der Zeit mitten in ihrem Stillstand“, also Zauberei. Denn:
die Hölle, das ist die Zeit.
So werden im Alterswerk („die Psyche wird in das Alter hineingerissen“), in der Selbstabrechnung und Lebensbeichte, der „Ohrenbeichtvater“, die „glückliche Dreierbeziehung“, die todkranke Mutter, der Brief-Freund und eben „mein Herz mein Zimmer mein Name“ in ein bewegtes poetisches Still-Leben verwandelt, in einen orientalischen Prosateppich, „perplex (verflochten, verworren)“, mit rhythmisch wiederkehrenden Mustern, „alles zigeunerhaft, dennoch zauberhaft abgezirkelt“, Literaturdschungel, Dschungelliteratur.
In der Tat wuchert und sprießt „die spannende Folter Natur“ immer üppiger in Mayröckers Büchern, eben weil wir jene, dank der „Narrwissenschaft“, schon „lieb- / verloren“ haben:
alles die kleinen
schönen unauffälligen Dinge, Tränen am Morgen, Lachen sogar
des Kopfes, der Handschlag, Balg eines
Vogels im Rinnsal, was habt ihr an-
getan diesem schönen Planeten, … was haben wir
getan dieser Welt, wie haben wir sie
in Stücke gerissen, grausam verwüstet, verhöhnt den ewigen
Dachsbau zerstört.
Vorzustellen hat man sich das in dem beinahe tonlosen Ton, in dem die Dichterin ihre Texte liest, sprödeste Intensität.
Animiert von Salvatore Dalí, Henri Rousseau und Frida Kahlo mutieren da Gärten in betörende naiv-surreale Urwald-Szenerien. Eine Magierin muss das Verzauberte indes auch zurückverwandeln, muss entzaubern und notfalls auch romantischen Rohstoff industriell raffinieren können:
Wälder bei Wien, wehende Wälder. Buchseiten im Wind, grosze hagere engbedruckte hohe Buchseiten, wehend im Wind, am Anfang war der Wald, deutsch Papier.
Endloses Requiem für Ernst Jandl
Auf dem Papier einen Menschen zum Leben zu erwecken – daran scheitert selbst die Magierin. Seit dem Tod ihres Gefährten Ernst Jandl im Jahr 2000, nach 46 Jahren des (räumlich getrennten) Beisammenseins, zeigt sich Mayröckers Schreiben zunehmend auf die Beschwörung des Abwesenden fixiert. „leise leise um ihn nicht zu wecken so ist meine Handschrift, hatte an seinem Grab das Gefühl ich müsse ihn ausgraben“. Das „Requiem für Ernst Jandl“ nimmt kein Ende.
Und die Überlebende, vom Freund zeit seines Lebens für das Schöne und das Unverständliche ihres Werkes bewundert wie kritisiert, nähert sich im unverstellten Schmerz Jandls Einfachheit. Ein erster Schritt drei Tage vor seinem Tod, in einer Paraphrase auf ein Gedicht von ihm:
in der Küche stehen wir beide
rühren in dem leeren Topf
schauen aus dem Fenster beide
haben 1 Gedicht im Kopf.
So wortkarg die Verschwenderische, so schlicht, das rührt und irritiert. Immer geht es bei Friederike Mayröcker um Universalien der Existenz, aber nicht immer so offenkundig:
WÜRDE ALLES TUN FÜR DICH WENN
du nur lebtest!
… Weinen
würden wir trotzdem oft, weil
der Abschied noch vor uns läge –.
Daniela Strigl, Literaturen, Januar/Februar 2005
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Fritz J. Raddatz: Über Sinnliches
Die Weltwoche, 6.1.2005
Frank Lingnau: Mayröcker + Jandl
Am Erker, Heft 49, 2005
Harald Hartung: Das Gedicht, die Daten und die Schöne Zunge
Merkur, Heft 6, 2005
Eine Gleichung von mathematischer Eleganz
– Friederike Mayröckers Werk hat seinen Blick auf die Welt und die Literatur verändert. Jetzt hat Marcel Beyer, der im November den Büchner-Preis erhält, die große Dichterin in ihrer Heimatstadt Wien besucht. Die österreichische Schrifstellerin spricht im Wiener Café Rüdigerhof mit Marcel Beyer über ihr Lebenswerk. –
Gleich nebenan, im Ecklokal der Hausnummer 14, hat vor wenigen Monaten die erste Hipster-Bar des Viertels aufgemacht. Über Wochen haben die Betreiber mit akribischer Wildheit Tapetenfetzchen auf den blanken Putz gekleistert, einen kunstvoll abgerissenen Zustand hergestellt, bis der Gastraum endlich so aussah, wie noch Ende der achtziger Jahre manche Behausung in den umliegenden Gassen ganz selbstverständlich ausgesehen hat.
Ich erinnere mich, wie mir damals immer ein wenig mulmig war, wenn ich auf dem Weg zu Friederike Mayröckers Wohnung die vier Stockwerke hinauf an einer stets offenstehenden Tür vorbei musste: In der fensterlosen Kammer dahinter sah man tagein, tagaus einen vor sich hin brütenden Mann im verschwitzten Unterhemd am Tisch sitzen. Huschte man als Schatten über sein Gesicht, konnte es passieren, dass der alte Katatoniker wie in Todesangst zu brüllen anfing, um sich imaginärer Eindringlinge zu erwehren.
Gegenüber ein Riesensupermarkt, der bis 1999 den abstrusen Namen „Pampam“ trug. Eine Quergasse weiter unten das Vereinslokal der Wiener Hells Angels. In meiner Erinnerung war die Gasse früher gesäumt von Altwarenhändlern, der Blick in die Souterrains fiel auf zusammengewürfeltes Mobiliar, Heftchenromanstapel, unbeholfene Landschaftsmalerei und Beethovenbüsten aus Gips, lauter Zeug, das es nicht in den Antiquitätenhandel geschafft hatte.
In diesem nicht besonders ansehnlichen Quartier im fünften Wiener Gemeindebezirk, in dieser Abgrundgegend also, weitgehend bevölkert von Unterschichts- und Randexistenzen, unter Menschen, von denen die wenigsten jemals ein Buch auch nur in der Hand gehalten haben dürften, lebt eine der größten Dichterinnen, die das zwanzigste Jahrhundert hervorgebracht hat, lebt Friederike Mayröcker seit ihrer Geburt am 20. Dezember 1924, vier Uhr nachmittags.
Vor sechzig Jahren, 1956, erschien ihr erstes Buch. Anfang der achtziger Jahre, als sie bereits ein Mammutwerk aus Gedichten und Prosa und Hörspielen im Rücken hatte, wurden ihre Bücher Reise durch die Nacht und Das Herzzerreißende der Dinge von Melancholie und Zerbrechlichkeit und Verzagen durchwirkt, als glaubte sie selbst, nun in die Phase des Alterswerks zu gleiten. Da war Friederike Mayröcker gerade sechzig Jahre alt. Auf die neunzig zugehend, entschied sie, es sei an der Zeit, eine Trilogie zu schreiben, die erste ihres Lebens, bestehend aus études, cahier und, in diesem Frühjahr 2016 erschienen, fleurs.
Es erübrigt sich fast anzumerken, dass sie seit vergangenem September wieder tief in der Arbeit an einem neuen Werk steckt. Leben = Schreiben: Mir fiele niemand ein, für den diese Gleichung so wenig antastbar, so produktiv, schlicht unumstößlich wahr wäre wie für Friederike Mayröcker. Eine Gleichung von mathematischer Eleganz.
Wir sitzen im Perchtenstüberl, am Zentaplatz, keine fünfzig Meter von Friederike Mayröckers Wohnhaus entfernt. Ein Mann kommt herein und grüßt fröhlich: „Guten Morgen!“ Der greise Betriebsschäferhund freut sich wie irre, er wedelt die halbe Kneipe um. Es ist zwanzig vor vier am Nachmittag. Hier trinken die Damen von schräg gegenüber ihren Kaffee, wenn im „Studio Relaxe“ Freierflaute herrscht.
„Die waren reich“, antwortet Friederike Mayröcker, ohne Raum für Zweifel zu lassen, als ich sie nach ihren Großeltern mütterlicherseits frage, die in der Parallelstraße zwei Delikatessengeschäfte besaßen, weit zurück, bis Mitte der dreißiger Jahre. „Und wir“, ergänzt sie ebenso deutlich, „waren bettelarm.“ Sehr jung und finanziell von der Familie abhängig waren Franz Xaver und Friederike Mayröcker senior, als ihre Tochter Friederike in der großen, großelterlichen Wohnung im ersten Stock der Wiedner Hauptstraße 90–92 zur Welt kam. 1927 ergab sich die Möglichkeit, einen eigenen Haushalt zu gründen, fast möchte man sagen: in Rufweite, gleich um die Ecke in der Anzengrubergasse 17. Was als Übergangswohnung gedacht war, wurde für die Eltern zum lebenslangen, beengten Provisorium – der Vater starb 1978, die Mutter 1994.
Läuft man die Anzengrubergasse hinunter in Richtung ihrer heutigen Wohnung, sind es wiederum nur zwei Minuten bis in die Nikolsdorfer Gasse 8, in der Friederike Mayröcker im September 1930 bei den Englischen Fräulein eingeschult wurde. Nach einer Hirnhautentzündung im ersten Lebensjahr wollten die Eltern das zarte Kind vor den Ansteckungsgefahren schützen, die sie in einer öffentlichen Schule befürchteten. Die Privatschule mit einer Klassenstärke von zwölf Kindern, ganz in der Nähe gelegen, kam ihnen gerade recht.
Ob zu Hause immer Hochdeutsch gesprochen wurde, frage ich, oder ob sie als Kind etwas vom wienerischen Gassendeutsch der Kinder auf der Straße aufgeschnappt habe. Nein, ihr Vater sei schließlich selbst Lehrer gewesen, auf ein gutes Hochdeutsch wurde großer Wert gelegt.
Außerdem: „Meine Eltern haben mich nicht auf die Gasse gelassen.“
„Wolltest du denn auf die Gasse?“
Wie aus der Pistole geschossen: „Nein.“
Mit dem Alter kommt das Langzeitgedächtnis, sagt man. Vielleicht aber verhält es sich auch anders, vielleicht steckt man in der Jugend schmerzhafte Erinnerungen einfach leichter weg, während mit den Jahren die Abwehrkräfte nachlassen und die Bilder einen überfallen, so vehement, dass man im Bruchteil einer Sekunde wieder dasteht wie am Tag der allerersten Erinnerung. Als ABC-Schütze. Als in die Welt geworfenes Bündel.
Ein behütetes Kind aus prekären Verhältnissen, hochsensibel, unter Kindern aus der gehobenen Wiener Gesellschaft. Eines Tages, als sie wieder einmal in einem nicht eben schmucken Mantel in der Schule erschien, rief eine Mitschülerin: „Schaut, die Fritzi sieht heute wieder so verpumpeidelt aus!“
Mir ist dieses Wort nicht geläufig, ich frage nach, es bedeutet soviel wie ,nachlässig, verpfuscht, verschlampt, heruntergekommen‘, und um mitschreiben zu können, lasse ich es mir von Friederike Mayröcker buchstabieren.
„V-E-R-P-U-M-P-E-I-D-E-L-T.“
Ob das ein geläufiger wienerdeutscher Ausdruck sei? Sie schüttelt den Kopf. Ob sie dieses Wort seitdem überhaupt jemals wieder gehört habe? „Nein.“
Eine frühe Erfahrung der mitunter fürchterlichen Macht der Sprache, unmittelbar körperlich, schockhaft, nach fünfundachtzig Jahren Buchstabe für Buchstabe präsent. Diese Demütigung saß tief. Und es ist kein Wunder, wie ich nachher feststelle, dass Friederike Mayröcker das Wort nur aus dem Mund ihrer gehässigen Schulkameradin kennt, als singulären bösen Zauber. Denn „verpumpeidelt“ oder „verbumbeidelt“ oder „verdumdeidelt“ ist: „Datterich“-Deutsch! Südhessen! Die Mitschülerin griff also damals in der Sprachkiste ganz nach unten – und traf damit zielgenau ins Herz.
„Aber die“, so Friederike Mayröckers wienerisch-trockener Kommentar, „ist auch schon lange tot.“
Im Perchtenstüberl, in diesem Nachbarschaftsbeisl, kann Friederike Mayröcker sich aufgehoben fühlen. Man kennt ihren Getränkewunsch (allerdings habe ich in Wien seit zwanzig Jahren keine Kellnerin und keinen Ober mehr erlebt, die sich ihr anders als mit „Ein Pago für Sie?“ genähert hätten), man weiß, dass eine große Dichterin zu Gast ist, die hier gelegentlich mit Viertelsfremden, mit Freunden einkehrt.
Was genau sie jedoch schreibt, weiß in ihrem Lebensbezirk wohl nur einer: der Schneider, der seit Jahrzehnten neben dem „Studio Relaxe“ seinen Betrieb führt. Denn alles, was sie aus der Welt da draußen aufsaugt, notiert, in ihre Literatur wandern lässt, gibt Friederike Mayröcker an diese Welt auch zurück: so 1992 den bibliophilen Druck mit dem Titel Proëm auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin, in dem von einer zufälligen Alltags-Augenbegegnung zwischen Schneider und Dichterin die Rede ist, einer Blitzverbrüderung ohne Worte. Draußen in der Welt sein, um tief in die Welt der Literatur einzutauchen – das Gedicht mündet in die Zeile:
mit FARNKRAUT AUGEN, Breton
Wir sitzen in Friederike Mayröckers Küche, unterm Dach. Immer war ihr die französische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts wichtig, insbesondere Prosawerke, die sich unter der schönen, im Deutschen undenkbaren Gattungsangabe „récit“ fassen lassen, also einem Erzählen, das nicht auf einen Plot angewiesen ist, mit leichter Hand zwischen Beobachtung und Imagination wechselnd, das Ineinandergreifen von Schreiben und Leben reflektierend: das Farnkraut-Augen-Buch Nadja von André Breton etwa, Mannesalter, der Auftakt des lebenslangen Autobiographieprojekts von Michel Leiris, der Bericht Sommer 1980 von Marguerite Duras, Maurice Blanchots Der Wahnsinn des Tages, die Meskalinbücher von Henri Michaux oder das Werk Claude Simons, in dem so gut wie nichts erfunden ist, ohne dass es darum am Fliegenpapier Wirklichkeit klebte. Kurzum: das absichtslose Erzählen.
Keine Leseliebe aber hat so lange gehalten, ist bis heute so intensiv und euphorisch und anregend wie Friederike Mayröckers Leseliebe zu Jacques Derrida. Ob sie sich noch erinnere, wie sie ursprünglich auf ihn gestoßen sei, frage ich sie. Friederike Mayröcker steht auf und holt den ersten Band von Derridas philosophischem Briefroman Die Postkarte aus dem Nebenzimmer – mindestens drei Exemplare dieses Buches finden sich in ihrer überbordenden Arbeitsbibliothek. Unter welchen Umständen es dorthin gefunden hat, bleibt im Dunkeln, doch die Arbeitszusammenhänge können wir rekonstruieren: Die deutsche Übersetzung von La carte postale erschien 1982, und die Lektüre muss sich nahezu unmittelbar als schreibfördernd erwiesen haben, finden sich doch die ersten Derrida-Bezüge in dem 1982/83 entstandenen Prosawerk Reise durch die Nacht.
Die Postkarte sollte in den folgenden Jahren eine konstante Begleitlektüre bleiben, doch es scheint, dass sich das Derrida-Verlangen nach dem Tod von Ernst Jandl im Juni 2000 noch einmal verstärkte, ja, mehrfach potenzierte, da Friederike Mayröcker in Begleitung ihrer seitdem engsten Vertrauensperson, Edith Schreiber, im Wintersemester 2004/2005 die Vorlesung „Freud, Lacan, Derrida“ besuchte, die der Psychoanalytiker Michael Turnheim im Hörsaal B des Allgemeinen Krankenhauses von Wien hielt.
Spuren dieser Lektionen wie der neu entflammten Derrida-Liebe finden sich 2005 in Und ich schüttelte einen Liebling, dem großen Trauerarbeitsbuch um den verlorenen Lebensgefährten, und in einem im Mai 2004 entstandenen Text mit dem Titel „J. D.“ heißt es:
Wollte ihn sehen wollte mit ihm sprechen vor allem über seine Fußnoten Bekenntnisse die Zeile an Zeile (= Wange an Wange) mit den Fußnoten des Aurelius Augustinus standen in dem Buch „Jacques Derrida. 1Porträt von Geoffrey Bennington und Jacques Derrida“.
Fußnoten, Bekenntnisse: Wie die Derrida-Lektüre ohne den Umweg über Ideenhorizonte oder die Spur philosophischer Überlegungen auf das Schreiben Friederike Mayröckers einwirkt, zeigt sich in ich bin in der Anstalt. Fusznoten zu einem nicht geschriebenen Werk, das tatsächlich zur Gänze aus Fußnoten besteht – „zum 5.x Derrida/Bennington ausgelesen“, liest man dort in der Fußnote 128, auf den Mai 2009 zu datieren, sowie, bereits in Fußnote 106:
und ich habe mir GLAS von Jacques Derrida gekauft
Glas, zu deutsch: Totenglocke, Totengeläut, 1974 erschienen, aber erst 2006 – vom Titel selbst abgesehen – ins Deutsche übersetzt, sollte das Buch von Derrida sein, das sie fortan, anders als Die Postkarte, niemals verlegen, aus den Augen verlieren, ein zweites und drittes Mal erwerben würde – weil sie ihr inzwischen über und über mit Anstreichungen versehenes Exemplar seit jenem Mai immer bei sich trägt. Ausgerechnet dieses Werk des Philosophen, das selbst von eingefleischten Derrida-Freunden als „enigmatisch“ bezeichnet wird, womit nichts anderes gemeint ist als: ungenießbar.
Friederike Mayröcker dagegen kam Glas bei der Arbeit an ihren fünf großen seit 2010 erschienenen Büchern jedesmal von Neuem einer Offenbarung gleich. In fleurs nun, dem Abschluss der Trilogie, wird die anhaltende Faszination selbst reflektiert, ausgehend vom Buchobjekt und der Textgestalt:
ich meine es nimmt mich wunder seit etwa 6 ½ Jahren lese ich in GLAS von Jacques Derrida. Das Buch ist zerlesen sein Leim oder Leib hat sich aufgelöst es ist empfindlich wie Glas: eine Lieblingsfarbe,
und:
Ich erlebe Wunder mit GLAS was mein Schreiben angeht: ich schlage das Buch z.B. auf Seite 142 auf und erblicke 3 Kolumnen geheimnisvoller Texte. Links die Anstrengung v. Hegel, mittig das Zitat eines Jean Genet Textes (,wie im Tagebuch eines Diebes, das man in allen Richtungen wird durchlaufen müssen, um dort alle Blumen abzuschneiden oder einzusammeln‘) und rechts, in Kursivdruck, nierenwärts, nochmals ein Zitat von Jean Genet.
Glas, ein Buch der Parallelbewegungen und Abzweigungen, der Einschüsse und Ausfransungen, ein Buch, das mitten im Satz beginnt und mitten im Satz endet – so negiert das geschriebene Totengeläut den Tod. Insofern ist es alles andere als ein Wunder, wenn Friederike Mayröcker mit fünfundachtzig Jahren elektrisiert wird, in anhaltende Euphorie gerät, da Jacques Derrida sich, um Jahrzehnte verzögert, als enger Verwandter zu erkennen gibt, als Mitstreiter im Geiste schon seit 1974, und dies nicht nur hinsichtlich der Schreibauffassung, sondern, unauflösbar damit verwoben, im Aufbegehren gegen das Ende.
Wir sitzen in einem anderen Stammlokal Friederike Mayröckers, in einer Stimmung, die sie 2013 in études beschrieben hat:
im Gastgarten des Rüdigerhofs die Nachmittage verbracht
unter den grünen Baldachinen der Bäume solch 1 Sommer im Hinter-
grund der seichte Wienflusz und das ferne Donnern der Bahn
„Wie kommt man da raus?“, fragt sie, womit weit mehr gemeint ist als nur jene wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die ihre Eltern und Großeltern Anfang der dreißiger Jahre tiefer und tiefer hineinrutschten. Sie meint den Familienalptraum, aus dem es kein Erwachen gibt.
Der Vater war Lehrer. Das Geld reichte nicht. Die Eltern gründeten ein Taxiunternehmen. Das Geld reichte nicht. Die Eltern eröffneten eine Weinhandlung, und auch diese Investition erwies sich als Fiasko. 1935 wurde das Haus in Deinzendorf zwangsversteigert, in dem Friederike Mayröcker ihre Kindheitssommer verbracht hatte – „um eine lächerliche Summe“, wie sie sich erinnert. Sie sagt:
Und das hat meine Mutter fast umgebracht.
Sie spricht vom „Zusammenbruch der gesamten Familie“. Die geliebte Großmutter erkrankte an Krebs. Die Delikatessengeschäfte gingen zugrunde. Um die Großmutter beerdigen zu können, musste Geld geliehen werden.
Ja, es herrschte Weltwirtschaftskrise. Im Rückblick aber nahm das Unheil schon früher seinen Lauf, trafen die Eltern ökonomische Entscheidungen nicht eben mit glücklicher Hand. Symbolisches Trumm einer Kette von Fehleinschätzungen ist der ominöse Konzertflügel, der durch das Werk Friederike Mayröckers geistert und von dem sie sich bis heute nicht hat trennen können. Anfang der dreißiger Jahre schenkten die Eltern der Tochter zu Weihnachten einen gebrauchten Bösendorfer. Und sich selbst damit wohl das Versprechen, der – samt Konzertflügel nun natürlich noch engeren – Provisoriumswohnung zu entkommen, der räudigen Gegend, der Existenz am unteren Rand der Wiener Gesellschaft. Ein Konzertflügel, um die Abstiegsangst im Zaum zu halten, die Aufstiegshoffnungen zu befeuern.
Friederike jedoch saß ihre Klavierstunden lustlos ab. Mit schlechtem Gewissen. Als „verstocktes Sündenkraut“ hat sie sich in diesem Zusammenhang bezeichnet, wobei das Sündenkraut nicht etwa ein Neologismus ist, sondern eine oberösterreichische Bezeichnung für den Spitzwegerich. Irgendwann funktionierte sie das kulturbürgerliche Möbelstück um – zum Stehpult: „In dieser Taille, da habe ich gestanden und geschrieben“, sagt sie. Dort wurden zunächst Schularbeiten erledigt, dann die ersten Gedichte geschrieben. Später diente ihr der Bösendorfer als Ablage für die sich häufenden, häufenden Manuskripte – sie vernachlässigt ihre études und füllt statt dessen ihr cahier.
„Gestochen scharf, eingepflanzt was wurde mir alles eingepflanzt von Kindesbeinen an, auf das Schreibritual bin ich von selber verfallen –“, heißt es einmal bei ihr, und man spürt eine nahezu unerträgliche Spannung, zwischen Selbstvorwurf und Selbstbehauptungswillen, zusammengepresst in einem Satz, der kein Ende hat.
Als die Familie am Boden lag und der Vater auf eine neue Erwerbsmöglichkeit sann, verfiel er – seltsame Koinzidenz – auf die Idee zu schreiben. Von Mitte der dreißiger bis Ende der sechziger Jahre erschienen, zunächst im Selbstverlag, mehr als ein Dutzend Bücher und Broschüren: ein Ernährungsratgeber mit dem Titel Gesunde Menschen etwa, in den fünfziger Jahren dann vornehmlich pädagogische Handreichungen, aber auch ein Heft in der Reihe Mentor für’s praktische Leben und den Fortschritt: Abenteuerliche Jagd auf Menschenaffen.
Die Tochter besuchte das Gymnasium, schrieb glänzende Aufsätze, hatte jedoch Schwierigkeiten in Mathematik. Nach zwei Jahren war Schluss: „Fritzi, so geht’s nicht, du kannst nicht studieren, du gehst auf die Hauptschule“, habe ihr Vater gesagt. Friederike Mayröcker erinnert sich heute, als wäre das Urteil vor wenigen Stunden ergangen, und:
Das war für mich der Todesstoß.
Nach dem Krieg wurde sie, dem Vater folgend, Lehrerin. 1950 legte sie das externe Abitur ab, nahm das Studium der Germanistik auf – doch wieder machten die prekären finanziellen Verhältnisse der Familie den Bildungsträumen den Garaus:
Da musste ich eben mitverdienen.
Fast ein Vierteljahrhundert – längst war sie eine gefeierte Schriftstellerin – sollte sie an Hauptschulen Englisch unterrichten. Ein Beruf, der sie die Stimme gekostet hat.
Hundert Schilling habe sie als Junglehrerin verdient, doch der Trotz, der Selbstbehauptungs-, nämlich der Schreibwille zeigte sich auch hier: Von ihrem ersten Gehalt, erzählt Friederike Mayröcker noch immer voller Begeisterung, kaufte sie sich eine Schreibmaschine, die Hermes Baby, deren weichen Anschlag – Pianistinnensensiblilität! – sie bis heute schätzt.
Genet, das ist der Ginster. Mit ihm, dem Deserteur, dem Dieb, dem Strichjungen, der Anfang der vierziger Jahre im Gefängnis zu schreiben begann, kommt ein zweiter geistiger Bruder ins Spiel. Notre-Dame-des-Fleurs heißt einer seiner Romane, und wenn Friederike Mayröcker für ihr neuestes Buch den Titel fleurs gewählt hat, dann spiegelt sich darin auch etwas von der Genetschen Underdog-Existenz. Seine Werke besitzt sie seit Jahrzehnten, aber erst mit den von Jacques Derrida zusammengestellten und kommentierten Genet-Zitaten in Glas wurde das Feuer entfacht. „Das brennt ununterbrochen“, sagt sie. Liest man études, cahier und fleurs, meint man, Friederike Mayröcker korrespondiere mit Jean Genet auch über Derridas Kopf hinweg. Als nähme sie die eigene Familiengeschichte in den Blick, meint sie:
Dieses fürchterliche Ganz-unten-Sein hat er mit einer ungeheuren Schönheit beschrieben,
und:
Er hat Bücher gestohlen, er war ganz verrückt nach Büchern.
Wie bei ihr öffnet sich bei Jean Genet mit der Blumenfülle eine Welt der – mitunter rohen – Intimität, und wie bei ihr fungieren bei Jacques Derrida die Namen der Blumen als Schaltstellen zwischen sinnlicher Erfahrung und Denkbewegung.
In der ungeheuren Präsenz der Blume treffen sich die drei. „Das sind immer noch diese Deinzendorf-Reminiszenzen“, sagt sie, indem sie die Augen schließt, „dass ich mich manchmal fühle wie diese Blume.“ Friederike Mayröcker hebt die Arme, formt mit den Händen eine imaginäre Hortensie, die irgendwo schräg hinter meinem Kopf stehen muss:
Es ist fast wie ein Austausch zwischen der Blume und mir.
Nun ist es aber eine Sache, als Kind durch die Wiesen zu streifen und sich an der Pracht weißer Lilien zu berauschen, und eine ganz andere, sagen zu können, welche Lilien genau als „Madonnenlilien“ bezeichnet werden. Das unendlich große Blumenlexikon in Friederike Mayröckers Werk hat mich, der ich eine Rose knapp von einer Tulpe unterscheiden kann, immer betört, etwa wenn in fleurs der Eintrag vom 25. Januar 2015 lautet:
damals in D. auf der Schwelle zum Sommerhaus 1000
Schwertlilien, Malven, Ringelblumen, Veilchen, Hyazinthen,
Gauklerblumen, Lupinen, Carolinenrosen …….. ach wie
lieblicher Film vor meinem Auge
Ob sie die Blumennamen von ihrer Mutter kenne, deren Lieblingspflanze das Farnkraut war, frage ich sie. Friederike Mayröcker lächelt und schüttelt den Kopf. Nein, dieses Wissen hat sie sich nach und nach angeeignet, indem sie bis heute reale Blüten und Blätter mit Abbildungen in Bestimmungsbüchern vergleicht. Weder ihr noch mir ist in diesem Moment bewusst, dass 1936 im „Selbstverlag Franz X. Mayröcker, Wien, V. Anzengrubergasse 17“ ein Band mit dem Titel Heimische Beeren, Pflanzen und Pilze und ihre Verwendung im Haushalt. Mit Bestimmungstabelle und Blütenkalender erschien.
Friederike Mayröcker hat, wie sollte es auch anders sein, immer ihre schützende Hand über die geliebten Eltern gehalten. 1953 zog sie aus der Familienwohnung in die Zentagasse, aber nicht etwa in luftigere Räumlichkeiten, sondern in eine Anderthalbzimmerwohnung, die sie zudem mit einer Tante teilte. Sie hat dem Haus, dem Viertel von ärmlicher Anmutung, dem – heute nur noch in Erinnerungsspuren vorhandenen – Familienkreis immer die Treue gehalten. Kompromisse geht man im Leben ein. In der Kunst jedoch muss Kompromisslosigkeit walten.
Berauschende Vorstellung: Friederike Mayröcker, die beim Mittagessen ein paar freundliche Worte mit dem Autohändler wechselt und die nachher jener stets vor dem Supermarkt hockenden jungen Frau zulächeln wird, die wir aus ihren Büchern als Bettler-, als Almosenfigur kennen, sie, Friederike Mayröcker, wird, sobald sie die Tür zu ihrer Wohnung hinter sich geschlossen hat, ein selbst unter Derrida-Lesern kaum bekanntes Werk des französischen Philosophen-Schriftstellers oder Schriftsteller-Philosophen aufschlagen und vom einen auf den anderen Augenblick darin versinken. Wird versinken in Mayröcker-Sätzen wie: „mit vliesartigen Blütenblättern versehene Blumen (all dies ist sehr beladen, nicht wahr:)“ – eine Vorstellung, so berauschend, dass man fast selbst in den Schreibrausch gerät.
„Wie auch immer“, sagt Friederike Mayröcker zum Ende unseres Gesprächs ruhig und bestimmt, „ich arbeite weiter, so lange ich kann.“
Marcel Beyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.7.2016
Ideen sind Himmelfahrten: Friederike Mayröcker liest aus ihren Gedichten am 15.5.2006 im Lyrik Kabinett München.
Theo Breuer: „Wie eine Lumpensammlerin“ – Vermerk zu Friederike Mayröckers Werk nach 2000
poetenladen.de, 20.12.2014
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram + IMDb +
KLG + PIA + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Archiv 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
Keystone-SDA + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Marcel Beyer liest ein Gedicht aus Graphit und macht etwas Werbung für sein Lesungskonzert mit dem Ensemble Modern zur Eröffnung der Frankfurter Lyriktage 2015.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Zettels Träumerin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.2024
Michael Wurmitzer: Das Literaturmuseum lässt virtuell in Mayröckers Zettelhöhle schauen
Der Standart, 17.4.2024
Barbara Beer: Hier alles tabu
Kurier, 17.4.2024
Anne-Catherine Simon: Zuhause bei Friederike Mayröcker – dank Virtual Reality
Die Presse, 18.4.2024
Paul Jandl: Friederike Mayröcker: Ihre Messie-Wohnung in Wien bildet ein grosses Gedicht aus Dingen
Neue Zürcher Zeitung, 17.6.2024
Sebastian Fasthuber: Per Virtual-Reality-Trip in die Schreibhöhle der Dichterin Friederike Mayröcker
Falter.at, 9.7.2024
Fabian Schwitter: Von Fetischen und Verlegenheiten
Kreuzer :logbuch, Oktober 2024
Cornelius Hell: Kreuz und quer durch Mayröcker-Texte
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und die Dorfwelt
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und der heilige Geist
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und das Skandalon des Todes
relidion.orf.at, 20.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker ist der Frühling
relidion.orf.at, 21.12.2024
Martin Reiterer: Gegen den Strich gebürstet
Der Standart, 16.12.2024
Iris Radisch: Majestät am Campingtisch
Die Zeit, 18.12.2024
Bernd Melichar: Sie weidete in Poesie, sie war nicht von dieser Welt
Kleine Zeitung, 18.12.2024
Clemens J. Setz: Ihre Stimme macht alle Selbstgespräche tröstlicher
Süddeutsche Zeitung, 19.12.2024
Oliver Schulz: Darum war Friederike Mayröcker von Sprache besessen
Nordwest Zeitung, 19.12.2024
Lothar Schröder: Einfach mit Larifari beginnen
Rheinische Post, 19.1.2024
Bernhard Fetz: Zum 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker
hr2, 20.12.2024
Joachim Leitner: Wie Friederike Mayröcker in Tirol den Mut zum „Mayröckern“ fand
Tiroler Tageszeitung, 19.12.2024
Marie Luise Knott: Engelgotteskind
perlentaucher.de, 20.12.2024
„Königin der Poesie“: 100 Jahre Friederike Mayröcker
Der Standart, 2012.2024
Martin Amanshauser: Durch ihre Welt tanzen die Blumen, Tiere und Gedanken
Die Presse, 20.12.2024
Gerhild Heyder: „Der Tod ist mein Feind“
Die Tagespost, 20.12.2024
Paul Jandl: Vor hundert Jahren wurde Friederike Mayröcker geboren: eine Dichterin, die mit ganzem Herzen an das glaubt, was von oben kommt
Neue Zürcher Zeitung, 20.12.2024
Richard Kämmerlings: Unaufhörlicher Dialog mit Lebenden und mit Toten
Die Welt, 20.12.2024
Peter Mohr: Den Kopf verlieren
titel-kulturmagazin.net, 20.12.2024
Michael Denzer: „Haben 1 Gedicht im Kopf“
salto.bz, 24.12.2024
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
und Interview 1, 2, 3 & 4
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA + IMAGO +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


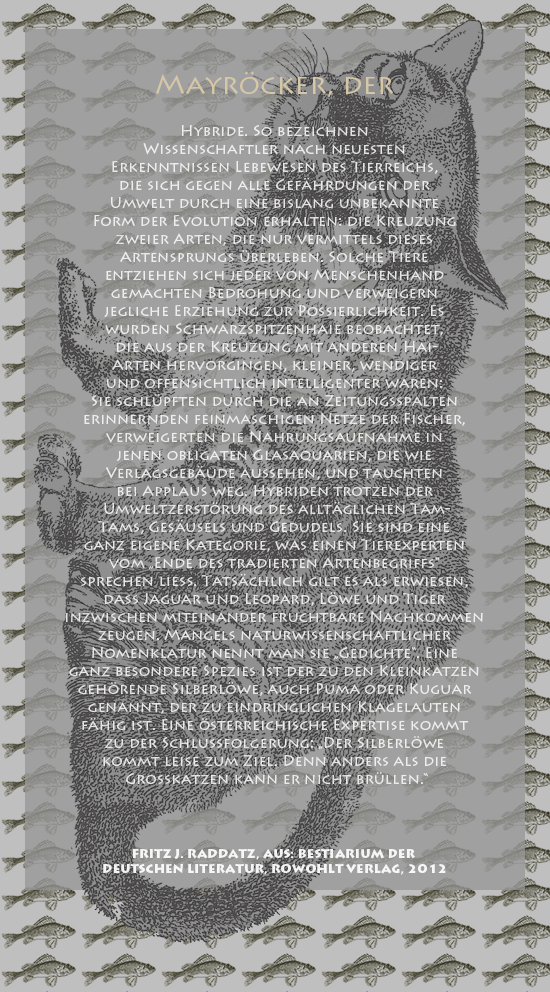












Schreibe einen Kommentar