Friederike Mayröcker: Winterglück
WINTERGLÜCK
eine Erlösung eine Offenbarung jetzt diese
Stimme wieder zu hören Vogelstimme jetzt dieses
Gezwitscher, etwas wie Paradiese blühten
auf ich vergösse die
Tränen
aber die Stimme kommt nicht Vogelstimme nein
aaaaadieses
Winterglück
ist mir nicht zugedacht jemand
anderer an einem anderen Ort wird es wird dieses Gezwitscher
Vogelstimme Stimme empfangen an meinerstatt jetzt in dieser
Stunde Sekunde
Wort im Schatzhaus der Wirklichkeit
− Winterglück – Friederike Mayröckers Gedichte aus den Jahren 1981 bis 1985. −
„Befreiung durch Lesen, ein Weihnachtsbrief“ ist ein kurzes, nur acht Verse umfassendes Gedicht Friederike Mayröckers überschrieben. Von Knotenschrift ist darin die Rede, die man mit den Augen oder Händen lesen kann; auch Durchtrennen ist möglich, wodurch die Schrift lebhafter wird, doch immer bleibt der Sinn („alter magischer / Text“) sich gleich, zielt auf das in der Überschrift annoncierte Befreiungserlebnis.
Das ist ein prägnantes Gleichnis für die Wirkung der Poesie und spielt mit den landläufigen Bedeutungen von Knoten und Schnur. Binden, fesseln, bewegungsunfähig machen kann man mit ihnen, und die Verknotung ist allemal ein unerwünschter Zustand. Doch was geschieht, wenn man die verschlungenen Schnüre als sprachliches Ereignis auffaßt, wenn man sie, einer anderen Gebrauchsanweisung folgend, als Schrift liest, als Quipu, worin die Inkas ihre Botschaften verschlüsselten? Die Bedrohung fällt von ihnen ab, die unheilvolle Bedeutung löst sich in einer sprachlichen Information auf, und die Knotenschnur verliert ihre fatale Erdenschwere: lesend fühlen wir uns befreit. „Eskapismus ist schon / dabei“, heißt es freilich in einem anderen Gedicht, und einen leisen ironischen Vorbehalt meldet die Autorin auch in ihrem poetologischen Gedicht an: Der Zusatz „ein Weihnachtsbrief“ relativiert die Überzeugung auf jeden Fall, ob man ihn nun als frohe Botschaft oder frommen Kinderglauben nimmt.
Das Gleichnis von der Knotenschrift liefert eine unmißverständliche Lektüreanleitung für das meiste, was Friederike Mayröcker geschrieben hat, macht ihr ästhetisches Ziel deutlich, aber auch die Zweifel, die sie nicht los wird. Selbst der Titel Winterglück ihres neuesten Buches ist zweideutig. Er steht über Gedichten, die zwischen 1981 und 1985 entstanden sind und vor allem vom Glück einer Kunstwelt zeugen, die aus sich selber von Kälte bedroht ist.
Die Themen bieten dabei zunächst kaum Überraschendes, wirken wie aus dem üblichen Katalog der Gattung abgezogen. Von den Jahreszeiten ist viel die Rede, ausgezeichnet vor allen anderen natürlich der poetischste Monat: „auf dem Boden, und in den Wolken im Mai“ ist gleich das Eingangsgedicht überschrieben, ein anderes zeigt den „Wiegen- / druck Deutschland im Mai“, und dann fehlen auch die entsprechenden gefühlstimulierenden Wendungen nicht: „der Frühling / längst gehißt, schwer / bricht Liguster auf“, man liest von niederfallenden Kirschblüten und singenden Amseln.
Auch die anderen Jahreszeiten und andere Monate tauchen auf, der August („beim Beerenpflücken“) oder Landregen im Juli, „Frühabend im September“ und schließlich der Winter, der ganz stilgerecht „Bußwinter“ heißt. Stichwortgeber ist in allen Fällen die Natur, ein Wortreigen schließt sich an, in welchem die „Silberlinge des Birkenlaubs“, „rosa Bauernrosen“, „Dahlien, Phlox in den Beeten“ sich mit prosaischeren Kräutern wie Kapuzinerkresse oder Spitzwegerich mischen.
Andere Gedichte nehmen ihren Ausgang von alten Fotos („dreijährig ich / mit Zipfelmütze / baumelnden / Fausthandschuhen“), von der Erinnerung an die Toten und Begrabenen, von Reisereminiszenzen und Alltagssituationen. Doch so identifizierbar mit unserer Erfahrung, der im Wirklichen und jener in der Literatur, diese Themen auch sind, in den meisten Fällen verlieren sie sich schnell im Labyrinth mehrfach verschränkter Wortreihen, die zwar noch in einer nach Laut und Gebrauch sich richtenden assoziativen Beziehung zum Anlaß stehen, ihn darüber hinaus aber nicht mehr berühren.
Um das Verfahren mit Hilfe Friederike Mayröckers poetologischem Gleichnis zu verdeutlichen:
Die gegenständlichen Verschlingungen auf der Knotenschnur verwandeln sich in einen sprachlichen Vorgang, in ihm haben sie eine bestimmte, durch Anordnung und Form definierte Funktion, und ihr Gebrauch, nicht etwa in Beziehung zur materiellen Wirklichkeit der Schnur und ihrer Schleifen, entscheidet über ihre Bedeutung:
das Hufeisen auf der Schwelle,
immer noch, mit seinen Enden nach oben – ja, wir wissen
schon, damit
das Glück nicht ausrinnt, etc., in diesem Verstall:
Hasen-, Hosenstall, Koben, in diesem verschworenen
Pferdekopf in dem ich wohne; ich drehe
vergeblich den Türkenkopf, Türknopf, verliere Verwandtschaft,
Kniestücke, Flöte
von Flucht,…
Die Worte bezeichnen Tätigkeiten, die als sprachliche Ereignisse ablaufen; ihre Bedeutung als Gegenstandsbenennung tritt zurück hinter ihre grammatische und stilistische Bedeutung, sie werden zu Trägern lyrischer Kompositionen. Deren Zweck orientiert sich am Ideal einer rein sprachlogischen Kommunikation. Die Dichterin gibt den Anstoß dazu, nimmt ihn von irgend woher, aus der Natur oder dem städtischen Leben, gleichviel, und erzeugt durch Weiterentwicklung, Anordnung und Veränderung von Worten und Wortfügungen einen Text, der potentiell unendlich ist, auf einen Leser zugeschrieben, der ihm möglicherweise antwortet und ihn weiterspinnt. Daher der prinzipiell offene Schluß aller Gedichte, die mitten im Satz abbrechen („Glanz vor Augen der duftenden Blütenmonde im hohen / Holunderbaum,“), in eine Frage münden oder in ein fragmentarisches Bild („einer Insel / bräunlicher Rückenschild wölbt / die See –“).
Dabei spielt der Rhythmus eine große Rolle, und wenn man sich einmal in ihn eingeschwungen hat, wird die Frage nach dem außersprachlichen Sinn des Textes immer wesenloser, die Worte funktionieren wie Pendel, die sich gegenseitig anschlagen, aufleuchten für einen Augenblick und dann, ohne Erinnerungsspuren zu hinterlassen, von den nächsten abgelöst werden. Wer diese Gedichte verstehen will, darf nicht nach ihrem außersprachlichen Sinn fragen (auch wenn Sinn-Rudimente erhalten bleiben, sich immer wieder vordrängen), sondern muß sich auf ihre Gebrauchsweise einstellen, darf die Bedeutung der Einzelelemente nicht in einer Entsprechung zur äußeren Welt suchen, sondern allein in ihrem Platz im Gedicht. Wer wäre unempfindlich gegen diese Verführung durch reine Poesie, wer genösse nicht das Einschwingen ins schön geregelte, mit dissonanten Spannungen aufgeladene, daher niemals bloß eintönige Spiel der Worte? Es ist die Luftgeisterei, das Arielhafte der Poesie, das hier wirkt, und Dichtung, die davon unberührt bliebe, müßte stumpf, glanzlos und ohne Leben erstarren. Friederike Mayröcker spricht an anderer Stelle von dem „Strahlenkranz von Assoziationsmöglichkeiten“, den die lyrischen Erinnerungspunkte für sie besitzen, von der „Eigenbeweglichkeit“, für welche das Gedicht dann zum Spielfeld wird:
Wolf wie ein Wolf du siehst
darauf aus wie ein Wolf nach-
denklich mit gesenktem Kopf, Kopf-
tier, das Bild hat dich in einen
Wolf verwandelt auch aufgelöst, nicht
so sehr Wölfin, Wolf! auch Bruder Bruder Wolfs-
hund, mit dem Kopf auf die Brust
gesenkt sitzend, ein Wolf ich weiß
nicht gepaart mit struppig-nachdenklicher
Korpulenz (nachsichtig?) Kopf : behaartes
Gewicht
nach unten, wolfs-
mäßig du siehst du sitzt ein wenig
zusammengesunken wölfisch die Schärfe!, und
gnadenlos knochenschüttelnd von Gullies
umflort, das hat mich auch ganz
verstorben,
Wir erleben die Herstellung einer lyrischen Metapher, ihre zunehmende Entfernung vom Gegenstand (dem Bild oder Foto), erleben ihre Verselbständigung und Kollision mit anderen Metaphern oder Metaphernkeime, getragen von einer Beunruhigung, die mit dem Eingangswort gegeben ist, in ihm wurzelt und aus ihm heraus nun sprachlich entfaltet wird. Doch sind in diesem, für Mayröckers Manier kurzen Gedicht die Grade der Abstraktion noch erkennbar, so haben sich die Wortreihen in den meisten langen Gedichten ganz von ihrem Anlaß entfernt, auf grammatische und stilistische Verhältnisse, Kontraste und Vergleiche reduziert.
Bei ihrer Lektüre werden wir Opfer einer ständigen Irritation. Gewohnt, Wörter auch als Objektmitteilung zu verstehen, versuchen wir dauernd, ihnen auch im Gedicht einen gegenständlichen Sinn abzugewinnen, obwohl die Autorin uns dafür jeden Vorwand zu entziehen versucht. Diese Hartnäckigkeit, die uns, entgegen der dichterischen Absicht, nach einer außersprachlichen Bedeutung des lyrischen Worts fragen läßt, wurzelt gewiß in Tradition und Übereinkunft, doch auch in der Überzeugung, daß Sprachbau und Objektwelt keine disparaten, nur durch Konvention verbundenen Sphären darstellen, sondern sich sinnvoll entsprechen.
Das Ideal, auf das hin sich Friederike Mayröckers Gedichte unaufhaltsam zubewegen, ist nicht die Vermittlung der sprachlosen mit der menschlichen Welt, sondern die autonome künstlerische Ausdrucksform, die in sich selbst ihr Genüge findet und Bedeutung mit Funktion zusammenfallen läßt. Ein Weg, der ins Leere führt, auch ins bloß Private, Abseitige, in die Maschinerie von Sprachfunktionen, die sich von der Alltagsrede nur dadurch unterscheidet, daß die pragmatische Zwecksetzung wegfällt und an ihrer Stelle die formalästhetische Instrumentalisierung des Wortes tritt.
Es gibt auch gegenläufige Tendenzen in Mayröckers geschlossenem Sprachbau, es gibt die Sehnsucht nach der sinnlich-sinnfälligen Erfahrung („ich will mich betören / lassen von aller Welt“), und es gibt sogar die offene Hinwendung zum Wirklichkeitsbezug der Sprache: dort nämlich, wo die Freundschaft, wo gar die Liebe eintritt für den anschaulich erweisbaren Sinn des Worts im Schatzhaus der Wirklichkeit („mit deiner sanften / Zunge Kirschkerne zählend in meinem / Mund“). Dann vollendet sich ihre Dichtung nicht mehr bloß in der Absicht, Sprache zu entwirklichen, sondern wird gleichsam leibhaftiger Ausdruck des Geliebten in seiner ganzen Realitätsfülle. Ein argumentum ad hominem, von dem ich wünschte, daß es sich doch noch als stärker erweisen und die geniale Sprachspielerin Friederike Mayröcker zur Dichterin jener offenen Möglichkeiten machen möge, die nicht nur eine Dimension der Sprache, sondern zugleich auch des Wirklichen ist.
Gert Ueding, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.12.1986
Verdorrter Planet
− Winterglück: Gedichte von Friederike Mayröcker. −
Im Jahre 1946 veröffentlichte Friederike Mayröcker in der Zeitschrift Plan ihr erstes Gedicht. Inzwischen sind vierzig Jahre vergangen. Die Dichterin hat sich zu ihrer Arbeit einige Male geäußert. Bewegend ist dabei die Offenheit, mit der sie auf die eigene Ratlosigkeit hinweist, wenn es darum geht, zu ihren Texten Distanz zu gewinnen oder gar eine abschließende Beurteilung abzugeben. Friederike Mayröcker weiß nie so genau, wie es weitergeht, auch wenn Erinnerungsstränge und Alltagserfahrungen sich zunehmend in ihren poetischen Texten ausbreiten. Sie hat ihre sprachliche Neugierde nie verloren, ist nach wie vor in die Sprache verliebt, spielt mit ihr und läßt sich in Höhen und Tiefen führen. In ihrem Text „Mail Art“ spricht sie von einem „Periskop“, um in die abenteuerlichen Räume zu gelangen. Sie benutzt also durchaus ein technisches Auge, um das zu sehen, was sich dann später in ihren Texten spiegelt. Das Auge ist eine zentrale Metapher in ihrer Dichtung.
Das Auge sieht – aber es bilden sich in ihm auch Projektionen. Auf der Schwelle von Innen und Außen ist es für beides gleichermaßen zuständig. Die Funktion des inneren Auges, dem das Sehen nach draußen nur willkürliches Futter ist, wird durch das Periskop erweitert, das sich allerdings nur auf bestimmte Ziele richtet. Es ordnet die verwirrend vielen Fragmente durch die Hand der Dichterin. Für den poetischen Blick des inneren Auges ist der Winkel des Sehens entscheidend und die eigenwillige Kombination der Blickrichtungen. Dieser poetische Blick ist Voraussetzung für die Schreibweise, in der Experiment, Erfahrung, Intuition und Konstruktion zusammenspielen, und der poetische Blick berührt alles, auch die Sprache selbst:
da fliegt mir
das Auge davon diese
Ringeltaube…
Mit diesem Satz beginnt der Gedichtband Winterglück. Die Wahrnehmung des Auges ist also nicht nur an einen Punkt gebunden, sondern es hat sich in eine Ringeltaube verwandelt. Bereits in diesem Bild wird die Vorstellung einer Alltagslogik durchkreuzt. Der Leser verliert den festen Boden der Linearität unter den Füßen. Wenn ihm auch die Augen davonfliegen, wird er viel sehen können: Sichtbares und Unsichtbares, Metamorphosen von Tieren, Pflanzen und Menschen, Landschaftsfragmente mit üppiger Vegetation, teilweise mythologisch aufgeladen, teilweise zerstört, verkleinert und vergrößert.
„Interieur“ heißt die Überschrift eines Gedichtes, und sie könnte für all das stehen, was den Innenraum dieser poetischen Welt ausmacht. Nachdem das Dichterauge davongeflogen ist, kommt es wieder mit dem, was es in Wien gesehen hat oder in Griechenland, auf einem Photo oder in den vielen Büchern und auf Gemälden. Die Augen sind aber nicht nur ungebundene Blickfänger, sie können auch selbst Teil eines Landschaftsbildes werden:
… also
Verstoßung
der hübschen Gewässer (meine Augen
im grünlichen Scheine)
welche in meinen Augen
mit grünlichem Scheine und
schlaflos
umhertrieben
So weit geöffnet und so groß kann das Auge sein, daß sogar „hübsche Gewässer“ in ihm Platz haben, dann wiederum lesen wir von einem Auge, das vom Schlaf noch zugenäht ist. Das Auge reagiert als empfindlichstes Organ sofort auf alle äußeren und inneren Einwirkungen, und deshalb sieht man in ihm auch den Tod zuerst. Die Vögel als Träger des fliegenden Blicks sind es an anderer Stelle, die das Auge fressen: „die Vögel picken das menschliche Auge zuerst aus“. In diesem Bild ist kein Rest mehr von der einstigen „poetischen Unschuld“, vieles muß zu Ende gedacht werden, der Tod bleibt nicht ausgespart.
Trotzdem streicht die Poetin aus ihrem Gedächtnis nicht jene Erinnerungsbilder, die von ihr selbst als erinnerte „Urbilder“ bezeichnet werden, denn nicht jedes Erinnerungsbild kann den gleichen Reiz haben. Die „Urbilder“ gehören dem Bereich privater Mythologien an, berühren aber auch das kollektive Gedächtnis der Menschheit oder deren Gedächtnisverlust. Beide Bereiche sind Teile dessen, was Friederike Mayröcker als „Poesiereservat“ bezeichnet hat. Nach der Vertreibung aus dem Paradies gibt es dort noch „Urbilder“, die sonst nirgends mehr zu finden sind, Wörter und Sätze, die geschützt werden müssen vor denen, die alles zertrampeln.
Ein Reservat hat immer auch etwas Künstliches. Einer der entscheidenden Sätze des Gedichtbandes Gute Nacht, guten Morgen heißt: „ich züchte mir mein Gedicht“. Innerhalb der Grenzen dieses „Poesiereservates“ gibt es also etwas, was außerhalb nicht existieren kann, zum Beispiel das Gedicht.
Das Gedicht als kleines Literaturparadies? Ja, aber nur manchmal. Auf der anderen Seite steht die unausweichliche Erkenntnis vom Zustand unserer Erde.
Furor: Klage Anklage Ohnmacht
heißen Hirns oder Herzens, stopf ich
die Ohren mir zu auch den Schädel, wie
Ulrich halt ich die Ohren mir zu, wie auf
Stelzen zu gehen: die Zeit der verdorrte
Planet, Dalis Wunderwüste verbrannt, diese
Zeilen gehen auf Stelzen – verrückt!, die paar
Sätze auf Stelzen, ach Ulrich!, was
haben wir mit diesem Himmel getan, was
haben wir getan mit diesem Paradies von dem nur noch
Reste
Himmel und Blumen und
manchmal ein
Stern, verdorrter Planet ich sagte es schon…
Das Periskop der Dichterin richtet sich auf den kaputten Planeten. Die Wahrnehmungen sind kaum auszuhalten, und würde Ulrich aus dem Mann ohne Eigenschaften diesen Zustand sehen, es ginge ihm wohl nicht anders. Aber bei Musil ist der Mensch noch entwicklungsfähig. Ulrich unternimmt mit seiner Schwester eine Reise nach Italien, ins Paradies, und das bedeutet eine Reise in den anderen Zustand. Doch wo der Planet verdorrt ist, haben selbst die surrealen Bilder von Dali mit ihren vielgestaltigen, halluzinatorischen Landschaften keine Chance mehr. Sie sind verbrannt, weil der Planet verdorrt ist. Darüber könnte man rasend werden. Die Dichterin erhebt Anklage und kennt doch ihre Ohnmacht. Es entsteht die bange Frage: Wie sieht meine Welt aus? Diese Frage betrifft auch die Welt der Poesie. Zwar gibt es noch die Kindheitsträume, aber was bedeuten sie? Die Antwort kann sich der Leser selbst geben, und trotzdem fühlt er, denkt er darüber nach, eine merkwürdige Leere, weil ihm die Zukunftsbilder nicht so recht in den Kopf wollen. Es wird Friederike Mayröcker ähnlich gehen. Sie hält trotzig an ihrem Bilderreservoir fest, auch wenn sie Unrat, Schutt und „Endzeitfarben“ sieht. Zur poetischen Wahrnehmung gehört eben beides: Endzeit und Paradies.
Daneben gibt es den Bildraum des Traumes, für ihn hat Friederike Mayröcker ein ganz eigenwilliges Gedächtnis. Er ist einzigartiges „Futter“ für ihre Poesie. „Also in meinen tatsächlichen Träumen komme ich weit herum“, sagte sie im längsten Gedicht von Winterglück, das sich mit Traumwahrheiten beschäftigt. Inwieweit diese erfunden sind, bleibt unklar. Zumindest gibt die Überschrift „oder Süße erfundener Träume“ einen Hinweis auf deren bewußte oder halbbewußte Gestaltung, denn auch das Wachen kann ja von Tagtraumsequenzen überlagert sein. Die Traumbilder fluten und werden doch in eigenwilligen lyrischen Formen gebändigt. Im Gedächtnis von Friederike Mayröcker wechseln die Zeiten in schneller Geschwindigkeit, das Vergangene ist immer schon in die Gegenwart gerückt, und die Lebenszeit wird zugleich zusammengepreßt bis zum nicht mehr vorhandenen Winterglück.
Wer beim Lesen dieser Gedichte die Bewegung durch Zeit und Raum mitmacht, wird weit hinausgetragen in den Weltenraum und zugleich hineingelassen in das Zimmer der Dichterin. Dieses Zimmer wird im Gedicht „Veduten“ als „Biwakschachtel“ bezeichnet. In ihr ist alles aufgehoben, was Erinnerungswert besitzt. Pflanzen, Tiere, Bücher führen ein merkwürdiges Eigenleben, sie sind wirklich und unwirklich zugleich. Wir sehen Ausschnitte einer Zimmerlandschaft mit ihren „wüsten Verschlingungen“, die von den vielen Dingen ausgehen, aber auch von der privaten Geschichte, den Ängsten, den Halluzinationen. Alles wuchert und wird doch wie in einer Biwakschachtel zusammengehalten. Ein Biwak ist zugleich eine kleine Befestigung.
Nichts ist für die Sinne verboten, hier gibt es Nachtwunder und den „Rasen der Zeit“. Hier ist der Ort für Exerzitien: „Ich bleue mir Kunst ein.“ Aber auch der „närrische Grimassenschneider Tod“ wohnt in der Biwakschachtel. Seine Anwesenheit wird weggedrückt durch den Wunsch: „Ich will mich betören lassen von aller Welt.“ Das ist aber nur ein Teil des Wunsches, der andere besteht darin, „Zauberbotschaften auszustreuen“.
Aber die Möglichkeit, das Geschriebene als „Niederlage“ zu begreifen, liegt dicht daneben. Der Körper ist Träger der Niederschrift, und die ist ein „Ungetüm“. Wer wird da von wem überwältigt, wer gehorcht wem nicht mehr? Der einzige Ausweg scheint die etwas ungelenke Schrift aus Kindertagen zu sein, oder ein „Handkorsett“, in dem die schreibende Hand fest ruht. Offensichtlich ist die Hand Trägerin unbewußter Regungen und in Widerspruch geraten zum schreibenden Ich. Da die wilde Handschrift wohl zu deutlich sprechen würde, zieht sich die Schriftstellerin auf ihre Kinderhandschrift zurück. Aber es können keine unschuldigen Kritzeleien mehr entstehen, das Schriftbild wird immer ungewöhnlich sein.
In der Schrift liegt eine magische Qualität, und es kommt allein auf den Leser an, ob er sie aus der Pappschachtel herausholt und wie er sie aufschnürt. In diesem Prozeß wird die Schrift „lebhaft“. Wenn es aber dem Leser gelungen sein sollte, diese Schrift zu befreien, dann hat er auch sich selbst befreit – dann kann er lesen. Durch diesen Befreiungsakt wird dem Text ein Stück Leben zurückgegeben, es ist dies eine Möglichkeit, weniger sterblich zu sein.
… – wir Vieläuger wir
Dichter, mit einem
Kustos (Hüter): mit einem
Anagramm hat alles ja
angefangen!
Das Anagramm ist als Buchstabenrätsel die „Knotenschrift“ eines magischen Textes. Die Dichterin kennt sein Geheimnis, spielt mit den Buchstaben und Wörtern eines Satzes, stellt sie um, und schon ergibt sich ein anderer Sinn. Kein Buchstabe des „Urtextes“ darf verloren gehen. Dafür ist ein Kustos da; er ist der Hüter der Form, er kennt Regeln und Inhalt, er beschützt die Buchstaben, er ist eine Art Schutzengel. Ein Anagramm ernstnehmen heißt, mit Sprache zu experimentieren und doch alle Auswüchse in eine Form zu bannen. Erst dann entsteht ein unverwechselbarer Rhythmus und ein lyrischer Ton. Es ist vielleicht das, was Mallarmé den Eintritt von „Musik in die Buchstaben“ nennt.
WINTERGLÜCK
eine Erlösung eine Offenbarung jetzt diese
Stimme wieder zu hören Vogelstimme jetzt dieses
Gezwitscher, etwas wie Paradiese blühten
auf ich vergösse die
Tränen
aber die Stimme kommt nicht Vogelstimme nein dieses
Winterglück
ist mir nicht zugedacht jemand
anderer an einem anderen Ort wird es wird dieses Gezwitscher
Vogelstimme Stimme empfangen an meinerstatt jetzt in dieser Stunde Sekunde
Dieses vergleichsweise einfache Gedicht läßt ahnen, was es bedeuten könnte, mitten im Winter „Paradiese“ zu sich herein zu lassen. Wieder ist der Vogel ein Bild für die Erfüllung unstillbarer Sehnsucht. Seine Stimme, sein Gezwitscher würden den Raum öffnen für den ganz anderen Zustand. Aber der Vogel, der uns in so vielen Höhenflügen und Metamorphosen durch die Texte begleitet hat, läßt sich nicht mehr in die Realität des Winters imaginieren. Seine Stimme ist im Landschaftszimmer der Dichterin nicht zu hören und das heißt, daß auch die Stimme der Poesie schweigt. Aber es gibt diese Stimme noch, sie ist nur für andere Ohren bestimmt. Für andere kann es dieses Winterglück geben, die Erfüllung einer heftigen und zerbrechlichen Sehnsucht.
Ria Endres: Schreiben zwischen Lust und Schrecken. Essays zu Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker, Marlene Streeruwitz, Verlag Bibliothek der Provinz, 2008
Die blanke Knospe des Schädels
Die neuere Poesie von Friederike Mayröcker hat das Experiment hinter sich gelassen. Sie vermittelt den Eindruck von spontaner Rede, von unmittelbarem Naturerleben, von mehr Intuition und weniger Konzeption, von Gelegenheitsgedicht und Erlebnislyrik. Doch dieser Eindruck täuscht.
EIN GLEICHES
der weiße
Seidenspitz auf der
Fensterbank; ich, ihn umhalsend,
mit Vaters Mütze, die fällt
mir tief ins Gesicht; daneben
im violetten und weißen
Rüschenkleid die schöne
Großmutter, lächelnd –
beim Magnesiumlicht des Vaters
zucken wir alle
zusammen; begraben
alle, ich
lebe
Kein einfacher Text. Das Ich betrachtet eine Photographie, auf der es mit Seidenspitz und Großmutter abgebildet ist. Beschrieben wird nur, was sofort ins Auge fällt: das Erschrecken vor dem Blitzlicht, das auffällige Kleid der Großmutter, die Mütze des Vaters. Die lückenhafte Beschreibung hebt den Eindruck spontaner Rede hervor; auch das Präsens und die Hauptsatzstellung im Nebensatz („die fällt mir tief ins Gesicht“) betonen das situative Sprechen. Dennoch ist es selbstverständlich unzulässig, hier eine hübsche biographische Geschichte zu erfinden und das lyrische Ich stillschweigend mit Friederike Mayröcker zu identifizieren. Wer so verfährt, gibt sich zu schnell zufrieden und läßt sich dazu verleiten, den Text und die Autorin nicht ernst zu nehmen; der erkennt nicht, daß sich das Gedicht längst von seinem Anlaß gelöst hat und ein eigenständiges Kunstwerk geworden ist. Denn das Gedicht suggeriert jenes unmittelbare, situative Sprechen nur, in Wirklichkeit aber haben wir es mit einem genau kalkulierten Text zu tun.
Das „begraben alle, ich lebe“ zeigt den Tod von Vater und Großmutter an; es schmeckt nach Bedauern und Trauer, bekommt jedoch eine ganz andere Klangfarbe, wenn man die Anspielung auf das Goethegedicht „Über allen Wipfeln ist Ruh“ („Ein gleiches“ 1780) berücksichtigt. Dann lesen sich die letzten Zeilen „begraben alle, ich lebe“ wie ein trotziges Aufbegehren gegen die letzten beiden Verse bei Goethe: „Warte nur balde, / Ruhest du auch“. So gelesen wäre das unbestimmte Ich im Mayröckergedicht identisch mit dem unbestimmten „Du“ im Goethegedicht. Und wir hätten hier die phantastische Korrespondenz zweier Texte, die mehr als 200 Jahre auseinanderliegen. Und wir könnten spekulieren, daß zugleich mit der Titelanspielung ein ungeheurer Anspruch der Autorin sichtbar wird, ein ‚Das-kann-ich-auch‘, und ein Versuch, dem Vorbild und Konkurrenten Goethe „ein gleiches“ entgegenzusetzen. (Besonders pikant ist in diesem Zusammenhang noch, daß man auch Goethes Gedicht beharrlich als „Erlebnislyrik“ mißverstanden hat; genau wie sein Gedicht „Erwache, Friederike“ 1771.) Friederike Mayröckers vollendetes Gedicht hat gar nichts Experimentelles, gar nichts Innovatives an sich, es betont im Gegenteil durch Rückbindung an die literarische Tradition das Herkömmliche. Und dennoch ist es originell. Der vorliegende Gedichtband zeigt beispielhaft, daß die österreichische Autorin die Mittel der ‚neuen‘ und auch der ‚alten‘ Poesie gleichermaßen souverän einzusetzen vermag. Ihre Dichtkunst lebt von der Spannung zweier gegensätzlicher Pole, die oft innerhalb eines Gedichts miteinander konkurrieren: alte versus neue Poesie, Traditionalität versus Originalität, Epigonalität versus Avantgardismus, konventionelles versus engagiertes Sprechen, „schöne“ versus konstruierte Poesie.
ANTWORT UND FRAGE
nur noch von Nesseln
genährt, ganz weiß geworden flog
er über die Felder Kielwasser offene
Brust –
vom Parnaß das weiße
Leuchten auf dunklem
Foto der weiße glänzende Fleck sein
lachender Mund :
wohin
fragt der Verkäufer im
Hutgeschäft, mag Ihr Vater
verzogen sein ich sah ihn lange
nicht mehr
Der Sinn erschließt sich besser, wenn man den zweiten und Frageteil vor dem ersten und Antwortteil liest: Der erste Teil des Gedichts beantwortet die Frage im zweiten Teil; die Überschrift stiftet den Zusammenhang zwischen beiden. Sie erlaubt es, in der zeitlichen Abfolge von heterogenen Zuständen ein Zuerst und ein Danach zu bestimmen; sie benennt aber nicht nur die inhaltlich verdrehte Reihenfolge, sondern auch die stilistische: der neue, ‚engagierte‘ Text kommt vor dem alten, ‚konventionellen‘. Hier werden zwei Sprachschichten nicht montiert, sondern direkt nebeneinandergestellt; sie sind gleichwertig.
Die Frage des Verkäufers wird referiert; das „ich sah ihn schon lange nicht mehr“ deutet schon auf den Tod des Vaters leise hin. Im ersten Teil des Gedichts – wiederum wird eine Photographie betrachtet – ist die Metempsychose/Metamorphose des Vaters zum weißen Seelenvogel bereits vollzogen: Er fliegt, leuchtend und von Nesseln genährt, über die Felder. Es ist ein menschenähnlicher Vogel, wie sein lachender Mund belegt. Da wir aber die Lehre von der Seelenwanderung nicht mehr so recht glauben können, fungiert der Vatervogel zugleich als Literaritätssignal, so daß im Text der Gegensatz von ‚Literatur‘ (Antwort) und ‚Realität‘ (Frage) aufgebaut wird. Friederike Mayröckers späte Lyrik neigt dazu, alles zu beleben und alle Formen des Lebens in Beziehung zu setzen, zu verschmelzen. Aus allem, was sie sieht, macht sie Bilder. Alles wird, wenn auch nicht direkt menschlich, so doch menschenähnlich. Köpfe und Blütenstände, Arme und Äste, Füße und Wurzeln werden in einer reichen Bildersprache verknüpft.
IM GARTEN VON BADEN
meine Gehirn-
sporen in der Minderheit, Diaspora
Samen mit roten
Herzwellen Rosen,
zersplittertes
Ohr fast ohne
Fußwurzel
Ein typisches Beispiel für Friederike Mayröckers oftmals befremdliche Metaphorik. Hier sind zwei Bildbereiche (Mensch und Blume/Rose) miteinander verbunden, zwei Wesenheiten übereinandergeschoben, woraus eine neue, dritte Wesenheit entstanden ist; sie beschreibt sich nun selbst von Kopf (Gehirn/Sporen) bis Fuß (Fuß/Wurzel). Dazwischen werden mit Hilfe der Sinne und des Intellekts Bedeutungsketten aufgebaut: Samen – Sporen – Minderheit – Diaspora. Im Judentum ist ja die Tradition des Hörens stärker ausgebildet, während bei uns der Gesichtssinn allmächtig herrscht. Hier aber sind wohl beide Sinne gefordert: die Verbindung der Wörter läßt sich nicht nur denken, sondern auch hören und sehen. Die Literaturkritik geht langsam davon ab, Friederike Mayröcker auf eine „Progressivität der Sprache“ (Max Bense) einseitig festzulegen. In ihren langen Gedichten sind die drei Formen lyrischen Sprechens (konventionell, engagiert und beides im Wechsel) miteinander verschliffen. Und das geht nur, weil sie nebeneinander und miteinander bestehen dürfen und von der Autorin offenbar auch als gleichwertige Ausdrucksmittel anerkannt sind. Friederike Mayröcker hat den Zwang, Originalität über aufwendige Konstruktionen zu erreichen, lange schon hinter sich gelassen. Die Anstrengung der ‚Gedichtproduktion‘ ist nur selten spürbar, und das kann ja nur als Gewinn gewertet werden. Aber immer noch erwecken viele Gedichte den Eindruck des Fragmentarischen, Zusammenhanglosen – gerade die langen Gedichte. Es sind aber mehr Querverbindungen da, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Das Fremde, oftmals Hermetische dieser Dichtkunst rührt auch nicht primär vom Fragmentarischen her, auch nicht vom Experiment; ein Großteil des Gesamteindrucks ‚avantgardistisch‘ geht auf das Konto der Metaphorisierung, welche die Texte schwer zugänglich macht. „Ich mache einfach meine ganz eigene Sache.“
Lutz Hagestedt, Lesezeichen. Zeitschrift für neue Literatur und Kunst, Herbst 1986
Die Wunde Wahrnehmung
Wir alle wissen, was Glück ist: das, wonach wir uns am meisten sehnen, was uns am meisten fehlt. Der neue Gedichtband Winterglück von Friederike Mayröcker vereint in seinem Titel Unvereinbares – Winter bedeutet Kälte, Isolation, Schutzlosigkeit, Glück bedeutet Wärme, Geborgenheit, ein wohliges Sich-Recken und -Strecken, Winterglück ist eine Art unmögliches Glück „ist mir nicht zugedacht, jemand anderer an einem anderen Ort wird es wird dieses Gezwitscher Vogelstimme Stimme empfangen an meiner statt jetzt in dieser Stunde Sekunde.“
Der Band enthält 108 Gedichte aus den Jahren 1981–85, sein Kernstück sind die im Sommer 85 in Rohrmoos (Ennstal, Steiermark) entstandenen Gedichte, in denen präzise Naturbeobachtungen „ein Hang ein Honig ein Bienenschwarm“ und die Fragwürdigkeit der dichterischen Existenz „oder der stete Hang zur Verleugnung von Wirklichkeit?“ eine oft phantastische, oft erschreckende Verbindung eingehen.
Die schamlose Virtuosität, mit der Friederike Mayröcker ihr poetisches Instrumentarium einsetzt, wirkt ebenso anziehend wie abstoßend, beschönigt nichts, läßt keine falsche Idylle entstehen und ist alles andere als gefaßt oder besinnlich – Qualitäten, die dümmlicher Lyrik gern zugeschrieben werden (sonst wäre sie gar zu peinlich) – „jene finsteren Sonnen Seidenspinner in meinen mehreren Köpfen: sprießenden Tränen also winkt mir neu das Leben? mit Mücken im Dorngebüsch, mit Blüten mit Blut übersät fallen die Stare ein, das Blut, die Blüte des Grases im grünen, im sinkenden Sensenrausch.“
Der Psychiater Franz Wellendorf, der eine psychoanalytische Interpretation der Texte Friederike Mayröckers versuchte („Sprache, Schreiben und Aggression. Überlegungen zu Texten Friederike Mayröckers“), betont die ambivalente Reaktion, die er bei der Lektüre empfand – „… und mit zunehmender Vertrautheit riefen sie mir immer wieder – jenseits von Ambivalenz und erotisch-sinnlicher Phantasie – die Erinnerung an Gefühle, großer Verlassenheit und Verzweiflung und an Versuche, ihnen zu entkommen, wach.“
Friederike Mayröcker selbst ist sich der ambivalenten Reaktionen der Leser auf ihre Texte durchaus bewußt:
Je grundsätzlicher ich mich vom Publikumsgeschmack absetze, desto abstoßender wirke ich auf die Mehrzahl der Leser, desto verantwortlicher werde ich dafür, daß diese außer sich geraten, aber indem sie außer sich geraten, setzt sich andererseits etwas wie eine widersprüchliche Begierigkeit in ihnen fest, ich meine sie wollen dann weiterverfolgen was es gibt, kurz sie wollen mich verfolgen, sie sind mir auf der Spur, auf den Fersen, was wieder auf mich zurückwirkt… das ist eine alte Geschichte und eine alte Erfahrung, aber wir erleben es ja immer aufs neue, das Abstoßende ist anziehend und umgekehrt.
Dieser Verzicht auf Verstandenwerden, auf Einverständnis, auf Versöhnung, auf die Kumpanei des Realen mit der real existierenden Wirklichkeit ist die Grundbedingung der dichterischen Existenz. Leistet der Dichter diesen Verzicht nicht, verfällt er der Lüge, der Untreue sich selbst gegenüber.
Das Offenhalten der poetischen Wunde Wahrnehmung läßt 1.000 Augenblicke funkeln „in Nachbars Garten das Kind, mit einer Hacke läuft es – sein ächzender Blick, Raster des Pferdes und Raster des Rinds, gebeugt geht das Weidetier, sein Leib parzelliert nach Gütebereichen im Auslagenfenster des Fleischers“ und läßt unvermutet/unverhofft manchmal auch einen Augenblick des Glücks Wirklichkeit werden:
sanft ich schließe die Augen wie vom Meer strömt es, fächelt es mir ans Haar, an die Lippen, ich trinke vom warmen Bauch, jene leichte Brise von fern läuten die Weidetiere es weidet mich weidet mich aus, Dahlien, Phlox in den Beeten, aus dem Lattenzaun sprießen einzelne Halme, Kapuzinerkresse, Spitzwegerich, der untere Teil der Lärche befallen von Flechten, eine Ulme gibt auf.
Der Leser ist eingeladen, sich an diesem poetischen Lebensexperiment zu beteiligen.
Liesl Ujvary, Die Presse (Wien) vom 13. Dezember 1986
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Astrid Bergner: Toter Vogel in der heilsvergeßnen Welt
Die Neue Ärztliche, 11.11.1986
Maria Bosse-Sporleder: Lyrik im Gespräch
Badische Zeitung, 7./8.2.1987
B. v. M. [Beatrice von Matt]: Polyphones Dichten
Neue Zürcher Zeitung, 30.1.1987
Sibylle Cramer: In der Ferne ein Dichter
Frankfurter Rundschau, 3.1.1987
dr.: Sinnlicher Sog
Wochenpresse, 31.10.1986
Helmut Hein: Winterglück
Die Woche, 20.11.1986
IST [Ingrid Strobl]: Glückliches Österreich
Emma, Oktober 1986
Susanne Ledanff: Dennoch in Schüben das uneinnehmbare Paradies
Süddeutsche Zeitung, 11./12.10.1986
Gisela Lindemann: Zum Lesen empfohlen
Norddeutscher Rundfunk, 12.12.1986
Inge Meidinger-Geise: o. T.
Literatur und Kritik, Heft 211/212, Februar/März 1987
Burkhard Meier-Grolman: Ein Gedicht ist doch kein Fast-Food! Einige Anmerkungen zu Trends in der Lyrik-Szene
Südwest Presse, 9.2.1981
Susanne Mittag: o. T.
Hessischer Rundfunk, 4.7.1987
nks: Gedichte
Der kleine Bund, 11.10.1986
Marie Theres Nölle: Flug und Verharren
Zürichsee-Zeitung / Allgemeiner Anzeiger / Grenzpost, 4.7.1987
Peter Pessl: Winterglück: Neues von Friederike Mayröcker
Neue Zeit, 9.11.1986
Reinhold Tauber: Wie Reif auf letzten Blüten
Oberösterreichische Nachrichten, 30.12.1986
Ingeborg Teuffenbach: Grüne, grüne Erinnerung Baum: Mayröckers neue Natur- und Lebensstenogramme
Tiroler Tageszeitung, 6.11.1986
Alfred Warnes: Gedichte von Mayröcker und Kunze
Wiener Zeitung, 17.3.1987
ja es ist wieder Frühling, aber…1
– Über Friederike Mayröckers unermüdliche Fortsetzung sprachlicher Versuchsanordnungen. –
… ja es ist wieder Frühling, aber von jeder Bank schauen einen fünf Augenpaare an: unangenehmes Gefühl: die Strumpfnaht sitzt nicht, die Absätze an den Schuhen sind nicht tadellos, ob man meine vorgeneigte Haltung bemerkt, wohin soll ich im Vorübergehen schauen, vielleicht gibt es hier Leute, die mich kennen, nichts von mir halten, über mich spotten, mich auslachen, was macht man eigentlich mit den Armen und mit den Händen?
Mayröcker war eine Frau von dreißig, als dieser „Belvedere“-Text von ihr im Druck erschien; ihr erstes Buch hatte sie noch vor sich. Das war dann Larifari. Ein konfuses Buch, und Friederike Mayröcker mußte noch jahrelang ihren Doppelberuf ausüben: Schreiben neben dem Unterrichten, eine verflucht harte Geschichte das, ich kann mir ein Urteil erlauben: Meine Mutter war ebenfalls Lehrerin, und ich habe gesehen, wie das Menschen schaffen kann, die nicht dem Dienst nach Vorschrift obliegen.
Ein einziges Mal habe ich von Mayröcker, der, um es gleich loszuwerden, bedeutendsten lebenden deutschen, von mir aus deutschsprachigen, Dichterin, das Wort „Scheiße“ gehört; sie sprach vom „Scheißunterrichten“, bei dem sie sich ihre Stimmbänder ruiniert habe, und es wird ein Scheißunterrichten gewesen sein, im 10. Hieb, vierzehnjährige Rabauken an einer Hauptschule. Das sollte bedacht werden, wenn man an ihre imaginative Stimme denkt, die ebenso fragil wie fesselnd bei Lesungen die Zuhörer an sich heranzieht.
Im oben zitierten nun 40 Jahre alten Text ist Mayröcker schon voll zu erkennen: Die Themen der Beobachtung, Selbstbeobachtung, der Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung. Als ich 1979 nach Wien kam, für ein gutes Jahr, landete ich auf der Lerchenfelder Straße, fand eine gute Buchhandlung, die gerade ein paar Wochen zuvor aufgesperrt hatte, den Doktor Posch, und kaufte Heiligenanstalt (1978), die fiktiven KomponistInnen-Biographien. Ich ging in die Knie und wurde Mayröckerleser. An der Uni war ich ein bißchen eingeschrieben, hörte gelegentlich die superwitzigen Vorlesungen des Wendelin Schmidt-Dengler, erst sehr viel später erfuhr ich, daß zu dieser Zeit sich in dieser Umgebung auch literarische Spitzenkräfte wie Peter Waterhouse, Ferdinand Schmatz und Michael Donhauser aufhielten. Der Herr Privatdozent war so freundlich, mir ohne Umstände Mayröckers Telephonnummer zu geben. Und die trug ich noch bis an die vier Jahre herum, bis ich, auf Durchreise wieder einmal in Wien, vom Café Museum aus anrief.
Der Sprach- und Poesietheoretiker Roman Jakobson war in seinem wichtigen Aufsatz zur „Neuesten russischen Poesie“ (Prag 1921) der Ansicht:
Auskünfte von Zeitgenossen sind die einzig wertvollen Zeugenaussagen.
Und solch eine Zeitgenossenschaft finden wir in Friederike Mayröckers Dichtung. Wien, ihr Kontinent, wo sie bis auf einen Berlinaufenthalt um 1970, mit Jandl, lebte, wird ihr da zu klein. Wenn eines ihrer Gedichte einmal im Titel ein Wienthema zu versprechen scheint, wie „schöner Brunnen, Schönbrunn“ (in: Winterglück, 1986), so muß mit Doppelbelichtungen gerechnet werden, mit Bilokationen:
ach unratbar wie dein Herz riesig gelb lupend lumpend die
Wunderblüte Welt wie schwimmt gegen Mittag eben-orange, die
Bäume in Töpfen zwischen dem dunklen Laub leuchtend Zitronen, nie
sah ich es so nie sah ich ähnliches mir ans Herz, zwischen
Viale Buozzi einmal die römischen Gärten : zwischen Viale Buozzi
(Votivköpfe der Gärten des Hotels Byron) plötzlich die gelben die
goldgelben Früchte gesichtet, ich erstarrte, ich weinte Zitronenbäumchen…
Im späteren folgen grandiose Verse, die den babylonischen Hochbetrieb an solchen Örtern solchermaßen fassen:
… imaginäre Schmeichler
(Chimären), in allen Sprachen der Welt, so scheint es die Ausrufe,
Rufe, schreie, Gespräche – wer wagte da noch an die Deklassiertheit von
Sprachen zu denken, wer könnte solches behaupten, wie wenig beweglich
unser Gehör…
Ein metropolitaner Atem, der schnelle Atemschnitt, die Blickhetze finden, hochaufgeladen, in ihren Texten der 80er Jahre Niederschlag. Ich zitiere aus ihrem Gedicht „Abruf Knochen-Werk“ (Winterglück): „… vollgekarrt ein riesiger / Laster mit Buchsbaum und hohen Palmen durch den Morgenverkehr, ich / kann meinen Blick nicht lösen davon, die Gärten!, die Gärten!, aber / vermutlich für irgend republikanischen Festakt, Staffage…“, dann, weiter mit eminent filmischem Auge gesehen, ganz in der Vanitas-Tradition eines Abraham a Sancta Clara der Pestzeit:
… stehen
sie, schleppen sich, repetieren sich in rasenden
Wiederkünften, das rohe blutige Fleisch, wieder
ein UNIKAT mehr!, huckepack schleppend den halben
Ochsen vom parkenden Kühlwagen in den Lagerraum der Fleischerei, ich
sehe mit hoch erhobenen Armen den Fleischer als flehe er
um sein Leben, oder als gäbe er sich geschlagen, das blutende
Schlachtvieh um den Hals : eine gesprenkelte Boa, das blutende
Fleisch auf dem Rücken und über den Kopf gestülpt…
Ja, die Mayröcker gehört zu den Unikatkünstlern, und nicht zuletzt dieses Verdienst des unermüdlichen Fortsetzens von Versuchsanordnungen ist es, das ihr seit langem den Respekt von Autoren sichert, die gerade halb so alt sind wie sie, oder noch jünger. Sie hat viele beeinflußt, das stellt sich immer deutlicher heraus. Sie war ja schon eine Legende, als ich sie kennenlernte – Leute um die zwanzig spüren das ziemlich genau, „an die kommst du nicht ran“, hieß es, und in den 80ern hing in zahlreichen Wiener Szenelokalen die Panoramaaufnahme ihrer Wohnung in der Zentagasse, photographiert von Bodo Hell. Das muß man erst schaffen.
Auf meine, damals schon, naive Frage, weshalb sie den Büchnerpreis nie bekommen hätte, meinte die Dichterin, das läge wohl daran, daß sie irgendwann einmal Marcel Reich-Ranicki auf einer Party „nicht gegrüßt“ hätte; das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Schon in ihrer Hommage à Otto Wagner, „,Auseinanderstoszung‘“, einer 1971 geschriebenen kurzen Großstadtprosa (in: Fantom Fan) legt Mayröcker ein völlig unsiebzigerjahremäßiges Tempo vor; es ist dies der unsentimentale Wienverlust-Katalog:
Galeriestrecke Donaukanal, Inbetriebnahme mit periodischer Promenade, Stiegenabgang zum Treidelweg 68 (gibts auch Sonne in England? – dann standen wir auf einmal ganz nah Big Ben und über alle Brücken, auch St. Paul’s). Haltestelle Schottenring: blinds down? – (…) wenn ich Pekarek auf dem Weg zum Taxistand treffe, ist er meist scheu: hat seine Nordgrenze bei den Sängerknaben (…) Verhäuslichung von Ideen. Brücke über die Zeile: abgetragen; (…) Alser: abgetragen; Josef: abgetragen; Gürtel: abgetragen; Niveau: abgetragen; Zeile: abgetragen…
Auch hier ihre Überblendungstechniken, ihre Vorliebe für das Litaneihafte; „das Echo, zwischen den Wörtern“ (Die Abschiede, 1980). Auch in ihrem Gedichtband Das besessene Alter (1992) ist Friederike Mayröcker auf der Höhe ihrer Beobachtungs- und Sprachkraft, sie findet „das Unerwartete mit / bewegender Kraft“, sie tritt auf die Straße, das Gedicht startet durch:
und eingewindelt in ihre Miniröcke Bermudashorts
die jungen Frauen hochstöcklig behindert
der junge Neger zur Seite getreten seitlich zur Wand wie
um zu urinieren nämlich die Krawatte zu binden nämlich
für diese Intimität unter den Torbogen des Hauses getreten
sich meinen forschenden Blicken solchermaßen entzogen
schließlich in einer Mauernische hockend Schwall
von männlichem Schweiß das Scharmützel
im Lichthof oder karrenweise der Schutt das Unerwartete mit
bewegender Kraft: im Verschnitt der Sprache
im Parlandogebrauch.
Mayröcker nimmt es bekanntlich mit der Datierung ihrer Texte möglichst genau. In ihren Gedichtbänden – und das sind, schon vom Umfang, nun wirklich keine Bändchen, Bände sind das – sind die Entstehungsdaten im Inhaltsverzeichnis immer genau angegeben. Das eben angeführte Gedicht „Zeppelin oder Tropfen solch Formgeschöpf“ ist am 3.7.1990 entstanden, eine Fünfundsechzigjährige hat es geschrieben, und das ist dem Text ja nun doch nicht anzusehen. Gucken Sie sich dagegen die seicht-gravitätischen (lies: abgeklärten) Verse eines, heute, Gleichaltrigen an, sagen wir, eines Enzensberger. Da sieht der doch alt aus, finden Sie nicht?
Dazu kommt: Mayröcker ist eine meisterhafte Schreiberin von Naturgedichten, wohingegen man in Deutschland auf weiter Flur Sarah Kirschs ökotörtchenhafte Klassizismen für das non plus ultra zu halten scheint.
Abschließend aus demselben Buch eins ihrer zahlreichen Deinzendorf-Gedichte; Friederike Mayröcker, die bald wieder einen Gedichtband vorlegen wird und der ich reiche Weiterarbeit wünsche, hat es 1991 geschrieben. Es heißt:
Deinzendorf
grüne Montage oder
wo habe ich diese weißen Augen
schon einmal gesehen
bin kuckuckskrank bin knochenkrank
aber damals auf silbernen Schienen der Horizont
damals als da war dieses Birkenfest dieses
welkende Birkenfest über den Fluren Fronleichnam
über den grünenden Fluren wogenden Fluren
und ich ein Kind war unwissend
gesalbt
gesalbtes Kind und mein Auge tauchte ins
Blau des Himmels ins Flamingogewölk in
den Flug der Fahsanenschwärme Carree oder Bubenfrisur und lehnte
gegen das glyzinienbehangene Gartenhaus abermals
Klee und Schleppengehäuse Baldachin eines Morgens
nämlich geköpfte Tümpel und Geigengewitter
Faulwasser Mäusefigur die blassen
Schwertlilien vor den Fenstern ein blaues Konsilium oder Kaninchen
ums linke Auge die höchsten Wipfel
sind Safran offene Luken
Blume leger und heiterer Puppenarm
Thomas Kling, in Thomas Kling: Werke 4. Essays 1974–2005, Suhrkamp Verlag, 2020
BEIM WIEDERLESEN VON FRIEDERIKE MAYRÖCKER
Viola d’amore ich fegte
alle Weltraumnischen für dich
lasz uns selbander
wäldchenwärts gehn
über die Strichpunktbrückchen
mein Querschnitt
Krammetsvögelchen querschnittsgelähmtes
aus den Purpurgewässern
schönbogig
von der Seufzerschaukel
spucken wir in die wirbelsträhnigen
schwarzmäuligen Quarsarchen
wie
wenn wir später Quitten hineinwürfen?
ohne zu stillen in uns ertrügen
Sommerlaub Sommerlaub
sanfte Klistiere
komm aufs Stühlchen Käferkadaver
aufflügelt dieser Morgen;
groszflächig; dunstig; ganz still
ach Hamletin
laß mich dein Wallen-
steinchen sein
dein Geleefrüchtchen; Herzogin
abwärts die Helikonpfade
jet-
zund bis Schotenseptember
Margarete Hannsmann
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Zettels Träumerin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.2024
Michael Wurmitzer: Das Literaturmuseum lässt virtuell in Mayröckers Zettelhöhle schauen
Der Standart, 17.4.2024
Barbara Beer: Hier alles tabu
Kurier, 17.4.2024
Anne-Catherine Simon: Zuhause bei Friederike Mayröcker – dank Virtual Reality
Die Presse, 18.4.2024
Paul Jandl: Friederike Mayröcker: Ihre Messie-Wohnung in Wien bildet ein grosses Gedicht aus Dingen
Neue Zürcher Zeitung, 17.6.2024
Sebastian Fasthuber: Per Virtual-Reality-Trip in die Schreibhöhle der Dichterin Friederike Mayröcker
Falter.at, 9.7.2024
Fabian Schwitter: Von Fetischen und Verlegenheiten
Kreuzer :logbuch, Oktober 2024
Cornelius Hell: Kreuz und quer durch Mayröcker-Texte
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und die Dorfwelt
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und der heilige Geist
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und das Skandalon des Todes
relidion.orf.at, 20.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker ist der Frühling
relidion.orf.at, 21.12.2024
Martin Reiterer: Gegen den Strich gebürstet
Der Standart, 16.12.2024
Iris Radisch: Majestät am Campingtisch
Die Zeit, 18.12.2024
Bernd Melichar: Sie weidete in Poesie, sie war nicht von dieser Welt
Kleine Zeitung, 18.12.2024
Clemens J. Setz: Ihre Stimme macht alle Selbstgespräche tröstlicher
Süddeutsche Zeitung, 19.12.2024
Oliver Schulz: Darum war Friederike Mayröcker von Sprache besessen
Nordwest Zeitung, 19.12.2024
Lothar Schröder: Einfach mit Larifari beginnen
Rheinische Post, 19.1.2024
Bernhard Fetz: Zum 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker
hr2, 20.12.2024
Joachim Leitner: Wie Friederike Mayröcker in Tirol den Mut zum „Mayröckern“ fand
Tiroler Tageszeitung, 19.12.2024
Marie Luise Knott: Engelgotteskind
perlentaucher.de, 20.12.2024
„Königin der Poesie“: 100 Jahre Friederike Mayröcker
Der Standart, 2012.2024
Martin Amanshauser: Durch ihre Welt tanzen die Blumen, Tiere und Gedanken
Die Presse, 20.12.2024
Gerhild Heyder: „Der Tod ist mein Feind“
Die Tagespost, 20.12.2024
Paul Jandl: Vor hundert Jahren wurde Friederike Mayröcker geboren: eine Dichterin, die mit ganzem Herzen an das glaubt, was von oben kommt
Neue Zürcher Zeitung, 20.12.2024
Richard Kämmerlings: Unaufhörlicher Dialog mit Lebenden und mit Toten
Die Welt, 20.12.2024
Peter Mohr: Den Kopf verlieren
titel-kulturmagazin.net, 20.12.2024
Michael Denzer: „Haben 1 Gedicht im Kopf“
salto.bz, 24.12.2024
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
und Interview 1, 2, 3 & 4
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA + IMAGO +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


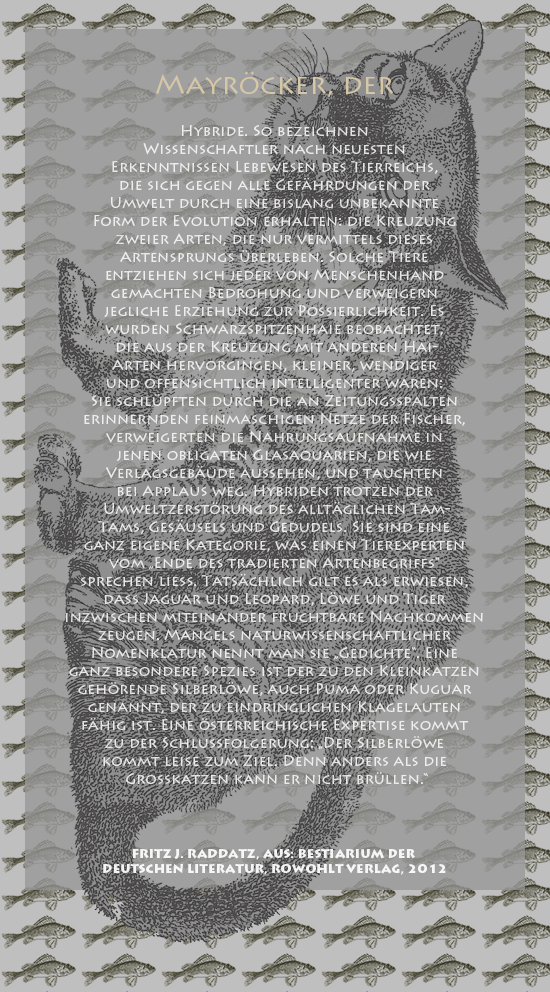












Schreibe einen Kommentar