Friederike Mayröcker: Tod durch Musen
WAHRSAGEN AUS DEN MORGEN-STUNDEN EINES HELLEN TAGES
beschritten und blau Enzianvergessenheit
Fenstersturz eines kleinen schilfbadenden Monokels
o traurige Osterblume Birkenbäumchen im Atlantik
Flügelschlag der Riesensonne Meer über
aaaaaMittagswellen
nur im Umkreis verlassene Stätten Häuser aus
aaaaaBlättermusik
I like the sunrise fis-dur die Fliederschatten zur Stunde
blütenverstreut bleichen dich Wassertauben sanfter Mond
Stagnation des Blutes in den Haupt-Straszen der Tauben
rein-leise durch den Septembertag hirsch-grün ins Weite
über die Hänge schlieszlich die Rebe: Immer-Stock
Nachwort
Friederike Mayröcker legt eigene Poesie aus 20 Jahren vor. Sie bezeichnet, was in diesem Band versammelt ist, als „poetische Texte“. Mit dieser Bezeichnung erhebt die Autorin – die wir trotzdem gerne eine Dichterin nennen werden – für ihre Texte den Anspruch auf Zugehörigkeit zu einer Gattung Poesie, die sich in Gegensatz stellt zur klassischen Poesie und sich von dieser als nichtklassische oder experimentelle Poesie unterscheidet. Dazu hat Friederike Mayröcker alle Berechtigung: Ist es doch erstaunlich, wie selbst ihre frühesten Texte, die man gegenüber den späteren „Reiz-Texten“ noch als „Erlebnis-Texte“ betrachten kann, bereits die für experimentelle Texte charakteristische Tendenz des Machens erkennen lassen. Eine Tendenz, die sich vermehrt fortsetzt bis zu den jüngsten Schöpfungen, sich dabei differenziert und so sehr verfeinert, daß sich schon aus diesem Grunde ein Nachwort mit einigen Hinweisen rechtfertigt.
Die Zugehörigkeit der Autorin zum wachsenden Feld der internationalen experimentellen Poesie – die zwar im Literaturbetrieb unserer Zeit immer noch eine inoffizielle Existenz zu führen hat – sei damit festgehalten. Ja, es sei auch allen weiteren Festhaltungen die Prophezeiung vorweggenommen, daß Friederike Mayröckers Textband mindestens in diesem Feld der grauen Eminenzen unserer Literatur einer der Stützpunkte bleiben wird, in denen sich die reinen Ausbildungen bestimmter Möglichkeiten der experimentellen Poesie deutlich aufzeigen lassen. Vielleicht darf an die Veröffentlichung ihrer Texte sogar die Hoffnung angeknüpft werden, daß dadurch auch Kreise, die dem experimentellen Schreiben weder Geschmack noch Verständnis abzugewinnen vermochten, sich zu eingehenderen Betrachtungen von „hergestellten“ Texten anregen lassen. Der Fall Mayröcker ist dazu besonders geeignet. Denn er liegt günstig im allgemeinen Kulturfahrplan.
Der Weg durch diese 20 Jahre „poetische Texte“ führt von frühen, erlebnismäßig geprägten sprachlichen Gebilden zu jüngsten, welchen Reiz und Reflex eine bestimmte Beschaffenheit verursacht haben. Entsprechend ist festzustellen, daß das Erlebnis-Ich der Dichterin, das anfangs – auch in der Mein- und Dein-Form – eng selbstbezogen gewertet werden kann, in zunehmendem Maße verschwindet oder gelegentlich noch als Zitat erscheint. Und entsprechend ist festzustellen, daß das einfache Sagen der frühen Texte, das fast ohne Interpunktion auskommt, sich in den jüngeren Texten zu faserigen, nervigen Wortfolgen ausgebildet hat, die von wahren Feuerwerken der Interpunktion gerastert, unterteilt, geballt und gleichzeitig beredt interpretiert werden. Nie mehr seit E.E. Cummings ist man so sehr auf die Verwendung und die Funktion der Interpunktion aufmerksam gemacht worden wie heute durch das Werk der Wiener Autorin. So wird man etwa gewahr, daß das Fehlen der einfachen Satzzeichen wie Beistrich und Satz-Schlußpunkt dem Willen zur Vermeidung „einfacher Sätze“ durchaus entspricht. Anstelle der einfachen Satzzeichen häufen sich dafür der Strichpunkt, die Klammer, das Ausrufezeichen, der Gedankenstrich, der Trennungs- oder Verbindungsstrich, der Doppelpunkt, die Auslassungspunkte und schließlich mehr und mehr der Schrägstrich. Faßt man den Strichpunkt – ein typographisch an und für sich wenig hübsches, etwas zwitterhaftes Zeichen – als starken Gliederer bei mehrfach zusammengesetzten Sätzen ins Auge, beginnen allein schon die „Bilder“ der jüngeren Texte sich vielversprechend zu äußern. Die Struktur der Texte wird auch visuell markant.
Der Weg durch die zwei Jahrzehnte „poetische Texte“ wird aber vor allem gekennzeichnet durch Merkmale, die festzuhalten sich besonders die Begriffe der experimentellen Poesie, wie sie Max Bense entwickelt hat, eignen. Denn wenn bisher zwar auf offensichtliche Merkmale der Wandlung hingewiesen wurde, so ist es doch notwendig zu präzisieren, daß es sich um Änderungen im Bereich einer Poesie handelt, in welcher das Herstellen von Texten das Anwenden von Sprache überwiegt. Auch die „Erlebnis-Texte“ von Friederike Mayröcker – und was immer als Erlebnis-Spur durch ihr Werk geht – sind letztlich Zeugen für diese Poesie, die immer wieder an ihrer sprachlichen Eigenwelt interessiert ist und sich an ihre sprachliche Struktur zu erinnern scheint. Mag sich gerade in den frühen Proben die außertextliche Objektwelt hin und wieder sentimentalisch der Sprache bedienen, so melden doch gleichzeitig einige Schreibtechniken – Wiederholung, Anhäufung gleicher Elemente, aber auch erste überraschende Selektionen – die Verpflichtung der Autorin gegenüber bewußten Herstellungsvorgängen des Schreibens an.
So scheint nicht selten die Herstellung eines Textes absichtlich auf das Erzielen hoher Überraschungswerte, in Vereinigung mit einem außergewöhnlich reichen Vokabular, ausgerichtet zu sein. Dadurch werden bereits auch in diesen frühen Texten die Folgen solcher Entscheidungen sichtbar: Die Häufigkeit, mit welcher Textereignisse eintreten, ergibt lineare Kompositionen von überraschenden, ja bizarren Nachbarschaften. Um ihre Juxtaposition noch deutlicher zu machen, tritt der Strichpunkt in Kraft.
Es ist in der Folge höchst aufschlußreich, die Entwicklung einer Schreibweise zu beobachten, die man mit Recht eine ästhetische – und das heißt auch eine intellektuelle – Schreibweise nennt. In den zwei Jahrzehnten ihres Schaffens hat Friederike Mayröcker damit mehrfach den Beweis erbracht, das die experimentelle Poesie alles andere als langweilig und trocken ist – was man ihr oft vorwirft –, daß im Gegenteil auch ihre Texte den Reichtum gemalter Fensterscheiben besitzen können: Fensterscheiben allerdings, auf deren Struktur ein bedeutender Teil der ästhetischen Information übertragen worden ist. Wir bewundern die Struktur dieser Texte wie wir die leichte Schönheit von Seifenblasen bewundern, die ihre Umwelt spiegeln und die durch ihre „Zerbrechlichkeit“ unsere Sinneslust und unsere Sensibilität über alles zu steigern vermögen. Wir bewundern aber vor allem die reifen Texte, in denen die Erfindungen bunter metaphorischer Abläufe Durchblicke ermöglichen in die Sphäre der Werte, in denen sich die Kräfte des Bauens und die Kräfte der Verflüchtigung, in sprachliche Elemente gebannt, die Waage halten.
Eugen Gomringer, Nachwort
Dieser erste große Sammelband
der Lyrik Friederike Mayröckers erschien 1966 in einer begrenzten Auflage; der Band enthält Gedichte aus dem Zeitraum von 19145 bis 1965. Gerade an diesem Buch „erkennt man, wie wenig die Landschaft der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur in Wahrheit abgesteckt ist. Einer der wichtigster Versuche, Methoden des Surrealismus wie der konkreten Poesie gleichermaßen fruchtbar zu machen, würde fehlen, kennt man das Opus dieser Autorin nicht“. (Helmut Heißenbüttel)
Der Zyklus von 1965 Tod durch Musen, nachdem der ganze Band benannt ist, steht gleichsam als Motto vorweg. Die Autorin setzt sich damit ausdrücklich ab von den verstaubten Gipsfiguren des 19. Jahrhunderts, das in Wien sowohl in der Architektur wie im Kulturleben deutlich präsent ist. Der Untertitel des Bandes, Poetische Texte, bezeichnet als Oberbegriff alle Arbeiten, die früher datierten, die man noch Gedichte nennen kann, und die neuen und neuesten, an die man die herkömmlichen Maßstäbe, die durch Wörter wie „Gedicht“ oder „Lyrik“ beschworen werden könnten, nicht mehr anlegen darf. (Gerald Bisinger).
Friederike Mayröckers eigene Sprache hat hier eine Dimension erreicht, die vor den ausartikulierten Satzgebilden liegt und deshalb in jedem Augenblick eine Fülle latenter Möglichkeiten anzubieten hat. Es ist das Geheimnis dieser poetischen Texte, daß sie dennoch in einer schwer beschreibbaren Weise kohärent sind. Ein Lyrikexperte würde vermutlich seine Zuflucht bei Bezeichnungen wie „Montage“ oder „Assoziationenstil“ suchen. – Montage und Assoziationsfuge sind wichtige und unentbehrliche Prinzipien der modernen Lyrik, aber es gehört ein sehr disziplinierter Kunstverstand dazu, sie richtig einzusetzen – Friederike Mayröcker verfügt über diese Disziplin und Zurückhaltung, die einem Gedicht erst Konsistenz verleiht. (Beda Allemann)
Spielräume der Bedeutung oder der Bedeutungsvarianten, Bedeutungsmöglichkeiten öffnen sich gegen den Leser, der hier, wie an anderen Texten neuerer Literatur, durchaus aufgefordert ist, das Repertoire seiner selbständigen Erfahrung miteinzusetzen. (Helmut Heißenbüttel)
Auf jeden Fall: eine Lektüre, nur denen anzuraten, die willens und fähig sind, Sprache als Abenteuer zu erleben. Ihnen jedoch sei Tod durch Musen angelegenlichst empfohlen. (Kurt Marti)
Luchterhand Verlag, Klappentext, 1973
Tod durch Musen
Als 1952 bei einer Tagung der Gruppe 47 mehrere jüngere österreichische Schriftsteller auftraten, schien der Zugang zur Nachkriegsgeneration dieses zweiten deutschsprachigen Landes gefunden. Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Paul Celan, um nur diese drei stellvertretend zu nennen, wurden „deutsche“ Schriftsteller. Inzwischen hat sich gezeigt, daß vielleicht gerade dadurch der unmittelbarere Kontakt zur österreichischen Nachkriegsliteratur verdeckt wurde.
Nun gut, daß Hans Carl Artmann eine der entscheidenden Figuren der deutschen Nachkriegslyrik ist, hat sich 1969 wohl herumgesprochen. Die Wiener Gruppe mit Bayer, Rühm, Achleitner und Wiener nimmt ihren Platz in der Chronik der avantgardistischen Bewegungen ein, jeder für sich versucht sich zu behaupten. Erich Fried, der auch in London Österreicher geblieben ist, hat sich durchgesetzt. Der altehrwürdige Gütersloh, Initiator der ersten Nachkriegsgruppierung, ist ein Begriff geworden. Zuletzt kam Ernst Jandl dazu. Und schließlich, überraschend, Friederike Mayröcker.
Gerade an dem jetzt bei Rowohlt erschienenen Sammelband ihrer Lyrik, Tod durch Musen, der Arbeiten aus dem Zeitraum von 1945 bis 1965 enthält, erkennt man, wie wenig die Landschaft der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur in Wahrheit abgesteckt ist. Einer der wichtigsten Versuche, Methoden des Surrealismus wie der konkreten Poesie gleichermaßen fruchtbar zu machen, würde fehlen, kennte man das Opus dieser Autorin nicht.
Friederike Mayröcker ist, laut Verlagsprospekt, 1924 geboren und lebt als Lehrerin in Wien.
Wie dem Nachwort von Eugen Gomringer zu entnehmen ist, unterscheidet Friederike Mayröcker Erlebnis-Texte und Reiz-Texte. Erlebnis-Texte, das sind wohl vor allem die Gedichte von 1945–50, sie sind Ausdruck eines Subjekts, das Ausdruckswollen bestimmt die Formulierung:
Hellrote Hortensien und
ein ununterbrochener Wind
der Liguster duftet
meine Fenster sind verhängt
mit Lanzen
oben im Weißen: Claude Debussy blaue Zikade
geborstene Dachstühle
die Erdbeeren blühen
Nach 1950 ändert sich etwas. Die Aussagen und Bilder werden in sich unabhängiger, fremder, verlieren den unmittelbaren Bezug zum leidenden Ich. Bild- und Lautanklänge beginnen sich zu mischen.
Die Gedichte der letzten fünf Jahre bringen dann das eigentlich Neue und Überraschende. Ihre Kennzeichnung als Reiztexte besagt zunächst nur, daß dem Reiz der Wörter, Wortgruppen, Sätze und Satzbruchstücke mehr zugetraut wird als dem möglichen Kausalzusammenhang oder einer an Inhalt gebundenen Logik. Die Aussagen oder Aussagenreste werden auf ihren Reizwert hin abgehorcht und danach zusammengestellt. Dieser Reiz kann reminiszenzhaften, assoziativen oder rein klanglichen Charakter haben. Oft wirkt alles das zusammen. Unter- und Obertöne schwingen mit. Der Raum an Unbestimmtheit, den inhaltlich oder gedanklich nicht ganz eindeutig eingebundene Sprachstücke haben, wird stehengelassen, zur Mischungszone umgedeutet; Spielräume der Bedeutung oder der Bedeutungsvarianten, Bedeutungsmöglichkeiten öffnen sich gegen den Leser, der hier wie an anderen Texten neuerer Literatur, durchaus aufgefordert ist, das Repertoire seiner selbständigen Erfahrung miteinzusetzen. In einer geläufigeren Terminologie könnte man diese Gedichte als Montagen bezeichnen. Montagen, die sich der stehengebliebenen, der aufleuchtenden oder der weggeworfenen Sprachstücke bedienen wie der Hersteller von Materialbildern oder Assemblagen der Materialien, aus denen er seine Gebilde zusammensetzt. Reiz hat dabei auch das völlig Unentzifferbare, Fremde, Rätselhafte. Ja, vielleicht könnte man sagen, daß diese Gedichte da ihren höchsten Rang erreichen, wo sie ganz undurchdringlich, mit nichts als dem vielfach facettierten Gepränge ihrer Wörter dem Leser entgegentreten.
Freilich nur für den Moment des ersten Anblicks undurchdringlich. Denn dringt man in den Sprachraum des Gedichts ein, erfährt man sein ihm eigenes Gesetz, einen strukturellen Zusammenhang, der anzieht, anverwandelt. In den Echoräumen dieser Sprachgitter öffnet sich der Reiz zu Perspektiven halluzinativer Verwandlung. Die Andeutungen, Anklänge und Anerinnerungen summieren und überlagern sich, bis am Ende das ganze Gebilde wie etwas dasteht, das alle seine Elemente simultan zur Verfügung hält. Im Vollzug und Nachvollzug seiner so gebildeten Sprachgestalt bleibt es, vollzogen, jeder Zeit wiederum auflösbar und neu zusammenzusetzen. Friederike Mayröcker hat in diesen Gedichten, die sie Reiztexte nennt, entscheidend dazu beigetragen, einen neuen Typus von Lyrik zu bestimmen, dem mit den Kriterien des romantischen Gedichts nun endgültig nicht mehr beizukommen ist.
Helmut Heißenbüttel, Süddeutsche Zeitung, 17.11.1966
(Erschienen zur Erstausgabe)
Friederike Mayröcker: Tod durch Musen
Wohl bei keiner literarischen Gattung hat es soviele Ausweitungsversuche in den letzten 70 Jahren gegeben wie bei der Lyrik. Mallarmés Spätwerk bereits weist auf einen Typus, der kaum noch in den überlieferten Kriterien vom Gedicht erfaßt werden kann. Strophe, Metrum, Reim, Metaphorik im engeren Sinne, all das scheint beiläufig zu werden. Zwar ist das Gedicht, wie es den traditionellen Gesetzen entsprach, nicht ausgestorben. Aber die Zersetzungen des Futurismus, die Irritationen des Dadaismus und des Surrealismus oder die neueren der sogenannten konkreten Poesie, die Konzepte eines Ezra Pound, Edward Estlin Cummings oder Francis Ponge sind nicht ohne Spuren und ohne Folgen geblieben. Das Gedicht, wenn man denn diesen Namen beibehalten will, ist etwas anderes geworden, etwas, das man kaum schon definieren kann, aber dessen Offenheit unbeschränkt ist.
Dies soll voraufgeschickt sein dem, was ich zu einem jetzt neu erschienenen Gedichtband sagen möchte. Es soll voraufgeschickt Sein nicht als Erklärung oder Entschuldigung oder Hinleitung, sondern als eine Voraussetzung, über die man sich immer wieder noch einmal verständigen muß.
Die Verfasserin dieser Gedichte heißt Friederike Mayröcker. Sie ist Österreicherin, veröffentlicht hat sie seit 1948, also fast ebenso lange wie ihre bei uns weit bekanntere, wenn auch konventionellere Landsmännin Ingeborg Bachmann. Obwohl bei den Avantgardisten Wiens (und auch darüber hinaus) seitdem bekannt und von ihnen geschätzt, tritt Friederike Mayröcker mit dem jetzt erschienenen Band zum ersten Mal mit einer Publikation an die Öffentlichkeit, die einen umfassenden Begriff von ihrer Arbeit gibt. Das Buch heißt Tod durch Musen; poetische Texte. Es enthält 74 Gedichte (wenn man die einleitenden 8 Anrufungen an die Musen mit dem Titel des Bandes als eins rechnet), geordnet in 4 Abteilungen nach ihrer Entstehungszeit. Sie stammen aus einem Zeitraum von 20 Jahren, dem Zeitraum zwischen 1945 und 1965. Eugen Gomringer, einer der Begründer der konkreten Poesie und ihr Schweizer Repräsentant, schrieb das Nachwort. Das Buch erschien im Rowohlt Verlag in Reinbek bei Hamburg.
Tod durch Musen lautet der Titel. Er deutet bereits an, was irritieren kann. Wäre nicht, in der Abkehr von traditioneller Lyrik, zu erwarten, daß auch diesen antiken Gottheiten der Laufpaß gegeben wird? Kann man, indem man sie herbeizitiert, etwas aussagen? Kann man durch sie sterben? Oder was anders soll der Titel bedeuten? Ich lese das achte Teilstück des Titelgedichts:
den reptilismus der musen
anzweifeln
archaisch verschleudern/tanzschritte
im „metropol“
petro-chemie mit purpurrotem kamm
rothaarig
braunrückig
purpurwangig
purpurfüszig
von rosen rot
abtasten/aufheben/straucheln
– zu sterben
tod durch musen
Mit diesen Sätzen, Halbsätzen und Einzelwörtern wird Euterpe, die Muse des lyrischen Gesangs, gerufen. Kann man etwas dazu sagen, wörtlich interpretieren? Was bedeutet: den Reptilismus der Musen anzweifeln? Sind die Musen Reptilien? Sollte man bezweifeln, daß sie Reptilien sind? Wie kommt es dann zu dem nachfolgenden archaischen Verschleudern? Sollen die reptilischen Musen verschleudert werden, oder das, was sich aus dem Zweifel an ihrem Reptilismus gewinnen läßt? Wie stehen dazu die Tanzschritte im „Metropol“? Sind sie der Ausdruck des Verschleuderns, Folge des Zweifels am Reptilismus der Musen? Aber es wird noch verwirrender. Das nächste Wort heißt Petrochemie, es bezeichnet einen Spezialzweig der chemischen Industrie, ursprünglich auf Produkte bezogen, die aus Kohle und Braunkohle gewonnen werden, heute allgemeiner auf Chemikalien, die auf Rohölbasis entwickelt werden. Was hat dieses Wort mit den Musen zu tun? Ist es nur ein Kontrastbegriff aus der industriellen Welt? Warum hat die Petrochemie einen roten Kamm wie ein Hahn, ist sie eine Metapher, eine Metapher für was? Aus dem roten Kamm wird ein: rothaarig. Darauf folgt, kontrastierend, nuancierend: braunrückig, purpurwangig, purpurfüßig und schließlich wie ein abgekürztes Zitat aus einem vergessenen Volkslied: von Rosen rot. Sind die Musen, ist Euterpe rothaarig, braunrückig, purpurwangig, purpurfüßig, von Rosen rot? Das wäre romantisch. Aber wäre es nicht auch zu einfach? – Auf diese Assoziationskette folgen drei Infinitive: abtasten, aufheben, straucheln. Sie stehen in einer gewissen Parallele zum anzweifeln der zweiten Zeile; oder: man ist versucht, sie mit den vorhergehenden Infinitiven in Verbindung zu bringen. Der Infinitiv erweitert eine Rede, die in der ersten Person Singular geführt wird, ins Anonymere. Die Infinitive stünden etwa statt: ich taste ab, ich hebe auf, ich strauchle. Und rückwirkend könnte man einsetzen: ich zweifle den Reptilismus der Musen an, ich verschleudere archaisch. Macht diese Transposition den Zusammenhang deutlicher? Ist es ein solcher Zusammenhang, der gemeint ist, ein Zusammenhang, der auf der Basis eines deutlich erkennbaren, reagierenden Ich steht? Auf die Infinitive: abtasten, aufheben, straucheln folgt ein weiterer, der nicht in die erste Person Singular zurückprojiziert werden kann, da er durch den Zusatz des Wörtchens zu ganz in seinen grammatischen Zustand festgelegt ist: zu sterben. Und dann folgt der Titel des Gedichts, hier pointiert abgesetzt: Tod durch Musen. Kann man den Anschluß so herstellen, daß man sagt: Jeder hat zu sterben, aber wenn das schon so ist, dann am besten einen Tod durch Musen wählen, den unaufhaltsamen und ständigen Verlust an Gegenwart, die unaufhörliche Verringerung der Zukunft, wenn sie schon nicht aufzuhalten sind, dann verwandeln in Kunst, archaisch verschleudern (um eine frühere Zeile aufzunehmen), noch aus Rohöl Kunst gewinnen, rothaarig, braunrückig, purpurwangig, purpurfüßig, von Rosen rot?
Ich habe die Befragung der wenigen Zeilen von Friederike Mayröcker absichtlich so penetrant durchgeführt und absichtlich am Ende übertrieben, um zu demonstrieren, was man überhaupt fragen kann. Es ist deutlich geworden, daß eine strikte Befragung auf den Symbolgehalt hin sich selbst ad absurdum führt. Das, was sich allenfalls symbolisch hineinlegen ließe, steht in Wahrheit nicht da.
Eine weitere Möglichkeit muß abgewehrt werden. Es handelt sich nicht um eine poetische Verkettung von Bildvorstellungen, die gegen ihre grammatische Logik und ihre Bedeutungslogik zu einer quasi neuen Realität, einer Surrealität zusammengefügt werden. Es handelt sich nicht um die fahnenflüchtigen Engel oder die belegten Brotherren oder die riesigen jüdischen Schmetterlinge, wie sie etwa Hans Arp erfunden hat. Die Wörter und Sätze Friederike Mayröckers sind schon wörtlich zu nehmen, vokabulär, wenn man so sagen kann. Nicht eine Bildassoziation, Bildprovokation, die durch das Wort in Gang gesetzt wird, ist gemeint. Das Wort, die Vokabel, wird als sie selbst für wahr, für Realität genommen. Das entspricht einem der Programmsätze der konkreten Poesie. Aber was ist das Wort, was ist Sprache als sie selbst, als Realität an sich?
Das Entscheidende ist nicht in der Isolierung dieses Ansicht zu sehen, sondern in der Frage nach der Priorität, nach der Einstufung, – lange Sprache als Mittel erscheint, vermittelt sie Sachen, entweder um etwas mitzuteilen oder um etwas auszudrücken, die Sache hat den Vorrang, die Sprache dient. Auch in der Dichtung. Kehrt man das Verhältnis jedoch um und gibt den Wörtern, den Namen und den Sätzen den Vorrang, so wird die Realität der Dinge, der Fakten, der Aktionen, der Gefühle immer erst da real, wo sie der Sprache folgt. Sprache provoziert erst Sachen, ihre Verdoppelungsfunktion ist es, die Priorität hat (oder haben kann, wenn man sich darauf einstellt).
So etwa müßten die Voraussetzungen für die Lyrik Friederike Mayröckers lauten. Die Vokabel Reptilismus, einem zoologischen Bereich entstammend, wird der Vokabel Musen und der Vokabel anzweifeln entgegengesetzt. Muse stammt aus einem mythologisehen Bereich, anzweifeln gehört in eine psychologische oder juristische Kategorie. Archaisch ist noch einmal mythologisch, aber auch einem ästhetisch-historischen Bereich zugehörig. Verschleudern ist nicht strikt festzulegen. Metropol bedeutet zweifellos ein Lokal. Petrochemie wurde schon erklärt. Undsofort. Es ist jetzt zu erkennen, daß die Wörter und Sätze sich nicht in einem logischen oder symbolischen Bedeutungszusammenhang aneinander anschließen (obwohl logische und symbolische Aufschlüsselung von ferne wie ein Echo mitklingt), sondern daß sich mit den Wörtern die Bedeutungssphären, aus denen sie stammen, ihre Kategorien, aneinander anschließen und daß erst deren Vermischung den Zusammenhalt gibt. Die Priorität der Sprache öffnet die Möglichkeit, nun wirklich und entschieden jene Alchemie der Sprache zu betreiben, von der Imagisten und Expressionisten vor fünfzig Jahren schon träumten. Auf welche Weise? Abtasten, aufheben, straucheln, heißt es, diese Infinitive stehen auch für die Tätigkeit, so könnte man sagen, in der dies Gedicht gemacht wird.
Friederike Mayröcker hat es, wie der Gedichtband ausweist, in zunehmendem Maße zu einer großen Meisterschaft in dieser Tätigkeit gebracht. Die frühen Gedichte sind relativ einfach, sie selbst nennt sie „Erlebnis-Texte“, aber obwohl dieses Erleben durchschimmert, sind auch sie schon auf die Priorität des Sprachlichen ausgerichtet. Von einem bestimmten Punkt an hört das auf. Die „Reiz-Texte“, wie die Autorin sagt, bestehen in sich selbst. Reiz bedeutet das Ansprechen der Zugehörigkeitsbereiche und Kategorien von Einzelwörtern und Wortgruppen; in deren Alchemie schmilzt der Text zum Ganzen zusammen. Je weiträumiger und komplexer die Texte werden, umso stärker wird dieser Reiz auch vom Zitatcharakter bestimmter Wortgruppen, Satzbruchstücke getragen. Es wird nicht nur auf das Mitgesagte des Einzelwortes verwiesen, sondern auf ganze vorgeprägte Sprachbereiche. Die Texte bilden weitmaschige Muster aus mit vielfältigen Bezügen in sich selbst; eine eigentümliche, rondoartige, doch auch ganz flexible Rhythmik bildet sich aus. Die Titel, indem sie ein sozusagen zentrales, überraschendes Reizwort als Ausgangspunkt setzen, gewinnen neue Funktion. Reiz heißt, gerade von den Titeln her gesehen, auch, daß der sinnliche Effekt der Vokabeln deutlicher, schmeckbarer, ja aggressiver gemacht wird. Die Textur der Gedichte Friederike Mayröckers hat eine starke sinnliche Qualität.
So bleibt mir zum Schluß nur zu sagen, daß ich diesen Gedichtband für einen der originellsten und anreizendsten seit Jahren halte. Ich halte die Gedichte nicht nur für sehr gut, ich habe auch, nachdem ich anfängliche Schwierigkeiten überwunden habe, ein ununterbrochenes Vergnügen an ihnen.
Helmut Heißenbüttel, Westdeutscher Rundfunk 3, 11.11.1966, aus Helmut Heißenbüttel: Zur Lockerung der Perspektive 5 x 13 Literaturkritiken, Wallstein Verlag, 2013
(Erschienen zur Erstausgabe)
Wiener Cantos
Die poetischen Texte der Wiener Dichterin Friederike Mayröcker, die unter dem Titel Tod durch Musen bei Rowohlt (Reinbek b. Hamburg, 1966) gesammelt wurden, stellen die Ernte von zwanzig Jahren vor. Sie sind zwischen 1945 und 1965 entstanden. Da Friederike Mayröcker 1924 geboren wurde, bedecken sie rein biographisch den Zeitraum von der Erreichung der Volljährigkeit bis zur Lebensmitte. Betrachtet man die äußeren Welterscheinungen, so bilden der Zusammenbruch von Hitlers Armeen, Flüchtlingszüge, Gefangenentransporte, Schwarzmarktgefeilsche, Besatzungssoldaten, Zonenbegrenzungen, Sartre, Brecht, der Krieg in Korea, die Mauer von Berlin, die Panzer von Budapest und die Toten von Vietnam den zeitlichen und stimmungsmäßigen Hintergrund, vor dem die Seelenlandschaft der Dichterin aufgebaut wird.
Die Texte der Mayröcker sind immer und zuerst „Erlebnistexte“. Dieser Erlebnischarakter eignet auch noch den späteren Texten, die Eugen Gomringer als „Reiztexte“ verstanden wissen will. Wir werden im folgenden diesen Gegensatz dadurch zu bewahren suchen, daß wir von „erfahrungsbewirkten“ und „reizbewirkten“ Erlebnistexten sprechen. Es soll freilich nicht verschwiegen werden, daß auch diese Unterscheidung behelfsmäßig und keinesfalls „deckend“ ist. Die Übergänge zwischen den beiden Textgattungen sind selbstverständlich fließend. Wir dürfen jedoch hoffen, daß diese Unterscheidung uns helfen wird, dem Phänomen des Mayröckerschen Textes näherzukommen.
Der Text „zu fünf gleichen traurigen Trommelschlägen top-top-top-top-top“ mag in seiner charakteristischen Mischung aus „zeitgebundenen“ und „nicht zeitgebundenen“ Erfahrungen als Beispiel für einen „erfahrungsbedingten“ Text gelten. Ganz am Anfang steht eine Bildungserfahrung „Péguy’s Trommelschläge gegen den Himmel“, dann schiebt sich „Paßkontrolle“ zwischen „Mond“ und „Regen“. Auf „Kirkenes“ folgt alsbald ein Zitat aus „Mine eyes have seen…“, „Träume vom Kreml“ werden durch die „burschikosen Dreißigerjahre im Anmarsch“ gestört. Es folgen die „schauerlichen Vigilen zwischen 42 und 45“ – Erinnerungen an die Kriegsjahre, welche die Dichterin nach ihrem eigenen Zeugnisse „wie hinter einem Schirm, der alle Wirklichkeit abdeckte“, verbrachte. Die Erfahrungen und Erlebnisse der Kindheit und frühen Jugend sind in den Texten der Mayröcker immer gegenwärtig. Sie nennt die Entdeckung: „Ich schreibe meine eigene Poesie“ das ungeheure Erlebnis ihrer Kinderjahre. Dieses Schreiben der „eigenen Poesie“ wird in einem Exaltationszustand geübt, den Friederike Mayröcker „die Äußerste Spitze“ nennt, ein „Zustand des Dichters, der im Vollbewußtsein seiner Kraft ein Gedicht schreibt“. Sie ist dann „alles begreifend“ und kennt die geheimen Schmerzen der Mitbrüder. Diese „Äußerste Spitze“ hat offenbar manches mit dem „Vortext“ von Ezra Pound gemein. Auch sie ist ein „Punkt maximaler Schwerkraft“, in dem der „primäre Werkstoff“ (Erlebnisse, Erfahrungen) seine Formung erhält.
Bei dieser Formung wird zu den verschiedensten Stilmitteln gegriffen. Friederike Mayröcker spricht von „ästhetischen Verdichtungs- und Verdünnungszonen“, vom „Aufladen, Atomisieren und Deformieren“ des „Wortmaterials“. G.M. Hopkins, der Konvertit von Oxford, der wahrscheinlich auf dem Umweg über Pound und Eliot das rhythmische Empfinden der Friederike Mayröcker wesentlich geformt hat, postulierte die Forderung nach der „Ingestalt“ (inscape) der Rede, welche die Dichtung „zu tragen“ habe. „Wiederholung, Verhäufigung (oftening), Wieder- und wiedersetzen (over-and-overing), Nachsetzen (aftering) der Ingestalt dienen dazu, diese dem Geist einzuprägen.“ (Die Übersetzung der Termini von Hopkins wurde nach Hermann Rinn zitiert.) Friederike Mayröcker verwendet alle von Hopkins empfohlenen Wirkungsmittel, um ihre „Verdichtungen“ und „Verdünnungen“ zu erzielen. Vor allem das „over-and-overing“ ist ein charakteristisches Mittel ihrer Aussagetechnik. Im „Register zu den geheimen Schmerzen der Mitbrüder“ wird der Begriff „Vergipsung“ in den verschiedensten Zusammenhängen immer wieder von neuem in den Text eingeführt. Er charakterisiert offenbar einen Zustand, der manche Parallelen zur „Verschimmelung“ des Malers Hundertwasser aufweist.
Die „Aufladung“ des Wortmaterials, die sich sehr bewußt der Stilmittel von Collage, Montage und Assemblage bedient, erzeugt jenen „Reiz“, den Eugen Gomringer als charakteristisches Element der späteren Mayröcker-Texte empfindet. Dieses Reizelement scheint für ihn den Erlebnisgehalt der Texte zu überdecken. Es werden durch ein Reizwort Assoziationsketten erzeugt, die sich gleichsam wuchernd fortzusetzen scheinen. Im Text mit den langen Bäumen des Webstuhls, einem „reizbewirkten Erlebnistext“, werden diese Assoziationsketten, welche die späteren Texte vielfach bestimmen, freimütig beim Namen genannt: „& alles assoziationen & / die hälfte des gesamtwerks & emphase?“ Da wird der „Alster“ die Aster assoziiert und an die „blaue gebrochene Alster“ das „Unterbrechen“ geknüpft. Diese Elemente setzen sich durch das ganze Gedicht fort, reichem neue assoziative, aus anderen Schichten des Bewußtseins stammende Inhalte an, schlingern durcheinander, verschränken und verdichten sich, um sich alsbald wieder voneinander zu lösen und gleichsam in ihre ursprüngliche Einsamkeit zurückzusinken. Hier wird aus der Reizwirkung des Wortes, der sich die zusätzliche begriffliche Reizung gesellt, ein neuer, erhöhter Erlebnisgehalt provoziert. Dieser erhöhte Erlebnisgehalt weist gelegentlich metaphysische Bezogenheiten auf.
Die verstärkte Bewußtwerdung wird nicht zuletzt durch Erlebnisinhalte der Traumsphäre bestimmt. Allerdings sollte man dieses Element nicht überschätzen.
Die wenigen Knotenpunkte des Traumes kann man reproduzieren, aber das Eigentliche, das Vibrierende, das weit Ausgesponnene, das Intensive, das Faszinierende, die Farbe konnte man nicht wieder herstellen, es war da als Traum, man hat es als Traum produziert, und das war schon das Beste, was man tun konnte.
Friederike Mayröcker gesteht der Traumsphäre nicht jene entscheidende Bedeutung zu, die Walter Höllerer ihr bei der „Gewinnung des Wesenhaftesten“ beimessen möchte. Näher steht die Mayröcker Henri Michaux. Auch bei ihr erzeugt „jede Wissenschaft eine neue Unwissenheit, jedes Bewußtwerden ein neues Unbewußtes“.
Die „Schattenzonen“, um einen Ausdruck von Michaux zu verwenden, sind breit und tief in den Texten von Friederike Mayröcker. Sie werden gelegentlich durch „Zitate“ erhellt. Neben die Stellen aus Dichtern und Philosophen der Weltliteratur treten Textfetzen aus Zeitungen, Reklamebroschüren und Plakaten, die „im Trubel des Arbeitstages“ notiert werden. Die Texte der Friederike Mayröcker sind – ganz im Sinne von Guillén – „Lebensbescheinigung“. Sie gehören einem genau umrissenen zeitlichen und topographischen Umraum zu. Es ist das Wien der Jahre 1945 bis 1965, das sich in ihnen spiegelt. Wien ist für die Mayröcker in gleicher Weise Erfahrungs- und Erlebniszentrum wie Pisa für Pound, London für Eliot, Berlin für Holz und Paterson für Williams. Deshalb wäre „Wiener Cantos“ der beste Untertitel für diese poetischen Texte.
Ruediger Engerth, Wort und Wahrheit, Heft 1, 1968
(Erschienen zur Erstausgabe)
Qualvoller Tod durch Musen
– Friederike Mayröckers experimentelle Butzenscheiben-Lyrik. –
Von links schiebt sich auf dem Schutzumschlag eine der Umschlagzeichnung von Grass’ Hundejahren nachempfundene, aber feinsinnig mit einem Spitzenhandschuh garnierte Hand aufs Glanzpapier. Wahrscheinlich ist es die Hand einer Muse, Ihre Fingernägel durchstoßen bedrohlich das Geklöppelte, um sich dem Leser tödlich ins Herz zu krallen. Tod durch Musen!
Wirklich, die Gedichte von Friederike Mayröcker: Tod durch Musen – Poetische Texte, mit einem Nachwort von Eugen Gomringer; Rowohlt Verlag, Reinbek; 200 S., 20,– DM können einen schon umbringen. Nicht allein wegen der Akribie, mit der sie chronologisch zu Gruppen zusammengefaßt den poetischen Werdegang der Autorin dokumentieren. Auch ihre Metaphernfülle, ihr Assoziationsreichtum, ihre raffinierte Sprachtechnik veranlassen den Leser, sich nach einer weißen Fahne umzusehen. Etwa wenn es heißt:
kleines buntes Vöglein
ich möchte dasz du dich einnistest in meinem Blätterdach
bis zum nächsten Frühling
dann zieh hin zu deinen April-Schwestern und Fransenmädchen
und ich werde dir mit allen verjüngten Blättern winken und winken
aber jetzt mitten im Januar verlasz mich nicht wieder
eben erst hast du dich verirrt in mein Laub
in mein Winterlaub eines Nachts als kein Mond schien
und du müdegeflogen kamst
Oder:
MEIN FEDERÄUGIGER LIEBLING!
mein schellenfüsziges Erkerschlöszchen!
meine wunderschöne Osterblume
wie sehr du mich verlassen hast
und jetzt musz ich um dich weinen.
Eugen Gomringer, der Papst jener experimentellen Poesie, die seiner Meinung nach „im Literaturbetrieb unserer Zeit immer noch eine inoffizielle Existenz zu führen hat“, findet in seinem Nachwort für Gebilde dieser Art den Begriff „Erlebnis-Texte“. In ihnen werde das „Erlebnis-Ich der Dichterin… anfangs – auch in der Mein- und Dein-Form – eng selbstbezogen gewertet“. Doch man lasse sich durch dies experimentelle Kauderwelsch nicht irritieren. Was hier mit bedeutungsvollem Augenaufschlag als „Erlebnis-Text“ deklariert wird, ist nichts anderes als das gute alte Erlebnisgedicht, oder besser: das alte Erlebnisgedicht, denn daß dergleichen herzbeklemmendes Tandaradei keineswegs gut, sondern ein zwar bildhaftes, aber dennoch sentimentales Gerede ist, dürfte im Ernst kaum zu bezweifeln sein.
Gomringer versucht denn auch, diese frühen Gebilde von den späteren zu unterscheiden, die er als „Reiz-Texte“ bezeichnet. Mit diesem Begriff trifft er ungewollt das Richtige, denn die Lektüre dieser Texte läßt den Leser tatsächlich aufs äußerste gereizt zurück. Ohne Gebrauchsanweisung läßt sich mit diesen Aneinanderreihungen von Wortungetümen nichts anfangen. Fragmente umgangssprachlicher Redewendungen, deutsch- und fremdsprachige Zitate aus Dichtung, Werbung und anderer Gebrauchsliteratur, Namen von Orten, Pflanzen, Tieren, Dichtern, Politikern, Fremdwörter aller Art und immer wieder Substantive, Reihen von Substantiven – all das wird zu einem zähen Wortbrei zusammengeknetet, aus dem ein gelegentlich beigesetztes „wie ponge“ dem Leser signalisieren soll, es handele sich um äußerst bedeutungsvolle Mitteilungen, in denen das Sein der Welt schlechthin sich zu Wortformationen kristallisiert habe.
Auffällig vor allem ist die Tendenz zur Bildung von neuen Komposita (was die deutsche Sprache ja nahezu uneingeschränkt erlaubt) und zu einer dementsprechenden Häufung von Genitivmetaphern, attributiven Ausdrücken und Partizipialkonstruktionen. Hierin beweist die Autorin zweifellos eine unerschöpfliche Phantasie. Zu verlangen, daß Zeilen wie „Leib licht Blätter Kranz fern so brief raschelnd südherz“ („Text mit Giotto“) oder „Terpentintod Kausal-Herz einzelne Schuhe im Monstergrün“ („Text mit Erdteilen“) irgendeinen Erkenntniswert vermitteln sollten, wäre natürlich unangemessen, aber man kann sogar die Notwendigkeit bezweifeln, mit der sie innerhalb ihres Textzusammenhangs erscheinen. Fielen sie fort, so würde dem Gebilde nichts Erkennbares fehlen.
Gomringer erläutert den Sachverhalt, um den es bei diesen Texten geht, mit der Bemerkung, „Reiz und Reflex (haben ihnen) eine bestimmte Beschaffenheit verursacht“, und er nun verursacht mit einem solchen Orakelspruch im Leser das dringende Bedürfnis, etwas Näheres darüber zu erfahren, wie denn diese Bestimmtheit beschaffen ist. Leider aber muß er sich mit der Erklärung begnügen, daß es sich hier um eine „Poesie handelt, in welcher das Herstellen von Texten das Anwenden von Sprache überwiegt“. Demnach, so schließt man messerscharf, bedarf es zur Herstellung von Texten keineswegs der Anwendung von Sprache, und genau diesen Eindruck gewinnt man auch von der Poesie der Friederike Mayröcker. Der Leser nimmt mit nicht geringer Heiterkeit zur Kenntnis – sofern er sich entschlossen hat, sich von dieser Poesie nicht die gute Laune verderben zu lassen –, daß in ihr häufig „Textereignisse eintreten“, und weiß hinfort, daß in der experimentellen Literatur zwar Ereignisse stattfinden, nämlich Textherstellungen, daß es dazu jedoch nicht der Sprache, sondern bloß eines „reichen Vokabulars“ bedarf.
Die Poesie der Friederike Mayröcker soll nach Auskunft Gomringers, der die Autorin „trotzdem gerne eine Dichterin nennen“ möchte, auf einer neuartigen Poetik beruhen und die „für experimentelle Texte charakteristische Tendenz des Machens erkennen lassen. Was ist daran neu? Schon Gottfried Benn forderte, daß ein Gedicht „gemacht“ werden müsse, und für ihn war dies die Voraussetzung aller lyrischen Betätigung. Ob das „Gemachte“ sich dann auch als gut erwies, war eine zweite Frage, wohingegen es bei dieser Art von experimenteller Poesie so scheint, als ob man es mit dem „Machen“ selbst bereits gut sein lasse. Die Betonung des Technischen – Reihung, Wiederholung, Variation, Parallelisierung – versucht den Anschein einer poetischen Revolution zu erwecken, die sich „in Gegensatz stellt zur klassischen Poesie“, obwohl Gomringer eigentlich wissen müßte, daß all diese Mittel so alt sind wie die Lyrik selbst. Neu allerdings, und damit hat er recht, ist der Anspruch, mit der bloßen Tatsache, daß etwas gemacht wurde, bereits Dichtung hervorgebracht zu haben.
Das alles wäre weiter gar nicht so wichtig, wenn diese literarische Richtung sich selbst nicht so bierernst nähme, wenn der Leser gewiß sein könnte, diese „Textereignisse“ mit ihren manchmal recht witzigen Wortbildungen und Wortspielen ganz unvoreingenommen und einfach belachen zu dürfen, ohne sich damit das Armutszeugnis totaler Unbildung auszustellen. Solange er aber im Zweifel sein muß, ob die Feststellung „schwerer Held: empfand Position 2 wie Position 1 (ca. 40 mm entfernt)“ nicht vielleicht doch die Lösung irgendeines Welträtsels enthält, wird er sich das Lachen lieber verkneifen. Und vielleicht ist ja auch seine Freude darüber, daß hier nicht, wie sonst bei Gedichten üblich, Papier verplempert, sondern der Text gefällig über das ganze Blatt verteilt wird, völlig unangebracht, wird doch so „die Struktur der Texte… auch visuell markant“, wozu nicht zuletzt eine wildgewordene Interpunktion beiträgt, die dem Leser mit Zeichen wie „–?:“ oder „../..“ höchst beredt die Überflüssigkeit, Sprache anzuwenden, demonstriert.
Ein Wort zum Begleittext des Verlages, der den Lyrizismus der in dem Band enthaltenen Texte womöglich noch übertrifft und für den der Begriff „Waschzettelpoesie“ nicht unangemessen erscheint. Entschlossen deklariert er die älteren Gedichte der Mayröcker als „fragile Preziosen“, konstatiert er an ihnen zur Freude von Höllerer die „Möglichkeit zu langen, ja sehr langen Gedichten“, in denen „Redeströme“ freiwerden, ein Begriff, der dann bei den sehr langen Gedichten nicht mehr am Platz ist, da es sich hier „eher um Textflächen“ handelt. Wer nun immer noch nicht Bescheid weiß, halte sich an die ungewöhnlich treffende Charakterisierung Gomringers, der dieser Dichtung den „Reichtum gemalter Fensterscheiben“ zuspricht.
Friederike Mayröcker soll 1956 einen Band Kurzprosa, Larifari überschrieben, veröffentlicht haben. Ob in diesem Titel der Schlüssel zu dem neuen Gedichtband liegt? Eines jedenfalls steht fest: Der Tod durch Musen ist qualvoll. Der Leser verheddert sich in lyrischen Stickmustern und wird mit spitzen Fingernägeln erdolcht. Friederike die Unsterbliche aber behält ihre Palme: Auch sie meinte es ernst, doch sie ist viel komischer.
Helmut Salzinger, Die Zeit, 10.3.1967
Friederike Mayröcker: Tod durch Musen
Friederike Mayröcker, 1924 in Wien geboren, hat bislang vor allem in Zeitschriften und Anthologien publiziert; drei kleine Bände mit Kurzprosa (1956) und Gedichten (1964, 1965) waren quasi unter Ausschluss der Oeffentlichkeit erschienen. In diesem Jahr nun gibt ihr der Rowohlt Verlag Gelegenheit, in einem relativ umfangreichen Band Gedichte aus zwanzig Jahren zu präsentieren, nach ihrer Entstehungszeit in vier Gruppen geordnet.
Die Texte des Bandes sind als „experimentelle Poesie“ deklariert. Diese Charakterisierung ist zumindest für die bis 1960 geschriebenen Arbeiten wenig zutreffend, es sei denn, man rechnete Montage-Technik und Surrealismen noch zum „Experiment“. Die Gedichte aus dieser Zeit sind eher in der herkömmlichen Dichtung verwurzelt, etliche von ihnen sind deutlich autobiographisch gefärbte Erlebnislyrik, bildhaft anschaulich und gedanklich fassbar. Ihre Metaphorik weicht keineswegs vom Durchschnitt des damals Modernen und Gängigen ab („das hanfgelbe Getränk des Triumphes“), ebensowenig die Art der Vergleiche („der Mond dieser Sägefisch aus Rosenblatt und Elfenbein“). In manchen geradezu empfindsamen Gedichten finden sich ausgesprochen konventionelle Passagen: „kleines buntes Vöglein / ich möchte dass du dich einnistest in meinem Blätterdach / bis zum nächsten Frühling…“: dergleichen war auch zwischen 1950 und 1960 nicht gerade originell – abgesehen von der sorgsam gepflegten Marotte, sz statt ß zu schreiben (dasz, auszen, gespieszt), die ihren Grund darin haben mag, dass die Autorin eine Schreibmaschine ausländischen Fabrikats benutzt, auf der das ß fehlt.
Die Gedichte aus den letzten fünf Jahren – sie machen den Hauptteil des Bandes aus – sind ebenfalls reich an surrealer Metaphorik. Nun aber ist die in den früheren Texten deutlich spürbare Sensibilität durch intellektuelle Montage gewaltsam verdrängt. Die Bildhaftigkeit ist zwar stellenweise erhalten geblieben, aber Form und Syntax sind aufgelöst, die Texte sind blosse Reihungen von Bildern und Begriffen geworden, Redeströmungen, angefüllt mit zusammenhängenden Partikeln aus allen möglichen Sprachschichten – von der Alltagsphrase bis zum lyrischen Zitat, von der wissenschaftlichen Fachsprache bis zum Jargon. Diese langen Textgebilde sind gemischt aus konventionellen Elementen und forcierter Modernität, unentschieden, nicht eben konsequent gefügt und eher nach den Gesetzen des Zufalls arrangiert. Die Autorin schwankt zwischen Konvention und Experiment, und darum ist es ihr – so hiess es in der österreichischen Monatsschrift Literatur und Kritik – „erstaunlicherweise gelungen, Agentin beider Richtungen zu sein, Synthesen herzustellen, die wohl jedem Gutmütigen etwas bieten“. So ist es. Nur, dass die Devise „Für jeden etwas“ nicht unbedingt ein geeignetes Kriterium für Literatur sein kann und dass nicht jeder Leser gutmütig ist.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 24.12.1966
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Anonym: o. T.
Buch und Bibliothek Nr. 11/74, 1974
Beda Allemann: o. T.
Hessischer Rundfunk, 6.1.1967
Beda Allemann: Experimentelle Dichtung aus Österreich
Neue Rundschau, Nr. 78, 1967
Gerald Bisinger: Demonstration von Poesie
Diskus Nr. 7/66, November 1966
EA: Literarische Ernte. Buchpremieren mit Mayröcker und Jandl im Palais Wilczek
Kurier, 20.9.1966
Jeannie Ebner: o. T.
Österreichischer Rundfunk, 8.12.1973
Jeannie Ebner: o. T.
Literatur und Kritik, Nr. 82, April 1974
Peter Wolfgang Engelmeier: Mayröcker-Poesie für Verständnisreiche
Münchner Merkur, 11.2.1967
Ruediger Engerth: Avantgarde im Palais Wilczek. Friederike Mayröcker und Ernst Jandl lasen aus neuen Gedichtbänden
Neues Österreich, 18.9.1966
Ruediger Engerth: Wiener Cantos
Siegfried J. Schmidt (Hg.): Friederike Mayröcker, 1984
Walter Helmut Fritz: Friederike Mayröcker: Tod durch Musen
Neue Deutsche Hefte, Nr. 2/74, 1974
Gisela Grimme: Sprache, die zweite Schöpfung. Frauenlyrik heute
Buch und Bibliothek, Nr. 11, 1974
Raoul Hausmann: Friederike Mayröcker. Tod durch Musen. Poetische Texte
Manuskripte Nr. 20, 1967
Regina Käser-Häusler: Herstellung von Texten
Basler Nachrichten, 22.9.1966
Ulrich Kneipp: o. T.
Literatur und Kritik, Nr. 5, August 1966
Karl Krolow: Litaneien, Sprachspiele und Gewitzel. Drei neue Lyrikbände
Der Tagesspiegel, 6.11.1966.
Karl Krolow: Tod durch Musen
Luxemburger Wort, 7.6.1968
Helmut Kreuzer: Friederike Mayröcker: Tod durch Musen
Neue Deutsche Hefte, Nr. 112, 1966
Kurt Marti: Poetische Reiz-Texte
Die Weltwoche, 18.11.1966
Manfred Mixner: o. T.
Österreichischer Rundfunk, 4.5.1974
Peter Horst Neumann: Zwischen Benn und Bense. Zwei Gedicht-Bände von Friederike Mayröcker
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.7.1967
Jost Nolte: Verse von heute
Deutschlandfunk, 13.10.1966
Michael Scharang: o. T.
Österreichischer Rundfunk, 4.11.1968
Alfred Treiber: Avantgarde in Österreich
Die Furche Nr. 1967
Jürgen P. Wallmann: Für Gutmütige
Welt der Literatur 22.9.1966
Jürgen P. Wallmann: o. T.
Süddeutscher Rundfunk, 6.12.1966
Jürgen P. Wallmann: Friederike Mayröcker: Tod durch Musen Ernst Jandl: Laut und Luise
Jürgen P. Wallmann: Argumente Mühlacker, 1968
Fritz Werf: o. T.
Welt und Wort, Nr. 1/67, Januar 1967
Tod durch Musen
– Ein kleiner Überschwang als Pars pro toto zum Werk Friederike Mayröckers und zu ihrem siebzigsten Geburtstag. –
(Als ich wenig über zwanzig war, ist mir Friederike Mayröckers Band TOD DURCH MUSEN, Poetische Texte in die Hände geraten. Nichts in der Literatur und in ihrer Geschichte war für mich nach der Lektüre dieses Buchs so, wie es vorher gewesen war.)
*
Auch davon träumen alle, die dichten: die Grenzen ihrer selbst als die Grenzen ihres Dichtens zu erfahren und die Grenzen ihres Dichtens über alle Maßen auszudehnen, auf daß das Spiel, und auch der Ernst, zwischen Ermächtigung und Preisgabe bis zum letzten Tropfen ausgekostet werden kann.
Wie eng scheinen die Grenzen jenes Selbsts normalerweise zu sein, und wie eng auch normalerweise jene eines poetischen Selbsts in der Literatur, da eine Innerlichkeit oder eine Äußerlichkeit, Reihen oder auch Tumulte innerer oder auch Gewitter oder Ordnungen äußerer (sinnlich wahrnehmbarer) Zustände als ihrer sprachlichen Wiedergabe gegenüber gedacht werden, und also die Literatur als ein Versuch aufgefaßt wird, diese Zustände in ein Jenseits zu verweisen, sie zu benennen, und damit fest- und darzustellen. – Die Literatur als mehr oder weniger geschickte Nachahmung oder als mehr oder weniger gelungene Re-Konstruktion eines Selbsts oder einer Welt in einem ideellen, symbolischen Raum, in einer ideellen, symbolischen Zeit. Alle diese Suchen nach verlorenen Zeiten und Räumen mit Hilfe der dafür zu findenden Zeichen, durch die jene Zeiten und Räume wie jenes Selbst widergespiegelt werden sollen, gleichsam auf der Oberfläche einer künstlichen (und dennoch über alle Maßen kostbaren) Perle, abgesondert von der angeblich natürlichen Muschel Sprache aus dem angeblich noch natürlicheren Meer Welt.
Immer also diese heran- wie hinwegflutende Woge von außen oder von innen und woanders! – Gegeben in einer Sprache, die damit zu einem Raumzeit widerspiegelnden Körper wird, auf dessen Oberfläche sich der Schreibende oder Lesende in seiner eigenen Lese-Zeit, seinem eigenen Lese-Raum, in seinem eigenen sinnlichen Wahrnehmen so von Sprach-Reiz zu Sprach-Reiz bewegt, als gäbe es ihn selbst und seine eigene Lese-Zeit, seinen eigenen Lese-Raum gar nicht; ihm wird seine eigene Bewegung zum Mittel, er wird von diesem, seinem Mittel seinerseits ergriffen, jene Widerspiegelung sowohl genießend als auch erleidend. Aber so – das ist die Arbeitshypothese, ob man davon weiß oder nicht – als ob er im Spiegel dieser Perle die heran- wie hinwegflutende Woge bzw. sein eben insofern poetisches Selbst auf einem andern Stern betrachten würde, ohne diese, seine eigene Bewegung, sein Zeilen tastendes Umkreisen der spiegelnden Perle konstruktiv, also als Tat-Sache einbeziehen zu können; ohne einbeziehen zu können, daß dieses Umkreisen wesentlich Teil haben kann an dem Erzeugen jenes Bildes, daß es als wirksame Voraussetzung der Möglichkeit der Deutung ein solchen Widerspiegelns angesehen werden kann. So erfährt ein solcher Lesender vielleicht zu wenig von dem so ungeheuren und eigenmächtigen Gewittern der Sprach aber auch vielleicht zu wenig von ihrem Ordnen, den Reihen ihrer vor allem ihr selbst eigentümlichen Tumulte von diesen vielfach einander kreuzenden und querenden, zugleich einander klassifizierenden und klassifizierbaren Tätigkeiten, zu deren kontingentem Ergebnis es womöglich erst gehört, daß damit ein Spiegel entsteht und darin ein Bild von etwas anderem, das woanders und zu ein anderen Zeit existieren können soll und durch dieses Bild fest- und dargestellt werden.
Wird also jene Möglichkeit, jenes ungeheure und eigenmächtige Gewittern, aber auch Ordnen der Sprache, die Reihen ihrer vor allem ihr selbst eigentümlichen Tumulte, nicht zu einem Sinn erzeugenden oder auch Sinn vernichtenden Moment des Lesens gemacht, zu einem wesentlichen konstruktiven oder auch dekonstruktiven Prinzip, dann wird aus dem Sandkorn in der Muschel Sprache vor allem jene spiegelnde Perle, in welcher der Schreiben oder Lesende sich oder einen anderen Teil der Welt als etwas sieht, das er oder das die Welt in einem anderen Zeitraum ist als in dem, den er braucht, um davon zu schreiben oder zu lesen.
*
In diesem Bild der Dichtung und ihrer Grenzen, des poetischen Selbsts und seiner Grenzen, das aber auch ich selbst hier gerade im Begriff bin, mir zu machen oder zu erleiden, indem ich auf diese, meine spiegelnde Text-Perle sehe, und darin bestimmte andere Texte zu entdecken behaupte, so als wären sie Sterne, die ich so betrachte, als existierten sie an und für sich, unabhängig von meinem Beobachten; in diesem Bild also, dieser Widerspiegelung eines angeblich im Jenseits dieser Schrift existierenden Weltzeitraums, bestehend aus einer wahren Milchstraße ihrerseits widerspiegelnder Literatur-Perlen, also gerade der Hypothese folgend, man könne etwas über diesen Weltzeitraum aussagen, male ich ein Bild aus, das zugleich ein maßgebliches (wenn nicht das maßgebliche) unserer Literaturgeschichte ist.
Dennoch gibt es den Augenblick, da das Zweifelhafte dieser Hypothese oder der Mangel dabei an eigener, aber auch an anderer Gegenwart überdeutlich oder überschmerzhaft wird, da die Widerspiegelungen trüb, unzuverlässig oder fade wirken, das Leben auf den fernen Sternen gespenstisch erscheint (als wären sie längst erloschen); dennoch gibt es da den Augenblick, da der Vorstellung mißtraut wird, daß das Spiegeln der Perle, sollte es überhaupt etwas widerspiegeln, etwas widerspiegle, das ihres eigenen Glanzes wert sei. Und so kann ein Widerstand dagegen entstehen, daß man jene Aspekte seiner selbst bzw. seines Dichtens auszublenden habe, die man benötigt, um um des Spiegelbildes willen in die Perle zu sehen; ein Widerstand, der sich damit zeigt, daß die Sehnsucht nach dem Ausdehnen des eigenen oder auch des poetischen Selbsts überhand nimmt, so daß man die Lust daran verliert, jenes Jenseits vorauszusetzen, das auch als Jenseits von einem selbst erscheint.
Und so kommt der literaturgeschichtliche Augenblick oder auch nur der Augenblick innerhalb des eigenen Schreibens oder Lesens, da man die eigene Bewegung eines Schreibens oder Lesens sowohl mitsamt allen seinen akustischen und optischen Reizen als auch mit all seinen semantischen Formen, seinen Über- und Unterordnungen, all den Mechanismen des Klassifizierens, die man sonst einfach gebraucht, um jene Perle zu formen und als Spiegel benützen zu können, mit in den Blick zu bekommen sucht oder einfach wie von selbst mit in den Blick bekommt.
Gerade dann, unter diesen Umständen kann man die Fähigkeit gewinnen und der Lust nachgeben (aber auch dem Schmerz), die Dinge von der Wurzel her umzukehren: Aus der Perle Text, auf die man schreibend, lesend sieht, um das zu betrachten, was sich in ihr widerspiegelt, wird jetzt selbst ein Zeitraum, etwas, das Zeit einräumt und Raum zeitigt, eine, wie man sagt, Gestalt annimmt: Diese Gestalt gibt in ihrem Entstehen (damit, daß sie erlesen wird) ihre visuellen und akustischen Reize preis, im und durch das Zusammenhängen mit semantischem Formen und Umformen, dem Herstellen und Vernichten also aller jeweils denkbaren Assoziationen und auch Dissoziationen. So eben verdonnert man sich, wird man verdonnert zu dem ungeheuren und eigenmächtigen Gewittern, aber auch Ordnen der Sprache, zu den Reihen ihrer vor allem ihr selbst eigentümlichen Tumulte, die sich beim Lesen oder Schreiben eröffnen, sich also als Wirkung des Schreibens oder Lesens auffassen lassen und damit als Wirkung einer Selbst-Erweiterung über alle Maßen.
Keine von innen oder außen heran- oder hinwegflutende Woge von Eindrücken, die von der Sprache gegenübergedacht wird, kein Versuch mehr, etwas ins Jenseits zu verweisen, kein Suchen nach verlorenen Zeiten oder Räumen mit Hilfe der dafür zu findenden Zeichen! Jetzt ist jenes Selbst buchstäblich und absolut, Synthese aus dem, was normalerweise Selbst genannt wird, und dem poetischen Selbst, also etwas, das sich zum absoluten Angelpunkt erweitert: ein Ausgangs- oder Mittelpunkt, und von ihm aus, von seinem Schreiben oder Lesen, flutet die Woge nach allen Richtungen zugleich und breitet sich aus, gemäß den Gesetzen des Schreibens oder Lesens. Ständig, mit jedem Leseaugenblick werden diese Räume und Zeiten hervorgerufen, die nirgends in ein An-und-für-Sich entlassen werden, sondern immer an die Bedingungen der jeweiligen, augenblicklichen akustischen und optischen Reizbarkeit, wie auch an die semantischen Ordnungen gebunden bleiben, jedenfalls an die als unbedingt erfahrene Tätigkeit, in der die Möglichkeit des Widerspiegelns nur als ein Moment, und als ein paradoxes Ergebnis eines solchen unbedingten Entwerfens erscheint. Damit befindet und erfindet man sich also im Inneren einer Entfaltung, vielleicht im Inneren jener Perle. Aber was heißt da Inneres und was heißt da Perle, wenn es kein Jenseits dieser Entfaltung gibt, wenn das, was jeweils als Inneres oder Äußeres erscheint, es nur relativ zu anderen Stadien dieser Entfaltung ist?
Man beginnt zu lesen, und da gibt es, man weiß nicht was, da beginnt man mit etwas, sagen wir, mit einem Buchstaben, einem Laut, einem Wort, einem Satz oder auch mit einem Impuls, einem Begriff, einer Idee, oder viel mehr mit etwas, das alles das enthält oder erzeugen läßt, und daraus, aus diesem ersten Reiz, der nicht nur einer für die äußeren Sinne ist (aber auch deren Tätigkeit hervorruft), aus diesem tatsächlich ersten Anstoß erschafft sich alles so, als hätte es vorher nichts gegeben. Dieser absolute Anfang wird zu einer Art Proustschen Madeleine, aber nicht zu einer, die etwas anderes wiederauferstehen läßt, was (gemäß jenem Bild) einmal geschehen ist, sondern zu einer, die selbst ein Geschehen, eine Reihe von Ereignissen, von Hinter- und Vordergründen, einen Zeitraum, oder eine Reihe von Zeiträumen entstehen, sich entfalten und wieder in sich zusammenstürzen läßt, so daß, was wir normalerweise Erinnern nennen, nur ein Aspekt jener Entfaltung ist.
*
Friederike Mayröcker, davon zeugt der Band Tod durch Musen am deutlichsten, hat sich jenen literaturgeschichtlichen Augenblick zu eigen gemacht, oder hat diesen eigenen Augenblick des Zweifels oder Mangels zu einem literaturgeschichtlichen gemacht, hat ihn zu einem, zu ihrem fundamentalen Umschwung genützt.
Und insofern dieser Augenblick eines Umschwungs als ein literaturgeschichtlicher betrachtet wird, steht er eben auch in einer Geschichte, hat er auch verschiedene Namen bzw. lassen sich aus ihm verschiedene literarische Traditionen oder Verfahren herauspräparieren; insofern man also mit Hilfe der Sprache einer jeweiligen Literaturgeschichtsschreibung auf das sieht, was sich in der Perle des Schreibens einer solchen Geschichte widerspiegelt, insofern man die Geschichte der Literatur als eine Kette von Perlen sieht, die einander bespiegeln.
Diese Weise, auf Friederike Mayröckers Texte zu sehen, hat uns eine Reihe von Vergleichsstücken beschert, die man dann mit einigem Recht als Konstituenten des Baus der Mayröckerschen poetischen Texte behaupten kann; man hat da surrealistische und dadaistische Traditionen und Verfahren, auch Verfahren konkreter Poesie erwähnt (vor allem ihrer visuellen Spielart), Montagetechnik, Zitat usw.; man hat hervorgehoben, daß in der Dichtung der frühen Mayröcker auch eine ganze Reihe traditioneller Verfahren und Techniken (Reime, Alliterationen, Assonanzen z.B.) zu finden sind, so daß man ihr Werk geradezu als Kompendium ansehen kann, sowohl bestimmter literarischer Traditionen als auch der Verfahren, die mit ihnen verbunden werden.
Aber diese Traditionen und Verfahren, ob althergebracht oder modern, sind natürlich nicht alles, sie sind sogar sehr wenig, ihre sie voneinander isolierende Beschreibung als einzelne unterschlägt das Entscheidende.
Dieser absolute Anfang, den viele Texte in Tod durch Musen heraufbeschwören, diese absolute Ermächtigung oder Preisgabe, dieser Versuch des Erfüllens der Sehnsucht, die Grenzen von einem selbst zu den Grenzen des eigenen Dichtens zu machen und zugleich die Grenzen des eigenen Dichtens über alle Maßen auszudehnen – das alles könnte auch beinahe gar nichts sein. Die Verkörperung dieser frühromantischen Idee, diese radikale Verwirklichung der modernen Kräfte oder Aspekte dieses frühromantischen Impulses könnte im völlig Beliebigen enden, in der unvermittelten und unvermittelbaren Anmaßung, alles zu sein, in fruchtloser Reklamation dessen für sich oder für seine Dichtung, was man dennoch nicht ist. (Dafür gibt es Beispiele genug in der Literatur dieses Jahrhunderts).
Doch das Rätselhafte und Berauschende an Mayröckers Tod durch Musen ist ja, daß das, was unter allen andern Umständen als unter jenen von Mayröckers Texten zufällig oder beliebig wäre, poetisch notwendig wird, so als wäre es tatsächlich man selbst, der dafür verantwortlich ist, ob etwas als Zufall oder als Notwendigkeit, als Ergebnis einer Absicht oder als unwillkürliches Geschehen, sinnlos oder sinnvoll erscheint. Die Möglichkeit solcher absoluten Ermächtigung oder absoluten Preisgabe, das Ausdehnen des eigenen Selbst in jenes der Dichtung, zugleich das Ausdehnen des Dichtens über alle Maßen kann für jeden, der Friederike Mayröckers Tod durch Musen liest, wie sie geschrieben worden sind, Wirklichkeit werden.
*
P.S.: Hat sich Friederike Mayröcker nach dieser radikalen Umkehr, durch diese radikale Umkehr wieder die Möglichkeit verschafft, mit Lust, aber auch mit Schmerz in die Perle Sprache wie in einen Spiegel für sich selbst und eine Welt zu sehen, allerdings ohne auf die andere, entgegengesetzte Möglichkeit zu vergessen, vielleicht mit dem Ziel, die konstruktiven und die rekonstruktiven Momente einander die Waage halten zu lassen oder wenigstens ihr wechselseitiges einander Gewichten betrachtbar zu machen? Wie, wenn Friederike Mayröcker im Spiegeln ihrer späteren Texte, ihre von ihnen aus anscheinend vergangenen, damals absoluten Entfaltungen entdeckt und beobachtet, als ihr zu erinnerndes poetisches Selbst, so wie man umgekehrt, die besten Texte in Tod durch Musen lesend, innerhalb jenes scheinbar absoluten Entfaltens eine Perle entdecken mag, die einen anderen Teil jenes Entfaltens so widerzuspiegeln scheint, als wäre dieser Teil in einem Jenseits, – ein relatives Widerspiegeln, das dennoch für uns Lesende zugleich das Sandkorn sein könnte, das sich inzwischen zu jenen Texten Friederike Mayröckers ausgewachsen hat, die seit Tod durch Musen entstanden sind?
Franz Josef Czernin, manuskripte, Heft 125, 1994
Poesie und Poiesis,
dargestellt am Werk Friederike Mayröckers
„Poesie“ und „Poiesis“ waren ursprünglich ident. Im Laufe ihrer jahrtausendalten Begriffsentwicklung haben die beiden Termini dialektischen Charakter angenommen, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, daß die Poesie die Poiesis transzendiere. Wenn wir es in dieser bescheidenen Studie wagen, den für viele sehr fragwürdig gewordenen Begriff der Poesie im Zusammenhang mit einer den geläufigen poetischen Traditionen so sehr widersprechenden Autorin wie Friederike Mayröcker zu evozieren, dann nur zunächst im Sinne der Gleichsetzung von Poesie und Dichtung als „Sprachkunst“. Wir wollen uns dabei gar nicht auf eine der vielen Möglichkeiten einer Definition dessen einlassen, was Dichtung sei oder sein solle. Wer das raffiniert komponierte Nachwort Walter Höllerers zu der Theorie der modernen Lyrik kennt, in dem Positionen und Gegenpositionen von sechzig weltberühmten Poeten der Moderne über Poesie im allgemeinen und Lyrik im besonderen dialogisch zusammengefaßt werden, der weiß um die Definitionsnot des Literaturwissenschaftlers der Gegenwart. Aus ihr findet sie ihren Ausweg vielleicht nur in einer sauberen Deskription der jeweiligen Positionen. Wenn wir andererseits den alten aristotelischen Begriff der „Poiesis“, der ja ein Gegenbegriff zur „Mimesis“ ist und dem die Poesie entstammt, auf das Werk der Dichterin anwenden, so geschieht es auch hier mit dem schon eingangs ausgesprochenen Hintergedanken, daß das Poetische des Werkes das „Poietische“ seines Entstehungsprozesses transzendiere. Ehe wir uns der Dichterin und ihrem Werk, das von 1956 bis 1978 auf insgesamt 19 Titel angewachsen ist, zuwenden, wollen wir die Situation der Gegenwartsdichtung und deren geistesgeschichtliche und poetologische Herkunft in wenigen Strichen umreißen.
Es spricht sehr viel dafür, die moderne Dichtung mit Kurt Leonhard zwischen den Polen von „Spiel und Botschaft“ zu sehen, in einer „dialektischen Lage“ also, die aus der älteren von Verfremdung und Vergeistigung hervorgegangen ist.
Drei Welten erscheinen uns vor allem innerhalb dieser dialektischen Polarität:
Einmal die alogische, surreale Bilderwelt einer Kunstbewegung, in die viele Ströme künstlerischen Ausdruckswillens der letzten hundert Jahre geflossen sind. Der Futurismus und der Kubismus, der Expressionismus und die abstrakte Malerei haben an ihr ebenso Anteil wie die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften (die Relativitätstheorie und die Quantenphysik), vor allem aber die Tiefenpsychologie und ihre Entschlüsselung der Traumwelten, in denen das bewußte Ich ausgeschaltet ist.
Weiters die Welt der Chiffre, in der die Botschaft der Dichter hermetisch verschlüsselt wird. Hugo Friedrich hat gezeigt, wie die moderne Lyrik die Sprache zu der „paradoxen Aufgabe“ nötigt, „einen Sinn gleichzeitig auszusagen wie zu verbergen“. Welche Bedeutung die „Welt der Chiffren“ auch für die Philosophie hat, das wurde uns von Karl Jaspers sehr eindringlich dargestellt. Otto Knörrich demonstrierte an den Lyrikern Ernst Meister, Paul Celan und Max Hölzer, wie aus einer „surrealistischen Metaphysik“ sich die verschlüsselten, chiffrierten Botschaften dieser Dichter entfalten.
Endlich die Welt der Sprach- und Lautspiele der experimentellen Dichtung und konkreten Poesie. Sie hat endgültig alle Mimesis aus der Dichtung im Anschluß an die vorhergegangenen Bewegungen in der bildenden Kunst verbannt und will mit ihrer „Poiesis“ die Dinge aus Sprache und ihren Bestandteilen – vom Wort bis zum Laut, vom Phonem bis zum Graphem – herstellen, die nichts als sich selber zeigen, ganz im Sinne des berühmten Aphorismus von Paul Klee:
Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.
Der Ästhetiker und Linguist Siegfried Johannes Schmidt, einer der Theoretiker der Konkreten Dichtung, führt die „Konkrete Kunst“ auf die Theorien von Malewitsch, Kandinsky und der holländischen Führer der Stijl-Gruppe (Theo von Doesburg und Piet Mondrian) zurück. Diese theoretischen Grundlagen sind auch, wie wir sehen werden, für die „poietischen“ Elemente im Werke Friederike Mayröckers bestimmend und wichtig gewesen. Wie sehr wir durch diese extreme Richtung der modernen Dichtung zu einer Sensibilisierung unseres Sprach-Material-Bewußtseins angeregt worden sind, wie weit sie unseren Sprach-Spiel-Trieb einerseits und unsere Einsicht in die „Kommunikationsspiele“ und ihrer Strategien andererseits gefördert hat, das werden erst spätere Untersuchungen dartun müssen.
Wie sehr die Sprachskepsis im Zusammenhang mit der konkreten Dichtung zur Thematisierung der Sprache in der modernen Literatur geführt hat, das hat uns Walter Weiss schon vor einigen Jahren eindringlich dargestellt. In diesem Zusammenhang ist auch auf die „antigrammatische Poetik“, wie sie von Heißenbüttel und Höllerer vertreten wird, hinzuweisen. Ihre bekanntesten Stilmittel sind: Montage, Assemblage, Collage, Wiederholung, Reihung etc.
Die Deutungsversuche für die Entwicklung der modernen Kunst in den vergangenen hundert Jahren füllen bereits eine ganze Bibliothek. In unserem Zusammenhang wäre dabei auf drei Erklärungsversuche hinzuweisen. Sie zeigen sowohl die Übereinstimmung als auch die Differenz in der Auffassung dieses kunst- und geistesgeschichtlichen Vorgangs hinsichtlich einer Theorienbildung zum Wirklichkeitsverständnis unserer Zeit.
Hier wäre zunächst das kulturphilosophische Werk über die „aperspektivische Welt“ von Jean Gebser, Ursprung und Gegenwart, zu nennen, das den Vorgang durch das Heraustreten des Menschen aus der „perspektivischen“ Welt in eine „aperspektivische“ darzulegen und zu erklären versucht. Gebser entwickelt seinen groß angelegten kulturphilosophischen Versuch als Kulturanthropologe und Historiker des menschlichen Denkens, das er auf fünf Ebenen sich entwickeln sieht: der archaischen, der magischen, der mythischen, der mentalen und der integralen Ebene, auf der der Mensch lernen muß, das Raum-Zeitkontinuum der aperspektivischen Welt zu bewältigen.
Herbert Reads Buch Formen des Unbekannten intendiert kein so großes kulturphilosophisches Ziel wie Gebser, mit dem es sich in manchem Gedankengang berührt, sondern eine philosophische Ästhetik der Moderne. Hierin trifft es sich auch mit den Ästhetischen Prozessen Siegfried Johannes Schmidts, doch geht beider Theorie von völlig verschiedenen Ansätzen aus.
Schließlich das kultursoziologische Werk Theorie des gegenwärtigen Zeitalters von Hans Freyer, das mit seiner Darstellung der technisch-rationalen „Sekundärschöpfung“ auch manches Licht auf die Entwicklung der modernen Kunstentwicklung wirft. Vor allem ist Freyer für die Frage wichtig, ob die ästhetischen Prozesse einer nicht mimetischen Kunst als legitimer Ausdruck der technischen Sekundärschöpfung gelten können, wofür u.a. ihr „Modellcharakter“ gelten könnte. Die Sekundärschöpfung schafft ja Modelle einer zweiten Wirklichkeit. Die antigrammatische Poetik im Sinne Heißenbüttels versucht dies auf ihre Weise mit der Sprache auch.
In allen Erklärungs- und Deutungsversuchen spielt natürlich das Problem der Wirklichkeit eine vordringliche Rolle. Die Wandlungen des Wirklichkeitsverständnisses gehen mit den Wandlungen sowohl der bildenden als auch der Dicht- und Sprachkunst Hand in Hand. Wir wissen, daß um die Jahrhundertwende jene geistigen Faktoren entscheidend wurden, die das Gefüge unserer Zeit umgestaltet haben. Durch die Relativitätstheorie, die Atomtheorie und Quantenphysik wurde die Nichtabbildbarkeit der Welt immer offenkundiger. Die Gesamtwirklichkeit ließ sich nur mehr in verfremdeter Form, nämlich in den mathematisch-physikalischen Modelle statistisch darstellen.
In der Erkenntnistheorie und der Erkenntnissoziologie, in der Anthropologie, Wissenschaften, die immer präzisere Theorien ausbildeten, in der Tiefen- und Gestaltpsychologie erschien die Wirklichkeit immer mehr als das Ergebnis bestimmter historischer und gesellschaftlicher sowie kognitiver Prozesse. Durch die Erfindung der Photographie und ihre rasche Fortentwicklung war der Künstler nicht mehr zum Lieferanten illusionistischer Wirklichkeitsausschnitte für die Gesellschaft nötig, sein handwerkliches Können, das ja zur Erweckung dieser Illusionen nötig gewesen war, büßte seinen Wert ein.
Endlich zeigte die radikale Entwicklung der Technik einerseits durch die Erfindung von Gegenständen, die es in der Natur nicht gab, die Fragwürdigkeit einer bloß mimetischen Kunst, andererseits verstärkte sie den Wunsch, immer mehr Neuartiges zu erschaffen.
Diese Faktoren setzten in zunehmendem Maße die bisher gültigen Modelle einer mimetischen Wirklichkeitsauffassung außer Kraft und schufen für den Künstler ganz neue Aufgaben. „Die Aufgabe, Wirklichkeit zu repräsentieren“ – so formuliert Schmidt –, „machte der Aufgabe Platz, Wirklichkeit zu schaffen, neue Dimensionen des Wirklichen im Bild zu erschließen: An die Stelle eines mimetischen Kunstbegriffes trat ein poietischer, genauer gesagt ein generativer Kunstbegriff.“
Auf zwei Wegen haben die Künstler der Jahrhundertwende diese Aufgabe zu lösen versucht: sie legten einmal eine subjektive Perspektive auf die Erfahrungswirklichkeit an, um so neue Aspekte derselben bewußt und sichtbar zu machen. Kubisten, Futuristen, Expressionisten sowie Vertreter sämtlicher Spielarten der abstrakten Malerei haben diesen Weg beschritten.
Den zweiten Weg begingen Künstler wie Mondrian, Malewitsch und Kandinsky, die Begründer der konkreten bzw. konstruktivistischen Malerei, indem sie ohne Bezug auf die Erfahrungswirklichkeit optische Gebilde schufen, „für die es kein Analogon in der natürlichen oder technischen Umwelt gibt“.
Was sich um die Jahrhundertwende bis etwa in die Mitte der zwanziger Jahre in den bildenden Künsten, der Malerei, Plastik und Architektur vollzog, das ereignete sich mit einer Phasenverschiebung von drei bis fünf Jahrzehnten auch in der deutschsprachigen Literatur. Signifikant dafür ist ihre Abwendung von jeder Inhaltsästhetik und die Hinwendung zu einer konkreten Materialästhetik, die sich – nach Schmidt – immer mehr zur Reflexion der „polyvalenten Polyfunktionalität“ des Ästhetischen zu entwickeln scheint.
Das Jahr 1924 ist in mehrfacher Hinsicht bezeichnend: einmal ist es das Todesjahr Franz Kafkas, in dem auch der Expressionismus zu Ende ging. Gleichzeitig feierte die literarische Welt in diesem Jahr den fünfzigsten Geburtstag zweier so unterschiedlicher Dichternaturen wie Hugo von Hofmannsthal und Gertrude Stein, die ihre frühe Kindheit ebenfalls in Wien verbracht hatte. Im gleichen Jahre erschien das erste surrealistische Manifest von André Breton.
In eben jenem Jahre 1924 kam am 20. Dezember Friederike Mayröcker zur Welt. Zehn Jahre zuvor hatte die erste Vertreterin der kubistischen Literatur in Paris ihr umstrittenes Werk Tender Buttons veröffentlicht: Friederike Mayröcker wird Gertrude Stein, der sie sich in mehr als einer Hinsicht verpflichtet fühlt, die verfremdete Hommage „Tender Buttons für Selbstmörder“ widmen. Die junge Wienerin, die nach ihrem Mittelschulstudium Englischstudien betrieb und dann viele Jahre als Englischlehrerin tätig war, trat mit ihren ersten Gedichtveröffentlichungen ab 1946 in verschiedenen Zeitschriften hervor. So finden wir sie bereits in der Nummer 4 des Jahrgangs 1947 der von Otto Basil edierten Zeitschrift Plan mit fünf Gedichten, die in einer an Trakl und frühe surrealistische Einflüsse gemahnenden Weise einen Engel beschwören, der gleich Rilkes Engel ein schrecklicher Todesengel zu sein scheint, in den sich nach Jean Gebsers frappierender Beobachtung die einstmals Schaffens- und Lebenskraft spendende „Muse“ verwandelt hat. Eines dieser Gedichte trägt den Titel „In Schwarz“ und lautet:
Der Engel wird mich verlassen.
Er schlägt mir schon Wunden.
Sie brechen auf wie Rosen.
Er hebt die Schwere
des Weltraums von meinen Lidern.
Er entzieht mir
den zärtlichen Frühling.
Er legt mir die weißen Hände auf.
Er nimmt sich leise zurück.
Er verlöscht mich.
Zwei Jahrzehnte später wird die Dichterin in einer völlig gewandelten Technik einen neunteiligen Gedichtzyklus schreiben, dessen Titel Tod durch Musen lautet. Sie hat diesen den neun Musen gewidmeten Zyklus ihrer gleichnamigen großen Textsammlung vom Jahre 1966 vorangestellt. Die neun Modelle, die je einer Muse gewidmet sind, stellen eine fürs erste befremdende Assoziationskette dar, die ihre politische Implikation in dem das erste Modell „Cleo“ beschließenden Klammerausdruck hat: „(goebbels: ,… wollt ihr den totalen krieg…!‘ – JAAA)“
Die Musen als Todesgöttinnen des totalen Krieges oder die Künste als Kulturkulisse vor dem Menschenmorden, weshalb sie schon von den Dadaisten schärfstens angegriffen worden sind. Demgemäß lautet die der Muse Euterpe gewidmete Assoziationenkette des Modells 9:
den reptilismus der musen
anzweifeln
archaisch verschleudern
tanzschritte
im ,metropol‘
petro-chemie mit purpurrotem kamm
rothaarig
braunrückig
purpurwangig
purpurfüszig
von rosen rot
abtasten
aufheben
straucheln
– zu sterben
tod durch musen
Abgesehen davon, daß in dieser montierten Assoziationenkette jedes Wort und jeder Begriff zunächst sich selbst meint, ehe er der Muse der Tonkunst zugeordnet ist, die hier eher Terpsichores Funktion übernommen haben dürfte, nämlich den Todes- und Totentanz, enthält sie auch eine Erinnerung an einen Ort, der vielleicht nur den Wienern, die die Jahre von 1938 bis 1945 bewußt durchlebt haben, als Ort des Schreckens bekannt sein dürfte: das Hotel Metropol, wo die Gestapo ihren Sitz hatte. Ein Ort, in dessen Kellern das archaische Menschenwesen – von den Nationalsozialisten als indo-arisches) nordisches Erbe oftmals beschworen – sein Menschentum verschleuderte, indes die Muse der Todes-Chemie des Krieges ihr Blut-Rosenlied – die Zeile „von rosen rot“ könnte vielleicht einen Anklang an die Wunderhorn-Zeile „O Röslein rot“ aus Mahlers Dritter Symphonie beabsichtigen. – „purpurwangig“ sang und „purpurfüßig“ tanzte, bis sie strauchelte und selber starb. (Der „Petro-Chemie“ verdanken wir nicht nur die synthetischen Stoffe, sondern auch das Giftgas, in das man Menschen jagte!)
In dem gleichen Planheft, in dem Mayröckers frühe Gedichte zu finden sind, publizierte auch Werner Riemerschmid seinen für die damalige Generation der jungen Schriftsteller und Künstler so wichtigen Aufsatz „Über surrealistische Lyrik“. Dieser Essay und Max Hölzers mit Edgar Jené gemeinsam herausgegebene Surrealistische Publikationen haben einer Generation den Anschluß an eine weltliterarische Bewegung vermittelt, von der sie während der faschistischen Herrschaft hermetisch abgeschlossen war. Wie sehr der Aufsatz Riemerschmids auf die junge Friederike Mayröcker gewirkt haben muß, das läßt sich noch aus einem 1960 geschriebenen Gedicht ablesen, in dem ein Gedanke aus dem Riemerschmid-Aufsatz wiederkehrt. Bei diesem Autor lesen wir:
Der Traum soll an die Stelle des logischen Denkens treten. Die Bilder sollen ,Blitze‘ sein, die in jedem Augenblick die ,Kavernen des Daseins‘ erhellen.
Diesem „Blitz“ begegnen wir wieder in einem Gedicht Friederike Mayröckers:
JUNI IM FÄCHERWIND STÄUBT
mit den knisternden Romakoschwertern junger Robinien
durch unsere abschiednehmenden Hände
und entläszt pfingstrosen-blutende Enthauptungen
du hörst kaum die Schritte in meiner bitteren Mundhöhle
nicht die lässigen Schreie gemischt aus pochender Trauer und Sanftheit:
die roten Mandelkähne unserer Liebe hinter den Rosenschleiern
wasserhelle Enthüllungen und
die Apfelhaut deiner Lende – eine Frucht für mein grünes Herz
freilich die heitere Zeit ist flüchtig
und ich denke in langsamen Blitzen
und ich spreche zu dir weil du fern bist wie die Maulbeerbäume meiner
Kindheit komm heute nacht:
geblendet vom Mond wird heute die Nacht sein.
Hier erhellt dieser „Blitz“ die Bilderwelt und die „Kavernen“ eines liebenden Bewußtseins. Die Zeile von den „langsamen Blitzen“ gefiel der Autorin so gut, daß sie eine Sammlung von 29 Gedichten, die parallel zu den beiden ersten Abteilungen von Tod durch Musen – also in der Zeit von 1945 bis 1960 – entstanden sind, mit dem Titel In langsamen Blitzen versah und als Buch erscheinen ließ. Die typisch surrealistische contradictio inadjecto dieser Zeile besagt wohl, daß die Bilder zwar wie ein Blitz aufleuchten, daß aber dann durch das poietische Denken der Dichterin die Räume, in denen diese Bilder aufblitzen, langsam und oft mühevoll erhellt werden: die Kavernen des eigenen und des fremden Bewußtseins, die dunklen Höhlen der Welt und die Prunkgemächer einer phantasiegesteuerten Imagination, vor allem aber die immer rätselhafter werdenden Welten der Sprache selbst, die in der „bitteren Mundhöhle“ schrittweise entsteht und deren Materialgeheimnisse mit ihren Untiefen auszuleuchten sind. Die „wasserhellen Enthüllungen“, die hier von der Sprache zu erwarten sind, verbergen sich im Gestammel einer rosenroten Liebe.
Wenn wir heute das vorliegende Werk der Dichterin – die Bücher, die in den zwei Jahrzehnten zwischen 1956 und 1978 entstanden sind, und ihre Hörspiele, die zwar alle gesendet, aber nur zum Teil gedruckt wurden – überblicken, so fällt eine deutliche Dreiteilung ins Auge: die erste Periode umfaßt ihre surrealistischen Anfänge, in denen sie gleichzeitig schon das „lange Gedicht“ zu schreiben beginnt; die zweite Periode gilt dem „linguistischen Gedicht“ seit ihrer Hinwendung zur experimentellen und konkreten Dichtung; die letzte Periode, die mit der Sammeltätigkeit ihrer frühen Gedichte aus der surrealistischen Periode einsetzt, die Buchfassungen der Hörspiele umfaßt und in den drei Prosabänden je ein umwölkter gipfel (1973), Das Licht in der Landschaft (1975) und Fast ein Frühling des Markus M. (1976) im wahrsten Sinne des Wortes gipfelt. Für das Jahr 1978 sind vier weitere Bände zu erwarten, von denen vor allem die fiktiven Biographien von Brahms, Bruckner, Chopin, Schubert und Schumann in dem Bande Heiligenanstalt für die Autorin von besonderer Bedeutung sind.
Wie sehr schon gewisse Techniken der Reihung und der Iteration die frühen Arbeiten der Dichterin beeinflussen, soll uns noch ein Gedicht aus ihrer Frühzeit zeigen, das im Februar 1951 in den von Andreas Okopenko herausgegebenen Publikationen einer wiener gruppe junger autoren erschienen ist. Der Titel des Gedichts „… wird welken wie Gras…“ klingt deutlich an den berühmten Chor „Denn alles Fleisch ist wie Gras“ aus dem Deutschen Requiem von Brahms an, der seinerseits wieder sich auf eine Isaiasstelle bezieht. Der Text des Gedichtes lautet:
… Wird welken wie Gras. Auch meine Hand und die Pupille.
Wird welken wie Gras. Mein Fuß und mein Haar. Mein stillstes Wort.
Wird welken wie Gras. Dein Mund, dein Mund.
Wird welken wie Gras. Dein Schauen in mich.
Wird welken wie Gras. Meine Wange, meine Wange, und die kleine
Blume, die du dort weißt, wird welken wie Gras.
Wird welken wie Gras. Dein Mund, dein purpurfarbener Mund.
Wird welken wie Gras.
(Aber die Nacht. Aber der Nebel. Aber die Fülle.)
Wird welken wie Gras, wird welken wie Gras…
Was hier die aufzählende Reihung und die Wiederholung dichterisch zu leisten vermögen, ist evident. Was sie als „Struktur“ in einem experimentellen Text zu leisten vermag, davon legen die Gedichte der zweiten Periode in Friederike Mayröckers Schaffen ein vielfaches Zeugnis ab.
Ehe wir diese Periode näher betrachten, müssen wir auf ein wichtiges Phänomen hinweisen, worauf sowohl Harald Weinrich als auch Christian Johannes Wagenknecht im gleichen Jahre 1968 aufmerksam gemacht haben: auf den innigen Zusammenhang zwischen der Linguistik und der experimentellen bzw. konkreten Poesie. Betont Weinrich im Ablauf der poetologischen Entwicklungen von Baudelaire bis Celan unter Berufung auf Gottfried Benns berühmten Satz „Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht“, eben diesen „Fabrikationscharakter“, der dazu geführt hat, daß das „Machen“ selber als „leitendes Motiv“ in das Gedicht eintreten kann: „Gedichte werden möglich, die ihr eigenes Machen zum Gegenstand haben: Gedichte über Gedichte, Metapoesie“ und zieht er daraus seine linguistischen Folgerungen, die schon bei der noch nicht konkreten und nur teilweise experimentellen Poesie zur Erkenntnis führen, daß in der Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts es eben nicht mehr ausschließlich darum geht, „die Welt in intuitiver Mimesis oder in streng realistischem Protokoll abzubilden“, daß es vielmehr „um die Sprache, vielleicht nur um die Sprache“ geht, so sagt Wagenknecht von der konkreten Dichtung ausdrücklich:
Eine Poesie, die nicht von der Sprache handelt, wie von irgendeinem anderen Gegenstand, sondern sie selber sprechen lassen will, stellt, indem sie ihre phonetischen, graphischen und syntaktischen Potenzen phonetisch, graphisch und syntaktisch entwickelt, eine linguistische Poesie darstellt, in der Geschichte ein ebensolches Novum dar wie in der Geschichte der bildenden Künste die abstrakte Malerei, mit der sie sich gewiß nicht zufällig in einzelnen Texten unmittelbar verbindet. Und so wie die abstrakte Malerei, die freilich ebensogut auch konkret genannt werden könnte und genannt worden ist, nicht einfach einen neuen Stil begründet hat, dem ein neuerer folgen könnte, scheint auch die konkrete Poesie sich von keiner anderen mehr überholen zu lassen.
Ihre Freundschaft mit Ernst Jandl sowie die sympathisierende Nähe zu den Bemühungen der Wiener Gruppe in den fünfziger Jahren dürften das poetische „Problembewußtsein“ der jungen Autorin, die sich auf dem Wege vom Surrealismus zu einer neuen Ausdrucks- und Aussageform befand, noch verstärkt haben. Die Ansätze dazu zeigen sich bei ihr im „Langen Gedicht“, das nach Gerald Bisingers Feststellung noch stark von der „écriture automatique“ des Surrealismus beeinflußt wird und weitschichtig mit den langen Gedichten H.C. Artmanns verwandt ist. Schon in ihren frühen langen Gedichten zeigt sich manchmal ein gewisser „Stilleben“-Charakter, d.h., sie schreibt ähnliche sprachliche „Stilleben“, wie sie die Kubisten zwischen 1908 und 1912 gemalt oder wie sie Gertrude Stein in den Tender buttons versucht hat. Es wäre für einen Komparatisten reizvoll, darzustellen, wie die Anglistin Mayröcker ihr reiches Wissen um die moderne englische Literatur an die Dichterin weitergibt, die es dann für ihre Zwecke „poietisch“ ins Poetische transformiert. Otto Knörrich weist auf Einflüsse von Pound, Eliot und Cummings hin, verschweigt aber den für Friederike Mayröcker so wichtigen Einfluß von Gertrude Stein. Wir haben schon deshalb eingangs auf diese Verbindung hingewiesen.
Wenn Marie-Anne Stiebel in ihrem Nachwort zu den Drei Leben (Three Lives) von Gertrude Stein von der Sprache der Amerikanerin schreibt, daß sie an „Bauklötze, mit denen Kinder spielen“, erinnern, so denkt man unwillkürlich sofort an die mehr oder minder großen Sprachblöcke in den langen Gedichten Friederike Mayröckers, mit denen sie die mannigfaltigsten Gebilde aufbaut. Und wenn von Gertrude Stein hier weiter gesagt wird, daß die Nacktheit des Sprachmaterials ihre Phantasie beflügle, so könnte man sich zumindest fragen, ob Friederike Mayröcker in manchem ihrer Stücke der Sprache nicht das Sinnkleid, d.h. das Gewebe einer einwertigen, vordergründigen Bedeutung ausziehe, um sich dann an der Polyvalenz und Polyfunktionalität des „nackten Wortes“ und seiner Struktur zum „poietischen“ Werk zu entzünden. Wer ihre Technik der Arbeit kennt, würde von ihr das gleiche sagen, was Stiebel von der Stein berichtet:
Gertrude Stein hat jedes einzelne Wort der englischen Sprache neu überprüft, es wie einen Nußkern aus seiner Schale gelöst und bloßgelegt. Sie machte sich mit jedem Worte vertraut, weil das Wort für sie eine eigene Existenz besitzt. Bevor sie sich dazu entschließen kann, ein neues Wort zu gebrauchen, in ihr Satzgefüge aufzunehmen, trägt sie es wochenlang mit sich herum und fühlt sich unbehaglich, als führe man einen Fremden in einen Kreis alter Freunde ein. Wenn es aber gewogen und für gut befunden worden ist, dann stellt sie es kühn in den lichten Raum hinein. Dieser Prozeß verleiht Gertrude Steins Sprache ihre Intensität. Wie Blumen in den kargen Landschaften südlicher Länder blühen ihre Wörter auf und leuchten in der Wüste ihrer Sätze – Steppenblüten könnte man sie nennen. Der Einbildungskraft des Lesers überläßt sie es, den Sinn und die Bedeutung des Wortes an sich wieder zu entdecken und zu empfinden. So ist auch ihr bekannter Satz „A rose is a rose is a rose is a rose“ zu verstehen! Alles, was man sich beim Wort Rose denken kann, soll in ihm enthalten sein, alle Rosenarten, alle die verschiedenen Düfte, alle mit einer Rose verbundenen Freuden. Gertrude Stein stellt das Wort Rose, das einzelne Wort, vor den Leser oder Zuhörer hin, wie die Chinesen nur eine Blume in die Vase gesteckt haben, um ihre Schönheit hervortreten zu lassen. Und wie man diese einzelne Blume in der Vase an verschiedene Orte hinstellen kann, hoch, tief, vor eine Wand oder an ein Fenster, so wiederholt Gertrude Stein ihre Wörter im gleichen Satz, verschiebt sie innerhalb des Satzgefüges, um das einzelne Wort immer wieder in einem neuen Aspekt hervortreten zu lassen. Das scheint eine Erklärung für die Wort- Wiederholungen in ihrem Stil zu sein.
Von hier führt nicht nur ein Weg zurück zu Mallarmé und seiner Hochschätzung der Konstellation, sondern auch nach vorn zur Konstellationen-Theorie Eugen Gomringers vom Jahre 1955, in der er u.a. schrieb:
das wort ist eine größe. es ist – wo immer es fällt und geschrieben wird. es ist weder gut noch böse, weder wahr noch falsch, es besteht aus lauten, aus buchstaben, von denen einzelne einen individuellen, markanten ausdruck besitzen. es eignet dem wort die schönheit des materials und die abenteuerlichkeit des zeichens. es verliert in gewissen verbindungen mit anderen worten seinen absoluten charakter. das wollen wir in der dichtung vermeiden. wir wollen ihm aber auch nicht die pseudoselbständigkeit verleihen, die ihm die revolutionären stile gaben. wir wollen es keinem stil unterordnen, auch dem staccato-stil nicht. wir wollen es suchen, finden und hinnehmen. wir wollen ihm aber auch in verbindung mit anderen worten seine individualität lassen und fügen es deshalb in der art der konstellation zu anderen worten.
Man könnte also sagen, daß sich das Werk Friederike Mayröckers zwischen diesen Polen bewege. (Wie sehr der Pol Gertrude Steins noch wirksam ist, bewiesen erneut ihre „fiktiven Biographien“, die an die frühe biographische Tätigkeit der Amerikanerin erinnern!) Gerade Gomringers Theorie hat ja in den fünfziger Jahren die Wiener Gruppe und das Forum Stadtpark stark beschäftigt. Bei Friederike Mayröcker ist aber auch der kubistische Einfluß Gertrude Steins – natürlich in verwandelter Form – unverkennbar. Man muß bei John Malcolm Brinnin nachlesen, wie die literarischen kubistischen „Stilleben“ der Gertrude Stein unter dem Einfluß Picassos, Matisses und anderer Kubisten entstanden sind. Als solche aus Sprache gefertigte „Stilleben“ könnte man auch alle jene Texte von Friederike Mayröcker betrachten, die im Titel ein „mit“ haben, wie etwa: „Romanze mit Blumen“, „Text mit Steinen“ oder „Maschinen-Text mit F. Léger“, der durch die Evokation des berühmten kubistischen Malers schon ein Bekenntnis zu dieser Tradition vermuten läßt, wie übrigens auch ihr Text „Kahnweilers Lied“, der als eine Hommage an den berühmten Freund und Förderer der kubistischen Maler und Gertrude Steins gedacht ist. Ihr Name wird übrigens in einem Gedicht aus der gleichen Schaffensperiode beschworen:
Im Elendsquartier
Wo du mir Cummings vorliest
und ich dir Gertrude Stein
auf dem Drudenfusz stehend
dir den Rücken kehrend…
Betrachten wir so ein „Stilleben“ einmal näher, z.B. die
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaRomanze mit Blumen
… breitete uns ein Buch-Wort
Schellenwind – Geflüster? Schnell-Atem kerzenweis?
weisz weiter in lindernden Geschöpfen
verscholl dein Wort
mit bezwingendem Knie mit aufgelösten Fragen
weiter und weiter verzweigt
in den Gehöften (straszengebündelt)
mit einer Tafel schöner Blicke
durch Nebel (kristallin
durch etwas Frühling)
WasserschIund möglicher Hoffnungen
hast du mich angeschnallt an deine Gelenke
voll Blüten hoch erhobnen Blicks
schön Wahnsinns Gerinnsel in Tiefen
breit ungesagt Leben
breit ohne Formel
mit Flammen kommst du und ich brenne drei Mal zu end
fortwährend im Aug deiner Freunde
fliehend zu Deutschlands Fernen
atemlosen romanischen Kirchendächern
Weggefährten: springende Festen ausdauernder Schächte
dämmernde Brunnen
verankerte Nächte
durch Deutschlands stille ebene Sterne
weitgespannte Schönwange Bravour Blumenküsse und Gongoras
weiszt du wohin; weiszt du wie
weit und mit aufgeschlagenen Händen
und fürchte nicht Wegloses
Blume für Blume:
(Rauhblume Weiszblume Schönblume Engelwurz Bittersüsz
Eiche Himmelbrand Brennender Hahnenfusz Gartengleisze
Schneerose Quendel…)
Dieses zwischen 1960 und 1965 entstandene Gedicht gehört in die dritte und größte Gruppe des Bandes Tod durch Musen, einer Sammlung von Gedichten aus zwei Jahrzehnten. Betrachten wir diese drei unterschiedlich langen Sprachblöcke zu 11, 6 und 13 Zeilen, so fällt uns bei aller anfänglichen Verwirrung über die scheinbare Zusammenhanglosigkeit der Satz- bzw. Zeilenteile die merkwürdige Traumstimmung auf, die über das Ganze gebreitet ist, die das Unvereinbare, das hier unter einem Assoziationendiktat automatisch niedergeschrieben worden zu sein scheint, doch zu einem Ganzen macht, das aus Wortmaterial gefügt ist. Es ist der Traum, der Disparates zu harmonisieren vermag. Es ist der Traum, in dem die Plurivalenz der Worte, die Plurifunktionalität selbst der Laute dem Träumenden durchaus einsichtig sind oder werden.
Nur sehr guten Literatur-Kennern wird beim ersten Aufnehmen dieses Textes die Evokation des spanischen Barocklyrikers Luis de Góngora (1561–1627) auffallen, dessen hermetisch verschlüsselte Wortkunst und Stil des Kultismus gerade Dichter und Literaturkenner des zwanzigsten Jahrhunderts erneut in seinen Bann schlug. (Man denke nur an García Lorca, der seine Bewunderung für seinen großen Landsmann des siebzehnten Jahrhunderts offen bekannt hat.) Wir kennen schon aus den frühen surrealistischen Gedichten der Autorin die Evokation bestimmter Namen, die nicht immer, aber doch sehr oft pointierend eingesetzt wird. In diesem Fall soll der Literaturkenner durch die Beschwörung des spanischen Dichters nicht nur an den oft notwendigen Hermetismus moderner Poesie erinnert werden, sondern wohl auch an einen der Erfinder der spanischen Romanze, die von dort aus ihren Weg in die Weltliteratur angetreten hat. Daß die Form der Romanze, die auch hier ein verfremdetes – durch verschiedene assoziative Gedanken- und Redeströme unterbrochenes – Liebeslied ist, völlig aufgelöst wird, hängt ebenfalls mit dem Prozeßcharakter moderner Lyrik zusammen.
Die völlig offen gelassenen Satz- und Redeteile dieser drei Sprachblöcke, deren genaue linguistische Analyse wir hier nicht durchführen können, zeigen aber jedenfalls die Polyvalenz und Polyfunktionalität der Sprache, die unseren „Möglichkeitssinn“ dazu einlädt, die Potentialität der Worte und Sätze zu meditieren.
Auch auf dieses aus Assoziationen „montierte“ Gedicht der Friederike Mayröcker trifft zu, was Brinnin von Gertrude Stein im Unterschied zu Mallarmé gesagt hat:
Ein Gedicht von Mallarmé enthält eine kompakte, reich facettierte Gedankenordnung, die man wahrnehmen kann, wenn man das Gedicht mehrmals liest und die diversen Ebenen des Begreifens auslotet. In einem ,Gedicht‘ von Gertrude Stein findet ein Prozeß statt – das ,gedicht‘ bedeutet nur das, was der Leser während der aufeinanderfolgenden Augenblicke, in denen er es liest, empfindet.
Vor allem zeigt der poetische Text – so wie ein Text eines konkreten Gedichtes – als Sprachtext sich selbst in all seinen Möglichkeiten. In diesem Sinn würde für unseren Mayröcker-Text in noch größerem Maße zutreffen, was Brinnin von den dichterischen Bestrebungen Guillaume Apollinaires sagt:
Ein Gedicht von Apollinaire ist voll von Gedankenausstrahlungen, die den Leser vom geschriebenen Gedicht fort und in die freie Welt der Vorstellungen hinausführen, in die Poesie aller natürlichen oder geschaffenen Dinge.
Wir sprachen von „Stilleben“. Diese aus freien Assoziationen gebildete Romanze ist ein sprachliches „Liebes-Frühlings-Stilleben“ mit Blumen, die am Ende in schöner Reihung aufgezählt werden, wobei auch in dieser Aufzählung noch assoziative Bildungen wie „Himmelbrand“ neben der merkwürdigen Blume „Eiche“ vorkommen. Im Französischen heißt „Stilleben“ „nature morte“ (tote Natur). Merkwürdige Assoziationen könnten sich von da aus ergeben. Sind die Sprachstilleben sowohl der Gertrude Stein als auch der Friederike Mayröcker vielleicht Stilleben in einer „langue morte“, in einer tot, weil nur noch verdinglicht erscheinenden Sprache? Seltsame Paradoxie, daß sie dennoch von pulsierendem geistigem Leben erfüllt sind, ja ebenso geistige Gebilde sind, wie alle Schöpfungen der nichtmimetischen Kunst!
Die Poesie, die im Werke der Friederike Mayröcker demonstriert wird – das gilt vor allem für ihre mittlere Periode, die auch die großen Bände Minimonsters Traumlexikon und Fantom-Fan mit ihrer experimentellen Prosa umfaßt –, ist zwar noch nicht „konkret“, obwohl sie ihre Materialsensibilität von der Konkreten Poesie bezieht, aber sie ist auf dem Wege zu einer syntaktisch-semantischen Kunst, die nach Siegfried Johannes Schmidt ästhetische Prozesse in Gang setzt, für die nicht so sehr das Kunstwerk selbst, sondern vor allem der Prozeß entscheidend ist. Mit dieser Kunst – möge man sie nun abstrakt oder konkret nennen, zu der auch das „linguistische Gedicht“ gehört – „tritt“ – in der Formulierung Schmidts – „ein neuer Kunsttyp in die Geschichte ein, der das mimetische Prinzip in ein formal-syntaktisches transformiert: Nicht mehr die Re-Präsentation subjektiv interpretierter Wirklichkeit, sondern die Präsentation, Konstitution oder Generierung neuer, eigenartiger Wirklichkeiten tritt als Ziel der Werkproduktion in den Vordergrund.“
Wir wohnen dabei schon seit den Tagen des Surrealismus einem „Kernumwandlungsprozeß“ der Sprache bei, der uns in mancher Hinsicht an den von der Physik beschriebenen Kernumwandlungsprozeß in der atomaren Struktur der Materie denken läßt, worauf schon Werner Riemerschmid in seinem Aufsatz im Plan hingewiesen hat. In Friederike Mayröckers Hörspiel arie auf tönernen füszen sagt eine der Stimmen:
– höre gern, obwohl mitten
drin, bei mehr als fünf
gesprächspartnern auf
einzelne gesprächsstücke,
ohne dem allgemeinen fluß
folgen zu wollen –
wunderbare teilchen!
Die Assoziation mit der subatomaren „Teilchen-Struktur“ der Materie drängt sich einem geradezu auf!
Hier und in den anderen Hörspielen, die einmal einer eigenen Darstellung bedürften, werden Erinnerungs- und Gedankenfetzen und Gesprächsteile bzw. -teilchen miteinander – gleichzeitig oder zeitlos? – konstelliert und ergeben die Collage eines sprachlich realisierten Ineinanders von Unbewußtem und Bewußtem, dessen „Ich“ oszilliert (vgl. das große Vorbild Joyce!). Es ist ein Kraftfeld, das Wortfelder organisiert – immer anders, immer neu, sei der Innovationsschritt auch noch so geringfügig. Es bleibt dabei dem Leser oder Hörer überlassen, welche Stimme er besonders hervortreten lassen will oder welches Wortfeld in den Scheinwerferkegel der Bedeutungszusammenhänge, die ebenfalls auf Grund ihrer Polyvalenz oszillieren, gerückt wird. Jedenfalls vollzieht sich vor unseren Augen oder Ohren das Wunder, daß Gesprächs- bzw. Sprachteilchen in der Reflexion oder im Sprachexperiment einen Kernumwandlungsprozeß durchmachen bzw. durchmachen müssen. Dieser Umwandlungsprozeß zeigt sich phonetisch als „Lautprozeß“, syntagmatisch als Prozeß der offenen, polyfunktionalen Formen, syntaktisch als polyvalenter semiotisch-semantischer Prozeß.
In der dritten Phase krönt die Dichterin ihr Werk mit den drei Erzählungsbänden, in die sie alle poietischen Erfahrungen ihrer experimentellen Phase einbringt. Hier ist sie auf dem Weg zu jenen neuen Wirklichkeiten, die die moderne Kunst generieren will. Für alle drei Prosabände, die selbstverständlich wiederum die Sprache und das Sprechen als zentrale Thematik der Gegenwartsliteratur uns vor Augen führen, könnte als Motto eine Stelle aus je ein umwölkter gipfel stehen:
ich nähere mich, sagte er, in immer engeren kreisen der wirklichkeit, schrecke, sagte er, angesichts solcher umwege zurück, die von der wirklichkeit gefordert werden, sagte er; und so scheint sie mir in ihrer abweisung, sagte er, gleicherweise unbegehbar lockend.
Und dazu die alles enthüllende Dialogstelle über das Verhältnis der Dichterin zur Wirklichkeit, die unserer mimetischen Sprache widersteht:
du mußt ausreißen, sagte sie, aus der Wirklichkeit, aber sie mit dir hinunterreißen in den abgrund während du fällst. und wie ist dir das bekommen, sagte er. von nebenan, sagte sie, hörte ich in der stille des morgens, wie vorhänge vom fenster weggezogen wurden.
In allen drei Prosabüchern dieser Periode zieht die Dichterin die Vorhänge von jenem Fenster fort, das uns in die neuen imaginativen Welten blicken läßt, die diese Sprachkunst aus ihren ureigensten Mitteln, wozu auch die verschlüsselte Zeichen- und Bildersprache des Traums gehört, aufbaut. Immer wieder lesen sich ihre Texte der jüngsten Zeit als Traumstücke, die in einer unendlich geduldigen und mühsamen Arbeit bewußt und aussagbar gemacht wurden, wobei die Simultaneität, die schon die Kubisten darstellten, „die Gleichzeitigkeit von Vorgängen, von inneren Vorgängen also, die man gleichzeitig hat, mit allen möglichen Menschen gleichzeitig und mit sich selbst gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen“, eine wesentliche Rolle spielt.
Fassen wir zusammen: Friederike Mayröcker, in allen experimentellen Methoden sattelfest und sie souverän beherrschend, unterscheidet sich jedoch, nach einem schönen Worte Gerald Bisingers, „von den meisten ,experimentellen Autoren‘ dadurch, daß sie nicht bloß in Skeletten, Methoden und Techniken, die sie erfunden hat, vorstellt, die nun lehr- und lernbar sind, (mitunter sehr wichtige) Vor- und Werkstattarbeiten also, nicht aber Dichtung als singuläre Erscheinung wie eben ihre poetischen Texte“. Ihre aus dem Unterbewußtsein gespeiste Phantasie verbindet sich mit einer hochgradigen Material-Sensibilität, die sie sowohl zu semantischen als auch zu phonetischen Assoziationsreihen befähigt, mit denen sie ihre „Wortpolyeder“ – der Ausdruck stammt von Peter Weibel – schafft. Wenn man gelernt hat, bestimmte Signalwörter oder leitmotivische Wortgruppen zu erkennen, die in ihren großen Montage-Gedichten immer wiederkehren, dann wird man selbst angeregt von ihrer Methode der „assoziativen Progression“, vielleicht ihre offenen Texte, die manchmal syntagmatische Konstellationen sind, frei assoziierend weiterzubauen. Peter Weibel stellt an einer Stelle seiner Analyse ihrer Lyrik fest:
Bei wiederholter Annäherung lockern sich Visionen bestürzender Schönheit: Rapportsysteme, Strukturen, Affinitäten, Reihen, Analogien; ein Wort erscheint in einer Position, um an einer anderen unvermutet wieder aufzutauchen, sein Ort ist diskontinuierlich; Funktionsveränderungen der Präpositionen, der Substantive, der Adjektive; absolute und Genitivmetapher; Hypallagen.
Auch für die jüngsten Bücher gelten diese Feststellungen. Sie gehören mit ihrer elliptischen, offenen Form, mit ihrem Reichtum poetischer Möglichkeiten zu den bedeutendsten Prosawerken der österreichischen Gegenwartsliteratur. Ernst Jandl hat schon bei ihren Prosatexten vom Jahre 1968, Minimonsters Traumlexikon, den darin geschaffenen „poetischen Raum“ – er entsteht ähnlich wie bei Gertrude Stein an Hand eines konstanten Struktur- und eines variablen Formmodells – entdeckt, in dem man Weltraumreisen und Welttraumreisen unternehmen kann. Mit Recht weist er dabei auf den prachtvollen Text „Die Sintflut“ hin, in dem sich zeigt, wie die Poiesis in die Poesie transzendiert. Friederike Mayröcker, die am Fenster steht und in die „andere Wirklichkeit“ schaut und horcht, weil ihr von dort die neuen Signale eines poetischen Codes kommen, sprach einmal davon, wie sie reimende Elemente in ihren Texten verwendet, ästhetische Verdichtungs- und Verdünnungszonen erzeugt, Wortmaterial auflädt, atomisiert, deformiert, Collagen, Montagen, Assemblagen macht, Verba substantiviert und Substantiva verbalisiert, daß sie Wiederholungen verwendet, vor allem als Leitmotive, daß sie vor allem Disparates harmonisieren will, nicht durch müden Ausgleich, sondern durch eine vielgestaltige Koexistenz der verbalen Kräfte, durch gemeinsames Vorhandensein gegensätzlicher Elemente – all dies ist „poiesis“, Machen aus Sprache. Wie daraus aber die „Poesie“ entsteht, das ist für die Autorin manchmal selber unvorstellbar, unglaublich, ungeheuerlich… Und dennoch zeugt davon ihr reiches Werk.
Victor Suchy, in Kurt Bartsch u.a. (Hrsg.): Die Andere Welt. Aspekte der österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Hellmuth Himmel, A. Francke Verlag, 1979
Tomas Espedal, in der Nacht zum 5.6.2021, bevor er morgens von seinem deutschen Verleger die Nachricht vom Tod Friederike Mayröckers erhielt.
Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt Henkel
TOD DURCH MUSEN
sexgedicht mit postkoitaler depression
gott durch losen:
mut durch tosen
tut durchmoosen
glut durch fohsen.
hot durch busen,
flott durch stossen,
aaaaaaaatusch durch kosen.
müd durch schmusen,
spott durch loosen.
wut durch rosen.
schrot durch dosen!
Crauss
DAS IST FÜR FRIEDERIKE MAYRÖCKER
Die Kenntnis eines Dinges erzeugt Liebe zu ihm, je
aaaaagenauer die Kenntnis, desto brennender die Liebe
aaaaa– Leonardo da Vinci
Ich liebe das Ding, das du bist, bist und bist, der
aaaaaMaschine gleich
In einem Hals eingebunden die Wörter
Die möchten, nein, wollen, was die Ohren hören
Tiefer, brennender ist die Liebe eine Heilung
Eine Verbrennung, Narbe, hässlich auf der Hand
Über den Lippen wie der Mondschatten
Das Sprechenwollen der Kehle vernäht zu einem
Bauschigen Saum, die Stirn daran gepresst
Nicht gehen lassen wollen, nicht bleiben können
In diesen Stunden der blassen Lichter in Stuben
Der Näherinnen, der Frauen, die auftrennen
Immermüd
Nora Gomringer
FLIEGENDER HASE
Für Friederike Mayröcker
1
Sie sagt/ruft „Hase“ und dann
ist sie Hase, sie bittet um
Flügel und
dann flattert, schwebt sie,
reitet sie davon, hokuspokus
………………………………………(Kennerinnenblick)
und wir hinterher
2
Und immer die Angst, dass
der Kopf wegkullert
dass, plumps, auf den Kopf
der Himmel
und ein Gott durch die Fontanelle hineinfährt
und durch mich hindurch und Löcher
hinterlässt
Heda, kannst ruhig reinkommen, aber geh dann
auch bitte wieder raus und verteile dich
aufs Weltgeschehen
3
Schlaf wird
wieder wichtiger und
ich möchte auch bitte nicht
so viel Schmerz empfinden
weil alles abbröckelt oder
abblättert oder Flecken/ Streifen bildet auf der
Haut wie phönizische Schrift
auf Pergament
4
Mit der Schnauze die Erde aufrauen
verlorenes Dehnungs-h,
es erschnuppern,
fasset Mut
oder
sich aus Trotz
über den Rand des Universums lehnen wie über
die Schreibmaschine,
mit ihr verwachsen, Hingabe an die Schwerkraft
Körperhaltung = Schreibhaltung
so sterben
5
Wo bist du jetzt?
Schreib weiter, sagt sie
bis zum Schluss
Hasenbabys
Vermehrung
und zum Schluss ein
Komma,
Ruth Johanna Benrath
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Zettels Träumerin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.2024
Michael Wurmitzer: Das Literaturmuseum lässt virtuell in Mayröckers Zettelhöhle schauen
Der Standart, 17.4.2024
Barbara Beer: Hier alles tabu
Kurier, 17.4.2024
Anne-Catherine Simon: Zuhause bei Friederike Mayröcker – dank Virtual Reality
Die Presse, 18.4.2024
Paul Jandl: Friederike Mayröcker: Ihre Messie-Wohnung in Wien bildet ein grosses Gedicht aus Dingen
Neue Zürcher Zeitung, 17.6.2024
Sebastian Fasthuber: Per Virtual-Reality-Trip in die Schreibhöhle der Dichterin Friederike Mayröcker
Falter.at, 9.7.2024
Fabian Schwitter: Von Fetischen und Verlegenheiten
Kreuzer :logbuch, Oktober 2024
Cornelius Hell: Kreuz und quer durch Mayröcker-Texte
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und die Dorfwelt
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und der heilige Geist
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und das Skandalon des Todes
relidion.orf.at, 20.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker ist der Frühling
relidion.orf.at, 21.12.2024
Martin Reiterer: Gegen den Strich gebürstet
Der Standart, 16.12.2024
Iris Radisch: Majestät am Campingtisch
Die Zeit, 18.12.2024
Bernd Melichar: Sie weidete in Poesie, sie war nicht von dieser Welt
Kleine Zeitung, 18.12.2024
Clemens J. Setz: Ihre Stimme macht alle Selbstgespräche tröstlicher
Süddeutsche Zeitung, 19.12.2024
Oliver Schulz: Darum war Friederike Mayröcker von Sprache besessen
Nordwest Zeitung, 19.12.2024
Lothar Schröder: Einfach mit Larifari beginnen
Rheinische Post, 19.1.2024
Bernhard Fetz: Zum 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker
hr2, 20.12.2024
Joachim Leitner: Wie Friederike Mayröcker in Tirol den Mut zum „Mayröckern“ fand
Tiroler Tageszeitung, 19.12.2024
Marie Luise Knott: Engelgotteskind
perlentaucher.de, 20.12.2024
„Königin der Poesie“: 100 Jahre Friederike Mayröcker
Der Standart, 2012.2024
Martin Amanshauser: Durch ihre Welt tanzen die Blumen, Tiere und Gedanken
Die Presse, 20.12.2024
Gerhild Heyder: „Der Tod ist mein Feind“
Die Tagespost, 20.12.2024
Paul Jandl: Vor hundert Jahren wurde Friederike Mayröcker geboren: eine Dichterin, die mit ganzem Herzen an das glaubt, was von oben kommt
Neue Zürcher Zeitung, 20.12.2024
Richard Kämmerlings: Unaufhörlicher Dialog mit Lebenden und mit Toten
Die Welt, 20.12.2024
Peter Mohr: Den Kopf verlieren
titel-kulturmagazin.net, 20.12.2024
Michael Denzer: „Haben 1 Gedicht im Kopf“
salto.bz, 24.12.2024
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
und Interview 1, 2, 3 & 4
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA + IMAGO +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


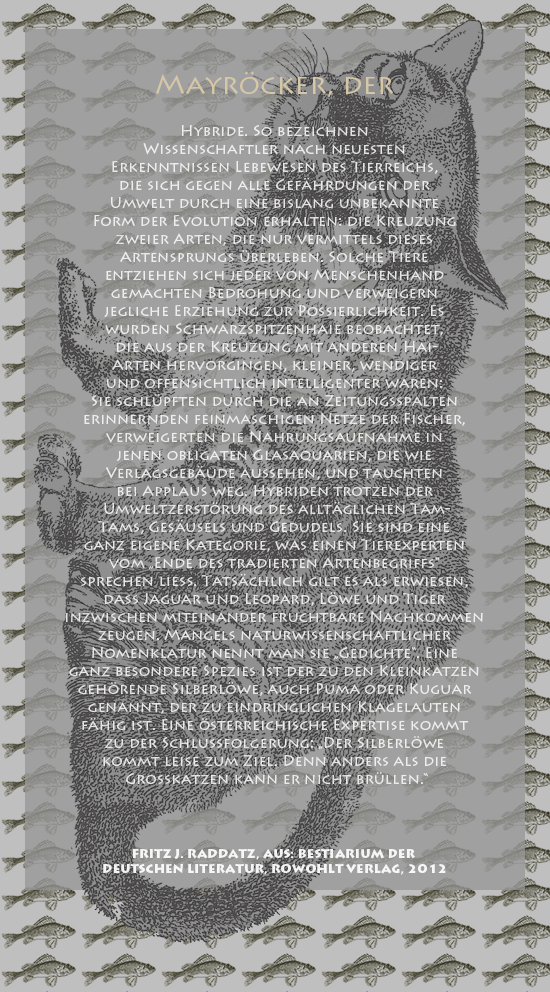












Schreibe einen Kommentar