Gellu Naum: Pohesie
FLÄCHE UND OBERFLÄCHE
Da könnte man in unschuldigen Varianten auch von
Erscheinungen reden die noch keinen Sinn ergeben
Das aber nur im Hinblick einer Ausflucht über die man
aaaaaschweigt
doch von der Haut der Oberfläche gehen bloß die Wellen aus
die auch imstande sind den Bau zu unterst zu oberst zu
aaaaakippen
während der Mond wie ein vierarmiger Diskus mit beiden Händepaaren
sich in den Schein honoris causa dehnt
und die brutale Faszination der Wörter ihn bereits
vom Sockel stürzt und eingehn läßt in eine Nähe
des Fitzelchens Papier das uns ausmacht
Als Oskar Pastior 1968 Rumänien verließ,
um in Deutschland zu bleiben,
hatte er unter dem Wenigen, das er mit sich führte, einen Gedichtband von Gellu Naum: „Athanor“, einen geistigen Ofen zur Erzeugung des Steins der Poesie. Seither hat Pastior Naum übersetzt, im Stillen zuerst, dann in zwei Auswahlbänden. Hier nun legt er sämtliche Gedichte Gellu Naums in seiner Übersetzung vor: ein doppeltes Lebenswerk also, Oskar Pastiors Hauptwerk als Übersetzer und das poetische Lebenswerk des größten Vertreters des rumänischen Surrealismus.
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 2006
Gellu Naum
Der eine wurde 1915 in Bukarest geboren, der andere 1927 im siebenbürgischen Hermannstadt; kennen gelernt haben sich Gellu Naum und Oskar Pastior aber erst einen heißen und einen kalten Krieg später. Doch als sie sich 1993 im Berliner Literaturhaus in der Fasanenstraße erstmals begegneten, hatte der jüngere der beiden, Oskar Pastior, schon eine ganze Reihe der Naum’schen Gedichte übersetzt. Bald erschien ein erster Auswahlband, dann ein zweiter und ein dritter. Jetzt, fünf Jahre nach Gellu Naums Tod und wenige Monate nach dem Tod seines Übersetzers, des Büchnerpreisträgers Pastior, liegt eine Gesamtausgabe der Gedichte des großen rumänischen Surrealisten vor.
DAS PFERD
Bei mir im Garten war ein Pferd gewachsen
Im Winter hatte ich gewisse Mühe
Es vor den Wurzeln der Maulbeerbäume
Und der eisigen Kralle der Sonne zu schützen
Auch im trockenen Dickicht saß der Frost
Nachts platzten an den Toren die Rohre
Und seine Mähne raschelte wie Schilf
Im Frühjahr kam das Wasser bei uns trüb
Brüste wackelten unter den Blusen
Und es war rein und wurde rot wie ein Ikonenheiliger
Weißt du – sprach es zu mir – wenn ich mich nicht bewege
Und ohne Auslauf hier in deinem Garten wachse
Dann sind so viele Fährten rings um mich
So viele Brücken über unser trübes Wasser
Du könntest mir für eine Nacht die Flinte leihen
Als Gellu Naum das soeben gehörte Gedicht veröffentlichen konnte, lagen 21 Jahre erzwungenen Schweigens hinter ihm. 1947 hatten die neuen Machthaber in Bukarest den noch jungen rumänischen Surrealismus, zu dessen Protagonisten auch Naum gehörte, verboten. Gedankliche Freiheit und Ungebundenheit, wie sie der surrealistischen Schreibweise eigen ist, konnten die kommunistischen Kunstwächter nicht tolerieren. Ihrer rationalistischen Gleichmacherei mussten die wilden Gärten, in denen Naums sprechende Pferde wuchsen, zuwider sein. Fortan hielt sich der Dichter mit Übersetzungen und Kinderbüchern über Wasser. Dabei spielte Märchen- und Fabelhaftes in seinem Schaffen schon immer eine große Rolle.
[Fortsetzung] Ihm berichtete ich nie von meinen nächtlichen Begegnungen mit der Störchin
Die mich rief in ihrem Ei zu schlafen
In gewisser Weise wussten wir um die Komplizenschaft des Wassers
Unter der Obhut des fruchtbaren Sandes
Barfuß auf dem Lehm spürten wir
Wie nah die feuchten Brüder waren
Das Brunnenrad quietschte die Kinder kamen aus der Schule blieben stehen und bettelten um Laugewasser
Führten feminine maskuline und sachliche Wörter im Mund
Weil das abstrakte Geschlecht sie beunruhigte
Und betrachteten das Pferd mit
Wissenden Augen alt wie die Welt
Und lächelten wenn sie den Mund sich wischten wie Fremde
Dann wuchsen Dahlien groß und schwer
Wie breite Messingspiegel
Und mancher müde Baum ließ sich ins Gras fallen
„Und mancher müde Baum ließ sich ins Gras fallen“ – aus vielen rätselhaften, widersinnigen, verstörenden Bildern taucht am Ende von Gellu Naums Gedicht „Das Pferd“ ein unmittelbar einleuchtendes, melancholisches und ergreifendes Bild auf: alte, sterbende Bäume, so stellt man es sich vor, die unter leichtem Stöhnen zusammensacken und sich lebensmüde ins Gras legen. Selten tauchen bei Naum Bilder von solcher Klarheit und Schlichtheit auf, was nicht heißen soll, dass seine Gedichte verworren und überladen wären. Unverständlich sind sie höchstens in einem heuristischen Sinn. Wenn man von ihnen aber keine eingängige philosophische Wahrheit erwartet, keinen begrifflich festzunagelnden Erkenntnisgewinn und auch nicht gefällige Landschaftsbeschreibung, sind sie im Grunde ganz einfach zu begreifen: als literarische Biographie eines Menschen. „Ich bin in allen Dingen“, sagte Naum einmal, „und alle Dinge sind in mir, die des Traumes, die der Wirklichkeit, was heißt das schon. Ich weiß nie, worüber ich schreibe, aber wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass ich immer über die gleichen Dinge schreibe.“
Zwischen gut und kalt zwischen schwarz und rein zwischen
Trüb und fließend zwischen ungewiß und säuberlich
Wie die unzähligen dunklen Geschäfte denen man nachgeht der Hydra von Lerna
aaaaazum Beispiel und einer Menge anderen
Wenn wir uns am Abend in den Eisblock zurückziehn
Wenn der direkte Nachfolger sein Gummibandel kappt
Wenn mit dem Finger auf der Stirn beim Meditieren diese Dinge selber uns zu denken beginnen
wenn dann die Hydra und die anderen Lernäischen aus ihrem anonymen Zustand treten
aaaaaum auszumisten was im Stall ist
Auch dieses Gedicht stammt, wie das zuerst gehörte Gedicht „Das Pferd“, aus dem 1968er Band „Athanor“, dem ersten, den Gellu Naum nach 21 Jahren veröffentlichen konnte. Er hatte früh schon Gedichte publiziert. 1936, da war er 21, erschien sein erster Band in Bukarest. Dieser war, wie Naums gesamtes Schaffen, deutlich vom französischen Surrealismus geprägt. Da aber dem Surrealismus etwas Chaotisches, Wildes, Unberechenbarautomatisches eignet, kann man sagen, dass viele in seine Schule gingen, niemand aber in ihr eingeschrieben war. Zumindest bei den großen Surrealisten, wie Naum einer ist, weist das Werk weit über die programmatischen Posen André Bretons hinaus. So schreibt der Herausgeber der nun auf Deutsch vorliegenden „Sämtlichen Gedichte“ Gellu Naums, Ernest Wichner, Naums „persönlicher“ Surrealismus erweise sich als eine „Mischung aus Biographik, Privatmythologie, schwarzem Humor und abgewandelten Restbeständen“ dessen, was einmal écriture automatique hieß. Sich getragen vom schwarzen Humor durch die Restbestände automatischer Schreibweisen zu bewegen und den Spuren von Biographik und Privatmythologie zu folgen bieten die „Sämtlichen Gedichte“ auf 856 Seiten reichlich Gelegenheit. So begegnet einem im soeben anzitierten Gedicht „Zwischen gut und kalt“ etwa das Motiv der metamorphotischen Beziehung von Flora und Fauna wieder, wie sie auch im Gedicht vom sprechenden Pferd eine wichtige Rolle spielt.
[Fortsetzung] Doch wie gesagt es wird der Baum
Zum siebenten Mal als Tier geboren werden
Und niemand wird es interessieren
Nest um Nest Ziegel um Ziegel Borke um Borke
Bekömmlicher Zweifel unser perfektes Händewaschen die unvorhersehbare Schwelle
Der intime Leitfaden für unsere Unzufriedenheit
Einmal mehr die gleichen feuchten Finger im Gesicht
(wirre Dekodierung von Matrixgebärden
auf einem Mergelquadrat einem Sog der Oberflächen)
Und verborgen in der trauten Falle auch der mir Unbekannten
Unser Himbeer- und Maulbeergedächtnis (Morula)
Athanor, der Gedichtband, dem diese Zeilen entstammen, war auch das einzige Buch, das Oskar Pastior mitnahm, als er 1968 nach Deutschland flüchtete. Und es gehörte zu den Büchern, wie er schreibt, in denen er „über die Jahre hinweg immer wieder mal ohne Grund und unmittelbaren Anlaß ein wenig las“, mit anderen Worten, so Pastior, ein wenig „übersetzte“. Dass er diese Übersetzung Naums noch vor seinem Tod abschließen konnte, ist ein Glücksfall. Ein Glücksfall ist es auch, dass es noch Verlage wie den Urs Engeler Verlag gibt, die die ökonomische Wahnsinnstat begehen, Gedichte eines wenig bekannten rumänischen Surrealisten auf fast 1000 Seiten auszubreiten, ihnen einen schönen Einband zu geben und auch Übersetzer und Herausgeber noch mit zwei klugen Essais zu Wort kommen lassen. Unmäßig, wer da noch Erläuterungen oder gar eine zweisprachige Ausgabe verlangt.
SEINESGLEICHER
Gegen Abend wenn die alten Landkreise
Aus dem Nebel kriechen
Geht ein sanfter Irrsinn durch die Welt
Und die Kälte bricht Seinesgleicher nun
Spazierend Arm in Arm mit einem Baum
Die Fingerspitzen rostig an den Schläfen
Ist immer deutlicher zu hören je stiller
Er wird jetzt will er mir sogar
Mein unterbrochenes Gedächtnis auffrischen
Was aber suchst du dort und
Weshalb befällt uns solche Kälte
Naums Gedichte besitzen in der Übersetzung Oskar Pastiors eine Eigenständigkeit, wie sie nur den wenigsten Übersetzungen und überhaupt nur wenigen Originalgedichten eigen ist. Die Diskussion darüber, ob zu wörtlich oder zu frei übersetzt wurde, erübrigt sich in diesem Fall. Man liest die deutschen Gedichte wie eigenständige Werke, ohne allerdings in ihnen Pastior-Gedichte zu lesen. Gleichwohl ist die Verwandtschaft der beiden Rumänen zu spüren. Pastior bringt sie in seinem Nachwort auf die Formel Schüler-Meister-Verhältnis. Zum Teil ist dies sicher eine Bescheidenheitsgeste. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, in Naums Gedichten spontane Entsprechungen dessen zu lesen, was bei Pastior erst einer Textmaschine, eines voreingestellten Textgenerators oder eines oulipistischen Konzepts bedarf. Daher rührt wahrscheinlich Pastiors Verehrung für Naum: dass dessen Gedichte voll von Wunderbarem und Bizarrem einen inhärenten, automatischen Code besitzen; keinen hermetischen Schlüssel, sondern eine poetische Konsequenz, gegen die jedes Computerprogramm alt und schlampig wirkt. „Gellu Naums Texte“ schreibt Pastior, „denken so dicht und so genau, nicht nur weil dem Autor jede Rhetorik zuwider ist, sondern aus einer poetisch genuinen Nüchternheit heraus.“ Hören wir nun zum Schluss eines der schönsten Gedichte Naums. Es ist, wie viele seiner Gedichte, die für die Ewigkeit sind, erst nach 1990 entstanden. Ob eine solch späte Reife tatsächlich mit dem Alter zu tun hat oder mit dem Ende der Ideologien, dem sich lösenden Klammergriff der Zeit, bleibt offen.
GRÜNER LÖWE UNBESTIMMTER PELIKAN
Im Labyrinth kommt uns ein Pelikan entgegen
In grünen Nebelschwaden unter buntem Flitter
Und ruft achtmal Vater und achtmal Unser
Weil er grinst kriegt er von mir
Ein paar triste abgehackte Watschen
Etwas später findet sich der Wächter ein
Die Geliebte gibt mir einen Kuß die labyrinthischen Bienen geben mir Honig
Der Wächter zuckt mit keiner Wimper
„es will Abend werden“ meldet er
eine lehmige Wolke zieht auf
Tobias Lehmkuhl, Deutschlandfunk
Die Pohesie der Ereignisse
− Er gehörte zum Kern des rumänischen Surrealismus: Gellu Naum. Er übersetzte Gedichte von Kafka und Diderot, schrieb wunderbare Kinderbücher. Mit dem rund 850 Seiten starken Gedichtband „Pohesie“ erweist sich Naum endgültig als ganz Großer der Weltlyrik. Es ist der gelebte Surrealismus. −
Klein und zart könnte er auch gewesen sein. Ich aber habe Gellu Naum als einen großen, schlanken Herrn mit vollem Haar und tiefer Stimme in Erinnerung. So tauchte er in den 90er Jahren in Berlin auf, nie ohne seine liebenswürdige Frau Lygia, oft an seiner Seite der erst in Berlin als Freund erkannte Mittler Oskar Pastior. In Münster haben beide Dichter 1999 den Preis für Europäische Poesie erhalten.
Gellu Naum, geboren am 1. August 1915 in Bukarest, dort gestorben am 29. September 2001, war damals schon eine verehrungswürdige Figur der rumänischen Literaturgeschichte und des internationalen Surrealismus. Als Freund des großen Malers Victor Brauner, als Weggefährte von Ghérasim Luca, von Paul Pãum, Dolfi Trost und Virgil Teodorescu gehört Naum zum Kern des spät entstandenen rumänischen Surrealismus. Ghérasim Luca ist übrigens in der Übersetzung von Mirko Bonné und Theresia Prammer ebenfalls bei Urs Engeler erschienen. Die französische Bewegung um André Breton hat er 1938/39 in deren Endphase durch Victor Brauner kennen gelernt. Naum wollte schreiben, wie Victor Brauner malte. Also erkor er den Surrealismus zu seiner Lebensform. Surrealismus „machen“, wollte er nicht, aber ihn leben und neu erfinden. Vielleicht erschien er ihm als das Okular, durch das seine Zeit und seine Welt nur mehr kenntlich waren.
Erst in Paris, dann in Bukarest war Gellu Naum bis 1947 (freilich mit den politisch bedingten Unterbrechungen) noch an Gemeinschaftspublikationen und an Ausstellungen beteiligt. Ende 1947 wurde dem ein jähes Ende gesetzt. André Breton, der 1935 Ilja Ehrenburg öffentlich geohrfeigt und sich später von Louis Aragon und Paul Eluard, dem prosowjetischen Flügel des Surrealismus, getrennt hatte, war nun in den Augen der neuen kommunistischen Machthaber und der sowjetischen Kommissare der falsche Freund. Bis 1968 dauerte das Berufsverbot des Dichters.
Naum hat diese zwanzig Jahre für ein riesiges Übersetzungswerk genutzt. Beckett und Kafka, René Char und Jacques Prévert, aber auch Denis Diderot oder die schönen Schmöker der Dumas (père und fils) hat er übersetzt, und wunderbare Kinderbücher hat er auch noch geschrieben. Und er hat wahrscheinlich nicht einmal darunter gelitten, dass er keine eigenen Gedichte veröffentlichen durfte.
Wollte er denn überhaupt der große Dichter sein, der er zweifellos gewesen ist? Selbstbewusste Poeten trifft man allemal in Rumänien, doch Gellu Naum gab vor, nichts als „Pohesie“ zu schreiben. Er konnte auch lachen über die Poesie und ihr eine Nase drehen. Dann wandte er sich um und schrieb „Pohesie“.
Paul Celan, der 1947 aus Bukarest nach Wien und dann weiter nach Paris geflohen war, hat als erster ein Gedicht Naums ins Deutsche gebracht, dafür allerdings eine fehlerhafte französische Vorlage aus den „Cahiers du Sud“ von 1946 benutzt. Oskar Pastior (1927-2006) hat, als er 1968 Rumänien verließ, Naums gerade erschienenen Gedichtband „Athanor“ mit nach Deutschland gebracht.
Der Band und das darin enthaltene Gedicht „Anfang und Mittelpunkt“ markiert und antizipiert 32 Jahre nach dem ersten Gedichtbuch und 32 Jahre vor dem letzten zu Lebzeiten erschienenen so etwas wie die Mitte des Lebens, das in einem Tagtraum auf den Punkt gebracht wird: „und Platon mein obskurer Gaul / fanatisierte die Grammatik“.
Ernest Wichners Nachwort erhellt hier die private Mythologie des Surrealisten und unfreiwilligen Kavalleristen vom September 1941 durch ein reales Zitat: „Stell dir doch mal vor, wie das ist, du kommst aus dem Pariser Künstlermilieu zurück nach Bukarest, wirst notdürftig militärisch ausgebildet, na klar, Akademiker, Unteroffizier und so, und dann sitzt du in voller Montur auf dem Rücken eines armen Pferdes und reitest in die Ukraine hinein. Im Kopf hast du noch Bretons Aufruf ,Weder euer Krieg noch euer Frieden‘; vor dir ist der sogenannte Feind und hinter dir sind die Verbündeten: erst die Ungarn, dann die Deutschen, und alle schießen sie wie wild, du bist von lauter Wahnsinnigen umgeben.“ Platon? Vielleicht bedurfte es eines philosophischen Pferdes, damit dieser Reiter von der traurigen Gestalt in der Mitte seines poetischen Daseins die Unangemessenheit einer grammatischen Gangart erkennen konnte, in die ihn jener mörderische Krieg der falschen Verbündeten und der falschen Gegner einzubinden drohte. Naum war ein bekennender, doch parteiferner Revolutionär aller verderbten Normen von Politik, Sexualität und Kunst. Deshalb hatte er auch die, für die er in den Kampf ziehen musste, zu fürchten; offenbar wusste Naum von einer Akte, die man gegen ihn verwenden konnte. Vielleicht aber war jener obskure Gaul auch nur der falsche Dialogpartner für einen Dichter, der auf dem Weg war, seine Grammatik der Auflehnung von unmittelbaren Zwecken und Utilitarismen zu befreien.
Die frühen Gedichte funkeln noch, jedenfalls in Pastiors Übersetzung, mit den frechen, kessen Grotesken in der Art der deutschen Expressionisten Jakob van Hoddis und Alfred Lichtenstein. Naums Zeilen „junge Herren schnuppern vornehm-elegant an unseren Frauen / die Fabriken knirschen mit den Zähnen“ weckt die Erinnerung an Verse aus „Weltende“ des Jakob van Hoddis: „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut …“. Der ältere Gellu Naum bricht Sprache nicht auf. Lieber ergibt er sich dem ruhigen Fluss seiner parataktischen Sätze, wird auch zum lyrischen Erzähler, der die Bilder der Natur liebt und ihnen in tiefem Vertrauen folgt. Doch eine Zeile wie „Es wehte kühl Dunkelheit kam auf und unser müdes Denken ertrank in seinen Buhnen“ steht nicht im Widerspruch zum Handwerk des Diamantschleifers, von dem Oskar Pastior spricht. Naum gibt sich der Natur nur „in einer großen Denkanstrengung“ hin, und selbst in der geringsten „Unordnung des Auges“ droht eine Gefahr für „die menschliche Kontur“ (1994).
„Athanor“, das Buch aus der Mitte des Lebens, und nahezu alle früheren und späteren Gedichte Gellu Naums hat Oskar Pastior Naum lesend übersetzt, und Ernest Wichner, der Herausgeber der Pastior-Ausgabe des Hanser Verlags, ist nun auch der Herausgeber und gelegentliche Mitübersetzer der Gellu Naum-Werkausgabe geworden, deren erster Band am Tag von Oskar Pastiors Tod auf die Frankfurter Buchmesse gelangte. Dieses lyrische Lebenswerk ist zugleich Pastiors größtes Übersetzungswerk, und der Übersetzer hat ihm nichts Oulipotisches übergestülpt, sondern sich in Naum hineingelesen.
Der in nur 500 Exemplaren erschienene Band umfasst 31 Textgruppierungen beziehungsweise Bücher aus der Zeit von 1936 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Das sind rund 850 Seiten „Pohesie“ auf Deutsch (Zweisprachigkeit hätte hier keinen Sinn ergeben).
Der umfangreichste Gedichtband des Jahres erschließt ein lyrisches OEuvre des gelebten Surrealismus, ein Werk, das verunglimpft, zensuriert und verboten wurde und sich als eine riesige Insubordination in seiner völligen Eigenständigkeit behauptet hat. Der „Pohät“ oder „Pohet“ hätte es nicht ertragen, dass sich auch nur ein Satzteil dem anderen unterordnet. „und wir noch nicht Vertriebene vom Ort der Asche an dem wir Anspruch / hätten wenigstens zu lauschen wie die Erde ins Nichts taumelt und / auseinandergeklammert uns in der enigmatischen Substanz der Liebe / zu wiegen … phonetisch denkend ist an diesem Ablauf nicht schwer zu begreifen daß / so vieles passiert und wir halten die Ohren uns zu um nicht mehr zu / hören doch die Ereignisse brausen von innen nach außen“ (1990) „Ohne Punkt und Komma“, wie Oskar Pastior das genannt hat, schiebt sich in der Parataxe der Bilder, der widerspenstigen Gedanken und ironischen Entlarvungen ein Ausdruck von Welt voran, der uns selbst dann noch erreicht, wenn wir uns die Ohren zuhalten vor dem Schrecklichen, denn „die Ereignisse brausen von innen nach außen“.
Herbert Wiesner, Die Welt, 29.12.2006
Gellu Naum
− Pohesie. Sämtliche Gedichte. −
Wenn dieses Buch nicht 856 Seiten schwer wäre, könnte man es als Taschenbuch – im ursprünglichen Sinne des Wortes, also als leichtes, mit sich herumzutragendes Buch, das in jede Jacken- oder Handtasche paßt, empfehlen. Aber diese über ein Kilo schwere, wunderschön ausgestattete Ausgabe der Sämtlichen Gedichte von Gellu Naum ist nicht unbedingt fürs Unterwegssein geeignet, man muß sie doch am Tische oder im Sessel zur Hand nehmen. Fürs leichte Gepäck empfiehlt sich dann das Abschreiben oder das Auswendiglernen, und diese heute vielleicht nicht mehr ganz übliche Anstrengung lohnt sich bei vielen Gedichten des rumänischen Dichtes, der hierzulande erst noch richtig entdeckt werden muß.
Gellu Naum betonte einmal, daß er keinen Surrealismus mache, sondern Surrealist sei. Und das merkt man allen seinen Gedichten an. Mit Leichtigkeit setzt er die Realität außer Kraft, um poetische Bilder zu schaffen, die absurd und konkret zugleich sind.
Gellu Naum wurde 1915 in Bukarest geboren, er studierte dort und in Paris Philosophie. Mit 21 Jahren veröffentlichte der Student seinen ersten Gedichtband. Er hatte drei Jahre zuvor in einer Bukarester Galerie Bilder des rumänischen und in Paris lebenden Malers Victor Brauner gesehen. Er wolle so schreiben, wie Brauner male, beschloß Naum, und es war Brauner, mit dem ihn dann eine lebenslange Freundschaft verband. Brauner war es auch, der ihn in seiner Pariser Zeit, von 1938 bis zum Kriegsausbruch 1939, mit den Surrealisten um André Breton zusammen brachte. Als er nach Rumänien zurückkehrte, gründete er in Bukarest eine Gruppe rumänischer Surrealisten. Bis Ende 1947 waren gemeinsame Publikationen und Ausstellungen möglich, dann aber, als Rumänien unter kommunistischer Regierung stand, wurden die surrealistischen Aktionen verboten. Gellu Naum verdiente nun seinen Lebensunterhalt mit Übersetzungen und schrieb Kinderbücher. Ab 1968 konnte er wieder eigene Gedichtbände veröffentlichen. Gellu Naum starb 2001.
Der Dichter Oskar Pastior, der 1968 Rumänien verließ, um dann in Berlin zu leben, übersetzte nach und nach die Werke seines Freundes, und er konnte das große Übersetzungswerk, das nun vorliegt, noch vor seinem eigenen Tod – Pastior starb im letzten Jahr während der Frankfurter Buchmesse – abschließen.
Der Band „Pohesie“ versammelt Gedichte aus den Jahren 1936-2000. Da Gellu Naum sich seinem eigenen Anspruch „Surrealist zu sein“ über die Jahrzehnte hin treu geblieben ist, wirkt dieses lyrische Werk, das doch in sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Zeiten entstanden ist, erstaunlich einheitlich.
Gellu Naum erzählt von der Liebe, von Freunden, von der Familie, er malt Landschaften, er inszeniert Kämpfe und aberwitzige Figuren, aber immer sind es auch Traumgesichte, immer ist es auch ein Spiel mit der Sprache, ein Aufbrechen der Konvention, die Suche nach der wahren Poesie. Er läßt kein Komma, keinen Punkt zu, als müßten seine Gedichte offen bleiben für weitere Assoziationen, für Bilder, die im Kopf des anderen entstehen.
Oskar Pastior, der kongeniale Übersetzer, überlegt in seinem Nachwort, ob sich möglicherweise alle Gedichte von Gellu Naum, inklusive seiner eigenen Anmerkungen, in einer Kuh abspielen. Bei Gellu Naum ist eben alles möglich. Naums Wortwitz, seine Ironie, seine Wort- und Bildschöpfungen machen das Lesen zu einem vergnügen. Und es sind die Irritationen, die kleinen Verschiebungen und Absurditäten, die Erkennen und Erkenntnis auslösen, oft mit einem Lachen.
Bei einer Ausgabe, die „Sämtliche Gedichte“ eines Autors versammelt, kann nicht jedes Gedicht gleich ansprechend, gleich überzeugend sein. Aber manchmal entdeckt man mitten in den Langgedichten auch nur eine oder zwei Zeilen, die schon ausreichen können für den täglichen Lyrikbedarf.
Hanne Kulessa, Hessischer Rundfunk, Welle 13
Bukarest – Paris
− Die Gedichte von Gellu Naum. −
Ein Buch mit dem Format und dem Gewicht einer kleinen Schatzkiste, die nichts als Pohesie enthält – und damit zugleich das gesamte lyrische Schaffen Gellu Naums und das übersetzerische Hauptwerk Oskar Pastiors, der jahrzehntelang um die Vermittlung dieses rumänischen Dichters bemüht war, der doch nie einer sein wollte, jedenfalls nichts mit der althergebrachten „Stinkejauche süßer Verse“ und „dem tristen Reimschleim“ zu tun haben mochte. Eher schon war Naum darauf aus, seine „Stinke- / socken an den Ruhmestagen vor der Pforten der Rumänischen Akademie zu hissen“, wie es in einem frühen Text heißt. Als Pastior 1968 Rumänien verließ, nahm er Naums gerade erschienene Sammlung Athanor mit in den Westen und begann, „den Details und den Mäandern seiner Rede Wort für Wort zu folgen“, wie Pastior schreibt. Athanor war der erste Gedichtband, der Naum nach langem Publikationsverbot, nach Jahren des spärlichen Broterwerbs durch literarische Übersetzungen, gestattet worden war, und mit ihm begann sein später, langsamer Aufstieg zu einem Klassiker der Moderne.
Dabei hatte er der rumänischen Dichtung schon drei Jahrzehnte zuvor entscheidende Impulse gegeben, als er mit Ghérasim Luca (dessen Gedichte vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls im Verlag Urs Engelers erschienen sind) und anderen den Surrealismus für die rumänische Sprache fruchtbar machte. Ende der dreißiger Jahre waren die Freunde gemeinsam nach Paris gereist, um mit der französischen Avantgarde Kontakt aufzunehmen, vor allem natürlich mit André Breton. Der, so die Überlieferung, sah den Hauptsitz des Surrealismus nur wenige Jahre später von Paris nach Bukarest verrückt, mit so viel Intensität ging die Gruppe der Heimkehrer um Luca und Naum zu Werke. Während Luca der „eingesperrten Klanglichkeit“ der Sprache Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, Morpheme und Silben aus dem gewohnten Rahmen entband und der Syntax zu Leibe rückte, geht es in Naums Gedichten weit mehr um eine semantische Freiheit. Gerade die frühen Texte lassen erahnen, wie wichtig das revolutionäre Konzept der écriture automatique für ihn gewesen sein mag: „Pünktlich wird die Straße den Passanten verspeisen / der aus den Pedalen unter seiner Stirn / Glasmurmelgeräusche fahren lässt die dann / den ganzen Tag tönen und die Pfütze umarmen als ob / das eine Trauerweide sei und die Pfütze wird sich / ärgern wegen des Klaviers und auf die schma- / le Kathedrale klettern“.
Dixtung! Gedyxt!
Welche Provokation in dieser Verweigerung von Bedeutung, von Deutbarkeit gelegen haben muss, ist noch immer offenkundig, auch wenn sich der revolutionäre Impuls mittlerweile verflüchtigt hat. Brisanter als die ganz frühen Versuche wirken nach wie vor die Gedichte, die Naum ab den fünfziger und sechziger Jahren schrieb und die später in Athanor eingingen.
Hier findet man Perlen wie die Gedichte „Häute“, „Das Zimmer“, „Meine große Schwester“, nicht zuletzt die „Hennenerscheinung“ und viele mehr. Von Eingängigkeit und Routine sind sie weit entfernt, doch ist ihr Ton entspannter, scheinen sie mit größerer Umsicht und Selbstgewissheit umgesetzt – auch wenn die entworfenen Topographien genauso beunruhigend sind, auch wenn der Leser nach wie vor mit Witz und Virtuosität in ein Sprachgebilde gelockt wird, in dem vielen Wegen, vielen Fäden gefolgt werden kann, in dem trotz des listigen und oft benutzten Wortes „gewiss“ aber kaum etwas gewiss ist.
Nicht umsonst, bemerkt man lesend, hat Naum ein ausgesprochenes Faible für Spiegel. Die großen Themen klingen zwar alle an – die Schuld, die Liebe, die „alte Gier nach Intimität“ und die „Traurigkeit des Fleisches“ -, doch hält sich kein Gedicht länger als nötig bei ihnen auf, schlagen sie alle, ganz im Gegenteil, rasch eine Volte und verweigern sich dem rationalen Verstehen, dem landläufigen Sinn. Zu skeptisch ist Naum, was die großen Worte angeht, mögen sie sich auf die eigene Kunst beziehen, die er meist als „Gedyxt“, „Dixtung“ oder eben „Pohesie“ bezeichnet, oder auf Konzepte wie das „Jehenseits“.
Unterschiedlichste Tonlagen werden mit viel Koketterie verknüpft, die pathetische Anrufung kippt sofort um in den grotesken Vergleich. All dies ist oft von großer Komik, gelegentlich ermüdend, manchmal unergiebig – aber wer alle Kostbarkeiten benennen wollte, die sich in dieser Buch-Truhe befinden, käme mit dem Zitieren an kein Ende. Über das „quälende Gefühl, dass ich nichts gemacht habe als Poesie“, schrieb Naum, der 2001 im Alter von 86 Jahren starb, in einem Essay, befürchtend, „dass ich nichts gefunden habe als das, was man das Schöne nennt, dass ich nichts gelöst habe als eine dichterische Aufgabe“. Das mag sein. Für den Leser aber ist das eine bleibende Bereicherung.
Jan Wagner, Frankfurter Rundschau, 1.2.2007
Gellu Naum: Pohesie
− Sämtliche Gedichte. −
Ein Buch, dessen breiter Rücken gerade noch in die Hand passt und dessen Gewicht man beim Lesen gerade noch mit einer Hand halten kann: ein gewichtiges Buch also, ein Kompendium, das einen ganzen Kosmos enthält. Und eines der wenigen Bücher mit zwei Lesebändchen. Offenbar soll man es, so lässt sich daraus folgern, nicht nur von einer Seite her lesen und nicht nur an einer Stelle innehalten. Der Umschlag ganz in Weiß, in schwarzer Schrift stehen vier unregelmäßige Verszeilen darauf, darunter in leuchtendem Hellblau – wie der Bucheinband – das seltsame Wort „Pohesie“. Und damit man die Orientierung nicht verliert, steht daneben noch: „Gellu Naum. Sämtliche Gedichte.“ Zwischen den Buchdeckeln ist wirklich ein poetischer Kosmos ganz eigener Art enthalten, der zwischen den Jahren 1936 und 2000 entstanden ist, Stücke der unterschiedlichsten Art enthält und doch unverkennbar zusammengehört.
Wenn man überhaupt etwas weiß von Gellu Naum, dann das: Er war Surrealist. So hat er sich auch zeit seines Lebens verstanden. Er sagte von sich: „Ich musste Surrealist sein, ich konnte nichts anderes sein. Ich könnte sagen, ich sei prädestiniert gewesen dazu. Meine Struktur, alle meine Wege führten dorthin.“
Begonnen haben diese Wege 1936 in Bukarest, wo Naum mit 21 Jahren seinen ersten Gedichtband veröffentlichte: „Der wandernde Brandleger“. Seine wilde Anarchie poetischer Bilder hat damals eingeschlagen, die Kampfansage dahinter war ja auch unüberhörbar:
Das fünfseitige Gedicht will „die Stinkejauche süßer Verse“ abfließen lassen; hier spricht einer, der es fertigbringen will, „meine Stinkesocken an den Ruhmestagen vor den Pforten der Rumänischen Akademie zu hissen“. Außer wenigen unvermeidlichen Punkten und Doppelpunkten fließt dieser Textstrom interpunktionslos dahin. Von der pathosschwangeren Politrhetorik der rumänischen Vorkriegszeit weiß er sich gerade in seinen Schlusszeilen deutlich abzugrenzen:
Und der Abend leckte an den Fensterscheiben der Abend
war eine Propagandabroschüre.
1938 ging Gellu Naum nach Paris, setzte sein Philosophiestudium an der Sorbonne fort und kam mit André Breton und seinem Kreis in Kontakt. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach Rumänien zurück, wurde zum Militär eingezogen und verwundet. Doch bis 1947 war er Mittelpunkt einer Gruppe rumänischer Surrealisten, deren Aktivität André Breton zur Aussage veranlasste, das Zentrum der surrealistischen Bewegung habe sich nach Bukarest verlagert.
Etwas für die Surrealismus Typisches, die Verbindung von logischer Argumentationsfigur mit Begründungen, die jeder Alltagslogik zuwiderlaufen, findet sich in Zeilen des 1943 entstandenen Gedichts „Verschwiegene Morgenstunden“:
Im Gedicht „Der Korridor des Schlafs“ findet sich eine Aufforderung, die in ähnlicher Weise logische Sprachstruktur und alogische Bildwelt verbindet:
Und was die Liebe betrifft so / sollst du viel Blau auf die Augen tun oder sie geschlossen
halten. Wir / werden dann wenigstens glauben, dass du ein großer Stern bist.
Nach der kommunistischen Machtergreifung wurde der Surrealismus verboten und Gellu Naum konnte 20 Jahre kein einziges Werk veröffentlichen. Über Wasser gehalten hat er sich als glänzender Übersetzer: Von Diderot und Stendhal bis zu Kafka und Beckett bekam man in Rumänien vieles in seiner Übersetzung zu lesen; noch in den 1990er Jahren war das von ihm übertragene „Warten auf Godot“ ein Bühnenerfolg.
Der Großteil des poetischen Werkes von Gellu Naum entstand erst nach 1968, als er wieder publizieren durfte – er war bereits 53 Jahre alt. Großgedichte in freien Formen sind entstanden, auch Texte, die zwischen Lyrik und Prosa angesiedelt sind, aber auch kurze, prägnante Gedichte wie dieses:
TIEFEN DER OBERFLÄCHE
Es hätte eine Begleitmusik für Häuser gebraucht
es hätte ein paar Klänge für Spiegel gebraucht
es hätte ein paar entschieden resolute Handbewegungen gebraucht
doch man läutete die Glocken
und aus ihnen fielen nur große Watteklumpen heraus
Und immer wieder gibt es Passagen, die man sich gut als surrealistische Bilder vorstellen kann, wie den Beginn des Gedichts „Adler auf Urlaub“:
In dem opulenten Band fíndet man auch Bilder aus alten Inseraten mit schrägen Texten, die nicht dazu passen, oder – bereits 1959 entstanden, „Grammatikalisches“: Hier treibt Naum mit Genitivbeispielen seinen Schabernack. Dass er in den 1990er Jahren zum überragenden rumänischen Lyriker und zu einem Klassiker des 20. Jahrhunderts wurde, hat für sein Schreiben keine Stagnation bedeutet, sondern neue Kräfte frei gesetzt. Knapper, gezielter und strenger komponiert wird das immer noch surrealistische Bildmaterial eingesetzt:
Es waren liebliche Täler ihr Wermut bitter und samten die Hügel und / die Pferde der Dunkelheit gesattelt und das alle stimulierte unseren / Wunsch da zu wandern – so beginnt eines der nahezu strophisch gegliederten Gedichte. Gegen den Bereich der chaotischen Klarheiten oder gegen eine Klarheit / die verfälscht und vergisst ziehen Gellu Naums Gedichte noch immer kompromisslos zu Felde.
In einem kurzen, präzise komponierten Gedicht setzt er sogar den Reim ein, den er freilich zugleich auch unterläuft:
DAS KREISEN
Immer an der Wand lang
um die man nicht herum kann
führt der blinde Mann den blinden Mann
indes mein Kreisen um mich selbst ver-
bannt und setzt zugleich das Erste Wort
ins Wort das nichts mehr nennt be-
ziehungsweise trennt
Poesie, oder – wie Naum sie nennt – Pohesie bleibt für ihn immer noch das, was sie ihm schon im Jahr 1945 war: eine Form der höheren Unzufriedenheit“.
In manchen Gedichten der späten 1990er Jahre ist vom Alter und vom Zu-Ende-Gehen die Rede, etwa in der „Rede auf dem Bahndamm an die Steine“ oder in den leichten, schwebenden Bildern des folgenden kurzen Gedichts:
DIE EISPFERDE
Bald ist Schluß mit allem
und wir wandern alle in klirrender Kälte
zusammen über ein endloses Feld
bis dann auf einmal unsere Eispferde wiehern
bis dann auf einmal unsere Eispferde schmelzen
Natürlich trifft man auf 850 Seiten Poesie auch einmal auf taubes Gestein. Natürlich gibt es auch schwächere Gedichte, die sich totlaufen. Aber es sind erstaunlich wenige.
Selbstverständlich kann man den Band nicht einfach vom Anfang bis zum Ende durchlesen. Aber es ist garantiert, dass man immer wieder Erstaunliches darin findet.
Dass man das gesamte poetische Lebenswerk Gellu Naums jetzt auf Deutsch lesen kann, ist der jahrzehntelangen Übersetzerarbeit des im Vorjahr verstorbenen Oskar Pastior zu danken. Aus Hermannstadt stammend, war er im Rumänischen zu Hause, und seine kongeniale dichterische Potenz befähigte ihn, Naums Bilder und Sprachspiele nachzuerfinden. Die wenigen Gedichte, die in Pastiors Übersetzung noch fehlten, hat der ebenfalls aus Rumänien stammende Ernest Wichner übertragen. Er hat auch ein wichtiges Nachwort beigesteuert, in dem er Naums „persönlichen Surrealismus beschreibt als „sehr eigene Mischung von Biographik, Privatmythologie, schwarzem Humor und abgewandelten Restbeständen dessen …, was einmal écriture automatique hieß – hier in halbwachen Tagtraumzuständen gesehene und bearbeitete Texte“.
Zu danken ist diese Jahrhundertedition auch dem mutigen Verleger Urs Engeler, der sich rückhaltlos der Poesie verschrieben hat. Er hat mit diesem Band seine deutschsprachige Gellu Naum-Ausgabe gestartet.
Cornelius Hell, Österreichischer Rundfunk, Ex libris, 11.3.2007
Nocturne Betrachtungen auf den Hügeln des Weltgebäudes
– Laudatio zur Verleihung des Preises der Stadt Münster für Europäische Poesie 1999 von Sibylle Cramer auf Gellu Naum und Oskar Pastior. –
Was ist die Welt?
Wir bewohnen sie und sind uns ihrer bewußt. Warum, um alles in der Welt, befragen wir sie nicht? Einst, in Glaubenszeiten, waren die Theologen und Philosophen zusammen mit den Künstlern zuständig für Fragen wie diese, die dem Ganzen der Wirklichkeit gelten, dem Absoluten. Die Metaphysik in Theologie und Philosophie ist abgetreten, als letzte Metaphysiktreibende ist die Kunst übriggeblieben. Aber wo man hinschaut, bei Klopstock, Goethe, E.T.A. Hoffmann, Byron, Baudelaire und Jean Paul, die Weltfrage wird mit Vorliebe obskurem Gesindel überlassen, Ironikern, Nihilisten, Satanisten oder gleich dem Teufel selbst. Das sind die Geister, die stets verneinen, aber auch die Negation führt in die offene Frage zurück. Jean Pauls Teufel, stellvertretend für seinesgleichen ringsum, weiß sich nicht anders zu helfen, als den Fundus der christlich-abendländischen Metaphysik zu plündern. Er holt die alten Vorschläge hervor, das Weltspiel, Welttheater, die als Einheit von Gegensätzen organisierte Weltharmonie. Nur wird jetzt, was dort Glaubenswahrheit war, zur Metapher.
Der Teufel antwortet verblümt.
Was aber ist die Welt unverblümt?
Die Frage führt recht besehen geradewegs zu Gellu Naum und Oskar Pastior. Gellu Naum beantwortet sie in fünf Verszeilen. Auf den Hügeln der Welt heißt das Gedicht, dessen Lakonik, Konkretheit und Klarheit eine Ahnung vermitteln von der klingenden Struktur aller seiner Texte, ihrer nüchternen Schreckens- und Entzückensmomente, ihrer intelligenten Leidenschaft, begriffenen Sinnlichkeit, ihrem drastischen, komischen, banalen Umsturz des klassischen Schönen und Erhabenen. Es ist die Sprache des Geistes, der ohne jeden Selbstverlust wieder einfach geworden ist. Die Aussagen des Gedichts decken sich mit dem Ursprungsgeschehen in altägyptischen Kosmogonien. Danach ist die Welt unten, ein finsteres, nasses Lokal voll flutenden, ungeschaffenen Lebens. Auf den Hügeln der Welt bearbeitet der autogene, aus sich selbst entstandene taube Weltschöpfer wutentbrannt das Klavizimbel. Die Leere wird zu seinem Auditorium. Das ist ein hochironisches Selbstbildnis des Künstlers als Demiurg.
Das parallele Gedicht Oskar Pastiors Allgemeine Betrachtung ueber das Weltgebaeude, legt die demiurgische Potenz von Sprache frei. Die Titelzeile entstammt Johann Peter Hebels Erzählungen des Rheinländischen Hausfreundes. Pastior unterwirft sie einer anderen, einer mathematischen Grammatik. Im permutativen, im Bäumchenwechseldich-Spiel der Lettern und Laute übersetzt sie sich in sich selbst. Was durchaus regelhaft, aber gegen das Regelsystem der Sinnlogik entsteht, ein elfzeiliges Anagrammgedicht, ist nun aber keineswegs sinnlos. Das Gedicht selbst sagt, wohin es uns verschlagen hat, in „Multischallgegenden“. Dort ist unsere bekannte Sprache eine unter unbekannten. Ihr Klangbild, Tonfall, Zungenschlag, kurzum, ihre sprachliche Physiognomie macht sie als Idiome erkennbar. Hier streift die Kombinatorik das Undenkbare, daß die auspermutierte Zeile, die ein schier unendliches Gedicht ergäbe, an den Anfang zurückführte, zu den babylonischen Ursprüngen der Sprachvielfalt, in mythische Zeit, wo Wort und Ding eins sind.
Beide Antworten auf die Frage, was die Welt ist, Gellu Naums totale und Oskar Pastiors totalisierende, münden in Begriffe, die der Barockmusik entstammen, hier das Klavizimbel, dort die Tabulatur, eine alte Instrumental-Notenschrift, der Pastiors Gedicht ausdrücklich gegensteuert. Die Barockmusik teilt mit den altägyptischen und alttestamentarischen Schöpfungsberichten die Kompositionsmethode. Derselbe Schöpfungsakt, der die Welt zu einer Einheit von Gegensätzen ordnete, Himmel und Erde, Wasser und Land, Licht und Finsternis, setzt in der musikalischen Komposition punctus und contrapunctus entgegen. Das Weltwerk und das menschliche Weltkunstwerk haben als kontrapunktisches Konzert ihre Harmonie in sich selbst. Aber die Welt Gellu Naums ist kein klingendes Abbild der göttlichen Schöpfung. Gellu Naums Welt ist sein Werk.
Sein Werkzeug ist eine Sprache, die dem geltenden Sinnsystem seinen Eigensinn entgegensetzt, eine Sprache der Identität und Authentizität, deren materiale Oberfläche und Sinntiefe zusammenfallen. Die Welt ist in den Wörtern selbst. Ihre Sinnlichkeit ist nicht metaphorische Anschaubarkeit, sie ist konkret. Die Wörter komponieren. Das ist Gellu Naums Königsweg in die mythische Geographie eines Unbewußten, das sich anders als bei Sigmund Freud, anders als in der psychoanalytischen Theorie als Kunstwerk des Lebens entschlüsselt. So kommen sie zusammen, Sinnlichkeit und Reflexion, so sind die Gegensätze Natur und Geist momenthaft aufgehoben. Es sprechen eine selbstbewußte Natur und ein Bewußtsein im Wechselstrom von sinnlicher Erfahrung und Reflexion. Bäume rauschen in den Wörtern, und der Mensch stammelt, aber es sind keine Wörter. Der Himmel ist Stille. Die Steine hören zu. Die Reisenden legen sich in Hunde, und der Wald ist in ihnen. Welt, so bestimmt, ist nicht an sich da, sie hat keine belegbare Realität außerhalb des Bewußtseins. Der Roman Zenobia, sein erstes ins Deutsche übersetzte Werk, wendet das Mythische entschieden ins Profane und stellt die Liebe, eine Leidenschaft unter der Bestimmung des Geistes, dar als Form totaler Welterschließung. Im Mythischen entdeckt Gellu Naum die Natur des Geistes, ihre Verwandlungskraft, ihre Produktivität, den Quellgrund des Werdens und jenen verborgenen Automatismus: das Denken des Denkens, die Ränder des Denkens.
Zum Beispiel die „Möbiusschleife“. Möbiusschleife heißt ein Gedicht Gellu Naums, ein Selbstbildnis des Dichters als Möbiusschleife. Die Möbiusschleife ist ein Ring, ein zusammengeklebter Papierstreifen etwa. Um 1800 zur Schleife gedreht, springt er auf eine Fläche mit nur einer Seite, aus dem Endlichen ins Unendliche. Das Gedicht Gellu Naums folgt mathematischen Prinzipien, der Symmetrie. In sieben Versschritten, bei regelmäßiger Verkehrung der Seitenfolge, ordnet der Dichter Gliedmaßen und Gebrauchsgegenstände links und rechts um sich. So wickelt er sich in eine Folge von Ebenen von zugleich immer größerer und immer imaginärer Wirklichkeit. Der Gegensatz von Innen und Außen, Wirklichkeit und Phantasie, verschwindet. Was entsteht, eine Möbiusschleife, ist mitten im Rationalen ein Unendlichkeitsverweis.
Das Gedicht fiel Oskar Pastior 1968, kurz vor seinem Weggang aus Rumänien, auf, als er in dem eben erschienenen Gedichtband Athanor blätterte. Kein Wunder, in seiner vollkommenen Einheit von Poesie und Wissen ist der Text ein Vorschein der Utopie, auf die Oskar Pastiors Werk zusteuert. Es macht die Trennung von Poesie und Wissen rückgängig. Es könnte ein Gedicht Oskar Pastiors sein, eines jener Gebilde, die tendenziell auf ein vollständig erfaßtes Universum aus Sprache zusteuern und sich im Zielpunkt träfen mit einer Universalphysik, die alles wüßte – auch, daß es die Sprache ist, mit der sie den Aufbau ihrer Tatsachenwelt vollzieht.
Pastiors Gedichte klären sich selber auf. Sein Sprachkunstwerk reißt die Grenzen zwischen Text und Technik, Poesie und Poetik, Dichtung und Deutung ein. Er ist ein Aristoteliker der Kunst. Seine alexandrinische Bibliothek schreibt er sich selbst, einen von Buch zu Buch sich erweiternden Sprachatlas, der Sprache vermehrt, der in mögliche Sprachen neben, zwischen und hinter die bekannten Sprachen führt. Das ist seine Methode der Annäherung an eine in seinem Fall imaginäre Einheit zwischen Wort und Ding. Die Sachbücher der Poesie, die danach folgten, sind poetische Sprachlehren, die ihren eigenen logischen, technischen, phonetischen, morphologischen Zustand untersuchen. Seine Vokalisen, seine Palindrom-, Anagramm- und Sestinenstudien sind unübertrefflich kunstvolle Forschungen, die der sinnbildenden Eigendynamik der Sprache gelten und staunend die Tatsache beobachten, daß einschränkendes Regelwerk Sprache hervorbringt, daß demnach Determination und Freiheit in der Sprache aufs gedeihlichste zusammengehen, daß die Grammatik Sprache erzeugt.
Neben dem modernen Mythologen Gellu Naum ist Oskar Pastior der moderne Methodiker. Nicht der Mythos, die Geschichte ist der Grund eines Werks. Er befragt die Welt des Wissens, deren Objektivität kontrollierbar und überprüfbar zu sein behauptet. Und siehe da, er stößt auf Sprünge in ihrem Kausalsystem, auf Zufallsphänomene, Kopfstände der Vernunft. Die Übersetzungssprünge in der molekularen Logik des Lebens gehören dazu und der Gödelsche Unvollständigkeitssatz. Er selbst nennt die Bifurkation in der Chaostheorie, die Rotverschiebung und die Möbiusschleife. Er beobachtet die Ohnmachten des Exakten, die Begrenzungen der Wissenschaft und träumt von einer idealen Sprache des Wissens, die im Unterschied zur Wissenschaftssprache frei von allen Einsickerungen der Prophetie, Meinung, Geschichte wäre und aus reinem Wissen bestünde. Damit schlösse sie zur Poesie auf und fiel mit ihr zusammen, einer Poesie, die alle Sprachen, auch die vergessenen und nichtgesprochenen, einschlösse und der physikalischen Welt entspräche. Es ist ein Traum, so rational und total wie die Möbiusschleife.
Das Gedicht Möbiusschleife nahm Oskar Pastior, damals in Bukarest, im Kopf mit nach Wien und München. In Berlin, wo er sich niederließ, wurde die „Möbiusschleife“ zum Ausgangspunkt eines zunächst apokryphen, dann schriftlichen Grenzverkehrs zwischen dem rumänischen Comana und Berlin und, 1993, als Lygia und Gellu Naum das Jahr seines 80. Geburtstags in Berlin verbrachten, der Bekanntschaft und Freundschaft der beiden Schriftsteller. Die Gedicht-Übersetzungen, die im Laufe der Jahre ohne äußeren Anlaß entstanden, unter ihnen die Möbiusschleife, gingen in den ersten ins Deutsche übersetzten Gedichtband Gellu Naums ein, einen Auswahlband, der 1993 erschien. Im vergangenen Jahr folgte der zweite, Rede auf dem Bahndamm an die Steine. Als erste zweisprachige Edition eines Werks Gellu Naums haben wir nun Zugang zu seinem poetischen Greifwerkzeug, zu seiner Sprache. Mit den krimgotischen Idiomen Pastiors teilt sie die Intelligenz und Komik und die Eigenschaft, dem Sirenengesang der Kunst Verstand einzupflanzen. Einträchtig stehen sie nebeneinander, das Kunstwerk in rumänischer Sprache und das Kunstwerk in deutscher Sprache, jeweils auf der linken und rechten Buchseite, ohne Schleifentricks. So überlassen sie es uns, hier in Münster, das vor mehr als vierzig Jahren geknüpfte Band zu verknoten, zu drehen und zuzuziehen.
Gellu Naum und sein Übersetzer Oskar Pastior werden für den Gedichtband Rede auf dem Bahndamm an die Steine mit dem diesjährigen Preis für Europäische Poesie ausgezeichnet. Damit besiegelt die Stadt Münster einen Bund, der die schöne Paradoxie der Möbiusschleife hat: den Bund zwischen zwei Künstlern, deren ästhetische Positionen einander auszuschließen scheinen. Der Surrealist Naum reißt die cartesianischen Grenzen zwischen Wirklichem und Unwirklichem, Vernünftigem und Unvernünftigem, Sinnhaftem und Unsinnigem ein. Den Vernunftapostel stellt er auf den Kopf und sagt: „Ich denke, also bin ich nicht“ und: „Du mußt mit den Händen denken lernen“. Er wendet sich gegen einen normativen Wirklichkeitsbegriff, der Erfahrungsbereiche wie den Traum, Wahnsinn, den Okkultismus, die Mystik, die Metaphysik und den Mythos ausschließt. Er ist Schöpfer eines Weltreichs, das in die Geschichte hineinführt und aus ihr hinaus, in unsere dreidimensionale Welt und aus ihr hinaus ins Vielfach- oder Einfachdimensionale, womit er offenbar jene heitere Dimensionen meint, wo man mit einem Kopf auf dem Kopf herumläuft. Der analytisch fragmentierten Moderne setzt er seine absolute Realität entgegen. Das Absolute ist kein Verweis auf göttliche Instanzen, es ist innerweltlich, ihr Prinzip. Er ist ein Nachfahre der romantischen Reflexionskunst. Er sucht die künstlerische Synthese.
Nichts liegt der Konkreten Kunst ferner, der Pastiors Werk zugerechnet wird. Sie ist Rationalistin durch und durch. Aber mit ihren analytischen Methoden legt Pastior Spuren in ein Weltreich der Sprache. Die uneingeschränkte Permutation hat ja zur Voraussetzung, daß alle Welten und alle Sprachen, auch die unentdeckten, daß eine unermeßliche Welt voller Welten als möglich gedacht werden können. Pastiors künstlerisches Selbstaufklärungswerk hat mit Gellu Naums Surrealismus den utopischen Fluchtpunkt gemeinsam, die Versöhnung von Natur und Geist, von Ding und Wort. Sie teilen die Überzeugung, daß die Poesie dem positiven Wissen, dem wissenschaftlichen, überlegen ist und Rationalität und Totalität vereinbar sind. Absolutisten, Universalisten sind beide.
Beide gehören zu dem aufständischen Fähnlein auf der oppositionellen Seite der Kunstfront, wo das Bezugssystem Sprache kein allgemeines mehr ist und kein sinnlogisches und die Selbstverständlichkeit des Verstehens endet. Beide gehören sie innerhalb der Sprach- und Dichtkunst der alten ehrwürdigen Fakultät der Proteuser an. Im Unterschied zum prometheischen Künstler findet der proteische das Unendliche im Endlichen vor und stellt es selbstbewußt dar, konkret. In seinem Roman Zenobia hat Gellu Naum einige Proteuser um sich versammelt, den Vorsokratiker Empedokles, die Mystiker Jacob Böhme und Meister Eckhart, den Sprachsystemiker Raimundus Lullus, den Existenzphilosophen Sören Kierkegaard und den Vorsurrealisten Raymond Roussel. Oskar Pastiors Anagrammgedichte führen zu Johann Peter Hebel, sein Werk ist ohne die Dadaisten, die Konkrete Kunst und die Pariser Oulipoten, vor allem aber ohne den Russen Velimir Chlebnikow nicht denkbar.
Die europäische Landkarte überzieht der diesjährige Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie mit einem dichten Netz von Verbindungslinien, die entfernteste Orte, Zeiten, Sprachen und Geister einander zuordnen, das Dorf Comana im Süden Rumäniens und die Charlottenburger Schlüterstraße, den Rückzugsort Lygia und Gellu Naums in den Jahrzehnten der Unterdrückung und das Domizil Oskar Pastiors. Der Preis verbindet die osteuropäische Avantgarde mit der westeuropäischen, die Surrealisten in Bukarest, die 1947 von den Kommunisten verboten wurden, mit den Surrealisten in Paris, mit denen Gellu Naum 1938 in Paris bekannt geworden war; er verbindet den Schwarzwälder Bund der Proteuser um Johann Peter Hebel mit dem russischen Avantgardisten Velimir Chlebnikow, den Astronomen und Mathematiker August Ferdinand Möbius, der 1844 Direktor der Leipziger Sternwarte wurde, mit dem Thomaskantor Bach, der im Musikalischen Opfer eine Möbiusschleife komponierte, den flämischen Graphiker Maurits Cornelis Escher und den amerikanischen Erzähler John Barth, den Argentinier Jorge Luis Borges und den New Yorker Maler Barnett Newman – kurzum, der Preis verwandelt die Landkarte in eine einzige große schöne Nachbarschaft – und mehr, er zeigt auf Zusammenhänge zwischen ältester und jüngster Kunst und verweist in unserer Zeit, deren Kunst eine Kunst der Einzelheiten sein soll, auf ästhetische Positionen, die an den alten großen Anspruch der Kunst festhalten. Ich gratuliere der Jury zu ihrer Entscheidung.
Und nun die Möbiusschleife, Gellu Naums einfach kompliziertes Gedicht in Oskar Pastiors Übersetzung:
Meine linke Hand und mein rechtes Auge
mein linker Handschuh und mein rechter Stiefel
meine rechte Leuchte und mein linkes Pferd
mein linker Apfel und meine rechte Stimme
mein rechter Rock und mein linkes Ohr
meine linke Mütze und mein rechtes Ohr
mein rechter Schlüssel und mein linker Läufer
undsofort undsoweiter
Aus: Als ihr Alphabet mich in die Hand nahm, Daedalus Verlag, 2011.
Gellu Naums
erste Gedichtsammlung erschien 1936. Sein Titel Drumetul incendiar, der in der deutschen Übersetzung Der Brandwanderer lautet, wurde neulich von Richard Anders beim Lesen eines französischen Artikels über den rumänischen Surrealismus mit Der entzündete Reisende wiedergegeben. Oskar Pastior wird eventuell auf die richtigere Lesart verweisen. Die Variante signalisiert jedenfalls etwas Ansteckendes, das auf dem Weg vieler Sprachen ist. „Surrealismus“ heißt die große Schublade, die Gellu Naums Poesie nur insofern faßt, als er sie in kritischer Auseinandersetzung mit allen ihren Manifesten und Grundbegriffen immer wieder aufgezogen hat. Und so hat er auch den traditionellen Begriff von der Poesie schon zeitig „aufgezogen“, indem er ihn mit einem „h“ auflockerte und als „Pohesie“ mit dem ironischen Abstand zu allen Formen ihrer Festschreibung weiterführte, Denn eine „ständige Durchdringung von Traum und Wachzustand“ verlangte, um wahrgemacht zu werden, vor allem nach einer anderen Porosität im dichterischen Medium. „Der Sohn der Raserei und des Schattens“, wie der Impuls einer permanenten Empörung im Surrealismus genannt wurde; brauchte eine neue Wahrnehmung für die nächtlichen Seiten der Zeit. Diese Bereitschaft bezeichnet Gellu Naum mit seinem Wort von der „aktiven Erwartung“ bzw. einem „Zustand gespannter Disponibilität“.
…
ich sage Tisch Bett Vorratskammer
doch in der harschen Poetik unserer Beziehungen
muß ich das Brot mit der Lunge schneiden
Brennholz mit der Zunge spalten
und mit den Ohren Wasser holen gehen
heißt es in seinem Gedicht „Mutter der Dinge“. Hier klingen die Schritte an, mit denen das Subjekt die Mitte seiner Welt verläßt, um den Traum wieder auf den Boden jener einfachen Tatsachen zurückzuholen, die sich plötzlich auf eine schmerzhafte und dennoch wunderbare Weise von sich selbst abheben. Und so ist es auch das Wunderbare, das mit diesen Gedichten immer wieder von der alltäglichen Behauptung seiner scheinbaren Unmöglichkeit entbunden wird. Heute; fast 60 Jahre nach seiner Begründung eines rumänischen Surrealismus, dessen Idee dem Vernehmen nach während einer Heimreise von Paris im Orientexpreß entstand, gilt Gellu Naum als der letzte echte Vertreter dieser poetischen Strömung; einer Strömung, die sich zwischen den Kontinenten des Unterbewußten, des Traums und den mehrsprachigen Wirklichkeiten ihr Bett gräbt; in dem die Unruhe und das Wunderbare sich begegnen können, um in einem gegenseitigen Akt der Erkenntnis aus dem Alptraum der Geschichte zu erwachen. Jede dichterische Konvention, die das chaotische Bündnis zu ordnen versuchte, würde über kurz oder lang die Freiheit vernichten, ohne deren Voraussetzung die Begegnung zwischen dem Wunsch und seinem Gegenstand keinen entsprechenden Raum fände, einen „Raum nächtlichen Charakters“, wie es bei Gellu Naum in einem Bezug auf Lautréamont gesagt ist. Daher ist es kein Wunder, daß der Dichter seine einmal erhobene Forderung, daß die Poesie sich von der Literatur befreien müsse, permanent in die Tat seiner freien Assoziationen umsetzt, in der die Verschiedenartig der Lebensweise und derjenigen der Dichtung in radikaler Aufhebung begriffen sind. Etwa 25 Bände „Pohesie“ hat er veröffentlicht und über hundert Titel der Weltliteratur übersetzt. In den zwei Jahrzehnten zwischen 1947 und 68 durfte er keine Gedichte publizieren, weil er sich jedem Ansinnen verweigerte; seine Lyrik mit der politischen Macht des Landes zu versöhnen. Stattdessen schenkte er dem Ländlichen, in das er sich zurückzog, surrealistisches Augenmerk und bereicherte damit die Topographie der ansonsten städtisch orientierten Bewegung. Bis heute wurde er in ca. zehn Sprachen übersetzt, darunter erstmals ins Deutsche von Paul Celan.
Andreas Koziol, aus einem Vortragsmanuskript
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1, 2 & 3
und zum IM Stein Otto
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Oskarine ist ein Gedicht-Generator von Ulrike Gabriel, der auf den Gedichten von Oskar Pastior basiert. Jedes Gedicht spricht sich selbst – immer neu und mit der Dichter-Stimme.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
Nachruf auf Gellu Naum: Der Tagesspiegel
Gellu Naum im Gespräch.


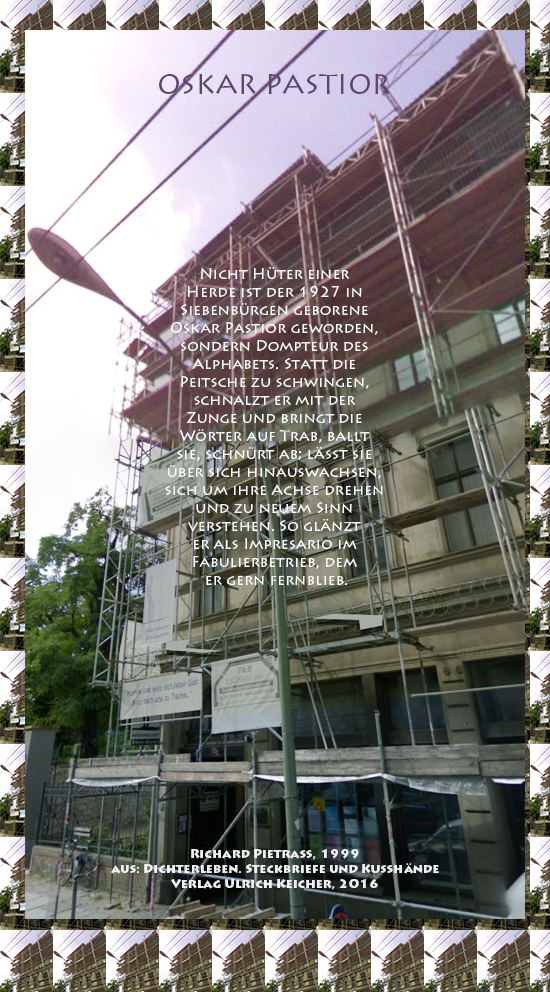












Schreibe einen Kommentar