Gellu Naum: Rede auf dem Bahndamm an die Steine
DIE SCHLÄFER
Sie kamen uns mit Argumenten wie die Finsternis
wollten keine Beweise dafür sondern bloß
intime Gleichheit in dem Vorzug eines traurigen Ver-
schmelzens mit einem ungeschriebenen und im
aaaaaGedächtnis
verschwundenen Ereignis einen Ort gewissermaßen
ohne Ausdehnungsvermögen oder Elastizität
etwas das alles werden und gleichzeitig in den Fängen
dieses Herbstzustandes bleiben könnte
Oskar Pastior und Gellu Naum lesen abwechselnd Gedichte in deutscher Übersetzung und rumänischem Original aus dem 1998 bei Ammann erschienen Band Rede auf dem Bahndamm an die Steine am 3.4.1998 im Literaturhaus Berlin. Die Übersetzung der Gedichte des für Oskar Pastior ungemein wichtigen Gellu Naum stammen von Pastior selbst.
Ohne Punkt und Komma
– Das Lesen und das Übersetzen Gellu Naums. –
So einfach ist das. Nur wenn ich jetzt, November 1997, mich Korrekturfahnen lesend über die Gedichte beuge, ohne daß die Dinge repetierlich würden (etwa die Zwiesprache Gellus vom Balkon der Güntzelstraße mit der Venus hinterm Dachfirst, wo sie manchmal auftauchte und manchmal nicht, schräge Zeichen blinzelnd oder stumm verbandelt mit dem flachen Kiesel unter einem Holz in Comana, sagen wir), dann müßte ich, wie jeder andere Leser, noch mal von vorne anfangen zu übersetzen, was beim Schreibenreden (Lesenhörenfabulieren) sich nun womöglich oder anders artikuliert. Ungleichgewichte könnten an porösen Stellen die Grammatik durchlöchern oder, behüte, sie fanatisieren wie „Platon, mein obskurer Gaul“ einst im Anfang und Mittelpunkt. Vielleicht spielt sich ja auch alles, mitsamt diesem Text, in einer Kuh ab.
Übersetzen ist (natürlich, ein Gemeinplatz) das falsche Wort für eine Sache im Vorgang, die und den es nicht gibt. Ich gebe in diesem Buch das Jahr aus der Hand, das zwischen Schlüterstraße, wo ich wohne, und Güntzelstraße, wo Gellu und Lygia Naum das Zelt aufgeschlagen hatten, hin und her verlief, genauer gesagt die meiste Zeit an der „Fläche und Oberfläche“ meines Schreibtisches und quer durch die Zyklen des 1994 erschienenen Bandes sowie des Berliner Päckchens Manuskripte, das dem Buch nun den Titel gibt. Schreibenlesenredenhörend bin ich von A bis Z, nein, habe ich, muß es heißen, eine geraume Weile in einem Text geschwommen, der an jedem seinem Zeitpunkt „(n)AUM auf seiner Höhe“ ist; eine Auswahl zu treffen wäre Amputation gewesen.
Das, denke ich, ist auch das Geheimnis der Interpunktionslosigkeit, „mit“ der seine Texte oder Gedichte seit eh und je sich ohne Punkt und Komma in Schüben, Sprecheinheiten, Denketappen bewegen, deren Maß auf dem Papier dann vielleicht die Zeile ist, die kurze, oder die längere, oder die ganz lange (editorisch: eingerückt, solange sie läuft), hie und da mal von optischen Leerstellen unterbrochen, die man nun auch nicht einfach als Ersatz für ein fehlendes Satzzeichen ansehen sollte – eher für eine Regieanweisung des sich selber lesenden Textes an sich selbst, daß etwas Anderes war und daß etwas Anderes kommt, vergleichbar zeichen- und traumlosen Strecken im Schlaf, die trotzdem gefüllt sind, aber nicht mit Atemholen oder Zeit.
Ein solches Notationsmuster erscheint mir, weiter ausgeholt, wie eine hochprivate „Grammatik zu denken“, als eine Art parataktischer Insubordination, die auch mit der naumschen Aversion gegen theatralische Auftritte, ideologische Ironielosigkeit und schauspielernde Gefühlswallungen, die er unerträglich findet, zu tun hat, im Grunde aber dann sein herrlicher Eigensinn ist.
Denn akausal und afinal, so will mir ohne Punkte, Kommata und Ausrufezeichen scheinen, generiert seine egalitäre Syntax ja eine wunderbare künstliche Rede-Ebene, eine dem kleinsten Ausgesprochenen zugewandte Künstlichkeit in ihrem Rückverweis auf die selbstbewußte Natur des Redens. Nichts ist da überflüssig oder weniger wichtig. Die zeichenlose Notation stupft uns auf Zeichen Dressierte geradezu permanent mit der Nase auf diese Offenheit (Porosität), von der wir ohne intakte Zeichenregeln, siehe Rechtschreibreform, viel weniger erführen.
Und seltsam: Übersetzungsprobleme in andere Sprachen scheinen Gellu Naums Texte auch weder einzukalkulieren noch zu ignorieren. Sie setzen unbekümmert autonom auf ihre Selbstverständlichkeit der Evidenz. So hatte ich im interpunktionslosen deutschen Satzgefüge, das sich mir ergab, bloß darauf zu achten, keine unnötigen syntaktischen Mißverständnisse aufkommen zu lassen, etwa bei längeren Reihungen. Echt spannend und ins innere Gefüge dieser Texte wirkend war die Herausbildung dort, wo es um die präzise Begrifflichkeit geht, wie beim Diamantenschleifer. Ich denke nämlich, Gellu Naums Texte denken so dicht und so genau, nicht nur weil dem Autor jede Rhetorik zuwider ist, sondern aus einer poetisch genuinen Nüchternheit heraus, jener „nocturnitas“, mit der die frühmittelalterlichen Lehnwörtner (Sprachkärmer) mönchisch-laisch zu Werke waren, denen die deutsche Sprache so viele unmittelbar einleuchtende Begriffe verdankt, einschließlich den Begriff Begriff. Fast denke ich, analog dazu, daß in Gellu Naums Denken und Sprechen etwas wie „eingenaumte Latinität“ geschieht, entsprechend unserer eingedeutschten, eine Spur, auf die auch seine Studien zur „Dämonie der Dinge“ deuten (Paris, dreißiger Jahre, inmitten seiner surrealistischen Präokkupationen), wo und bei denen er sich, wie er auch gerne erzählt, traumwandlerisch auf die Seite der alten Mystiker gegen das kartesianische Teufelchen stellte. Oder aber bereits seit eh und je schon zu nichts anderem als zu seiner primordialen und persönlichen Geliebten Lygia unterwegs war; also Naum ist.
Wie dem auch sei, oft kam es mir beim Übersetzen vor, schon im rumänischen Originaltext einem naumschen Übersetzungsvorgang aus einem Sprachzustand in einen anderen, deutlicheren, mir höchst vertrauten, zu assistieren und dabei ja bereits an der Quelle dessen zu sein, was ich gerade im Begriff war zu tun.
Ansonsten galt es bloß, den Details und den Mäandern seiner Rede Wort für Wort zu folgen, den Bizarrerien seiner Sprünge kein metaphorisches Gehabe überzustülpen, sich in der Geduld noch unbekannter Konsequenzen zu üben; das gewöhnliche Understatement.
Die erste Begegnung mit Gedichten von Gellu Naum war, kurz vor meinem Weggang aus Bukarest, 1968, sein nach einer Leerstelle des Nichtgedrucktwerdens von 20 Jahren erschienener Band Athanor. Ich weiß noch, daß ich die „Möbiusschleife“ daraus gleich übersetzte. Mit ihr im Kopf kam ich nach Wien, dann nach München; und später dann, in Berlin, gehörte Athanor (nach und nach auch folgende Bände) zu den Büchern, in denen ich über die Jahre hinweg immer wieder mal ohne Grund und unmittelbaren Anlaß ein wenig las, mit anderen Worten übersetzte, so daß es zu Beginn der neunziger Jahre, als auch schriftliche Botschaften von Gellu aus Comana mich zu erreichen begannen, einen ganzen Stoß von angesammelter Freiwilligkeit gab, die den Auswahlband Black Box (erschienen 1993) eröffnen konnte.
Persönlich sind wir uns erst im Oktober 1993 in Berlin im Wintergarten des Literaturhaus-Cafés in der Fasanenstraße begegnet – wie nach einer langen Art von Trennung, weil man sich irgendwie ja kannte. Egal auf welcher Seite man zu reden begann, es war ein Anknüpfen, ohne Punkt und Komma, eine Art Selbstverständnis, das längst in Texten, und wohl auch in meinen, stattgefunden hatte.
In dieser Logik war das Berliner Jahr von Lygia und Gellu Naum in der Güntzelstraße, das Jahr seines 80. Geburtstages, das sich bis ins Frühjahr 1996 hineinzog, ein weiteres Möbiusband mit Fläche und Oberfläche, Torsionen und Tensionen (ganz normale Blutdruckmesserei), wo immer einzutauchen die Grammatik temporärer Aufenthalte es mit sich brachte aufzutauchen, Veranstaltungen in O & Ü, an Main & Rhein, in Salzdam oder Rotterburg – und immer auch Anstoß für mich, dem beargwöhnten Ismus im Surrealismus auf die Schliche zu kommen, Gellus Schliche natürlich, und, noch primordialer, falls eine solche Steigerung möglich ist (warum nicht?), im alten Begriff der Verehrung vom Schüler zum Meister die Oberfläche einer kindlichen Freundschaft dort an der unteren Sohle, wo es um den Umgang mit der Sprache geht, für wahr zu nehmen.
Soviel zur Übersetzung; die es, siehe zweiter Absatz, ja gar nicht geben kann. Und alles, was ich hier zu Texten ohne Punkt und Komma nach der Lektüre anderer Texte ohne Punkt und Komma sage, ist vermutlich auch ein wenig Selbstbeschreibung in der Folge Gellu Naums.
Oskar Pastior, Nachwort, Dezember 1997
Gelebter Surrealismus
– Gellu Naum und seine Dichtung. –
Gellu Naum, 83 Jahre alt, scheint der jüngste und produktivste rumänische Dichter zu sein. Während der eine Verlag (Editura Eminescu) eine mehrbändige unautorisierte Werkausgabe auf den aus den Fugen geratenen rumänischen Buchmarkt wirft, der andere Verlag (Litera) den umfangreichen neuen Gedichtband publiziert und dem Dichter die ehrwürdigsten Preise verliehen werden, hat dieser sich mit Lygia, seiner Geliebten, Ehefrau und Muse in seine kleine Bukarester Wohnung zurückgezogen, verweigert die öffentliche Rede und schreibt Gedichte, als gälte es, noch einmal anzufangen, noch einmal, vielleicht zum ersten Male frei und im bescheidenen Stolz des Nur-Dichters sich der Poesie zu widmen als eines Lebensentwurfs. Denn es ist tatsächlich das erste Mal in diesem langen Leben, daß Gellu Naum äußerlich unbedrängt und frei der Dichter sein kann, der er immer schon war. Einer, dem alles Geschrei und Gezänk der Zeitgenossen nichts bedeutet angesichts der Poesie und deren Ansprüche. Nichts, wie die Literatur, die schlichte Poesie, die er in der verballhornend klingenden Formel seiner Pohesie zu überwinden und auf den Begriff zu bringen trachtet. Die Poesie Gellu Naums, Formel einer Lebensanstrengung, meint totale Eigenständigkeit, Ablehnung alles tradiert Poetischen, Dichtung als radikal individuelle Ausdrucks-, Erkenntnis- und Seinsweise. Nur wessen Subjektivismus-Verdacht den Blick verstellt für die Konkretionsleistungen solchen Dichtens, wird erstaunt sein festzustellen, wie genau die Bilder des auf das Frühjahr 1990 datierten Gedichts „Zeiten der Nacht“ die geistige und existentielle Verkommenheit einer eben der Diktatur entkommenen Gesellschaft bilanzieren.
Gellu Naum wurde am 1. August 1915 in Bukarest geboren. Sein Vater, Dichter und Offizier in der rumänischen Armee, starb noch in den letzten Wochen des Ersten Weltkriegs an der Front. Auf seine Weise hat später der erwachsene Sohn das Zwiegespräch mit dem unbekannten Vater geführt. Die surreal-aphoristischen Legenden des Zyklus „Tatǎl meu obosit“ („Mein müder Vater“) aus dem Jahre 1972 sind ebenso Fragmente dieses Gespräches wie zahlreiche weitere Gedichte, die sich in allen Bänden Gellu Naums finden lassen. In Bukarest besuchte Gellu Naum das Gymnasium und studierte Philosophie und Literatur. Als Achtzehnjähriger, so erzählt er, geriet er zufällig in eine kleine Galerie, in der Bilder ausgestellt waren, die ihn zutiefst beeindruckten. Dem großen, blonden jungen Mann, dem die Faszination des Jüngeren aufgefallen war und der ihn nach seiner Meinung zu den Bildern gefragt hatte, sagte er, diese Bilder seien so gemalt, wie er schreiben möchte. Victor Brauner, der ausstellende Künstler, habe ihn daraufhin eingeladen, ihn noch am gleichen Abend zu besuchen – es war der Beginn einer Lebensfreundschaft. Victor Brauner war für die Dauer dieser Ausstellung aus Paris zurückgekehrt; mit seiner Begeisterung für den Pariser Surrealistenkreis um André Breton eröffnete er dem angehenden jungen Dichter einen Kosmos, der noch lange nach dem Ende des Pariser Surrealismus seine Strahlkraft behalten sollte. Schon ein Jahr nach dieser Begegnung publizierte Gellu Naum seinen ersten Gedichtband, den drei Illustrationen von Victor Brauner begleiteten Drumeƫul incendiar (Der Brandwanderer), und 1937 folgte der ebenfalls von Victor Brauner illustrierte Band Libertatea de a dormi pe o frunte (Die Freiheit, auf einer Stirn zu schlafen).
1938 ging Gellu Naum nach Paris, um dort eine philosophische Doktorarbeit über Abaelard zu schreiben. Auch hier war es wieder Victor Brauner, der ihn mit André Breton und dessen surrealistischen Freunden bekannt machte. Obwohl er sehr schnell das Interesse des ansonsten eher zurückhaltenden André Breton geweckt hatte und den Auftrag erhielt, für Minotaure zu schreiben, empfand der skeptische junge Dichter aus Bukarest eine kritische Distanz zu den hochpolitisierten französischen Intellektuellen.
Gestört hat es mich allerdings schon damals, daß sie die ganze Welt verändern wollten und die Poesie dabei schlecht wegkam. Ich habe dann auch erlebt, wie aus der surrealistischen Bewegung eine regelrechte Partei wurde: Die Surrealisten sind mit der Internationalen auf den Lippen in den Krieg gezogen, womit sie sich von der großen Mehrheit abgegrenzt haben, die die Marseillaise gesungen hat.
Gellu Naum war zu spät nach Paris gekommen; die surrealistische Bewegung, mittlerweile vielfach zerstritten und ideologisiert, erlebte eine letzte Agonie vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dessen tatsächlicher Beginn am 1. September 1939 ihn zwang, nach Rumänien zurückzukehren. Nach seiner Rückkehr aus Paris wurde Gellu Naum zum Militär eingezogen und 1941, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und dem rumänischen Kriegseintritt an der Seite Hitlerdeutschlands, an die ukrainische Front abkommandiert.
Was kann man in solch einer Nacht auf einem großen Boulevard tun? In mir trage ich die tiefe Traurigkeit jener Dichter, die ihr ganzes Leben lang, aber auch ihr ganzes Leben lang sich bemüht haben, keine Literatur zu machen, und schließlich beim Durchblättern ihrer paar hundert Seiten feststellen mußten, daß sie nichts als Literatur gemacht haben. Eine furchtbare Enttäuschung. Doch über diesen schmutz starrend glänzenden Kleidern, hinter dem grobschlächtigen Faltenwurf einer Poesie, die vor platter und pompöser Literatur alles erdrückt, die Überzeugung, Ferment zu sein. Ein schlechtes Geschäft. Diesmal ist unsere Sache schiefgegangen, und zwar gerade wegen ihrer scheinbaren Perfektion. Trotzdem aber ist es sehr gut, dich als Dichter zu erkennen, wenn du dies so sehr haßt. Es ist der einzige Grund, der mich noch zu einem Buch greifen läßt. […] Wir haben ein Gedicht geschrieben, das uns veranlaßt, gemächlich auszuschreiten, alles mit beängstigender Ruhe zu betrachten, das würgende Knäuel Genugtuung in der Brust zu tragen, das nichts Gutes verspricht. Doch sollten wir uns nicht täuschen: dies ist bloß das quälende Gefühl, nichts als Poesie gemacht zu haben, bloß etwas gefunden zu haben, das man schön nennt, bloß ein ästhetisches Problem gelöst zu haben.
Diese und zahlreiche weitere, ähnlich klingende Bekenntnisse gegen die falsche Literarizität der Dichtung stehen auf den ersten Seiten des 1945 in der Colecƫia suprarealistǎ (Surrealistische Sammlung) in Bukarest erschienenen umfangreichen Essays „Medium“. Sie markieren das Ende des „Iiterarisierenden“ Dichters Gellu Naum und die Entwicklung einer zutiefst eigenständigen Poetologie, die sich zwar nach wie vor auf den Surrealismus beruft, diesen aber nicht primär als literarische Technik oder Schule begreift, sondern, umfassend, Surrealismus als eine Lebensweise, die sämtliche Schreibund Lebenssituationen ergreift und bestimmt. Das Ziel solchen Engagements ist die Befreiung des Menschen von aller falschen Form im Denken, Fühlen und Handeln – ein Programm, das ohne die totale Befreiung des Menschen nicht erreichbar ist. In kritischer Distanz zu den revolutionären Befreiungsideologien des Jahrhunderts konnte die Freiheit solch eines surrealistischen Konzeptes nur als individuell anzustrebendes und im Alltag zu praktizierendes Projekt gedacht werden.
Schon zwischen 1939 und dem Sommer 1941 hatten Gellu Naum, Paul Pǎun, Dolfi Trost und Virgil Teodorescu in Bukarest eine Gruppe rumänischer Surrealisten gegründet. Der Kriegseintritt Rumäniens und die rumänische Judenverfolgung – Gh. Luca, D. Trost und P. Pǎun waren Juden; während P. Pǎun als Arzt gebraucht wurde und in seinem Beruf weiterarbeiten durfte, mußten Gh. Luca und D. Trost, mit dem gelben Davidsstern versehen, in Bukarest die Straßen fegen – erlaubte erst nach dem Herbst 1944 wieder gemeinsame Unternehmungen. So etwa die große Gruppenausstellung in der Galerie Cretzulescu vom 29. September bis zum 18. Oktober 1946, in deren Katalog L’infra-noir, Préliminaires à une intervention sur-thaumaturgique dans la conquête du désirable sich alle fünf Protagonisten des rumänischen Surrealismus vorstellten, oder die Beteiligung an der Pariser Surrealismus-Ausstellung von 1947. Gemeinsame Publikationen wie Critica mizeriei (Kritik des Elends, 1945) mit P. Pǎun und V. Teodorescu, Spectrul longevitǎƫii, 122 Cadavre« (Das Spektrum der Langlebigkeit. 122 Kadaver, 1946) zusammen mit V. Teodorescu, Eloge de Malhombra (1947) mit Gh. Luca, P. Pǎun, V. Teodorescu und D. Trost, Gruppentreffen mit surrealistischen Frage-Antwort-Spielen und theoretischen Diskussionen zeigten eine Lebendigkeit und Produktivität, die im Bukarest der unmittelbaren Nachkriegszeit geradezu sensationell wirkten; André Breton soll angesichts dieses Reichtums davon gesprochen haben, daß das Zentrum der surrealistischen Bewegung sich nach Bukarest verlagert habe.
Im Zuge der kommunistischen Machtergreifung wurden gegen Ende 1947 die rumänischen Surrealisten verboten. Die sowjetischen Kulturoffiziere hatten nicht vergessen, daß André Breton die prosowjetischen Schriftsteller Louis Aragon und Paul Éluard aus seiner Bewegung ausgeschlossen hatte, daß er Ilja Ehrenburg 1935 kurz vor dem Internationalen Kongreß zur Verteidigung der Kultur auf offener Straße geohrfeigt hatte, daß er die Stalin-freundlichen Reden auf jenem Kongreß als „wahre Ergießungen von Wiedergekäutem, von kindischem Kalkül und Speichelleckereie gegeißelt hatte und daß es die Surrealisten waren, die 1938, nach dem Münchner Abkommen über die Zerschlagung der Tschechoslowakei, in ihrem Flugblatt „Weder Euer Krieg noch Euer Frieden“ Hitler und Stalin gleichgesetzt hatten. Angesichts solcher politischen Positionen erübrigte sich in den osteuropäischen stalinistischen Diktaturen der Nachkriegszeit jedwede ästhetische Diskussion; Paul Pǎun, Gherasim Luca und Dolfi Trost wanderten aus, Virgil Teodorescu versöhnte sich mit der Macht und schrieb die politisch erwünschten Hymnen, Sonette und Reportagen. Gellu Naum, der sich als Übersetzer (u.a. Denis Diderot, René Char, Julien Gracq, Franz Kafka, Samuel Becken) und Kinderbuchautor durchbrachte, durfte erst 1968 wieder einen eigenen Gedichtband veröffentlichen: Athanor, das Buch, das Oskar Pastior noch kurz vor seinem Weggang aus Rumänien aufgefallen war.
Nun schien der rumänische Surrealismus als intellektuelle Bewegung endgültig zerschlagen und vergessen zu sein. Über die unsystematische und theoretisch kaum reflektierte Rezeption (d.h. Nachahmung) der künstlerischen Strömungen der Moderne war auch in Rumänien ein diffus-modernistisches Zeitgefühl entstanden, ein zwar indifferentes, immerhin aber kein feindliches Klima für den letzten echten Surrealisten. Mit einiger Regelmäßigkeit konnte Gellu Naum nun unter fürsorglicher Beobachtung und in einem Falle auch Behinderung durch die Zensur seine Gedichtbände veröffentlichen: Copacul animal (Der Tierbaum, 1971); die in den Jahren 1944/45 geschriebenen Künstlerparabeln und Doppelgängergeschichten Poetizaƫi, poetizaƫi (Poetisiert, poetisiert, 1972); Tatǎl meu obosit (Mein müder Vater, 1972); den Gedichtband mit den zensurierten Collagen des Zyklus Der Vorteil der Vertebrae, den Gellu Naum dann noch einmal in unzensurierter Form als Privatdruck veröffentlichte Descrierea turnului (Die Beschreibung des Turmes, 1975); Partea cealaltǎ (Die andere Seite, 1980); die autobiographische Prosa Zenobia (Zenobia, 1985 / in der deutschen Übersetzung 1990); Malul albastru (Das blaue Ufer, 1990) und zuletzt Faƫa si suprafaƫa (Fläche und Oberfläche, 1994).
Nach dem Sturz des Ceauşescu-Regimes mochte es eine Zeitlang so scheinen, als habe Gellu Naum sich noch einmal politisch radikalisiert, dabei wurde nun erst deutlich, wie anders einer denkt und handelt, dessen literarische Existenz und Verantwortlichkeit als citoyen kongruent sind. Im Frühsommer 1990, als die Studenten auf dem Bukarester Universitätsplatz gegen die postkommunistischen Machthaber und für die Fortsetzung der Demokratisierung demonstrierten und in den Hungerstreik traten, verließ Gellu Naum den Schriftstellerverband, weil dieser den Studenten die Solidarität verweigerte. Während die Schriftsteller, fasziniert oder gelähmt von den politischen Veränderungen, ihre Schreibtische verwaisen ließen, schrieb Gellu Naum weiter an seinem poetischen Werk – Gedichte, deren politischer Skandal in der behaupteten Differenzlosigkeit von ästhetischer und schlicht humaner Äußerung begründet liegt. Denn Gellu Naums Surrealismus als Lebensweise erlaubt keine Trennung unterschiedlicher Segmente des Lebens, Denkens und Fühlens. Die Gedichte sind – in ihrer prosodischen Gestalt sich jeden äußeren Zierats enthaltend – zugleich Zeugnis seines Liebens, Traumprotokoll, historische Legende, Landschaftsbild, mystische Offenbarung, Erinnerung und Beschwörung ebenso wie politisches Pamphlet, Kampfschrift oder sozialkritische Groteske. Reduzierte man sie auf einen dieser Aspekte, käme man wieder bei der Literatur an, und Gellu Naum spräche milde lächelnd von der Pohesie:
Ich bin bis ins Mark infiziert mit Literatur, und ich wette, daß jeder Arzt in jedem meiner Nerven den faulenden Wundbrand der Poesie sehen könnte.
Ernest Wichner, Nachwort
Die in diesem Band
Rede auf dem Bahndamm an die Steine vorliegenden Gedichtzyklen des rumänischen Dichters Gellu Naum geben uns einen Begriff von der ungebrochenen Lebendigkeit der Avantgarde Rumäniens.
In der Übersetzung von Oskar Pastior sind wunderbare pastior/naumsche Gebilde entstanden, die für den Leser eine Bereicherung darstellen, insbesondere wenn er die Bekanntschaft mit dieser großen europäischen Tradition des Surrealismus sucht.
Ammann Verlag, Klappentext, 1998
In den 40er Jahren
sagte André Breton angesichts des Reichtums, den die rumänischen Surrealisten an Poemen, Kunstbüchern, Gruppentreffen und Ausstellungen hervorbrachten: das Zentrum der surrealistischen Bewegung habe sich nach Bukarest verlagert. Zum Kreis der rumänischen Surrealisten zählte auch Gellu Naum (*1915, Bukarest), der 1938–39 in Paris von André Breton in die Minotaure-Gruppe aufgenommen worden war, zu einer Zeit, als, wie Naum später bemerkte, die Poesie bereits unter der politischen Zerstreuung der Bewegung gelitten habe.
Dass der Surrealismus tatsächlich nicht auf seinen französischen Anteil reduziert werden kann und dass er weit in unser Jahrhundert ausstrahlt, bezeugen auch Gellu Naums neue Gedichte, die Oskar Pastior eingedeutscht hat. Ein schönes Zeichen übrigens, dass Ammann die Sammlung zweisprachig herausgibt, ein Zeichen, das auch den Beckett-, Char- und Kafka-Übersetzer Naum freuen wird. Dem erfahrenen Wortarbeiter Pastior ist es gelungen, die „verlorengegangene chemische Braut zu eruieren“, um ein Wort Gellu Naums an der Leistung seines Übersetzers zu erproben. Die lyrische Verschwisterung inkongruenter Sphären, der sich der Surrealismus zur Erschaffung einer assoziativ dekonditionierten, neuen Dimension verschrieben hat, inszeniert Pastior formal „ohne Punkt und Komma“; Gedichte hätten ihr Mass in sich selbst, bedürften nicht der Interpunktion, erläutert er im Begleitwort; die weissen Stellen, die der Text auf dem Blatt ausspare, seien „vergleichbar zeichen- und traumlosen Strecken im Schlaf, die trotzdem gefüllt sind, aber nicht mit Atemholen oder Zeit.“ Und dazwischen, darin vielmehr: Sprache, Zeichen, textuelle Evokationen. Gefrorene Momente Naumscher Traumstille:
Die alten Männer an den Türen neben längst geschlossenen Fenstern qualmten
langsam kämmten sie ihr langes Haar
und hin und wieder in der letzten Abendsonne zog ein blaues Wolkenband durch ihre Augen.
Gellu Naum vertritt einen „gelebten Surrealismus“ (Ernest Wichner). Seine Gedichte erzeugen keine referenzlose Artistik. Die poetische Freizone impliziert politische Stosskraft. Während Rumäniens langer kommunistischer Diktatur, in der die Surrealisten – wenn überhaupt, dann – nur unter Einschränkungen an die Öffentlichkeit treten konnten, war Gellu Naums Poesie sein operatives „Versteck“, sein Raum zur Entgrenzung von sich selbst und von anderen, sein Pièce-de-résistance, in dem sich unablässig das Freiheitsrecht des Menschen realisiert: „keiner blieb in seinen Grenzen // beim Schreiben mit der Zunge auf Asfalt“. – Schreiben, die Rede auf dem Bahndamm an die Steine, Poesie als Quell einer inneren „Lebenskraft“:
oft wartete ich drauf
diese Quellen auch sehen zu können
die nicht zu den vielen Arten zu schweigen
übergelaufen waren
„(n)AUM“ hat sie gesehen; die langen Jahre der Unterdrückung haben ihn nicht zum Schweigen gebracht.
Florian Vetsch, literaturwelt.de
Mit dem faulenden Wundbrand der Poesie
„In einer anderen Zunge reden wir doch mit der gleichen Stimme von hinter den verstörten Schlagbäumen im Stirnbereich hervor“, schreibt Gellu Naum in seinem soeben bei Ammann erschienenen Gedichtband Rede auf dem Bahndamm an die Steine, übersetzt von Oskar Pastior. Naum hat Zeit seines Schreibens die „Sprache der Poeten inkohärent und vage“ den Konventionen von Literatur entgegengestellt. Denn „nur sie handelt und verändert“. Es ist ein Dichter, der in jedem seiner „Nerven den faulenden Wundbrand der Poesie“ spürt, der in einer stürmischen Zahl von Gedichtbänden immer wieder jenen surrealen poesieschaffenden Moment untersucht „weshalb hier eines für das andere redet und dies da sich auflöst während jenes leblos Angehäufte scharf hervortritt“. Allein ein rein formales Interesse an der Poesie lehnt er ab. Der inzwischen zweiundachtzigjährige Dichter zählt zu den letzten lebenden Surrealisten. In ihrem 1945 veröffentlichten Manifest ging es den Bukarester Surrealisten wie schon dem Kreis in Paris darum, dem Wort seine „Möglichkeiten“ zurückzugeben und somit den menschlichen Ausdruck zu befreien. „Wir zwängen uns in ein Gebiet von grober Zweifelhaftigkeit seit eh und je // und können uns nicht rühren während die Wasser steigen und fallen.“ Deshalb verließ Naum in einer Art „Traum im Traum in welchem ich nicht träumte“ die bindenden Strukturen die Gesellschaft wie Sprache bestimmen und lichtete die Anker des Realismus. Bereits 1924 hatte Breton im ersten Manifest des Surrealismus geschrieben:
die logischen Methoden unserer Zeit wenden sich nur noch der Lösung zweitrangiger Probleme zu. Die Imagination ist vielleicht im Begriff wieder in ihre alten Rechte einzutreten.
Naums poetische Imaginationen lassen das reale Prinzip wie in einem Brennglas zusammenfallen, erglühen und schmelzen. In die mythischen Abgründe des Wortes getaucht, gelingt es ihm, „einen Bogen um die kristallinen Reden, die sie führten“, zu ziehen und damit ihren „leergelaufenen Sanduhren“ und „kalten Feuerstellen“, über die sie „merkwürdige Sonntagskathedralen errichteten“, zu entkommen. Seine Gedichte liest man, wie von einem Sog angezogen, auf die nächste fremde Schönheit ihrer Bildhaftigkeit wartend, auf ihre unerwarteten Ausgänge und überraschenden offenbarenden Wendungen. Eine süchtigmachende Poesie, die jenen Suchtprinzipien folgt, denen auch unser Unbewußtes zu eigen scheint. Der Magnet seiner Poesie ist das ihr innewohnende Pulsieren und die Ausdehnung von Sprache über ihre Nutzwiese hinaus. Es ist eine Fähigkeit, die sich aus dem Hören auf das Unbewußte als zweite, sogenannte Metasprache des Menschen speist. Selbst wenn der Begriff Surrealismus inzwischen seine geschichtliche Patina erhalten hat und alle Ismen suspekt erscheinen, vermag er doch noch immer Naums Schreiben zu umreißen, das unter der Oberfläche von deren „Haut bloß die Wellen aus (gehe)“ bis in die „Nähe des Fitzelchens Papier das uns ausmacht“ dringt, das durch „die brutale Faszination der Wörter“ den „Mond vom Sockel“ stürzt und in jene „Fläche“ den papierenen Untergrund unseres Denkens und Empfindens einschmilzt. So nah Naum dem surrealistischen Prinzip auch steht, fand er doch konsequent seine eigene Definition für diesen Begriff. Seine Gedichte „frappieren durch mobile und unverbrauchte Assoziationen“, die seiner Lyrik eine gewisse Ironie und seltenen Artenreichtum geben, die ihm wiederum „Bewegungsfreiheit gegenüber jeder Konventionen selbst gegenüber jener der surrealistischen Ausdrucksweise sichert“, wie es im Nachwort zu Black Box heißt. Ende der Dreißiger hatte Naum in Bukarest und Paris Philosophie studiert. Während des zweijährigen Aufenthaltes in Paris (er schrieb dort seine Doktorarbeit über Abelard) lernten er und der ebenfalls aus Rumänien kommende Gherasim Luca den surrealistischen Kreis um André Breton kennen. Dem Maler Victor Brauner, der ihn in diesen Kreis einführte und mit dem ihn später eine langjährige Freundschaft verband, war er bereits zuvor in dessen Bukarester Ausstellung begegnet, in die der junge Philosophiestudent mehr oder weniger zufällig geriet. Gefragt, wie ihm die Bilder gefielen antwortete damals Naum: So möchte er schreiben. Das Zusammentreffen mit dem Surrealismus, jenem „reinen psychischen Automatismus, durch den man den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht“, wie im Manifest von 1924 formuliert, blieb prägend für Naums Schaffen. Auch wenn Breton gleichermaßen warnte:
Man muß viel auf sich nehmen, will man sich in jene entfernten Bereiche zurückziehen, wo alles zuerst so schwer zu gehen scheint und noch schwieriger ist es, wenn man jemanden dorthin führen will.
Der Kriegsausbruch zwang Naum, 1939 nach Bukarest zurückkehren. Hier gründete er gemeinsam mit Luca, Paul Paun, Dolfi Trost und Virgil Theodorescu eine Gruppe rumänischer Surrealisten, die bis 1947 produktiv war. Der kommunistische Staat verbot ihre Aktivitäten, da ihm alles außer Realismus systemfeindlich erschien. Damit glitt diese Periode rumänischer Literatur ins Vergessen. „In flüssiger Sonne Gelöschte wir fallen / wie in einen tiefen Spiegel in den Schlaf“ ein Zustand der mit wenigen Ausnahmen bis zum Ende der Diktatur 1990 anhielt, das Jahr, aus dem diese Zeilen stammen und das für Rumänien einen Neuanfang bedeutete. Doch dieser bleibt nach all den Jahren der Diktatur schwierig. „Niemand mehr zu sehen den Boden haben die Wörter zerkratzt.“ Naum hatte sich nach dem Verbot der Gruppe im Gegensatz zu den ausgewanderten Luca, Paun und Trost und dem sich den Verhältnissen anpassenden Theodorescu nach 1947 in ein kleines Dorf zurückgezogen.
Meist gehen wir diesen Gang allein
mit einem Kopf auf dem Kopf
durch den Schatten der uns jeden erlebt.
In der Abgeschiedenheit schrieb er weiterhin, konnte jedoch lange Jahre nicht und nach einer gewissen kulturpolitischen Lockerung Ende der Sechziger nur unter Zensur veröffentlichen. Oskar Pastior war, kurz bevor auch er Rumänien verließ, der 1968 endlich erschienene Gedichtband Athanor in die Hände gefallen. Durch seine Übersetzung entstand der Grundstock für den ersten auf deutsch verlegten Band Naums Black Box (1994) dem nach dem Roman Zenobia jetzt ein zweiter folgt.
In mir trage ich die Traurigkeit jener Dichter, die ihr ganzes Leben nach Kräften versucht haben, keine Literatur zu machen, und schließlich beim Durchblättern ihrer gut hundert Seiten feststellen mußten, daß sie nichts anderes als Literatur gemacht haben. Eine furchtbare Enttäuschung. Und dennoch: über all diesen vor Schmutz glänzenden Kleidern, hinter all dem grobschlächtigen Faltenwurf einer mit fad literarischem Pomp erdrückenden Dichtung die Überzeugung, Ferment zu sein.
Cornelia Jentzsch, Berliner Zeitung, 6.6.1998
In diesem Jahr
erschienen mit dem Buch Rede auf dem Bahndamm an die Steine zwei Gedichtsammlungen in einem Band, OSKAR PASTIOR, der von Haus aus in unterschiedlichen Sprachen unterwegs ist, ist die Übersetzung zu verdanken. Oskar Pastior sagt von sich selbst, „ich gehöre zur Familie der Wörtlichnehmer“. Wo immer ihm also ein zu welchen Zwecken auch immer geformtes Stück Sprache begegnet, findet er es Interessant, es zu einem Wortspiel einzuladen Und im Fall des Glücks, auf den Oskar Pastior dabei nicht immer setzt, vergißt die Sprache beim Spielen ihre Funktion und unterwirft sich den neuen Regeln, die der Dichter eigens erfindet oder bereits erprobte Regeln neu kombiniert. Der Einsatz gilt der täglich zu machenden Erfahrung, daß kein Wort so sehr an seiner Bedeutung klebt, als daß es nicht auch für einen ganz anderen Gegenstand gut wäre. Oskar Pastior hat immer eine Verabredung mit den Wörtern: Er holt sie unter allen Umständen dort heraus, wo sie sich in geschlossenen Systemen befinden und baut ihnen einen Weg in die Freiheit, der dann ein Weg oder vielmehr eine Weise ist, auf dem und auf die das sprachfertige Material auf einmal gelöst und rätselhaft anmutet, endlich es selbst sein kann und dabei sogar noch etwas singt. Die Namen für die Schritte bei einem solchem Vorgang, der ja eigentlich auch ein Wunder obwohl nicht im surrealistischen Sinn ist, lauten natürlich anders. Sie lauten Anagramm oder Parallelismus oder Katachrese oder Palindrom und noch vieles anderes und sie lehnen in den Partituren von Oskar Pastiors Sprachspielen als haargenaue Musikinstrumente, die zugleich auch Dirigenten sind. Form folgt auf Form, wenn das unerschöpfliche Potential jener Wandlungsfähigkeit erst einmal entdeckt ist, wie es beispielsweise in der so eigensinnigen wie wortlustig einleuchtenden pastiorschen Universalformel „Prometheus minus Mäh gleich Proteus“ enthalten ist.
Andreas Koziol, aus einem Vortrag
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1, 2 & 3
und zum IM Stein Otto
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Oskarine ist ein Gedicht-Generator von Ulrike Gabriel, der auf den Gedichten von Oskar Pastior basiert. Jedes Gedicht spricht sich selbst – immer neu und mit der Dichter-Stimme.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
Nachruf auf Gellu Naum: Der Tagesspiegel
Gellu Naum im Gespräch.


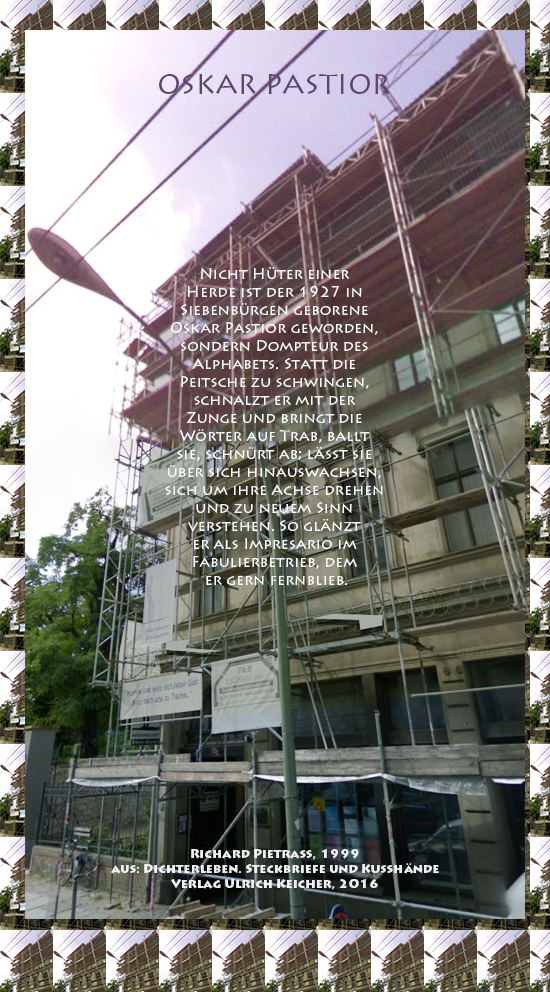












Schreibe einen Kommentar