Gerhard Falkner: Gegensprechstadt – ground zero (CD)
GEGENSPRECHSTADT
ich habe zu wenig geschlafen
aaain diesem Jahrhundert!
ein zwei drei
aaazwei drei – vier
aaaoder fünf Stunden
pro Nacht, oder Monat
aaaoder Jahr
damals, in der Zeit des kurzen Schlafs
aaawar noch ziemlich viel wahr
die Zeit hatte Zeit
aaaund man war nackt
wenn man die Geduld hatte
aaasich zu entkleiden
ich habe zu wenig geredet
aaain diesem Jahrhundert!
ein zwei drei
aaazwei drei – vier
aaaoder fünf Worte vielleicht
oder Sätze, oder Sprachen
aaaes gab noch keinen 11. September
keinen 3. Oktober
aaaund keinen 15. März
die Gelegenheit also war günstig
aaader Zeit die Freiheit zu lassen
einmal den Ort zu spielen
ich kann die stillen, zitternden Bäche
aaades Lichts
über dem Frankfurter Bahnhofsviertel
aaain all den Jahren
als ich achtzehn wurde
aaanoch aufsagen
sie rauschten
aaawie die Tulpen unter dem Rasenmäher
eine Schrift niederlegend
aaains Gras
die man nur entziffert
aaamit matter Stirn
und schlaflos geröteten Augen
ich habe zu wenig geschlafen
aaain diesem Jahrhundert!
in jedem Frühling lag so viel Verbrechen
aaaso viel Ausbruch und Verstörung
also begann ich die Tage zu buchstabieren
aaaich saß vor den Tagen
wie vor der Tagesschau und buchstabierte
aaaihre Namen, ihre Neuigkeiten
ihre Nachrichten: D I E N S T A G
aaabis sie meinen Buchstabiermund
nachbuchstabierten
aaabis sie mich
buchstäblich auswendig konnten
heute lebe ich in der Duncker 19 Uhr 40
aaabei 39,6
gemessen unter der Zunge
aaain meinem Herzen
schneidet sich der 52. Grad nördlicher Breite
aaamit dem 13. Grad östlicher Länge
das ist plusminus Berlin
aaaalso (mehroderweniger) genug!
„Stin Agora“ – Ich habe zu wenig geschlafen in diesem Jahrhundert
Inszenierung des Gedichts Gegensprechstadt – ground zero von Gerhard Falkner
Gelesen von Gerhard Falkner und Marina Agathangelidou
Musikalisch begleitet von der der Gruppe MiniMaximum imroVision
Videoprojektion der Gedichte aus G. Falkners Pergamon Poems
Ein Spaziergang mit Gerhard Falkner zu Orten aus seinem Gedicht Gegensprechstadt – ground zero.
Nachwort
Das Gedicht „ground zero“ wurde zwischen 1995 und 2005 geschrieben. Der ursprüngliche Arbeitstitel hieß: „Vom Hören der Tage“.
Eine der zwischen den Zeilen verfolgten Absichten war es, poetisch der Schrumpfung von kontinuierlicher und überpersönlicher Zeit in jene jeweils fragmentierte und nur vom Subjekt als wahr erlebte Jetztzeitigkeit nachzuspüren. Daher auch immer wieder das Anreißen von poetischen Augenblicken als Zeitbeispielen, die nicht in der richtigen „chronologischen“ oder „systematischen“ Ordnung sind. Durch das Dilemma, dass die Zukunft nicht vor und die Vergangenheit nicht hinter uns liegt, jene unglückselige Transfinität, die uns gleichzeitig der Schuld wie der Hoffnung beraubt, bleibt auch das Gedicht auf den Durchbruch ins soeben erlebte Eigene beschränkt. Dies befördert zugleich die Lust an folgenloser poetischer Selbstverbrennung wie auch den Widerspruch gegen die strukturell verordnete Destruktion von Dauer und linearer Ordnung, denn, wie Nietzsche bezeichnenderweise gerade in einem Gedicht sagt:
alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.
Bei dem Gedicht „ground zero“ handelt es sich, technisch gesehen, um polymere Poesie. Gemeint ist damit das additive Zusammenwirken mehrerer Stilformen auf die Intensität der Ausprägung des Gesamtmerkmals.
Ich erlaube mir, hier gleich nochmals Nietzsche zu zitieren, diesmal aus dem Ecce Homo:
… in Anbetracht, daß die Vielheit innerer Zustände bei mir außerordentlich ist, gibt es bei mir viele Möglichkeiten des Stils, die vielfachste Kunst des Stils überhaupt.
Lyotard beschreibt ganz in diesem Sinne verschiedene künstlerische Ausdrucksformen als libidinöse Dispositive, die – in kritischer Opposition zu den repressiven Strukturen von Theorie, Kapital und Politik – dazu dienen, die Energie des Begehrens in intensive Wirkungen zu transformieren.
Der Tradition großer Langgedichte des 19. und 20. Jahrhunderts folgend und eine ganze Reihe von diesen mit rhythmischen und motivischen Anspielungen grüßend, verkettet Gegensprechstadt – ground zero vor dem Hintergrund der deutschen Hauptstadt das große Geschehen mit den flinken Kommentaren und kleinen Komplimenten, die der denkende und zum Sprung in die Helle bereite Körper während seines Vorüberziehens dazu anmerkt. Unter dem Sprung ins Helle ist die spezifische Erkenntnis des Gedichts im Moment seiner sprachlichen Gewahrwerdung zu verstehen.
Das Vorgehen in „ground zero“ ist, abgesehen von einer klar als solcher ausgewiesenen Stelle, nirgends parodistisch. Parodie sollte dem Gedicht immer zuwider sein, auch wenn es die Versuchung zu polemischer Schärfe manchmal in gefährliche Nähe zu ihr bringen mag.
Wo Motive bekannter Gedichte aufgegriffen wurden, werden sie kurz gecovert, um gleich darauf vom eigenen Gedicht absorbiert und in eine jeweils andere, dem Zusammenhang adäquate Höhe und Prosodie eingegliedert zu werden. Sie sind Humus. Montageteil. Zitat. Anleihe. Link. Referenz. Verbeugung.
Auf ausgediente Floskeln des Experiments und eine sprachliche Wurst-, Zisch- und Stotterküche mit veralteten Falschschreibungen wurde verzichtet.
Ziel war eher, in Mischsprachen von erhabener bis burlesker Ambition unter Einbeziehung von sauberen Paradoxen die Diskursfähigkeit poetischer Sprache zu gewährleisten, ohne sie je an die Texttheorie zu verschenken oder die tubulären Dunkelheiten des erdichteten Gedichts preiszugeben.
Dabei ist mir Heinrich Heine, etwa mit dem „Wintermärchen“, gerade auch wegen der Verbindung von beißendem Spott und preisendem Ton oft näher und neuer gewesen als zeitlich nähere und neuere Dichter. Ironie, poetische Kraft und Augenhöhe mit dem Stand der Dinge, nicht nur in ihrer dinglichen Präsenz, sondern auch in ihrer philosophischen Ausprägung, das waren die Ziele.
Das angesprochene Jahrhundert im Text ist, wo nicht ausdrücklich anders vermerkt, immer das zwanzigste.
Bei „ground zero“ handelt es sich in erster Linie um ein Langgedicht über Berlin, nicht über den 11. September. Die Eckdaten bedeuten ebenso Ereignisse, in denen ein maximales Interesse der Öffentlichkeit kristallisiert, wie auch deren Metaphern. Der 11. September steht für das Schreckliche, der 3. Oktober für das Schöne, und der 15. März steht für das Differente. (Das dritte Datum verweist sowohl auf die Iden des März, Ermordung Cäsars, also ein Attentat auf die Macht (wie der 11. September), als auch auf meinen Geburtstag, dem gleichfalls eine Form des Attentats zugrunde liegt, sowie drittens im Sinne der Differenz auf die Welten, die zwischen diesen beiden Beispielen liegen.)
Trotz durchgängiger ironischer Unterlaufung verpflichtet sich das Gedicht dem Hintergedanken einer Rehabilitation des Schönen und Sublimen, basierend durchaus auf den geschätzten Resultaten ihrer Reduktion und Dekonstruktion durch Moderne und Postmoderne. Das „ground zero“ im Titel bedeutet dabei nicht nur den 11. September (der Begriff als militärischer Euphemismus ist ja um einiges älter), er bedeutet auch den poetischen Euphemismus eines katastrophalen Nullpunkts, einer Tabula rasa, jener rasenden Reglosigkeit, die Schrecken und Schönheit in der Waage hält.
Der Horizont dieses Begriffs umgreift somit Momente eines Nullpunkts allgemein, wie etwa den des 3. Oktobers zwischen Deutschland Ost und West, der in der plötzlichen Auslöschung von Mauer, Grenze und Teilung wie jede „geglückte Revolution“ auch die potenziellen Merkmale der Katastrophe aufscheinen ließ, die berühmte Stunde Null oder, noch weiter zurück, den 9. November 1918.
„ground zero“ meint die Climax einer politischen, historischen, umweltlichen oder persönlichen Zerschlagung über ein inhärentes Symbol oder Motiv, von dem aus es sich intentionell auf seine entgegengesetzte Bedeutung zubewegt, also zum Beispiel Terror versus Gerechtigkeit, Freiheit vom totalitären Staat versus totalitärer Kapitalismus usf.
Das „ground zero“ Berlins ist der Fall der Mauer, das „ground zero“ des Dichters ist das Zerschellen der Persönlichkeit an der unerfüllten Liebe.
„ground zero“ wurde mit David Moss 2003 in Berlin von der Literaturwerkstatt uraufgeführt. Da dieser Begriff, der kurz nach dem 11. September für dieses Gedicht gewählt wurde, inzwischen in unzähligen Buchtiteln vorkommt, wurde er auf Gegensprechstadt – ground zero umgeändert. Sowohl seit der Uraufführung als auch seit der Aufnahme der CD für dieses Buch hat der Text immer wieder kleine Veränderungen erfahren, die durchaus seinen Charakter unterstützen, da dieses Langgedicht, zu dem es zahlreiche Textvarianten gibt, ja nicht eigentlich abgeschlossen wurde, sondern abgebrochen.
Zur emotionalen Temperatur des Textes sei angemerkt, dass sie aus dem Hype der mittleren 90er Jahre gespeist wurde, in denen Verschmelzungskraft, Verdrängungswiderstand Ost, Restenergie des ehemaligen Ausnahmezustands, Dynamisierung der Hauptstadt und gesellschaftlicher Agilität einen glücksfallartigen historischen Moment bildeten. Diese Lage ist inzwischen nicht mehr gegeben.
Was nicht nur die Mittel, sondern gerade auch die Inhalte des Gedichts angeht, war es mein Ehrgeiz, abseits jeglicher Opportunität, alle Moden zu zitieren und keiner zu gehorchen.
Gerhard Falkner, Nachwort, Mai 2005
Mit Gegensprechstadt – ground zero
legt Gerhard Falkner ein Opus Magnum der polymeren Poesie vor – von David Moss kongenial musikalisch umgesetzt und begleitet.
Vor dem Horizont der Hauptstadt verkettet Gegensprechstadt – ground zero das große Geschehen mit winzigen Annotationen, die ihm der denkende Körper während seines Vorüberziehens hinzufügt. Berlin bildet dabei die urbane Folie, die, über das Zeitgeschehen gezogen, mit den Kräften der Geschichte, der Mauer, der politischen Wiedervereinigung und mentalen Entzweitheit, aber auch mit der Ironie der Beobachtung und dem Eros der visuellen Aneignung poetisch verschmilzt. Der Tradition der großen Langgedichte des 19. und 20. Jahrhunderts folgend, grüßt „ground zero“ eine ganze Reihe von ihnen mit rhythmischen und motivischen Anspielungen.
In seinen Anfängen in die frühen 90er Jahre zurückreichend, thematisiert das Gedicht disparate geistige Tendenzen, etwas zwischen Ost und West, Theorie und Plattheit, gesellschaftlicher Utopie und entnervendem und entseelendem Materialismus. Es verfolgt die Bahn der Schönheit und des komplementären Terrors, des radikalen Denkens und der ridikülen Spaßgesellschaft, den Gang des Chronos, mit seinem 11. September, seinem 3. Oktober und seinem politischen Gesetz der Reziprozität: Was zerstört, wird zerstört werden, und wenn Schönheit zerstört wird, entsteht „ground zero“.
kookbooks, Klappentext, 2005
Schlaflos in Berlin
– Herausfordernd: Gerhard Falkners vielstimmige Großstadtdichtung. –
Wo die U-Bahn oberirdisch fährt, stülpt eine Stadt sich um und hält ihren Unterbauch ans Licht. Das sogenannte „Gleisdreieck“ in Berlin ist solch ein Ort urbaner Umkehr, an dem ein ganzes Geflecht alter Verkehrs- und Versorgungsschläuche plötzlich an die Oberfläche quillt. 1924 schrieb der große Joseph Roth ein glühendes „Bekenntnis zum Gleisdreieck“ und feierte es als „Mittelpunkt“, wo „alle vitalen Energien“ der Großstadt „Ursprung und Mündung zugleich“ haben, so wie „das Herz Ausgang und Ziel des Blutstroms ist, der durch die Adern des Körpers rauscht“. Im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts geriet dieser Ort allerdings bald ganz ins Abseits, wurde erst zum Zonenrandgebiet und Brachland des zerteilten Stadtkörpers, dann zum Abraum- und Schuttgelände seiner brachialen Neuerfindung. Neuerdings entstehen dort Sportanlagen für die business class vom Potsdamer Platz.
Jetzt lesen wir, wie der Dichter Gerhard Falkner „als Unangebundener / durch die vollkommene Figur“ des Gleisdreiecks streift:
das Leben spielte seine
in vielen billigen Bällen geworfenen Zugaben
vom Spielfeldrand
in die knietiefen Blumen
und aus den Gedanken heraus, wahllos gestaltet
gelang noch einmal ein home run
Seine Streifzüge durch Berlin führen diesen zeitgenössischen Flaneur an solche abseitigen Orte, die auf dem Stadtplan sehr viel leichter als in der Stadt zu finden sind, weil heutzutage sämtliche Verkehrsströme an ihnen vorbeirauschen. Seine Beobachtungen, die er dort notiert, haben daher oftmals einen suchenden, fast archäologischen Charakter, als wollten sie unter all der lärmenden Gegenwärtigkeit des neuen Berlin an alte Schichten stoßen. Das gilt auch für seine Sprache, die in vielen Formulierungen noch einmal Echos jener hochtönenden Großstadtliteratur der Moderne zurückwirft – als nehme er die Bälle, die ihm zugespielt werden, dankbar, aber wahllos im Vorübergehen an. Denn ein Unangebundener kann von „home“ wohl nur als „home run“ sprechen.
Mit Gegensprechstadt – ground zero legt der Lyriker Gerhard Falkner, Jahrgang 1951, einen weiteren Band vor, der seine Erkundungen im Feld der Sprache als Expedition in ganz konkretes urbanes wie historisches Gelände eindrucksvoll vorantreibt. Dazu wählt er die Form eines Langgedichts aus knapp neunzig Strophen, deren klare Architektur aus alternierenden, reimlosen Versen dennoch Raum für andere Bauformen bietet und den epischen Strom immer wieder durch Elemente konkreter Poesie, durch fremde Stimmen oder Echowirkungen bricht. Eine seiner Absichten sei es dabei gewesen, wie der Autor im Nachwort erklärt, „poetisch der Schrumpfung von kontinuierlicher und überpersönlicher Zeit in jene jeweils fragmentierte und nur vom Subjekt als wahr erlebte Jetztzeitigkeit nachzuspüren“. Doch statt über derlei Tiefsinn nachzugrübeln, den Falkner mitzuliefern müssen meint, sollte man sich ruhig der persönlichen Lektüre überlassen, die das Programmatische schnell schrumpfen läßt und dafür ungleich spannendere Erlebnisse subjektiv spürbar macht.
Das Wörtchen „gegen“, das den Titel „Gegensprechstadt“ prägt, ist dabei weniger in antagonistischer Bedeutung als vielmehr im Sinne des Begegnens und Entgegnens zu verstehen, wie es sich in jedem Aufeinandertreffen ereignet, ob zwischen Stadt und Flaneur, Geschichte und Gegenwart oder Sprache und Welt: Das Gegenüber fordert stets heraus. Falkners Text antwortet auf diese Forderung mit lyrischen Momentaufnahmen wie mit literarischen Zitaten, mit elegisch inszenierten Abschiedsgesten wie mit harten Schnitten, mit sperrigen Wortfügungen wie auch gefälligen Phrasen. So entsteht ein bizarrer Reigen aus poetischen Figuren, die, teils wie Heimsuchungen, teils wie Heilsbringer, gegen die Zumutungen einer Hauptstadt aufgeboten werden, die sich am liebsten nur im Hier und Jetzt begreifen will. „Berlin beginnt immer mit den Worten: Heute, Jetzt / und Hier bin ich“, heißt es an einer Stelle, die erhellt, wovon Gegensprechstadt – ground zero spricht: vom Nullpunkt solcher Selbsterfindung.
Falkner beginnt mit den Worten:
Ich habe zuwenig geschlafen
in diesem Jahrhundert.
Wie ein Refrain ziehen sie sich durch den Text und markieren, wie er immer wieder neu ansetzt, seinen Gegenstand zu entwerfen oder zu umwerben. Denn mit dem Aufbruch in ein neues Jahrhundert ist diese Stadt erst recht erwacht und läßt dem, der sie erkunden will, wohl noch weniger an Schlaf. So erklärt sich jedenfalls das Somnambule dieses Textes, der oftmals wirkt, als streife der Flaneur mit aufgerissenen Augen, aber dennoch wie im Traum umher und gleite durch eine eigentümliche Assoziationswelt. Dieser Effekt verstärkt sich noch in der akustischen Umsetzung des Werks (in der Regie von Heiko Strunk), die Falkners Lesung mit der Musik des New Yorker Komponisten David Moss durchsetzt. Sie beginnt mit dumpfen, perkussiven Schlägen, die wie ein später Nachhall aus Berlin – Sinfonie der Großstadt klingen, geht dann aber bald in eine Toncollage über, die den Wortlaut mit disparaten Klängen und Geräuschen anreichert.
Dabei sind bei Falkner viele Verse selbst schon gleichermaßen vielsinnig wie vielstimmig gestaltet, denn durchweg zeugt der Text von dem, was er in einer wunderbar spielerischen Formulierung als „Reichspielungsantum der Sprache“ bezeichnet. Bei soviel Verweisungs- und Verwerfungsarbeit in der Sprache bleibt die Frage, an welchem Ort dieses Großstadtgedicht eigentlich selbst zu Hause wäre, letztlich offen. Von Heimatdichtung spricht man landläufig ja ohnehin nur noch im Sinn von einfältiger Beschränkung. In einem radikalen Sinn dagegen könnte jeder Akt, sich eine Welt sprachlich einzurichten, dazu zählen, und sei ihr Universum noch so groß. Der gestirnte Himmel über uns fand einst sein Zuhause im moralischen Gesetz in uns. Joseph Roth begeisterte in „klaren Nächten das Gleisdreieck, das von zehntausend Laternen durchsilberte Tal – es ist feierlich wie der gestirnte Nachthimmel: eingefangen darin wie in der gläsernen Himmelskugel sind Sehnsucht und Erfüllung“. Schlaflos in Berlin, probt Falkner solche Posen noch einmal und sieht von der Oberbaumbrücke „eine glänzende Nacht / die Sterne aus Styropor / im Wasser die Männer Borofskis / überragt vom Lichterautomat der Allianz“. Immerhin.
Tobias Döring, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.10.2005
selbstgespräche und klimadaten an der gegensprechanlage
poesie muss das risiko eingehen, miss- oder nichtverstanden zu werden, hat aber die chance, ihr ziel über die wahrnehmung der ästhetik, des schönen, verstörenden zu erreichen. ich bin mir nicht sicher, ob Gerhard Falkner dieser möglichkeit vertraut. warum sonst hätte er es für notwendig befinden sollen, seinem überaus atmosphärischen, ,scheinenden‘ langgedicht gegensprechstadt – ground zero ausser einem üppigen glossar ein viel zu ängstliches nachwort anzuhängen?
ein buch führt zum anderen, und andererseits ebenjenes glossar auf einen früheren gedichtband Falkners in der edition suhrkamp zurück: x-te person einzahl, eine sammlung 1996 aktueller sowie in früheren zusammenhängen veröffentlichter gedichte. ein kühles, konstruiertes buch, wie auch gegensprechstadt — ground zero konstruiert ist aus einzelszenen, teilweise älteren formexperimenten und zufall. allerdings eines, das – vielleicht gerade durch zufällig hineinspielende alltagswahrnehmung und tagesnachrichten – einen warmen, vielleicht etwas schwermütigen ton erzeugen und bis zum ende hin durchhalten kann.
aber der reihe nach:
als Clint Eastwood gefragt wurde
wie machen Sie Ihre filme
soll er geantwortet haben:
ich reite in eine stadt
der rest ergibt sich von selbst.
so macht es Falkners alter ego: „ich habe wenig geschlafen / in diesem jahrhundert“ lautet der erste und einer der zentralen, sich wiederholenden verse, ein refrain. es ist viel geschehn, zum schlafen konnte oder wollte Ich nicht kommen. es reitet stattdessen durch die tage, durch die strassen, durch eben jenes jahrhundert und es geschieht, dass Ich sich ein körpergedächtnis zufügt, das „das grosse geschehen mit winzigen annotationen“ verkettet. „kick your ass / and your mind will follow.“
also, erstmal aufstehn, aufzählen der tage, des ewig gleichen, eine basis finden. der erste abschnitt der gegensprechstadt mutet wie eine genesis an:
ich habe zu wenig geschlafen
in diesem jahrhundert!
ein zwei drei
zwei drei — vier
oder fünf stunden
pro nacht, oder monat
oder jahr
damals, in der zeit des kurzen schlafs
war noch ziemlich viel wahr
die zeit hatte zeit
und man war nackt
wenn man die geduld hatte
sich zu entkleiden
es gab noch keinen 11. september
keinen 3. oktober
und keinen 15. märz.
„der 11. september steht für das schreckliche“, merkt Falkner im nachwort an. das 9/11-attentat ist ihm ins schreiben gekommen. 2001 und nachher über eine stadt zu schreiben hiess, dass man an manhattan als ,ort und zeit der bildheit‘, der „optischen initiation“ nicht mehr vorbeischreiben konnte. es sind zentrale und doch beliebige, zufällige daten der geschichte, die der autor eingearbeitet hat.
meine augen sehen
… wie alles sich fickt und fortpflanzt
und zwischen den zeilen
der grossen attentate
nichts als den blanken alltag vorantreibt.
deutsche einheit, eigener geburtstag, tsunami-katastrophe. so zufällig sollte man die daten denn auch lesen. Falkner verbindet keine einzige, konkrete aussage mit einzelnen, konkreten ereignissen; in der hauptsache stellt er atmosphäre her und dem geistigen itzt-zustand nach: einem Wir am ende des 20. und am beginn des 21. jahrhunderts.
dieses gedicht
dient der augenblicklichen stimmung
als sprachrohr.
dafür spricht, dass man selbstverständlich passagen einzeln konsumieren kann und darf, dass man die dem kookbook zugegebene, mit dem musiker David Moss und der literaturWERKstatt berlin produzierte cd nach reihenfolge eigener lieblingstracks anhören kann (und wohlmöglich nur die musikalischen interluden, nicht den gesprochenen text auflegt) — und dafür spricht, dass sich sinn auch beim querlesen des buchs einstellt.
ich habe zu wenig geschlafen, ich habe zu wenig geredet. ich habe zu wenig geschlafen, heute lebe ich in der duncker 19 uhr 40 (der dienstag ist der grausamste unter den tagen: dies martis, dies irae)… dir allerdings begegnete ich an einem freitag: in fact: heute ist wieder freitag, aber ich habe zu wenig geschlafen… eine glänzende nacht, berlin, phäakenstadt, 20. jahrhundert, silvester 2000, 20. jahrhundert — heute ist immer heute
und das gedicht ist lauter erste zeilen.
gegensprachstadt — ground zero ist neben Michael Stavarics europa. eine litanei und Ron Winklers gedichtband vereinzelt passanten das bereits siebente und bestimmt nicht letzte kookbook, das den weg in mein regal gefunden hat. für das cover des teils in kookone (kook 1 oder cocoon) gesetzten buchs hat sich Andreas Töpfer eine collage aus messinstrumenten einfallen lassen. ein kassenband, eine zahnradapparatur, druck- und zeitmesser, geographische koordinaten, eine stadt – berlin – auf einer waagschale und vielleicht auch eine radioskala.
ein bisschen schwankt der ton des gedichts nämlich wie drehen am radio; stimmen erscheinen, verzerrt noch, dann deutlicher, und sind im gleichen augenblick verschwunden. sprechhaltungen werden angenommen wie anzüge, motive lagern dauerhaft übereinander, scheinen durch andere hindurch: die hauptstadt immer zuoberst, 9/11 hin und wieder aufkommend, an die oberfläche durchbrechend. frauen, liebe zuunterst, als ein auch, als etwas, das zur atmosphäre beiträgt, das auch nur eine yahoo-identität hat, eine telephonnummer ist. „für seelische noten verwendet“ das gedicht „ein multiplex-verfahren / das urbane leidenschaften / in ultrakurze pulse zerlegt.“
kein du im text, es ist vom ich die rede, von der stadt auch als ich. „die stadt ist ein buch / wir schlagen die erste strasse auf / wir lesen die erste strasse / wir lesen sie mit den füssen“ und durch die ohren der engel im himmel über berlin. das geschieht einmal im Kuhligkschen tonfall, ein andermal spielend, anspielend auf Mandelstam und Celan oder als parodie auf die sprechweisen des rap und poetry slam. Ginsbergs howl klingt genauso an wie Brinkmann:
berlin, august, heute
geschmeidige tage, guter groove
aber auch angst vor dem mittag
angst vor seiner ungegenständlichkeit.
dabei macht gerade der anhang das gedicht ungegenständlich, interferriert den wirklich guten, in seiner melancholie treibenden (und definitiv ohne cd-beigabe auskommenden) groove mehr als die immer wieder einstürzenden, implodierenden motive innerhalb des eigentlichen texts. da frieren bilder ein „wie videostills / angehalten zu erinnerungen“, noch ehe sie ganz ausgekostet sind. denn nicht die bewegten, nur stehende bilder bleiben haften.
und manchmal war es dann
wie damals
berlin war voller luft
die tage bewegten sich wie eine Venus
von Bartholomäus Spranger
und erzeugten ein klima
das sich bahn brach
in wilden ehen
in tropismen, doubles, differenzen
bis das blatt sich wendete
bis es das ganze ding
endlich richtig erwischte
getroffen wie die twin towers
vom gesetz
der reziprozität.
Gerhard Falkner schafft es mit bewundernswerter leichtigkeit — und in diesem aktuellen text mehr als in älteren —, abstrakte anschauung mit blut zu füllen.
in dritter vergangenheit
gingen wir rüber
in die duncker
und legten unsere minds auf
wie eine scheibe von Lou Reed
damals in diesem keller in moskau.
es ist dem buch zu wünschen, was es sich selber wünscht, dass es nämlich genau so wie eine scheibe aufgelegt wird. man wird es stets heraushören aus allen mashups und mixes, in die es einfliesst. denn es handelt sich hier um grosse poesie — auch, wenn es sich mit dieser manchmal verhält wie mit grossen penissen: man kommt nicht überall hinein damit.
„ich habe zu wenig geschlafen / in diesem jahrhundert“ heisst auch: ich habe zu viel schund gesehen, zu wenig essentielles, und zu wenig schlicht verpasst. damit muss man leben. und wäre es ein leben ohne all das?
Crauss, Kritische Ausgabe, 31.5.2016
Sing die Großstadt
– An den Lagerfeuern von Berlin: Gerhard Falkner unternimmt eine dichterische Expedition. –
Nichts ist diesem Dichter verhasster als jener Kulturgehorsam, mit dem man sich in Deutschland für den Karrieresprung zum „Götterliebling“ ausstattet. Gerhard Falkners Schönheitsverlangen braucht die schroffe Abgrenzung gegenüber den jeweils dominanten Tonlagen des lyrischen Betriebs. Oder die kunstvolle Irreführung, wie er sie neulich in der Poetik-Anthologie Die Hölderlin-Ameisen zelebriert hat. Dort jonglierte Falkner, 1951 in Schwabach geboren und heute im Fränkischen und in Berlin zu Hause, mit mythologischen Materialien als den vermeintlichen Ingredienzien seines Gedichts „Vielversprechend versprochene Kiesel“ – um dann preiszugeben, dass seine Interpretation nur eine Luftnummer war, ein Bluff zur „Aufpolsterung“ der poetischen Textur.
Trotz einer ausgeprägten Neigung zur ironischen Imprägnierung seiner Stoffe fühlt sich Falkner einer „Rehabilitation des Schönen“ verpflichtet. In seinen ersten drei Gedichtbänden hatte er die flau gewordene Subjektivitätspoesie der Alltagsrealisten und das „verausgabte“ experimentelle Gedicht im Visier.
Angeödet von einem gedichtblinden Literaturbetrieb, zog er sich nach seinem dritten Band wemut (1989) an die Westküste der USA zurück. Sein Schweigegelübde vermochte er indes nur einige Jahre einzuhalten. Kurt Drawert hat Falkner einen „Minnesänger der Moderne“ genannt – weil dieser Dichter beharrlich die Anschlussfähigkeit der Dichtung an die Bewusstseinsherausforderungen einer medial präformierten Gegenwart herzustellen sucht. Zuletzt agierte Falkner als Mentor der ruppig diskutierten Anthologie Lyrik von Jetzt, in der die Generation der Dreißigjährigen ihr urbanes Lebensgefühl kundtat, dabei mitunter aber in den Bildbeständen eines schal gewordenen Realismus kramte.
In seinem jüngstem Gedichtband, den er in einer frühen Fassung bereits 2003 in der Berliner Literaturwerkstatt vorstellte, hat sich Falkner an eine neue Kühnheit gewagt: an die Rekonstruktion des modernen Großstadtpoems, das mit einem „starken, aufgestockten Deutsch“ neu belebt werden soll. Das Langgedicht Gegensprechstadt – ground zero ist zugleich Großstadtgesang, politische Rhapsodik nach den Erschütterungen des 11. September und Requiem auf eine verlorene Liebe. Das lyrische Subjekt gleicht hier jenem schlaflosen Dauergast im „Hotel Insomnia“, das schon Charles Simic als Fabrikationsstätte moderner lyrischer Fantasie beschrieben hat. „Ich habe zu wenig geschlafen / in diesem Jahrhundert!“: Dieser Refrain bildet den Auftakt zu einem nervösen Spaziergang entlang der Bewusstseinsreize und Mode-Zeichen des zu Ende gegangenen „Jahrhunderts der Gegenwart“. Der 11. September wird ebenso herbeizitiert wie eine Unzahl kultureller Codes: Das „E-Mail-Konto von Yahoo“ , ein „gelb kariertes Van-Laack-Hemd“ oder „die Scheibe von Lou Reed“ werden mit derselben Aufmerksamkeit bedacht wie der Angriff auf die Twin Towers. Diese zerstreuten Inspektionen eines Großstadt-Subjekts werden auf der beigefügten CD flankiert von den stimmlichen und perkussiven Suggestionen des Avantgarde-Musikers David Moss.
Das lyrische Ich, das „zwanzig Jahre an den Lagerfeuern von Berlin“ verbracht hat, registriert die Gegenwarts-Versessenheit der Metropole, in der jeden Tag neue Utopien geboren werden und „die Gesterns – nichts als Späne (sind), / die vom Heute flogen“. Falkner verfährt fast durchweg erzählerisch, adaptiert von seinen Bezugsfiguren Walt Whitman, Charles Olson und Allen Ginsberg den offenen Vers. Die paradoxe Sprachfigur, die Verballhornung und die kühne Metapher sind ihm dabei genauso nah wie das kitschige Bild. Die Kollisionen zwischen Neo-Romantik und Banalität fallen mitunter heftig aus:
die unstillbare Liebe
das ist der poetische GAU
Hölderlin hat das nur anders ausgedrückt…
Der Textteil und der Anmerkungsapparat stehen in diesem Buch in einem seltsamen Gegensatz-Verhältnis. Je verhaltener der Ton der lyrischen Rede, desto ausladender wird der Dechiffrierehrgeiz in eigener Sache, den Falkner in seinem zwanzigseitigen Kommentar an den Tag legt. In seinem universalpoetischen Kategorien-Furor kann Falkner sehr geistreich, aber auch sehr umständlich sein. In seinem Gedicht gibt es entzückende, aber auch sehr verquaste Partien. Aber wie sagte schon Walter Höllerer vom langen Gedicht: Es „gibt eher Banalitäten zu, macht Lust auf weiteren Atem. Ich spiele mit dem, was ich gelernt habe.“
Michael Braun, Der Tagesspiegel, 6.5.2005
Von der Spaßgesellschaft zur Konjunkturmaschine
– Literarische Orientierungssuche: Gerhard Falkners Gedichtzyklus Gegensprechstadt – ground zero. –
Die deutschsprachige Belletristik steht derzeit vor einer ähnlich großen Umwälzung wie zuletzt vor gut 30 Jahren, als eine 68er-bewegte Szene die vordersten Plätze im Literaturbetrieb für sich reklamiert hatte. Die Autoren der Jahrgänge 1965 bis 1980 sind angetreten, dem Roman einen frischen Stempel aufzuprägen und die Generation ihrer Väter in Rente zu schicken. Die neuen Stars bevorzugen es nett, gefällig und angepasst, lassen Politik und Gesellschaftskritik außen vor, wagen keine formalen Experimente, ganz so, als wollten sie die mit den 68ern verknüpften erzählerischen Innovationen zurücknehmen.
Dieser Wandel ist nicht ohne Auswirkung auf die Lyrik, die sich vermehrt der Aufgabe annimmt, kritische Diskurse anzustoßen, und die sich mittlerweile zu einem Hauptschauplatz entwickelt hat, an dem die Verwachsungen der Gegenwart seziert werden. Statt sich in das Los der Rente zu fügen, meldet sich die Nachkriegsgeneration dort mit vor Energie, Subversion und Sprachgewalt nur so strotzenden Monumentalgedichten zu Wort, die vom Kalten Krieg einen Faden bis in das Heute spannen. Statt sich widerstandslos dem Lauf der Globalisierung zu fügen, suchen dort Altmeister nach den Sollbruchstellen, an denen sich die harte Nuss der neuen Weltunordnung knacken lässt.
Mit Gegensprechstadt – ground zero, gesellt sich jetzt auch der 1951 in Schwabach geborene Gerhard Falkner zu jenem Kreis, die aus seiner im 20. Jahrhundert gesammelten Lebenserfahrung heraus zu erahnen versuchen, in welches Schlamassel das noch junge 21. Jahrhundert zu schlittern droht.
„eine Zeit, in der man bei Künstlern / wenn man sie auszieht / auf CK- oder Joop!-Unterwäsche stößt / (als letzte Schicht sozusagen / vor der eigentlichen Inspiration)“, zetert der Schiller-Preisträger 2004, der sich zum Schreiben gern aus seiner zweiten Heimat Berlin in die Provinzialität des Nürnberger Umlands zurückzieht, „ist reif für eine Revision (…) damit sie zurückfindet / (um im Bild der Sprache zu bleiben) / zum ehrlichen Baumwollripp mit Eingriff“.
Falkners 70 Seiten umspannendes Sprachnetz Gegensprechstadt – ground zero erschreibt sich einen Bauplan für das kulturelle, soziale und politische Fundament, auf dem eine Gegenwart fußt, die sich nicht entscheiden kann, ob sie Spaßgesellschaft sein will oder lieber eine Konjunkturmaschine, die auf Rebellion und Individualität verzichtet. Dreh- und Angelpunkt der Exkursionen eines lyrischen Ichs in die Metaphysik der Vergangenheit sind jene zwei schweren Detonationen, die die Ordnung der deutsch-deutschen Polarität ausgelöscht haben, in der man sich vier Jahrzehnte lang wie ein Blinder hatte bewegen können. „Die DDR, die Grenze und das ganze Gestern: alles weg“ – „Der 11. September hat meine Zeilen eiskalt erwischt. Oder war es der 3. Oktober?“
Die langen Tauchgänge zurück in die eigene Biografie sind Versuche, neue Orientierung zu finden. Denn erst wenn das lyrische Ich wieder verwurzelt, geerdet ist, dann kann es sich auch wieder mit der Sicherheit durch den Strudel der Fortschrittlichkeit manövrieren, die ihm vor dem Fall des eisernen Vorhangs gegeben war. Nein, Falkners Beschwörungen der an die 68er gekoppelten linken Kosmen und deren Vorbilder und Helden aus Kunst und Kultur, die sich auf seinem riesigen Versteppich breit machen, generieren keinen nostalgischen Ballast.
Viele Zeitgenossen interpretieren die „Stimmen von Stammheim“ und „Mogadischu“ als von der Geschichte entwerteten Schrott, bei Falkner gehören sie den verlässlichen Koordinaten an, den Eckpunkten einer Identität, die Halt verleihen und es dem lyrischen Ich erst erlauben, sich in eine neue Relation zum Heute zu setzten, Autonomie und Selbstvertrauen zu zurückzugewinnen. „damals in der Zeit des kurzen Schlafs / war noch ziemlich viel wahr / die Zeit hatte Zeit / und man war nackt / wenn man die Geduld hatte / sich zu entkleiden“.
Die Literaturkritik hat den Band bereits als „Jahrhundertgedicht“ gefeiert. Doch es würde bereits genügen, wenn er die Aufmerksamkeit all jener, die die einfallsarmen Bauchnabelschauen der Nachwuchs-Romanciers schon jetzt nicht mehr lesen können, auf ein Genre umlenken würde, in dem es den Themen so richtig an die Substanz geht.
Auch wenn Zitat und Zusammenfassung leicht den Eindruck erwecken, Gerhard Falkners poetisches Programm wäre abstrakt, elitär und verstiegen, wird sich Gegensprechstadt – ground zero beim Lesen schnell als erstaunlich griffiges Versgebilde entpuppen. Dank der beigefügten CD, die eine Hörbuch-Fassung enthält, ist das atemberaubende Langgedicht selbst für wenig Geübte verblüffend rasch decodierbar.
Martin Droschke, Nürnberger Nachrichten, 11.1.2006
Instadtsetzung und Verbergung der Seele
– Über die Ich-Inszenierungen in Gegensprechstadt – ground zero und Bruno. –
Wie oft ist das lyrische Ich bei Gerhard Falkner ein lächerliches Ich. Verzweifelt lauert es sich auf und stolpert durch einen Parcours, auf dem es sich im selben Moment, da es sein schütteres Haupt erhebt, schon wieder aus dem Blick gerät. Als zuverlässiges Organisationszentrum von Erfahrung taugt es wenig, und es würde seine Hilflosigkeit wohl kaum aushalten, wenn es sich von Zeit zu Zeit nicht wenigstens ironisch in den Griff bekäme. „ich, bitte antworten!“, fordert es sich im gleichnamigen Gedicht des Bandes wemut auf. Der Appell kommt über die Beschwörung nicht hinaus. Denn „wird ein wort so dicht / dass sich sein sinn / der eigenen anziehung / nicht mehr erwehrt / stürzt es in sich“. Im schönsten hölderlinschen Odenton bleibt daher nur der Schluss:
seine innere irre ordnet der geist
grundlos
Aber wo verläuft die Grenze zwischen dem irrenden Innen und dem chaotischen Außen? Durch welchen Widerstand gelangt das Ich über das tautologische Selbstgespräch hinaus? Falkner weiß, dass sich das ersehnte Ich auch durch anhaltende Selbstverspottung allenfalls als verspottetes Ich herbeilocken lässt. So heißt es in dem Gedicht „zwei zu eins“, das sich ebenfalls in wemut findet:
um einmal mit jemand zu sprechen
sprach ich zu mir und sagte
nun sitzt du hier und weißt
nicht wer du bist und sprichst
zu mir der eh weiß was du
sagst
Deshalb dividiert sich das traurige Individuum auch gleich wieder auseinander und empfiehlt:
am besten ist du fährst ans
meer und schickst mich ins tessin zurück
In Falkners Inszenierungen steckt mindestens so viel romantische Ironie wie schmerzhafter Ich-Zerfall und postmoderne Verabschiedung eines Subjekts, das doch nicht von sich und seinen narzisstischen Gewohnheiten lassen kann. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch das Langgedicht Gegensprechstadt – ground zero und die Novelle Bruno:
jedenfalls war ich zur Wirklichkeit
wie sie sich selbst über Hiroshima hinaus erhalten hatte
mit Subjekt und Sinn und Geschichte
mit Strand, Tierpark und Liveshow
so nicht mehr bereit
Die beiden Texte beziehen sich nicht ausdrücklich aufeinander, doch sie sind zweifellos komplementäre Entwürfe. Was der große Berlin-Gesang Gegensprechstadt als „Instadtsetzung der Seele“ betreibt, leistet die in den Oberwalliser Alpen spielende Prosa Bruno mit einer nicht weniger buchstäblichen Verbergung der Seele. Hier wie dort folgt Falkner einer paradoxen Strategie des Sichsuchens und Sichverfehlens, des Sichmarkierens und Sichunkenntlichmachens.
Es sind nicht die einzigen Parallelen. So, wie das Gedicht in seinen Wanderbewegungen durch Berlin narrative Züge besitzt, hat die Novelle poetische. Jeder Satz, auch der kürzeste, beansprucht einen eigenen Absatz, als handle es sich um einen Vers. Und der chemische Begriff des Polymeren, den Falkner auf Gegensprechstadt anwendet und der vor allem bedeutet, dass hier eine Großstruktur aus mehreren, sich wiederholenden Elementen aufgebaut ist, lässt sich auch für Bruno in Anspruch nehmen. Die Motivketten, die Falkner hier zwischen Licht und Feuer, Hitze und Kälte, Denken und Trieb, Mensch und Bär immer wieder neu knüpft, sind für einen erzählenden Text geradezu überdeterminiert.
In beiden Fällen handelt es sich obendrein um hochgradig intertextuelle Arbeiten. Bruno bezieht sich, wie der Text selbst freimütig preisgibt, in seinen Naturschilderungen auf Adalbert Stifters Erzählung Granit und in seinem Jagdmotiv auf Ernest Hemingways Novelle Der alte Mann und das Meer. Rhythmisch, so hat Falkner einmal verraten, habe ihm die syntaktische Verknappung von Rainer Maria Rilkes jugendlicher, mit den in Gegensprechstadt zitierten Worten „Reiten, reiten, reiten“ einsetzenden Erzählung Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke vorgeschwebt, deren traumverlorener Protagonist weniger eine deutlich konturierte Person als eine mit den Energien der Liebe und des Krieges aufgeladene Leerstelle ist.
Gegensprechstadt wiederum enthält eine schwindelerregende Zahl offener und versteckter Anspielungen auf kanonische Großgedichte: darunter T.S. Eliots The Waste Land, Allen Ginsbergs Howl, Inger Christensens „Alfabet, Walt Whitmans „Leaves of Grass, Kurt Schwitters’ „An Anna Blume, Ezra Pounds „The Pisan Cantos – nicht zu reden von den sonstigen literarischen und philosophischen Bezügen und der Tonlagenvielfalt bis hin zur Rap-Anverwandlung.
Mit krampfhaftem Bemühen um Gewicht hat dies nichts zu tun, schon weil es alle Erhabenheitslasten spielend abschüttelt. Es ist der Versuch, die Unmöglichkeit originären Sprechens an jene Grenze zu treiben, wo die persönliche Vision mit dem totalen Zitat verschmilzt. Falkner erlebt sich schreibend durch das bereits Geschriebene, und die Auslöschung seiner Subjektivität ereignet sich im unmittelbar Autobiografischen. Niemand bezweifelt, dass Gerhard Falkner in Prenzlauer Berg wohnt und die Wege, die er in Gegensprechstadt geht, zahllose Male gegangen ist. Und jede Vita bestätigt, dass er 2006 als Träger des Spycher-Preises zum ersten Mal ins Oberwallis nach Leuk kam, um zu Füßen des Illhorns in Schreibklausur zu gehen. Zugleich ist er nicht müde geworden, „das Einzigartige als beliebige Folge von Austauschbarkeiten“ zu betrachten, wie ein Gedicht in X-te Person Einzahl heißt.
In einem Internetfilm für landvermesser.tv, bei dem Falkner Schauplätze der Gegensprechstadt aufsucht, betont er:
Die Ausschließlichkeit des Ortes als Punkt der Erfahrung ist nicht mehr notwendig.
Ähnlich entschieden äußert sich der Erzähler von Bruno:
Aber nun bin ich eben mal hier. Und darum wird jetzt in Alpen gedacht.
So entdeckt er beim „Blick in die eigenen Räume“, welche überraschenden Perspektiven sich ergeben, wenn man „auf seine garstigen Karste blickt, seine Karawanken mit ihrem gärenden Schnee, oder ob man ihn über die farbsprühenden und wohlduftenden inneren Meeralpen schweifen lässt, die sich in den Buchten zwischen den Nizzas und den San Remos dieser Welt mit einem rasanten Glanz in südliche Meere stürzen“. Und er macht die Beobachtung:
Während das Denken in einer Region gedeiht, in der Klarheit und Kälte einander begünstigen, kocht in den Eingeweiden der Trieb, gärt in den Lenden das Laster und an den Füßen züngeln die Flammen.
Das Ich fungiert in den unterschiedlichen Kontexten nur noch als Spannungsprüfer von Reizkonstellationen, bei denen sich Inneres und Äußeres, Messbares und Gefühltes, Topografisches und Historisches, politische Nachricht und Marketingbotschaft überkreuzen. Es kann sich an einzelnen Punkten lokalisieren, aber nicht mehr als Ganzes adressieren:
heute lebe ich in der Duncker 19 Uhr 40
bei 39,6
gemessen unter der Zunge
in meinem Herzen
schneidet sich der 52. Grad nördlicher Breite
mit dem 13. Grad östlicher Länge
das ist plusminus Berlin
besucht von Putin
bebaut mit dem Neuen Bundeskanzleramt
und bevölkert von Menschen
denen zum Wort ,klassenlos‘ gerade mal noch
die Süddeutsche Klassenlotterie einfällt
Falkner hat in seiner Dankesrede zum Peter-Huchel-Preis 2009 „das Versiegen des inneren Monologs“ nicht zum ersten Mal als „die definitiv ernsteste Bedrohung für das Gedicht“ bezeichnet und „die Erschließung der intimen, diskreten und empathischen Räume“ im „Interesse des Marktes“ als „Folge der Hyperkommunikation“ ausgemacht, „die mit ihren anamnetischen Strategien die letzten Ruhezonen des Ichs beseitigt“. Die Sache ist nur, dass selbst ihm dieser innere Monolog nur noch rinnsalartig gelingt. Das Ich von Gegensprechstadt schwächelt als „Ich-Ritze“, „Mich-Meldestelle“ und „Seinsaufgangsomen“ und begegnet sich allenfalls stockend und stotternd:
BIST DAS
BIST DAS EINFACH
BIST DAS EINFACH NUR DU?
ist das Du denn dazu da, um nicht
mitten im Ich stecken zu bleiben, ist denn Du das bebendste der Personalpronomen
Sturzbäche dissonanter Informationen brausen darüber hinweg: mit Datenmengen, die jedes Internalisierungsvermögen überfordern, mit Sprachen, die als fremd erlebt werden, und mit ökonomisch motivierten Narrativen, die die Kolonisierung der Seele betreiben. In dieser Unfähigkeit, sich und die Welt noch als Einheit zu erleben, ist Falkner ganz Bewohner eines Waste Land, wie es T.S. Eliot in der auseinanderstrebenden Polyphonie seiner Dichtung kartografierte. Mit der Stadt als Raum und Projektionsfläche dieser Erfahrung erkundet er jenen Ort, an dem die Wirklichkeit seit Beginn der Moderne ihr multiples Gesicht am offensten zeigt. Und wie Rolf Dieter Brinkmann, allerdings mit kulturkritischem Unterton, gelingt ihm Wahrnehmung nur noch über kulturelle Artefakte:
ein Tag
wie gekauft bei Macy’s
getanzt von Ginger Rogers
und gesampelt für MTV
ein Tag
erfrischt mit einem Spritzer ,Eternity‘
von Calvin Klein
Falkners spezifisch zeitgenössische Wendung liegt dabei nicht nur im verarbeiteten Material. Sie liegt auch darin, dass er im selben Maß über die aufgenommenen Traditionen hinauszugehen versucht, wie er hinter ihre postmodernen Konsequenzen zurückkehren will. So weiß er, dass kaum jemand dem unversehrten Selbsterleben des Subjekts in Prosa und Gedichten radikaler zu Leibe gerückt ist als Gottfried Benn, dessen späten Reden und Vorträgen er 2011 unter dem Titel „Mind the Gap – Über die Lücke zwischen lyrischem Ich und Wort“ eine auch für die eigene Poetologie aufschlussreiche Einführung gewidmet hat. Er geht mit neurowissenschaftlichen und systemtheoretischen Bezügen aber auch deutlich über die hirngeologischen Untersuchungen hinaus, in denen Doktor Benn in einem Aufsatz „Zur Problematik des Dichterischen“ 1930 dekretierte:
Das Ich ist eine späte Stimmung der Natur.
Falkner will, wie er in „Mind the Gap“ erklärt, bereits 1984, „mit einer eigentlich unverzeihlichen Verspätung von fast zwanzig Jahren“, festgehalten haben:
Für das lyrische Ich wird’s langsam Zeit fürs Müttergenesungsheim.
Die Verspätung ist im Grunde viel dramatischer. „Die Menschenlehre Europas, als Fiktion individuell existenter Subjekte“, heißt es etwa in Benns Prosa „Das letzte Ich“ von 1920, „hat nur noch einen kommerziellen Hintergrund.“ Und in dem Vortrag „Das moderne Ich“ aus dem Jahr 1919:
Nun steht es da, dies Ich, Träger allen erlebten Inhaltes, allem erlebbaren Inhalt präformiert. Anfang und Ende, Echo und Rauchfang seiner selbst, Bewusstsein bis in alle Falten, Apriori experimentell evakuiert, Kosmos, Pfauenrad diskursiver Eskapaden, Gott durch keine Nieswurz zu Geräusch lanciert; – Bewusstsein, fladenhaft, Affekte Zerebrismen; Bewusstsein bis zur Lichtscheu, Sexus inhärent; Bewusstsein, Fels mit des Königs Inschrift, krank von der Syntax mythischem Du, letzter großer Buchstabe: persisch, susisch, eleamitisch, drohend Gewalt unterworfenen Ebenen: Erbe und Ende und Achämenide.
Dennoch denkt Falkner gar nicht daran, den Wackelkandidaten Ich zu opfern und widerstandslos in einen unpersönlichen Zusammenhang der Dinge und Diskurse einzurücken, wie ihn Nouveau Roman und Poststrukturalismus entwerfen.
Als Bewunderer des New York Poet Frank O’Hara, dem Bruno den fett hervorgehobenen Satz „Das geringste Nachlassen der Aufmerksamkeit führt zum Tod“ verdankt, misstraut er der Neigung, sich in der trügerischen Tiefe einer einsamkeitsumflorten Innerlichkeit zu ergreifen, die Rilke und Benn auf ihre je eigene Weise propagierten. Doch er trotzt auch der Versuchung, jene Affirmation der Oberflächen zu betreiben, die popkulturellen Distinktionsgewinnlern ihre Prêt-à-porter-Identitäten leiht. Vor die Alternative „Vergegenstädtlichung oder Ungegenstädlichkeit“ gestellt, nimmt Falkner die Herausforderung an, die von allen Seiten heranbrandenden Stimmen und Diskurse noch einmal mit größtmöglicher Trennschärfe festzuhalten, bevor sie einander in einem weißen Rauschen überlagern. „Man muss die Zugeballerten im Auge behalten“, fordert er im Benn-Aufsatz, „auch wenn man am Schreibtisch, im Bus oder in der Straßenbahn sitzt, unterwegs in halkyonische Gefilde. Nichts darf vor dem Gedicht sicher sein, nicht einmal die Benzinpreise, alles aber darf das Gedicht im geeigneten Fall gelassen verschmähen. Nur durch das Wissen um die eigene Zeit erwirbt sich das Gedicht die Starterlaubnis in den zweckfreien Raum.“
Das Ich, das dies zu leisten versucht, mag als synthetisierendes Organ zu keiner schlüssigen Deutung mehr fähig sein. Es ist abwechselnd Kühlsystem und Durchlauferhitzer, als dichterische Aufzeichnungsinstanz gibt es sich jedoch keineswegs verloren, auch wenn Falkner wie Benn in den „Problemen der Lyrik“ Albrecht Fabri zustimmen würde, der eindeutigen Autorschaften bei Gedichten misstraut:
Jedes Gedicht hat seine homerische Frage, jedes Gedicht ist von mehreren, das heißt von einem unbekannten Verfasser.
Die Pluralität der Stimmen schließt Wert- und Wahrnehmungshierarchien nicht aus. „Ein brüllendes Auto ist keineswegs schöner als die Nike von Samothrake!“, schreibt Falkner in „Mind the Gap“, um das Qualitätsgefälle zwischen Benn und den Dadaisten zu illustrieren:
Obwohl natürlich der, der nicht weiß, was die Nike von Samothrake ist, in einem brüllenden Auto sicher besser aufgehoben ist als im Louvre oder Pantheon.
Falkner vertritt solche kulturkonservativen Ansichten mit Verve. Denn gerade die Leichtfertigkeit, mit der Intellektuelle „Kulturpessimismus als lästige und sogar reaktionäre Inszenierung abtun“, ist ihm zuwider: Sie „passt perfekt in jede Harald-Schmidt-Show“. Auch die alte Metapher von der Lesbarkeit der Stadt, die Falkner in einem längeren, der Gegensprechstadt kursiv eingelagerten Gedicht noch einmal ausbuchstabiert, will er nicht einfach preisgeben. Ihre hermeneutische Strahlkraft mag dekonstruktivistisch beeinträchtigt sein, behält jedoch zumindest im Hinblick auf das Element, in dem er sich bewegt, ihre konstruktive Bedeutung:
mit der Zeit verstehen wir auch
dass der Satzbau der Straße
wichtiger ist als das Verstehen
Denn wo wäre das fassbare Ganze? „Sie liegen da, sagte ich, meine Gedanken, wie die Lichter einer Stadt, die man nachts mit dem Flugzeug anfliegt“, heißt es in Bruno, Erst die Zusammenhänge würden zeigen, „dass es sich zum Beispiel um eine Stadt handelt und möglicherweise, um welche“, während die einzelnen Gedanken „für sich genommen vielleicht ein Berg oder ein Gipfel“ seien, „welche aber als Detail ebenso viel Bedeutung besäßen wie das System des Gebirges, das mit seiner viel größeren Komplexität diesen Berg zwar einbegreife und möglicherweise unterordne, ihn dadurch aber weder schmälere noch übertreffe.“
Das Ich von Bruno ist weniger fragmentiert als dasjenige von Gegensprechstadt, aber genauso opak. Unter Mühen erkennt es sich – „mit dem Gesicht, das ich aus Berlin mitgebracht habe“, und der Absicht, ihm „nun ein anderes, aber ebenfalls eigenes, hinzuzufügen“ – auf einer Fotografie in der lokalen Walliser Zeitung. Sie zeigt für ihn aber nicht mehr als „das Konterfei an der Spitze jener sterblichen Hülle, deren Bewohner ich auf die Spur kommen möchte“. Wenig später entdeckt dieses Ich in der Zeitung die Aufnahme eines Bären, dessen Fährte aufzunehmen mindestens ebenso schwierig zu sein scheint. Denn es handelt sich, in Anlehnung an den bayerischen Problembären Bruno, der 2006 die deutsch-österreichischen Alpen unsicher machte, um ein flüchtiges Wesen, das „als zurzeit einziger Bär in der Schweiz gelten muss“, in einer Region, in die es „auch mich, als derzeit letztes lebendes Exemplar meiner eigenen Person, verschlagen hat, mich, ein ebenfalls vom Aussterben bedrohtes Exemplar einer einst in gesunden Populationen vorkommenden, unbändigen Existenz“. Aus der Verwandtschaft des Ich mit dem Anderen ergibt sich ein regelrechter Verschmelzungswunsch:
Jemand wie ich könnte sich nur wünschen, auszusehen wie dieser Bär.
Bruno erzählt also die vexierbildhafte Geschichte einer Selbstsuche mit Doppelgänger. Es versteht sich von selbst, dass sie misslingen muss. Die Jagd, die der Ich-Erzähler auf sich selbst in Gestalt des Bären macht, endet zuerst mit einer kapitalen Verwechslung: Statt der Bestie steht auf einmal ein halbwüchsiger Bulle vor ihm. Und als ihm der Bär endlich vor Augen tritt, ist ihm durch die Tatsache, dass man ihm „in den Kopf geschossen“ hat, einem burjatischen Mythos zufolge die entscheidende Fähigkeit geraubt:
Der Bär ist bestimmt durch seinen Kopf, die Kraft und das Geheimnis seines Kopfes, denn dieser Kopf transportiert immer eine Seele von einem Leben zum nächsten. Wenn man einen Bären tötet, so darf keinesfalls der Kopf verletzt werden, da diese Seele sonst entweicht.
Die Figur des Doppelgängers gehört zum festen Motivbestand des vorletzten Fin de Siècle. Als Abspaltungsphänomen ist sie das sinnfälligste Zeichen von Selbstentfremdung und Ich-Auflösung, die im ästhetizistischen Kreis der Wiener Moderne spätestens durch Hugo von Hofmannsthals 1899 erschienene Reitergeschichte zu literarischer Bedeutsamkeit gelangte. Schon 1886 erklärte der für Hofmannsthal und Robert Musil prägende Philosoph und Physiker Ernst Mach in seinen „Beiträgen zur Analyse der Empfindungen“:
Das Ich ist unrettbar.
Es war für ihn lediglich ein Komplex unablässig wechselnder Empfindungen in einem Kontinuum von Innen- und Außenwelt. Der ironische Umgang damit ist für Falkner allerdings der einzige Weg, dem Existenziellen solcher Erfahrungen einen zeitgenössischen Nachhall zu verleihen – wie er auch der einzige Dichter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sein dürfte, der manchmal hart an der Grenze zum Kalauer wortzertrümmernd die komplexesten Gedanken formuliert.
Benns Beschwörung der geistigen „Selbstentzündung“, die in Falkners Bild vom zitternden „Flämmchen des Ichs“ aufscheint, kommt nicht weniger ungeschoren davon. Die wesenhafte Einsamkeit, die Benn im „Roman des Phänotyp“ unter Bezug auf Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft mit den Worten „Selbstentzündung, autarkische Monologie“ als Voraussetzung künstlerischer Schöpfung definiert, verliert jede Feierlichkeit, wenn der Erzähler am Ende von Bruno ein armseliges BIC-Feuerzeug anknipst und mit einem Glas Rotwein übergießt. Die Zeiten, in denen man, wie Benn schreibt, „in sich selber seine Springbrunnen hochwerfen, seine Echowände errichten“ musste, sind vorbei. An die Stelle der auratischen Anrufung „O Selbstentzündung, / tödliches Fanal“, die das Gedicht „Selbsterreger“ abschließt und in den „Problemen der Lyrik“ zitiert wird; tritt eine Perspektive, die „das Zündeln mit dem Denken“ zwar fortsetzt, den Gang ins subjektive Innen aber nur auf dem Umweg über eine objektivierende, dem eigenen Erleben unzugängliche Sprache antreten kann: „Das menschliche Gehirn besitzt ausgefaltet ungefähr die Oberfläche von dreieinhalb Bogen Schreibmaschinenpapier“, heißt es da. Dieses Papier muss man sich als „beschichtet mit der Großhirnrinde“ vorstellen, „auf welcher hundert Millionen Neuronen Dienst tun, mit der Fähigkeit zu hundert Billiarden Verknüpfungen. (…) Die Neuronen verzweigen sich aus dem Zellkern in Dendriten, die zusammengenommen eine Gesamtlänge von hunderttausend Kilometern haben und die elektrischen Strom leiten.“ Und so geht es weiter, über Synapsen und Neurotransmitter bis zu jenem phänomenologischen Wunder, das sich auch wider besseres Wissen noch als Entität ins Visier zu nehmen versucht, weil es sonst Probleme bekommt:
Erst wenn das Ich einigermaßen eingegrenzt ist auf eine Person, die in diesem Ich sich als Person denkt, kann ein Du neben ihm aufatmen.
Dies ist nicht mehr der Sound der Väter, den Helmut Lethen in seinem gleichnamigen Buch bei Benn vernahm. Es ist der Schwanengesang einer neurobiologischen Ernüchterung, die sich von der empirischen Forschung so etwas wie die Seele indes gar mehr ausreden lassen muss. Denn literarisch und philosophisch ist das Subjekt längst vom Sockel geholt. Die Erkenntnis vom substanziellen Selbst als Hirnsimulation koexistiert jedoch friedlich mit dem Wunsch, auch der Bewusstsein erzeugenden Maschine Mensch ein halbwegs kohärentes inneres Bild abzuverlangen. Die Neurowissenschaften und ihre Interpreten, etwa der auf diesem Gebiet in Deutschland führende analytische Philosoph Thomas Metzinger, begeben sich durch die offensichtlich konkurrierenden Beschreibungsebenen in eine weitaus größere Bredouille. In seinem Buch Der Ego-Tunnel (2009), das im englischen Original den sprechenden Titel Being No One trägt, tut er so, als müsste man der Illusion des phänomenalen Ich endlich schonungslos ins Auge sehen. Zugleich bleibt er einer humanistischen Rhetorik verhaftet, die emphatisch für Werte wie die Autonomie des Menschen eintritt, ohne deren Fragwürdigkeit im Licht der eigenen Diagnosen ernsthaft zu diskutieren. Er entdeckt sogar einen Ich-Zerfall in großem Maßstab. Wenn es zutrifft, „dass das subjektive Erleben, den eigenen Aufmerksamkeitsfokus zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten, eine der tiefsten Schichten des phänomenalen Ich-Gefühls ist“, schreibt Metzinger, „dann werden wir gegenwärtig Zeugen nicht nur eines organisierten Angriffs auf den Raum des Bewusstseins per se, sondern auch der gesellschaftlichen Ausbreitung einer leichten Form von Depersonalisierung: Man versucht, uns die Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit zu entreißen. Immer neue mediale Umwelten könnten deshalb eine neue Form des Wachbewusstseins erzeugen, die schwach subjektiven Zuständen ähnelt – eine neue Mischung aus Traum, Demenz, Berauschtheit und Infantilisierung.“ Gerhard Falkner ist weit davon entfernt, sich diesen Verhältnissen einfach zu überlassen. Aber sein Bemühen, inmitten der heraufziehenden Nebel literarische Klarheit zu schaffen, unterscheidet sich vom bloßen Festhalten an den vertrauten Formen kritischer Rationalität nicht zuletzt dadurch, dass er diesen mentalen Zumutungen nicht nur den Lärm, sondern auch das Lied abzulauschen versucht, das in ihnen schläft.
Gregor Dotzauer, aus Text+Kritik Heft 198 Gerhard Falkner, edition text + kritik, 2013
Weiterer Beitrag zum Buch:
Matthias Mader: eine wunderbar sprechende „gegensprechstadt“
matthias-mader.de, 21.6.2006
Gerhard Falkner
Die Literatur ist ein schwieriger, schmaler, tödlicher Stand geworden. Sie verteidigt nicht mehr ihren Schmuck, sie verteidigt ihre Haut.
Diese Worte von Roland Barthes, die Falkner den „Aufzeichnungen aus einem kalten Vierteljahr“ vorangestellt hat, schwingen in die Pole eines von Beginn an fest umrissenen Dichtungsprogramms aus: Die Verteidigung der Poesie als Existenznotwendigkeit gegen die Kältewellen einer Gesellschaftsformation, die in ihrem Marktfetischismus die Vorstellung von der Überflüssigkeit der Dichtung nährt noch in der Goutierung des Arabesken und der Bebilderung der Oberflächen. Mit dem ersten Gedichtband so beginnen am körper die tage (1981) betritt auch ein energischer Kritiker des Literaturbetriebs die öffentliche Bühne. Die Gedichte Gerhard Falkners tauchen zu einer Zeit auf, als der gehobene Dilletantismus des Konventionskitsches á la Ulla Hahn bzw. die lyrische Verschwatztheit einer angeblich neuen „Subjektivität“ den westdeutschen Lyrikgeschmack bestimmten. Dem hält Falkner entgegen:
Die Warenscheinlichkeit unserer Gesellschaft und die Verschleierung der Herrschaft ist zu infam, als daß sie sich in einem Spot auf Supermärkte ‚erkenntlich‘ zeigen würde. (…) Jede Kunst, die meint, es genüge, abzubilden oder zu wiederholen, was oben auf der Hand liegt, übersieht neben ihrer ostentativen Belanglosigkeit auch ihr affirmatives Agens. Die ‚ungekünstelte‘ Sprache ist eine beherrschte Sprache.
Der Spannungsarmut des lyrischen Dokumentarismus entgegnet Falkner mit einer Ästhetik des „Choks“ (Walter Benjamin), der Überraschung, des Erschreckens. Seine Auskunft: „Ich schreibe fast nur, wenn ich erschrecke“ ist alles andere als Koketterie, denn das Erschrecken ist einerseits Ausgangspunkt poetischen Transformationsgeschehens, wie es andererseits energetisch aufgeladener Kristallisationspunkt im Gedicht selbst sein soll:
Gedichte können einen Schrecken verraten, den jede andere Sprache dem Körper verheimlichen würde.
An anderer Stelle präzisiert er:
Gedichte… müssen geschehen wie Katastrophen, elementern, uneindämmbar. Sie müssen die katakombische Sprache, diese Ursache des Dunklen und Mühsamen, zerschmettern, ausspülen, ins Licht rücken.
Das Titelgedicht des Debütbandes enthält bereits eine Poetik in nuce:
so beginnen am körper die tage; zart
wie ein ausgeblasenes grau auf den augen
ungesondert von sporen und schweiß
so beginnen im auge die bilder; zögernd
unter den eingerollten fahnen der haut
den organen ein milder, grübelnder reiz
Es sind die Sinnessensorien des Körpers, bevorzugt Auge und Tastsinn, die die Außenwelt aufnehmen und sie, oft synästhetisch, der Sprache überantworten:
siehst du, ich habe das auge aufgestemmt.
mit dem werkzeug der stimme
habe ich freigelegt das zittern seiner linse.
ich habe die netzhaut durchlässig gemacht
für den einspruch der körper
ihre ratlosen schatten und stürze
beginnt ein anderes Gedicht. Mit Benennungen von Zeitlichkeit bildet die „Körper“-„Sprache“-Achse eine Trias, die als Grundgerüst in vielen Gedichten fungiert:
… und morgens lag da schnee
auf deinen hüften, das war kein schnee
nun huren meine tage hier um jedes
bißchen licht und meine zunge spielt
verrückt mit meiner muttersprache
Die kalkulierte Architektur seiner Gedichte hat der Dichter auch als Invektive gegenüber der „Neuen Subjektivität“ in ihrer Zufallsverfallenheit und Oberflächenfrömmigkeit verstanden wissen wollen. Die Untertreibung „Die Kunst hat nur ein Geheimnis, das ist die Grammatik.“ deutet den Stellenwert an, den Falkner dem gekonnten Gebrauch poetischer Techniken zumisst. So unterscheidet sich das rätselhafte Bild im zitierten Gedicht von leicht aufzulösenden Scheinparadoxa, indem es Figurationen der Identität und Nichtidentität ineinanderspiegelt, die das Denken zur Verzweiflung bringen und zugleich jenes ästhetische Chokpotential bereithalten, aus dem der entgegnende Leser sein Vergnügen aus der Lektüre ziehen kann. Die kunstvoll in das Gedicht eingebauten Bildparadoxa greifen die Tradition der Concettis in der manieristischen Dichtung des 17. Jahrhunderts (Gongorá) auf, eine Traditionslinie, die wohl in der spanischen (Lorca, Alberti, Cernuda) oder englischen (T.S. Eliot) Lyrik des 20. Jahrhunderts wiederaufgenommen wurde, der deutschsprachigen Dichtung im 20. Jahrhundert aber fremd blieb.
Mit seinem ersten Gedichtband legt Falkner Fährten, die in den folgenden Bänden der atem unter der erde (1984) und wemut (1989) modifiziert und weitergeführt werden. Zu den bestimmenden Konstituenten seiner Dichtung, die zusammen den unverwechselbaren Eigensinn des Werkes ergeben, zählen:
a) Gerhard Falkner war der erste Lyriker seiner Generation in der Bundesrepublik, der in den siebziger Jahren das weitgehend ideologisch motivierte Pathosverbot durchbrach. Sein Pathos freilich ist ein von Ironie und Sarkasmus unterspültes. Dieser Dichter misst sich an dem, was am schwierigsten zu bewerkstelligen ist: Melancholie ohne Larmoyanz, Erhabenheit ohne Schwulst, Sarkasmus ohne billige zynische Beimengungen. Die Melancholie kommt von der Registratur eines irreversiblen Natur- und Heimatverlustes. Diesem Generalthema der Moderne seit der Romantik bisher ungehörte Stimmführungen abzugewinnen, bestimmt den poetologischen Ehrgeiz Falkners, dessen Maßstab denn auch nur die gesamte Dichtungsgeschichte sein kann. Heraus kommt eine „scharfzüngige Katerstimmung“ (Erk Grimm, KLG)
b) Ausgangspunkt seiner Dichtung ist die Engführung von Sprache und Körper, wie schon der Titel des ersten Gedichtbandes nahelegt. Die Verschränkung von Reizeindrücken, Reflexion und Bewegungen innerhalb der Sprache selbst stiften jenen charakteristischen Eindruck sinnenkräftiger, zarter und zugleich hochkomplexer Referentialität.
c) „wogegen ich nicht schweigen kann, / dagegen laßt mich singen“, heißt es programmatisch im Gegensinne Wittgensteins. In diesem Sinne werden poetologisch Leitworte wie „Schönheit“ und „Kunstfertigkeit“ nobilitiert: „Für dies Schöne gibt es grundsätzlich keine Präferenzen, es erweist sich, wo es sich nicht aus dem Konsens ableitet, an der Intensität der Darstellung. (…) Ein Gedicht kann sich aber schlagartig aus einer Verstiegenheit, Fremdartigkeit und Turbulenz auf eine Aussage zusammenziehen, die aus dem Ausdruck auf die Sache selbst hinaussteigt, durch eine Gesehenheit und Gespürtheit seinen Begriff überwältigt, und durch dies Beeindruckende einfach schön werden.“
d) „Ein derber Kerl, Catull, aber erhält die Form. Man muß sein ‚Maul oder Hintern‘ lesen, um einzusehen, wie großartig das Gräßliche bei ihm Bild wird. Ich schätze die, deren Haß sich keine formalen Blößen gestattet.“ Genauigkeit und Prägnanz als Wertkategorien bedingen bei Falkner ein geschärftes Gespür für die Adäquatheit des Auszusagenden, seine Verachtung gegenüber einer Plünderungsmentalität, die sich unter den Auspizien postmoderner Bricolagetheoreme schamlos aus den Traditionsbeständen der Moderne bedient. Falkners Texte funktionieren hingegen oft als Durchlauferhitzer, in denen nicht nur das Sprachmaterial, sondern auch die technischen Mittel geprüft werden. Mit dem Ergebnis, daß eher behutsame Operationen der Zusammenziehung (Kompositabildungen wie „körpervorhersage“, „aschenkaputtel“, mundbirnen), Vertauschung, des Einbaus von Störquellen („herzzeitlose“) vorgenommen werden. Auch deshalb passt Falkners Lyrik in keine der schnellbereiten Schubläden wie „experimentell“, „empfindungslyrisch“ oder „hermethisch“.
da, wo wir uns sprachlich am wohlsten fühlen, ist die Sprache am meisten verbraucht. Das ist, glaube ich, ein Grundgedanke. Und das Gedicht muß entweder über diese Sprache, in der wir uns gegenwärtig am wohlsten fühlen, hinaus, oder es muß vor diese Sprache zurück. Und am besten beides.
Diese Verantwortung gegenüber der Schrift trennt ihn von den Vertretern der fröhlichen Unterhaltung in der Lyrik, denn alle Kunstanstrengung ist der Aufgabe existentieller Selbstbestimmung zugeordnet. Im „Heranwachsen milchführender Wörter“ sollen Intimität, Obsession, Präzision zum Gedichtschönen verbunden werden können, wobei sich Falkner auf George berufen kann:
Nur durch den Zauber bleibt das Leben wach.
e) Falkners Lyrik verbindet Traditionskontaminierung und postromantische Ironie in der Nachfolge Heines zu einem modernen Klassizitätsanspruch. Traditionsbestände der Lyrikgeschichte, insbesondere der Frühromantik (Novalis, Schlegel), Klassik (Schiller), der Lyrik der Moderne (von Baudelaire über Rilke bis Ferlinghetti oder Christensen), aber auch der Philosophie (Nietzsche, Cioran, Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Baudrillard, Derrida, Virillo) werden im Gedicht in neue Kontexte gestellt und auf heutige Brauchbarkeit hin geprüft.
Gerade den letzten Aspekt akzentuiert Falkners zweiter Gedichtband der atem unter der erde. Den einzelnen Gedichtblöcken werden Zitate u.a. von Adorno, Kafka, Bloch, Stevens, Epikur vorangestellt, in Gedichten kontrastiert Falkner Erbesplitter europäischer Aufklärung in Dichtung und Philosophie mit Zeugnissen hochgerüsteter Überwachungstechniken:
zitate aus den ‚frühen gräbern‘
aaaaasind dann geschenkt
denn niemand liest diese wie meergrüne zapfen
aaaaageschnittenen worte
auf dem bildschirm der frühwarnsysteme
nie im leben sind dies halkyonische orte
tötungsunrat
in trojanischen containern
aaaaajahrhundertelang
aaaaahabt ihr die monade masturbiert
nun tragt ihr ums herz
den eiskragen der kardiogramme, schimmernde
von geschliffenen saphiren
aaaaagebrochene hochfrequenzen
Die schwachen Echos, die hier von Klopstock, Nietzsche oder Leibnitz empfangen werden, erscheinen eingeklammert und absorbiert durch die Tatsächlichkeiten einer Kälte-Welt, denn:
das rasche stampft das schöne ein
dann gilt nur noch das wort
als kleinste gemeinsame heimat
Es bleibt der Sarkasmus, sie als „eingedrungene warenzeichen“ in das Gedicht zu schleusen, um die Trauer um die Unüberbrückbarkeit von Glücksbegehren in den Entwürfen großer Poesie mit gegenwärtiger Weltwahrnehmung zu illuminieren:
der schnatternde kavavis (aus alexandria)
und der schäumende ginsberg (aus frisco)
versiegeln die welt
mit ihren apfelsinenfarbenen stimmen.
Die Diagnosen Falknerscher Welt-Zugewandtheit unter dem Diktum „wissen ist melancholie“ fallen düster aus, wogegen die gewaltsame Epiphanie der Sprache ohnmächtiges Aufbäumen bleibt:
mundbirnen
aber mit dem gedicht zur wand
zähle ich die einschüsse der sprache:
und auch das ist gewalt
Ein so hochgemuter Anspruch, das Arsenal der lyrischen Moderne gegen (post)-moderne Zeitdiagnose als geläufigem Gesellschaftssinn zu mobilisieren, führt Falkner in seinem dritten Gedichtband wemut (1989) an die Grenzen des Sagbaren. Bereits der Bandtitel faltet durch die Tilgung des Buchstabens „h“ mehrere Bedeutungen auf: Wermut, Wehmut, we, mute (engl., dt.: wir, gedämpft) und schließlich „wermund“, ein Gedichttitel im Band. In den einzelnen Abteilungen des Bandes mit so rätselhaften Überschriften wie „gebrochenes deutsch oder der umarmte augenblick“, „hilde der nacht elegien vor der jahrtausendwende“, pensées“ oder „materien“ demonstriert Falkner jeweils unterschiedliche Formierungsweisen. Beherrschendes Thema ist wiederum die problematische Verhältnisbestimmung zwischen dem begehrenden Körper und der Sprechnot bzw. -lust in einer totalitär durchrationalisierten, verwalteten, digitalisierten Welt, wie in dem Gedicht „gedichtbau & normalzeit“:
stell dir vor, seele dazu zu sagen
ihre lichtempfindlichkeit zu prüfen
am schwefel von hochsommerfluren
sich so zerfetzt, wie man ist
mit allem, was man innen anhat:
taxis, kinos, telefonen
in ihren glanz zu stellen
was ist denn der atem
anderes als asche, die uns kalt
aus dem mund fällt, vor die brennenden
füße. wir stecken doch nur
als dochte im leichengift des schönen
und hinten unter der kopfhaut
wirft ihren weißen schatten
die uterusblume
Mit Verve entwindet Falkner „alte“ Grundworte des Poetischen wie „Seele“, „Atem“, „Glanz“, „Asche“, „Blume“, „das Schöne“ der Vernutztheit, bindet sie in kühne Metaphern ein („dochte im leichengift des schönen“; „uterusblume“) oder in überraschungsstiftende Vorgänge („ihre lichtempfindlichkeit zu prüfen“; „vor die brennenden füße“), so dass sie wieder zu Kräften kommen können.
Im Langgedicht „ich, bitte antworten!“ evoziert der Sprecher in mehreren Anläufen poetische Epiphanien, in denen Sinn-Entgrenzung, Rausch und Versschönheit zusammenfallen:
schwarze wörter sind orte
des sinns nach dem einsturz
die kraft des sinns flieht
hinter den ereignishorizont
(bei schwerster ich-dichte
tritt gott ein)
…
Hier und mehr noch im an den Schluss des Bandes gestellten Zyklus „materien“ stellt Gerhard Falkner seine Abtastversuche der Sprache prozessual aus, operiert in die Wortkörper hinein, kreiert z.B. über Kompositabildungen Neuworte und lässt im Schriftbild freigestellte semantische Einheiten miteinander reagieren. In „materie IV“ geht er soweit, Wortteile herauszulösen und isoliert auszustellen:
sinnsturz, trostfreie nacht
in rosen flügend alpenschaum
nähert sich die frist und zieht
die grenze der bedeutung zeitwerke im aufsprung
ich werde erbschaften
reisen in rückstandsarme länder
gehalten in dunkelblauem futur tung, gend, eie
das reich
der schäume
aaaaa(im gebet hatte gott ein gefundenes fressen)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaD ie
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaN eue
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaS ucht
ein wollen
wankt aus wortbordellen ford hiv-positiv
vorletzte stufe des schmutzes
im schatten – schutt – gemist zeiterwerb
…
Mit „materien“, in denen Sprache dezidiert Material-Tests unterworfen werden, um die Grenzen poetisch brauchbarer Sprachverwendung zu markieren, erkundet Falkner zugleich neues Terrain für die Möglichkeiten der Poesie im aufdämmernden Zeitalter der Netzkulturen. Dichter wie Thomas Kling oder Peter Waterhouse haben diese Impulse in ihren eigenen Bemühungen modifiziert. Für Falkner schien aber auch eine Grenze erreicht, auf der der Widerspruch zwischen sich selbst abgerungener Kunstanstrengung und rezeptiver Ignoranz quälend wurde. In einem „n-a-c-h-w-o-r-t“ zu wemut erklärte er, seinen letzten Gedichtband vorgelegt zu haben, und führte zur Begründung an:
…in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, [wurde] mir immer unwahrscheinlicher, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.
Es war symptomatisch für den Zustand der westdeutschen Literaturkritik, dass sie dieses Reflexionsangebot nicht aufnahm, geschweige denn sich gründlich mit den Gedichten und ihren grenzwertigen Angeboten ins Vernehmen zu setzen, sondern dass sie vor allem die Ankündigung der Teilnahmeverweigerung am literarischen Markt herausstellte. Falkner wiederum nahm diese strukturell verankerte Ignoranz als Gelegenheit ernst, gründlicher über die Zusammenhänge zwischen einer zunehmenden Ächtung seitens der Herrschaftsdiskurse – das Wort „Lyrik“ wurde in den frühen neunziger Jahren z.B. in Politikerkreisen längst zum Schmähwort depraviert – gegenüber Poesie und dem Ende der achtziger Jahre einsetzenden Triumphalismus von Marktfetischismus und einem von sozial klingenden Beiworten bereinigten Kapitalismus nachzudenken. In der 1993 veröffentlichten veröffentlichten Schrift Über den Unwert des Gedichts hält er der Sprache der Poesie jene „geführte“ Sprache entgegen, die im Zuge der totalitär gewordenen Apologie der herrschenden Gesellschaftsordnung Entindividualisierung und Freiheitsbeschneidung vorantreibe. Der Dichter sterbe aus, „weil eine in Pleonoxie verrottende Gesellschaft seine Existenzbedingungen zerstört, die nämlich der Verfeinertheit, eines Gewissens des Ohrs, der Zeit (Muse) für rhythmische Wiederholung, aller Arten von Herzensgüte, Noblesse und Unterscheidungsfähigkeit.“ Diese Zeit wiederzugewinnen, setzt Falkner den Begriff der rezeptiven „Entgegnung“, der auf „Setzung und Behauptung des emphatischen Raums“ zielt.
Sieben Jahre nach der Selbstherausnahme aus den Distributionszusammenhängen des literarischen Marktes erscheint 1996 bei Suhrkamp eine Auswahl aus den drei Gedichtbänden der achtziger Jahre einschließlich etlicher neuer Texte unter dem Titel X-te Person Einzahl. Den Versuch, seine Gedichte „vor der Personalisierung zu schützen“, betrachtet der Autor als gescheitert. Zu den weiterbestehenden Gründen des Entkopplungsversuches von Autor-Person und Text sind, wie ein „Nachwort statt eines Nachworts“ in Endogene Gedichte (2000) begründet, weitere hinzugetreten, die mit der krakenartigen Ausbreitung der „Event-Kultur“ in den neunziger Jahren zusammenhängen. Angesichts eines rapiden Schwundes der Aufmerksamkeitsbefähigung seitens des Publikums durch sich potenzierende mediale Überschwemmung sieht sich der Dichter genötigt, seine in Vom Unwert des Gedichts entwickelten poetologischen Grundsätze zu modifizieren. Er präferiert nun eine „,rücksichtenlose‘ aleatorische Polyphonie, die den Jetztzeitlichkeitshunger und Kickbedarf mit reinen und klaren Vorstellungen versöhnt. Die schnellen Sprachen müssen in den langsamen Sprachen ausgebremst werden.“
Wie schon der Gedichtbandtitel, so verweisen die Gliederung („Offene Abteilung“; „Geschlossene Abteilung“; „Archiv“) und einzelne Gedichttitel („Einweisung“; „Diagnose“; „Notdienst“) auf klinisch-psychiatrische Konnotationen, nicht zuletzt, um auf den existentiellen Ernst der poetischen Entwürfe hinzuweisen, der ihn schon immer abhob vom in den neunziger Jahren eher zunehmenden geschäftsmäßigen Verwerten einmal erfolgreicher Wortfindungssicherungen, wie Falkner sie im sich als „tendenziell verengenden Korridor mit poetischer Wahlwiederholung“ beobachtet.
Der Gedichtband Endogene Gedichte knüpft strukturell und intentional durchaus an wemut an. Er eröffnet mit „Sprechwiesen“ Austestungen verlangsamter Rezeption durch Schriftbildmanipulationen, die, von der „Konkreten Poesie“ als Prüfmaterial geborgt, im Jahr 2000 aber nicht mehr funktionieren. Die Intention, den Gedichttext über verfremdende, sperrende Auseinanderschreibung einer erneuten, noch sorgfältigeren Lektüre zuführen zu können, dürfte sich als Illusion erwiesen haben: Da die „Destabilisierungen“ die semantischen Einheiten auseinanderreißen, gleicht die Lektüre eher einem mühsamen Buchstabieren des im „drama“ bereits übereigneten Textes.
In Endogene Gedichte setzt Falkner mit auffälligen Verweisen auf die „langsamen“ Sprachen von Volkslied („Traum“) und deutscher Literatur der Kunstperiode („Kleist, Novalis und Hegel“; „In Grüningen, nichts wie Schmerzen“; „Tübinger Stift“); „Sommer, so sagen alle“; „Ardinghello“; „Bleierne Festung hirn“) klare Signale. Nicht die Affinität überrascht, sondern die qualitativ erhöhte Aufmerksamkeit. Den anzitierten Leidenszeichen, Utopieentwürfen eines Hölderlin, Kleist, Heinse stehen Zeichen deutscher Unheilsgeschichte (vgl. „Die blonde Inge“; „Deutschlandbild, veraltet“; „Heldendenkmal (Stadtpark)“) gegenüber; gemeinsam bilden sie einen Referenzraum für Befindungserkundungen im vereinigten Deutschland nach 1990. Die Diagnosen der neuen deutschen „Belustigungswelt“ wollen ein Angeekeltsein denn auch gar nicht verbergen. Das Gedicht „Conditio Germaniae (Deutschlandbild, neu)“ beginnt höhnisch:
Fleiß & Treue?
Stille. Ordnung. Und Zufriedenheit?
Never!
Eine Rasse,
der vor Gier die Fingernägel splittern –
buy or die!
beispiellose Beschleunigung
von Null auf Nichts
sobald Innovation angesagt ist
trotzdem immer noch mit die beste Kunst!
(…)
Die Bombardierung der Sinne durch elektronische Medien, die aufdämmernden Perspektiven industrieeller Nutzung der Genforschung, der Krieg der „global players“ „von der feindlichen Übernahme / bis zur Eroberung der Märkte“ gegen den Rest der Menschheit und der Natur bindet Falkner überpräzise gesetzte cut-ups („du kennst die Hand /die an den Bildschirm greift / sie will den Engel leimen // erst das Klon Schaf Dolly / dann Dolly Buster“) in die Deutschland-Bilder ein. Gerhard Falkner beweist in diesen Gedichten, dass ästhetische Raffinesse und scharfzüngige politische Intervention sich sehr wohl, gegen die Trends von germanistischer und Feuilleton-Reflexion in den neunziger Jahren, gegen unterstützende Einlassungen auch von Poeten von Schrott bis Grünbein, verbinden lassen.
Der 2000er Gedichtband faltet auch andere, in wemut skizzierte Intentionen auf, so das Ansinnen, traditionelle Wortbestände der Lyrik über moderne Anverwandlung in zerstreuten, postmodernen Kataklysmen reagieren zu lassen. So ist es z.B. das Grundwort „Brot“, eine der „reinsten Schnittstellen zwischen dem Heiligen und dem Profanen“, das Falkner zum Ausgangspunkt nimmt zu einem grandiosen Parforceritt zwischen Wirklichkeitsverweisungen und Sprachbewegungen, deren Wechselbeziehungen er geschmeidig vorführt. Unzufällig trägt der Titel „Ach; Der Tisch“ den Untertitel „Zur PoeSie des PoeDu“ mit sich. Der Ehrgeiz des Dichters, die Errungenschaften und Krisen der literarischen Moderne zu erfassen, zu verarbeiten und mit genauem Blick auf Gegenwartsumstände und Rezeptionsbedingungen fruchtbar zu machen, mündet in einer kaum noch für möglich gehaltenen Emphase der Mischung von Tradition, Moderne und Postmoderne, die singulär und erratisch in die deutschsprachige Lyriklandschaft ragt. Das Langgedicht beschließen die Verse:
mehr als alles, ich will, abends, wenn die Drossel
verstummt, mehr als alles gehabt haben, es soll
so tränenlos geweint worden sein wie in einer Zeile
von Trakl, es soll mich, soll, soll, soll mich, fertig
fertig gemacht haben, fertig, es soll mich sagen
gehört haben: NICHT DU! Ich kann das Brot anklicken
und habe deine Brust: (eine Brust für Götter)
ich kann deine Brust anklicken
und habe dein Herz … (ein Herz für Götter)
aber nicht du! Nur das Brot
ich will nicht mehr gekonnt haben können, will
nach dem Brot, in das ich soviel Gewicht gelegt habe
nicht mehr gekonnt haben können
aber ich ach ich bin bin doch nicht
doch nicht zu haben!
Er hat seine Hände an mir haben wollen aber
icb bin, binhin nicht zu haben
nicht für Brot … und nicht … unter dem Tisch!
Eine weitere Linie „Mallarméscher Lettern“ versucht über den Treppenvers die Konzentration auf das Einzelwort zu erhöhen und sie gleichzeitig zur Reaktion mit Metaphern („Redundanz und Aussenverweisung“) zu animieren.
Die Bemühungen Gerhard Falkners, polyphon und in vielen Richtungen die Zeitgenossenschaftsfähigkeit der Lyrik zu erkunden, waren nicht unbemerkt geblieben. Im Gegensatz zu anderen in den neunziger Jahren gefeierten Dichtern wie Schrott, Kling, Waterhouse, Seiler oder Grünbein hat Falkner, wiewohl er die Grundlinien poetischen Insistierens stets ausgestellt hatte, eine in viele Richtungen mögliche Anschlussfähigkeit bewiesen. Diese Vielseitigkeit auf hohem Niveau wurde Ende der neunziger Jahre von einer jüngeren Dichtergeneration willkommen geheißen, zumal sich Falkner als Vermittler neuer amerikanischer, irischer, ungarischer Lyrik längst empfohlen hatte. Es war darum kaum zufällig, dass 2003 eine Anthologie junger deutscher Lyrik von dem Vorwort Gerhard Falkners begleitet wurde. Dass er sich überdies zum engagierten Fürsprecher für jüngere Dichterkollegen machte, ist nicht zuletzt dem Ehrgeiz zu verdanken, Lyrik- und Gesellschaftsentwicklung zusammenzusehen.
2005 übergab der Dichter mit Gegensprechstadt – ground zero ein Poem der Öffentlichkeit, an dem er zehn Jahre gearbeitet hatte. „ich habe zu wenig geschlafen / in diesem Jahrhundert!“ – dieser Satz durchkämmt wellenartig das Langgedicht. Mit Pathosenergie angereichert, trägt er leichthin durch neunzig Strophen, die halten, was der Satz verheißt: Intimste Ich-Recherche mit der Besichtigung des 20. Jahrhunderts engzuführen und dabei die poetische Spannung aufrecht zu erhalten. Das Geheimnis, warum ausgerechnet Gerhard Falkner in einer Zeit, in der eigentlich niemand mehr darauf vorbereitet ist, dass jemand an die großen Poeme der Weltliteratur eines Heine, T.S. Eliot, Pound, Mandelstam, Ginsberg, einer Inger Christensen anschließt, genau dies bewerkstelligt, lässt sich nicht auflösen, aber umkreisen: So überraschen etwa genau gesetzte Rhythmus- und Gestuswechsel. Falkner prägt dafür in einem Nachwort ausgleichend den etwas chemischen Begriff der „polymeren Poesie. Gemeint ist damit das additive Zusammenwirken mehrerer Stilformen auf die Intensität der Ausprägung des Gesamtmerkmals“. Wenn beispielsweise von der Konzentriertheit poetischer „glimpses“ (T.S. Eliot) unvermittelt übergegangen wird zu trockenster Ironie politischer Einspruchnahme, stehen dem Autor jene Kunstgriffe etwa der Reizüberflutung auf kleinstem Raum, des Spiels mit Selbstreferentalität und scheinbar postmodern abgeklärtem „common sense“ zur Verfügung, die den Pegel der Aufmerksamkeit und Textlust hoch halten. Dabei ist Falkner dem Programm treu geblieben, das Schöne und Sublime behaupten zu können, „basierend durchaus auf den geschätzten Resultaten ihrer Reduktion und Dekonstruktion durch Moderne und Postmoderne“, wie Falkner in seinem Nachwort betont.
Wie Verkörperlichung von Situation, Imagination und ernsthaftes Spiel mit Zeitlichkeit ineinandergreifen, macht Falkner gleich zu Beginn des Poems klar. In der dritten Strophe heißt es:
ich kann die stillen, zitternden Bäche
des Lichts
über dem Frankfurter Bahnhofsviertel
in all den Jahren
als ich achtzehn wurde
noch aufsagen
sie rauschten
wie die Tulpen unter dem Rasenmäher
eine Schrift niederlegend
ins Gras
die man nur entziffert
mit matter Stirn
und schlaflos geröteten Augen
Man beachte die Verszeilen 4 und 5, die keinen Zeitpunkt, sondern einen Vorgang, den des Erinnerns abrufen. Falkner ergreift die Gelegenheit, wie vorher angekündigt, „der Zeit die Freiheit zu lassen / einmal den Ort zu spielen.“ Die Imagination wird vom Verb „aufsagen“ an den Sprecher zurückgebunden und schließlich als Textur dem Stadtkörper eingeschrieben. In der Mitte des Poems kristallisiert Falkner schließlich dieses Verfahren, indem er in einem kursiv herausgehobenen Abschnitt „Stadt“ und „Buch“ metonymisch setzt und dem „Satzbau der Straße“ nachgeht. Diese Schrift zu lesen bedarf es – „mit matter Stirn / und schlaflos geröteten Augen“ – des Zustands der Somnambulität, in dem „die Energie des Begehrens in intensive Wirkungen“ transformiert werden kann.
Gegensprechstadt – ground zero ist im Proustschen Sinne ein Poem über subjektive Zeitlichkeit, und es ist ein Poem des stets schon Berlin-süchtigen Flaneurs (Berlin – Eisenherzbriefe hieß ein 1986er Prosaband) über Berlin. Über die Jetzt-Berlins, mit „Rigaer Straße“, „Duncker“, „Tresor“, „Humboldthain“, „Kit-Kat-Klub“, „Wannsee“, „Hansaviertel“, mit ihren „114% Gegenwart“ (GZ 25), über die Mauer-Berlins der achtziger Jahre („bis 89 war Berlin geteilt / in spra und che“, GZ 54), das Mauerfallnacht-Berlin als Berlins „ground zero“ (GZ 75), das chaotisch-anarchisch-hippe Berlin der frühen neunziger, das der Jahrtausendwende:
dann die Wende vor der Wende
die New Economy
das kalte Grausen
das damals
seinen Ausgang
heute seinen Fortgang
und morgen sein böses Ende nimmt.
„ground zero“? Den Begriff gibt es seit dem 6. August 1945, bezeichnend den Bodennullpunkt in Hiroshima. Dass die Ursprungsbedeutung so gut wie ausgelöscht werden konnte, ist der Definitionsmacht imperialer Medien nach dem 11. September 2001 zu danken. Diese Auslöschungsmacht ist das Anathema des Poems. Alexander Kluge hat einmal treffend die Postmoderne als Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit definiert; für Falkner ist im übertragenen Sinne „ground zero“ auch das Auge des Taifuns, in dem sich für einen Moment Schönheit und Schrecken die Waage halten, bevor die Katastrophe das Bisherige auslöscht, aber im Verglühen „gleich weit den Radius seiner Ursachen wie den seiner Folgen ausleuchtet“. Und so birgt das Gedicht noch einmal den „analoge(n) Tag in einer digitalen Welt“ in die Sprache der Poesie, ehe binär in 0 und 1 vergleichgültigt wird. Noch einmal –
in diesem Jahrhundert der Gewalt
und der Langeweile
in dem wir versucht haben
Jim Morrison nicht mit
Rainer Maria Rilke zu verwechseln
zitiert Falkner ihm teure Kunst- und Wissenschaftsdiskurse seit der Aufklärung, von Goethe, Heine, Nietzsche bis Levi-Strauss ins Gedicht, ehe „das Grimm’sche Wörterbuch als Futter / für die neokannibalistische Festplatte“ eingedampft wird. Wenn das Gedicht „eine arabeske an den rand des kausalzusammenbruchs (kritzelt)“ so bürdet diese „Arabeske“ ihrem Verfasser Konsequenzen in poetologischer, politischer, philosophischer, selbst moralischer Verantwortungsübernahme auf, die auf die Dehumanisierungsschübe in der Welt des anbrechenden 21. Jahrhunderts zu antworten versucht:
der 11. September hat meine Zeilen
aaaaaeiskalt erwischt
oder war es der 3. Oktober
aaaaaoder der 15. März
ich weiß nicht ob ich weiß nicht
aaaaajedenfalls war ich zur Wirklichkeit
wie sie sich selbst über Hiroshima hinaus
aaaaaerhalten hatte
mit Subjekt und Sinn und Geschichte
aaaaamit Strand,Tierpark und Liveshow
so nicht mehr bereit
aaaaaab jetzt, so war uns plötzlich klar
hätte alles Konsequenzen
Peter Geist, aus Peter Geist und Ursula Heukenkamp (Hrsg.): Deutsche Lyrik des 20. Jahrhunderts in Einzel- und Gruppenporträts, Erich Schmidt Verlag, 2006
lichtkolik in der schwärze
– Falkners Langgedichte. –
1
Lyrik ist im weitesten Sinne als gebundene Rede in Versen definiert, man assoziiert mit ihr gemeinhin Konzentriertheit der Sprache, Musikalität, Prägnanz, Kürze. Von Beginn an bildete die Poesie, vom Gilgamesch-Epos über Ovids Metamorphosen, Lukrez’ de rerum natura bis zu T.S. Eliots The Waste Land, aber auch Langformen aus: Epos, Poem, Langgedicht. Gerade in den letzten Jahren wurden umfängliche Gedichte von mehr als 50 Seiten von deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyrikern als eigenständige Bücher veröffentlicht: holzrauch über heslach (2007)1 von Ulf Stolterfoht, Am Meer. An Land. Bei mir (2010)2 von Paulus Böhmer, Donauwürfel (2010)3 von Zsuzsanna Gahse, Das bleibende Thier (2011)4 von Alban Nikolai Herbst, beispielsweise. Es mag sein, dass bei Inangriffnahme dieser dichterischen Herausforderung seitens der Autoren überlegt wurde, der dramatisch sinkenden Aufmerksamkeit der Literaturkritik im speziellen und der Öffentlichkeit im allgemeinen gegenüber Gedichtbänden einen „großen Wurf“ entgegenzusetzen. Die Entscheidung für ein Langgedicht dürfte aber vor allem mit den Genreeigenschaften in Verbindung zu bringen sein: Eine Vielzahlvon Motivketten vernetzen zu können, Gestus- und Tempiwechsel in größerem Maße anzubringen, komplexe Bild- und Gedankengänge zu entfalten.
Die Spezifik des Langgedichts ist bisher kaum reflektiert worden, deshalb kommt man immer noch nicht um die „Thesen zum langen Gedicht“ von Walter Höllerer aus dem Jahre 1965 herum. Von den genannten neuen Gedichtbänden erfüllt interessanterweise nur der von Paulus Böhmer die Kriterien, die weiland entworfen wurden, etwa die Forderung:
Im langen Gedicht will nicht jedes Wort besonders beladen sein. Flache Passagen sind nicht schlechte Passagen, wohl aber sind ausgedrechselte Stellen, die sich gegenwärtig mehr und mehr ins kurze Gedicht eingedrängt haben, ärmliche Stellen. […] Subtile und triviale, literarische und alltägliche Ausdrücke finden im langen Gedicht zusammen.5
In den Bänden von Stolterfoht, Gahse und Herbst sucht man vergebens nach „flachen Passagen“, vielmehr ist das Bestreben spürbar, kunstfertige Gedichtspannung den gesamten Text hindurch aufrecht zu erhalten. Dieser Ehrgeiz kommt nicht von ungefähr: Wurde doch Höllerers Thesenpapier seit Ende der sechziger Jahre als Ermunterung aufgefasst, das Gedicht im Namen der „Neuen Subjektivität“ mit oft willkürlich gewählten Alltagsidiomen quantitativ aufzupumpen – mit dem Ergebnis verwechselbarer, redselig-verquatschter, jedenfalls nicht hinterlassungsfähiger Gebilde. Diesem Mainstream der bundesrepublikanischen Lyrik trat als Erster konzeptuell Anfang der achtziger Jahre Gerhard Falkner mit seinem Debütband so beginnen am körper die tage6 entgegen, ehe mit dem furiosen Antritt einer neuen Dichtergeneration Mitte/Ende der achtziger Jahre (Peter Waterhouse, Thomas Kling u.a.) die Absetzbewegung von der „Laberlyrik“ (Roman Ritter) an Breite gewann. Parallel, gegen Ende der achtziger Jahre, konnte von Falkner ein Projekt in Angriff genommen werden, das im Nachhinein als Kontrafaktur auf Höllerers „Thesen zum langen Gedicht“ erscheinen muss und sicher auch den Boden bereitete für die artifiziellen Maßstäbe, die sich Dichter der nächsten und übernächsten Generation auferlegten, wenn sie lyrische Großformen in Betracht zogen: Langgedichte zu schreiben, die durchgängig einen hohen Ton behaupten können, ohne manieristisch oder spannungsarm zu werden. Es ist daher eine faszinierende Geschichte von Entfaltung „arbeitender Subjektivität“ (Dieter Schlenstedt), den Zusammenhängen Falknerscher Langgedichte über mehr als zwei Jahrzehnte nachzugehen.
2
Falkners erstes mit 306 Verszeilen ausgewiesenes Langgedicht „ich, bitte antworten“7besteht aus 27 Versblöcken zwischen zwischen fünf und elf Verszeilen und einem in fetter Schrift abgehobenen Einzelvers, der das Langgedicht beschließt: „gott würfelt“8 resümiert apodiktisch der letzte Satz des Gedichts. Der Komposition des Bandes wemut (1989) entsprechend bündelt „ich, bitte antworten“ Motive, Metaphernkonstrukte, ideelle Drehpunkte der vorausgegangenen Werkteile, ehe sie in den abschließenden „materien“9 einer erneuten Dekonstruktion unterworfen werden. Insofern erweist sich dieses Poem als Energiezentrum des Gedichtbandes. Die durchgehend philosophisch grundierte Diktion des Textes hält ihn auch zusammen, denn es sind mehrere Anläufe, in denen der Sprecher seine Figuren in jeweils anderen Konstellationen und Gewichtungen zueinander stellt und ein Spiel der Wechselwirkungen aufführt. Grundfiguren sind die Sprecherinstanz samt ihrer kognitiven und vitalen Begehren, evozierte „Welt“ und die Sprache selbst. Bereits die ersten beiden Versblöcke entwerfen eine komplexe experimentelle Spielsituation:
die außenwelt begrenzt das ich schweigend
sie ist von herzen stumm
ihrer stille mangelt alles geschrei
das ich ist es, das die außenwelt mit lärm
erfüllt. es begeht die welt mit getöse
eine concorde startet
ein kraftwerk wird angefahren
unsere kräfte ragen hinaus in den
ziellosen regen, der regen durchschlägt
die haut zur außenwelt und trifft
unser staunen. ein schaltkreis ist geschlossen
das ich sagt du zu einem ding
es möchte mit ihm eine bedeutung bilden
das ich will sich regeln über diese
bedeutung. doch das ding erträgt
keine bedeutung, es trägt jede bedeutung
aber kein ich, das sich daranhängt
und sich schwer macht
das ich rutscht auf der bedeutung vom
ding wieder herunter
(am ende liegt es unten und verstummt)
(…)10
In einer ersten Versuchsanordnung wird das eingangs evozierte Scheinparadoxon von Weltenstille und Ich-Lärm ausdifferenziert und mit Sinn erfüllt, indem das sprechende Ich zum Menschheitsrepräsentanten erhoben wird. So erscheint einsehbar, dass „geschrei“, „lärm“, „getöse“ an den Menschen und menschliche Gestaltungskräfte („concorde“, „kraftwerk“) gebunden sind. Der Überraschungseingang des Gedichtes enthält in nuce bereits eine Leseempfehlung, Aussagen („die außenwelt begrenzt das ich schweigend“) wenig zu trauen, weil deren Bedeutungen ins Gleiten geraten können. Zudem wird der philosophierende Duktus sofort durchstört durch einen poetischen: Die „außenwelt… ist von herzen stumm“, „unsere kräfte ragen hinaus in den / ziellosen regen, der regen durchschlägt / die haut zur außenwelt und trifft / unser staunen“. Das vital durch die Bewegungsverben („ragen“; „durchschlägt“, „trifft“) und das Pronomen „unser“ aufgewertete „staunen“ generiert Höhepunkt und Achse des Versblocks, der dann im sich schließenden „schaltkreis“ abgerundet wird. Ein Schaltkreis von Kognition und Emotion, von Ich und Welt, von Stille und Getöse, von Bezeichnendem und Bezeichneten. Und es ist ein hoher Ton angeschlagen, der nichts weniger denn die Welträtsel in das poetische Visier zu nehmen gedenkt, im vorgeblich naiven Staunen, Welt, Ich und Sprache neu zu buchstabieren. Im nächsten Versblock wird das zweite große Thema dieses Genesis-Poems angeschlagen: das schwierige Verhältnis zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten, das weite Feld der Signifikantendämmerung von de Saussure bis Lacan und Derrida. Auch hier wird Kontaktnahme versucht zwischen „ich“, „ding“ und „bedeutung“, aber ein Regelkreis („das ich will sich regeln über diese / bedeutung“) kommt nicht zustande, fixe Bedeutungssetzung scheitert. Gibt sich der Sprecher in den ersten beiden Versblöcken aussageorientiert und konnotatationsarm, so dass der Text einen beinahe narrativen Charakter erhält, ändern sich ab dem dritten Versblock Strukturierung und Gestus des Textes entschieden:
ach das ich und sein ende dort unten
beim nein zur bedeutung, beim nein
zur begründung, im nirgends mit sich
und für niemand. allein mit der
fluchterregenden mutter
allein mit dem enderfüllten amerikaner
bei sich selbst und dem reinen computer
eine lichtkolik in der schwärze
aller schwänze voller erbmasse
ein meeresleuchten überm außenweltstrand
unsere körper prallen gegen die präsenz
von ionen und bilden metalle. schön!
unsere körper erregen mit licht
das mutige grün der kontinente. schön!
unsere körper bilden die knöchel
der alpen wie die schläfe der nordsee
ein zwerchfell trennt luft und wasser
zur mitte: der main, norden und süden
schenken sich ihre lieblichen grenzen
unsere körper reißen den mund auf
und sind stumm
(…)11
Das Scheitern instrumenteller Bedeutungsfixierung im chaplinesken Bild á la „Modern times“ wird nun als Chance ergriffen, Sprachbewegungen aufzuführen, die in die Freiheit der Imagination vortasten. Schon die Diskrepanz zwischen dem starken Emotionswort „ach“ und den Evokationen von Entfremdung und Isolation des „ich“ bereitet einen Ausbruch aus Logik, Determination, Sprachohnmacht vor. Und dann wird eine erste Sprachexplosion generiert, die mit einem palimpsestiösen Phonemtauschreiz anhebt („fluchterregenden“ statt „furchterregenden“), dann aber konzentriert in ozeanisch-narzisstische Entgrenzungsbilder („lichtkolik“, „meeresleuchten überm außenweltstrand“) sich ausweitet. Der anschließende Versblock zieht seine poetische Verdichtungsenergie zuvörderst aus syntaktisch grundierten Stilmitteln, der Anapher („unsere körper“) und der Epipher („schön!“). Die Pantagruelsche Erhöhung des Körpers bis ins Erdteilhafte weist ins Groteske, das ästhetisch wertende „schön!“ auf das Erhabene. Diesen Verschränkungen des Grotesken mit dem Erhabenen wird am Ende des vierten Versblocks eine Laokoon-Gruppe vorsprachlicher Evidenz entgegengestellt:
unsere körper reißen den mund auf
und sind stumm.
Welt, begehrendes Ich und Sprache werden zunächst in ihrer Selbstreferentialität und Getrenntheit aufgeführt. So ist wenige Verse später von „geräusche(n) / im rohbau, nicht wortüberdacht / einfach ein tagesanbruch“12 die Rede, an anderer Stelle werden die Dinge als in ihr So-Sein beschlossen ausgestellt:
strandklar die herzen
alles draußen ist unter sich: wahrheit
wäsche, welt; alles hat eine tönung, einen
punkt auf der zeitkrümmung, einen
fahrschein.13
Nun allerdings fügt Falkner Konstellationen des Adverbialen hinzu, die überdies mit sexuell konnotierten Realien reagieren:
vielleicht und nein stehen beisammen
begierig gehen die tore des verstehens
auf und zu,
weich und hydraulisch
vielleicht steht am scheideneingang
blaugeädert, nein sperrt den mund
auf; tokio, orinoko, hongkong14
In der Kopulation von „vielleicht“ und „verstehen“ gelingt nun, was in mehreren Anläufen zuvor fehlschlug: Der Sprechakt, in diesem Fall onomatopoetisch-topographisch ausgelegt. Was ist geschehen? Zunächst einmal die Anreicherung des Schöpfungsspiels durch neue Wortfelder und dementsprechende neue semantische Kopplungen, angereichert aber auch durch die Intensivierung von Poetizitätsverfahren im Kontrast zu narrativ-benennenden Passagen. So kommen Allegorisierungen ebenso ins Spiel („grund und gegenteil überqueren eine straße“)15 wie kosmologisch-physikalische Verweise („im schwachfeld von selbst sind / entweder – oder bewirkungsarme / ladungen“)16 und Operationen mit normabweichenden Sememen („irgendetwas ist frühling, oder fühling / oder frühlung / um uns bewegen sich die versausten / mann-frauen“).17
In der Mitte des Gedichts imitiert der Sprecher schließlich eine Orgie der Benennungen, die programmatisch beendigt wird:
was will dann die sehnsucht?
sie will: ein ende der aufzählung18
Die fette Markierung, die ansonsten nur noch im Schlusssatz probat gehalten wird, signalisiert einen Umschlagpunkt: Es geht nicht um die Sprachmarken der Oberflächen, sondern um das Essentielle sprachlicher Erfassung von Ich-Welt-Beziehung. In einer Du-Anrede imaginiert der Sprecher den paradiesischen Zustand einer zweifel-losen Verbindung zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem, die es nur im Konjunktiv gibt:
an dich denke ich und mein staunen
stellt das schweigen wieder her
fast scheint es die welt wüßte
für einen augenblick
mit dem wort apfel die frucht
zu treffen, die gemeint war
vor der apfelsperrstunde
(…)19
Eine solche Sprache trägt das Sein an das Subjekt, und es ist allein die Sprache der Poesie, die mit existentieller Energie aufgeladen werden kann:
allem neuen, noch nicht von seiner dichtung
erkannten, fehlt einsicht
eine sprache muß kommen und sagen
ich stürze dich durch ein sein
dann erst erringt es sich selbst
und erträgt sich
(…20
Das klingt nicht von ungefähr nach Heidegger, eine Diktion, die an verschiedenen Stellen des Gedichts wieder aufgenommen und weitergeführt wird. Allerdings wird nicht die Sprache als „das Haus des Seins“21 zelebriert, sondern auf die potentiell unendlichen Kalibrierungsmöglichkeiten poetischer Sprache verwiesen:
die flurpforten: gastlich
die flutposten: gastlich
(hier spricht der automatische ich-beantworter)22
Weder „rettungsverkleinerungen“23 noch „schweigebrocken“24 helfen aus dem Dilemma changierender Signifikation, auch das Operieren an den Wortkörpern („bluten die liebenden, i streichen / lebenden, ben streichen, i einsetzten“25 oder Vokalballungen („das ununterbrochene ist uns durch brüche / berüchtigt“)26 nicht. Warum auch? Denn mit Derrida kann Bedeutungsverschiebung, die konnotative und semantische Aufladung der Sprachzeichen, ja noch die Sinnflucht der „absoluten Metapher“ die Gravitationskräfte des Poetischen verstärken. Falkner lässt nicht von ungefähr jene massereichen „Schwarzen Löcher“ im Kosmos assoziieren, deren Schwerkraft selbst das Licht nicht nach außen lässt:
wird ein wort so dicht
daß sich sein sinn
der eigenen anziehung
nicht mehr erwehrt
stürzt es in sich
schwarze wörter sind orte
des sinns nach dem einsturz
die kraft des sinns flieht
hinter den ereignishorizont
(bei schwerster ich-dichte
tritt gott ein)
(…)27
Vor diesem Endpunkt von Sprach- und Ich-Schwärze allerdings ermöglichen Konzentration und Ballung poetische Epiphanien, in denen Sinn-Entgrenzung, Rausch und Versschönheit zusammenfallen können. Und so betätigt sich der Dichter abermals als Demiurg: Er baut um das Gerüst bereits zuvor benutzter Worte und Satzteile („irgendetwas ist frühling“, „eine concorde landet“ usw.)28 eine poetische Welt der Fülle – „eine welt steht in farben“29 –, den „fremdsprachenleib der welt“30 neu buchstabierend. Nach so viel Dekonstruktion und Re-Konstruktion endet das Gedicht in existentieller Wucht und Kryptik:
im montagsmantel erscheint die welt
und eines will sie mir noch sagen
ich soll untergehen
es, von dem wir nicht wissen, ob es
mit uns spielt, ist nicht.
seine innere irre ordnet der geist
grundlos
es, das uns bricht, rät uns nur
gott würfelt31
Der „montagsmantel“ ist nach allen zuvor gegebenen Textindizien als Schöpfungsmoment assoziierbar, nun auf Augenhöhe mit dem sprechenden Ich. Doch dieses Moment der intimsten Begegnung von Ich und Welt hält als letzte gelungene Kommunikation die ,nichtende‘ Botschaft der Endlichkeit des Ich parat. Die folgenden Verse bezeugen Panik und Verleugnung, ehe die fett herausgestellte Schlusssequenz wieder intertextuelle Halt-Haken einschlagen kann: „gott würfelt“ bezieht sich offensichtlich auf Einsteins Äußerung „Gott würfelt nicht“:32
Dieser in mehreren Briefen variierte Grundsatz bezog sich auf eine physikalische Entdeckung und auf ein philosophisches Problem. Die Quantentheorie Plancks stellte den Determinismus des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs in Frage; Einstein weigerte sich, diesen Einsturz der letzten Festen des Newtonschen Weltbildes, an dem er ja selbst mit der Relativitätstheorie bedeutende Teilhabe hatte, zu akzeptieren. Die Physikgeschichte des 20. Jahrhunderts hatte dann seinen Widersachern Heisenberg und Bohr recht geben müssen, allerdings außerhalb theologischer Endfragen nach der Existenz Gottes. Doch geht es in Falkners Gedicht nicht um Letztbegründungen theologischer oder gnoseologischer Natur. Es versucht vielmehr, philosophische, sprachtheoretische und poetologische Diskurse in der Dichtung selbst zu überkreuzen: Einstein meets Derrida meets Mallarmé: Mallarmés rätselhaftes Gedicht „Ein Würfelwurf“ endet mit den Versen:
Auf leerer erhabener würfelfläche
In allmählicher folge
sternenhaft
die vollendete ordnung der allumfassenden zahl
erwachend
zögernd
aufgehend
schimmernd und sich sammelnd
vor dem stillstand
am höchsten heiligen punkt
Jeder Gedanke ist ein Würfelwurf.33
Die Bezugnahme des Falknerschen Textes auf Mallarmé ist evident: In beiden Gedichten wird der Schlussvers hervorgehoben, bei Mallarmé durch die untypische Großschreibung, bei Falkner durch die fette Schrift. Beide Gedichte verbinden den Aufschwung zu hohem poetischen Ton mit Pathosformeln, die sich aus kosmologischen und religiösen Wortfeldern speisen. Beide Gedichte kreisen um die Widerspruchspaare Existenz – Sprache, Determination – Zufall, Beschreibung – poetische Numinosität. Und beide Gedichte testen kühn und gewagt die Grenzen des Sagbaren aus. Mit „ich, bitte antworten“ und den auf Dekonstruktion ausgelegten „materien“ in wemut hat der Lyriker Gerhard Falkner jenen „am höchsten heiligen punkt“ (Mallarmé) avisiert und getroffen, der im Deutschen der Poesie möglich ist. Von hier aus werden jene vielzitierten und oft genug verengt interpretierten – nämlich allein auf mangelnde öffentliche Anerkennung des Gedichte-Schreibens bezogen – Sätze aus dem „n-a-c-h-w-o-r-t“ erst recht tiefenscharf lesbar:
… in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, [wurde] mir immer wahrscheinlicher, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.34
3
1996 meldet sich der Dichter Gerhard Falkner nach sieben Jahren Absenz vom Literaturbetrieb mit dem bei Suhrkamp erscheinenden Gedichtband X-te Person Einzahl zurück. Neben 24 neuen Gedichten am Anfang, einer Auswahl aus den drei bei Luchterhand publizierten Gedichtbänden und zehn „zerstreut“ veröffentlichten Gedichten enthält der Band das bis dato unveröffentlichte Langgedicht „Ich sage null für ja und eins für nein“.35 Es knüpft in Diktion und Motivik an „ich, bitte antworten“ an, setzt aber neue Akzente.
In den frühen neunziger Jahren hatte Gerhard Falkner intensiv die veränderte Stellung des Gedichtes und des Dichters in einer sich globalisierenden Gesellschaft reflektiert. In der 1993 veröffentlichten Schrift Über den Unwert des Gedichts hält er der Sprache der Poesie jene „geführte“ Sprache entgegen, die im Zuge der totalitär gewordenen Apologie der herrschenden Gesellschaftsordnung Entindividualisierung und Freiheitsbeschneidung vorantreibe. Der Dichter sterbe aus,
weil eine in Pleonoxie verrottende Gesellschaft seine Existenzbedingungen zerstört, die nämlich der Verfeinertheit, eines Gewissens des Ohrs, der Zeit (Muse) für rhythmische Wiederholung, aller Arten von Herzensgüte, Noblesse und Unterscheidungsfähigkeit.36
Als wesentlicher Bestandteil kapitalistischer Beschleunigung, Entdifferenzierung und Vergleichförmigung sind die technischen Sprachen und Computeroberflächen anzusehen in ihren Binärkodierungen von null und eins:
Die innere Bewegungsrichtung der Zivilisation zielt auf eine Vergegenständlichung des Menschen. Seine Vorgebundenheiten (Traum, Mythos, Imagination, Glaube, Transzendenz usf.) sind Quellen eines dem Zivilisations-Abschlußprozeß zutiefst fremden Aufruhrs. Die Innerlichkeit mit ihrem Ritus der Plötzlichkeit Widersacherin schlechthin, dem vulgo der Gleichrichterkräfte aber nicht mehr gewachsen. Die gewaltige Offensive (von Telekom bis IBM) zur Absaugung des Inneren macht die Lage angesichts des Paradoxons, daß der Täter mit dem Opfer binär verschmilzt, aussichtslos.37
Diese binäre Verschmelzung aber löckt den Stachel des poetischen Widerstands und gebiert die Intention des zweiten Langgedichts, das Gerhard Falkner Mitte der neunziger Jahre zu Papier bringt. Der Gedichttitel „ich sage null für ja und eins für nein“, der in der ersten Verszeile wiederholt wird, zieht sich in Variationen durch das ganze Gedicht, ja er strukturiert es dergestalt, dass seine Wiederholungen schließlich in der monotonen Schlichtheit des „null null ja null null eins nein“38 den Leser zu nerven beginnen. Genau dies aber ist beabsichtigt. Denn zwischen den Litaneien der Binärkonstellationen wird ein Sprachhandeln aufgefaltet, das jeweils andere Akzente setzt: Erstens existentiell-philosophische, zweitens sprachbezogene, drittens bildhaft-poetische sowie viertens den Sprechakt selbst betonende.
Bereits zu Beginn wird das Gegensatzpaar Bewegung – Starre eingeführt, das ebenfalls durch den gesamten Text geführt wird:
ich sage null für ja und eins für nein.
kann. sein.
aufs sein kommt das handeln zielend zu.
ein verlassen des ausgangspunkts
begünstigt das abgleiten ins überspringen.
nur ein schritt ist es dann vom geworfenen
zum aufgeschmissenen.
die begründung einer leere begreift
die notwendigkeit des ausschlusses
(omnis determinatio est negatio)
die seele ist eine sollbruchstelle.
(…)39
In der Mitte des Gedichtes – wieder so ein Drehpunkt – wird der Gegensatz auf den Punkt gebracht:
niemals werde ich schlecht reden vom werden
wohingegen vom sein ich nichts gutes berichten kann
halb hier und halb grün40
Bemerkenswert ist gleichfalls die ironische Brechung existentialistischer Begrifflichkeiten, wenn etwa abrupt die Stilebene gewechselt wird – „vom geworfenen / zum aufgeschmissenen“, umgekehrt die Herauspräparierung der Kategorie „sein“ aus der umgangssprachlichen Floskel „kann sein“ durch den dazwischengestellten Punkt.
Wie schon in „ich, bitte antworten“ operiert der Text zweitens mit Umschreibungsanweisungen, wodurch Bedeutungsbeziehungen zwischen Worten intensiviert werden, deren Verbindung zunächst nicht augenfällig sein muss:
ich sage nein wie not ohne o doch mit ei
und n für t
aber not? nein.41
Wenige Zeilen weiter werden durch phonetische Substituierung („die klocken leuten“)42 oder Wortzusammenziehung (in „heraklitoris“43 sind die Signifikate von „Heraklit“, „Klitoris“ und „Hera“ ineinandergeschoben) Situationen leicht rauschhafter Verrückung, sexuell konnotiert, evoziert.
Die dritte Akzentuierung, die des Bildhaft-Poetischen, bezieht sich auf insulare Bildfolgen, die von kühnen Metaphern durchsetzt sind, z.B.:
mauern, gesäumt von verrottenden orangen
zerstört von den sprühenden schamsplittern
einer durch die bäume gesiebten sonne.
(…)44
Es sind Bildfindungen, die, mit Benn gesprochen, einen hohen „Wallungswert“ aufweisen. Wellenartig durchkämmen sie das Gedicht, rufen Lesemomente hoher Intensität hervor und sollen auch gar nicht ihre Nähe zu Rausch und Exzess verleugnen, „den unerschöpflichen reichtum der turbulenz“.45
Ein vierter Akzent schließlich wird auf den Sprechakt selbst gelegt: Damit ist die stetig wiederholte Sprechformel „ich sage“ gemeint, aber sie korrespondiert mit den Hinweisen auf den Schnittort zwischen Ich, Welt und Sprechen, wenn nach der Sprechformel die Rede geht: „fleckenloser mund“,46 „die sätze bluten aus dem mund / wie zusammengeschlagene idioten“,47 „die blinde fülle eines überschäumenden munds“,48 „fliederfarbener mund. die concupiscentia“.49
Durch diese konnotative Aufladung erhält der anaphorisch strukturierte Schlussblock erst eigentlich seine pathosgestützte Evidenz, wobei die Dominanz von Einsilbenworten wirkungsvoll ein Staccato hinterlässt:
ich sage ja für nein
und kann für sein
ich sage null für eins
und welt für wein
ich sage grün für angst
und hart für null
ich sage brot für beil
und heil für tot50
Schlusshin bindet Falkner die Binärkonstallationen und die verschiedenen Sprechentfaltungen im Gedichtverlauf dergestalt zusammen, dass die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens in der immanenten Verweiskraft die öde Logik des null/eins außer Kraft setzen kann – letztlich durch „die concupiscentia“,51 das obszöne Begehren, dem der Platzwechsel von Ausschließlichkeiten („brot für beil“, „heil für tot“)52 durch das Gestöber intensiver poetischer Interventionen eingeschrieben werden konnte.
4
Die in „ich, bitte antworten“ und „ich sage null für ja und eins für nein“ Grenzen des Verstehens bewusst touchierende Methode kompositorischer Dehnung des Verhältnisses von Signifikanten und Signifikaten unter den Ausspizien des letzthin Einleuchtbaren erwies sich als ebenso folgenreich wie produktiv: In dem 2000 veröffentlichten Gedichtband Endogene Gedichte ist ein drei Seiten umfassendes Gedicht enthalten, mit dem der Autor bei Lesungen Triumphe feierte:
Ach; der Tisch (Zur Poesie des PoeDu)53
Wie ist dieser Publikumserfolg zu erklären? Vereinfacht gesagt vor allem damit, dass die zuvor entwickelten Verfahren des Poetizitätsgewinns in ein Sprechen integriert worden waren, das nicht mehr allein die Disparatheit des Sprachmaterials, sondern eine gewisse Einheitlichkeit im Grundgestus herausstellte.
Diese dem Gedicht eingeschriebene veränderte Auffassung vom langen Gedicht zieht praktische Schlussfolgerungen aus den Denk-Gängen im Essay „Vom Unwert des Gedichts“. So präferiert Gerhard Falkner, wie er in einem „Nachwort statt eines Nachworts“ Selbstauskunft gibt, nun „eine ‚rücksichtenlose‘ aleatorische Polyphonie, die den Jetztzeitlichkeitshunger und Kickbedarf mit reinen und klaren Verdichtungen versöhnt. Die schnellen Sprachen müssen in den langsamen Sprachen ausgebremst werden.“54 Bereits das äußere Erscheinungsbild des Langgedichts lässt sich ein auf die „schnellen“ Sprachen, die später vom Autor als „superkurze Einsatz- und Bereitschaftssprachen“55 apostrophiert werden sollten – allerdings konsequent an die genannte Funktion der Ausbremsung gebunden. Nicht mehr Versblöcke bestimmen das Bild, sondern ein durchgehender Textfluss. Mehr noch, der fiktive Gesprächsgestus mit seinen Wiederholungen („ach der Tisch“), dem stilprägenden Anakoluth, dem vorgespielten Stottern („denn, denn das, denn das diesmal als… ach der Tisch…“), den Interjektionen („ach“, „eh“), der imitierten Weitschweifigkeit insinuiert das Geschwätzigkeitsparlando der von Falkner herzlich verachteten „Neuen Subjektivität“ – und ist doch ihr Gegenteil. Denn der Text spannt ein straffes Netz zwischen den Grundworten „Brot“, „Tisch“, „Wort“ und selbstredend dem sprechenden „ich“. Dieses Netz ist recht eigentlich ein Sprachtrampolin, das bezaubernde Akrobatiken ermöglicht: Salti in die „Weltanwesenheit“56 des Sprechenden, Spreizungen in derbe Männerphantasien wie aristotelische Gefilde, Pirouetten in Emphasewirbel des Göttlichen. Wissend um die lange Aura-Historie von Worten wie „Brot“ oder „Laib“, werden sie mit den „schnellen“ Sprachen („Ich kann das Brot anklicken“)57amalgamiert und bleiben doch, aufgrund erheblicher Vorarbeit konnotativer Aufladung im Textprogress, überlegen gegenüber technischen Reizworten. Schlusshin mischt das sprechende Ich sich direkt ein, genötigt, sich zu wehren gegen Anmutungen:
aber ich ach ich bin bin doch nicht
doch nicht zu haben!58
Zweimal „ich“ „bin“ „nicht“, dann aber auch ganz am Ende des Gedichts zweimal „haben“ und dreimal „bin“: „ich bin, binbin nicht zu haben“.59 Aphasie und Erleuchtung begegnen sich, in der Konsequenz des Gedichtganges, in einem Sprechakt des Widerstands. Widerstand wogegen? Gegen die Verdinglichung der Sprache, die rohe eineindeutige Bedeutungszuweisung instrumenteller Rede:
zu Willen sein, in einer Haltung wie vom ausfälligen
Wort unter den Tisch geprügelt soll ich sein Ding
in die Hand nehmen, soll ich, soll ich seine Sprache
in den Mund nehmen, eine
aus dem Tisch in den Mund gesprengte
Männersprache60
Gerhard Falkners „Ach; der Tisch“ ist als Plädoyer für die Verlebendigungskraft der Poesie zu lesen. Um das Grundwort „Brot“ herum, „eine der reinsten Schnittstellen zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Beim Sprechtext ‚Ach; der Tisch‘ ist das ‚brotgewordene‘ Gedicht Vermittler zwischen beiden.“61
5
„ich habe zu wenig geschlafen / in diesem Jahrhundert!“62 – diese im Verlauf des 61 Seiten umfassenden Langgedichts immer wieder aufgegriffene Zeile bildet den Auftakt zu einem Poem, das ein Meisterwerk, ja ein Jahrhundert-Gedicht genannt werden darf: Gegensprechstadt – ground zero, veröffentlicht 2005, an dem Falkner zehn Jahre gearbeitet hatte. Es ist ein Poem über die Zeit – die subjektive Zeitlichkeit des sprechenden Ich im Verhältnis zur geschichtlichen Zeit. Gleich eingangs wird dieses Thema eingeführt:
es gab noch keinen 11. September
keinen 3. Oktober
und keinen 15. März
die Gelegenheit also war günstig
der Zeit die Freiheit zu lassen
einmal den Ort zu spielen63
Ein understatement, das eine Generösität der Wahl suggeriert, die so gar nicht vorhanden ist. Denn über die in ihm formulierte Idee wird das Poem im Ganzen strukturiert. In einer Anmerkung zu diesem Satz führt der Autor aus:
Unter dem Diktat unserer Mobilität dürfen wir uns durchaus die Zeit als den eigentlichen Ort unserer Bewegung vorstellen, wohingegen der (schwerfällige) materielle Ort nur den jeweiligen Referenzpunkt in einem nicht mehr an ihn gebundenen Zeitschema darstellt.64
Damit fixiert Falkner nichts weniger denn universelle Entfremdungszusammenhänge, die dem Kapitalismus seit seiner Herausbildung inhärent sind, die jedoch in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der totalen Mobilmachung der globalisierten Märkte eine neue, totalitäre Stufe erreichen, die qualitativ in der Vernichtung, Verstümmelung und Segregation von „Menschenmaterial“ den Vernichtungsorgien „totalitärer“ Regime im 20. Jahrhundert längst ebenbürtig geworden sind. Das Spiel mit Zeit und Zeitlichkeit als Hauptmotiv im Langgedicht ist ein ernstes, und es wird durchgehend geschichtlich grundiert. Diese bei Falkner so zuvor nicht angetroffene Akzentuierung hebt Alexander Kluges Aperçu von der Postmoderne als Angriff auf die übrige Zeit65 vom laxen Theorem in die sinnliche Fassbarkeit des damit verbundenen existentiellen Grauens:
20. Jahrhundert
aaaaaJahrhundert der Gegenwart
jede Woche eine neue Epoche
aaaaabrausende, brennende von Jahren
ein Heute hat das andere gejagt
aaaaadie Gesterns — nichts als Späne
die vom Heute flogen
aaaaalas horas artificiales
aaaaaaaaaalos anos artificiales
aaaaaaaaaaaaaaaaho paura! adelante!
dann die Wende vor der Wende
aaaaadie New Economy
das kalte Grausen
aaaaadas damals
seinen Ausgang
aaaaaheute seinen Fortgang
und morgen sein böses Ende nimmt
(…)66
Das böse Ende, das auch noch 2011 – die Einschläge kommen näher – schwer abschätzbar ist, hat hier zumindest seine geschichtliche Einsenkung in Emblemen neoliberaler Ideologeme vorgehabter Geschichtsvernichtung angenommen. Insofern sind Falkners Verse Sternminuten poetischer Prophetie.
Das Poem trug ursprünglich den Arbeitstitel „Vom Hören der Tage“.67 Zeitangaben und Zeitspannen tragen gleichsam (durch) den Text: Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte, das 20. Jahrhundert; heute, damals, Datumsangaben, „zu gegebener Stunde“.68 Diese Überpräsenz von Zeitlichkeitschiffren betont noch da, wo der Berlin-Flaneur sich scheinbar lässig der Gegenwärtigkeit des Augenblicks anheimgibt, die existentielle Dimension poetischen Insistierens:
aaaaaheute ist wieder Freitag
ein analoger Tag
aaaaain einer digitalen Welt
wo ist die Göttin
aaaaaderen Arm
wir die Beute
aaaaades heutigen Datums verdanken
so viel Gegenwart
aaaaain der Brad Pitt den Gegenwärtigen spielt
(…)69
Wie so oft in Falkners Lyrik wird die Wahrnehmung des sprechenden Ich zu Ereignissen und Prozessen der Weltgeschichte so in Beziehung gesetzt, dass sich unabdingbar erscheinende Konsequenzen für politische, philosophische und ästhetische Positionsbestimmungen ergeben:
Der 11. September hat meine Zeilen
aaaaaeiskalt erwischt
oder war es der 3. Oktober
aaaaaoder der 15. März
Ich weiß es nicht ob ich weiß nicht
aaaaaajedenfalls war ich zur Wirklichkeit
wie sie sich selbst über Hiroshima hinaus
aaaaaerhalten hatte
mit Subjekt und Sinn und Geschichte
aaaaamit Strand, Tierpark und Liveshow
so nicht mehr bereit.
(…)70
Der 11. September (2001) und der 3. Oktober (1990) sind Signaldaten, die jeder Leser als Epochenschnitte einzuordnen weiß, der 15. März verweist, aber das erfährt man erst aus dem Nachwort, auf die Ideen des März, die Ermordung Cäsars, vor allem aber auf den Geburtstag des Verfassers. Im Nachwort ordnet Gerhard Falkner den 11. September dem „Schrecklichen“, den 3. Oktober dem „Schönen“, den 15. März dem „Differenten“71 zu. Dort, wo das Schreckliche und das Schöne enggeführt werden in der „differenten“ Sprache der Poesie, generiert die Fallhöhe Sprechlagen des Erhabenen, auf die immer wieder zurückverwiesen wird, wenn passagenweise andere Gesten gewählt werden. Denn der vom Autor monierten „Schrumpfung von kontinuierlicher und überpersönlicher Zeit in jene jeweils fragmentierte und nur vom Subjekt als wahr erlebte Jetztzeitigkeit“72 entspricht das „additive Zusammenwirken mehrerer Stilformen“,73 dem der Autor den Begriff „polymere Poesie“ entwand. Der Leser wird durch einen lautmalerisch-kryptischen Einschub („Mantegna“)74 ebenso überrascht wie durch eine parodistische Rap-Imitation,75 ein in barocker Tradition stehendes Figurengedicht76 oder ein Gedicht im Gedicht, das unter dem Titel „Stadtplan“ als eigenständiges Buch veröffentlicht wurde. In dem in kursiver Schrift herausgehobenen Kabinettstück setzt Falkner „Stadt“ und „Buch“ metonymisch („Häuser sind Wörter / und Straßen sind Sätze und / Städte sind Bücher“)77 und geht dem „Satzbau der Straße“ nach. Vorzugsweise durch Rhythmisierung, Parallelismen im Satzbau und Vertauschungsfiguren in den angebauten Adverbialbestimmungen und Objekten wird boleroartig ein poetischer Sog erzeugt, der „die Energie des Begehrens in intensive Wirkungen“78transformiert.
Wird in „Stadtplan“ die „Gegensprechstadt“ in sublimer Versschönheit akzentuiert, laufen andere Stränge des Poems auf den entgegengesetzten zweiten Teil des Bandtitels zu: ground zero. Das bereits zitierte sehr ernste, sehr zentrale lyrische Statement „Der 11. September hat meine Zeilen / eiskalt erwischt (…)“79 betont den ins Vergessen entsorgten Zusammenhang zwischen Hiroshima und dem 11. September 2001. Der Begriff „ground zero“ bezeichnete den Bodennullpunkt vom 6. August 1945 in Hiroshima, als die USA die erste Atombombe über der japanischen Stadt abwarfen. Durch die Definitionsmacht der Medien nach dem 11. September 2001 wurde die Ursprungsbedeutung überschrieben, wenn nicht so gut wie gelöscht. Der ground zero Berlins ist der 9. November 1989, der den 9. November 1938 („Kristallnacht“) wie den 9. November 1918 (Novemberrevolution) überstrahlt wie der 11. September 2001 Hiroshima 1945 und den Pinochet-Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Allende in Chile 1973. Diese Auslöschungsmächte konturieren das Anathema des Poems. Für Falkner ist im übertragenen Sinne „ground zero“ auch das Auge des Taifuns, in dem sich für einen Moment Schönheit und Schrecken die Waage halten,80 bevor die „Katastrophe (…) absolute Zuspitzung erfährt und im Verglühen des Bisherigen gleich weit den Radius seiner Ursachen wie den seiner Folgen ausleuchtet“.81 In etlichen Variationen werden die nur scheinbar paradoxen Wirkungen des katastrophischen Jetzt benannt:
20. Jahrhundert
Milliarden Momente
des Aberwitzes
die Schläge verteilt
die Wunden geschlagen
die Siege verloren82
20. Jahrhundert
Jahrhundert der Gegenwart
von Errungenschaften zerstört
von Erkenntnis zerfressen
im Grunde hat dieses Jahrhundert
den Planeten auf dem Gewissen
(…)
besorgniserregend wachsende Intelligenz
bei rapide sinkender Vernunft
plus die totale Pleite aller Werte
außer Kohle83
Falkner unterlegt den Walter-Benjamin-Satz – „Daß es so weitergeht, ist die Katastrophe“84 zuvor mit wiederholten Verweisen auf die vielfachen Zivilisationsbrüche im 20. Jahrhundert vom Holocaust bis zum Afghanistan-Krieg. Seine gegen Ende des Langgedichts resümierende Zivilisationsdiagnose ist daher alles andere als hoffnungsheischend, also eher zutreffend.
Von dieser Diagnose her leuchtet ein, warum der Dichter den gesamten Gedichttext hindurch einen immensen Aufwand an intertextuellen Verweisen betreibt – der Sprecher selbst sieht sich ironisch gar „schikaniert / vom Reichspielungsantum der Sprache“.85 Nun ist es nachgerade ein Spezifikum Falknerscher Dichtung, dass Traditionsnahmen offen und konzentriert ausgestellt werden. Hier aber werden sie essentieller Humus.86 Es sind selbstredend die ganz Großen der Poesiegeschichte, die direkt oder indirekt als Stimme aufgenommen werden: Allen Ginsbergs Howl, Ezra Pounds Cantos, Mandelstam, Yeats, Hölderlin, Schwitters, Joyce, Shakespeare, Nabokov, Levy-Strauss, Goethe, Heine, Kleist, Pynchon, Shelley, Nietzsche, Rilke, Brecht… . Die Zitat- und Anspielungsdichte indiziert einen allerletzten humanen Selbstschutz vor den Anmutungen einer katastrophischen Moderne, die „das Grimm’sche Wörterbuch als Futter / für die neokannibalistische Festplatte“87einspeist:
denn große Poesie
auch wo sie glücklich verwirrt
ist Marken und Moden abhold
in diesem Jahrhundert der Gewalt
und der Langeweile
in dem wir versucht haben
Jim Morrison nicht mit
Rainer Maria Rilke zu verwechseln88
Aber Falkner ist nicht Kunert, dem noch jedes Bild zur Parabel bevorstehenden Untergangs gefriert. Er ist – erinnert sei an seinen Prosaband Berlin – Eisenherzbriefe – auch stets ein Flaneur in der Nachfolge Baudelaires. Und so ist Gegensprechstadt – ground zero auch eine Liebeserklärung an das Ost-West-Berlin der achtziger und neunziger Jahre, dem unwiederholbaren melting-pot von Chaosnormalität, Kreativitätsexplosion, Utopiereservoir und Geschichtsheillosigkeit:
Berlin, du bist die Stadt
die savoir-vice
die savoir-vibrer
und Anna Blume hat
du bist von hinten wie von gestern
bist von vorne aber wie von morgen
bist die Herrlichste von allen (…)89
Dass Berlin diejenige der Weltstädte ist, die immer im Werden und nie im Sein ist, hat sich herumgesprochen, insofern war sie ideal geeignet, „der Zeit die Freiheit zu lassen, / einmal den Ort zu spielen“.90 „Berlin beginnt immer mit den Worten: heute, Jetzt / und Hier bin ich“,91 stellt das sprechende Ich fest, dem Berlin ergo „114% Gegenwart“92 wurde, allerdings erst nach dem Mauerfall, der die Zeitbeschleuniger anlaufen ließ:
zwanzig Jahre
hockte ich an den Lagerfeuern von Berlin
feuerte Drinks ab
und weinte ein Loch in den Boden
ich weinte um Gegenwart93
Unablässig streift das Ich durch die Jetzt-Berlins mit Rigaer Straße, Dunckerstraße und Schönhauser Allee, mit dem „Tresor“ und „Kit-Kat-Klub“, Hansaviertel, Humboldthain 10, Yorckbrücken und Kreuzberg, ganz 114%, allgegenwärtig. Im Poem allerdings sind die „114%“ umgeben von Vergangenheitsverweisen:
vor der Wende
Berlin war noch nicht aufgerundet
auf seine 114% Gegenwart
(bei unverändertem Anteil an Geschichte)94
Und so wird das Mauer-Berlin der achtziger Jahre erinnert („bis 89 war Berlin geteilt / in spra und che / überklebte Fotos / Schmauchspur der Geschichte“),95 die anarchisch-hippe Zeit zwischen Mauerfall und Mitte der neunziger Jahre („alles in allem aber: / was für ein Aufruhr“).96 In die Gegenwartsversessenheit schießt der Text immer wieder Erinnerungssignalements, die den Zusammenhang zwischen medialer Geschichtsvergessenheit und ausgegrenzten bzw. dämonisierten Diskursen vor Augen führen, hier die des Terrorismus:
Ich höre in Kreuzberg
die Stimmen von Stammheim
in Pankow
die Stimmen von Entebbe
in Moabit
die Stimmen von Mogadischu
in Mitte die Stimmen der Roten Armee
in Dahlem
am Schalter der American Embassy
höre ich
die Stimmen von ground zero
(…)97
Zugleich werden einfache Zusammenhangsbildungen auch wieder durchbrochen – „die Stimmen der Roten Armee“ meinen eben nicht nur die der RAF, sondern auch jene der Roten Armee, die in Berlin-Mitte 1945 dem „Dritten Reich“ den Todesstoß versetzte. Falkners Poem verteidigt die Rest-Souveränität eines reflektierenden, fühlenden Ich gegen den turbokapitalistischen Zurüstungssog im Realen und gegen die postmodernen Entleerungen von Werte-Gewichtungen im Philosophischen, oder wie es das Gedicht blitzhaft zu erhellen vermag:
ich singe das Selbst ist nicht das Gleiche
wie: das singe ich selbst.98
In dieser Berufung auf Walt Whitman, dessen nobler Impetus schon zuvor Grund zur Trauer gab – „ich wartete / vor den Ufern der Stadt / bis sie Walt Whitman den letzten Grashalm / gezogen hatten“, kristallisiert sich die Intention des Poems in nuce: Indem sich die Sprache in ihrer „schroffen Existenz“99offenbart, ermutigt sie Gegenwehr gegen die kapitalistischen Todesmaschinen, deren steuernde Matrizen unablässig unternehmen, Wahrnehmen, Denken und Sinne des Einzelnen zu bestimmen.
Gerhard Falkners Poem tastet sich wie kaum ein anderes deutschsprachiges Gedicht der unmittelbaren Gegenwart an den Puls der Zeit, es besichtigt ein Jahrhundert und fragt nach der Verfasstheit des Menschen in ihm. Impulse aus dieser Arbeit hat der Dichter mit hinübergenommen in das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts: In das 2011 veröffentlichten Gedicht (kein Langgedicht)„Der letzte Tag der Republik“, das den Abriss des Palastes der Republik 2008 thematisiert, sind sie ganz sicher eingegangen: So, wenn die Zeit zum Subjekt erhoben wird, so, wenn der fortschreitende Verfall von Geschichtsbewusstsein konstatiert wird:
Es wird bleiben ein Loch in der Luft, so groß wie ein Schloss.
Mit oben lauter antike Figuren.
Und unten lauter Figuren mit keine Ahnung von Antike.
Das Schloss wird sich schließen um den versunkenen Bau
und die Zeit wird im Schloss den Schlüssel umdrehen
bis der Schlüssel (mit der Zeit) das Schloss umdreht.
Und immer so weiter.
(…)100
Das Gedicht endet mit einer sarkastisch-düsteren Prophezeiung, die freilich wieder einmal den Stand der Dinge auf den Punkt bringt – mit Falknerscher Eleganz:
Erst wenn die Wolken ins Gras beißen,
wird dieses Stück Geschichte gegessen sein.101
Peter Geist
Laudatio auf Gerhard Falkner
– Rede zur Verleihung des Kranichsteiner Literaturpreises an Gerhard Falkner am 15. November 2008 in Darmstadt. –
Nichts als ein Gerücht. Drei Gedichtbände von 1981–1989 – nirgends fand ich auch nur einen. Stattdessen stieß ich 1995 in Berlin auf ein harmlos aussehendes, grotesk rosafarbenes Büchlein: Über den Unwert des Gedichts. Rasant ging es los, fort in den Untergrund: unter Tage, zum Sittich. Der sitzt in einem kleinen Käfig am Helm des Bergmanns, gleich neben dessen Lampe. Kippt das Wetter, geht als erstem dem Vogel die Luft aus. Kippt der Sittich, rette sich wer kann. Ich musste lachen, und es blieb das Lachen mir stecken im Hals: einen so lustigen Dichter wie diesen Sittich hatte ich selten gesehen. Neben der Lampe der Papageien-Vogel, getragen am Kopf – unter Schutt und Stein. Rette sich, wer kann.
Hier sprach jemand erfinderisch, selbstironisch, übertreibend-exakt über die Grenzen zwischen Sprechen, Nachreden und Nichts. Die Grenzen zwischen Gedicht und – nun, eben keineswegs dem unsäglichen „Unsagbaren“, sondern unseren Diskurskonstellationen und Beschleunigungen im Medien-, Moden- und Markenrascheln, im Geldlaufen, Werben, Ver-Brennen und Kalauern des Jetzt. Hier sprach jemand mit Leidenschaft. Gerhard Falkner schreibt über das Dichten, weil ohne dieses Nachdenken vom „Normalrand“ her – in Prosa, mit Feuer und Witz – ohne dieses Sprechen über die Bedingungen, unter denen der Dichter lebt in den Augen der anderen, der Öffentlichkeit, des Raums, den jedes Gedicht braucht, um Gedicht zu sein, weil ohne Sprechen über das unsichtbare Exil und Exiliertwerden der „Dichter“, schlimmer noch Lyriker, das täglich stattfindet, sich ausbreitet, absichtlich schlecht versteckt hinter Lippenbekenntnissen zur „kulturellen Wichtigkeit“ der poetischen Sprachkletterei im Doch-Affenzoo, die Achtung vortäuschen und Missachtung nie verbergen – Frage: „kann man davon leben?“ – Antwort: „Wie Sie sehen bin ich tot“ – weil es angesichts dieses sich zunehmend verengenden und zugleich verdriftenden (aus der Sprache als Wissen und Können herausschwimmenden) Normalraums, unabdingbar ist zu zeigen, dass die Person, die dichtet, dies eben nicht tut, weil sie zu dumm ist für anderes, sondern weil sie ihre 500 PS Intelligenz, ihre spezifische, etwa Falknersche Wachheit, ihre scharfe Beobachtergabe, ihre lange erprobte Intuition und Bewegungssicherheit in Räumen, von denen andere nicht einmal zu träumen wagen, ihre Unbestechlichkeit von Konsum und „Werten“ dieser Art, nutzt, um uns in den Spuren unserer Sprache nachzugehen. Gerade auch „nach unten“. Damit wir überhaupt noch merken, wenn uns die Luft ausgeht.
ACH; DER TISCH
(Zur PoeSie des PoeDu)
Und er wird mich sagen hören: ach der Tisch!
ach der… wird mich sagen hören: ach der Tisch!
und er wird mich fragen werden: wo! Zu!
und er wird mich sagen hören, ach der
sagen hören… ach der… ach der Tisch!
der Tisch… mit dem Brot!
Und er wird mich haben wollen, haben wollen
wie ich sage, ach die… ach der Tisch
Dieses Gedicht ist wunderbar, es ist viel länger, am liebsten trüge ich es zur Gänze vor. Als ich es zum ersten Mal las, riss ich die Augen auf. Da dachte jemand mithilfe eines Gedichts. Da kannte jemand die „Theorien“ der Gegenstände, des Ich und des Du, und hatte sie abgestreift, ohne sie wegzuwerfen. Der „Tisch“, das vielfach malträtierte Standardbeispiel aus dem philosophischen Seminar: da stand er. Und wie! Konkret und intelligent: mit Brot, Sehnsucht, dreifachem x. Ich spitzte die Ohren. Wie machte dieser Falkner das? Der erwischte mich nicht kalt, sondern heiß. In den Schleifen seiner mit Wiederholung und Variation spielenden Sätze, seiner Musiksätze, die die Syntax öffneten und sich in neuen Mischungen verklebten, gingen mir die Gedanken im Schädel rund, mit Gefühlen fürs Brotessen und Tischdasein, fürs unterm Tisch sein, fürs Ach und ach, das Ich.
Denken im Dichten setzt voraus, dass der Dichter sich gleichermaßen in Gedanken wie Wahrnehmung, in Sprachsinn wie Sprachlautung, bewegt. Quer durch die Zeiten. Auch deswegen sind Falkners Gedichte immer Echoräume von Formen und Tonlagen. Auch deswegen Übersetzt Gerhard Falkner aus anderen Sprachen: er hört zu. Horcht auf. Lernt die Hand der Sprache nachforschend, neu zu bewegen. Nomade musst du bleiben. Falkner weiß das wohl.
Er ist ein Dichter des Satzes. Gewiss arbeitet er mit Bildern, Rhythmus, Wiederholung und Staffelung. Vor allem aber arbeitet er mit der Fläche. Zahlreiche seiner Gedichte sind Teil von Zyklen. Seine Gedichtbände sind Projekte. Langgedichte wie Gegensprechstadt – ground zero bauen sich flächig auf. Sie verfahren, ich übernehme ein Wort von Gerhard Falkner, polymer: chemisch bedeutet das „aus vielen gleichen Teilen“ verzweigt gebaut. So ergibt sich, im doppelten Sinn, erst der Geschmack eines Stoffs.
Gerade im Satz, der Bilder zusammenfügt, und als Form, die selbst wiederum Verkettung verlangt, Bilder in Bewegung setzt, gewinnt Denken Form. Der Satz ist jenes Netz, das ausgeworfen sein muss nicht um den Gedanken „einzufangen“ – als gebe es ihn außerhalb des Rhythmus- und Sprachepolymers bereits – sondern um den löchrigen Raum zu markieren, in dem er Platz finden kann. Auf dass der Gedanke, gedacht in der Satzvariation, im Drehen des „Gegenstandes“, im Immer-neu-Atem holen, sich nicht setze, sondern entwickle in uns, den Lesern. An der Hand, am Tisch, beim Wort genommenes Denken, mit Brot für Körper und Geist. Um aufzuwachen, im Gedicht: unterm Tisch zu sitzen im Schatten – beschützt und bedroht. Mit fühlenden Gedanken, in der Sicherheit der Wiederholung, liebkost von ihr, doch mit den Forderungen eines anderen im Ohr, voller Sehnsucht nach allem, nach immer mehr. Als Spielball der eigenen Verweigerung, in der Spannung von x, der bösen Zärtlichkeit des Lebens bei Gerhard Falkner, die man manchmal fast überlesen könnte, so zärtlich schön – mit Augenzwinkern – richtet sie sich – nach uns.
und er wird mich fragen werden, ach der..?
wird mich fragen wollen: ach der… der Ti?
mit dem Brot oben, dem Gedicht in seinem dunklen
gebundenen Laib, das sich herleiert und mit dem
alles gesagt ist, mehr als alles, ich will von dem Brot
oben
mehr als alles, ich will, abends, wenn die Drossel
verstummt, mehr als alles gehabt haben, es soll
so tränenlos geweint worden sein wie in einer Zeile
von Trakl, es soll mich, soll, soll, soll mich, fertig
fertig gemacht haben, fertig, fertig, es soll mich sagen
gehört haben: NICHT DU! Ich kann das Brot anklicken
und habe deine Brust: (eine Brust für Götter)
ich kann deine Brust anklicken
und habe dein Herz… ( ein Herz für Götter)
aber nicht du! Nur das Brot
ich will nicht mehr gekonnt haben können, will
nach dem Brot, in das ich soviel Gewicht gelegt habe
nicht mehr gekonnt haben können
aber ich ach ich bin bin doch nicht
doch nicht zu haben!
Er hat seine Hände an mir haben wollen aber
ich bin, binbin nicht zu haben
nicht für Brot… und nicht… unter dem Tisch!
(Endogene Gedichte, S. 107f.)
Wer hier Echos hört, hört richtig. Falkner arbeitet mit Wirklichkeitsbrüchen, Versatzstücken, Neuwörtern, Fachsprachen, technischen Entwicklungen, er klopft, hämmert, mutiert. Den Satz liebt er doppelt. Baut Stufen damit, führt uns in einen Raum. Und dann: der Sprung. Im Deutschen ist der Satz beides: Kontinuität und – Überraschung. Weite. Zu Falkner gehört eben dieses Paradox: Weiterführung und Bruch, in einem.
Auf der Höhe der Zeit sein?
Welch Ausdruck. Muss man nicht unter ihr liegen? Als schwerer Körper, offenen Nervs. Versteckt, kein Gegenstand mehr. Auflösend. Begeistert.
Da wird der Leser im Satz vom Satz überrascht. Weil Falkner um Grenzen spielt: wie er uns etwas in Lücken durch Lücken hindurch erzählt, aus Null oder unter Null, als Gegensprechen, also Teil eines mechanisch bedroht-ermöglichten Dialogs, als Verschieben der Sprache im Worterfinden und Verhören, absichtsvoll.
Jeder Autor entwickelt seine Mittel und Besonderheiten: sie sind nicht frei gewählt, sondern Schmerzpunkte. Brennstellen. Bündelungen. Sie rutschen mit uns unter den Tisch, bringen unsere Ängste, unser Dennoch, unsere Sehnsucht nach „Mehr“ auf den Punkt. Bei Falkner gehört Körperbewegung zu diesen Mitteln, gleitend, halb willkürlich, nach unten. Und es gehört dazu das über sich selbst lachende Ich.
Jossif Brodskij meinte, jeder Dichter verfüge über hundert Grundwörter. Woher er das so genau wusste, 100, ist mir ein Rätsel. Aber ich bin sicher: ein Grundwort Falkners lautet „unten“. Im Dunkeln sein. Bei den Geräuschen. Beim Körper. Am Körper beginnen die Tage? Brechungen, Schatten, langsames Licht. Von unten nach oben, zum Brot, zum Gedicht, zur „Liebe“, doch erneut – unterm – Tisch. Abstürzen – und waghalsig, unwahrscheinlich – wieder hinauf. So auch bei Bruno, dem Bären. Der hieß wirklich so: als hätte man ihn gleich in den Falknerschen Wortkosmos hineinerfunden mit seinem „u“ und „n“. Und jenem uno: der eine.
Unten.
Allein sein also? Ja. Und die Verbindung ersehnen. Das „und“, von dem Falkner sagt:
Die Konjunktion ,und‘, mhd. zum Beispiel unde, ahd. unte, ist ein Knotenpunkt der gesamten Syntax und quasi ein Wort ohne Synonym. In ,Äpfel und Birnen‘ kann kein anderes Wort die beiden Früchte zusammenzählen, in ,eins und eins‘ ebenfalls nicht. Das ,und‘ ist Exponent fast aller Nebensätze und gilt als mit geheimnisvollen Kräften ausgestattet, ,die Andacht zum Unbedeutenden zu wecken‘. (Gegensprechstadt, S. 92f.)
Unten: Andacht zum Unbedeutenden. Zum kleinen Wort.
Falkner ist einer, der sich nicht scheut. Einer, der keine Angst hat? Welch Fehlschluss. Es ist ja eben dieses Nicht-Scheuen Teil der innersten Textarbeit.
Natürlich ist Falkner Romantiker. Einer, der Novalis und Hegel zitiert, in Hölderlin eintaucht. Aber mit Nietzsche. Einer der korrigiert, Schlachten schlägt. Pechschwarz, gleißend hell. Romantische Kon-stellationen kehren in Falkners Texten immer wieder – zum schönen Schein. Er lebt auf dem Land, er kennt sich mit Tieren aus. Er lebt in der Stadt. Verteilt gehärteten Stoff: polymer. Nicht Romantik in der xten postpostmodernen Saloppform, sondern immer Textur, ernst, allemal, wenn der Erzähler lächelt.
Das Ich, das in der Novelle Bruno spricht, ist selbst ein Polymer. Aus vielen, einander ähnlichen Teilen gebaut. Ähnlich zur Biographie seines Autors. Ähnlich zum Foto in der Lokalzeitung. Ähnlich zu Fragen der Ähnlichkeit. Bissig heiter beginnt die Erzählung, Satz um Satz, im Außen:
Dass ich hier bin, habe ich in der Zeitung gelesen.
In der Zeitung steht, ich sei in Leuk eingetroffen.
Leuk ist ein Ort im Wallis.
Das Wallis ist ein Kanton der Schweiz.
Die Schweiz ist ein kleines Land aus Granit im Herzen Europas.
Da der Notiz in der Zeitung ein Bild beigestellt ist, weiß ich
wenigstens, wie ich aussehe.
(Bruno, S. 7)
Bruno ist großartig – und großartig präzise. Wie Trittsteine legt der Satzdichter Falkner hier seine Sätze aus. Ehe man sich versieht, steht man mitten in einem Land, das angeblich „Schweiz“ heißt, ein Ich ist, und mindestens einen Bären enthält.
Es folgen: Sprünge ins Unbekannte. Weite Sätze. Die Novelle führt von außen nach innen, die Berge hinauf. Nicht von ungefähr fällt gleich zu Beginn das Wort „Granit“. Ein grobkristallines, magmatisches, also feuriges Tiefengestein, reich an Quarzen und Feldspat, aber auch dunklen Mineralen, etwa Glimmer. Ein echter Falkner also.
Über das endogene Reimgebilde Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess’ ich nimmer stürzt der Leuker Dichter. Vielleicht können wir ihn selbst Bruno nennen. Er fällt – über eine Felskante, ein Bärenbild, sich selbst. Da hängt er überm Abgrund, am eigenen Arm.
Der Mann kann sich retten – sich wie Münchhausen aus dem Sumpf an nichts als sich selbst über den Abbruch ziehen. Der Schrecken sitzt dem Leser in den Knochen. Das ist klug erzählt: nicht der Bär ist bedrohlich. Gefährlich wird es nicht dort, wo man es erwartet – sondern wenn man trällernd dahingeht. Auf den eigenen Wegen wandelt. Und doch ist es gut, im Leben das Erschrecken nicht zu vergessen: vor Sätzen, Dingen. Vor dem, was gilt.
Zum zweiten: Als Bruno endlich auf Bär Bruno stößt, dreht das Tier ihm den Rücken zu, dreht sich um – ist ein Rind. Erzählerisch ist das geschickt, seelisch klug: der Schrecken macht den Ernst fühlbar, der den Erzähler antreibt. Sein Ernst seinerseits ist Voraussetzung dafür, lachen zu können, ohne hämisch zu sein.
Wunderbar: wie man mit Falkner hier zur Heiterkeit kommt aus dem Ernst. Zum Ernst aus dem Schrecken. Und da unvermittelt beschenkt auch als Leser beides kann: über sich selbst lachen und doch der eigenen Passion folgen.
Das Bruno-Ich gibt nach Brunos Tod nicht auf. Es legt Feuerkerne in den gebirgigen, nachhangenden Wald. Eine sorgende Figur verhindert, dass das Holz wirklich brennt; schützend ist sie dem Nachgänger des Bären nachgegangen. Diese Figur rührt an: weil es manchmal gut ist, wenn der eigene Plan misslingt. Wenn man bebt – aber einmal auch gehalten wird.
Und so sind sie nun versammelt, drei Kategorien aus dem Unwert des Gedichts, die mir das Herz schneller schlagen ließen: Herzensgüte, Noblesse, Unterscheidungsfähigkeit. (Über den Unwert des Gedichts, S. 61). Um sie uns zu zeigen, muss Falkner sie verstecken: die Masken, unter denen wir überhaupt bereit sind, sie zu sehen, sind oft genug extravagant. Was leicht daherkommt, beruht so auf genauester Arbeit. Genauigkeit ist, wenn man so möchte, ihrerseits ein Stück Romantik. Sie bedeutet Extremität.
Von der „ersatzlosen helle innerster sprache“ spricht Falkner in seinem Gedicht „Tübinger Stift“ (Endogene Gedichte, S. 17). Diese Helle wird von ihm durchs Dunkel getragen, Satz um Satz. Untertage, zum Schatzabbau, in Höhlen, die man sich selbst gegraben hat, in Nähe der Erdluft, der Linien, großen Kräfte. Dorthin hat Falkner den Vogel geholt. Dass er atmet, wie wir, dass er singt, wie er Atem hat. Dass er uns begleitet.
„Begleitung“: wie etwas vorausfliegt und wiederkehrt, innehält und sich einkrallt. Wie Schmerz und Freiheit zusammengehören: das bunte Gefieder. Wie empfindlich sie ist, die bloße Hand. Wie man mit einem Wesen spricht, das nicht spricht.
Bärenohren ragen, die Muscheln nach vorn gerichtet, aus dem pelzigen Kopf. Man sieht an dieser Ohrstellung, dass Bären wahrlich keine Fluchttiere sind. Anders als wir: unsere Ohren sitzen seitlich. Angreifer sind wir, und Flüchter, angewiesen darauf, rundum zu hören.
So hört, möchte man mit Falkners Gedichten in der Hand rufen. Ihr müsst ja nicht wissen, wie er das macht. Hört einfach, was alles er findet und erfindet. Dass er den Satz, die Raffinesse des doppelten Satz-um-Satz braucht, damit der Text zu schwingen beginnt. Damit er sich und wir uns mit ihm einmal mehr um den Gedanken dreht, mal zornig, mal augenzwinkernd, immer mit Bildkraft und ja, Schönheit und Harmonie. Sie ist das Ziel der Härte der Form. Allerdings in einer spezifischen Konstellation: nach „nach der Natur“. Nach nach dem Zynismus, dem Pathos, den Pathostabus. In einer Welt, die Sprechformen für Gefühle dringend braucht. Falkner tastet sie aus.
Formt man die Ohren eines Menschen in Gips ab und setzt die getrockneten Schalen einem anderen so auf, dass aller Schall für ihn nun durch die Fremdohren gebrochen wird, hört der Proband nichts. Sein Gehirn ist so verwirrt, dass es die Signale nicht verarbeiten kann.
So die schwerfällige Physiologie.
Da lächelt die Dichtung. Mit ihr streifen wir uns die Ohren eines anderen über. Seine Augen öffnen sich in uns nach innen und außen. Zieh dir die fremd-vertraute Welt des Falknerschen Gedichts über den Kopf, herrlich geht sie auf.
Lieber Gerhard, herzlichen Glückwunsch zum Kranichsteiner Literaturpreis. Ich freue mich sehr für Dich – und für uns. Denn ich möchte mehr: Satz um Satz, Sprung um Sprung. Die folgende Pronomenkette verbeugt sich vorm Poesie-du-ich-ach: mit ihr wünsche ich uns-dir-mir dich in der Mehrzahl. Wie beginnen die Worte am Körper? Wie gehen sie um mit ihm?
Weg gibt es keinen. Beim Wiederlesen im Unwert fand ich den Sittich nicht mehr. Ich weiß dennoch, dass er da ist. Als Antwort, als Gegenwort, Echo und Wirkung. Dass Deine Texte in dieser Weise über sich hinauszugreifen vermögen, liebe ich sehr. Sie schlagen Funken. So grüß mir den Sittich. Den durchtrieben durchschriebenen Tag.
Ulrike Draesner, Park, Heft 63, Juni 2009
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram +
Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001.


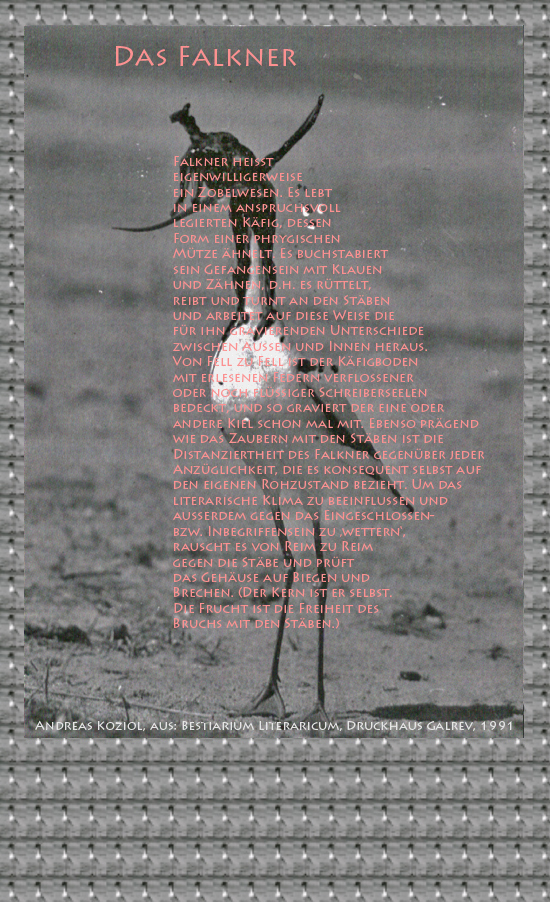












Schreibe einen Kommentar