Gerhard Falkner & Orsolya Kalász (Hrsg.): Budapester Szenen
BERYX DECADACTYLOS
Ach wäre doch alles nur Kauderwelsch,
fremd, wie die Wasserpalme im Wörterbuch,
fern, wie auf der Landkarte das Feuerland,
wäre es in mir und nur erfunden, gäb es doch
jungfräuliches Land über die Sprache hinaus −
in ihrem Süßwasser ruhte zehnfingrig ein Fisch,
blätterte ich im Zufall und fände sie dort,
diese Sprache, jungfräulich und völlig verrückt,
wir würden bauchreden, wie Karstwasser im Berg,
dolina, uvala, polje – sprächst du,
nicht wie zu jemand, der wirklich existiert
gleich einem Wörterbuch, vom Zufall aufgeblättert,
meine Antwort hieße: Flammenufer, Feuersteinjahr,
und würdest denken Felsenfalten, Lavasteine,
es gäbe keine Geschichten ich sehnte mich nicht
nach wirklicher Landschaft, Gesicht oder Haut,
erdachte Zeit, getrost könnten wir baden
zehnfingrige Fische, dort im Teich des Unbekannten.
körperloser Name, gestreichelt treiben
− natürlich nicht von mir, sondern einfach nur so.
Krisztina Tóth
Deutsch von Oliver Mertins
In Budapest zu leben ist schon das halbe Gedicht
Wie in jedem durch die Wende erschütterten Land leben auch in Budapest zwei Seelen in einer Brust: Die der bösen Vergangenheit mit ihren guten Seiten und der der guten Gegenwart mit ihren bösen Seiten. Die eine liefert den Stoff der Tradition, eine mit Weltschmerz gesättigte Geste aus dem Geiste großbürgerlicher Vergangenheit, die andere durchtränkt diesen Stoff mit den Insignien der Konsumwelt und ihren sozialen Verzerrungen. Auf höchst ungarische Weise werden die Werte der ungarischen Poesie mit Themen verschmolzen, die in ihr eigentlich keinen Platz haben. Das Neue, das Zeitgemäße, das, was hip ist oder high macht, wird von der Sprache des kleinen Landes verschlungen, daß die nationale Selbstbehauptung zuletzt immer gewahrt bleibt. Am Ende hat es dann doch wieder mehr zu tun mit Attila József als mit dem gestreckten Stoff oder der Acid-Party.
In unzähligen Fragmentierungen und Brechungen spiegelt sich diese Dichotomie – eine auf große Prospekte angelegte Architektur mit Neigung zum Prunkvollen und der unerbittliche Zugriff von McDonalds, der Deutschen Bahn und Trash-Läden – im Gedicht wider. Manchmal klingt das, als versuche diese Sprache, das, was morgen sein wird, nachzuholen.
Tief im Herzen aber ist die ungarische Lyrik mit einem Hang zur Selbstgenügsamkeit und Autarkie ausgestattet, lediglich der Druck durch außerkulturelle Kräfte beugt die „echte“ ungarische Poesie den internationalen Einflüssen. Zwar liebt man Baudelaire oder Hölderlin, aber Namen dieser Größenordnung haben kraft Erwähnung bereits ein solches Kaliber, daß sich der regelrechte Einfluß, der durch das Werk entstehen könnte, begrenzen läßt. Die Gedichte behaupten sich eben gerade in der Spannung zwischen Prätendiertem und diesem: Hoppla, jetzt wird es doch etwas ganz anderes.
Man fühlt sich bei der literarischen Szene der Donaumetropole an die inzwischen zerrüttete Situation des Prenzlauer Bergs erinnert. Was alle verbindet, ist stärker als das, was die einzelnen voneinander trennt. Der Underground ist die gemeinsame Schmusedecke, der Alkohol gehört zum Anstand. Hier begegnet man noch dem Dichter mit den rollenden Augen der dem stechenden Blick. Man triffst sich in Cáfes oder in Salons, man redet über Massive Attack oder Grunge so, als versuche man, das einem Gehörlosen zu vermitteln. Die Gesten sind düster, ungestüm, oder vom Weltschmerz gesättigt, aber man ist Dichter, und es ist großartig, darunter zu leiden.
Gerhard Falkner und Orsolya Kalász, Vorwort
Editorische Notiz
Die Lyrikanthologie Budapester Szenen wurde in weitgehender Abstimmung mit den jüngeren und jüngsten literarischen Gruppierungen Budapests entwickelt. Orsolya Kalász hat zusammen mit Janos Térey, István Kemény und anderen auf der Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme eine Auswahl getroffen, die, wenn auch nicht absolut vollständig, so doch mit Sicherheit repräsentativ ist.
Sonett, Moritat und sentimentale Suada gehören zusammen mit dem Reim und der gebundenen Zeile noch immer zur poetischen Grundausstattung, und es ist ganz selbstverständlich, daß der Zeitgeist am leichtesten im „ungezwungenen“ lyrischen Parlando Fuß faßt.
Die Dichter Buxhoeveden, Döring, Koziol und Mertins haben auf der Grundlage der Übersetzungen von Orsolya Kalász an deutschen Fassungen gearbeitet, die unterschiedlichen Anliegen folgen.
Zuerst ist da die Übersetzung, das Dienen nach bestem Wissen und Können, notorisch zerrissen zwischen Klang und Inhalt, zwischen Musik und Text. Dann gibt es die Übertragung, die die Aussage gelegentlich verläßt, wo der Klang es fordert. Ihr folgt die Nachdichtung, die analog arbeitet und unter Aufopferung von Sinnstellen auf den kongenialen Eindruck hinarbeitet, und zuletzt die adaptive Nachdichtung, die das fremde Gedicht ganz im eigenen Sprachwillen des Übersetzerdichters widerspiegelt.
Für jedes dieser Konzepte finden sich Beispiele in diesem Band.
Gerhard Falkner, Sommer 1999
Wie in jedem durch die Wende erschütterten Land
leben auch in Budapest zwei Seelen in einer Brust: Die der bösen Vergangenheit mit ihren guten Seiten und der der guten Gegenwart mit ihren bösen Seiten. Die eine liefert den Stoff der Tradition, die andere durchtränkt ihn mit den Farben der Konsumwelt. Auf höchst ungarische Weise werden die Werte der ungarischen Poesie mit Themen verschmolzen, die in ihr eigentlich keinen Platz haben. Das Neue, das Zeitgemässe, das hip ist oder high macht, wird von der Sprache des kleinen Landes verschlungen. Am Ende hat es dann doch mehr zu tun mit Attila József als der der Acid-Party.
DuMont Buchverlag, Klappentext, 1999
Rezensionsnotizen gesammelt von perlentaucher.de
Was gibt es Neues im Land der Dichter?
Fragt man mich, was die ungarische Literatur Bedeutendes hervorgebracht habe, antworte ich: Poesie. Poesie, soweit das Auge reicht. Sie wollen Namen wissen? Nun denn. Beginnen wir mit dem Revolutionsdichter Sándor Petőfi (1823–1849), der während seines kurzen Lebens, in meisterhafter Abbreviatur, zum Sänger der Tiefebene wie der Patria wurde, zum Idylliker wie zum Freiheitshelden; kommen wir sodann zu Mihály Vörösmarty, János Arany und dem großen Endre Ady (1877–1919), dessen Verse von fataler Liebe und tragischer Einsamkeit so betörend musikalisch klingen, daß keine Übersetzung ihnen auch nur annähernd beizukommen vermag. Adys Sprachmagie hat nur Parallelen bei den französischen Symbolisten; der melancholische Grundton allerdings verweist sie nach Pannonien.
Andere Schwermut spricht aus den Gedichten Attila Józsefs: der Sohn einer Waschfrau hofft lebenslänglich auf den proletarischen Befreiungsschlag, bis er – politisch und persönlich entmutigt – 1937 den Freitod wählt. („Dichter: deine Feder raucht, kein / Streichholz wert, und tot / Ist dein Mond; ein Strick dein Nabel und dein / Stammeln eine Stadt, die loht.“) Während József seine Verzweiflung in herbe, polemisch-expressive Worte faßt, spielt Mihály Babits – Wortführer des Kreises um die Zeitschrift Nyugat (Westen) – auf den Registern von Weltläufigkeit und immenser Belesenheit, variiert (biblische, antike) Themen, erprobt ein reiches Formenrepertoire.
Dann Dezső Kosztolányi, Gyula Juhász, Gyula Illyés und Miklós Radnoti. Von Radnóti gibt es Eklogen und Elegien, „heidnische Grüße“ und beklemmende Notate zum Spanischen Bürgerkrieg, vor allem aber jene späten „Ansichtskarten“, die der konvertierte Jude 1944 auf dem Gewaltmarsch vom Lager Heidenau (südlich von Belgrad) Richtung Deutschland schreibt:
Am Maul der Ochsen trieft im Speichel Blut,
die Menschen haben alle Blut im Wasser,
die Mannschaft stinkt,
ein Knäuel ohne Sinn.
Wüst über uns wehn die Todeswinde hin.
Am 8. November desselben Jahres wird Radnóti durch Genickschuß getötet und ins selbstgeschaufelte Massengrab geworfen, 35 Jahre alt.
Wie weiter? Zum Beispiel mit János Pilinszky (1921–1981), bei dem sich philosophische Reflexion, katholisch grundiert, zu feinsinnigen lyrischen Gebilden verdichtet. Oder mit Sándor Weöres (1913–1989), dessen schillernde Universalität sich post-traklsch, dadaistisch, surrealistisch und lautpoetisch gebärdet. Womit wir – nach zugegeben allzu forschern Gang durch die ungarischen Poesie-Reviere der letzten 150 Jahre – bei der Gegenwart angelangt wären, die ihrerseits mit vielen lyrischen Talenten aufwartet.
Was die Lyrik in Ungarn so attraktiv machte – und noch macht –, darüber kann nur gemutmaßt werden. (Polen erscheint als ähnlich gelagerter Fall.) Das Gedicht bedeutet höchste Konzentration, es erlaubt persönlichen Ausdruck und (subtile) politische Intervention, es ist „Schaltung, Reportage, Klang“ (Thomas Kling). Zwischen Konfession und Subversion behauptet es sich als Medium der Zwischentöne, macht die Ambivalenz fruchtbar. Und verwandelt existentielle Erfahrung in ästhetischen Mehrwert. Ob es sich mehr als Mission oder als Spiel versteht, hängt vom einzelnen Dichter ab, wobei die Tradition in Ungarn (wie im gesamten Ostmitteleuropa) den Verantwortungscharakter der Poesie betonte und den Dichter entsprechend aufs Piedestal hob.
Und heute? Die Wende von 1989 hat an solchem Image zwar gekratzt, der Lyrik-Produktion jedoch konnte sie nichts anhaben. Ungarn ist immer noch ein Land der Dichter, „auch wenn es wegen der vielbeklagten Sprachbarriere kaum gelingt, der nationalen Lyrik weltliterarische Geltung zu verschaffen“. So Hans-Henning Paetzke, der sich unverdrossen und tatkräftig für die Übertragung zeitgenössischer ungarischer Poesie einsetzt.
(…)
Von den jüngeren Dichterinnen wären Orsolya Kalász, Krisztina Tóth, Anna T. Szabó, Vera Filó und Virag Erdős zu nennen, alle versammelt in der gerade erschienenen Anthologie Budapester Szenen. Junge ungarische Lyrik. Es herrscht erfrischende Stimmenvielfalt. Die 1973 geborene Vera Filó arbeitet auch mit traurigschönen Comics, während Virag Erdős (Jahrgang 1968) die Grenze zwischen Poesie und Prosa gekonnt verwischt beziehungsweise das Genre der Hommage-Persiflage kreiert. So in ihrem Gedicht „Herr Parti groß, Herr Parti klein“, das sichtlich auf den sprachvirtuosen Lajos Parti Nagy gemünzt ist, dessen neologistische Wortgebilde, ja Wortgetüme, nicht nur jeden Übersetzer überfordern, sondern auch manchem Muttersprachler unzumutbar erscheinen.
Da Schreiben allemal Fortschreiben ist, wundert es nicht, daß sich die junge Generation an der Tradition (kritisch oder nicht) abarbeitet. Für die Frauen heißt es durchwegs, sich mit Vätern auseinanderzusetzen. Aber auch den männlichen Kollegen bleibt Auseinandersetzung nicht erspart. Das Gewicht der ungarischen Lyrik (seit Petőfi) ist immens: solcher Reichtum kann, wo es um die Suche nach eigenen, neuen Wegen geht, zur Hypothek werden. Dennoch fällt auf, daß der Dialog dominiert. Widmungsgedichte (an Kollegen, Vorbilder) zeugen ebenso davon wie Anspielungen, Persiflagen usw. Man versteht sich, man rekurriert auf gemeinsames Vokabular, auf gemeinsame Erfahrungen. Das kulturhistorische Gedächtnis funktioniert, und die Bildungstradition ist weitgehend ungebrochen. So kann Gerhard Falkner, Herausgeber der Budapester Szenen, über die junge Lyrik notieren:
Sonett, Moritat und sentimentale Suada gehören mit dem Reim und der gebundenen Zeile noch immer zur poetischen Grundausstattung, und es ist ganz selbstverständlich, daß der Zeitgeist am leichtesten im ,ungezwungenen‘ lyrischen Parlando Fuß faßt.
Keine Frage, der Zeitgeist existiert. Auch in Ungarn tragen Gedichte mittlerweile Titel wie „Our Videoclip“, „Der Club macht dicht“ oder „Coca-Cola und Eisbär“. Auch in der Donaumetropole wird über Informatiker, Movies und Alltagskram gesungen, während politische Themen ziemlich ausgedient haben. Doch die (stolze) Tradition hält sich. Wer dichtet, partizipiert an einem gemeinsamen Fundus. Vielleicht darf man ihn Ungarntum nennen.
Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung, 9./10.10.1999
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram +
Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + Instagram 1 & 2 +


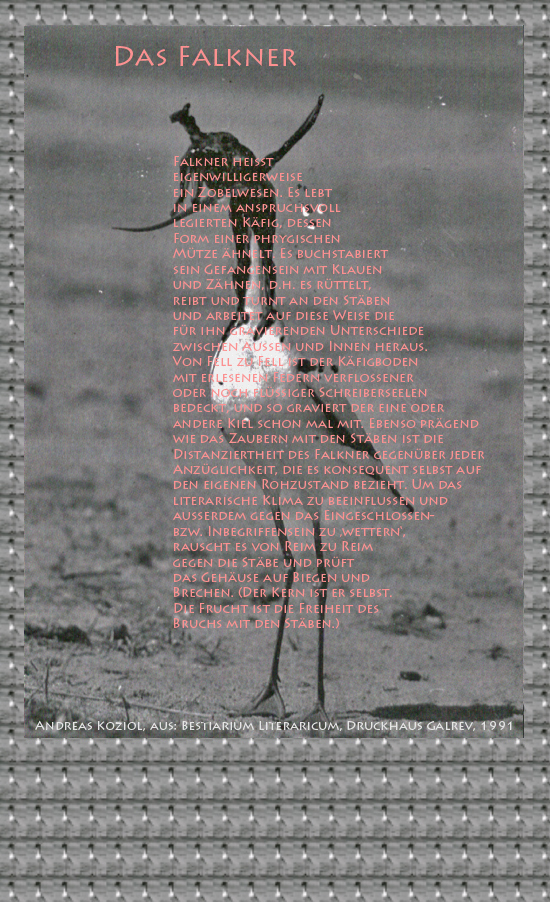












Schreibe einen Kommentar